.
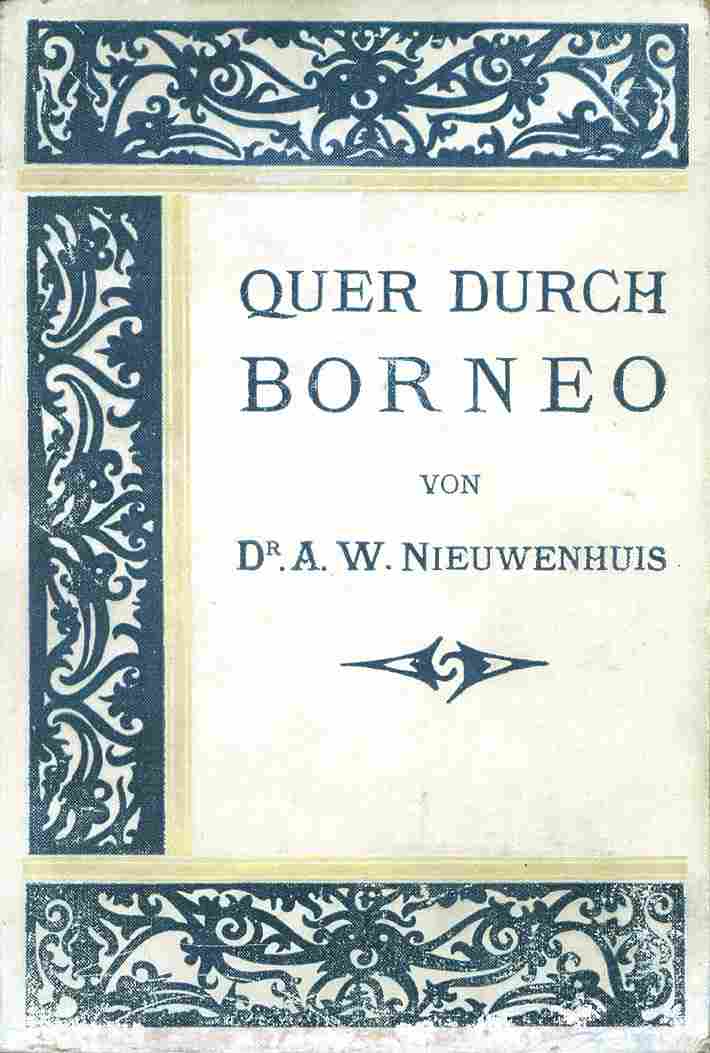
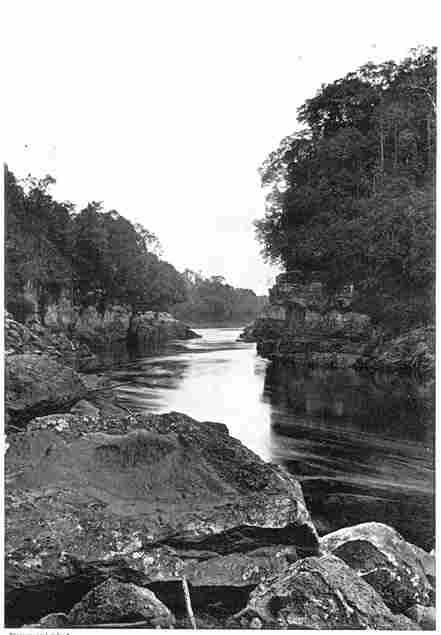
Der Mahakam unterhalb Long Dĕho.
Quer durch Borneo
Ergebnisse Seiner Reisen
in den Jahren 1894, 1800–97 und 1898–1900
Von
Dr. A.W. Nieuwenhuis
Unter Mitarbeit
Von
Dr. M. Nieuwenhuis-von Üxküll-Güldenbandt
Zweiter Teil
Mit 73 Tafeln in Lichtdruck und 18 Tafeln in Farbendruck.
Buchhandlung und Druckerei
Vormals
E.J. Brill
Leiden—1907
Vorwort.
Beim Erscheinen dieses zweiten und letzten Teils meines Reisewerks erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass er nach demselben Plan wie der erste angeordnet ist; umfangreichere Ausführungen über Staatseinrichtung, Häuserbau, Industrie, Kunst u.z.w. erforderten eine Behandlung in gesonderten Kapiteln; ausserdem wurden aber auch diesmal in den Reisebericht, welcher den Zug von Samarinda zu den Kĕnjastämmen in Mittel-Borneo schildert, eine Menge Beobachtungen auf verschiedensten Gebieten eingeflochten.
Vor allem machte es dieser Umstand erforderlich, dass dem Werk als Wegweiser zu den vielen Einzelheiten ein ausführliches Inhaltsregister beigefügt wurde. Diesem Hauptregister folgt ein zweites, welches die im Text vorkommenden inländischen Wörter enthält und somit in bescheidenem Umfang eine Liste in Mittel-Borneo gangbarer Wörter und ihrer Bedeutung darstellt. Diese Wörter gehören zwar verschiedenen Dialekten an, doch habe ich ihren Wert durch sorgfältige Angabe der richtigen Aussprache zu erhöhen getrachtet.
Jetzt, wo die wichtigsten Resultate meiner Forschungsreisen in diesem Werke vor mir liegen, fühle ich mich verpflichtet, allen, die mich auch bei der Herausgabe dieses zweiten Bandes unterstützt haben, meinen lebhaften Dank zu bezeugen.
An erster Stelle meiner Frau, welche mich dazu ermutigte, schon so bald nach dem erst 1900 in holländischer Sprache erschienenen Werk “In Centraal-Borneo” ein zweites, noch umfangreicheres her [VI] auszugeben. Ihrer selbstlosen Mitarbeit habe ich es auch zu danken, dass die Ergebnisse meiner Forschungsarbeit in der vorliegenden Form und in deutscher Sprache veröffentlicht werden konnten. So sind die Resultate meiner langjährigen Reisen durch die Insel, die bisher noch kein Europäer durchquert hatte, auch dem Auslande zugänglich geworden und werden hoffentlich dazu beitragen, bei anderen Völkern richtigere Vorstellungen über die niederländische Verwaltung im indischen Archipel zu erwecken, als dies durch die oberflächlichen Betrachtungen geschieht, welche öfters in der ausländischen Presse die Runde machen.
In herzlichster Dankbarkeit gedenke ich auch diesmal der Hilfe, welche mir Professor Dr. F. Schwend in Stuttgart bei der sprachlichen Korrektur in so hohem Masse hat zu Teil werden lassen.
Leiden,
Dezember 1906.
A.W. Nieuwenhuis.
Inhalt.
Kapitel I. 1–32
Einzug in Samarinda am 9. Juni—Abreise von Barth und einem Teil des Personals nach Java—Vorbereitungen zur Reise nach Apu Kajan—Besuch beim Sultan—Begegnung mit der Siboga-Expedition—Abfahrt von Samarinda mit dem “Lawu” am 17. Juni 4 tägige Dampferfahrt bis Udju Tĕpu und Ana—Mondfinsternis in Ana—Von Ana bis Long Howong—Rückkehr des “Lawu” zur Küste—Von Long Howong mit Böten nach Uma Mĕhak—Über die östlichen Wasserfälle nach Long Dĕho—Aufenthalt in Long Dĕho—Besteigung des Batu Ajo—Von Long Dĕho nach Long Tĕpai—Beunruhigende Gerüchte aus Long Blu-u—Ankunft daselbst im September—Misstrauen seitens der Kajanbevölkerung.
Kapitel II. 33–51
Der mittlere Mahakam und seine Bewohner—Auswanderungen aus dem Stammland—Degeneration der Stämme im Tieflande Verhältnis der Niederlassungen zu einander—Einfluss des Sultans von Kutei auf die Dajakhäuptlinge—Die Niederlassung Long Dĕho und ihr Oberhäuptling Bang Jok—Die Punan als Kopfjäger—Verhältnis zwischen den Kĕnja und Bahau—Der degenerierende Einfluss der Malaien auf die Dajak—Erhaltung der ursprünglichen Sitten und des Kultus der Dajak am mittleren Mahakam—Tundjung- und Kĕnjastämme—Verhältnis der Bewohner des oberen zu denen des mittleren Mahakam.
Kapitel III. 52–74
Plan eines Zuges ins Quellgebiet des Mahakam—Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen—Fahrt auf dem Mahakam bis zum Quellfluss Sĕlirong—Durch den Sĕliku auf den Lasan Tujang—Aussicht von dessen Gipfel—Topographische Aufnahmen Geologische Verhältnisse des Quellgebiets—Über den Lasan Towong zurück zum Lagerplatz am Sĕlirong—Charakter der beiden Quellflüsse—Besteigung des Batu Balo Baung—Umschlagen des Bootes in den Stromschnellen—Vereinigung der topographischen Messungen des Mahakam- und Kapuasgebietes—Heimkehr nach Long Blu-u nach einmonatlicher Abwesenheit.
Kapitel IV. 75–94
Aussichten für die Reise nach Apu Kajan—Beziehungen der Bahau zu ihrem Stammlang—Die Kĕnja als Kopfjäger—Alte Fehden zwischen den Kĕnjastämmen—Bedrohungen seitens des Sultans von Kutei—Vergebliches Warten auf die Einsetzung eines Kontrolleurs—Beratung in Long Tĕpai—Reisehindernisse seitens der [VIII] Bahau—Beunruhigende Gerüchte von der Küste und Apu Kajan—Abschied von Long Blu-u—Über Long Tĕpai nach Long Dĕho.
Kapitel V. 95–129
Organisation eines Stammes am oberen Mahakam—Stellung der Häuptlingen Freien und Sklaven—Vielweiberei—Verlobung Heirat, Ehescheidung, Ehebruchs Erbschaftsrechte—Geburt und Verbotsbestimmungen für Kinder—Schreckfiguren und Beschwörungen zur Vertreibung von Krankheiten—Prophezeiungen ans den Eingeweiden von Tieren—Betrügerisches Vorgehen der Priester—Geisterbeschwörung bei Dürre—Schöpfungsgeschichte der Mahakam-Kajan—Die mächtigsten Geister des Mahakam (seniang)—Begräbnisgebräuche—Ökonomische Verhältnisse am Mahakam—Ackerbau und Ackerbaufeste—Verschiedene Feldprodukte—Sagogewinnung—Fleischnahrung—Fischfang und Fischzucht—Haustiere—Schlachtmethoden Fleischkonservierung.
Kapitel VI. 130–146
Religiöse Bedeutung einiger Spiele der Mahakam-Dajak—Spiele der Männer: Waffentanz (kĕnja), Ringkampf, Wettlaufs Hochund Weitsprung, Ball- und Kreiselspiel, Scheinkämpfe (Wasserspritzen, Blasrohrschiessen)—Spiel der Frauen: Tanz zwischen Preisstampfern—Volksspiele—Kinderspiele: Spielzeug, Steinewerfen (aus freier Hand; mit Schleudern), Figurenbilden mittelst einer Schnur, Häuserbau—Singtänze (ngarang)—Rezitationen—Musikinstrumente: Gonge, klĕdi, Flöten, Guitarre (sape̱), Maultrommel (tong)—Singen und Pfeifen.
Kapitel VII. 147–185
Häuserbau bei den Bahau- und Kĕnjastämmen—Unterscheidung dreier Baustile—Vorschriften bei der Wahl des Baumaterials und Baugrundes—Bau von Kwing Irangs Haus—Hilfeleistung seitens der Dorfgenossen und fremden Stämme—Zeremonien bei der Aufrichtung der Pfähle—Konstruktion des Gerüstes des Fussbodens und Dachs—Innere Einteilung—Ausstattung der Galerie (ăwă) und des Wohngemachs (amin)—Äusserer Hausschmuck—Herstellung von Schindeln—Opferzeremonien bei der Dachdeckung Verbotsbestimmungen für ein unvollendetes Haus—Feierlicher Einzug ins neue Haus—Entzündung des ersten Herdfeuers Kopfjagdzeremonien—Opferung und Schlussfeier—Hausbau bei den Freien—Bau von Scheunen.
Kapitel VIII. 186–233
Charakter der Industrie bei den Bahau und Kĕnja—Herstellung von Kleidung: Spinnerei; Webereid Verzierung durch Figuren Stickereien, Knüpfarbeiten- Baumbastkleidung—Schmieden: Werkzeuge; Eisengewinnung Herstellung von Arbeitsgerätschaften, Lanzen, Schwertern; Verzierung der Schwerter—Schnitzerei: Griffe und Scheiden; Holz- und Bambusschnitzerei—Flechterei: Zubereitung von Rotang, kĕbalan, tika, samit;—Flechten von Körben, Mattem Hüten; Flechtarbeit für Waffen—Töpferei—Bootsbau: Wahl und Behandlung des Materials; Roharbeit Endbehandlung—Kalkbrennerei—Herstellung von Schmuck aus Steinen und Perlen: Wert der Perlen ihre Herkunft, Verwendung; Rolle der Perlen in der Kulturgeschichte.
Kapitel IX. 234–284
Allgemeines über die Kunstäusserungen der Bahau- und Kĕnjastämme—Zahl und Art der in der Ornamentik angewandten Motive—Verwendung von Menschenfiguren—Erkennungszeichen für bestimmte Motive—Tierfiguren (Hunds Tiger, Rhinozerosvogel) Verwendung einzelner Tierteile (Feder des Argusfasans, Pantherfell)—Genitalmotive—Stilisierungen—Verwendung der Motive im Kunsthandwerk: bei Hirschhorngriffen, Schwertscheiden, Bambusköchern, Kleiderverzierungen, Perlenarbeiten—Einfluss fremder Völker und Stämme auf die Entwicklung der Kunst bei den Bahau und Kĕnja. [IX]
Kapitel X. 285–306
In Long Dĕho—Auseinandersetzungen mit Bang Jok—Begegnung mit den Kĕnja-Dajak unter Taman Ulow—Missstände im Dorfe—Zusammenkunft mit dem Kĕnja-Häuptling Taman Dau—Ankunft Demmenis und Kwing Irangs am 3. April—Neue Beratungen über die Reise—Einverständnis der Häuptlinge mit dem Zuge nach Apu Kajan—Bo Adjang Lĕdjüs Tod und Beisetzung—Wahl und Vorbereitung eines Lagerplatzes am Boh—Widersetzlichkeiten seitens des Personals—Neue Hindernisse durch die Kajan—Midans Rückkehr von der Küste—Aufbruch zum Boh am 17. Mai.
Kapitel XI. 307–331
Dreimonatlicher Aufenthalt im Lagerplatz am Boh—Bier verlässt die Expedition—Anlage einer Fischsammlung—Günstige Nachrichten aus Long Blu-u—Offizieller Bericht von der Einsetzung eines Kontrolleurs am Mahakam—7 Kĕnja unter Taman Ulow schliessen sich der Expedition an—Jagdverhältnisse am Mahakam—Kastrierung der Hunde, Jagdmethoden, Fallenstellen, Beschwörung der Hunde, Vogeljagd—Kwing Irangs Ankunft am Boh—Reiseberatung—Schwierigkeiten durch den Tod von Kwing Irangs Schwester—Vorbereitungen zur Abreise—Aufbruch der Kĕnjagesandtschaft unter Taman Ulow.
Kapitel XII. 332–360
Aufbruch von der Bohmündung am 6. August—Reise auf dem Boh und seinen Nebenflüssen Oga, Tĕmha und Mĕsĕai—Landweg über die Wasserscheide—Begegnung mit unserer Gesandtschaft—Freundlicher Empfang seitens der Kĕnja in Apu Kajan—Einzug in Tanah Putih am 5. September.
Kapitel XIII. 360–401
Empfang in Tanah Putih—Verhältnisse im Dorf—Erste politische Versammlung—Freundschaftlicher Verkehr mit den Dorfbewohnern—Überblick über die geographischen und geschichtlichen Verhältnisse in Apu Kajan—Besuch aus benachbarten Dörfern—Stellung der verschiedenen Stände bei den Kĕnja—Tod und Begräbnis eines Häuptlings—Ankunft der verirrten Long-Glat-Gesellschaft—2. und 3. politische Versammlung—Anerkennung der niederländischen Herrschaft in Apu Kajan.
Kapitel XIV. 402–428
Aufforderung und Vorbereitung zu einem Besuch bei den flussabwärts gelegenen Niederlassungen—Ankunft in Long Nawang—Zustände im Dorf—Freundschaftlicher Verkehr mit den Bewohnern—Besuch von fremden Häuptlingen—Politische Versammlung—Besuch bei den Uma-Djalān—Rückkehr nach Tanah Putih—Vorbereitungen zur Heimreise.
Kapitel XV. 429–452
Abschied von Tanah Putih am 4. November—Im Lagerplatz am Kajan—Wiederholter Aufenthalt durch schlechte Vorzeichen—Zusammentreffen mit den Kajan in Long Laja—Geologische Verhältnisse im Laja—Aussichtsposten auf der Wasserscheide—Abstieg zum Mĕsĕai—Aufenthalt wegen Hochwasser—Umschlagen eines Bootes im Kiham Puging—Jagd auf Wildschweine—Ankunft am Mahakam—Besuch bei Barth in Long Iram—Abschied von Kwing Irang—Auflösung der Expedition in Samarinda—Ankunft in Batavia am letzten Dezember 1900.
Kapitel XVI. 453–487
Allgemeines über die körperliche und geistige Entwicklung der Dajak auf Borneo—Gründe für ihre geringe Bevölkerungsdichte: klimatische und hygienische Einflüsse, Krankheiten—Abhängigkeit des Gesundheitszustands von der Höhe des Landes— [X] Einfluss mangelhafter Entwicklung und Kenntnis auf die ökonomischen Verhältnisse und auf die religiösen Vorstellungen—Geistige Fähigkeiten der Dajak—Charaktereigenschaften—Körperliche und geistige Überlegenheit der Kĕnja-Dajak über die Bahau-Dajak.
Kapitel XVII. 488–507
Verhältnis zwischen der dajakischen, malaiischen und europäischen Rasse auf Borneo—Malaiische Regierungsprinzipien—Einfluss der Malaien auf ökonomischem und religiösem Gebiet—Unterdrückung und Ausbeutung der dajakischen Stämme durch die malaiischen Fürstenfamilien—Degeneration der ursprünglichen Bevölkerung—Furcht der Dajak vor den sĕrawakischen Stämmen—Segensreicher Einfluss einer europäischen Verwaltung—Gründung des Fürstentums Sĕrawak unter James Brooke und die günstigen Resultate von dessen Wirksamkeit.
Kapitel XVIII. 508–519
Ergebnisse meiner Reisen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, Medizin und Topographie—Praktische Bedeutung ethnologischer Studien für eine friedsame Kolonisation—Politische Ereignisse in Mittel-Borneo nach meiner Rückkehr—Schlussbemerkung. [XI]
Liste der Tafeln.
Kapitel I.
Einzug in Samarinda am 9. Juni—Abreise von Barth und einem Teil des Personals nach Java Vorbereitungen zur Reise nach Apu Kajan—Besuch beim Sultan—Begegnung mit der Siboga-Expedition—Abfahrt von Samarinda mit dem “Lawu” am 17. Juni—4 tägige Dampferfahrt bis Udju Tĕpu und Ana—Mondfinsternis in Ana—Von Ana bis Long Howong—Rückkehr des “Lawu” zur Küste—Von Long Howong mit Böten nach Irma Mĕhak—Über die östlichen Wasserfälle nach Long Dĕho—Aufenthalt in Long Dĕho—Besteigung des Batu Ajo—Von Long Dĕho nach Long Tĕpai—Beunruhigende Gerüchte aus Long Blu-u—Ankunft daselbst im September Misstrauen seitens der Kajanbevölkerung.
Der Dampfer des Sultans brachte unsere Expedition spät abends nach Samarinda. Herr van Assen, der Assistent-Resident, befand sich, wie wir vom Sultan gehört hatten, gerade auf einer Reise nach Bulungan. Der vorgerückten Stunde wegen wagten wir anfangs nicht, als Gäste in sein Haus einzuziehen, wozu er uns aufgefordert hatte. Ein indisches Hotel erschien aber Barth und mir nach allen überstandenen Anstrengungen so wenig verlockend, dass wir uns am Ende doch noch entschlossen, die Wohnung des Herrn van Assen aufzusuchen, in der uns dessen Gattin ebenso herzlich wie auf der vorigen Reise empfing und uns einige bereit gehaltene Zimmer anwies. Seit länger als einem Jahr schliefen wir hier zum ersten Mal wieder in einem guten Bett. Demmeni und Bier nächtigten im Hotel, während die Bahau und unser javanisch-malaiisches Geleite teils in unseren, teils in ihren eigenen Böten schliefen, die wir nach Samarinda mitgenommen hatten. Unsere Schutzsoldaten waren von ihren samarindaschen Kollegen sogleich abgeholt und in deren Kaserne einquartiert worden.
Meine erste Arbeit bestand darin, alles so zu ordnen, dass, sobald der Dampfer von Bulungan eintraf, Barth, die meisten Javaner und die Schutzsoldaten nach Java weiterfahren und letztere von dort nach Pontianak zurückbefördert werden konnten. Sehr leid tat es mir, dass auch unsere Pflanzensucher Sĕkarang und Amja nach Buitenzorg zurückkehren mussten, da ohne sie das Sammeln auf botanischem Gebiet nur mangelhaft fortgesetzt werden konnte. Mit Rücksicht auf unsere [2] sehr bedeutende Sammlung lebender Pflanzen war es aber durchaus notwendig, dass sachverständige beute die Pflanzen auf der Reise begleiteten, um sie vor Hitze oder schlechter Behandlung zu schützen.
Meinen Diener Mm Arm, den Jäger Doras und den sehr gewandten Abdul hatte ich bereits während des letzten Teils der Reise dazu überredet, gegen eine Lohnerhöhung von 5 fl monatlich nochmals mit mir ins Innere der Insel zurückzukehren. Von Hadji Umars Malaien nahm ich zwei, Dĕlahit und Umar, die sich willig und brauchbar gezeigt hatten, in meinen Dienst.
Die Reiseberichte unserer Schutzsoldaten in der Kaserne hatten so günstig gelautet, dass 5 junge Soldaten, die ich gern mit mir nehmen wollte, sogleich aus ihrem Dienst in Samarinda traten und sich mir anschlossen. Die Anwerbung des Personals regelte sich übrigens von selbst, während wir alles für Barths Reise vorbereiteten. Die ethnographischen und zoologischen Sammlungen nahm Barth nicht mit; jene deponierte ich in Samarinda, diese sandte ich, damit sie nicht verdarb, sogleich an das Museum in Leiden. Die nassgewordenen Ethnographica hatten eine Aufbesserung sehr nötig, so brauchte ich denn auch in Samarinda mein Personal nicht völlig untätig gehen zu lassen. Die meisten spielten sich übrigens als Führer ihrer Bahaufreunde auf, von denen die wenigsten eine so grosse Küstenstadt gesehen hatten und ohne Begleitung auszugehen wagten. Ich gab ihnen nur zuverlässige Personen mit, damit sie von den malaiischen und chinesischen Händlern auf dem Markt nicht zu stark betrogen wurden. Ich selbst hatte vor der Abreise Barths keine Zeit, mich der Leute anzunehmen.
Am 9. Juni kehrte der schöne, grosse Dampfer “de Reiniersz” mit dem Assistent-Residenten van Assen von Bulungan zurück und fuhr am folgenden Tage mit Barth und zwölf unserer inländischen Reisegefährten an Bord weiter nach Bandjarmasin und Batavia. In Barth verlor ich einen heiteren Gesellschafter und eine grosse Stütze für meine fernere Reise.
Hiermit war die erste unserer Expedition gestellte Aufgabe erfüllt. Im Lauf von 13 Monaten, vom Mai 1898 bis zum Juni 1899, hatten wir Borneo von Pontianak nach Samarinda durchquert, und die politischen und wissenschaftlichen Resultate unserer Reise entsprachen vollständig unseren Erwartungen. Nun galt es, auch die zweite Aufgabe, den Zug zu den Kĕnja in Apu Kajan, zu einem glücklichen Abschluss [3] zu bringen. Die Hauptschwierigkeit, geeignetes Personal zu finden, hatte ich, wenn auch mangelhaft, bereits gelöst, und was die Ausrüstung betraf, so hatte ich auf den Markt in Samarinda gerechnet. Die Tauschartikel und Konserven, die ich von Batavia aus hergesandt hatte, fand ich wohl aufgehoben wieder, und auch die Perlen, die ich von Putus Sibau aus den Assistent-Residenten in Pontianak einzukaufen gebeten hatte, waren gut angekommen und für mich um so wertvoller, als der Markt in Samarinda nur eine geringe Auswahl an Perlen bot. Beim Einkauf der speziell für die Kĕnja geeigneten Artikel bot sich mir der Anführer der Long-Glat, Bo Ului, der einzige Mann, der mehrmals bei den Kĕnja gewesen war, als Ratgeber an. So zog ich denn mit ihm von einem chinesischen oder buginesischen Laden in den anderen, stets gefolgt von der ganzen Bahaugesellschaft, die nichts besseres zu tun wusste, als unter meinem Schutz nochmals alle fremden Herrlichkeiten zu bewundern. Überdies hatten die meisten in den ersten Tagen noch zu überlegen, was sie sich anschaffen sollten, wie ihre Guttapercha und ihre guliga am besten zu verkaufen wären und—da sie alle ein Geschenk von mir erwarteten—welchen Gegenstand sie am liebsten von mir haben wollten. Es fiel mir nicht schwer, unter all den anziehenden Gegenständen etwas Passendes für sie zu finden; mit Beilen, Perlen, Tongefässen und Ähnlichem stellte ich sie bald zufrieden. Auf Anraten Bo Uluis kaufte ich für die Kĕnja weissen Kattun an Stelle des schwarzen, den ich von Batavia hergesandt hatte und der für die Bahau geeigneter war. Auch veranlasste Ului mich, alle vorhandenen grossen Glasperlen aufzukaufen, weil diese von den Kĕnja als Gürtelschmuck sehr geschätzt werden. Ferner erstand ich einen Vorrat von 2 dm langem, weissem Ziegenhaar, das zur Verzierung von Schwerter n beliebt ist und einen leichten und wertvollen Tauschartikel bildet. Unterdessen war Bo Uluis Auge auf grosse, sehr flache, als Schmuck für Kriegsmäntel sehr gesuchte Austerschalen gefallen; doch erschienen sie mir zu schwer zum Transport. Sehr zu statten kam später der bedruckte Kattun und Batik, den wir hier einkauften. Die grosse Auswahl an Elfenbeinarmbändern, die uns zu Gebote stand, war mir um so erwünschter, als ich bereits über Erwarten viele Sätze hatte verschenken müssen. Weniger willkommen war mir bei unseren Einkäufen die Gegenwart meiner Bahau: ich wusste nur zu gut, dass sie später versuchen würden, alle gesehenen Gegenstände mir abzukaufen oder abzubetteln.
Mein Diener Midan nahm wiederum die Sorge für unsere Küchen [4] vorräte auf sich. Da wir uns in bezug auf Raum und Gewicht sehr einschränken mussten, liess ich ihn für uns Europäer nur Zuspeisen zum Reis und für die Malaien so viele gedörrte Fische und gesalzene Eier einkaufen, als wir für die Reise bis zu den Wasserfällen voraussichtlich brauchen würden.
Mit dem Handelsdampfer des Sultans war die Fahrt den Mahakam hinab leicht von statten gegangen, weit schwieriger erwies es sich nun, den Fluss wieder hinauf zu gelangen. Die Regierung von Kutei hatte uns während unserer Reise so deutliche Beweise ihrer Unzufriedenheit mit unserem Aufenthalt bei den Bahau gegeben, dass wir eine besondere Unterstützung von ihr bei unserer Rückkehr ins Innere lieber nicht in Anspruch nehmen wollten. Hierzu wären wir jedoch gezwungen gewesen, wenn wir auf den bestimmten Termin der Abfahrt des Dampfers nicht hätten warten wollen, oder wenn wir unsere beiden grossen Böte und die drei der Bahau von dem Dampfer ins Schlepptau hätten nehmen lassen. Um dies zu vermeiden, suchte ich einen kleinen Dampfer zu mieten, aber von den zweien, die in Samarinda Privatleuten gehörten, war der eine defekt und der andere für unseren Zweck unbrauchbar. Zum Glück kam Herr van Assen auf den guten Gedanken, die Lotsengesellschaft an der Mündung des Mahakam um einen Dampfer zu ersuchen. Der betreffende Beamte, Herr Bussemaker, zeigte sich auch sogleich bereit, mir einen seiner beiden Dampfer zur Verfügung zu stellen, unter der Bedingung, dass ich die verbrauchten Kohlen selbst bezahlte. “De Lawu”, ein kleiner, aber sehr starker Schleppdampfer, war der geeignetste, doch konnte er nicht die ganze Menge Kohlen mitführen, weswegen ich die nötige Quantität durch den Handelsdampfer des Sultans voraus nach Udju Tĕpu schaffen liess, um sie dort einzunehmen.
Höflichkeitshalber und gleichzeitig zur Besprechung einiger Angelegenheiten stattete ich dem Sultan mit dem Assistent-Residenten einen offiziellen Besuch ab. Da die Residenz Tengaron weit oberhalb Samarinda liegt und im Gebiet von Kutei, gleichwie im Innern, fast keine Landwege existieren, mieteten wir eine Dampfbarkasse, die uns nach Tengaron brachte. Der Sultan empfing uns, trotzdem er von meinen Unternehmungen und meiner Person durchaus nicht eingenommen war, als Vertreter der Regierung aus politischen Gründen doch mit grosser Zuvorkommenheit. Er interessierte sich für den Verlauf meiner Expedition, über die er sehr gut unterrichtet sein musste, berührte aber [5] keine politischen Fragen, was sehr am Platze war, da sich nicht nur der Tronfolger, sondern auch dessen Brüder, unter diesen der berüchtigte Raden Gondol, über den ich mich am meisten zu beschweren hatte, in unserer Gesellschaft befanden.
Am Mittagsmahl nahmen alle männlichen Glieder der fürstlichen Familie Teil, wobei die jüngsten Prinzen, der Hofsitte gemäss, bedienten. Der elende Raden Gondol, der gegen die Bahaubevölkerung im Innern die schändlichsten Missetaten beging, suchte unserem Besuch zuletzt dadurch eine gehässige Wendung zu geben, dass er den Häuptling Bang Jok aus Long Dĕho rufen ging, der sich noch in Tengaron befand und den der Sultan dazu gebracht hatte, gegen unsere Expedition feindlich aufzutreten. Ich benützte jedoch Gondols Abwesenheit und brachte alle Schandtaten, die er in Uma Mĕhak beging, zur Sprache. Während meines Berichtes wurde der Sultan, der rechts von mir sass, rot vor Verlegenheit und bemerkte zu dem ihm gegenüber sitzenden Kronprinzen, er habe nicht gewusst, dass es so schlimm stehe. Er erklärte, ebenfalls allerhand gehört, aber den Gerüchten keinen Glauben geschenkt zu haben; da die Berichte nun aber aus solch einer Quelle kamen, wollte er seinem Sohne nicht mehr gestatten, nach Uma Mĕhak zu gehen, sondern ihn in Tengaron zurückhalten. Das musste ihm sehr schwer fallen, da er Gondol seiner Schulden wegen selbst fortgeschickt hatte. Der Sultan behauptete übrigens, sein Sohn begehe die Übeltaten nur unter dem starken Einfluss seiner Frau Mariam, die allerdings sehr energisch war. Als Raden Gondol bald darauf im Triumph mit Bang Jok zurückkehrte, hatte sich die Schadenfreude der Tischgenossen bereits stark gelegt, und wir ertrugen im Bewusstsein, unser Ziel erreicht zu haben, mit Gleichmut die unangenehme Gegenwart des Häuptlings. Bang Jok schien übrigens durchaus nicht heiterer Stimmung zu sein und fühlte sich auch in dieser hohen Gesellschaft sehr gedrückt; obgleich er mit seinem Vater mehrere Jahre vom Sultan in Tengaron zurückgehalten worden war, hatte er in der malaiischen Umgebung seinen Gesichtsausdruck doch noch nicht so zu beherrschen gelernt, wie die am Tische sitzenden Kuteischen Fürsten. Da wir nichts Wichtiges weiter zu besprechen hatten, fuhren wir bald darauf nach Samarinda zurück.
Ich vermutete, dass Kwing Irang und die Seinen in Udju Tĕpu bereits ungeduldig geworden waren, und da auch mein Bahaugeleite nichts lieber wollte, als das ihm fremde und unheimliche Samarinda [6] verlassen, wurde es Zeit zur Rückkehr nach dem oberen Mahakam. Einige unserer Bahau hatte ich bereits an dem Tage, an dem Barth nach Java abgereist war, in Gesellschaft von Demmeni und Sorong nach Udju Tĕpu vorausziehen lassen. Es hatten uns nämlich zwei unserer Malaien, die in Tengaron ebensogut bekannt waren wie in Samarinda, erzählt, der Sultan habe die Absicht, Kwing Irang nach Tengaron kommen zu lassen. Das musste vermieden werden; erstens weil hierdurch ein sehr unerwünschter Aufenthalt entstanden wäre, zweitens weil ein an die Residenz des Sultans gerufener Bahauhäuptling zu einem willenlosen Werkzeug in dessen Händen gemacht wird. Kwing Irang fürchtete sich daher selbst davor, in Tengaron zur Ablegung des Untertaneneids gezwungen zu werden, wie es eben mit Bang Jok geschehen war. Hätte Kwing keine Nachricht von mir erhalten, so wäre er wahrscheinlich doch dem Ruf des Sultans gefolgt; so liess ich ihn denn durch Sorong ersuchen, in keinem Fall zur Küste zu kommen, auch reiste Demmeni mit einem Teil der Leute und des Gepäckes voraus, um die Bewohner von Tengaron und Udju Tĕpu von unserem baldigen Aufbruch zu überzeugen. Die Reisevorbereitungen brachte ich zu einem schnellen Abschluss und wartete dann nur noch auf die Ankunft des Dampfers. Der Einkauf von Steinkohlen führte mich dazu, einer Aufforderung des Direktors Hulshoff-Pol nachzukommen und die Steinkohlenminen in Batu Panggal, zwischen Samarinda und Tengaron, zu besuchen. Der Direktor liess mich eines Morgens mit einer Dampfbarkasse aus Samarinda abholen, und als ich 1 ½ Stunden darauf in Batu Panggal ausstieg, lag dort gerade ein grosser Dampfer an der Reede, der abends zuvor vom Meere aus an Samarinda vorübergefahren war und den niemand dort kannte. Zu meiner grossen Überraschung hörte ich, dass das Schiff die “Siboga” sei, mit der Professor Max Weber, dessen Gattin Anna Weber van Bosse und einige andere Gelehrten eine Tiefseeforschung in der östlichen Hälfte des malaiischen Archipels unternahmen. Obgleich wir uns persönlich nicht kannten, hatten wir doch von einander gehört, so dass ich die Teilnehmer der Expedition gern kennen lernen wollte und mich beeilte, sie von meiner Anwesenheit zu unterrichten. Leider musste die Siboga, um den günstigen Wasserstand an der Mahakammündung zu benützen, bereits eine halbe Stunde darauf die Anker lichten, doch behielt ich diese, wenn auch kurze Begegnung mit gebildeten, sympathischen Menschen in angenehmer Erinnerung. [7]
Zur grossen Freude unserer Bahau beschloss ich, am 17. Juni abzureisen; sie hatten alles Interessante in Samarinda bereits gesehen, und da sie bald nichts mehr besassen, um sich Leckereien, wie gedörrte Fische, Süssigkeiten und Früchte zu kaufen, begannen sie sich zu langweilen. Sie verlangten nur noch nach einer einzigen Sehenswürdigkeit, nach europäischen Damen in europäischer Kleidung, mit den für sie so seltsamen dünnen Taillen, von denen sie durch Landsleute, die bereits in einer Küstenstadt gewesen waren, gehört hatten. Europäerinnen in der losen, indischen Morgenkleidung, sarong und kabaja, hatten sie bereits gesehen, aber das Merkwürdigste war ihnen noch vorbehalten. Es traf sich gut, dass die samarindasche Damenwelt ihrerseits darauf aus war, meine wilden Dajak Kriegstänze aufführen zu sehen. In dem Hotel, in dem Demmeni und Bier wohnten, hatte mein Geleite zwar schon vor den Herren getanzt, um nun aber die Damen und meine Bahau gleichzeitig zufrieden zu stellen, hielt ich es für das beste, diese in der grossen viereckigen Galerie des Herrn van Assen eine Extravorstellung für die weiblichen Zuschauer geben zu lassen. Am Vorabend unserer Abreise wurden die beiden interessierten Parteien denn auch wirklich eingeladen und fanden alle Musse, sich teils von Stühlen, teils vom Fussboden aus zu betrachten. Meine Dajak hatten zum Glück ihre schönen Schwerter und Blasrohre bei sich, Schilde und Kriegsmützen lieh ich ihnen, und so wetteiferten sie denn der Reihe nach im Tanze. Einige verstanden den Tanz überhaupt nicht oder waren so ungewandt, dass sie sich in unserer Gegenwart zu tanzen schämten; andere dagegen wollten mit ihrer Kunst gern vor uns glänzen, ausserdem wurden sie dadurch angefeuert, dass Kajan und Long-Glat, die einander in nichts nachstehen wollen, gegen einander aufzukommen hatten. Dass zuletzt sogar der alte Bo Ului zum Tanze aufgemuntert wurde, obgleich Greise für gewöhnlich nicht mithalten, bewies mir die gute Laune meiner Bahau und den animierenden Einfluss, den die Gegenwart der europäischen Damen auf sie ausübte. Die Zuschauerinnen, die derartige Kriegstänze noch nie hatten aufführen sehen, folgten der Vorstellung mit Spannung und Bewunderung, so dass unser Aufenthalt in Samarinda ein für alle Teile angenehmes Ende nahm.
Der “Lawu” war bereits mittags angelangt und zur Aufnahme von Kohlen zur Mine weitergefahren. Da unsere Böte, um gut bugsiert werden zu können, nur wenig belastet werden durften, wurde der Dampfer, nachdem er abends zurückgekehrt war, mit dem grössten und schwersten [8] Teil unseres Gepäckes, hauptsächlich mit Blechkisten mit Salz, Petroleum und Öl, Säcken mit Kartoffeln, Zwiebeln, getrockneten Fischen und Kisten mit gesalzenen Eiern beladen. Trotzdem stellte sich, als wir am folgenden Morgen unsere Reise antreten wollten, die Schwierigkeit ein, dass, sobald der Dampfer stärker anzog, die Böte, besonders die nur wenig über Wasser hervorragenden der Bahau, welche in Schlepptau genommen waren, mit der Spitze leicht Wasser schöpften und bei Biegungen umzuschlagen drohten. Von vorn herein musste daher mit halbem Dampf gefahren werden und wir gelangten an diesem Tage nur bis Tengaron, wo wir Halt machten, da ich mich noch vom Sultan endgültig verabschieden und auf dem Markt einige Tauschartikel, hauptsächlich langes, weisses Ziegenhaar, das in Samarinda nicht in genügender Menge vorhanden gewesen war, einkaufen wollte. Gegen Abend liessen Bier und ich uns beim Sultan melden, der uns sehr liebenswürdig empfing und in seinem Palast herumführte. Sehr stolz war er auf die elektrische Beleuchtung, die überall angebracht worden war und für die einige Japaner zu sorgen hatten.
Der malaiische Diplomat vermochte diesmal doch nicht gänzlich über meine politische Tätigkeit unter den Bahaustämmen; die ihn natürlich sehr nahe anging, zu schweigen. Als wir unwillkürlich über das Binnenland zu reden anfingen, bemerkte er, dass wir beide miteinander dort um den grössten Einfluss wetteiferten. Ich hielt aber ein näheres Eingehen auf diesen Gegenstand nicht für geraten und brachte das Gespräch auf die Plantagen, die Seine Hoheit seit dem Beginn seiner Regierung angelegt hatte. Nachdem wir mit dem Sultan noch eine Tasse Thee getrunken hatten, suchten wir in unseren langen Böten unser Nachtquartier auf, da auf dem Dampfer keine Passagierkabinen vorhanden waren.
Am anderen Morgen ging die Reise weiter. Wir fuhren 4 Tage lang den Mahakam aufwärts, der bis dicht vor Udju Tĕpu durch sehr flaches, wenig über den Wasserspiegel emporragendes Land strömt, das bei Hochwasser überschwemmt wird. Die Häuser der malaiischen Dörfer sind auf dieser Strecke daher entweder auf Pfählen längs des Ufers gebaut, oder sie stehen auf Flössen, die mittelst Rotangkabeln am Uferwall befestigt sind und mit dem Wasser steigen und fallen. Das Gleiche geschieht mit den zum Ufer führenden Holzstegen, die meistens aus grossen Baumstämmen bestehen, die der Fluss von oben heruntergeschwemmt hat. Die im Gebirge des Binnenlandes herrschen [9] den Regen bewirken nämlich nicht nur ein Steigen des Wassers, sondern schaffen auch die vor Alter oder bei der Anlage von Reisfeldern ins Wasser stürzenden Bäume in den Hauptfluss und von dort zur Mündung. Bei Hochwasser sieht man den Fluss daher stets ausser Massen von Schlamm eine Menge Blätter, Äste und Stämme verschiedenster Grösse abwärts führen. Viele dieser Bäume haben Jahre gebraucht, um den Hauptstrom und tiefes Wasser zu erreichen, und erscheinen durch das Anprallen an Felsen aller Äste beraubt und von aussen oft völlig verfault. Andere dagegen sehen noch sehr frisch aus und besitzen noch eine grosse Triebkraft. Die oben am Fluss wohnenden Dajak, die nur auf festem Land bauen, lassen diese Waldriesen vorüber treiben, und diese werden von den Malaien weiter unten bei Hochwasser aufgefangen. Wer einen solchen Stamm zuerst in Besitz nimmt, wird dessen Eigentümer und darf ihn entweder selbst verwenden oder verkaufen. Die meisten werden zur Herstellung von Flössen gebraucht, indem man sie aneinanderlegt und durch Querbalken verbindet. Auf den Flössen wiederum werden Häuser und Badehütten gebaut oder dienen sie zum Transport von Rotang. Die Gelegenheit, solcher Stämme habhaft zu werden, ist flussaufwärts natürlich am günstigsten, daher werden sie sowohl am Kapuri als am Mahakam von Malaien, die zur Küste reisen wollen, an den Oberläufen gesammelt.
Einmal sah ich Malaien und Buginesen, die sich zu Handelszwecken bei den Bahau aufhielten, die angeschwemmten Stämme billig aufkaufen, aus ihnen Flösse und auf diesen Häuser bauen und mit ihnen nach beendeten Geschäften den Mahakam hinunter bis in das malaiische Gebiet fahren, wo sie entweder selbst in den Häusern weiter wohnten oder diese verkauften.
Die verschiedenen malaiischen Dörfer, an denen wir vorüberfuhren, wie Kota Bangun, Muara Pau und Mĕlak tragen alle den gleichen Charakter; sie bestehen aus zwei Reihen Häuser, die eine auf dem Ufer, die andere auf Flössen erbaut, beide getrennt durch einen schmalen, hart am Wasser verlaufenden Uferweg. Die schwimmenden Häuser werden je von einer Familie bewohnt und sind bei weitem nicht alle, durch Bretterstege miteinander verbunden, was übrigens auch nicht notwendig ist, da die Bewohner sich, wie alle Malaien, gern in Böten bewegen. Weitaus die meisten leben von Buschprodukten, die sie selbst sammeln oder mit denen sie Handel treiben, und von Fischfang. Geräucherte Fische bilden besonders in den Gegenden, in denen sich zu [10] beiden Uferseiten des Mahakam zahlreiche Seen befinden, einen wichtigen Handelsartikel. Da diese Seen nämlich sehr fischreich und nicht tief sind, lässt sich in ihnen bei niedrigem Wasserstande in kurzer Zeit eine grosse Menge Fische fangen. Der Sultan von Kutei, ein grosser Liebhaber der Fischerei, begiebt sich jährlich zu bestimmten Zeiten an diese Seen.
Der Mahakam ist in diesem Teil seines Laufes 400–800 m breit und macht, besonders wenn man aus dem Innern kommt, wo keine Ebenen existieren, seiner sehr flachen, morastigen Ufer wegen einen imposanten Eindruck. Am dritten Tag passierten wir eine Gegend, in der keine Wälder zu sehen waren, sondern viele über eine grosse Fläche zerstreute, verkohlte Stämme von einem in nicht allzu ferner Zeit staugefundenen, ausgedehnten Waldbrand zeugten. Dieser hatte in der Tat während einer grossen Dürre im Anfang der achtziger Jahre hier geherrscht, und seit der Zeit war auf diesen Ebenen nur Gestrüpp gewachsen.
Weiter oben liegt Mĕlak, der Lieblingsaufenthalt des früheren Sultans und zugleich die höchste Niederlassung am Mahakam, die er noch betreten durfte. Sie liegt nämlich am Fusse eines 150 m hohen Berges, des Gunung Sindawar, der einer Überlieferung zufolge das Gebiet des Sultans begrenzt und von diesem und seinem Geschlechte nicht überschritten werden darf. Nach der Überlieferung stieg der erste Vorfahr des Sultans mit seinen zwei Brüdern vom Himmel auf die Erde herab. Sie teilten das Land am Mahakam in drei Teile, mit der Bestimmung, dass weder sie noch ihre Nachkommen die Grenzen der anderen überschreiten durften. Der Sultan und diejenigen seiner Söhne, die auf die Nachfolgerschaft Aussicht haben, halten noch heute an dieser Überlieferung fest.
Am 21. Juni erreichten wir um die Mittagszeit Udju Tĕpu, wo ich mit den bandjaresischen Kaufleuten sogleich meine Geschäfte abwickelte; auch liess ich Kwing Irang und seine Bahau am jenseitigen Ufer davon benachrichtigen, dass sie sich für die Abreise am folgenden Morgen vorbereiten sollten. Inzwischen nahm der “Lawu” die Kohlen ein, die der “Sri Mahakam” hier für ihn deponiert hatte.
Einen schmerzlichen Augenblick verursachte mir der Abschied von Hadji Umar, der von Samarinda aus mit uns wieder aufwärts gereist war und nun in Udju Tĕpu zurückbleiben wollte. Seit unserer Reise zur Küste hatte Umar sich stets geweigert, Chinin einzunehmen, viel [11] leicht in der Hoffnung, an der Küste bessere Arzneien zu finden. In Samarinda war er mit einigen anderen Malaien zu einem Bekannten gezogen und hatte sich sogleich chinesische Medizinen besorgt. Wenige Tage darauf rief man mich zu ihm, weil es ihm nach Gebrauch dieser Arzneien immer schlechter gegangen war und sie eine heftige Diarrhoe verursacht hatten. Der bereits sehr geschwächten Kräfte des Patienten wegen konnte ich die Diarrhoe nicht vollständig kurieren und bald darauf litt er auch am Magen und an der Mundschleimhaut, so dass es mit dem Essen schlimmer als je stand. Umar merkte selbst die ständige Zunahme seiner Schwäche und wünschte daher in Udju Tĕpu zurückzubleiben, wo er einige Wochen später, am 10. Juli, starb. Seine Frauen und Kinder und die Malaien, die mit ihm gezogen waren, ausser Dĕlahit und Umar, die ich in meinen festen Dienst genommen hatte, blieben beim Kranken zurück. In diesem intelligenten, einflussreichen Manne, der den Charakter der Bahau-Häuptlinge und deren Beziehungen zu einander vollkommen kannte, verloren wir eine grosse Stütze am Mahakam.
Obgleich ich Kwing Irang durch Demmeni hatte benachrichtigen lassen, waren die Bahau, wie ich bereits gefürchtet hatte, zur plötzlichen Abreise am folgenden Morgen nicht vorbereitet. Der eine hatte noch etwas einzukaufen, der andere von einem Händler noch Geld oder Waren zu empfangen u.s.w. Ich erklärte aber, in keinem Fall warten zu wollen, da das Wasser ständig fiel und das grosse Boot, dessen Tiefgang 6 Fuss betrug, bei zu niedrigem Wasserstande nicht fahren konnte.
Der nervöse Njok Lea hatte das lange Warten in Udju Tĕpu nicht ertragen können und war bereits fünf Tage nach unserer Abreise nach Samarinda mit vier Mann Begleitung in einem Boote wieder aufwärts gefahren. Bo Ului und seine Leute waren darüber sehr beunruhigt; sie fürchteten, Njok könnte sich aus Verzweiflung über den Tod seiner beiden Reisegenossen das Leben nehmen, und zeigten sich daher zur Weiterreise mit uns am folgenden Tage sogleich bereit. Dank Demmenis Vorbereitungen in dem eine halbe Stunde höher gelegenen Ana konnte bei unserer Ankunft mit dem Dampfer sogleich mit dem Laden begonnen werden.
Als wir abends in aller Ruhe auf dem Verdeck unser Mahl einnahmen, entstand im Dorfe plötzlich grosse Aufregung; die Bewohner riefen einander an, ein besonders laut dröhnender Gong ertönte mit [12] vielen anderen, ab und zu knallte ein Gewehrschuss, und schliesslich wurden an langen Bambussen brennende Bündel umhergetragen und hin- und hergeschwungen. Die Ursache dieser Unruhe wurde uns erst klar, als wir einige Leute auf den Vollmond weisen sahen, der sich bereits teilweise verfinstert hatte. Unser Kalender, den wir sogleich befragten, verzeichnete eine totale Mondfinsternis für diesen Tag; auf eine baldige Beruhigung der Eingeborenen war daher nicht zu rechnen. Auch der Stamm der Tundjung, der nicht am Flusse selbst, sondern weiter landeinwärts wohnte, war durch diese Naturerscheinung heftig erregt worden: sobald in Ana einen Augenblick Ruhe eintrat, drangen die Schläge der Gonge und Trommeln von den Hügeln her zu uns.
Die verschiedenen Mondphasen sehen die Bahau als verschiedene Wesen, Geister, an, die am Himmel Zuflucht suchten. Die Flecken auf dem Vollmonde sollen in der Zeit entstanden sein, wo diese Geister noch als Menschen nach Bahausitte mit vielen anderen in einem Hause zusammen lebten. Der Mond war damals ein aussergewöhnlich schönes Mädchen, das den Neid ihrer Gefährtinnen in so hohem Masse erregte, dass ihr eine derselben beim Füttern der Schweine den heissen Brei des Schweinefutters übers Gesicht goss, wodurch dieses vollständig verbrannt wurde. Die Flecken auf dem Monde bedeuten daher Brandnarben.
Glücklicherweise schien der Mond wieder hell, bevor wir uns niederlegten- die Dorfbewohner beruhigten sich, und wir suchten im Schlaf für den folgenden Morgen frische Kräfte zu sammeln. Der Tag begann für uns früh, weil ich in Anbetracht des forwährend fallenden Wassers unsere Abreise beschleunigen wollte. Um 6 Uhr war jeder bereits mit dem Einladen des Gepäcks beschäftigt und schon vor 7 befanden wir uns nach Udju Tĕpu unterwegs, um die Bahau von dort abzuholen. Ausser vier Böten der Long-Glat waren nur drei Böte der Kajan soweit fertig, dass wir sie sogleich aufwärts bugsieren konnten. Kwing Irang wollte die Zurückbleibenden nicht im Stiche lassen und versprach, so schnell als möglich nachzukommen; ich sollte ihn an dem höchsten Punkte, bis zu dem der Dampfer uns bringen konnte, erwarten.
Im Augenblick der Abfahrt von Ana trafen noch drei andere Böte der Kajan ein, die wir auch aufwärts bugsieren sollten, so dass ich jetzt zwei eigene Böte und zehn der Bahau mitzunehmen hatte. Dies erschwerte die Aufgabe des Steuermanns um ein beträchliches, da der Dampfer auf diese Weise viel von seiner Bewegungsfreiheit einbüsste, die er doch weiter oben sehr nötig hatte. Er war nämlich [13] bisher nur bis Ana hinaufgefahren und die Bänke, Untiefen und Felsblöcke im Flusse waren der Mannschaft daher nur bis zu diesem Punkte bekannt. Weiter aufwärts hatte sich nur ein einziges Mal ein Dampfer des Sultans gewagt, mit dem Resultat, dass er in der Nähe der Ratamündung auf eine Geröllbank auflief. Der malaiische Bootsführer teilte mir daher sogleich mit, dass er, falls ich den Fluss noch weiter hinauffahren wolle, die Verantwortung nicht weiter übernehme und sein Amt als Steuermann und Befehlshaber niederlegen werde, obgleich ich ihm gesagt hatte, dass zwei zuverlässige Bandjaresen, die diesen Teil des Flusses oft befahren hatten, mitgehen und das Fahrwasser angeben würden.
Da ein möglichst weites Hinaufbugsieren der Böte für uns sehr wichtig war und ein Kennenlernen des Fahrwassers dem künftigen Verwaltungsbeamten am Mahakam von grossem Wert sein konnte, beschloss ich, die Verantwortung und mit dieser das ungewohnte Kommando auf einem Dampfer selbst auf mich zu nehmen. Nach einem herzlichen Abschied von Angin, der Wittwe Ding Lĕdjüs, und von deren Sohn Djü, fuhren wir bei fallendem Wasser und strahlendem Sonnenschein ab. Falls der Wasserstand nicht mehr viel niedriger wurde, liefen wir keine Gefahr, und da meine beiden Führer wirklich gut Bescheid wussten, dampften wir den ganzen Tag über langsam weiter. Als wir bei Udju Halang vorbeifuhren, eilten sämtliche Dorfbewohner ans Ufer, um den aussergewöhnlichen Anblick eines Dampfbootes zu geniessen.
Obgleich die Strömung zwischen den Geröllbänken bisweilen sehr heftig war, wurde sie von dem kräftigen Dampfer doch ohne Schwierigkeiten überwunden. Dank dem chinesischen Maschinisten, der sein Amt nicht wie der maduresische Befehlshaber niedergelegt hatte, sondern sein möglichstes zu leisten versuchte, geschah am Ersten Tage auch kein Unglück. Die Felsblöcke, die etwas unterhalb ’Ma Mĕhak Tĕba an der linken Uferseite lagen und von denen man dem Befehlshaber gesagt hatte, er werde nicht lebend an ihnen vorüberkommen, ragten weit über die Wasserfläche hervor und waren daher leicht zu vermeiden. Selbst die Engen und Stromschnellen bei ’Ma Mĕhak Tĕba, welche für die Schiffahrt sehr verhängnissvoll werden können, passierten wir ohne Schwierigkeiten, da die sonst heftigen Strömungen bei diesem niedrigen Wasserstande ungefährlich waren.
Bei Sonnenuntergang liessen wir an der Mündung des Pari den [14] Anker fallen, worauf unsere Bahau zu ihrer grossen Erleichterung ihre Böte lösten und ans Ufer ruderten. Sie hatten sich nämlich den Tag über zwar an der grossen Schnelligkeit der Fahrt erfreut, jedoch bei jeder Wendung scharf darauf achten müssen, dass ihre schwerbeladenen, niedrigen Böte nicht Wasser schöpften und umschlugen. Sie verhinderten dies, indem sie ihre Böte mittelst der langen gala (Stangen) untereinander verbanden, wodurch sie besser das Gleichgewicht zu bewahren vermochten. Es erwies sich bald als notwendig, alle Böte, ausser den beiden grossen, vom Dampfer loszulösen, denn der Anker wollte im Flussgrund nicht haften. An verschiedenen stellen wurde versucht, einen Halt zu finden, auch hörten wir den Anker auf dem Boden schleppen, doch blieb er nirgends haften, weil das ganze Flussbett aus glatten Steinschichten mit geringen Unebenheiten bestand. Erst als die ganze eiserne Kette hinabgelassen worden war, blieb der Dampfer still liegen, jedoch nur scheinbar, in Wirklichkeit glitt er sehr langsam stromabwärts, was uns aber nicht verhinderte, ruhig bis zum Tagesanbruch zu schlafen. Der Morgen war dunkel und regnerisch; bevor wir noch aufbrachen, goss es in Strömen. Das Wasser begann auch sogleich zu steigen und durch die stärker werdende Strömung erwuchsen uns weit mehr Schwierigkeiten als Tags zuvor. Auch jetzt hinderten die Böte der Bahau eine Fahrt mit vollem Dampf, die häufig bei engen Biegungen um Geröllbänke der heftigen Strömung wegen sehr wünschenswert gewesen wäre. So fuhren wir denn auch schliesslich geradeaus auf eine überschwemmte Geröllbank auf, und nur ein schnelles Arbeiten der Maschine in umgekehrter Richtung verhinderte ein Festlaufen.
Nun blieb nichts anderes übrig, als die Bahau den Fluss selbständig hinauffahren und nur unsere grossen Böte vom “Lawu” bugsieren zu lassen. Zwar ging es jetzt mühelos weiter, aber da oberhalb Long Howong, beim Rata, sehr schwer zu überwältigende Strömungen vorkommen und das Wasser infolge des anhaltenden Regens ständig stieg, beschloss ich, doch in Long Howong anzulegen und es von dem folgenden Tage abhängen zu lassen, ob der “Lawu” uns noch weiter bugsieren sollte oder nicht. Das ununterbrochene Steigen des Flusses veranlasste uns bereits abends, die Ladung aus dem Dampfer in einige schwimmende malaiische Häuser, die vor der eigentlichen Niederlassung im Flusse lagen und verschiedenen buginesischen und bandjaresischen Händlern gehörten, überzuführen. Bald darauf legten auch unsere Bahau vor unseren improvisierten Packhäusern an. [15]
Am anderen Morgen fuhr der “Lawu” bereits früh zur Küste zurück und nahm alle Briefe mit, die wir in den letzten einförmigen Tagen unseren Angehörigen und Freunden geschrieben hatten. In grosse Verlegenheit brachte mich der Gedanke, wie ich die ganze Ladung des Dampfers nach oben schaffen sollte. Am schwersten waren die grossen Mengen Salz, die ich auch diesmal in verlöteten Blechgefässen zu je 20 kg mitgenommen hatte und von denen die meisten für die Kajan und Long-Glat, als Lohn für ihre Reise zur Küste, bestimmt waren. Um unser Gepäck so viel als möglich einzuschränken, begann ich daher bereits hier, vor Ablauf der Reise, den Bahau ihren Teil auszubezahlen, so dass sie das Salz in ihren eigenen Böten unterbringen mussten. Die Long-Glat waren jetzt aber kaum noch zu halten, wollten auf den Nachschub der Kajan unter Kwing Irang nicht länger warten und hatten es so eilig, ihren Häuptling Njok La einzuholen, dass ich sie nur mit Mühe dazu bewegen konnte, 25 Salzkisten für mich nach Long Dĕho mitzunehmen. In Anbetracht, dass sie bereits ihr eigenes Salz wegen zu grosser Belastung der Böte in Long Howong zurückgelassen hatten, verargte ich es ihnen nicht, dass sie unsere Salzkisten nicht über die östlichen Wasserfälle brachten, sondern in Long Bagung deponierten. Am Abend des 26. Juni reiste dieser Teil unserer Gesellschaft ab, nachdem vorher noch ein Boot mit Kajan, die Udju Tĕpu vor uns verlassen hatten, in Long Howong angekommen war. Diese hatten sich allein auf den Rückweg gemacht, weil einer der Ruderer an einer Unterleibskrankheit, zu der noch Malaria hinzugetreten war, schwer krank darniederlag. Da seine Angehörigen nicht genau wussten, wann ich aus Samarinda eintreffen würde und die Schwäche des jungen Mannes stets zunahm, hatte man beschlossen, mit ihm den Heimweg anzutreten, damit er zu Hause oder doch wenigstens seiner Heimat so nahe als möglich sterbe. Nach dem Bericht der Kajan war der Mann an dem Leiden erkrankt, das sich die Stämme aus dem Innern häufig bei längerem Aufenthalt an der Küste zuziehen. Die Krankheit entsteht dadurch, dass die zu Handelszwecken zur Küste reisenden Eingeborenen sich dort allerhand Naschwerk und Leckerbissen kaufen, für sie ungewohnte und schädliche Genüsse; ausserdem trinken sie, wie daheim im Gebirge, das hier bereits stark verunreinigte Flusswasser. Die Dajak mit ihrer zarten Konstitution erkranken hierdurch begreiflicherweise leicht an Unterleibskrankheiten, die sich mit Malaria komplizieren und dann häufig einen tätlichen Verlauf nehmen. [16]
Die Kajan hatten sich bereits so sehr in die Vorstellung, dass der Mann sterben müsse, hineinversetzt, dass sie auch an meine ärztliche Kunst nicht mehr glaubten und kaum dazu zu überreden waren, nicht mit den Long-Glat weiterzureisen. Erst als ich sie darauf aufmerksam machte, dass sie den Kranken sicher nicht lebend bis zum Blu-u bringen würden und er ebenso gut in Long Howong als weiter aufwärts sterben könne, entschlossen sie sich zum Bleiben. Ich nahm den bereits apathischen Patienten sogleich in Behandlung, liess ihn mittelst Laudanum die Nacht gut schlafen, sorgte für geeignete Nahrung und brachte ihn in einigen Tagen so weit, dass er bei unserer Abreise bereits im Boote sitzen und, noch bevor wir die Wasserfälle erreichten, ein Stück weit gehen konnte.
Bereits am folgenden Tage erschien Kwing Irangs Faktotum Sorong und meldete des Häuptlings Ankunft. Am 28. Juni traf dieser auch wirklich ein. Das Wasser war in den letzten Tagen ständig gefallen, daher beeilten wir uns, diese günstige Reisegelegenheit zu benützen. Auch Kwing Irangs Kajan hatten so viel Gepäck von der Küste mitgenommen, dass ich für meine vielen Böte keine genügende Menge Ruderer fand. Indem ich den Kajan ihren Lohn in Salz ausbezahlte, die drei Böte für Biers topographische Aufnahme als Packböte benützte und 20 Kisten Salz in Long Howong abstellte, konnte das eine grosse Boot zurückbleiben. Unsere Kajan und Malaien zogen das 23 m lange Fahrzeug voller Eifer den hohen Uferwall hinauf und banden es an einige Hauspfähle fest, so dass es vor Wind und Wetter zum grössten Teil geschützt war.
Am Morgen des 29. Juni erklärten die Kajan, alle Leute für ihre eigenen Böte nötig zu haben; da meine eigenen Malaien und Javaner für unsere kleinen Ruderböte erforderlich waren, blieb für das grosse Boot, in dessen Mitte ein Asyl für mich aufgeschlagen war, keine Bemannung übrig. Nach Kwing Irangs Meinung konnten die Bewohner von Long Howong sehr gut helfen. Als ich mich daher des Morgens zum Häuptling Lĕdjü begab, erklärte sich dieser zu meiner Verwunderung sogleich bereit, mein Boot so weit bringen zu lassen, als die Leute an diesem Tage zu rudern im Stande wären. Obgleich ich an der Erfüllung des Versprechens noch einigermassen zweifelte, machte ich mich sogleich an die Reisevorbereitungen.
Zuerst überwachte ich die Ladung des Gepäckes, denn das neue Personal besass vom richtigen Packen keinen Begriff, und die fünf Schutz [17] soldaten aus Samarinda hatten sich bereits in Ana durch Ungeschicklichkeit ausgezeichnet. Meine braunen Gehilfen waren aber alle sehr willig und die Arbeit daher in einigen Stunden erledigt. Weit mehr Schwierigkeiten verursachten meine weissen Reisegenossen. Bereits nachts war ich in meinem Boote wiederholt durch das laute Benehmen von Bier geweckt worden, der mit Demmeni ein schwimmendes Haus eines bandjaresischen Kaufmanns bewohnte. Zugleich hörte ich den Grammophon, den Demmeni zur Unterhaltung der Bahau um teures Geld in Samarinda gekauft hatte. Ich dachte anfangs, dass beide die schöne Tropennacht in heitrer Stimmung genossen, aber als der Morgen anbrach, trat immer noch keine Ruhe bei ihnen ein, und beim Aufstehen merkte ich sogleich, dass Bier dem Alkohol stark zugesprochen hatte und Demmeni mehr infolge der durchwachten Nacht als des Alkohols schlechter Laune war. Es stellte sich heraus, dass Bier, um den Genüssen der zivilisierten Gesellschaft in Samarinda noch lange fröhnen zu können, eine Flasche Genever mitgenommen hatte, von der er jeden Tag ein Gläschen hatte geniessen wollen. Unsere bevorstehende Reise in die unbekannte Wildnis hatte ihn aber so bedrückt, dass er unter dem Einfluss der Töne des Grammophons alle Widerstandskraft verloren und mit Demmeni beinahe die ganze Flasche leergetrunken hatte. Das Schlimmste war, dass er in dieser Verfassung erklärte, nicht mit uns reisen zu wollen; auch war er anfangs so erregt, dass er nicht wusste, was er tat. Ich ging ihm daher aus dem Wege. Demmeni bat ich, den Patienten nicht zu reizen und darauf zu achten, dass er nicht aus seiner Behausung herauskam, da er sonst Gefahr lief, von den schwimmenden Balken, auf denen man gehen musste, ins Wasser zu fallen. Die Hausbewohner waren schon abends zuvor aus Furcht vor dem grossen, starken Europäer geflohen, und so erwartete ich von der Ruhe und dem Rest natürlichen Verstandes, der ihm geblieben, das Beste. Ich beschloss, dass Bier seine Sachen in ein besonderes Boot laden lassen und mit uns fahren oder eventuell folgen sollte, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte. Die ersten Stunden vergingen mit allerhand Vorbereitungen, und da ich Bier nicht hörte, glaubte ich, alles stünde gut, und begab mich vor dem Essen zu ihm, um seine Stimmung auszukundschaften. Als er von der Weiterreise immer noch nichts wissen wollte, appellierte ich an sein militärisches Ehrgefühl als deutscher Unteroffizier, sagte ihm auch, dass ich ihm sein Betragen nicht nachtragen wolle und dass mir viel an seiner Begleitung gelegen [18] sei. Die Wirkung meiner Rede wollte ich beim Frühstück abwarten. Wie ich später von Demmeni hörte, hatte Bier sich inzwischen doch zum Mitgehen entschlossen und wollte eigenhändig sein Gepäck in sein Boot laden. Da mir dies zu gefährlich vorkam, liess ich ihn von Demmeni und einigen furchtlosen Malaien in seinem Boote unterbringen, wo bald sein fester Schlaf aller Unruhe ein Ende machte.

Der Kiham Lobang Kubang.
Gegen 10 Uhr morgens traten wir unsere Bootfahrt endlich an und erreichten an diesem Tage Laham. Die Leute aus Long Howong, die uns hier verliessen, wollten für ihre Arbeit nicht einmal eine kleine Belohnung annehmen. Die Bewohner von Laham geleiteten uns weiter nach Long Asa, Hadji Urans früherem Wohnort, wo sich noch seine ganze Gesellschaft Buschproduktensucher aufhielt. Dĕlahit brachte einige dieser Leute dazu, uns nach Uma Mĕhak hinaufzurudern, doch zeigten sie sich nicht so bescheiden wie die Bewohner von Long Howong, sondern nahmen für den erwiesenen Dienst gern 1 fl pro Person an.
Des ständig fallenden Wassers wegen, das zum Hinauffahren über die Fälle sehr günstig war, drang ich gleich nach unserer Ankunft in Uma Mĕhak gegen Mittag auf die Beschaffung von Ruderern, deren ich nur bis zum Beginn der Wasserfälle bedurfte, da Kwing Irang versprochen hatte, uns mit seinen Leuten über den Kiham Halo und Kiham Udang bis nach Long Dĕho zu bringen. Weitaus die meisten Männer wohnten aber auf ihren Reisfeldern und die beiden jungen, durch das Spiel schlaff gewordenen Häuptlinge sehen nicht vertrauenerweckend aus. So schlug ich denn Bier nach dem Essen vor, mit unseren Malaien vorauszufahren, um das in der Aufnahme noch fehlende Stück des Mahakam zu ergänzen und zu versuchen, auch den Bunut bis zu seiner Wasserscheide mit dem Murung zu messen, da dieser Fluss, der bei Long Bagun in den Mahakam mündet, einen viel benützten Verbindungsweg mit dem Gebiet des Murung bildet. Auch Kwing Irang und seine Kajan fanden ihre Zeit zu kostbar, um auf die Männer von Uma Mĕhak zu warten und fuhren mit dem Versprechen weiter, uns abholen zu wollen, falls wir in diesem Dorfe keine Hilfe erhielten. Zu unserem Verdruss hatten wir auch zwei Tage später noch keine genügende Bemannung für unsere Böte beisammen.
Am Morgen des 4. Juli konnten wir nur ein kleines Boot dieser Bahau mit Gepäck hinaufschicken, um das grosse Boot etwas zu entlasten. Da sich für uns selbst immer noch keine Leute eingefunden [19] hatten, waren wir sehr erfreut, als zwei Böte mit Kajan kamen, um uns nach oben abzuholen. Als wir abends auf einer Geröllinsel am Fuss des Batu Tĕnĕbang lagerten, erschien eine grosse Gesellschaft Männer aus Uma Mĕhak, die, einmal aufgefordert, nun doch gern ihren Tageslohn verdienen wollten. Meine Entrüstung über ihr langes Zögern machte so viel Eindruck, dass sie auf meinen Vorschlag, uns nicht nur bis Long Bagun, sondern nötigenfalls auch noch weiter bringen zu wollen, sogleich eingingen.
Mit Hilfe der zahlreichen Mannschaft ging es am folgenden Morgen schnell weiter nach Long Bagun, wo wir Kwing Irang mit den Seinen auf einer Insel gelagert antrafen; Bier war bereits mit einem Kajanboot den Bunut hinaufgefahren. Kwing Irang, der es wie ich für geraten hielt, den günstigen Wasserstand zur Weiterreise zu benützen, gab Sorong den Befehl, mich mit seinem Boote zu begleiten. Nachdem ich noch Bua und deren Gemahl Rauf am jenseitigen Ufer einen kurzen Besuch gemacht hatte, fuhren wir denn auch weiter bis zu einer Geröllinsel beim Beginn des Kiham Halo, wo wir übernachteten. Früh am anderen Morgen brachen wir auf und hielten unser Frühstück auf der Insel Nĕha Lunuk, auf der alle, die zur Fahrt über den Kiham Halo einen günstigen Wasserstand abwarten, ihr Lager aufzuschlagen pflegen. Hier glaubten unsere Männer aus Uma Mĕhak aber genug geleistet zu haben und erklärten, nicht weiter zu können. Da es noch nicht einmal Mittag war, versicherte ich ihnen, dass ich alle Verantwortung für ein eventuelles Unglück mit dem grossen Boot im Kiham Halo auf mich nehmen wolle und dass auch das langsam steigende Wasser kein Hinderungsgrund sei, worauf die Leute sich, wenn auch zögernd, auf den Weg machten. Als die Männer, die mit dem kleinen Gepäckboot vorausgefahren waren, am Anfang der Flussenge nochmals das Gepäck an Land zu tragen begannen, rief ich ihnen zu, dass sie durchaus weiter müssten, und von jetzt an widmeten sie alle Aufmerksamkeit und Kraft ihrem Boote. Das Wasser stand zwar tief, strömte aber doch infolge der grossen Enge des Flussbettes sehr heftig; dabei entstanden an den zerklüfteten Ufern ständig Wirbel und Strudel, die unserem grossen Boote nicht viel anhaben konnten, aber immerhin mit grosser Anspannung überwunden werden mussten. So lange die Ufer noch schräg aufstiegen und aus stark verwittertem Gestein bestanden, boten sie den Haken der Bootsstangen einen genügenden Halt und wir gelangten schnell vorwärts. Weiter aufwärts verengte sich aber das [20] Bett immer mehr und die felsigen Ufer wurden immer steiler, bis sie zuletzt lotrecht aufstiegen; dabei war das Gestein so hart und glatt, dass es selbst für die eisernen Haken keine Unebenheiten oder Spalten als Angriffspunkte bot. An der engsten Stelle konnte das Boot auf keine Weise vorwärts und wurde dreimal zurückgetrieben. Sorong, die Kajan und die Bemannung des kleinen Bootes kamen uns zu Hilfe; sie ruderten weiter hinauf bis zu einer Stelle, wo sie auf den horizontal vorstehenden Sandsteinschichten hinaufklettern und einen Platz erreichen konnten, der sich mehr als 20 m über unserer schwierigen Passage befand. Von oben warfen sie uns ein Stück Holz an einem langen Rotangseil in den Fluss zu, das von unserem Boote aus aufgefischt wurde, vorauf die Männer den Rotang an diesem befestigten. Das Boot wurde nun so weit aufwärts gezogen, bis die Felsen wieder eine genügende Menge Höhlungen und Spalten zum Einschlagen der eisernen Haken boten. Von hier an konnten wir uns selbst weiterhelfen, indem wir uns vorsichtig an den steilen Felsen festklammerten. Es war aber Abend geworden, bevor wir an einer Geröllinsel oberhalb des Kiham Halo anlegten. Meine Mannschaft freute sich über das gelungene Wagstück ebenso sehr wie ich und drückte trotz des anstrengenden und ermüdenden Tages ihre Genugtuung darüber aus, dass sie das grösste Boot und die schwerste Ladung, die jemals über den Kiham Halo gefahren waren, ohne Unfall hinaufgeschafft hatte. In dem angenehmen Bewusstsein, mit meinem Gepäck bereits so weit gefördert zu sein, schlief ich in meinem Boot neben der grossen Sandbank ein, auf der die Uma Mĕhak und unsere Kajan sich neben einander niedrige Hütten aufgeschlagen hatten. Beim Erwachen am anderen Morgen bemerkte ich zu meinem Schrecken, dass mein Boot sich völlig schief dem Flusse zuneigte, da das Wasser nachts gefallen war und das Fahrzeug an der schräg ansteigenden Seite der Sandbank lag. Wenige Zentimeter weiter, und das ins Boot strömende Wasser hätte dieses zum Umschlagen gebracht und ich hätte mich in meinem Moskitonetz unter dem Palmblattdache nur schwer retten können. Die Männer schoben das Boot eiligst vom Wall ins Wasser. Früh morgens zahlte ich den Männern aus Uma Mĕhak ihren Lohn aus, schenkte ihnen in meiner guten Stimmung noch etwas Salz und Tabak und liess sie sogleich heimkehren. Sarong und seine Leute, mit denen ich allein zurückblieb, zogen das Boot an einem Rotangseil bis zu einem Nebenflüsschen hinauf, wo es sicherer als an der engen Stelle beim Kiham Halo untergebracht war. Zwei Tage darauf langten [21] auch Kwing Irang, Demmeni und Bier bei uns an; letzterer hatte mit Erfolg gearbeitet und das noch fehlende Stück des Mahakam oberhalb Uma Mĕhak und den Bunut bis zur Wasserscheide mit dem Murung hinauf gemessen.
Die Kajan brachten ihre Böte und ihr ganzes Gepäck an diesem Tage noch über den Udang bis oberhalb des Batu Brang; abends jedoch kehrte Kwing mit fast allen seinen Männern und einigen leeren Böten zu uns zurück, weil er uns aus Ängstlichkeit in dieser Umgebung nicht allein übernachten zu lassen wagte. Dank dem niedrigen Wasserstande wurden unsere Böte schnell den Fluss hinauf gerudert und an schwierigen Stellen wie gewöhnlich mit Rotangseilen dem Ufer entlang gezogen. Unser Gepäck brauchte sogar am Kiham Udang nicht über Land getragen zu werden, da das Wasser selbst an dieser engen Stelle augenblicklich tief stand. Der Udang bot jetzt ein ganz anderes Bild als das vorige Mal. Die Ufer bestanden nun einige Hundert Meter weit aus zahllosen, unregelmässigen, weissen Konglomeratblöcken, die unter der dunkelgrünen Masse des Urwaldes in der Mittagssonne hell hervorschimmerten. Im Kiham Udang selbst lehnten sich die Felsmassen, die bei Hochwasser völlig überschwemmt werden, turmhoch gegen die Bergwand an. An diesem Tage erreichten wir noch die Geröllbank oberhalb des Batu Brang und am folgenden Tage Long Dĕho.
Die Kajan zeigten sich jetzt, nachdem sie uns so weit gebracht hatten, nicht geneigt, uns und unser Gepäck auch noch weiter zu befördern, was Kwing Irang uns am folgenden Morgen mit verlegenem Gesicht mitteilte. Die Leute meinten, es würde ihnen unmöglich sein, in der nun folgenden langen Reihe der westlichen Wasserfälle, in denen das Gepäck mehrmals über Land getragen werden musste, mehr als ihr eigenes Hab und Gut mitzuführen. Sie hatten, wie es sich später erwies, vollständig Recht, da sie trotz des sehr günstigen Wasserstandes bis Long Tĕpai vier Tage unterwegs gewesen waren. Im Augenblick jedoch lautete Kwing Irangs Mitteilung entmutigend, trotz seines Versprechens, uns sobald als möglich durch die Long-Glat aus Long Tĕpai abholen zu lassen. Es blieb mir nun nichts anderes übrig, als aus der Not eine Tugend zu machen und zu versuchen, die Dorfbewohner auch hier durch Liebenswürdigkeit für uns einzunehmen.
Die vielen Frauen aus Bo Adjāngs amin suchten uns den Aufenthalt durch Freundlichkeit und Hilfeleistungen aller Art so angenehm als möglich zu machen—da sie ihrerseits allerhand von uns nötig hatten, [22] freuten sie sich mit allen Dorfbewohnern über unseren gezwungenen Aufenthalt. Am dringendsten bedurfte meiner wieder der alte Bo Adjāng, der in der letzten Zeit wieder stark an Malaria gelitten hatte und bei seinem Alter sehr schwach war; es dauerte auch mehrere Tage, bis ich ihn mit Chinin, grosser Ruhe und geeigneter Nahrung etwas herauf brachte. Zum Glück hing der Alte, trotz seiner gegenteiligen Behauptung, noch so sehr am Leben, dass ihm das bittere Chinin nie zu viel wurde. Ausser ihm hatten auch noch viele andere meine ärztliche Hilfe nötig.
Ich hatte nun Zeit, meine früher angefangenen Unterhandlungen wegen verschiedener schöner Gegenstände fortzusetzen, stiess hier aber auf grössere Schwierigkeiten als bei den Kajan, die sich an diesen Handel bereits gewöhnt hatten. Ein übler Umstand war, dass Long Dĕho in den letzten Jahren schwere Zeiten durchgemacht hatte und Lebensmittel dort immer sehr schwer zu kaufen waren. Nirgends hörte ich so viel über Missernten klagen, wie hier. Sehr nachteilig wirkte auf den Ackerbau der Umstand, dass Long Dĕho ein Zentrum für Spiel und Hahnenkämpfe bildete und die Dorfbewohner unwillkürlich in dieses Leben und Treiben hineingezogen wurden.
Viele Bewohner von Long Dĕho nährten sich aus Reismangel mehr von Bataten als von Reis, und die anderen Stämme nahmen Reis mit nach Long Dĕho, um ihn dort vorteilhaft zu verkaufen.
Die ganze Zeit über, die wir in Long Dĕho verbrachten, hielt Bang Jok sich in Uma Mĕhak auf, weil er uns nach seinem Aufenthalt in Tengaron nicht begegnen wollte. Angenehme Erinnerungen brachte er von seinem Besuch beim Sultan jedenfalls nicht mit, denn dieser hatte ihm den Untertaneneid abgezwungen und ihn ausserdem ohne die üblichen Geschenke abreisen lassen, auch hatte er beim Spiel so viel verloren, dass er sich an der Küste nicht einmal Salz und Tabak hatte kaufen können.
Die Bevölkerung zeigte sich jetzt durchaus nicht mehr zurückhaltend, wir verkehrten daher mit allen auf gutem Fuss. Am meisten Entgegenkommen fanden wir, wie gesagt, bei Bo Adjāngs Familie, mit deren Hilfe ich nochmals den Batu Ajo bestieg, einen Bergzug, der sich am rechten Mahakamufer in Gestalt einer 1000 m hohen, senkrechten Mauer erhob. Ich hatte diesen Berg als erster Europäer bereits im Jahre 1897 bestiegen und mich damals bereits davon überzeugt, dass er wenigstens nach Norden und Osten einen weiten Ausblick bot; [23] gelang es uns nun, seinen nördlichsten Endpunkt zu erreichen, so versprach er uns auch nach Westen eine freie Aussicht. Vom Batu Ajo aus liess sich vielleicht die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Besteigung des Pajang beurteilen, der sich, von Long Dĕho gesehen, als steiler Berg aus der Ebene erhob. Obgleich Demmeni für Bergbesteigungen nicht viel Sinn hatte, forderte ich ihn doch zum Mitgehen auf, weil die Moosvegetation auf dem Gipfel des Batu Ajo einer Aufnahme wert war. Als Führer und Träger nahm ich die gleichen Leute aus Uma Wak mit, die mich das vorige Mal begleitet hatten.
Diese wählten diesmal einen anderen Weg: von Long Dĕho setzten wir auf das andere Ufer über, folgten zwischen Reisfeldern einem direkt zum Batu Ajo führenden Pfade und erstiegen dann einen Rücken, der uns schnell nach oben brachte. Da wir uns hier durch alte, nur mit Gestrüpp bewachsene und daher schattenlose Reisfelder hindurcharbeiten mussten, zwang uns die Hitze bereits nach einer Stunde zum Rasten. Zu unserer Freude befanden wir uns hier am Rande des Waldes, neben dem alten Reisfelde des Ibau Adjāng, der mit seiner Frau Dĕwong gerade damit beschäftigt war, die Ananasse zu schneiden, welche die Wildschweine noch übrig gelassen. Sie hatten die Pflanzen dicht neben einander gesetzt, so dass die Tiere sich nur der äussersten Früchte hatten bemächtigen können, weil die in starke, scharfe Stacheln auslaufenden Blätter auch einer Schweinshaut gefährlich werden. Die kühlen, saftreichen Früchte liessen uns die Ruhe zwar doppelt geniessen, aber wir betraten doch gern den Urwald, in dessen Schatten es sich besser steigen liess, als im Sonnenbrand auf den verwilderten Feldern.
Der Pfad, dem wir folgten, war früher häufig von Kahájan-Dajak, die auf dem Batu Ajo Guttapercha suchten, und von den Bewohnern aus Uma Wak, die ihren Reis zum Verkauf an die Buschproduktensucher hinaufbrachten, benützt und vom Unterholz befreit worden. Daher hatten wir auch Uma-Wak als Führer genommen; die Bewohner von Long Dĕho kamen für gewöhnlich nicht so weit den Berg hinauf und hatten ihn auch noch nie erstiegen.
Unmittelbar vor dem Eintritt in den Urwald wurde der Aufstieg sehr steil, aber indem ich ununterbrochen vorwärts ging, war ich den schwer beladenen Trägern bald voraus, so dass ich mit zwei Männern aus Uma Wak als erster die senkrechte Sandsteinwand erreichte, gegen welche die Bäume unmittelbar anwuchsen. Die Wand bestand [24] aus horizontalen, über 20 m mächtigen Schichten, von denen einige vor, andere zurücksprangen, alle aber mit grünen, grauen und braunen Moosen und Flechten bedeckt waren und von dem ständig abströmenden Wasser trieften; höhere Pflanzen waren an diesen Felsen nicht zu sehen. Der Führer bog links ab und wir folgten ihm, über bemooste, den Waldgrund bildende Sandsteinblöcke auf und absteigend, auf einem Pfade, der die mehr oder weniger gut passierbaren Stellen verband. Über eine Stunde weit nach Süden der Felswand entlang gehend, gelangten wir an einen Kamin in der fast überall senkrechten Wand und stiegen nun auf einer Schutthalde bis zum Rande des Plateaus hinauf. Über einige Felsvorsprünge gelangten wir völlig nach oben, wo uns eine neue Welt empfing. Im Vordergrunde glich das völlig ebene Gelände einem Hochmoor, im Hintergrunde hingen an Lianen, welche kleine, dünne Bäume verbanden, Moosmassen und bildeten so 4–6 m hohe, zusammenhängende Wände. Jeder Ausblick war genommen; die ersten besten Durchgänge mussten benützt und die Richtung mittelst des Kompasses eingehalten werden. Vorläufig hatten wir nicht weit zu gehen, denn wir stiessen sehr bald auf das Gerüst einer Hütte der Kahájan-Dajak, die zwar sehr verfallen war, aber bald wieder aufgerichtet werden konnte. Die beiden Männer machten sich auch sogleich ans Werk. Dem Rande des Plateaus mich nähernd, hörte ich einige Schüsse fallen; die Nachzügler wussten augenscheinlich den Weg nicht, daher antwortete ich mit Revolverschüssen. Bald darauf kletterte denn auch der eine nach dem anderen längs der Schutthalde herauf. Mit der bekannten Geschicklichkeit der Bahau stellten diese die Gerüste für die Hütten auf und deckten sie mit Segeltuch oder Palmmatten, so dass wir noch vor Einbruch der Dunkelheit für die topographischen und photographischen Aufnahmen geeignete Standpunkte auszusuchen Zeit fanden.
Am anderen Tage machten sich Bier und Demmeni sogleich an die Arbeit, worauf dieser nach Long Dĕho zurückkehrte; unterdessen suchte ich mit einigen der tüchtigsten Begleiter den westlichsten Gipfel des Batu Ajo zu erreichen, der uns einen Ausblick nach Westen gestatten musste. Das Gelände bot viele Schwierigkeiten, und nur indem wir ständig den Kompass gebrauchten und uns dicht aneinander hielten, bewegten wir uns mit einiger Sicherheit vorwärts. Anfangs folgten wir einigen Pfaden der Buschproduktensucher und gingen bisweilen auf den von diesen gefällten und angezapften Guttapercha-Bäumen, doch [25] weiterhin mussten wir uns Öffnungen in den Mooswänden suchen oder selbst machen, dabei zwangen uns die zahllosen umgestürzten Bäume, die in dieser Höhe nur langsam zu verwesen schienen, über sie hinweg oder unter ihnen hindurch zu klettern. Die Moosmassen, welche mit Wasser vollgesogenen Schwämmen glichen, durchnässten mich in kaum einer halben Stunde. Tierisches Leben machte sich hier viel weniger als unten im Walde bemerkbar; den ganzen Tag über hörten wir kaum einen Vogel oder eine Zikade. Auch Rhinozerosse, von denen wir zahlreiche Spuren beim Aufstieg gesehen hatten, schienen diese trostlose Gegend zu fliehen; wenigstens bemerkten wir hier nichts von ihnen. Der Batu Ajo erwies sich bald als kaum einen Kilometer breit, und da wir zum Murung hin nichts als benachbarte, mit Urwald bedeckte Rücken sahen, suchte ich weiter nach Norden durchzudringen, wo das Gelände etwas anstieg. Nachdem wir verschiedene Punkte besucht hatten, erklommen wir gegen 2 Uhr einen steilen, vorspringenden Gipfel, zu dem wir uns über und unter moosbedeckten Wurzeln stehender und gefallener Bäume einen Weg bahnen mussten.
Von hier aus sahen wir nun zwar über die Wälder unter uns hinweg ins Murunggebiet, aber da wir immer noch keinen festen Boden unter den Füssen hatten, sondern ständig mit Moosmassen, die auf einem Chaos von Bäumen ausgebreitet lagen, kämpfen mussten, war hier kein fester Punkt zu finden, von dem aus Peilungen in nordwestlicher Richtung vorgenommen werden konnten.
Mit Hilfe des Kompasses fanden wir uns auf dem am Morgen begangenen Pfad nur schwer wieder zurück, und so langten wir erst um 6 Uhr abends, beim tiling duān (Zirpen der Grille) am Lagerplatz an. Auch in dieser Höhe begann bei Sonnenuntergang eine bestimmte Grillenart zu zirpen und hörte nach einer Viertelstunde wieder auf. Die Töne klangen anders als in den tiefer gelegenen Wäldern; wahrscheinlich gehörte auch die Grille einer anderen Art an. Unter Hunderten von Grillenarten, die den ganzen Tag über in den Bergwäldern Borneos die verschiedensten Laute ertönen lassen, hört man beim Auf- und Untergang der Sonne eine Viertelstunde lang nur zwei bestimmte Spezies und zwar so regelmässig, dass die Bahau den Augenblick vor Sonnenuntergang als “tiling duān” bezeichnen.
Am Lagerplatz war noch niemand angekommen, worüber ich mich zu ängstigen begann. Ich feuerte einige Gewehrschüsse ab, hatte aber wenig Hoffnung, von Bier und dessen Begleitern gehört zu werden, [26] da ich des Morgens bereits beobachtet hatte, dass Schüsse in dieser Moosvegetation bereits auf geringen Abstand nicht mehr gehört werden. Die Nacht war beinahe völlig hereingebrochen, als wir in südöstlicher Richtung endlich schiessen zu hören glaubten. Nur durch unsere Antwort fand Bier den Weg zu unserem Lagerplatz zurück. Die ersten Schüsse hatte er nicht vernommen.
Gleich nach unserer Ankunft hatten wir unsere durchnässte Kleidung mit einer trockenen vertauscht. Bier wollte jedoch noch von einem von mir gefundenen Punkte aus Peilungen vornehmen, und so zogen wir am folgenden Morgen wieder die nassen Kleider an und schickten uns an, an der betreffenden Stelle einen Beobachtungsposten zu errichten.
Vor dem Frühstück suchte ich noch den Aussichtspunkt zu erreichen, den Bier tags zuvor für seine Aufnahme hatte aushauen lassen. Wie ich bereits vermutet hatte, genossen wir hier das gleiche herrliche Panorama wie auf dem Batu Mili: wir befanden uns über einem die Landschaft unter uns völlig bedeckenden Nebelmeer, das, von der Sonne mit blendend weissem Lichte bestrahlt, nur einige dunkle Gipfel hervorragen liess. Rechts schien die Bergkette, die sich jenseits des Mobong parallel dem Batu Ajo hinzog, das Wolkenkleid zu heben, das in mächtigen, welligen Falten längs den Abhängen auf das Nebelmeer im Tal, des Mobong niederfiel. Der Wechsel von Hell und Dunkel, den die noch tiefstehende Sonne in diesem Teil des Panoramas hervorrief, war von wunderbarer Schönheit; ich trennte mich nur schwer von dem entzückenden Bilde.
Nach dem Morgenimbiss fanden wir einen Felsvorsprung, der für unsere Zwecke geeignet sein konnte; doch bedeckten auch hier Bäume, Lianen und Moose den Erdboden. Alles fortzuschaffen war unmöglich, daher liess ich nur so viel aushauen, dass auf einigen Baumstümpfen eine Diele angebracht werden konnte. Bier begann seine Arbeit erst um 11 Uhr, als die Wolkenmassen von unten herauf an uns vorübergezogen waren. Leider kamen auch nicht alle Berge zum Vorschein, sondern die Aussicht wurde erst im Lauf des Tages in verschiedener Richtung abwechselnd frei. Dank unserem aus der Bergwand hervortretenden Standplatz überblickten wir einen weiten Gesichtskreis. Vor uns sahen wir das Gebirge, das sich in gleicher Entfernung vom Batu Ajo hinzieht, von diesem durch das Tal des Mobong geschieden. Der Kiham Udang befand sich dort, wo der Mahakam diese Gebirgskette [27] an ihrem nördlichsten Punkt durchbricht, so dass das Gebirge, nach unseren im Udang gemachten Beobachtungen, gerade wie der Batu Ajo, aus Sandsteinschichten, die mit Konglomeratschichten aus rundgeschliffenen Kieseln abwechseln, bestehen muss. An der Ostseite dieser Kette muss der Kiham Halo liegen, der von horizontalen Sandsteinschichten begrenzt wird. Uns gegenüber, jenseits des Mahakam, wurde auch der Pajang sichtbar. Es erwies sich, dass dieser kein steiler, kegelförmiger Berg ist, wie er uns von Long Dĕho aus erschien, sondern den höchsten Gipfel einer Kette vorstellt, die sich von einem viel nördlicher gelegenen, ungefähr 2000 m hohen Bergmassiv zum Mahakam hinzieht. Die beschränkte Aussicht, die der Pajang uns geboten hätte, liess uns von einer Besteigung desselben absehen. Da unser Standort nur wenig über 1000 m lag, wurde uns die Aussicht nach Nord-Westen durch den Niaan und andere höhere Berge benommen. Nach Osten blieb das Mahakamtal ständig in Wolken gehüllt.
Als wir abends ins Lager zurückkehrten, hatten wir die vorgenommene Aufgabe gelöst. Die Nacht war aussergewöhnlich hell und kalt und so still, dass wir die kleinen Quellflüsse des Barito, der an der Westseite des Batu Ajo entspringt, murmeln hörten.
Den folgenden Tag ging es den Berg weit schneller hinunter als hinauf, und vormittags befanden wir uns bereits wieder in Long Dĕho, wo uns gute Nachrichten erwarteten. Ein Boot aus Long Tĕpai kam melden, man sei wegen des Neujahrsfestes verhindert gewesen, uns abzuholen. Man hätte das Fest nicht aufschieben können, weil viele Menschen darauf warteten, das lāli für ihr neu gebautes Haus oder ihre Heirat bei dieser Gelegenheit abzulegen. Nach viertägigem Fallen des Wassers erschien zuerst ein Boot mit Manok-Kwee unter Anführung von Bang Lirung und am folgenden Tage gegen Mittag Tului Lea mit Bo Ului und Bo Tijung, im ganzen 40 Mann. Njok Lea selbst hatte nicht mitkommen wollen, weil er mich durch seine Abreise von Udju Tĕpu erzürnt zu haben glaubte. Die Männer beeilten sich mit der Abfahrt, da sie den günstigen Wasserstand benützen und mit der Feldarbeit, die sie bereits so lange aufgeschoben hatten, beginnen wollten.
Der Abschied von Long Dĕho tat sowohl uns als der Bevölkerung leid; alle hatten uns Gutes erwiesen, und wenn die Kajan nicht versprochen hätten, uns zu den Kĕnja zu begleiten, wären wir hier noch gern etwas länger geblieben. [28]
Mit Rücksicht auf unseren Zug zu den Kĕnja, der längs des oberhalb Long Dĕho in den Mahakam mündenden Boh stattfinden sollte, hinterliess ich einen Teil unseres Gepäckes, der nicht leicht verderben konnte, in der amin Adjāngs. Ibau versprach, auf alles zu achten, und so übergab ich ihm 40 Blechkisten mit Salz, 5 Packen mit 100 Stück Kattun und 12 Holzkisten, hauptsächlich Konserven enthaltend; unsere Böte wurden dadurch erheblich entlastet. Trotzdem der Fluss sehr niedrig stand, musste das Gepäck doch an mehreren Stellen längs des Ufers getragen werden, so dass unsere Reise nach Long Tĕpai vier Tage dauerte.

Der Kiham Lobang Kubang.
Wir zogen diesmal in die Galerie von Bo Ibau ein, weil in der von Bo Lea Buschproduktensucher einquartiert waren. Durch den Pnihinghäuptling Taman Lirung vom Howong, der bei den Long-Glat Schwerter eingekauft hatte und wieder aufwärts reiste, liessen wir Kwing Irang melden, dass wir die Wasserfälle überschritten hätten. Da wir acht Tage lang nichts von oben hörten und schon in Long Dĕho Gerüchte über aufregende Ereignisse am Blu-u umgingen, sandte ich ein Boot mit Umar und Dĕlahit zu den Kajan, um zu sehen, wie es mit dem Abholen stünde. Nach echt malaiischer Art scheuten sich aber beide, ungünstige Nachrichten mitzuteilen, und so erfuhr ich bei ihrer Rückkehr nicht viel Neues. Doch bestätigten sie das Gerücht, man habe, während Kwing Irang sich auf Reisen befand, die Leiche der verschwundenen Anja Song unter einer Sagopalme mit abgeschnittenem Kopf und Bein versteckt gefunden; schlimmer noch war, dass der halb wahnsinnige Batang-Lupar Umar aus Hadji Umars Gesellschaft nachts, kurz vor Kwing Irangs Rückkehr, fünf Männer im Hause zu Long Bulèng mit einem Schwerte verwundet hatte und dann in den Wald geflohen war. Später hatte er noch einen kränklichen Mann, der mit Kwing Irang zurückgekehrt war, auf dem Wege zu seinem Reisfelde ermordet. Die Kajan hatten, da sie den Wahnsinnigen weder fangen noch töten konnten, einen Monat lang in grosser Aufregung gelebt, bis es endlich zwei Malaien gelungen war, den Mann durch List in eine Hütte zu locken, zu entwaffnen und niederzumachen. Erst darnach hätten die Dorfbewohner ernsthaft mit der Feldarbeit zu beginnen gewagt, so dass es ihnen augenscheinlich sehr schwer fiel, uns abzuholen, was Kwing Irang nicht hatte sagen wollen oder Dĕlahit aus Furcht vor meiner Unzufriedenheit sich nicht zu erzählen getraute. Doch waren mir derartige Verhältnisse [29] bei den Leuten allzu bekannt, um noch an ihnen zu zweifeln; da ich ausserdem hörte, dass binnen weniger Tage bei den Kajan das lāli nugal stattfinden sollte und die Long-Glat uns später, wegen des auch bei ihnen eintretenden lāli nicht abreisen lassen würden, ging ich ein auf den Vorschlag der Malaien, die nach dem Tode Hadji Umars mit dessen Frau und Kindern nach Long Tĕpai nachgezogen waren, nahm sie in meinen Dienst und liess mich von ihnen nach Long-Blu-u bringen. Demmeni und Bier blieben mit einigen unserer Leute und dem grössten Teil des Gepäcks in Long Tĕpai zurück. Ich selbst nahm nur zwei Böte mit und langte bereits zwei Tage nach Dĕlahits Rückkehr nach Long Tĕpai in Long-Blu-u an. Unterwegs erzählten mir die Malaien, die Händler in Udju Tĕpu hätten alles Hab und Gut von Hadji Uniar in Beschlag genommen, um seine Schulden zu bezahlen, sie hätten auch Umars Frau und Kinder nicht fortziehen lassen wollen, bis sie durch meinen Brief aus Long Dĕho eingeschüchtert worden seien. Man hatte mir nämlich dort mitgeteilt, dass Umars Frau und Kinder und alle seine Malaien wegen Schulden, für die er Bürgschaft geleistet hatte, dort zurück gehalten würden. Da Hadji Umar in Wirklichkeit ein wohlhabender Mann war, sein Besitz aber hauptsächlich in Forderungen an weit und breit im Innern von Borneo zerstreute Leute bestand und daher in einem bestimmten Augenblick nicht eingefordert werden konnte, kam es mir sehr ungerecht vor, seine Familie leiden und womöglich in Schuldsklaverei geraten zu lassen. In Ermangelung einer anderen Autoritätsperson sandte ich selbst von Long Dĕho aus dem einflussreichsten Bandjaresen in Udju Tĕpu einen Brief, in dem ich den Wunsch aussprach, dass man Uniars Familie und alle seine Malaien ungehindert hinaufziehen lassen sollte. Die Händler erfüllten auch wirklich meinen Wunsch, behielten aber den grössten Teil von Umars Besitz zurück. Dass seine Malaien nun selbst gern in meine Dienste treten wollten, kam mir in diesem Augenblick ausgezeichnet zu statten.
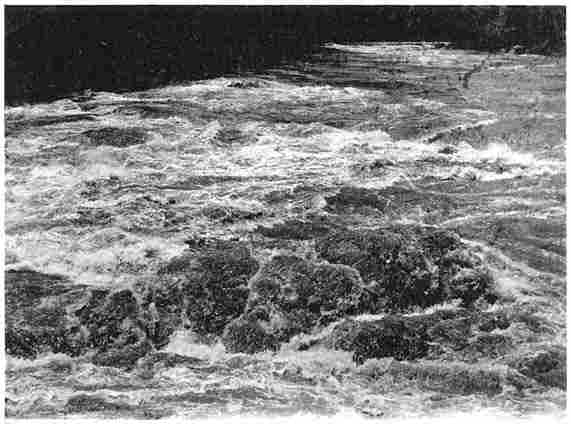
Der Kiham Lobang Kubang.
Bei unserer Ankunft abends in Long Blu-u bot Kwing Irang mir sogleich die eine, etwas erhöhte Seite seiner amin als Wohnstätte an, auf der ich es mir mit meinem Diener Midan und meinem Hunde sogleich gemütlich machte. Es war ihm sehr angenehm, dass ich mir selbst geholfen hatte und er mir nicht sogleich Leute entgegenzuschicken brauchte. Dass er mich bei unserer Rückreise nicht besser hatte unterstützen können, tat ihm sehr leid, aber er hatte gegen die [30] ungünstigen Verhältnisse nicht aufkommen können. Die Kajan hatten seit meiner Abreise in der Tat viel durchgemacht und berichteten mir gleich am folgenden Morgen die Einzelheiten.
Zuerst hatte Anja Songs Tod die Dorfbewohner in Aufregung versetzt. Über das Geheimnis, das ihren Tod umgab und die Rolle, welche die Geisterwelt dabei gespielt haben sollte, begannen in der Überzeugung der Leute Zweifel zu entstehen, und die Vorstellung, dass Anjang Bawan seine Frau, wahrscheinlich aus Eifersucht, selbst getötet hatte, gewann immer mehr Glauben. Kwing Irang und sein Ratgeber Sorong waren bereits während meines Aufenthaltes in Uma Mĕhak zu mir gekommen und hatten mich im Geheimen gefragt, ob ich nicht auch der Ansicht wäre, der Mann habe seine Frau selbst ermordet. Da der Vater des Mörders, Bo Bawan, zu den vornehmsten Priestern gehörte, wagten die Leute ihre Überzeugung nicht zu äussern und liessen die Angelegenheit ruhen. Wahrscheinlich wäre ich diesem Beispiel gefolgt, wenn man nicht meine Person in die Sache hineingezogen hätte. Um die Geister des Batu Mili zu beruhigen, hatte man nämlich eine Opferfeier gehalten, deren Leitung Bo Bawan unter Beistand des Bandjaresen Utas und eines Malaien vom Kapuri, Totong, übernommen hatte. Nun erklärten diese beiden, in der darauffolgenden Nacht geträumt zu haben, die Geister des Batu Mili hätten sich darüber erzürnt, dass ich beim Besteigen des Berges das Gestrüpp hatte umhacken lassen, wodurch der Boden für die Hühner und Schweine der Geister unbrauchbar geworden wäre. Jetzt, wo sie mir die Schuld an Anja Songs Tode zuzuschieben suchten, blieb mir nichts anderes übrig, als öffentlich zu erklären, was die anderen im Grunde selbst glaubten, nämlich dass Anjang seine Frau einfach selbst ermordet und ihre Leiche unter einer Palme versteckt hatte. Ich machte immer wieder darauf aufmerksam, dass die Geister sicher nicht den Kopf und die Beine vom Körper getrennt haben würden und es überdies bekannt war, dass das Ehepaar in Unfrieden lebte.
Kaum waren die Bewohner von Long Blu-u zur Feldarbeit zurückgekehrt, mit der sie infolge des langen Suchens nach Anja Song, das sehr viele Menschen beansprucht hatte, im Rückstand waren, als der von Umar verübte Mord die Gemüter aufs neue erregte und alle, deren Felder jenseits des Mahakam lagen, wohin Umar geflohen war, wiederum an der Arbeit verhinderte. Da der Mörder erst nach einem Monat getötet werden konnte, hatte man viel Zeit verloren. Auch an [31] diesem Unglück schrieb man mir die Schuld zu, indem ein Priester der Pnihing, der sich aufs Träumen verstand, es für eine Strafe der Geister erklärte, die darüber erzürnt wären, dass die Kajan so viele Insekten für mich gefangen und mir verkauft hätten. Augenscheinlich spielte der Neid der Pnihing wegen der grossen Vorteile, welche die Kajan aus unserem Aufenthalt bei ihnen zogen, hierbei eine grosse Rolle, doch gelang es dem Priester, auch meine Kajanfreunde von meiner Schuld zu überzeugen, so dass sie mir während meines späteren Aufenthaltes unter ihnen kein einziges Insekt mehr bringen wollten. Dass die Leute nach allen diesen Ereignissen keine Lust mehr verspürten, uns in ihren Stamm zurückzuholen, war begreiflich, überdies wussten sie, dass ich zu ihnen zurückkehrte, um sie an ihr Versprechen, uns zu den so sehr gefürchteten Kĕnja zu begleiten, zu mahnen.
Sehr eigentümlich berührte mich das Bewusstsein, mich unter einer mir befreundeten Bahaubevölkerung zu befinden und dabei doch machtlos zu sein, gegen alle diese offenbaren Lügen und Betrügereien, welche die religiösen Überzeugungen des Volkes zum Deckmantel genommen hatten, aufzutreten. Ich sprach zwar meine Ansichten immer wieder offen aus, wusste aber zu gut, wie wenig Eindruck sie auf die Masse machten, um mich viel mit ihr abzugeben. Weit mehr Hoffnung setzte ich auf den Einfluss persönlicher Sympathie und die vielen Wohltaten, die ich der Bevölkerung erwiesen hatte und noch erweisen wollte, um unser früheres Verhältnis wiederherzustellen.
Meine Versuche, Bier und Demmeni noch vor dem tugal (Saatfest) von Long Tĕpai abholen zu lassen, gab ich sogleich auf, liess ihnen aber durch mein eigenes Personal einige Kisten bringen, die sie für einen längeren Aufenthalt nötig hatten. Vorläufig ging ich vorsichtshalber nur in Gesellschaft eines bewaffneten Malaien durch die Niederlassung. Bo Hiāng, Kwing Irangs erste Frau, schlug mir zwar anfangs vor, den Geistern des Batu Mili ebenfalls ein Opfer zu bringen, um sie mit mir zu versöhnen, als ich ihr aber bedeutete, dass die Geister meiner Überzeugung nach mit den beiden Ereignissen nichts zu schaffen hätten, drang sie nicht weiter in mich.
In den ersten Tagen gaben mir die fünf malaiischen Männer in Long Bulèng, die durch Umau ernstlich, wenn auch nicht tätlich, verwundet worden waren und deren Wunden sich infolge schlechter Pflege während eines Monats etwas entzündet hatten, viel zu tun. Sobald ich [32] aber erfuhr, dass auch diese Malaien die beiden Morde benützt hatten, um mich bei der Bevölkerung verhasst zu machen, verweigerte ich ihnen weitere Hilfe. Um den wahren Mörder der Anja und meine Verleumder einzuschüchtern, erklärte ich, dass der Kontrolleur, sobald er sich am Mahakam als niederländischer Beamter niedergelassen haben werde, die Sache näher untersuchen würde. Dadurch enthob ich die vornehmsten Mantri der unangenehmen Pflicht, dies selbst zu tun, und jagte dem Schuldigen, der sich übrigens bei mir nicht zu zeigen wagte, einen heilsamen Schreck ein.
Gleich nach meiner Ankunft hatte Kwing Irang mit einigen Männern mein Haus auszubesseren angefangen, da man in meiner Abwesenheit das beste Material, besonders die guten Bretter der Diele, zu anderen Zwecken benützt hatte. In wenigen Tagen konnte ich die Wohnung wieder beziehen. Der Sicherheit wegen liess ich einige meiner Malaien neben mir schlafen.
Die Dorfbewohner beschlossen nun, in aller Eile das Saatfest zu feiern, das infolge jener Zwischenfälle bereits viel zu spät eintrat. Während der ersten achttägigen Periode des me̥lo̱ besserte sich die Stimmung der Bevölkerung soweit, dass bereits zwei Tage nach dem Maskenspiel (den Tag darauf hatte man das Feld des Häuptlings besät) eine genügende Anzahl junger Männer sich bereit erklärte, Bier und Demmeni aus Long Tĕpai abzuholen. [33]
Kapitel II.
Der mittlere Mahakam und seine Bewohner—Auswanderungen aus dem Stammland—Degeneration der Stämme im Tieflande—Verhältnis der Niederlassungen zu einander—Einfluss des Sultans von Kutei auf die Dajakhäuptlinge—Die Niederlassung Long Dĕho und ihr Oberhäuptling Bang Jok—Die Punan als Kopfjäger—Verhältnis zwischen den Kĕnja und Bahau—Der degenerierende Einfluss der Malaien auf die Dajak—Erhaltung der ursprünglichen Sitten und des Kultus der Dajak am mittleren Mahakam—Tundjung- und Kĕnjastämme—Verhältnis der Bewohner des oberen zu denen des mittleren Mahakam.
Nicht nur zum besseren Verständnis des ferneren Verlaufs unserer Reise, sondern auch an und für sich verdienen die geographischen und ethnologischen Verhältnisse am mittleren Mahakam eine eigene und ausführlichere Besprechung, als sie bis jetzt in der Reiseerzählung hatte gegeben werden können.
Der Mittel-Mahakam befasst den Teil des Stromes, der zwischen den westlichen Wasserfällen und Udju Tĕpu liegt und schliesst die östlichen Fälle in sich ein. Er wird gänzlich von zahlreichen, aber kleinen Stämmen bewohnt, die sich beinahe alle noch an ihre Auswanderung aus dem hochgelegenen Stammlande Apu Kajan in dieses Tiefland erinnern. Weitaus die meisten derselben haben sich am Hauptstrom niedergelassen, nur wenige wohnen an seinen Nebenflüssen. Die wichtigsten von diesen sind: der Alān, Mĕrah, Mĕdang und Pari am linken, der Bunut und Rata am rechten Ufer. Der Mĕrah ist insofern von Bedeutung, als man von seinem Oberlauf in einem halben Tage über Land an einen befahrbaren linken Seitenfluss des Lèn oder Tatyang gelangt, eines sehr grossen Flusses, der in den Unterlauf des Mahakam mündet und an dem sich der Kĕnjastamm der Uma-Timé und andere Stämme der Bahau, wie die Long-Bila, angesiedelt haben. Der Bunut und der Rata bilden zwei viel benützte Verbindungen zwischen dem Gebiet des Mahakam und dem des Barito. Längs des Bumst erreicht man in einem Tage den Murung; vom Rata führen Landwege nach dem Murung und dem Maruwi. [34]
Was die Bevölkerung am mittleren Mahakam betrifft, so bilden am Hauptfluss selbst Mujub und Udju Tĕpu, wo der Stamm der Tring-Dajak lebt, ihre ersten Siedelungen; weiter aufwärts, in Ana, wohnen die Hwang-Ana, in Long Tram die Hwang-Dāli, in Udju Halang die Uma-Luhat, in Lirung Kĕdawang die Uma-Mĕhak, in Sirau die Hwang-Sirau, in Long Way und Long Howong die Long-Way, in Boh die Long-Boh, in Laham die Uma-Laham, in Uma-Wak und Long Asa die gleichnamigen Stämme, in Uma-Mĕhak ein anderer Teil der Uma-Mĕhak und ein Teil der Uma-Tuwan. Die jetzt in Long Dĕho angesiedelten Stämme: die Long-Glat, ein Teil der Uma-Tuwan, Batu-Pála und Uma-Wak lebten bis vor kurzem unterhalb der Wasserfälle in Lirung Tika. In Long Bagung wohnten früher Malaien, die durch den Bumst mit dem Flussgebiet des oberen Murung (im Baritogebiet) Handelsbeziehungen unterhielten, aber gegenwärtig ist diese Niederlassung verlassen.
An den Nebenflüssen des Mahakam finden sich die Bewohner folgendermassen verteilt: am Rata haben sich die Stämme der Uma-Tĕmha, Mahakam und Djinawang beieinander niedergelassen, am Pari die Uma-Lutan und Uma-Tĕliba; am Mĕdang leben verschiedene Stämme im gleichen Dorfe vereinigt, was auch in den meisten anderen Niederlassungen der Fall ist. Der Grund für dieses Zusammenleben liegt hier, wie auch oberhalb der Wasserfälle, in dem Streben der stärkeren Stämme, ihre Seelenzahl und somit ihre Macht durch Einverleibung kleinerer, unterworfener Stämme zu vergrössern. Die Gesamtseelenzahl aller dieser Bahaustämme ist auf etwa 5000 Personen zu schätzen.
Neben diesen sesshaften Stämmen der ackerbautreibenden Bahau nomadisieren in den Quellgebieten der Nebenflüsse noch die Jägerstämme der Punan. An den linken Nebenflüssen sind es die Punanstämme der Lisum, Kohi, Lugat und Haput; die Namen der Stämme an den rechten Nebenflüssen sind mir unbekannt.
Die Bahaustämme bilden bereits seit Jahrhunderten die Bevölkerung des Mahakamgebiets, in welches sie, wie schon gesagt, ihren Traditionen zufolge, aus dem Apu Kajan eingewandert sind. Einige derselben tragen übrigens auch jetzt noch die Namen von Flüssen oder Bergen im Bohgebiet, das sie während ihrer Auswanderung passierten und in dem sie sich, ebenso wie die Uma-Timé bei ihrem Durchzug zum Tawang, zeitweise an verschiedenen Orten niederliessen. Die Uma-Boh, Kong-Glat, Long-Way und Tĕmha führen ihre Namen nach dem [35] Boh und seinen Nebenflüssen Glat, Way und Tĕmha, während die Tring nach dem Berg Tring oberhalb der Ogamündung genannt wurden. Die Long-Glat scheinen als die letzten am Ende des 18. Jahrhunderts im Mahakamgebiet angelangt zu sein, wonach ein Teil von ihnen sich, nach einem vorübergehenden Aufenthalt oberhalb der Wasserfälle unter dem berühmten Häuptling Bo Lĕdjü Aja, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts unterhalb derselben niederliess.
Diese Stämme hat das Schicksal aller ihrer Verwandten getroffen, die aus dem hohen Gebirge in die Tiefländer ausgewandert sind; sie wurden hier mehr als in ihrem hohen, isolierten Bergland von der Malaria und von Infektionskrankheiten, wie Cholera und Pocken, die von der Küste bei ihnen eingeschleppt wurden, heimgesucht, so dass ihre Anzahl und Wohlfahrt abnahm. Unter den vielen Stämmen am Mittel-Mahakam ist dieser Degenerationsprozess bereits weit vorgeschritten, denn ihre Kopfzahl ist sehr gering und ihre Dörfer machen einen viel verfalleneren Eindruck als diejenigen im höher gelegenen Lande oberhalb der Wasserfälle oder in Apu Kajan. Während die Bewohner in den Gebirgsgegenden dank ihrer Arbeitsamkeit nur selten Hunger leiden, ist dies unterhalb des Kiham Halo häufig der Fall, so dass gegenwärtig viel fremder Reis auf dem Mahakam angeführt werden muss.
Die Anwesenheit der vielen Fremden in diesen Gegenden trägt, wie aus der Reisebeschreibung selbst schon hervorging, das ihrige zum Rückgang der Bevölkerung bei. Vom unteren Mahakam aus drangen, nachdem die Buschprodukte dort erschöpft waren, Buginesen und Kuteinesen, vom Barito aus Bakumpai, Ot-Danum und Liang in die noch unberührten Wälder am mittleren Mahakam, um diese auszubeuten. Diese Einwanderung der Fremden fand erst statt, nachdem die Häuptlinge der Bahau mehr und mehr unter den Einfluss des Kuteischen Sultanats geraten waren und die Händler, die diese Stämme besuchten, nicht mehr so grosse Gefahr wie in früheren Zeiten bei ihnen liefen. Etwa um 1892 oder 93 zogen die ersten Truppen von Buschproduktensuchern vom Barito unter Anführung des Maleien Raden Djaja Kusuma in dieses Mahakamgebiet und gleichzeitig liess sich eine ähnliche Kolonie aus Kutei unter einem Abkömmling des Kuteischen Fürstenhauses an der Mündung des Pari nieder. Durch den grossen Einfluss, den die Lebensweise dieser Fremden auf die ursprüngliche Bevölkerung ausübte, haben deren Verhältnisse wesentliche Änderungen erfahren. [36]
Die Niederlassungen unterhalb der Wasserfälle sind gleich wie die oberhalb derselben von einander unabhängig, nur hat bei jenen länger als bei diesen eine von Bo Lĕdjü Aja abstammende Häuptlingsfamilie auf die vielen kleinen, schwachen Stämme einen grossen Einfluss geübt. Übrigens waren die Nachkommen dieser Familie infolge der auch hier herrschenden Vielweiberei unter den Häuptlingen so zahlreich, dass sie unter den Fürstenhäusern der meisten Dörfer Glieder zählte. Als im Beginn des 19. Jahrhunderts der genannte Lĕdjü Aja mit einem grossen Teil der Long-Glat und den von diesen abhängigen Stämmen die Wasserfälle hinunterzog, gingen zugleich eine Menge Sklavenfamilien mit, die zu den ursprünglichen Mahakambewohnern, wahrscheinlich Ot-Danum gehörten, wodurch sich die Bahau hier, wie oberhalb der Wasserfälle, mit dieser Stammgruppe stark vermischten. Von diesen Sklavenfamilien sind gegenwärtig beinahe keine mehr übrig geblieben, weil sie durch Heirat in den anderen aufgingen. Im Jahre 1825 begegnete, wie an anderer Stelle bereits gesagt, Georg Müller Lĕdjü Aja, der damals als einer der grössten Häuptlinge dieses Gebietes galt. Am Ende der 40 er Jahre hatte sich einer seiner Söhne, Kerta, bereits als Häuptling in Udju Tĕpu festgesetzt. Mit diesem als dem einflussreichsten Manne hatten Von Dewall und Schwaner bei ihren Reisen am mittleren Mahakam zu unterhandeln. Kerta war damals vom Sultan gänzlich unabhängig. Der jüngste Sohn Lĕdjü Ajas war der 90 jährige Bo Adjang Lĕdjü in Long Dĕho, der sich noch an Georg Müller erinnerte. Im folgenden wird noch öfters von ihm die Rede sein.
Der Sohn Kertas, Lĕdjü, trat unter dem Einfluss des Sultans von Kutei, der ihn viele Jahre in Tengaron festhielt, unter dem Namen Raden Temenggung zum Islam über. Er diente dem Sultan einerseits als Handlanger, um dessen Ansehen in den Gebieten oberhalb Udju Tĕpu zu verstärken, indem er die Macht des Kuteischen Fürsten, als seines Bundesgenossen, den anderen Bahauhäuptlingen gegenüber ausspielte, anderseits wusste er doch dafür zu sorgen, dass diese Macht sich nicht zu weit erstreckte.
Während Raden Temenggung jahrelang in Tengaron gefangen lebte, breitete die Familie seines Halbbruders Jok, der in Lirong Tika als Häuptling der Long-Glat ansässig war, ihren Einfluss im Gebiet des Mittel-Mahakam immer mehr aus; die Eifersucht zwischen den Nachkommen dieser beiden Brüder hat sich bis jetzt noch erhalten. Um 1890 [37] wurden alle grossen Häuptlinge dieses Gebiets ein Opfer der Cholera, die gerade zu einer Zeit in Tengaron ausbrach, als der Sultan die Bahaufürsten widerrechtlich jahrelang bei sich zurückhielt. Der junge Häuptling Band Jok floh damals mit der Leiche seines Vaters aus Tengaron nach Lirong Tika und zog dann aus Furcht vor Kutei mit der ganzen Niederlassung nach Long Dĕho, oberhalb des Kiham Halo und Udang, wo dieser Teil der Long-Glat jetzt noch wohnt. Auch Raden Temenggung starb an den Folgen derselben Krankheit in Udju Tĕpu. Auf ihn folgte sein Sohn Ding, der, als viel weniger kräftige Persönlichkeit, seinen Einfluss in diesem Bahaugebiet gegenüber seinem Vetter Bang Jok stark abnehmen sah, trotzdem aber bis zu seinem 1897 erfolgten Tode niemals aufhörte, der Macht der Kuteischen Malaien entgegenzuarbeiten. Aus Eifersucht gegen ihn intrigierte sein Bruder Brit, später Raden Mas, fortwährend zum Vorteil von Kutei, doch lehnte auch er sich, nach Dings Tode, gegen die zu anmassenden Forderungen von Kutei auf. Beide Brüder hatten jedoch nicht die Macht gehabt, den Strom von Buschproduktensuchern der Küste von ihrem Lande abzuwehren.
Die Bahau am oberen Mahakam haben in den Wasserfällen einen natürlichen Schutz gegen den Einfluss der Küstenmalaien gefunden; bei denen am mittleren Mahakam dagegen haben bereits seit Jahrzehnten zahlreiche Händler aus den tiefer gelegenen Gebieten verkehrt und die Dajak selbst sind auf den grossen, schiffbaren Flüssen öfters hinuntergefahren, um sich auf den Küstenmärkten mit verschiedenen Gebrauchsartikeln zu versehen. Ihre dajakischen Sitten und Gebräuche litten durch diese Berührung mit der Küste jedoch weniger als ihr Wohlstand, der bereits durch die mit den schlechteren klimatischen und hygienischen Verhältnissen verbundene Verminderung der Arbeitskräfte geschädigt, durch die Einführung von Spiel, Hahnenkämpfen und Wetten ernstlich untergraben wurde. In ihrer Kleidertracht behielten diese Stämme insofern ihre vorväterlichen Gewohnheiten, als sie den eingeführten Kattun und andere Stoffe auf altdajakische Weise verarbeiteten. Baumbastkleidung ist bei ihnen beinahe gänzlich ausser Gebrauch geraten, sogar bei Trauer wird statt dieser häufig weisser oder hellbrauner Kattun getragen. Kleiderverzierungen in Form ausgeschnittener Figuren kommen nicht mehr vor, und auch das Besticken der Frauenröcke, eine besonders bei den Long-Glat oberhalb der Wasserfälle sehr verbreitete [38] Mode, ist bei diesen tiefer wohnenden Stämmen in Abgang gekommen. Die zum Islam übergetretenen Häuptlingsfamilien kleiden sich gern nach malaiischer Art, und auch die noch heidnisch gebliebenen Häuptlinge wie Bang Jok finden ein malaiisches Kostüm ihrem Rang viel entsprechender als ihre alte Dajaktracht. Infolgedessen nehmen auch viele niedrigeren Häuptlinge und gewöhnliche Bahau, besonders die Männer, die malaiische Kleidung, hauptsächlich die Hose, an.
Das Tragen von Ringen in den weit ausgereckten Ohrläppchen ist unter Männern und Frauen noch allgemein gebräuchlich, auch ist die Tätowierung bei diesen noch sehr in Schwang. Trotzdem fiel es mir auf, dass die Frauen in Udju Halang z.B. sehr leicht zum Verkauf ihrer Tätowierpatronen zu bewegen waren, während ich mir diese bei den Stämmen oberhalb der Wasserfälle meist nur gegen sehr hohe Preise verschaffen konnte. Auch alte Schmuckstücke, wie Perlenarbeiten, waren hier leicht käuflich, wozu natürlich auch die Armut der Bevölkerung und ihre Kenntnis des Geldwertes beitrugen. Bezeichnend für letztere war, dass wir bei diesen Stämmen bereits viel mit Kupfergeld ausrichten konnten, während oberhalb der Fälle nur grosses Silbergeld Wert besass. Doch nahm man auch am mittleren Mahakam noch Tauschartikel, wie Lebensmittel, sehr gerne an.
Für den Ackerbau, der auch am mittleren Mahakam noch das Hauptexistenzmittel der Bewohner bildet, wird nur wenig Urwald mehr gefällt; dieser ist in der Nähe der Dörfer übrigens auch selten geworden. Die hier lebenden Bahau begnügen sich, wie die Malaien, mit dem Fällen von Gestrüpp und jungem Wald, weil diese Arbeit viel müheloser ist; später allerdings kostet das Jäten des in solchen Feldern massenhaft auftretenden Unkrauts viel mehr Anstrengung und Zeit, als anfangs erspart worden ist. Beachtenswert ist, dass alang-alang in diesem Teil des Mahakamgebietes noch sehr wenig vorkommt und auf den abgeernteten Feldern junger Wald noch sehr schnell aufschiesst. Besonders bei den tiefer am Fluss wohnenden Stämmen leidet der Landbau sehr stark durch Überschwemmungen der flachen Ufer, auf denen ihre Felder häufig liegen; überdies übt die seit Alters häufig wiederkehrende grosse Trockenheit einen sehr nachteiligen Einfluss auf die Ernten. Die oberhalb der Fälle lebenden Stämme, deren Felder zwischen hohen Bergen in 150–250 m Höhe liegen und daher viel regelmässiger Regen erhalten, versahen die unteren Gebiete während vieler Jahre mit ihren Landbauerzeugnissen. Seitdem von der Seeküste [39] aus am mittleren Mahakam Reis eingeführt wird und der Preis für diesen sehr gefallen ist, hat die höher wohnende Bevölkerung eine wichtige Einnahmequelle verloren. Dasselbe gilt für die selbstverfertigten Stoffe und Kleider; auch diese erreichen seit der Einfuhr europäischer und japanischer Ware in dieser Gegend nicht mehr den früheren Wert.
Unter allen Niederlassungen am Mittel-Mahakam ist die der Long-Glat in Long Dĕho eine der wichtigsten. Sie dankt ihr Ansehen teils der Persönlichkeit ihres Oberhäuptlings Bang Jok, teils der Zuflut von Fremden, die ihr Brot direkt oder indirekt durch Buschproduktesuchen in der Umgegend verdienen. Das Dorf selbst setzt sich aus verschiedenen kleinen Stämmen zusammen, wie dies auch bei den Long-Glat am oberen Mahakam der Fall ist. Bei einander wohnen die eigentlichen Long-Glat und die Ma-Tuwan, beide in ihren eigenen langen Häusern und unter eigenen Häuptlingen, während ein grosses Dorf der Batu-Pala und ein anderes der Uma-Wak, die beide unter direkter Abhängigkeit von Bang Jok, aber unter eigenen Häuptlingen stehen, etwas tiefer am Fluss gelegen sind. Neben Bang Jok wohnte die schon erwähnte Familie seines Grossonkels Bo Adjang Lĕdjü, der keine bestimmte Funktion ausübte, durch seine Abstammung als Sohn des bereits genannten Kriegshelden Bo Lĕdjü Aja jedoch grosses Ansehen genoss. Seinen Stammesgenossen bereitete er durch seinen Charakter und seinen Lebenswandel viel Ärgernis, denn er war stets unzuverlässig und den Frauen allzusehr ergeben. Infolge der von den Malaien übernommenen Sitte der Vielweiberei unter den Bahauhäuptlingen erlaubte er sich, nacheinander nicht weniger als 15 Frauen zu heiraten, ein Familienverhältnis, das seine Landsleute trotz seines langen Lebens unerhört fanden. Die Frauen waren teils gestorben, teils zu ihren früheren Wohnplätzen zurückgekehrt, nur 5 von ihnen lebten noch zu meiner Zeit mit ihren Kindern bei ihm. Die jüngste war bei seinem Tode etwa 25 Jahre alt. Adjang Lĕdjüs Frauen stellten die Arbeitskräfte in der Familie dar, indem sie sich mit einigen erwachsenen Söhnen und Töchtern hauptsächlich dem Feldbau widmeten. Obgleich der Vater trotz seines Alters und seiner Kränklichkeit sich immer noch als pater familias behauptete, hatte sein ältester Sohn Ibau Adjang, der verheiratet aber kinderlos bei ihm wohnte, doch die eigentliche Leitung in Händen und vertrat die Familie nach aussen. [40]
Bang Jok, der sich mit Vorliebe als Malaie aufspielte und kleidete und während seines langen gezwungenen Aufenthaltes in Tengaron eine starke Leidenschaft für Hazardspiel und Hahnenkämpfe entwickelt hatte, wurde von seiner einzigen Frau daran verhindert, auch der malaiischen Sitte der Vielweiberei zu fröhnen. Man redete im Dorfe zwar davon, dass er eine Tochter des Sultans von Kutei heiraten und zum Islam übertreten sollte, wodurch die Kuteinesen ihren Einfluss im Binnenland sehr zu verstärken hofften, aber die schnelle Einsetzung einer niederländischen Verwaltung1 unter diesen Bahau und das Misstrauen Bang Joks selbst vereitelten diesen Plan.
Angeborener Verstand, politische Einsicht und der Aufenthalt in Tengaron hatten Bang Jok einen grossen Einfluss auf die übrigen Stämme verschafft, und nachdem er sich einmal oberhalb des Kiham Halo und Udang angesiedelt hatte, durfte er den Kuteinesen gegenüber leichter eine feindliche Haltung annehmen als die tiefer wohnenden Häuptlinge, wie Ding Lĕdjü in Ana. Mehrere Morde an reichen Kaufleuten und Buschproduktensuchern, die Bang Jok durch seine Sklaven und Punan ausführen liess, waren in den ersten Jahren die Folge seines Aufenthaltes im entlegeneren Long Dĕho. Er besass nämlich eine gewisse Anzahl Sklaven, nicht solche, die in seiner Familie von früheren Kriegsgefangenen geboren worden waren, denn diese waren auch bei den Long-Glat beinahe vollständig in die Stämme aufgenommen worden, sondern Schuldsklaven, die er ihrer Schulden wegen nach malaiischem und buginesischem Brauch bei sich zurückhielt. Dies waren daher auch keine Bahau, sondern Küstenbewohner, vor allem Buginesen. Sie liessen sich denn auch leichter zu dergleichen Schandtaten bewegen als die Bahau selbst, die weniger Mut besitzen und Morde aus Raubsucht selten begehen.
Noch ein anderer Grund, weswegen Bang Joks Name bis ins Murunggebiet mit Schrecken genannt wurde, war die Macht, die er über die Punan am Boh ausübte. Wie die anderen Punanstämme lebten auch diese in starker Abhängigkeit von den in der Nähe ansässigen Bahauhäuptlingen, hier von Bang Jok, der auf dasjenige Gebiet der Nebenflüsse des Mahakam Anspruch machte, zu dem auch das ausgebreitete Land am Boh gehörte. Obgleich diese Abhängigkeit: in vieler Hinsicht äusserst schwach war, zeigten sich die Punan doch gern bereit, [41] Kriegszüge für den Häuptling zu unternehmen, eine ihren Neigungen sehr entsprechende Aufgabe, der sie sich auch im Auftrag anderer Bahauhäuptlinge stets bereitwillig unterzogen. So ermordeten sie auf Bang Joks Anstiften 1896 im Ogagebiet 5 Batang-Lupar, die hier aus Sĕrawak eingedrungen waren, um Buschprodukte zu stehlen. Ein anderes Mal sandte er einige Punanmänner ins Launggebiet an den Murung, wo sie einem feindlichen malaiischen Häuptling und einer Frau die Köpfe abschlugen und mit diesen nach Long-Dĕho zurückkehrten. Dass diese geheimnisvollen Urwaldkrieger sich selbst nicht straflos misshandeln liessen, bewiesen sie, als sie um 1897 einen Mantri von Bang Jok töteten. Dieser Mann, der die Punan zu Handelszwecken aufsuchte, musste die ungerechten Handlungen seines Häuptlings diesen gegenüber mit dem Leben büssen; Bang Jok hatte ihnen nämlich einen auf seinen Befehl geraubten Sklaven abgenommen, ihnen denselben aber nicht vergütet. Ähnliche Dinge hatte er wohl schon öfters ausgeführt. Die Punan flohen nach dem Morde zwar aus dem Bohgebiet, aber dieses wurde nun sogar von den Bewohnern von Long Dĕho selbst als eine äusserst gefährliche Gegend angesehen, in der sie fortan weder zu jagen noch zu fischen Nagten.
Die Lage seines Dorfes dicht an der Mündung des Boh, des Hinund Rückweges nach Apu Kajan, verschaffte Bang Jok auch viel Einfluss auf die Kĕnja, die den Mahakam besuchten und froh waren, diesen Fluss nicht zu weit hinunterfahren zu müssen, um allerhand Produkte kaufen und verkaufen zu können, wenn dies auch in Long Dĕho unter für sie äusserst ungünstigen Bedingungen geschah. Da Bang Joks Grossmutter eine Kĕnjafrau war, fühlten deren Stammesgenossen sich noch mit dem Häuptling verwandt. Ohne dessen Zustimmung wagten sie denn auch keine Kopfjagd im Mahakamgebiet zu unternehmen, obgleich es Bang Jok an Macht gefehlt hätte, um solch einen Zug mit Waffengewalt zu verhindern. Als ich 1899 den Mahakam bis über die Wasserfälle wieder hinauffuhr, lag eine Kĕnjabande unter Anführung von Punan am Nebenfluss Alān und wartete auf den ebenfalls von Tengaron aus flussaufwärts reisenden Bang Jok, um seine Zustimmung zur Fortsetzung ihrer Kopfjagd zu erhalten. Nach Erlangung derselben schlugen sie am Rata einigen Personen die Köpfe ab und flohen mit diesen eiligst nach Apu Kajan zurück. In Long Dĕho und den Nachbardörfern sah man die grossen Banden Kĕnja stets nur mit Angst den Boh hinunterfahren und in der Niederlassung Halt machen, [42] weil die Bahau nicht stark genug sind, um tätlich gegen die Kĕnja aufzutreten, und sich daher alles mögliche von ihnen gefallen lassen müssen. Nach ihrer Gewohnheit nahmen die Bewohner von Apu Kajan im Vorüberfahren von den ärmlichen Feldern der Bahau, was sie an Zuckerrohr, Tabak u.s.w. brauchten, und bisweilen wurde wohl auch in Long Dĕho einem der Dorfinsassen von einem Kĕnja der Kopf abgeschlagen. Begreiflicherweise kamen die Bahau den Kĕnja nicht freundlich entgegen, doch kauften sie ihnen immerhin gern die Buschprodukte ab, die diese auf der Durchreise am Boh gesammelt hatten, um Marktgeld für ihre Handelszüge zur Küste zu gewinnen. Waren die Bahau ihren Besuchern auch nicht an Mut und Kraft überlegen, so verstanden sie doch, ihnen ihre Ware für die Hälfte oder weniger des Wertes abzunehmen.

Junger Mann der Mahakam-Kajan.
In diesem vorteilhaften Handel mit den Kĕnja trat Bang Jok jedoch seine früher bereits erwähnte Schwester Bua als Konkurrentin entgegen, die in Long Bagung wohnte und dort mit Raup, dem Sohn des Bakumpaihäuptlings Raden Djaja Kusuma verheiratet war. Dieser schlaue Malaie verdiente hauptsächlich viel im Handel mit den Buschproduktensuchern, die aus dem Baritogebiet nach Long Bagung kamen, um sich hier mit Reis, Salz, Tabak, Leinwaren u.s.w. zu versehen. Wenn die Kĕnja daher von Apu Kajan den Kiham Udang und Halo hinabfuhren, fanden sie bei Rauf einen grossen Vorrat von allerlei Waren, der Bang Joks Betrügereien eine gewisse Grenze setzte. In diesem vorteilhaften Handel mit seinem Schwager gemeinsame Sache zu machen, dazu hatte er sich noch nicht aufgeschwungen; gegenseitiges Misstrauen bildete wohl den Hinderungsgrund. Ein wirksames Mittel, die Kĕnja anzulocken, wandten beide an, indem sie diese auf ihrem eigenen Gebiet Buschprodukte sammeln und so etwas verdienen liessen. Für Bang Jok sammelten die Kĕnja Rotang, hauptsächlich im Gebiet des Boh, für seine Schwester in dem des Alān. Guttapercha war in der Nähe des Mahakam nicht mehr zu finden, Rotang dagegen noch in grosser Menge. Die Dajak des Inneren haben überdies vor dem Besuch der näher zur Küste gelegenen malaiischen Niederlassungen am Mahakam eine gewisse Abneigung, auch wurden sie dort, z.B. in Udju Tĕpu, nur durch die stärkere Konkurrenz der Händler vor einer ebenso grossen oder noch grösseren Prellerei geschützt. Die Kĕnja mussten den gesammelten Rotang diesen Häuptlingen für 1 fl. pro gulung von 40 Stück bei einer Länge von 2–2½ dĕpa abliefern; [43] hierfür mussten sie ihn in Long Dĕho und Long Bagung auch noch trocknen und unter den Häusern aufstapeln; der Marktpreis betrug in Udju Tĕpu zur selben Zeit mindestens 3 fl pro gulung; ausserdem mussten die Kĕnja an Ort und Stelle für das verdiente Geld zu sehr hohem Preise Salz, Tabak, Zeuge etc. wieder einkaufen. Kein Wunder, dass die Kĕnja, die sich an der Küste bisweilen nach dem Preis der Handelswaren erkundigten, das betrügerische Vorgehen dieser Häuptlinge wohl durchschauten; doch wussten sie kein Mittel, um sich dagegen zu wehren. Nach der im letzten Jahr meiner Reise erfolgten Einsetzung eines niederländischen Kontrolleurs in Long Iram, der, in gleicher Weise wie es in Sĕrawak üblich ist, den Handel mit den Stämmen des Inneren beaufsichtigt, fahren die Bewohner vom Ober-Mahakam und Apu Kajan begreiflicherweise lieber bis zu dieser Handelsniederlassung hinunter. Die Entdeckung eines Schmuggelhandels in Waffen mit den aufständischen malaiischen Stämmen im Baritogebiet veranlasste übrigens einige Jahre später (1902) die indische Regierung zur Aufhebung der Niederlassung Long Bagung.

Junger Mann der Mahakam-Kajan.
Mit Bang Jok im selben Hause wohnte auch dessen jüngerer Bruder Lawing Jok, der viel weniger Energie und Verstand besass als er und sich hauptsächlich mit Ackerbau, Jagd und Fischfang beschäftigte, mit denen Bang Jok sich, gegen alle Bahausitte, überhaupt nicht abgab. Auch Lawing besass nur eine Frau, von der er mehrere Kinder hatte.
Trotz der grossen Einkünfte, die Bang Jok sich auf alle mögliche Weise zu verschaffen wusste, lebte er doch, wie das ganze Dorf, in einem schlecht gebauten, baufälligen Hause und dürftigen Verhältnissen, da, in einem für Europäer unbegreiflichen Masse, sein ganzer Tag von Spiel und Hahnenkämpfen eingenommen wurde. An diesen beteiligten sich die fremden Händler und Buschproduktensucher, die sich in Geschäften oder zur Erholung ständig in Long Dĕho aufhielten, mehr als die Bahau.
Obgleich die Wohnung des Häuptlings nur aus einem einzigen grossen Raum bestand, in dem alle Familienglieder lebten und ihre Matratzen mit den darüber gehängten Moskitonetzen sich befanden, hielten sich doch den grössten Teil des Tages über die Fremden dort auf, um sich dem Karten- und Würfelspiel zu sehr hohen Einsätzen hinzugeben. Noch mehr Geld wurde bei den ständigen Hahnenkämpfen gewonnen und verloren, die hier völlig den Charakter eines [44] Hazard- und Wettspiels angenommen hatten. Hier wurden nicht mehr vor der Bestimmung des Einsatzes nach allerhand abergläubischen Regeln die Kämpfer stundenlang miteinander verglichen, wie es bei den Bahau oberhalb der Wasserfälle Sitte ist, sondern nach kurzer Besprechung waren die Vorbereitungen getroffen, die Einsätze bestimmt, die eisernen Sporen angebunden, und das Wetten begann. Trotzdem Bang Jok zu den entschlossensten Charakteren unter den Bahauhäuptlingen gehörte, war er in vieler Hinsicht doch von den Malaien abhängig, die ihm mit ihrem Rat zur Seite standen. Er selbst sprach zwar fliessend und gern Malaiisch, da er aber weder lesen noch schreiben konnte, hatte er für diese Fertigkeiten die Hilfe der malaiischen Küstenbewohner nötig, von denen der eine oder andere sich als Schreiber bei ihm aufhielt und wieder verschwand, sobald seine Betrügereien dem Häuptling zu arg wurden. Unter den Leuten, die zu schreiben und zu lesen verstanden, befanden sich viele Bandjaresen, die in den Missionsschulen der Zuider-Afdeeling diese Kenntnis erworben hatten; wenn derartige, auch in der eingeborenen malaiischen Gesellschaft ihrer Kenntnisse wegen sehr gesuchte Personen ihre zivilisiertere Heimat gegen das unwirtsame Binnenland eintauschen, so darf man wohl sicher annehmen, dass ihnen der Boden ihres Landes zu heiss geworden ist, weil sie sich irgend eines Verbrechens schuldig gemacht haben. Kein Wunder, dass auch Bang Jok ständig von den Malaien in seiner Umgebung betrogen wurde und nicht minder als seine weniger weltklugen Ranggenossen einen lebhaften Abscheu vor ihnen empfand. Er konnte sie jedoch wegen seiner Spielwut nicht missen, und sein jahrelanger Aufenthalt in Tengaron hatte ihn zu viel mit malaiischem Wesen in Berührung gebracht, um ihn an der Gesellschaft seiner rohen Bahaubrüder noch Gefallen finden zu lassen.
Derselbe Widerspruch äusserte sich auch in seinem Verhältnis zum Sultan von Kutei: die Misshandlungen, die besonders seine Landsleute unterhalb der Wasserfälle von den Kuteischen Sultanen erdulden mussten und die ihn selbst in das Gebiet oberhalb des Kiham Halo getrieben hatten, erfüllten ihn zwar mit Hass und Widerwillen gegen die malaiische Rasse, doch war er andrerseits so geschmeichelt, wenn Abgesandte des Sultans bei ihm erschienen, dass er sich von diesen leicht als Werkzeug gebrauchen liess.
Die Bahaubevölkerung von Long Dĕho beteiligte sich, wie gesagt, [45] nur selten am Spiel in der Häuptlingswohnung, obgleich auch jeder Dajak, der Geld hatte, in dieser gemischten Gesellschaft willkommen war. In den Häusern der übrigen Familien wurde übrigens ebenfalls viel gespielt; da sich besonders die jüngeren Männer dem Spiel hingaben, statt sich dem Landbau zu widmen, herrschte in keiner Bahauniederlassung am Mahakam eine solche chronische Nahrungsnot wie in Long Dĕho. So oft ich auch bei meinen Auf- und Abfahrten auf dem Mahakam hier Halt machte, gelang es mir doch nie, für mich und mein Personal eine genügende Menge Lebensmittel einzukaufen; auch für die Niederlassung selbst mussten stets von ober- oder unterhalb der Wasserfälle Vorräte angeführt werden. Die Bevölkerung sprach denn auch öfters von den Vorteilen, die ein Rückzug in das Land unterhalb der Wasserfälle, wo man nie derartig an Mangel gelitten hätte, bieten würde. Angst vor den Kuteinesen verhinderte jedoch die Verwirklichung dieser Idee, und für den Häuptling bildete im geheimen die Nähe seines kostbaren Bohgebiets, in dem noch so viele Buschprodukte zu sammeln waren, ein gewichtiges Motiv, um seinen jetzigen Standort, von dem aus er jene Schätze im Auge zu behalten vermochte, nicht zu schnell wieder zu verlassen. Nach meiner Rückkehr aus dem Mahakamgebiet, Ende 1900, gelang es ihm denn auch, mit einer Truppe von Buschproduktensuchern Kontrakte über die Ausbeutung der höher gelegenen Teile des Bohgebiets abzuschliessen, die ihm sicher beträchtliche Summen eintrugen. Zur Wohlfahrt seiner Stammesgenossen wird dieser Umstand wenig beigetragen haben, denn, obgleich sie das Recht besitzen, im Gebiet des Stammes, also auch im Boh, auf eignes Risiko Buschprodukte zu sammeln, ohne für diese dem Häuptling Abgaben zahlen zu müssen, so haben sie doch keinen Anteil an den 10%, die die Fremden dem Häuptling für die Ausnutzung eines bestimmten, dem Stamme gehörigen Gebietes an Steuergeld aufbringen müssen. Das Gelände, in dem die Bahau selbst sammeln könnten und das durch die zunehmende persönliche Sicherheit nach der Einsetzung einer niederländischen Verwaltung in Long Iram für sie zugänglich geworden ist, wird jetzt durch Fremde ausgebeutet.
In Long Dĕho fiel es mir mehr als bei den reicheren, höher gelegenen Dörfern auf, wie sehr diese Bahau durch ihren Glauben in ihrem Tun und Lassen geknechtet sind. So pflegte z.B. Bang Jok jedes Jahr, nachdem der Reis gesät und der Nahrungsmangel vor [46] dem Eintritt der neuen Ernte am grössten war, mit seiner ganzen Familie und der seines Bruders Lawing nach Long Bagung unterhalb der Wasserfälle zu ziehen, wo die Zustände infolge der Reiseinfuhr von der Küste günstiger lagen. Zu Anfang der Ernte musste Bang Jok wieder nach Long Dĕho zurückkehren, um als Stammeshäuptling bei den Opferfeierlichkeiten für die Geister, die als lāli parei ok und lāli parei aja die Ernte einleiten, den Dorfbewohnern voranzugehen. Ich selbst erlebte mehrmals, dass der Häuptling durch Hochwasser am Passieren der Wasserfälle wochenlang verhindert wurde oder dass seine Reisevorzeichnen schlecht waren und die Bevölkerung von Long Dĕho, trotzdem sie Hunger litt und der Reis auf dem Felde überreif abfiel oder durch Regen verdarb, die Ernte in der Abwesenheit des Häuptlings, also ohne Feste, nicht vorzunehmen wagte. Dieser Beweis für das hartnäckige Festhalten der Bevölkerung an ihrem Glauben, auch trotz der ungünstigsten Umstände, ist um so bemerkenswerter, als sich seit langer Zeit so viele andersgläubige Händler und Buschproduktensucher bei ihnen aufhalten, die über ihre heidnische Dajakreligion spotten.
Was den Kultus der übrigen Dörfer am Mittel-Mahakam betrifft, so halten auch sie noch allgemein mit Zähigkeit an ihrem alten Glauben fest, obgleich die Familie ihres vornehmsten Häuptlings in der Person Raden Temenggungs zum Islam übergetreten ist und sie selbst bereits seit langem mit den Kuteinesen und Buginesen vom unteren Mahakam in Berührung gekommen sind. Natürlich hat der Einfluss, den diese in vieler Beziehung auf die Bahau geübt haben, auch das religiöse Gebiet nicht unberührt gelassen und es ist sehr wahrscheinlich, dass auch diese Stämme im Lauf der Zeit den für sie sehr leichten Übertritt zum Islam nicht werden vermeiden können; denn auch sie sehen zu den mohammedanischen Küstenbewohnern, wie zu höherstehenden Menschen auf und dieser Grund wird für sie stark genug sein, um das Schweinefleischessen aufzugeben und sich den wenigen Zeremonien, die der Übertritt zum Islam den Dajak anfangs auferlegt, zu unterziehen.
Zur vollständigeren Übersicht über die dajakischen Stämme am Mittel-Mahakam sind noch zwei Gruppen derselben zu nennen, nämlich
die Tundjungstämme am rechten Mahakamufer und die Kĕnjastämme am Tawang. Die Tundjung wohnen nicht am Hauptstrom, sondern in einigem Abstand von diesem im Hügelland zwischen dem unteren [47] Mahakam und dem Rata; sie betrachten sich selbst nicht als direkte Verwandte der Bahau. Sie stellen sich regelmässig, um Handel zu treiben, an den pankalan des Mahakam ein, d.h. an den Stellen, wo die Wege aus ihrem Gebiet den Hauptfluss erreichen. Der vielen Nahrungsmittel wegen, die sie auf den Markt bringen, sind sie hauptsächlich für die vielen Fremden in diesem Teil des Mahakamgebietes von grosser Bedeutung. Sie sind direkt abhängig vom Sultan von Kutei, d.h. sie sind ihm tributpflichtig und müssen sich von ihm zu willkürlichen Terminen Steuererhebungen gefallen lassen. An festen Abgaben muss jeder erwachsene Mann 3 fl und jede Frau und jedes Kind 1 fl leisten, überdies muss jedes Familienhaus, amin, noch 1 kati Guttapercha im Wert von etwa 2,5 fl aufbringen. Diese letzte Bestimmung rührt aus einer Zeit her, in der im Tundjunglande noch viele Guttaperchabäume zu finden waren, aber jetzt sind sie dort bereits lange ausgerottet, und die Tundjung können die erforderliche Menge nur noch in sehr grosser Entfernung von ihrem Wohnplatz zusammenbringen. Hierdurch ist diese, im Beginn nicht schwere Steuer allmählich sehr drückend geworden. Die zu unregelmässigen Terminen vom Sultan erhobenen Abgaben bestehen hauptsächlich in Reis und Hühnern. Sehr charakteristisch für die Verhältnisse in diesen Gegenden war das Betragen dieser Tundjungstämme gegenüber Kutei, insofern es sehr stark durch Rücksichten auf die Gesinnung der Bahau beeinflusst war. Obgleich sie von diesen völlig unabhängig sind, empfinden sie doch einen grossen Respekt vor deren vornehmsten Häuptlingen, hauptsächlich denen in Udju Tĕpu; sie machten sogar die Entrichtung der Steuern an Kutei, der sie sich nur sehr widerwillig unterzogen, von der unter diesen Häuptlingen herrschenden Stimmung gegen den Sultan abhängig. Unter Raden Temenggung, der in seinen letzten Lebensjahren nur noch im geheimen gegen Kutei aufzutreten wagte, hatten sie noch regelmässig bezahlt, sobald aber nach dessen Tode sein Sohn Si Ding Lĕdjü eine feindliche Haltung gegenüber den Sultan annahm, stellten sie die Zahlung ein. Da es den malaiischen Fürsten ausschliesslich um die Einkünfte von den unterworfenen Stämmen zu tun ist und sie die Ausgaben, welche Zwangsmassregeln erfordern, scheuen, schritt der Sultan nicht gegen dieses widersetzliche Betragen ein. Sobald nach dem Tode Dings dessen Bruder Brit Lĕdjü, der bereits lange vom Sultan bestochen worden war, unter dem Namen von Raden Mas an Stelle des Verstorbenen trat und die Tundjung somit in den Bahau nur wenig Stütze [48] gegen Kutei mehr fanden, begannen sie aufs neue Steuern zu bezahlen.
Ebenfalls von Bedeutung für die Bevölkerungsverhältnisse am Haupt strom ist die Existenz der Kĕnjaniederlassungen der Uma-Timé am oberen Tatyang, einem linken Nebenfluss des Mahakam, den man durch den Mĕrah erreicht. Dieser etwa 2000 Seelen zählende Stamm ist als letzter vor ungefähr 30 Jahren aus Apu Kajan in das Tiefland ausgewandert. Der unmittelbare Anlass zu ihrer Auswanderung war folgender: Die Uma-Timé spielten früher in ihrem Stammland infolge ihrer Stärke die gleiche Rolle, wie jetzt die Uma-Tow, d.h. sie nahmen den übrigen Stämmen gegenüber eine herrschende Stellung ein, machten sich aber unter diesen durch ihr gewalttätiges Auftreten so viele Feinde, dass ihnen der Aufenthalt dort nicht mehr sicher erschien. Ausserdem sehnten sie sich danach, in grösserer Nähe der Küste zu leben, von der sie Salz, Tabak und Leinwaren leichter beziehen konnten; auch hofften sie im Vertrauten auf ihre grosse Anzahl, nicht zu sehr unter die Abhängigkeit vom Sultan von Kutei zugeraten. Nachdem sie mit diesem zuerst über eine Ansiedelung in seinem Reich am Tatyang unterhan delt und seine Zustimmung erhalten hatten, begannen sie unter ihrem Häuptling Bo Adjang Hipui, der damals in Apu Kajan viel Einfluss besass, nicht längs des Boh, sondern in östlicher Richtung auszuwan dern. Um die mannigfaltigen, für ein so grosses Unternehmen erfor derlichen Vorzeichen zu suchen, begann der Stamm damit, in seiner Auswanderungsrichtung einen für eine zeitweilige Siedelung passenden Ort auszuwählen. Dort blieb er eine Reisernte über wohnen, dann zog er auf die gleiche Weise weiter, so dass es drei Jahre dauerte, bevor er sich am Tatyang niedergelassen hatte. Nach dem, was sie selbst erzählten, hatten die Uma-Timé auf dieser Reise nicht all ihr Hab und Gut mitnehmen können, sondern einige wertvolle Gegenstände, wie Gonge, an verschiedenen Waldstellen verbergen müssen. Augenblicklich wohnt der Stamm noch am Tatyang in mehreren grossen Niederlassungen unter der Herrschaft von Ibau Adjang und Ding Adjang, den Söhnen seines berühmten Häuptlings Bo Adjang Hipui.
Die Siedelung dieser Kĕnja-Dajak am Tatyang ist vor allem deswegen für den Mahakam von Bedeutung, weil ihre Verwandten aus Apu Kajan sie auf ihren Handelsreisen zur Küste stets wieder besuchen und dabei die Route Boh-Mahakam-Mĕrah-Tawang einschlagen. Ihre alten Fehden haben die Stämme aber trotz der ververwandtschaftlichen Besuche nicht vergessen. [49]
Diese Kĕnjastämme hatten nicht, wie die Bahau, ihre Unabhängigkeit Kutei gegenüber zu bewahren verstanden, obgleich sie anfangs so zahlreich waren und mit der Energie der Gebirgsbewohner ausgerüstet ihre neuen Wohnplätze bezogen hatten. Mit grosser Gewandtheit hatten die Sultane von Kutei aus dem Verhältnis der Stämme untereinander ihren Nutzen zu ziehen verstanden. Anfangs hatten die Kĕnja dieses Gebiet mit Zustimmung des Sultans besetzt, ohne von diesem in irgend einer Weise abhängig zu sein. Ihre vornehmsten Häuptlinge Ding Adjang und Ibau Adjang hatten sich oberhalb der Niederlassung Long Bila zwei grosse Häuser gebaut; nach kurzer Zeit entstand aber Streit zwischen den neuen Nachbarn, worauf das Köpfejagen von beiden Seiten mit Erbitterung betrieben wurde. Da die Long-Bila unter der Herrschaft des Sultans von Kutei standen, suchten sie bei diesem Hilfe. Er sandte ihnen einige Malaien und eine grosse Anzahl Gewehre mit Munition, die die Kĕnja nicht besassen und vor denen sie sich daher sehr fürchteten. Die Long-Bila erhielten hierdurch das Übergewicht über die Uma-Timé, denen sie im übrigen weder an Anzahl noch an persönlichem Mut gewachsen waren. Durch eine Beschiessung ihrer Niederlassungen zwangen sie die Kĕnja, diese zu verlassen, worauf sie die Häuser verbrannten. Dieser obdachlose Stamm musste sich darauf dem Sultan unterwerfen und ihm tributpflichtig werden, worauf dieser ihm dann neue Häuser zu bauen gestattete.
Über das Verhältnis der Uma-Timé zu den ihnen verwandten Stämmen in Apu Kajan und den Einfluss, den dieses auf den Verlauf meiner Reise zu den Kĕnja gehabt hat, wird im IV. Kapitel ausführlicher die Rede sein. Zum Schluss noch einige Bemerkungen über die Beziehungen zwischen der Bahaubevölkerung ober- und unterhalb der Wasserfälle. Aus den vorhergehenden Schilderungen ging bereits hervor, dass die Bande zwischen den Mahakamstämmen sehr locker sind; da die Glieder desselben Stammes in der Regel untereinander heiraten, besteht eine Blutsverwandtschaft zwischen den Stämmen nur unter den Häuptlingsfamilien, deren Angehörige, um eine ebenbürtige Heirat schliessen zu können, sich oft mit Gliedern anderer Stämme verbinden. So sind am oberen Mahakam die Häuptlinge aller Niederlassungen mit der Familie des alten Bo Ibau verwandt geworden, am mittleren Mahakam dagegen mit der seines Bruders Bo Lĕdjü Aja. Ihre gemeinsame Abkunft aus Apu Kajan ist den Stämmen jedoch, wie schon [50] erwähnt, noch wohl bekannt, wenn die Geschichte ihrer Auswanderung auch allmählich mit phantastischen Erzählungen verknüpft worden ist. Ebenso erinnern sie sich noch, wie seiner Zeit mit Bo Lĕdjü Aja Angehörige zahlreicher Stämme, wahrscheinlich von dem mächtigen Häuptling gezwungen, die Wasserfälle hinunterzogen. Von vielen dieser ausgewanderten Stämme sind nur wenige Familien übrig geblieben und diese werden allmählich über die Wasserfälle zu ihrem ursprünglichen Stamm zurückgeholt. So beabsichtigten die Kajan während meines Aufenthaltes bei ihnen, einige Familien, die von dem ausgewanderten Teil ihres Stammes übrig geblieben waren und am Rata ein armseliges Leben führten, nach dem Blu-u zurückzuholen. Der vornehme Kajanpriester Bo Bawan hatte, was der Entfernung wegen nur selten vorkam, eine Frau aus einer dieser Familien geheiratet; im Jahre 1891 begleitete er mich auf meiner ersten Reise den Mahakam hinunter, um mit seiner Gattin deren Angehörige am Rata zu besuchen.
Obwohl ihre Verwandtschaft unter einander ihnen bekannt ist, stehen sich die Stämme oberhalb der Wasserfälle viel weniger fremd gegenüber als denen unterhalb derselben. Die Bahau oberhalb des Kiham Halo betrachten sich noch als Leute gleicher Art und Gesinnung, unterhalb desselben beginnt für sie aber das Gebiet der Fremden. Hauptsächlich liegt dies daran, dass sie ihre Stammverwandten am Mittel-Mahakam weniger häufig besuchten und bei ihnen viele Sitten der Küstenbewohner eingeschlichen fanden.
Bezeichnend für das Verhältnis der Bewohner am oberen und mittleren Mahakam war, dass die jungen Kajan vom Blu-u auf unserem Zuge nach Udju Tĕpu in den Dörfern Long Dĕho, Batu Pala und Uma Wak mit den jungen Mädchen der Häuser, in welchen wir übernachteten, in intimen Verkehr traten und nur schwer von ihnen zu trennen waren, unterhalb der Wasserfälle jedoch derartige Vertraulichkeiten vermieden, weil sie hier weniger bekannt waren und überhaupt durch allerhand geheimnisvolle Einwirkungen der Bevölkerung auf ihre Gesundheit krank zu werden fürchteten. Die Bewohner des Binnenlandes sind überzeugt, dass die Leute unterhalb der Wasserfälle im Besitz von Giften sind, die sie einem unmerklich durch die Luft zukommen lassen können; auch sollen sie diese Gifte auf die Sitzbretter streichen. Die Gifte, die sich in das Essen mischen lassen, spielen in ihrer Vorstellung beinahe keine Rolle. [51]
Der Glaube an eine Vergiftung unterhalb der Wasserfälle findet eine Stütze in den vielen Umständen, die dort mehr wie oberhalb der Fälle dazu beitragen, sie krank zu machen. Vor allem die grosse Hitze, dann das unreinere Flusswasser, das sie trinken, ferner die hier häufig herrschenden Infektionskrankheiten, wie Influenza, Cholera, Pocken etc. Dazu kommt, dass sie hier ständig in ihren Böten leben, ungewohnte Dinge essen, die ihnen in den toko von den Malaien verkauft werden, u.s.w., alles Gründe, um eine Handelsreise die Wasserfälle abwärts für eine lebensgefährliche Unternehmung anzusehen. In der Tat erfordern diese Reisen häufig Opfer, und ich selbst hatte oft Mühe, meine Reisegenossen vom mittleren Mahakam oder gar von der Küste alle wieder lebend nach Hause zu bringen, trotz meiner Fürsorge, Ratschläge und Medizinen. [52]
1 1900 in Long Iram.
Kapitel III.
Plan eines Zuges ins Quellgebiet des Mahakam—Schwierigkeiten bei den Vorbereitungen Fahrt auf dem Mahakam bis zum Quellfluss Sĕlirong—Durch den Sĕliku auf den Lasan Tujang—Aussicht von dessen Gipfel—Topographische Aufnahmen—Geologische Verhältnisse des Quellgebiets—Über den Lasan Towong zurück zum Lagerplatz am Sĕlirong—Charakter der beiden Quellflüsse—Besteigung des Batu Balo Baung—Umschlagen des Bootes in den Stromschnellen Vereinigung der topographischen Messungen des Mahakam- und Kapuasgebietes—Heimkehr nach Long Blu-u nach einmonatlicher Abwesenheit.
Eine der wichtigsten Angelegenheiten, die mich, abgesehen vom Zuge zu den Kĕnja, an den Blu-u zurückgeführt hatte, war die schon lange geplante topographische Aufnahme des Quellgebiets des Mahakam und des Batu Tibang, des Grenzgebietes gegen Sĕrawak. Eine Reise in diese Gegend war mir bereits in den Jahren 1896 und 97 missglückt, im vorigen Jahre hatten wir hierzu keine Zeit gehabt, auch hatte der Pnihinghäuptling Bĕlarè keine Unternehmungslust gezeigt; so versuchte ich denn jetzt, den Zug mit Hilfe der Kajan zustande zu bringen. Kwing Irang fürchtete wie gewöhnlich, dass uns in diesen, den Kajan beinahe unbekannten Gegenden ein Unglück zustossen möchte und wollte anfangs seine Zustimmung nicht erteilen. Teils des Lohnes wegen, teils um wieder eine interessante Reise zu machen, fanden sich aber einige junge Männer bei mir ein, die zum Unternehmen bereit waren, und jetzt widersetzte sich Kwing nicht mehr ernsthaft, sondern beauftragte sogar seinen Ratgeber Anjang Njahu, mich als Anführer der Kajan zu begleiten. Kwing behauptete, selbst nicht mitgehen zu können, weil er, in Anbetracht der sehr mittelmässig ausgefallenen Ernte, seinen ganzen Reisvorrat beim Bau seines Hauses verbraucht hatte und daher am Mĕrasè Reis einkaufen musste. Zum Glück stellte sich später heraus, dass seine panjin doch noch Reis besassen. Ich beauftragte daher Demmeni, eine möglichst grosse Menge Reis in Long Tĕpai einzukaufen, was er auch tat. Im richtigen Augenblick kam ein Pnihing mit einem kleinen, aber starken Boot angefahren, das er den Long [53] Glat verkaufen wollte; es gelang Anjang Njahu, das Boot gegen ein Schwert, ein Fischnetz und zwei Stücke weissen Kattuns für mich zu erstehen. Ein Schwert und ein Netz besass ich zwar nicht, aber Anjang trat mir beides für Geld ab, so dass er auch noch einen Gewinn davontrug und ich um ungefähr 35 fl in den Besitz eines guten Bootes gelangte.
Als Bier ankam, waren bereits viele Vorbereitungen für den Zug getroffen, was um so nötiger war, als die trockene Jahreszeit ihrem Ende nahte (es war Ende September) und man überhaupt nur bei niedrigem Wasserstande daran denken konnte, den reissenden Mahakam bis zu seinem Ursprung hinaufzufahren. Da vorauszusehen war, dass das Unternehmen lange dauern würde, musste die Zahl der Teilnehmer mit Rücksicht auf den Reisvorrat möglichst beschränkt werden, weswegen ich Demmeni zu seiner grossen Freude keine photographischen Aufnahmen machen lassen konnte und ihn mit Doris, der auf diesem Zuge wegen der kurzen Rastzeiten doch keine bedeutenden Jagderfolge hätte haben können, am Blu-u zurückliess. Von den fünf Schutzsoldaten aus Samarinda, die sich hier in den ungewohnten Verhältnissen noch bei jeder Gelegenheit äusserst unbeholfen benahmen, sollten uns nur die zwei besten begleiten.
Am 30. September sollten wir, 30 Mann stark, in vier Böten abreisen, und noch am Tage vorher hatte ich mit den Kajan die Ausrüstung besprochen und ihnen ans Herz gelegt, für tuba-Gift zu sorgen, um, sowohl für unseren Unterhalt als für die Anlage einer Fischsammlung, einen kleinen Nebenfluss ausfischen zu können. Leider war das nicht geglückt und wir mussten unser Vertrauen auf die djala, das Wurfnetz, setzen.
Morgens stellte es sich heraus, dass zwei der tüchtigsten jungen Leute sich auf ihre Reisfelder begeben hatten und drei andere, Anjè Pĕla, Sawang Hugin und Sulang Orang unter allerlei Vorwänden nicht mitgehen zu können erklärten.
Eigentlich hatte nur der letztere einen wirklichen Grund, sich zurückzuziehen. Er war nämlich im Begriff Priester zu werden und befand sich in einer Periode von lāli, weil er seinem tō dājung geopfert hatte. Sulang Orangs Familie, die ihn nicht gern mitziehen lassen wollte, obgleich er selbst grosse Lust dazu hatte, verweigerte im letzten Augenblick aus diesen religiösen Gründen ihre Zustimmung zur Reise. Sie hatte aber nichts dagegen, dass Sulang Orangs Schwager Amei [54] den Zug mitmachte, und da dieser selbst sich bereit zeigte, beschloss ich, ihn mitzunehmen.
Was die Kajan in Wirklichkeit von der Beteiligung am Zuge zurückhielt, war mir nicht deutlich und konnte ich auch nicht leicht erfahren, da Kwing, die zuverlässigste Person im Dorfe, abwesend war. Es hatte den Anschein, als wolle man den Zug, wegen der Besorgnis des Häuptlings um unsere persönliche Sicherheit, überhaupt nicht unternehmen. Sowohl das Quellgebiet des Mahakam, in dem die Batang-Lupar aus Sĕrawak lange Zeit umhergeschwärmt waren, als der Batu Tibang, auf dem der Erzählung nach viele Geister, riesige Blutegel und andere gefährliche Tiere lebten, und den ich anfangs hatte besteigen wollen, waren nämlich sehr gefürchtet. Als ich aber Bo Kwai Adjung, einen für dajakische Verhältnisse aufrichtigen Mann, nach dem wahren Sachverhalt fragte, sagte er mir, dass in Wirklichkeit häusliche Umstände die Männer an diesem Tage an der Reise verhinderten und Kwing Irang überdies noch nicht endgültig mit ihnen gesprochen hätte.
An Stelle der beiden Männer, die sich morgens zu ihren Reisfeldern davon gemacht hatten, meldeten sich jetzt einige andere zum Zuge, und auch Anjè Pĕla und Sawang Hugin erklärten sich reisebereit, nachdem ich ihren weiblichen Familiengliedern, die durch allerhand Gegenstände, die sie für mich herstellten oder mir verkauften, viel verdienten, gesagt hatte, ich wolle mit ihnen nichts mehr zu schaffen haben, falls ihre Männer mich derartig betrögen. Kwing Irang, der abends zurückkehrte, verstand die Leute dazu zu bewegen, dass sie am 1. Oktober morgens endlich wirklich reisefertig dastanden, allerdings unter der Bedingung, dass ich ihren Taglohn auf 1 fl und Unterhalt erhöhte. Um nur fortzukommen und weil unser Unternehmen für die Kajan in der Tat ein Wagstück bedeutete, willigte ich sogleich ein, und bald darauf fuhren wir den Mahakam bei sehr günstigem Wasserstande aufwärts.
Kwing Irang führte seine Absicht, uns nach Long Kub zu begleiten, um bei den Pnihing einen guten Führer für uns zu suchen, nicht aus, sei es, dass die alte Hiang ihn aus Eifersucht nicht zu seiner jungen Frau lassen wollte, sei es, dass er in der kurzen Zeit keinen passenden Mann finden zu können glaubte. Wir waren somit auf eigene Kraft und Überlegung angewiesen.
Einmal unterwegs machten sich auch alle unsere jungen Männer [55] eifrig ans Werk, so dass wir, an Long Kub und Bĕlarès Niederlassung vorüberfahrend, abends bereits die Mündung des Tjĕhan erreichten. Nachdem wir dort im Hause des Häuptlings Anja: übernachtet hatten, fuhren wir am folgenden Tage mit der gleichen Schnelligkeit bis zur Mündung des Kaso. Unser Plan war, den Fluss so schnell und weit als möglich hinaufzufahren und von dem höchsten Punkte aus die Untersuchungen anzufangen. Der niedrige Wasserstand war für geologische Beobachtungen sehr geeignet, auch lassen sich diese weit besser während der ruhigen Auffahrt als bei der bewegten Abfahrt ausführen, aber ich musste damit rechnen, dass der Fluss überhaupt nur bei diesem günstigen Wasserstande befahrbar war und wir mit unserem Reisvorrat und daher auch mit unserer Zeit sehr sparsam umgehen mussten. Somit blieb mir nichts übrig, als dieses neue Gebiet nur im Vorüberfahren in Augenschein zu nehmen, ab und zu eine Notiz zu machen und im übrigen auf schnelles Vorwärtskommen zu achten. Bei der Rückfahrt hoffte ich, eingehendere Untersuchungen vornehmen zu können.
Gleich nach Sonnenaufgang, so schnell als das Abbrechen der Zelte und das Laden der Böte es gestattete, verliessen wir unseren Lagerplatz an der Kasomündung.
Als wir gegen 8 Uhr eine gute Landungsstelle und Brennholz fanden, hielten wir eine halbstündige Frühstückspause und ruderten dann ununterbrochen bis 4 Uhr nachmittags weiter. In den letzten Abendstunden wurde eine Waldstelle ausgehauen, eine Hütte gebaut, das Gepäck aus den Böten geholt und Essen gekocht. Gleich nach der Ankunft hatten sich einige Kajan mit dem Speer oder Netz zum Fischfang begeben; zu diesem Zweck hatten wir ein sehr kleines Boot mitgenommen, das von 2–3 Personen leicht gehandhabt werden konnte. Die Leute fingen in der Regel einen oder mehrere grosse Fische, so dass wir nur selten die Konserven anzugreifen brauchten. Da die Länge unseres Aufenthaltes in diesem unbewohnten Gebiet gänzlich von unserem Reisvorrat abhing, übernahm Bier die Aufsicht über den Reis und teilte jedem seine Portion zu. Die Kajan hatten übrigens auch jetzt einen eigenen Notvorrat an Reis oder ke̥rtăp mitgenommen.

Mann der Mahakam-Kajan
Den dritten Tag ging es von unserer malerischen Lagerstätte unter den grossen, überhängenden Uferbäumen weiter zum pankalan Mahakam, dem Anlegeplatz, an dem uns die Häuptlinge der Bahau ein Jahr zuvor, nach unserer Reise über die Wasserscheide, abgeholt hatten. [56] Die bis zu dieser Stelle flachen Ufer steigen hier plötzlich so steil an, dass an der Mündung des Howong keine hohen Bäume mehr an ihnen wachsen können. Der Howong ergiesst sich an seiner Mündungsstelle durch einen nur 10 m breiten, aber sehr tiefen Spalt des rechten Ufers, den er sich selbst in die Schiefer gegraben hat, in den Mahakam; weiter oben, wo er über lose Felsblöcke stürzt, bildet er 150 m hohe Wasserfälle. Von hier an verengt sich das Flussbett des Mahakam; hohe Felswände aus harten Schiefern und Hornstein erheben sich steil zu beiden Seiten, so dass ein Mensch nur an wenigen Uferstellen Raum zum Stellen findet und die Bootsstangen von den Wänden gleiten. Da das Wasser überdies zu tief war, um mit den Stangen den Grund erreichen zu können, hätten wir uns bei höherem Wasserstande überhaupt nicht fortbewegen können. Weiter oben flachte sich das Gelände wieder ab und die geringe Höhe des Uferwaldes, der sich über eine grosse Strecke ausdehnte, deutete an, dass hier einst die Reisfelder der Pnihing gestanden.
Auch am folgenden Tage fuhren wir an früherem Ackerland vorüber, bemerkten aber nur wenige Hütten; in diesen wohnten Pnihingmänner, die von der Jagd lebten und für Frau und Kinder daheim Nahrungsvorräte sammelten. Sie suchten auf den benachbarten Bergen wilden Sago und jagten mit ihren Hunden Wildschweine, deren Fleisch sie räucherten und deren Fett sie schmolzen, um es flüssig, ungesalzen, in frischen Bambusgefässen aufbewahren zu können. Zu bestimmten Jahreszeiten, wenn die Baumfrüchte reif sind, werden häufig so fette Schweine erlegt, dass ein einziges Tier eine Familie monatelang mit Fett versorgt. Das Wild ist in diesen ausgedehnten, von nur wenigen Bukatfamilien bewohnten Gebieten nicht scheu, die Jagd daher sehr lohnend. Die Pnihing schiessen auch Hirsche, da ihre adat ihnen Hornvieh zu essen erlaubt.
Die Jäger berichteten, dass wir weiter oben keine Jagdgesellschaften mehr antreffen würden, weil man sich aus Furcht vor den Batang-Lupar nicht weiter hinaufwagte, obgleich man von den Feinden nichts merkte; sie meinten auch, dass wir die Quellflüsse des Mahakam und den Landweg nach Sĕrawak bei diesem günstigen Wasserstande in fünf Tagen erreichen würden, was sich später als richtig herausstellte.
An diesem Tage passierten wir noch den Kiham Matandow (Sonnenfall), eine Stelle, an der der Fluss augenscheinlich eine der Ketten des Schiefergebirges durchbricht und die daher schwer zu überwinden ist.

Mann der Mahakam-Kajan
[57]
Der Fluss drängt sich hier mit starkem Gefälle zwischen einer beinahe senkrechten nackten Schieferwand links und einem Chaos von Felsblöcken rechts hindurch. Alle, die sich auf dem Wasser nicht sicher genug fühlten, stiegen hier aus und der stärkere Teil der Bemannung begann die Böte mit Rotangkabeln, bald längs des einen, bald längs des anderen Ufers aufwärts zu ziehen. Zur grossen Genugtuung der Kajan, die hier früher häufig mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt hatten, befanden wir uns mit allen Böten noch vor Sonnenuntergang oberhalb des Kiham Matandow; eine ähnliche Befriedigung empfand ich selbst darüber, dass wir den sehr beschwerlichen Weg über die Felsen ohne Arm- und Beinbruch zurückgelegt hatten. Leider entdeckten wir erst auf dem Rückwege, dass etwas weiter links ein sehr guter Pfad durch den Wald führte. Da es zum Weiterfahren zu spät war, schlugen wir auf der ersten besten Geröllbank unser Lager auf.
Von hier an begegneten wir keinen Menschen mehr, wohl aber vielen alten Hütten, die, ihrer Bauart nach, teils von Batang-Lupar teils von Bahau auf dem Wege nach Sĕrawak gebaut worden waren. Die feindlichen Hütten sahen, zur grossen Beruhigung unserer Kuli, am ältesten und verfallensten aus.
Oberhalb des Kiham Matandow verschmälerte sich das Flussbett immer mehr und zeigte an Stellen, wo es einen Bergrücken durchbrach, in der Regel nicht über 40 m Breite; dazu lag der Fluss voller Felsblöcke, die Stromschnellen verursachten. Trotz aller dieser Hindernisse kamen wir schnell vorwärts und übernachteten auf einer Flussbank gegenüber einer prachtvoll bewachsenen Bergkette.
Früh am anderen Morgen wurde aufgebrochen und an der Mündung des in das Mĕrasè-Gebiet führenden Sĕkè, eines grossen linken Nebenbusses des Mahakam, gefrühstückt. Wir erfuhren später, dass uns während der Mahlzeit eine Bande Punan vom Mĕrasè belauerte; sie hielt uns anfangs für Batang-Lupar und war, auch nachdem sie uns erkannt hatte, zu scheu, um näher zu kommen. Sie erzählten Kwing Irang, dem sie später am Mĕrasè begegneten, wo sie uns getroffen hatten.
Nachdem wir an einigen grossen Nebenflüssen vorbeigefahren waren, wurde der Hauptstrom schmäler und schmäler; da dass Flussgeschiebe ausserdem hie und da meterhohe, steile Bänke bildete, wäre es uns, wenn das Wasser nicht gerade jetzt infolge einiger Güsse gestiegen [58] wäre, wodurch die Böte sich leichter hinaufziehen liessen, nicht geglückt, bereits am neunten Tage am Sĕliku, dem rechten Quellfluss, vorüber zu fahren und noch am gleichen Tage den taga harok (Anlegeplatz der Böte) am Sĕlirong zu erreichen. Das Ziehen der Böte über das Flussgeröll war besonders am letzten Tage sehr mühsam gewesen, und ich hatte nicht nur das Boot verlassen, sondern auch beim Schleppen helfen müssen. Bei dieser Gelegenheit machte ich aufs neue die Beobachtung, dass die Bahau zwar bei weitem nicht so stark wie wir Europäer, aber dafür ausdauernder sind. Dass sich in dieser Gegend seit langer Zeit keine Menschen gezeigt hatten, bewies uns ein Hirsch, der uns vom Ufer aus in einem Abstand von kaum 10 m mit grossem Interesse beobachtete und durchaus nicht ans Fliehen dachte, sondern, erst nachdem unser Boot vorübergefahren war, mit bedächtigem Schritt in den Wald zurückkehrte.
Am taga harok war der Wald im Laufe der Zeit ausgerodet worden; in den mit Gestrüpp bewachsenen Lichtungen standen noch die halbverfallenen Hütten der letzten Reisenden. In einer Bucht lag auch noch ein altes Boot, das die Batang-Lupar augenscheinlich vor langer Zeit zurückgelassen hatten.
Die Männer fanden bald eine genügende Menge Holz, um Hütten zu bauen, in denen wir es uns noch vor Einbruch der Dunkelheit gemütlich machten, mit dem stolzen Bewusstsein, den Mahakam in aussergewöhnlich kurzer Zeit völlig hinaufgefahren zu sein. Der Sĕlirong ist bei niedrigem Wasserstande nur 10 m breit und weiter aufwärts der vielen Felsblöcke wegen nicht mehr befahrbar. Wir befanden uns hier an der Stelle, von der aus man am besten den Bergrücken, der längs des linken Ufers des Sĕliku zum Njangeian führt, besteigen kann. Früher benützte man das Flussbett des Sĕliku selbst als Weg, doch ist dieser wegen der zahlreichen Wasserfälle und glatten Schieferfelsen, über die man hinweg klettern muss, so beschwerlich, dass man jetzt lieber den 5–700 m hohen Bergrücken hinauf- und hinabsteigt.
Der taga harok liegt in einer Höhe von 550 m; wir waren also in neun Tagen ungefähr 300 m gestiegen, wonach man sich die Schwierigkeiten, die das Schleppen der Böte besonders in den letzten Tagen verursacht hatte, vorstellen kann. Der 10. Oktober war uns daher als Ruhetag sehr willkommen. Einige Männer wuschen unsere Kleider und trockneten sie in der Sonne, deren Strahlen bis zum Erdboden [59] durchdrangen; andere wieder trafen Vorbereitungen für die Landreise. Mit Rücksicht auf die kurze Dauer unseres Zuges nahmen wir nur das notwendigste Gepäck mit; denn es lag uns daran, so schnell als möglich den auf der Wasserscheide zwischen Mahakam und Batang-Rĕdjang liegenden und somit die Grenze gegen Sĕrawak bildenden Lasan Tujang zu erreichen. Von ihm aus sollte man sehr gut den Batu Tibang, den Mittelpunkt der Bahauwelt, den ich seit vielen Jahren bereits gesucht hatte, sehen können. Den Lasan Tujang hatten wir als das Endziel unserer Reise ausersehen, von ihm aus sollte Bier mit Tranche-Montagne und Massstäben den Weg bis zum Blu-u sorgfältig messen, während wir auf dem Rückwege ausserdem von einem Berg einen Überblick über die Umgebung zu gewinnen versuchen wollten.
Alles überflüssige Gepäck wurde auf ein Holzgestell gelegt und mit Segeltuch bedeckt; nachdem auch die Böte aufs Land gezogen und die Lasten verteilt worden waren, machten wir uns am 11. Oktober auf den Weg. Wir betraten einen breiten, wenig verwachsenen Pfad, der augenscheinlich seit vielen Jahren benützt wurde; trotzdem war die Besteigung des Abhanges des 1100 m hohen Lasang Towong, über den der Weg zum Lasan Tujang hinaufführte, sehr beschwerlich. Der Berg trägt seinen Namen nach einem Long-Glat “Towong”, der hier auf einer Handelsreise nach Sĕrawak auf Anstiften Bo Kulès, mit dessen Frau er in intimem Verkehr stand, von seinen Reisegenossen ermordet worden war.
Der Grat auf dem in nördlicher Richtung verlaufenden Bergrücken war zwar nur wenige Meter breit, doch blieb der Pfad gut; nur mussten wir, da er ständig 50–100 m fiel und wieder stieg, vor Ermüdung sicher 10 Mal Halt machen, bevor wir den 1200 m hohen Punkt, von dem aus der Weg wieder zum Sĕliku abwärts führte, erreichten. Zu meiner Verwunderung standen auf diesem Teil des Weges zahlreiche Hütten, obgleich Trinkwasser nur schwer zu erlangen sein musste. Die Kajan erzählten mir aber, dass sie auf ihren Handelsreisen soviel Salz mitnahmen, dass sie es der Schwere wegen nicht auf einmal befördern konnten, daher legten sie den Weg in Etappen zurück und machten bisweilen 3–4 Mal den Weg von einer Station zur andern, was sie zwang, in dieser grossen Höhe zu übernachten und das Wasser in der Trockenzeit 3–400 m weiter unten zu holen.
Die Bäume, die den Pfad beschatteten, schützten uns zwar vor der [60] brennenden Sonne, benahmen uns aber jede Aussicht. Nachdem wir 800 m tief ins Tal des Sĕliku hinuntergestiegen waren, betraten wir zu unserer Freude am rechten Ufer eine kleine Lichtung, die dadurch entstanden war, dass alle vorüberziehenden Gesellschaften hier ihr Lager aufschlugen und die nächsten Bäume fällten. Da hier in der Nähe wenig brauchbares Holz zu finden war, begnügten wir uns mit einer Punan-Hütte, die nur aus einer in einem Winkel von 60° geneigten Wand bestand. Indem wir diese mit Segeltuch bedeckten und auch seitlich, zum Schutz gegen den Regen, ein Segeltuch spannten, stellten wir uns in kürzester Zeit ein Nachtasyl her. Wir beiden Europäer schliefen in der Mitte, unsere Malaien an der einen und die Kajan an der anderen Seite. Zur grossen Beruhigung letzterer war mein Hund, der wie immer neben meinem Klambu schlief, diese Nacht sehr wachsam und schlug mehrmals an. Sein Gebell, das wahrscheinlich den um unser Lager schleichenden Tieren des Waldes galt, betrachteten unsere farbigen Reisegenossen als ein ausgezeichnetes Abschreckungsmittel für eventuelle Feinde, die uns in diesem gefürchteten Gebiet beschleichen konnten.
Als wir am anderen Morgen dem Bette des Sĕliku bis zum Fuss des Lasan Tujang folgten, begriffen wir, warum die Bahau lieber den Weg über den Lasan Towong einschlugen: das nur 10–12 m breite Flussbett ist nämlich entweder sehr tief und von senkrechten Wänden eingeschlossen, oder flach und dann voller Felsblöcke. Wenn die tiefen Stellen nicht durchwatet werden können, ist man gezwungen, längs des Ufers über hervorragende, glatte Schieferfelsen zu gehen, was gefährlich und anstrengend ist. Nicht nur wir beschuhten Europäer und unsere ungeschickten Küstenmalaien, sondern auch die schwer beladenen Kuli waren froh, dass wir bald den Fuss des Lasan Tujang erreichten. Dies ist ein steiler Kegel, der sich 150 m hoch über einen Grat erhebt und daher als Aussichtspunkt sehr geeignet ist. Auf dem steilen Pfade nahmen uns aber die Bäume jeden Ausblick, auch war die ganze Landschaft noch um 11 Uhr morgens in Nebel gehüllt. Auf dem Gipfel angekommen ruhten wir uns im Sonnenschein auf der kleinen Rasenfläche, die dem Gipfel wahrscheinlich seinen Namen gegeben hat (lasan = Fläche; tujang = grün) erst aus und liessen dann die Männer die Bäume an den südlichen, östlichen und westlichen Abhängen des Gipfels fällen; nach Norden, nach Sĕrawak hin, war eine Aussicht weniger notwendig, auch war die Arbeit ohnehin schwer genug. [61]
Vor ungefähr 20 Jahren hatte zwar Kwing Irang, als er sich während eines me̥lo̱ njaho̱ auf dem Lasan Tujang aufhielt, einen Teil des Waldes am östlichen Abhang, um Aussicht auf den Batu Tibang zu gewinnen, fällen lassen; doch hatten die Bäume jetzt bereits alle die gleiche, nicht bedeutende Dicke; leider war das Gebirgsholz hier wieder besonders hart.
Die Männer machten sich mit dem Eifer, den sie während der ganzen Reise zeigten, ans Werk; um m Uhr fielen bereits die ersten Bäume. Diese systematisch von unten an halb durchhacken und dann von oben ein paar grössere Exemplare so hinunterstürzen zu lassen, dass sie die unteren zugleich niederrissen, gelang nicht vollständig, weswegen die Kuli zwischen halb und ganz gestürzten Bäumen die noch stehen gebliebenen fällen mussten, eine schwierige Arbeit. Gegen Abend war der östliche Abhang doch so weit ausgehauen, dass wir eine freie Aussicht auf den Batu Tibang geniessen konnten. Der gewaltige Eindruck, den dieser Berg auf die Eingeborenen macht, beruht vielleicht ebenso sehr auf seinem Äusseren als auf der Tatsache, dass er ihren grössten Flüssen den Ursprung gibt. In der dunkelgrünen Masse der Urwälder, die alle bis 1800 m hohen Rücken bedecken, sind weder Felsen noch Bergstürze zu sehen, nur der Batu Tibang erhebt seinen spitzen Gipfel mitten in einem Gebirgsmassiv, dessen sehr steile weisse Wände sich aus der finsteren Umgebung, mit der sie in keinem direkten Zusammenhang stehen, leuchtend abheben. Es schien mir, dass dieses Massiv von den Bergrücken des Kettengebirges, das, von hier aus in südlicher Richtung gesehen, den gleichen Charakter wie am oberen Kapuas trägt, unabhängig ist. Das Massiv erhebt sich genau östlich vom Lasan Tujang in Form eines Kegels mit sehr steilen, grauweissen Wänden, die sich in einer Höhe von 1400 m nach innen neigen und dann mit schwacher Abdachung in 1800 m hohe, sehr spitze Gipfel verlaufen. Nach Norden, Nord-Westen und Ost-Süd-Osten entsendet das Batu-Tibang-Massiv Ausläufer; der südöstliche scheint mit einem hohen Rücken, der die Wasserscheide zwischen dem Gebiet des Kajan und des Oga bildet, zusammen zu hängen. Nach Süd-Osten kamen, getrennt von ihrer Umgebung, kleinere Massive von gleichem Charakter zum Vorschein. Der höchste Gipfel eines dieser Massive heisst Batu Tibang Ok (= kleiner Batu Tibang).
Wir sahen deutlich, dass das Flusstal des Tĕkĕn in den Batu Tibang [62] nach Westen tief einschneidet, dann gerade auf den Lasan Tujang zuläuft und sich um dessen Fuss nach Norden windet. Einige Malaien sagten mir später, dass der Tĕkĕn ein Nebenfluss des etwas östlicher entspringenden Nangeian ist.
Am folgenden Morgen liess ich sogleich die Bäume, welche die Aussicht nach Süden benahmen, fällen. Zu unserem Leidwesen befanden wir uns nicht hoch genug, um in der Frühe über die Wolken hinübersehen zu können und mussten lange warten, bevor die nächste Umgebung sichtbar wurde; trotzdem gelang es Bier, das im Laufe des Tages allmählich auftauchende Gebiet aufzunehmen. Im Westen sahen wir nur ein enges Tal, das die (wellen des Sĕliku birgt und im Westen und Norden von zwei hohen Rücken eingeschlossen wird. Erst abends, als sich alle Wolken erhoben hatten, bemerkten wir gen Süden den Lasan Towong und, in weit grösserem Abstand als wir erwartet hatten, die pittoresken Formen eines Gebirges, das dem Kalkgebirge am oberen Sĕrata und Mĕrasè sehr ähnelte.
Den folgenden Tag zogen wir weiter, nachdem wir alle von unserem Standplatze aus möglichen Aufnahmen ausgeführt hatten. Der Abschied fiel uns nicht schwer, da wir noch nie zuvor auf der Reise so stark wie hier von Bienen und Wespen geplagt worden waren. Bienen, kaum so gross wie kleine Fliegen, hatten es hauptsächlich auf unsere Augen, Ohren und Nasenlöcher abgesehen, doch stachen sie nicht, was die gleich grossen Wespen mit Vorliebe taten. Diese wiederum schätzten besonders die Haut zwischen den Fingern, in die sie, wenn wir die Finger unwillkürlich bewegten, sogleich ihren Stachel senkten. Auch an grossen Exemplaren fehlte es nicht, aber die konnte man wenigstens besser sehen und hören. Gegen die kleinen Tiere suchten wir uns durch Kajuputi-Öl zu schützen, das wir in grosser Menge auf die Haut strichen.
Für die Rückreise am 14. Oktober hatte ich bestimmt, dass Bier mit einigen Trägern für die Instrumente vorausgehen sollte, um den Weg zu messen, während ich das Abbrechen des Lagers überwachen und dem Vortrab das Essen bringen sollte, das er unterwegs einnehmen konnte. Die Kajan waren anfangs zur Eile nicht aufgelegt, wurden aber doch eifriger, als Bier vor dem Abmarsch noch über der Wolkenschicht einige Peilungen ausführte und ich einen Baum als Fahnenstange zuhauen liess. Zu diesem Zwecke hackten einige Männer von einem hohen Baume die Äste ab und befestigten an [63] dessen Spitze die niederländische Fahne, die Dĕlahit tags zuvor aus rotem, weissem und blauem Kattun genäht hatte. Die Kajan glaubten, dass diese Fahne, als Zeugin der Anwesenheit Weisser, die Batang-Lupar für lange Zeit davon abschrecken würde, auf diesem Wege in das Mahakamgebiet einzudringen. Jedenfalls bewies die Fahne auf sichtbare Weise unseren Zug, von dem man in weitem Umkreise reden würde.
Darauf richtete Bier sein Instrument nach Süden, seine Begleiter ergriffen die Massstäbe, riefen “dā, dā” und waren nach wenigen Messungen den Abhang hinunter verschwunden. Auch wir hatten bald gepackt und das Essen gekocht; die Verteilung der Lasten ging schnell von statten, da die schwerste Last, der Reis, beinahe vollständig aufgezehrt war. Bei unserem Aufbruch begannen auch meine Kajan “dā, dā, kĕ uli, kĕ uli” zu rufen; sie setzten den Ruf bis 50 m weit den Berg hinunter fort. Mit da riefen sie ihre Seelen an, die sie vor dem Zurückbleiben warnten, indem sie ihnen erklärten: kĕ uli = ich gehe nach Hause.
Auf dem Lasan Tujang selbst war, wie ich bereits auf dem Hinwege bemerkt hatte, nicht viel Gestein zu sehen, ich konnte es daher erst am Fuss des Berges, im Tal des Sĕliku untersuchen. Der Lasan Tujang wird, gleich seiner ganzen Umgebung, aus senkrecht stehenden Schiefern gebildet, auf denen hie und da mehr horizontal gelagerter Sandstein liegt, der hier stark verwittert und nicht so deutlich geschichtet ist, wie weiter unten im Sĕlirong.
Nach meiner Abmachung mit Bier schlug ich unser Lager im Tal des Sĕliku an der Stelle auf, die er mit seinen Messungen um 4 Uhr nachmittags erreichen sollte. Inzwischen hatte ich Zeit, das Flussgeschiebe zu untersuchen und mir einen Felsblock anzusehen, den die Bahau seiner Eigenartigkeit wegen batu ham (Schuppentier) nennen. Es war ein Basaltblock, der im Fluss, vom Ufer halb verborgen, lag und ganz aus aneinander schliessenden Basaltsäulen bestand; die eine Seite trug deutliche Rinnen, die andere, an der die Säulen abgebrochen waren, hatte eine schuppige Oberfläche. Später fand ich, u.a. oberhalb des Kiham Matandow, noch mehr derartiger Blöcke, die augenscheinlich besser als ihre Umgebung der Erosion Stand gehalten hatten.
Im Lager übergaben wir unsere durchnässten Kleider und andere Gegenstände sogleich den Malaien, die sie in die Sonne zum Trocknen [64] aushängten; doch wurde ihre blosse Haut von Bienen und Wespen so sehr misshandelt, dass sie es kaum bei der Arbeit aushielten.
A m anderen Morgen beschloss ich, zu versuchen, über den Lasan Towong bis zu unserem Lagerplatz am Sĕlirong vorzudringen. Da Bier mich an diesem Tage schwerlich einholen konnte und ich am Sĕlirong noch die Böte und andere notwendige Dinge für die Abfahrt vorbereiten lassen musste, gab ich Bier Proviant mit und alles, was er zum Übernachten nötig hatte, damit er uns später langsam folgen konnte.
Nach dem Frühstück brach ich unverzüglich auf, um auch die Leute zur Eile anzuspornen; ich wollte nämlich noch den Gipfel des Lasan Towong teilweise aushauen lassen, damit Bier einige wichtige Peilungen vornehmen konnte. Wie sehr ich in den letzten Tagen trainiert worden war, merkte ich daran, dass ich ohne Unterbrechung die ersten 400 m bis auf den Rücken zurücklegte, auf dem auf- und absteigenden Grate, der uns auf dem Hinwege wohl 10 Mal zum Ausruhen gezwungen hatte, weiter marschierte und nur da Halt machte, wo das Gestein eine Untersuchung verlangte. Dieses bestand ganz aus verwitterten ziegelroten Schiefern, die zu dem ungefähr nach Nord-Süden sich erstreckenden Bergrücken senkrecht standen. Einige weisse Adern eines verwitterten Minerals, wahrscheinlich Quarz, unterbrachen den einförmig roten Ton der Schiefer.
An den sehr steilen Abhängen des Lasan Towong wuchsen keine Bäume, daher ging das Aushauen des Gipfels schnell von statten. Wir sahen von hier aus in das Tal des Sĕlirong, der südlich von dem hohen Rücken strömt, der ihn vom Tĕkĕn scheidet. Das Tal setzte sich um das östliche Ende dieses Rückens fort, was meine Vermutung, dass der Sĕlirong auf dem Batu Tibang oder in dessen unmittelbarer Nähe entspringt, zu bestätigen schien. Nirgends waren helle Bergwände zu sehen, sondern nur mehrere Reihen dunkelgrüner, von Ost nach West ziehender Ketten, die von anderen, nordsüdlich gerichteten Ketten durchkreuzt wurden.
Nach vollbrachter Arbeit brachen wir bereits um 3 Uhr zu unserem Lagerplatz auf, der nur noch eine Stunde entfernt war. Dort fanden wir alles, wie wir es verlassen hatten, und in kurzer Zeit waren auch unsere Zelte wieder aufgeschlagen. Das Wasser im Sĕlirong war etwas gestiegen und zum Baden beinahe zu kalt.
Den folgenden Tag schienen meine Leute als Ruhetag ausersehen [65] zu haben, denn sie waren nicht dazu zu bewegen, im fischreichen Sĕlirong Fische zu fangen und als Vorrat für die weitere Reise zu räuchern; sie taten nur das Notwendigste und sammelten im übrigen neue Kräfte.
Um den Sĕlirong weiter aufwärts zu erforschen, begab ich mich mit einigen Männern zu Fuss das Flussbett hinauf und liess für das Passieren der tieferen Stellen ein Boot nachschleppen. Da dieses jedoch durch den Transport litt, gingen wir nicht weit, was übrigens auch nicht notwendig war, da ich bereits in der Nähe unseres Lagerplatzes, deutlicher als im Sĕliku, auf senkrechten Schiefern beinahe wagrechten Sandstein angetroffen hatte. Ausserdem liessen sich aus dem Befund der Geschiebebänke in Verbindung mit dem eigentümlichen Aussehen des Batu Tibang interessante Schlussfolgerungen ziehen. Während nämlich der Sĕliku ausschliesslich Schiefer, Quarz, Basalt und Sandstein mit sich führt, besteht das Geschiebe des Sĕlirong aus sehr verschiedenartigem vulkanischem Gestein und Schiefer, was unsere Vermutung, dass der Sĕlirong seinen Ursprung in einem vulkanischen Gebirge nimmt, beinahe zur Gewissheit machte.
Abends langte auch Bier im Lager an. Er hatte die letzte Strecke Wegs noch nicht gemessen und begab sich daher am folgenden Morgen gleich nach Sonnenaufgang zurück, das Versäumte nachzuholen, während wir das Essen kochten, das Gepäck in die Böte luden und alles zur Abreise vorbereiteten. Auch für die Flussfahrt sollte sich unsere Gesellschaft teilen: indessen Bier mit drei Böten den zurückgelegten Weg immer weiter sorgfältig aufnahm, wollte ich allein den Fluss hinunterfahren, um geologische Untersuchungen vorzunehmen. In nicht allzugrossem Abstand wollte ich dann einen geeigneten Lagerplatz suchen und Bier dort erwarten, damit wir wenigstens nachts alle vereinigt wären; dieser Plan wurde in den nächsten Tagen auch stets eingehalten. Abends, nach dem Aufschlagen der Zelte, fanden die Leute noch reichlich Zeit, um Fische zu fangen. Einmal schloss auch ich mich den Fischern an. Sie liessen unser etwas zu grosses Boot von der Strömung still hinunter führen und trieben die grossen Fische, die man im kristallklaren Bergwasser noch in Grosser Tiefe schwimmen sah, vor uns her nach flacheren Stellen. Hier schleuderte der an der Bootsspitze stehende Mann seinen Speer auf den Fisch. Traf die Waffe schief, so riss sie beim Abgleiten einige Schuppen ab; bei grossen Exemplaren konnte ich sogar den Aufschlag [66] der Speerspitze auf den Fisch hören. Meist gelang es dem Fischer unwillkürlich, der trügerischen Tiefe des Wassers Rechnung zu tragen und den Speer mitten durch das Tier zu treiben, worauf er sich sogleich auf die Beute warf, bevor sie ihm davonschwamm. Einmal traf der Mann einen Fisch unmittelbar oberhalb einer Stromschnelle, die das Tier, die lange Lanze im Leibe, noch hinunterschwamm. Wir sahen den Stock in und über den schäumenden Wassermassen auf- und niedergehen, bis wir uns ein grosses Stück weiter, in ruhigerem Wasser, seiner und mit ihm des grossen Fisches bemächtigten. Sogar nur 3 dm lange Fische trafen meine Begleiter noch mit dem Speer, aber meist schnitt dieser sie mitten durch und die Stücke sanken und trieben abwärts. In der Regel werden aber Fische unter 4 dm Länge mit dem Wurfnetz gefangen.

Mann der Mahakam-Kajan.
Infolge häufiger Regengüsse schwoll der Sĕliku stark an, doch wurden wir zum Glück bei dem Hinabfahren keinen Tag durch Hochwasser aufgehalten, wie es bei dem Hinauffahren sicher der Fall gewesen wäre. Wir kamen täglich ein gutes Stück vorwärts, nur war es schwierig, das Fahrwasser wiederzuerkennen, denn an Stellen, die bei niedrigem Wasserstande Stromschnellen bildeten, floss das Wasser jetzt ruhig über die Felsblöcke, während in den Buchten und an den Felsvorsprüngen neue Schnellen entstanden waren. Derartige Gebirgsflüsse sind daher nur; wenn man sie gut kennt, bei jedem Wasserstande befahrbar; leider war dies bei meinen Kajan nicht der Fall, da nur wenige von ihnen diesen Teil des Mahakam überhaupt einige Male besucht hatten. Sie waren daher sehr vorsichtig und gingen immer wieder eine Strecke längs des Ufers zu Fuss voraus, um sich eine gefahrdrohende Flussstelle vorher anzusehen.
Unser Reisvorrat, der seinem Ende nahte, mahnte zur Eile, auch hatten viele unserer Leute bereits ihren eigenen Notvorrat angegriffen. Drei unter einander befreundete junge Kajan, die ihren Reis zusammengetan und gegen eine Lohnerhöhung während der Reise davon gezehrt hatten, waren jetzt ebenfalls auf unseren Vorrat angewiesen. Trotzdem konnte ich, als wir am 21. October oberhalb des Kiham Matandow unser Lager aufschlugen, der Versuchung nicht widerstehen, den Batu Balo Baung zu besteigen, der sich neben uns am rechten Ufer erhob und eine gute Missicht auf die Umgebung zu bieten versprach. Die Bäume auf dem Gipfel dieses Berges, der wie alle anderen in dieser Gegend das Glied einer Kette bildet, konnten leicht entfernt [67] werden, da er spitz zuläuft. Die Pnihing fürchten den Batu Balo Baung als den Wohnsitz eines weiblichen Geistes, der seinen Gatten verloren hatte (balo), doch zeigten sich die Kajan zum Mitgehen bereit. Die beiden Malaien aus Samarinda liess ich zurück, da sie schlechte Bergsteiger waren und sich vom anstrengenden Ziehen der Böte angegriffen, wenn auch nicht gerade krank fühlten.

Mann der Mahakam-Kajan.
Der zum Gipfel des Berges führende Grat erhebt sich steil aus dem Mahakamtal und war mühsam zu besteigen. Wäre der Boden hart gewesen und hätten wir am Gestrüpp keinen Halt gefunden, so wären wir bei einer Steigung von 40–45° nicht hinaufgekommen. Der vorderste Mann musste dazu erst einen Pfad aushauen, so dass es mehrere Stunden dauerte, bevor wir den ersten, 900 m hohen Gipfel erreichten. Auf dem etwas weiter liegenden höchsten Gipfel liess ich für 1–2 Nächte ein Lager aufschlagen, was schneller von statten ging als das Fällen der Bäume, deren Holz hier wieder sehr hart war; topographische Aufnahmen konnten daher am ersten Tage noch nicht gemacht werden. Morgens bedeckte uns und die ganze Umgebung eine dicke Wolkenschicht, die sich nur sehr langsam erhob, weswegen Bier erst gegen 12 Uhr mit dem Anpeilen der wichtigsten Gipfel auf der Wasserscheide, die vom Kapuri aus sorgfältig bestimmt waren, beginnen konnte. Wir benützten diese Peilungen bei der späteren Übertragung der Messungen aufs Papier als Kontrolle. Unsere Aussicht war beschränkt, da uns im Osten und Westen viel höhere Rücken umgaben; sie trugen den gleichen Charakter wie die am Kapuri und weiter oben am Mahakam und waren auch hier von einem einheitlichen, faltenreichen, grünen Gewande bedeckt, ohne irgendwo Gestein hervortreten zu lassen; ihr Anblick war grossartig aber düster. Im Osten führte eine tiefe Schlucht auf einen 1600 m hohen Rücken, von dem aus sich zwei Seitenrücken bis dicht an das Ufer des Mahakam erstreckten, der selbst nur hie und da zwischen den überhängenden Uferbäumen hindurchschimmerte. Die Abhänge des Batu Balo Baung benahmen uns nicht die Aussicht, da sie an mehreren Stellen selbst so steil waren, dass wir sie nicht sehen konnten.
Meine Kajan hielten hier das Fällen der Bäume für sehr gefährlich, was ich ihnen auch glaubte, als ich die Bäume wie in einem leeren Raum hinunterstürzen, dazwischen an einen Felsen prallen und einige hundert Meter weiter unten aufschlagen hörte.
Wurde uns die Aussicht nach Westen durch die Wasserscheide gegen [68] den Kapuri und die Rücken, die sich von ihr aus zum Mahakam erstrecken, benommen, so hatten wir nach Nord-Osten einen prachtvollen Blick ins Mahakamtal, das vier Rücken durchbricht. In der Regenzeit, wo die Luft klarer ist, hätten wir eine bessere Fernsicht genossen. Jetzt befanden wir uns leider auch am zweiten Morgen nicht über den Nebelmassen.
Der Berggeist, der sich nachts sehr ruhig verhielt, liess tagsüber, besonders wenn die Sonne schien, ein Heer von stechenden und saugenden Insekten auf uns los, vor denen ich mich, wenn ich nicht das Fällen der Bäume zu beaufsichtigen hatte, sogleich in mein Klambu rettete, da Bier alles Kajaputi-Öl nötig hatte, um sich während der Arbeit zu schützen.
Am Morgen des 24. Oct. fand nach beendeter topographischer Arbeit der Abstieg statt, der uns zwar leichter fiel als der Aufstieg, der Steilheit des Abhanges wegen aber immerhin sehr ermüdend war. Ausserdem wurden wir ständig durch die Kuli aufgehalten, die unterwegs Früchte sammelten oder tuba parei und tengang zur Herstellung von Schnüren hackten, wogegen ich nichts einwenden konnte, da unsere Netze einer Reparatur dringend bedurften. Unten angelangt griff ich zum sichersten Mittel, die Leute zur Eile anzuspornen, nämlich zum Abfeuern einiger Schüsse, die ihnen in einer derartig einsamen Umgebung immer Schreck einflössen. Sie eilten denn auch schleunigst herbei, so dass wir über den Fluss zu unserem Lager setzen konnten, wo wir alles in guter Ordnung wiederfanden und die zurückgebliebenen Männer sich inzwischen etwas erholt hatten.
Leider begann das Wasser, das uns bisher so günstig gewesen war, des Morgens so schnell zu steigen, dass Bier bereits früh aufzubrechen beschloss, um noch die Fälle des Matandow passieren zu können. Ich gab ihm noch einige meiner Kuli mit, die längs des Uferpfades zu mir zurückkehren sollten, doch sandte mir Bier mit diesen auch noch drei seiner eigenen Leute, weil das Wasser in kurzer Zeit zwei Meter gestiegen war und das Gepäck desshalb beim Hinunterfahren über den Kiham Matandow nicht im Boote bleiben konnte, sondern zu Lande bis unterhalb der Wasserfälle getragen werden musste.
Während die Männer ihre Mahlzeit einnahmen, fiel das Wasser wieder so weit, dass das leere Boot ohne Anstrengung über die Fälle geschafft werden konnte. Unser Hab und Gut wurde inzwischen auf dem früher entdeckten guten Pfade hinab befördert. [69]
Bis wir unterhalb des Matandow angelangt waren und alles Gepäck sich wieder im Boote befand, war es Mittag geworden, doch wurde mit dem angenehmen Bewusstsein, die schwierigste Stelle hinter dem Rücken zu haben, die topographische Arbeit begonnen.
Mit Rücksicht auf die heftige Strömung vereinbarten wir, dass ich nur 1½ Stunden weiter fahren sollte, damit Bier uns leichter einholen konnte. In meinem Boote befand sich beinahe die ganze Zeltausrüstung, doch trugen besonders die schweren Kisten mit der Gesteinsund Fischsammlung dazu bei, dass das nicht sehr grosse Boot tief ins Wasser eintauchte. Da das Wasser unterhalb der Fälle ausserdem sehr bewegt war, strengten sich 6 unserer Kajan an, das Boot längs des Ufers, ausserhalb des hohen Wellenganges in der Flussmitte, zu halten.
Wir gelangten auch glücklich über diese Stelle und eine weiter unten gelegene Stromschnelle; übrigens beunruhigte ich mich nicht sonderlich, weil drei der tüchtigsten Männer die Führung übernommen hatten: Anjang Njahu und Maring Kwai sassen am vorderen, Sawang Hugin am hinteren Bootsende. Plötzlich, hinter einer Flussbiegung, geriet das Fahrzeug in heftig bewegte Wassermassen und wurde von einer Welle auf die andere geschleudert. Zwar versuchten die Männer, das Boot mit Anspannung aller Kräfte und Anwendung ihrer ganzen Steuerkunst zum Ufer hinzulenken, aber die Spitze erhob sich nicht schnell genug, das ohnehin überladene Fahrzeug sank und die Wellen schlugen von allen Seiten hinein. Ich erinnere mich nur noch, dass Anjang Njahu mir etwas zurief. Vielleicht verlor ich für kurze Zeit die Besinnung, jedenfalls weiss ich nur, dass ich mich unter Wasser treiben fühlte, ohne von Boot oder Mannschaft etwas wahrzunehmen. Bei der rasenden Strömung blieb mir nichts übrig, als so schnell als möglich an die Oberfläche zu gelangen; so schlug ich denn mit Armen und Beinen kräftig aus und bekam, bevor ich noch zu sehr betäubt war, erst mit der linken, dann mit der rechten Hand etwas Festes zu packen, augenscheinlich die Ränder des umgekippten Bootes, unter dem ich trieb. Ein kräftiger Ruck half mir heraus und einige Schläge brachten mich nach oben. Meine Augen standen noch voll Wasser und ich hatte noch kaum Luft schöpfen können, als ich erst am Kopf, dann an den Schultern gepackt und auf die runde Bootsunterseite hinaufgezogen wurde. Fünf Kajan und Abdul sassen bereits oben, daher schwamm das Boot tief in dem durchwühlten Wasser, [70] und sein glatter, runder Kiel bot mir, der ich an dergleichen Vorfälle nicht gewöhnt war, einen nichts weniger als festen Sitzplatz. Die Kajan schwiegen, nur Abdul, der hinter mir sass und mich voller Angst umklammert hielt, rief fortwährend: Tuwan, Tuwan! (Herr, Herr!), so dass ich ihn mit “tida apa” (es ist nichts) beruhigen musste. Unterdessen suchte mir Anjang Njahu mit Gewalt die Kleider vom Leib zu reissen, aber der starke Kaki widerstand seinen Bemühungen und er konnte nur meinen geologischen Hammer aus der Tasche ziehen und in den Fluss werfen. Bevor er noch weiteres ausrichtete, wurde das Boot von einer neuen Stromschnelle ergriffen, wobei jeder an sich selbst denken musste und ich vom Boot ins Wasser glitt. Mit einigen Schlägen war ich jedoch bald wieder an der Oberfläche, wo ich einen treibenden Schild zu packen bekam. Mich an die dajakische Weise Flüsse zu durchschwimmen erinnernd, fasste ich den Griff des Schildes mit der einen Hand, hielt diesen selbst unter mir und schwamm so halb treibend zuerst neben dem Boote, dann, als ich vor einem vorspringenden Felsen in ruhigeres Wasser gelangte, ans Land. In voller Ausrüstung, den Revolver an der Seite, war das Schwimmen sehr anstrengend, doch erreichte ich glücklich das Ufer, bevor mich die Strömung etwas weiter unten in einen neuen Strudel zog. Die 6 Männer, die mir nach ins Wasser gesprungen waren, zogen das Boot jetzt an einem Rotang ans Land, und dann standen wir triefend, unserer Habe beraubt, neben einander am Waldessaum. Anjang Njahu, der sich als Anführer für das Unglück verantwortlich fühlte, blieb anfangs scheu zur Seite stehen und trat erst, als er sah, dass ich nicht zürnte, mit bleichem Gesicht auf mich zu und fragte, ob ich verwundet wäre. Auch Tingang Sulang kam, um sich von meinem Wohlergehen zu überzeugen. Er war, da er mich nach dem Umschlagen nicht mehr an die Oberfläche hatte kommen sehen, wieder ins Wasser gesprungen und dann ebenfalls mit dem Boote abwärts getrieben worden. Maring Kwai fehlte noch, doch hatte man ihn auf meinen mit Riemen zusammengeschnürten Matratzen hinunterfahren sehen; augenscheinlich war auch er irgendwo gelandet.
Eigentümlicher Weise war mein erstes Empfinden nach der Rettung Selbstbefriedigung über die Geistesgegenwart, mit der ich mich durch die Schwierigkeiten hindurch gerungen hatte; erst viel später fühlte ich dankbare Freude über meine Lebenserhaltung.
Den Verlust unseres Gepäckes betrauerte ich lebhaft, da an ein [71] Auffischen der Sachen nicht zu denken war. Ich hatte zwar beim ersten Auftauchen eine eiserne Kiste und mein Moskitonetz vor mir schwimmen sehen, doch waren sie mit allem anderen gewiss längst gesunken. Meine wertvollen Sammlungen waren unwiderruflich verloren, ebenso die Konserven, die wir uns vom Munde gespart hatten. Besonders bedauerte ich den Verlust meines prachtvollen Jagdgewehrs, eines Fernrohrs, einiger Barometer und Bücher. Meine geologischen Aufzeichnungen und den geologischen Kompass fand ich zu meiner Freude noch in meinen Taschen; auch war der Schmiedehammer an dem hölzernen Gestell, das im Boote als Fussboden diente, hängen geblieben. Dass wir unseren Reis verloren hatten, machte mich sehr besorgt; zum Glück hatte sich nur ein halber Packen im Boote befunden und führte Bier den Hauptvorrat mit sich. Das grosse Segeltuch, mit dem wir die Reispacken zugedeckt hatten, war also auch gerettet.
Sehr bald erschien Bier an der Unglücksstätte, denn Maring Kwai war, gleich nachdem er sich ans Ufer gerettet hatte, zu ihm gelaufen und hatte ihm weinend den Vorfall berichtet. Maring hatte meine Matratze gerettet, was mir sehr angenehm war. Meine Kajan schienen mir durch den gänzlichen Verlust ihrer Habe für den Unfall, den sie durch grössere Aufmerksamkeit vielleicht hätten vermeiden können, genügend schwer bestraft; überdies hatte ich ja auch den Zug in dieses ihnen fast unbekannte Gebiet auf eigene Verantwortung unternommen.
Nachdem ich mich aus Biers Garderobe mit trockener Kleidung versehen hatte, beschlossen wir, an diesem Tage nicht weiter zu fahren, sondern zu beraten, wie uns aus der kritischen Lage zu helfen sei. In den letzten Strahlen der untergehenden Sonne trocknete ich meine Uhr, meinen Revolver, den geologischen Kompass und meine Kleider. Als unsere Männer den ersten Schrecken überwunden zu haben schienen, wurde in einem Kriegsrat bestimmt, dass ich mit nur einem Boote und der nötigen Bemannung ohne Aufenthalt bis zum Blu-u durchreisen und dafür sorgen sollte, dass man Bier von dort aus so schnell als möglich mit Reis versah. Eile war um so gebotener, als am folgenden Tage das Wasser so schnell stieg, dass wir nicht abfahren konnten und von unserem wenigen Reis zehren mussten.
Die Kajan, die zurückbleiben sollten, fürchteten sich hauptsächlich vor dem Hunger und meinten daher, es sei unmöglich, jetzt noch den Kaso [72] hinaufzufahren. Bier und ich hatten unter den obwaltenden Umständen an die Ausführung dieses unseres anfänglichen Planes überhaupt nicht mehr gedacht, da wir nun aber sahen, dass die Kajan ihn doch nicht für gänzlich unausführbar hielten, versuchten wir, ihn doch durchzusetzen. Abgesehen davon, dass der Kaso sorgfältig gemessen werden konnte, bot dieser Extrazug den Vorteil, dass Bier seine Aufnahme da anschliessen konnte, wo Werbata sie im Gebiet des Pĕnaneh geendet hatte. So wurde denn vereinbart, dass Bier zuerst den Kaso aufnehmen und dann den Pĕnaneh bis zur früheren Niederlassung der Pnihing, wo Werbatas Beobachtungsposten lag, hinauffahren und von dort aus den Mahakam messen sollte. Wenn möglich, sollte er auch ein hochgelegenes Reisfeld besteigen, um eine Übersicht über das Land zu gewinnen.
Infolge ihres starken Gefälles hält ein hoher Wasserstand in Gebirgsflüssen nie lange an, so konnten wir bereits am folgenden Morgen, als alles noch von schwerem Nebel bedeckt lag, in unser leeres Boot steigen. Die schwächsten und unbrauchbarsten unserer Männer hatte ich zu meinen Begleitern gewählt, doch leisteten sie ihr Bestes und fuhren über keine gefährliche Stelle, ohne sie zuvor von einem hohen Punkte des Ufers aus gut untersucht zu haben. Wir passierten denn auch ohne Unfall mehrere grosse Stromschnellen und legten bei der ersten Pnihing-Gesellschaft an, um zu hören, ob sie etwas von unserem Hab und Gut aufgefischt hätte und etwas Näheres über unsere Unglücksstätte wüsste. Einige hatten allerdings etwas Holz, wahrscheinlich meinen Klappstuhl, schwimmen sehen und einen Unfall vermutet, aber nichts aufgefischt; auch erzählten sie, dass der Wasserfall, in dem wir umgeschlagen waren, Anak Aran hiess und nur bei Hochwasser heftige Stromschnellen bildete und dass man am linken Ufer ohne Schwierigkeiten fahren konnte, in der Flussmitte dagegen unfehlbar umschlug. Bereichert mit dieser Weisheit fuhren wir weiter, fanden aber nichts von unseren Sachen wieder.
An der Mündung des Pè berichteten uns andere Pnihing, dass die Bukat sich jetzt am Oberlaufe dieses Flusses aufhielten, weil sich seit langer Zeit keine Batang-Lupar mehr gezeigt hätten.
An der Mündung des Pari, beim Häuptling Tingang aus Long ’Küb, machten wir Kalt. Der alte Mann, der in seiner Hütte mitten unter grossen Mengen geräucherten Schweinefleisches und Bambusgefässen mit Fett dasass, machte mir Vorwürfe, weil ich die Fahrt [73] ohne Pnihing gewagt hatte und bot zum Beweis seines Wohlwollens meinen Leuten Sago und mir einige Stücke Wildschweinfleisch zum Geschenk an. Der Alte reihte je 5–6 solcher Fleischstücke von ungefähr 1 dm Dicke zum Räuchern auf ein Holzästchen. Er musste das ganze Schwein in so kleine Stücke zerlegen, weil grössere über dem Feuer nicht gar genug wurden, um längere Zeit aufbewahrt werden zu können.
Nach der sehr dürftigen Kost, die ich während eines Monats genossen hatte, erschien mir dieses halb geröstete, halb geräucherte Schweinefleisch ein wunderbarer Leckerbissen, den ich später im Boote mit Behagen verzehrte. Den Rest liessen wir uns nachher auch noch am Blu-u schmecken, wo Fische und Hühner nur selten zu haben waren und die Kajan zum Jagen keine Zeit hatten.
Als ich nach unserer Ankunft in Long Blu-u Kwing Irang aufsuchte, fand ich ihn sehr erregt neben Anjang Njahu sitzen, der ihm unseren Reiseunfall berichtete, doch merkte ich nicht, dass er diesem ernsthafte Vorwürfe machte oder heftig wurde. Nur der Eifer, mit dem Leute gesucht wurden, um Bier Hilfe zu leisten, bewies mir, dass unser Missgeschick doch tiefen Eindruck gemacht hatte. Zum Glück waren die Männer sehr darauf aus, “ringgit” (Reichstaler) zu verdienen; einige wollten Bier sogar nur unter der Bedingung, dass sie ganz bei ihm bleiben durften, entgegen fahren. Dieser Eifer kam Biers Begleitern, die stark an Heimweh litten, gut zu statten. Die Gesellschaft, die bereits am 28. Oktober mit 4 Packen Reis und anderen notwendigen Dingen aufbrach, traf Bier auf dem Heimweg, unterhalb der Kasomündung, da sein Reis erschöpft war. Doch kehrte er jetzt wieder um, nachdem er die meisten Leute überredet hatte, bei ihm zu bleiben. Nur 4 Männer kamen nach Long Blu-u zurück. Als ich ihre bleichen Gesichter und hohlen Wangen mit denen ihrer Stammesgenossen verglich, konnte ich es ihnen nicht verargen, dass sie sich nach Ruhe sehnten. Krank wurde jedoch keiner von ihnen, und auch Bier traf am 7. Nov. zwar sehr ermüdet, aber vollkommen gesund mit seinem Geleite bei uns ein.
Abgesehen von unserem Unfall, hatten wir alle Ursache, mit dem Ergebnis unserer einmonatlichen Expedition zufrieden zu sein. Der ganze Weg vom Lasan Tujang, an der Grenze gegen Sĕrawak, bis zum Blu-u war sorgfältig gemessen worden, von dem Grenzgebirge hatten wir eine deutliche Vorstellung erhalten und weiter unten eine [74] Übersicht über das Land gewonnen. Durch die Peilungen vom Batu Balo Baung aus und die Aufnahme des Howong und Kaso hatten wir die Messung des Mahakamgebietes mit derjenigen des Kapuasgebietes verbunden, so dass wir von unserem Zuge kaum mehr hatten erwarten können. [75]
Kapitel IV.
Aussichten für die Reise nach Apu Kajan—Beziehungen der Bahau zu ihrem Stammland Die Kĕnja als Kopfjäger—Alte Fehden zwischen den Kĕnjastämmen—Bedrohungen seitens des Sultans von Kutei—Vergebliches warten auf die Einsetzung eines Kontrolleurs—Beratung in Long Tĕpai—Reisehindernisse seitens der Bahau—Beunruhigende Gerüchte von der Küste und Apu Kajan—Abschied von Long Blu-u—Über Long Tĕpai nach Long Dĕho.
Gleich nach meiner Rückkehr aus dem Quellgebiet des Mahakam begann ich Erkundigungen über die Aussichten für unsere Reise zu den Kĕnja nach Apu Kajan einzuziehen. Wenn ich damals gewusst hätte, dass es noch fast ein ganzes Jahr dauern würde, bevor ich die Bevölkerung am Mahakam zur Verwirklichung meines Planes brachte, so hätte meine Geduld vielleicht nicht stand gehalten und ich wäre unverrichteter Sache zur Küste zurückgekehrt. So aber hielt mich die Hoffnung, die stets neu auftauchenden Schwierigkeiten doch noch überwinden zu können, vom September 1899 bis zum August 1900 am Mahakam fest, eine Wartezeit, die mit Verhandlungen und Beratungen, Vorbereitungen, Hoffnungen und Enttäuschungen ausgefüllt wurde. Da die Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen hatte, nicht nur durch die Unentschlossenheit und Energielosigkeit der Dajak bedingt wurden, sondern vor allem auch durch die Verhältnisse zwischen den Bahau- und Kĕnjastämmen vor und während meiner Anwesenheit am Mahakam und durch die Drohungen des malaiischen Fürsten in Kutei, der die Ausbreitung der niederländischen Macht im Herzen Borneos mit allen redlichen und unredlichen Mitteln zu bekämpfen suchte, mögen diese Hindernisse dem Leser zur Orientierung in diesem Kapitel genauer ausgeführt werden, als es im vorhergehenden geschehen konnte. Die Überzeugung, dass die Zustände im Innern Borneos einer Regelung durch eine europäische Autorität dringend bedurften und dass diese nur stattfinden konnte, nachdem auch das für Borneo berüchtigte und gefürchtete Gebiet Apu Kajan von einem [76] Europäer besucht worden war, stärkte meine Geduld und meine Ausdauer bei der Verfolgung meines Planes.
Sowohl die Bahau- als die Kĕnjastämme bewohnten ursprünglich ihr gemeinsames Stammland Apu Kajan oder Hochland vom Kajan im Nordosten der Insel. Die starke Zunahme der dortigen Bevölkerung zwang jedoch immer wieder einige Stämme, ihr Heimatland zu verlassen und in den Gebieten der Flüsse, welche von den Gebirgen um Apu Kajan nach allen Richtungen fortströmen, neue Wohnplätze zu suchen. Die letzte Auswanderung hat vor etwa 38 Jahren stattgefunden, als die Kĕnja vom Stamme der Uma-Timé nach dem Tawang zogen.
Die Bahau wissen durch ihre Überlieferung noch sehr wohl, dass sie aus Apu Kajan herstammen, auch haben sie die Verbindung mit ihrem Stammland noch sehr lange unterhalten. Die ältesten Männer der Kajan und Long-Glat erzählten noch von ihren Reisen nach Apu Kajan, die sie noch zur Zeit, wo die Uma-Timé dort die Oberherrschaft führten, unternommen hatten. Nach der Auswanderung dieses mächtigsten Stammes brachen im Kajanlande unter den übrigen Stämmen heftige Kämpfe um den Vorrang aus, so dass die Bahau aus Furcht ihre Besuche dort einstellten. Auch nachdem die Kĕnja Uma-Tow unter Pa Sorang und später unter Bui Djalong die anderen Stämme besiegt hatten, vergrösserte sich die Reiselust bei den Bahau nicht. Nur ein einziger Mann, der öfters erwähnte Bo Ului, der bei den Long-Glat in Long Tĕpai lebte und mit den Kĕnja in Apu Kajan nahe verwandt war, hatte sich einige Male dort hin gewagt und war somit der einzige, der uns als Führer dienen konnte. Doch wurde die Abenteuerlust der Bahauhäuptlinge und ihrer jungen Untertanen stark durch die Vorstellung geweckt, das Land ihrer Abstammung und ihrer Sagen und nicht zum wenigsten das Gebiet, in dem sie vorteilhaften Handel in alten Perlen, und anderen Artikeln treiben konnten, kennen zu lernen. Aus diesen Gründen hatte mir Kwing Irang im Jahre 1897 das Versprechen gegeben, unter meiner Leitung die Reise nach Apu Kajan unternehmen zu wollen, und auf dieses Versprechen hatte ich meine Pläne gebaut.
Seit 1897 waren die Umstände für einen derartigen Zug jedoch viel ungünstiger geworden, hauptsächlich weil allerhand wahre und unwahre Gerüchte über Mordtaten, welche die Kĕnja begangen haben sollten, die Runde machten. Das damals bereits verbreitete Gerücht, die Kĕnja [77] hätten fünf vom Mahakam aus bei ihnen Handel treibende Malaien ermordet, hatte sich inzwischen allerdings bestätigt. Es wurde aber auch noch erzählt, 7 Malaien, die sich aus Sĕrawak ebenfalls zu Handelszwecken zu den Kĕnja begeben hätten, wären bei diesen umgekommen. In jüngster Zeit sollte auch ein malaiischer Kupfergiesser, der sich eine Zeitlang in Apu Kajan zu halten verstanden hatte, von den Kĕnja ermordet worden sein. Diese Ereignisse hatten nicht gerade dazu gedient, die ohnedies ängstlichen Bahau zur Reise zu ermuntern. Das gewaltsame Vorgehen der Kĕnja bildete im Grunde jedoch nur eine scheinbare Bestätigung für ihre wilde Natur, in Wirklichkeit bedeutete es nur ein energisches, mutiges Auftreten gegen Übergriffe, welche die Malaien sich schwächeren Eingeborenen gegenüber ungestraft erlauben dürfen. Die gleichen 7 Malaien aus Sĕrawak waren nämlich früher auch am oberen Mahakam gewesen und hatten sich dort so viele Betrügereien zu Schulden kommen lassen, dass Kwing Irang sie aus Besorgnis für ihre persönliche Sicherheit unter seinen Kajan und aus Angst vor Konflikten mit Sĕrawak unter einem Geleite in ihr Land hatte zurückbringen lassen. Jeder, der das Leben und Treiben des malaiischen Gesindels unter den Bahau kannte, hätte für diese Handlungsweise der Kĕnja Sympathie empfunden. Der Tod der fünf anderen Malaien, die unter Hadji Umars Anführung Jahre lang bei den Bahau gelebt hatten und nachher von diesen zu den Kĕnja gezogen waren, machte auf die Mahakambewohner einen besonders starken Eindruck, obgleich der Anlass zu diesem Morde schon längst zur Genüge bekannt war. Da er für das Verhältnis zwischen Malaien und Eingeborenen charakteristisch ist, mag er hier erwähnt werden. Die fünf Malaien waren mit einer grossen Menge Handelsware in Gesellschaft einer vom Mahakam heimkehrenden Kĕnjatruppe nach Apu Kajan gereist, wo sie 3 Jahre lang Handel trieben, ohne von den Stämmen belästigt zu werden. Als einer dieser Malaien sich einmal mit einigen Kĕnja zu den benachbarten Punan-Lisum begab, um mit diesen Handel zu treiben, kaufte er von dem Häuptling für ein Stück roten, golddurchwirkten Zeuges eine guliga (Intestinalstein). Sobald er aber merkte, dass der Häuptling noch mehr guliga hatte, wollte er für dasselbe Stück Zeug noch 4 dieser Steine haben. Nach der Weigerung des Häuptlings packte der Malaie dessen kleinen Sohn und drohte, ihn mitzunehmen, falls er seine Steine nicht erhalte. Im Augenblick aber, wo er das Kind binden wollte, [78] durchbohrte ihn der Häuptling mit seinem Speer. Trotzdem der Malaie bereits am Mahakam als frecher Betrüger bekannt war, fühlten sich doch die Kĕnja, die den Mann halb als ihren Gast betrachteten, für sein Leben verantwortlich und töteten aus Rache einige Punan. Diese übten Wiedervergeltung und das Köpfejagen hörte auf beiden Seiten nicht eher auf, bis auch der letzte Malaie, einen ausgenommen, der an Krankheit starb, getötet worden war. Die ohnehin ängstlichen Bahau wurden nun auch noch von dem Gedanken beunruhigt, die Kĕnja könnten fürchten, ihrer allzu energischen Handlungsweise wegen von mir zur Rechenschaft gezogen zu werden.
In den letzten Jahren standen die Kĕnja übrigens auch mit unserer Bevölkerung am Mahakam auf gespanntem Fuss, nicht nur weil sie nach Landessitte von den Produkten der Felder, an denen sie vorüberfuhren, lebten, sondern weil sie bei dieser Gelegenheit auch Köpfe jagten. Ein Jahr vor meiner Ankunft am Mahakam hatte noch ein Häuptling der Kĕnja Uma-Bom, während er auf der Galerie der Bahau Uma-Wak einen Schwerttanz aufführte, einem der vornehmsten Zuschauer plötzlich den Kopf abgeschlagen und mit diesem ungestraft die Flucht ergriffen.
Durch Vermittelung ihres Oberhäuptlings Bui Djalong hatten die Kĕnja für diese Tat zwar eine bedeutende Busse bezahlt, doch wurden sie trotzdem am Mahakam mit sehr begreiflichem Misstrauen begrüsst. Die Bahau, die mich auf meinen Fahrten auf dem Mahakam begleiteten, waren auch stets, besonders an den Wasserfällen beim Boh, sehr auf ihrer Hut. Als wir 1897 beim Hinabfahren auf dem Mahakam an einer Flussbiegung plötzlich einem Boot begegneten, griffen alle Männer sogleich zu den Waffen, bis es sich herausstellte, dass wir es mit befreundeten Ma-Suling und nicht mit Kĕnja zu tun hatten.
Auch zwischen den Bahau und Kĕnja am Tawang war die alte Feindschaft nicht vergessen, wenn die Uma-Timé auch ihre frühere Niederlage aus Angst vor dem Sultan nicht öffentlich an den Long-Bila zu rächen wagten. Kleinere Fehden wiederholten sich aber immer wieder zwischen ihnen. So hatten die Long-Bila Brit Adjang, den jüngsten Sohn des bekannten Uma-Timé Häuptlings Bo Adjang Hipui, ermordet. Der Mann war mit einer Frau der Long-Bila verheiratet und lebte bei diesem Stamme. Sein Tod hatte auf den Verlauf unserer Reise zu den Kĕnja grossen Einfluss, weil er neue Racheakte veranlasste, welche die Beziehungen zwischen dem Mahakam [79] und dem Kajangebiet immer mehr verschlechterten. Ibau Adjang, der Bruder des Ermordeten, sann natürlich auf Blutrache. Da er diese nicht selbst auszuüben wagte, brachte er einen Häuptling der Kĕnja Uma-Bom, Taman Dau, der die Uma-Timé am Tawang 1897 besuchte, dazu, statt seiner den Tod seines Bruders an den Long-Bila zu rächen. Taman Dau zeigte sich hierzu denn auch gleich bereit, fuhr mit einigen Stammesgenossen den Tawang hinunter und tötete einen einsam fischenden Mann der Long-Bila. Mit dem erbeuteten Kopf floh er eiligst den Fluss wieder aufwärts, schlug dann den kürzesten Landweg zum Mĕrah ein und erreichte von dort den Mahakam, den Boh und schliesslich Apu Kajan. Sobald es sich herausgestellt hatte, dass die Kĕnja am Tawang die eigentliche Veranlassung zu dem Morde gegeben hatten, drohte ihnen ein europäischer Ingenieur, der unter einem Schutzgeleite des Sultans in dieser Gegend Gold suchte, mit der Rache von Kutei. Ibau Adjang beschloss darauf sehr erschreckt, die erste Gelegenheit wahrzunehmen, um nach der in Borneo üblichen Weise dem Sultan seine untertänige Gesinnung zu bezeugen. Als bald darauf eine Gesellschaft Kĕnja vom Stamme Uma-Djalan von einem Besuch beim Sultan in Tengaron zurückkehrte und in mehreren Böten am Dorfe der Uma-Timé vorüberfuhr, überfielen diese eines der Böte, das von den anderen getrennt war, weil seine Insassen sich mit Fischen beschäftigten. Die ganze Bemannung wurde ermordet, unter dieser auch der Enkel des Uma-Tow Häuptlings Bui Djalong. wahrscheinlich hatte nicht nur der Wunsch, an Stelle des Sultans an den Kĕnja Rache zu üben, sondern auch eine alte Fehde zwischen den Uma-Timé und Uma-Djalan aus der Zeit, wo sie gemeinsam das Stammland bewohnten, Ibau Adjang zu diesem Morde getrieben. Die übrigen Kĕnja waren nach der Ermordung ihrer Reisegefährten über den Mĕrah zum Mahakam und Boh geflohen; sie waren es, die dem Kontrolleur Barth in Long Bagung begegneten und die ich den Kiham Halo hinauffahren gesehen hatte (Teil I pag. 487).
Eine Erzählung über den Ursprung der Feindschaft zwischen den Uma-Timé und Uma-Djalan verdient ihrer Eigenartigkeit wegen hier erwähnt zu werden, doch kann ich für die Wahrheit derselben nicht einstehen.

Junger Mann der Mahakam-Kajan.
Als beide Stämme noch gemeinsam in Apu Kajan wohnten, heiratete ein Häuptling der Uma-Djalan eine Tochter aus der Fürstenfamilie der Uma-Timé. Beim Fest gelegentlich der Namengebung des [80] ersten Kindes kämen die Uma-Djalan als Gäste zu den Uma-Timé, bei denen ihr Häuptling der Sitte gemäss im Hause seiner Schwiegereltern lebte. Nach dem Fest behauptete der Häuptling der Uma-Timé, seine kostbaren Halsketten seien ihm gestohlen. Trotzdem die Uma-Djalan versicherten, die Diebe befänden sich unter den Uma-Timé selbst, überfielen diese ihre Gäste, die, nichts Böses vermutend, in ihr Dorf heimkehrten und töteten viele von ihnen. Nach diesem Begebnis verkehrten die Uma-Djalan aber wieder mit dem inzwischen, zur Vorherrschaft gelangten Stamm der Uma-Timé, als ob nichts vorgefallen wäre, bis das Kind, dessen Namensfest den Überfall veranlasst hatte, gross geworden war. Erst dann sann der Häuptling der Uma-Djalan auf Rache für die einst verübte Bluttat. Er lud die Uma-Timé zum Fest des Früchtepflückens ein, und als sowohl die Gäste als deren Gastherren auf die Bäume geklettert waren, stiegen die Uma-Djalan unter allerhand Vorwänden wieder herunter und zerbrachen die Leitern, so dass die Uma-Timé oben bleiben mussten. Darauf ermordeten die Uma-Djalan zuerst die Frauen und Kinder ihrer Gäste und fällten dann die Bäume, wobei viele Männer umkamen. Die Uma-Timé, die bald nach diesem Ereignis unter Ibau Adjang und Li Adjang nach dem Tawang ausgewandert waren, hatten erst in dem oben erwähnten Morde Gelegenheit zur Ausübung der Blutrache gefunden.
Die ganze Bevölkerung am Mahakam lebte infolge dieser Geschehnisse begreiflicherweise in ständiger Angst vor Rachezügen seitens der ohnehin so gefürchteten Kĕnja von Apu Kajan, und wie gewöhnlich machten immer wieder schreckenerregende Gerüchte von geplanten Einfällen in das Mahakamgebiet die Runde. In der Tat hatten die Kĕnja bereits von sich hören lassen. Eine Bande Uma-Bom, mit einigen Punan als Führern, hatte eine Kopfjagd nach dem Mahakam unternommen und hielt sich im Alān unterhalb der Wasserfälle auf, gerade, als ich mit Kwing Irang ahnungslos den Fluss hinauffuhr. Mit Zustimmung von Bang Jok, der damals von Tengaron nach Uma-Mĕhak reiste, hatte sich die Gesellschaft zum Rata begeben und bei der ersten besten Gelegenheit zwei buginesische Büschproduktensucher und einen Bahau, während diese in einer Stromschnelle wehrlos standen, ermordet.

Junger Mann der Mahakam-Kajan.
Alle diese Ereignisse und Gerüchte, wie beunruhigend sie auch wirkten, hätten die Bahau oberhalb der Wasserfälle doch nicht von einer [81] Reise mit mir nach Apu Kajan zurückgehalten, wenn nicht zugleich der Sultan von Kutei jetzt ebenso stark gegen unser Unternehmen gearbeitet hätte, wie früher gegen unseren Aufenthalt bei den Bahau am Mahakam.
Die Fürstenfamilie fürchtete mit Recht, dass eine Ausbreitung des niederländischen Einflusses auf die Kĕnjastämme auch auf die Mahakambewohner einen grossen Eindruck machen würde, der ihrer eigenen Macht in hohem Masse nachteilig sein musste. Die Kuteinesen verbreiteten daher das Gerücht, der Sultan werde der niederländischen Regierung niemals gestatten, einen Kontrolleur unter den Bahau einzusetzen, auch würde er sich an allen Stämmen, die mir nach Apu Kajan hülfen, später rächen. Bang Jok, als einflussreichster Häuptling, unterstützte, in seiner erzwungenen Untertanenschaft, jetzt den Sultan bei seinen Drohungen. Durch seinen persönlichen Einfluss unter den Bahau gewannen Bang Joks Behauptungen überdies viel an Bedeutung. Zu meinem grossen Bedauern fand die Einsetzung eines niederländischen Regierungsbeamten erst im Juli 1900 statt, so dass ich ein volles Jahr vergebens auf eine Unterstützung seitens der niederländisch-indischen Regierung wartete und die Bevölkerung am Mahakam in ständiger Angst vor den Drohungen des gefürchteten Sultans und seines Handlangers Bang Jok lebte.
Schreckten mich diese Zustände der zu überwindenden Schwierigkeiten wegen einerseits von der geplanten Reise nach Apu Kajan ab, so überzeugten sie mich andererseits wieder davon, von welcher politischen Wichtigkeit diese Expedition für die Einsetzung einer niederländischen Verwaltung am Mahakam sein musste. Falls, wie ich sicher erwartete, ein Kontrolleur unter den Bahau eingesetzt wurde, musste dieser das ausgedehnte, schwer zugängliche und schwach bevölkerte Gebiet sicherlich nicht durch europäische Machtentfaltung sondern durch freundschaftliche Beziehung zu der Bevölkerung zu verwalten suchen. Er hätte auch unmöglich Kopfjagden und ähnliche Anlässe zu Fehden und Racheakten verhindern können, besonders wenn es sich um entlegene, so gut wie unzugängliche Gebiete wie Apu Kajan handelte, wo sogar schwere Vergehen nicht gestraft werden konnten, wenn nicht schon vor seiner Ankunft mit den betreffenden Stämmen ein gutes Verhältnis angebahnt worden wäre.
Die gespannten Verhältnisse zwischen Bahau und Kĕnja liessen daher eine Reise nach Apu Kajan sehr wünschenswert erscheinen, was einige [82] Häuptlinge der Bahau, wie Kwing Irang, der auch für das allgemeine Wohl Verständnis besass, auch einsahen. In wie weit dieses Motiv ihn dazu trieb, mich ständig, wenn auch oft für andere unmerklich, in meinem Plan zu unterstützen, war ich nicht zu beurteilen imstande.
Fürchteten die Bahau für sich selbst die zahlreichen Gefahren der Reise, so waren sie in nicht minderem Masse auch um mein Leben und das meiner Mitreisenden besorgt. Kwing Irang und sein Stamm beunruhigte auch der Gedanke, dass die niederländische Regierung für ein eventuelles Unglück, das uns zustiess, sich an ihnen rächen könnte. Kwing war daher auch von Anfang an dafür, dass nicht nur seine Kajan, sondern alle Stämme am oberen Mahakam Vertreter mit mir sandten, damit das Ganze Gebiet gemeinschaftlich die Verantwortung für unsere Sicherheit auf sich nehme. Da die jungen Männer der verschiedenen Stämme alle Lust zum Unternehmen zeigten, hätte dieser Punkt keine Schwierigkeiten verursacht, wenn die anderen Umstände nur günstig gewesen wären. Selbst der malaiische Häuptling Tĕmĕnggung Itjot aus dem Mĕrasègebiet hatte sich mit seinem Gefolge und dem jungen Häuptling Ibau Li zur Teilnahme an unserer Expedition vorbereitet. Sie wollten nämlich bei dieser Gelegenheit die Trauer für ihre Verstorbenen ablegen, Tĕmĕnggung Itjot für seinen kleinen Sohn, Ibau Li für seinen Vater Bo Li. Beide waren, wahrscheinlich aus Furcht vor mir, nicht dazu gekommen, die Trauerperiode nach der am Murung herrschenden Sitte durch ein Menschenopfer abzulegen und wollten der adert daher nach Bahauweise durch die Unternehmung einer grossen Reise und den Kauf eines alten Kopfes Genüge leisten.
Diese Ma-Suling, die durch den Tod des Häuptlings Obet Dĕwong verhindert gewesen waren, mit mir nach der Küste zu reisen (T. I pag. 410), begaben sich aber nach langem Warten, als mein Zug zu den Kĕnja zu missglücken schien, nach dem Murung, erhandelten dort zwei alte Sklavinnen und töteten diese auf der Rückreise an der Mĕrasèmündung, um durch Darbringung dieses Opfers die Trauerzeit abschliessen zu können. Sie hatten die Tat gewagt, nachdem ich bereits zum Boh aufgebrochen war.
Die Absicht aller Stämme am oberen Mahakam, mich zu den Kĕnja zu begleiten, war zwar ein willkommener Beweis von ihrem Bestreben, mich zu unterstützen, da aber jeder Mitreisende seine eigenen Interessen verfolgte, verursachte die Beteiligung einer so grossen Personenzahl viele Schwierigkeiten. Eine gemeinsame, wenn auch nur [83] vorläufige Beratung über den Reiseplan erschien daher dringend nötig, und so suchte ich denn eine Versammlung, trotz des anfänglichen Widerspruchs der Kajan, zu Stande zu bringen. In einer Zusammenkunft mit Kwing Irang und seinen Ältesten wurde beschlossen, dass die Beratung in Long Tĕpai bei Bo Lea stattfinden sollte.
Zu diesem Zwecke sollte ich flussabwärts nach Long Tĕpai fahren, während Kwing Irang vom Mĕrasè aus, wohin er mit seiner Frau Hiāng und seiner Pflegetochter Kĕhad reiste, sich dorthin verfügen wollte. Am 12. November waren in der Tat alle in Long Tĕpai versammelt; mit Kwing Irang War auch Tĕmĕnggung Itjot, als Vertreter der Ma-Suling, eingetroffen. Zuerst hielten die Häuptlinge untereinander eine Beratung, in der beschlossen wurde, dass Bo Lea zuerst allein nach Apu Kajan reisen sollte, um Bui Djalong zu fragen, ob die Mahakambewohner unsere Expedition zu ihnen geleiten dürften. Am folgenden Tage wurde mir dieser Plan abends in Bo Leas Galerie vorgelegt, wo sich alle Häuptlinge mit ihren Wortführern eingefunden hatten. In der Regel schweigen nämlich die Häuptlinge in solchen öffentlichen Versammlungen und überlassen ihrem klügsten und redegewandtesten Mantri das Wort; nur energische Häuptlinge Wie der Pnihing Bĕlarè sprachen oft auch persönlich ihre Ansichten aus. Hier in Long Tĕpai hatte der Häuptling Bo Tijung die leitende Rolle zugewiesen, der, trotz seiner Abstammung von den Barito-Dajak, in Wirklichkeit das ganze Dorf regierte.
Vor Beginn der Versammlung Wurden alle Anwesenden durch das Gerücht, der Kontrolleur sei bereits in Udju Tĕpu angelangt, erfreut und beruhigt. Ein Barito-Dajak, Häuptling einer Gesellschaft Buschproduktensucher, behauptete sogar, diese Nachricht habe in einem Brief, der von der Küste gekommen sei, gestanden, ein Umstand, der alle Anwesenden zu überzeugen schien.
Im Grunde hatte ich es in der Versammlung nur mit Bo Tijung zu tun, der stets wieder betonte, dass man gegen das Unternehmen sei, weil der Mord am Tawang noch nicht gesühnt wäre. Die anderen Gründe, die Angst vor den Kĕnja, den Zweifel an der Ankunft des Kontrolleurs und die Furcht vor der Ungnade des Sultans, erwähnte Bo Tijung überhaupt nicht. Zur Beseitigung der von ihm angeführten Schwierigkeit verlangte er, Bo Lea solle sich zuerst auf Kundschaft nach dem Apu Kajan begeben. Hierauf konnte ich jedoch durchaus nicht eingehen, da diese Reise vier Monate, wahrscheinlich noch viel [84] länger dauern musste, der Zug den Reiz der Neuheit für die anderen Mitreisenden verloren und ich sie dann viel schwerer in Bewegung gebracht hätte. Überdies war es am besten, die Kĕnja vor eine Tatsache zu stellen und nicht zu warten, bis sie vielleicht aus Angst vor dem Ungewöhnlichen meinen Besuch ablehnten.
Die Versammlung führte wie gewöhnlich, trotz 3½ stündiger Beratung, zu keinem Resultat; ich konnte auf den Vorschlag der Häuptlinge nicht eingehen und diese äusserten sich nicht darüber, ob sie dennoch mit mir gehen, oder die Reise überhaupt nicht unternehmen wollten. Trotzdem die Meinungen einander scharf gegenüber standen und unsere gegenseitigen Interessen mit der Angelegenheit fest verbunden waren, wurden wir doch nicht heftig. Alles ging ruhig seinen Gang, man merkte, dass die Bahau ihre Beschwerden, die für mich als Niederländer nur unangenehm, für sie aber sehr gewichtig waren, nicht zur Sprache brachten, und nur einmal, als Bo Tijung etwas hitziger ausfuhr, konnte ich ein “mata tasin” (“möge ein Speer mich töten”, Fluch der Bahau) nicht unterdrücken. Die ganze Gesellschaft wurde aber dadurch beunruhigt, da sie einen Ausbruch von Heftigkeit meinerseits fürchtete, und Bo Tijung beobachtete in seiner Beweisführung sogleich mehr Vorsicht.
Kwing Irang fand die Situation augenscheinlich sehr peinlich, denn er stand, ohne etwas zu sagen, als erster auf. Als ihm noch einige folgten, schlug Bo Tijung vor, die Beratung am folgenden Tage fortzusetzen. Ich erfuhr jedoch, dass die Häuptlinge später in Bo Leas amin wieder zusammengekommen waren. Des anderen Morgens früh kam Kwing Irang auch, um mir zu berichten, man habe in einer nächtlichen Beratung beschlossen, falls das Wasser falle, die Reise mit mir beim folgenden Neumond dennoch zu unternehmen. Tĕmĕnggung Itjot und er selbst, die nach dem Mĕrasè zurückkehrten, wollten die Ma-Suling benachrichtigen und Bo Tijung sollte sich nach Batu Sala und Lulu Njiwung begeben, um die Long-Glat mit ihren Häuptlingen Parèn Dalong und Ding Ngow dazu zu bewegen, ebenfalls ein oder zwei Böte mit Männern zur Reise auszurüsten.
Wegen des hohen Wasserstandes war drei Tage lang an eine Rückkehr nach dem Blu-u nicht zu denken, auch brauchte ich schliesslich mit meinem kleinen, gut bemannten Boot drei statt zwei Tage für die Reise. Kwing Irang langte mit seiner Familie in einem mit Reis schwer geladenen Fahrzeug sogar erst am 23. November an. Bis [85] zum Ende des Monats behielt der Fluss seinen hohen Wasserstand. Hiāng und Kĕhad, Kwings Frau und Pflegetochter, kehrten von ihrem Ausflug zum Mĕrasè sehr befriedigt heim, sie waren in ihrem Leben noch nie bei den Ma-Suling gewesen, trotzdem diese nur eine Tagereise weit von Long Blu-u wohnten. Beide Frauen hatten zuerst tagelang nicht gewagt, sich mit ihren Verwandten in ihrem gebrochenen Besang zu unterhalten. Die Kajanfrauen sind an einen Verkehr mit benachbarten, verwandten Stämmen nicht gewöhnt, die Frauen der Long-Glat sind etwas reisegewandter, da ihre ursprünglich vereinigten Niederlassungen noch jetzt durch viele Verwandtschafts- und Freundschaftsbande verknüpft sind.
Die Kajanfamilien in Long Blu-u waren in diesen Monaten noch immer damit beschäftigt, Material zum Bau von Kwing Irangs Haus herbeizuschaffen; augenblicklich arbeiteten sie an den grossen, schweren Brettern, welche für die Diele in der Galerie bestimmt waren. Je zwei Familien hatten ein solches Brett fertig zu stellen. Der Hausbau lag Kwing Irang so am Herzen, dass ihm sein Entschluss, mich jetzt schon auf der Reise zu begleiten, sehr viel Selbstüberwindung gekostet haben musste.
Während wir in grosser Einförmigkeit, so gut es eben ging, die folgenden Tage verbrachten, wurden wir eines Mittags durch einen grossen Menschenauflauf erschreckt, der sich nach dem unten am Fluss liegenden Teil der Niederlassung bewegte. Voll Neugier schlossen wir uns den Leuten an und bemerkten bald eine grosse, mitten aus einer langen Häuserreihe aufsteigende Rauchwolke. Beim Gedanken an das viele trockene Holz, aus dem das Dorf bestand, wurde uns Angst, doch sahen wir sogleich, dass das Feuer sich nicht weiter ausbreitete. Einige Männer, die unter lautem Geschrei auf das Dach geklettert waren, schlugen mit Schwertern von den angrenzenden Häusern die Schindeln los und warfen sie hinunter. Auch von Innen wurden die leichter entzündlichen Holzteile auseinander gerückt und das schwerere Holz mit Wasser begossen, so dass der Rauch nach kurzer Zeit nachliess und das Unheil abgewandt war. Eine Mutter mit ihrer Tochter hatten den Brand veranlasst, indem sie sich unvorsichtiger Weise von dem Topf, in dem sie Schweinespeck schmelzten, entfernt hatten. Wahrscheinlich waren die Flammen des Holzfeuers in den offenen Kochtopf geschlagen und hatten dann das über dem Herde aufgestapelte Brennholz ergriffen.
Die Dorfleute machten den Schuldigen, die übrigens durch den [86] Verlust ihres Hauses genügend gestraft waren, keine Vorwürfe, sondern schrieben den Brand dem Umstande zu, dass man in einer ungünstigen Mondphase das Haus gebaut oder das Baumaterial gesammelt haben musste. Bevor daher ein neues Haus errichtet werden durfte, mussten die Priesterinnen zur Besänftigung der zürnenden Geister ein Opfer bringen und die stehengebliebenen Teile mit dem Blute des Opfertieres bestreichen.
Anfang Dezember kam Bo Tijung mit einer Gesellschaft Long-Glat und meldete mir das Resultat seiner Unterhandlungen mit den verschiedenen Niederlassungen. Obgleich seine Berichte, die er in einer Versammlung vorbrachte, nicht ermutigend lauteten, machten sie dem langen Warten in Ungewissheit vorläufig doch ein Erde. Alle Niederlassungen hatten sich zwar zum Unternehmen des Zuges bereit gezeigt, aber die Bewohner von Lulu Njiwong hatten erklärt, sie litten bereits seit Monaten an Reismangel und könnten daher kurz vor der Ernte unmöglich ein Boot mit Mannschaft ausrüsten. Bo Tijung behauptete, die gleichen Zustände, wenn auch in geringerem Grade, herrschten auch in Long Tĕpai, und bat daher um einen Aufschub der Reise bis zum Beginn der Ernte, nach der Feier des lāli parei. Zwar bedeutete dies eine Verzögerung von anderthalb Monaten, doch war ich froh, dass man den Reiseplan unter diesen wirklich schwierigen Verhältnissen nicht gänzlich aufgegeben hatte, und stimmte zu, unter der Bedingung, dass man das lāli parei gleich nach Neumond feiern sollte. Meine Zustimmung schien alle Anwesenden von einem Druck zu befreien.
Jetzt, wo ich die Gewissheit hatte, fürs erste nicht fortzukommen, musste ich meine Zeit so nützlich als möglich anzuwenden suchen. Vor allem musste ich meinem Personal Arbeit schaffen, damit es sich im Dorfe nicht langweilte. Ich selbst konnte nicht mitgehen, so sandte ich denn Doris und Abdul mit einigen Malaien aus Samarinda und einigen Kajan als Führern nach einer Stelle am Blu-u, wo wir 1896 eine Jagdstation eingerichtet hatten. Teils um für das Trocknen von allerlei Gegenständen Luft zu schaffen, teils um zu verhindern, dass die Bäume, wie es einmal beinahe geschehen war, auf unser Lager stürzten, hatten wir dort ein grosses Stück Wald gefällt. Ich hoffte, dass es unseren Jägern diesmal gelingen würde, dort einige bang-e̱-u zu fangen, von denen ich während meiner ersten Reise mehrere Exemplare erhalten hatte, die jetzt aber in unserer Vogelsammlung [87] noch fehlten, weil die Kajan von dem Hausbau zu sehr in Anspruch genommen waren, um Schlingen legen zu können. Auf den Eifer meines Jägers setzte ich nicht viel Hoffnung, vertraute dagegen mehr auf Abdul und einige Malaien, Dĕlahit und Saïd, die ausser Talent auch noch Neigung und Verständnis für die Jagd besassen. Bis jetzt waren es hauptsächlich Abdul und Dĕlahit gewesen, die uns ab und zu mit grossem Wild, nicht nur Hirschen, sondern auch Rindern, versehen hatten. Ihre Art zu jagen bestand mehr darin, dass sie das Wild beschlichen oder ihm an einer Salzquelle im Hinterhalt auflauerten, als dass sie es von weitem zu treffen suchten, wozu sich im dichten Walde auch selten Gelegenheit bot. Ein selbst von den Dajak sehr bewundertes Talent im Aufspüren des Wildes besass Abdul, ein Halbblut-Chinese aus Java, der um der schönen Augen seiner javanischen Frau willen Mohammedaner geworden war. Dieser Mann verstand auf dem mit Zweigen und Blättern bedeckten Waldboden die frische Spur eines Hirsches zu finden, das Tier weit und so vorsichtig zu verfolgen, dass er es oft an seinem Lagerplatze überraschte und auf 10–15 Schritt schiessen konnte.
Die Bahau schätzten Abduls Fähigkeiten als Jäger und Spürhund gleichzeitig sehr und baten ihn oft, sie auf die Jagd zu begleiten. Zu unserem grossen Bedauern begab Abdul sich, trotz des chinesischen Blutes, das in seinen Adern strömte, nur selten auf die Wildschweinjagd, weswegen wir uns am schönsten Wildbret von Borneos Wäldern nur ab und zu erfreuen durften. Mit derselben Geschicklichkeit, mit der er auf Reisen das Löten und andere nützliche Handwerke gelernt hatte, verstand Abdul auch bald nach Art der Bahau Schlingen zu legen, ich hoffte daher von dem Aufenthalt meiner Jagdgesellschaft mitten in dem noch wenig besuchten Wald am oberem Blu-u das Beste. Kwing Irang zeigte sich zwar immer etwaiger Gefahren wegen, welche die Jäger dort treffen konnten, besorgt, aber da sie gut bewaffnet waren, liess ich sie ruhig ziehen. Der bang-e̱-u (Lobiophasis Bulweri Sh.) war leider, wie es sich erwies, noch nicht von den Bergen ins Tal herabgekommen, um sich dort an den Früchten gütlich zu tun, so dass nur allerlei andere hühnerartige Vögel, wie der kwe̥ (Argusianus Grayi), der bajan (Lophura nobilis Scl.) und der tajum (Bollulus roulroul Scop.) gefangen wurden, von denen wir aber bereits mehrere Exemplare besassen.
Am letzten Tage des Jahres traf Kwing Irangs ältester Sohn, Bang Awan, in Long Blu-u ein. Er war während unserer Reise zur Küste [88] bei den Hwang-Sirau unterhalb der Wasserfälle zurückgeblieben, um die Tochter des dortigen Häuptlings als zweite Frau zu freien. Bang Awan brachte uns zum Schluss des Jahres neue Enttäuschungen durch den Bericht, der Kontrolleur sei noch nicht angekommen und man habe von ihm überhaupt nichts gehört. Nur wisse man, dass die Kuteische Regierung gegen die Buginesen aufgetreten war, die bei den Bahau in Udju Tĕpu Handel trieben, sich dem Würfelund Kartenspiel ergaben und den Bandjaresen, ihren Konkurrenten, gegenüber sich allerlei hatten zu Schulden kommen lassen. Der Sultan hatte ihnen befohlen, sich bis nach Mĕlak zurückzuziehen und das Land der Bahau nicht wieder zu betreten; da die Buginesen diesem Befehle aber nicht gefolgt waren, wagten sich die Handelsdampfer des Sultans, der auf den Handel mit dem Binnenlande ein Monopol hatte nicht mehr bis Udju Tĕpu hinauf, wodurch dort alles sehr teuer geworden war. Kurz vor Bangs Abreise von Hwang Sirau hatte sich noch von der Küste her das Gerücht verbreitet, der Sultan sei gestorben und sein ältester Sohn solle sein Nachfolger werden, trotzdem die übrigen Kinder sich widersetzten. Um den Becher zum Überlaufen zu bringen und das Vertrauen der Bevölkerung in die niederländische Macht noch mehr zu erschüttern, traf auch die Nachricht von der Ermordung zweier Kontrolleure in Kendangan, im Bandjamasinschen Gebiete ein. Zu unserem Troste brachte Bang eine Post mit, die von Samarinda hinaufgeschickt worden war und die er von Udju Tĕpu, wo er seine Einkäufe machte, mitgenommen hatte; später fand er eine zweite Postsendung, älteren Datums, in Uma Mĕhak.
Mit Bang zugleich traf auch der Malaie Utas bei uns ein, der aus dem Gebiet des Murung, wo er Handelswaren eingekauft hatte, erst nach Udju Tĕpu gezogen war. Er brachte allerhand für unseren langdauernden Aufenthalt sehr nötige Dinge mit; den für Apu Kajan bestimmten Vorrat wollten wir nicht antasten. Utas verkaufte uns sowohl Tauschartikel als Esswaren, auch willigte er ein, mit Gold bezahlt zu werden, was in dieser Gegend ganz unbekannt war. Die Bahau am oberen Mahakam nahmen höchstens Reichstaler und Gulden an, während sie Kleingeld als minderwertig verachteten. Die Bevölkerung am unteren Mahakam dagegen sieht mehr Kupfer- als Silbergeld. Die erste Ausbezahlung in Gold kam mir insofern sehr zu statten, als mein Vorrat an Silbergeld durch die Reiseverzögerung sehr geschmolzen und ich bald auf mein Goldgeld angewiesen war. [89] Sobald die Bahau als Lohn oder Kaufgeld meine Silberstücke empfangen hatten, bewahrten sie diese für eine eventuelle Reise nach den Marktplätzen an der Küste und waren nicht dazu zu bewegen, das Geld gegen etwas anderes auszutauschen.
Um den ersten Eindruck von Bangs schlimmen Berichten vorübergehen zu lassen, wartete ich mehrere Tage, bevor ich mit Kwing Irang über unsere Reisepläne zu sprechen anfing; ich wunderte mich auch nicht, dass die Kajan nach den schlechten Nachrichten keine Reisevorbereitungen trafen, die Böte nicht ausrüsteten und keinen Reis stampften. Als ich am 20. Januar endlich an Kwing Irang das Wort zu richten wagte, bekam ich bald noch mehr beunruhigende Berichte zu hören: z.B. Bui Djalong sei in zwei grossen Böten mit Kĕnja den Boh hinuntergefahren, um wegen der Busse (pate̱) für den Mord seines Enkels zu unterhandeln. Zwei Pnihing, die vor einigen Tagen nach oben gekommen waren, hatten diese für mich so wichtige, aber doch vor mir geheim gehaltene Nachricht gebracht. Einige andere Männer, die Bĕlarè nach Long Tĕpai gesandt hatte, um Näheres hierüber zu hören, waren noch nicht zurückgekehrt.
Ich hatte bereits beschlossen, meinen Diener Midan und einige Malaien, noch bevor am folgenden Tage das lāli parei anbrach, nach Long Tĕpai zu schicken, um zuverlässige Nachrichten zu holen, als des Morgens die Pnihing von Bĕlarè im Vorbeifahren bei unserer Niederlassung anlegten. Zum Glück sprachen sie den Häuptling, noch bevor die Frauen, die auf dem Felde die Zeremonien für das lāli parei vorgenommen hatten, zurückkehrten, was dem Eintritt der Verbotszeit bedeutete. Nicht Bui Djalong selbst, sondern Taman Dau, der Häuptling der Uma-Bom, sollte mit 180 Mann in Long Dĕho angekommen sein. Dass er den Zweck seiner Reise nicht angab, erweckte grosses Misstrauen. Bui Djalong selbst sollte auf der Wasserscheide noch Böte bauen, um den Boh hinunterfahren zu können.
Kaum waren die Männer, deren Berichte glaubwürdig klangen, abgefahren, als Kwing Irangs zweite Frau, Umar Anja, in ihrem Boote vom Reisfelde heimkehrte, und wir durch das eintretende lāli parei für einige Tage von der Aussenwelt abgeschieden wurden.
Bereits seit einiger Zeit hatte ich erzählen hören. Kwing Irang trage sich jetzt, wo sein grosses Haus bewohnbar war, mit dem Plane, Lirui, seine jüngste und dritte Frau, die bis jetzt bei ihren Eltern in Long ’Kup gewohnt hatte, zu sich zu nehmen. Die Vorbereitungen [90] hierzu waren augenscheinlich getroffen, die Geschenke für die Pnihing zusammengebracht und, das Wichtigste, die Zustimmung von Kwings Haustyrannen Bo Hiāng erhalten, denn nach Schluss des lāli parei zogen die Ältesten des Stammes nach Long ’Kup, um Lirui und deren Söhnchen Parèn abzuholen. Am folgenden Tage trafen die Erwarteten, von fünf Böten geleitet, ein.
Bevor sie das Ufer bestiegen, wurde den Dorfgeistern als Opfer ein Ferkel und ein Huhn dargeboten. Darauf nahmen einige Männer Lirui mit ihrem Sohn auf den Rücken und trugen sie den 10 m hohen Uferwall hinauf, wobei sie zum Schutz gegen die Sonne über Lirui einen grossen Sonnenhut, über Parèn einen geliehenen Regenschirm hielten. Das Pnihing-Geleite blieb zwei Tage still in Kwing Irangs Hause; Festlichkeiten fanden nicht statt, weil der Häuptling bereits mehrere Frauen hatte und gehabt hatte. Dann zog die Gesellschaft mit den Gongen und Tempajan, welche die panjin der Kajan als Kaufsumme für Lirui zusammengebracht hatten, wieder heim. Lirui selbst blieb mit ihrem Sohn und der Sklavin, die sie mitgenommen hatte, bei den Kajan zurück.
Die politischen Verhältnisse, der Bau des neuen Hauses und die Ankunft seiner jungen Frau waren zwar triftige Gründe, Kwing Irang ans Haus zu binden, doch zögerte ich nach Ablauf der Verbotszeit nicht länger, mit ihm persönlich über die Reisevorbereitungen zu sprechen, da ich nicht warten konnte, bis alle Umstände günstig waren, und da die nächsten Monate voraussichtlich keine besseren Aussichten bieten würden.
Als Kwing sich eines Abends zu mir auf die Plattform meiner Hütte setzte, von der ich eine schöne Aussicht über den Mahakam genoss, ging ich vorsichtig auf den bewussten Gegenstand ein; mein Freund schützte zwar allerhand vor, wie Mangel an Böten, dringende Arbeiten u.s.w., erwähnte aber die eigentlichen Hinderungsgründe nicht, immerhin ging aus allem hervor, dass er für die Reise keine Möglichkeit sah. In der Hoffnung, die Bewohner von Long Tĕpai würden, ihrem Versprechen gemäss, zur Reise geneigter sein, oder man würde dort Buschproduktensucher und Malaien zum Mitgehen bereit finden, jedenfalls aber, um den Kajan zu zeigen, dass ich nicht länger warten wollte, gab ich Kwing Irang meine Absicht zu erkennen, Bier und Demmeni voraus flussabwärts zu senden. Nach Ablauf des lāli parei aja reisten die beiden wirklich ab, in Gesellschaft eines der ältesten [91] Kajan, der den Long-Glat eine nochmalige Beratung ans Herz legen sollte.
Bald darauf schrieben meine Reisegefährten, die Aussichten wären auch in Long Tĕpai nichts weniger als günstig, man würde aber zur Beratung zu mir hinauffahren. Wenn den jungen Leuten in Long Blu-u die Vorstellung, mit mir nach dem interessanten Apu Kajan zu ziehen, nicht immer noch verlockend vorgekommen wäre und sie nicht schon teilweise ihre lĕwo (Reispacken) vorbereitet hätten, wäre ich unter diesen deprimierenden Umständen sogleich unverrichteter Sache zur Küste zurückgekehrt. In diesem kritischen Augenblick teilten mir die am jenseitigen Ufer wohnenden malaiischen Buschproduktensucher mit, sie wollten mich begleiten, falls Kwing Irang seine Zustimmung gebe. Auch glaubte ich in der Herrichtung des grossen Häuptlingsbootes ein gutes Zeichen zu sehen, hörte aber bald, es habe nur den Zweck, eine grosse Anzahl Männer, die im Walde Dielenbretter für Kwings Haus verfertigen sollten, den Blu-u aufwärts zu bringen.
Die Abgesandten aus Long Tĕpai trafen erst am 11. Februar ein; sie äusserten sich mittags sehr zurückhaltend, erklärten aber abends in einer allgemeinen Versammlung mit den Kajan rund heraus, dass sie nicht mit mir zu den Kĕnja reisen wollten, weil aus Apu Kajan sehr ungünstige Berichte gekommen wären. Sie machten zwar wieder den alten Vorschlag, Bo Tijung und Bo Ului zur Vorbereitung unseres Zuges zu den Kĕnja vorausreisen zu lassen, doch ging ich hierauf aus den bereits erwähnten Gründen nicht ein. Sie sprachen so überzeugend, dass ich selbst an eine aus Apu Kajan drohende Gefahr geglaubt hätte, wenn Kwing Irang mich nicht schüchtern gefragt hätte, was ich von der Ankunft des Kontrolleurs dächte, woraus ich ersah, dass man wie gewöhnlich die wahren Beweggründe nicht nannte, Bedrohungen aus Kutei aber die Haupthindernisse bildeten. Fest überzeugt von der Einsetzung eines niederländischen Beamten am Mahakam, liess ich meine Hoffnung daher nicht fahren. Dass man nicht aufrichtig gewesen war, merkte ich am folgenden Morgen, wo auch die Long-Glat sich weigerten, zur Vorbereitung der Reise nach Apu Kajan voraus zu ziehen. Bo Tijung war ein zu grosser Diplomat, als dass ich von ihm etwas erfahren hätte, so liess ich ihn denn wieder nach Hause gehen.
Am anderen Morgen, als ich gerade über die unklare Rolle, welche Kwing Irang und die Kajan in dieser Angelegenheit gespielt hatten, nachdachte, kam der Häuptling selbst, vergrämt und wie gealtert, [92] zu mir. Mit Tränen in den Augen berichtete er, auch er wäre über die bestimmte Weigerung der Long-Glat sehr erstaunt gewesen und hätte, wie übrigens auch ich, die ganze Nacht vor Aufregung nicht geschlafen. Wie Kwing erzählte, hatte der Sultan von Kutei jeden Stamm, der mir nach Apu Kajan half, zu bekriegen gedroht, was natürlich alle Häuptlinge—da die Ankunft eines Kontrolleurs noch ganz ungewiss war—eingeschüchtert hatte. Mehr war von Kwing nicht zu erfahren, daher begab ich mich am folgenden Tage, als die meisten Long-Glat mit Bo Tijung zum Früchtepflücken den Blu-u hinaufgefahren waren, um Näheres zu hören, zu dem gutmütigen Bo Ului Jok, unter dem Vorwande, von ihm Auskunft über den Boh und dessen Nebenflüsse haben zu wollen.
Mit grosser Bereitwilligkeit ging dieser darauf ein, bedauerte lebhaft den Verlauf der Reiseangelegenheit und erklärte unter Tränen, nicht alles sagen zu dürfen. Als ihm eine Verwünschung gegen Bang Jok entschlüpfte, wurde mir die Lage sofort klar. Bang Jok suchte aus Eigennutz und angestachelt durch den Sultan auf alle Weise meine Reise zu den Kĕnja zu verhindern und hatte dadurch seine Verwandten in Long Tĕpai völlig eingeschüchtert.
Der Schwerpunkt der Unterhandlungen wegen der Reise lag somit nicht länger bei den Kajan, sondern bei den Long-Glat in Long Dĕho, auch war es wünschenswert, persönlich der Kĕnjagesellschaft unter Taman Dau dort zu begegnen, bevor sie den Heimweg einschlug, und zu verhindern, dass sie sich, um Köpfe zu jagen, den Mahakam hinunter begab. Auf Rat und mit Hilfe von Kwing, der keine Möglichkeit sah, eine genügende Anzahl Kajan in kurzer Zeit für einen längeren Zug nach Long Dĕho auszurüsten, nahm ich 10 Malaien aus Long Buleng in Dienst, was mich von der schwerfälligen Hilfe der Blu-u Bewohner unabhängig machte. Hierbei verfolgte ich noch den Nebenzweck, die Malaien, falls die Reise zu den Kĕnja nicht zu Stande kam, für eine topographische Aufnahme der Nebenflüsse des Mahakam unterhalb der Wasserfälle zu benützen. Die Malaien waren hiermit auch einverstanden, nur fürchteten sie, dass ich sie am Ende geradenwegs nach Apu Kajan mitnehmen würde.
Bevor ich Long Blu-u verliess, musste ich noch Midan mit einigen Malaien nach dem Mĕrasè und Long Tĕpai schicken, um Reis einzukaufen. Kwing schlug mir auch vor, mein Personal den Kajan bei der Reisernte helfen zu lassen. Als Lohn sollte jeder einen Packen von 20 kg mitbekommen. [93]
Im letzten Augenblick erschreckte Njok Lea aus Long Tĕpai, der auf einer Reise zu den Pnihing bei uns Halt machte, Kwing noch so sehr mit allerhand Unglücksbotschaften, dass dieser erklärte, mich bestimmt nicht zu den Kĕnja begleiten zu können. Da die Lohnfrage in dieser Angelegenheit durchaus keine Rolle gespielt hatte, liess Kwing sich trotz meines Angebots von 500 fl als Lohn für die Reise von seinem Vorhaben, mich nur auf dem Mahakam begleiten zu wollen, nicht abbringen. Doch wollte er nochmals nach Long Dĕho zur Beratung kommen und vorher sorgfältig aus dem Vogelflug Vorzeichen einholen lassen. Taman Dau und seine Kĕnja wollte Kwing gern persönlich sprechen und von deren Betragen würde er seinen endgültigen Entschluss abhängig machen. Da der Wasserstand zum Passieren der Wasserfälle niedrig genug war, drängte ich zur Abfahrt, aber nachts vor dem festgesetzten Tag starb ein Kind im Dorfe und die Malaien verlangten dieses schlechten Vorzeichens wegen einen Reiseaufschub von einem Tage.
Am 9. März fuhren wir um 8 Uhr morgens endlich von Long Blu-u ab. Der Abschied von der Niederlassung, in der ich so lange Zeit verbracht hatte, fiel mir nicht schwer, denn die Wartezeit von Monaten hatte meine Geduld erschöpft, so dass meine Sehnsucht fortzukommen, jede andere Empfindung überwog.
In Long Tĕpai traf ich meine Reisegenossen Bier und Demmeni und alles Gepäck in guter Verfassung an, leider empfing mich aber sogleich die Schreckensnachricht, die Kĕnja unter Taman Dau hätten unterhalb der Wasserfälle 3 Ot-Danum, die am oberen Medang Buschprodukte suchten, die Köpfe abgeschlagen. Dieses Begebnis machte einen so grossen Eindruck, dass vorläufig an eine topographische Aufnahme der Nebenflüsse nicht zu denken war, weil die Malaien sich viel zu sehr fürchteten.
Unter diesen Umständen schien es mir am geratensten, den niedrigen Wasserstand für eine Fahrt nach Long Dĕho zu benutzen, um die Kĕnja persönlich sprechen zu können. Ich wartete daher nicht auf Kwing Irang, sondern liess mich von Bier nach Bang Joks Löwengrube begleiten; ausserdem kamen einige vornehme Long-Glat mit uns, unter ihnen Bo Tijung und Bo Ului, welch letzterer die Kĕnja persönlich kannte. Demmeni sollte zurückbleiben, um mit Kwing alles Gepäck nach Long Dĕho zu transportieren. Bo Lea von Long Tĕpai half mir mit vielen seiner Männer über die Wasserfälle. Am Fuss des [94] Kiham Kĕnhè glücklich angelangt, empfand ich für die Bereitwilligkeit, mit der mir diese sogleich Hilfe geleistet hatten, so grosse Dankbarkeit, dass ich jedem Manne statt des gewöhnlichen Taglohnes von 1 fl einen Reichstaler gab, eine Freigebigkeit, die ich später bedauerte.
Am 14. März hielten wir wiederum in dem alten baufälligen Fremdenhaus von Long Dĕho unseren Einzug. [95]
Kapitel V.
Organisation eines Stammes am oberen Mahakam—Stellung der Häuptlinge, Freien und Sklaven Vielweiberei—Verlobung, Heirat, Ehescheidung, Ehebrach, Erbschaftsrechte—Geburt und Verbotsbestimmungen für Kinder—Schreckfiguren und Beschwörungen zur Vertreibung von Krankheiten—Prophezeiungen aus den Eingeweiden von Tieren—Betrügerisches Vorgehender Priester—Geisterbeschwörung bei Dürre—Schöpfungsgeschichte der Mahakam-Kajan—Die mächtigsten Geister des Mahakam (seniang)—Begräbnisgebräuche—Ökonomische Verhältnisse am Mahakam Ackerbau und Ackerbaufeste—Verschiedene Feldprodukte—Sagogewinnung—Fleischnahrung—Fischfang und Fischzucht—Haustiere—Schlachtmethoden—Fleischkonservierung.
Die Organisation eines Stammes beruht bei allen Bewohnern des oberen Mahakamgebietes auf denselben Grundprinzipien, wie bei denen am oberen Kapuas, nur mit dem bemerkenswerten Unterschiede, dass bei ersteren, besonders bei den mit der Küstenbevölkerung noch wenig in Berührung gekommenen Stämmen, alle Bestimmungen der adat viel strenger gehandhabt werden als bei letzteren. Der Häuptling geniesst am Mahakam ein viel höheres Ansehen als am Kapuas, zwischen den verschiedenen Ständen, wie Freien (panjin) und Sklaven (dipe̥n), ist die Kluft hier eine viel grössere. Die Kajan suchen selbst energisch eine Vermengung der Klassen durch Heirat zu verhindern, was ihnen jedoch nur zum Teile glückt. Die dipe̥n werden zwar gut behandelt, weder verkauft noch getötet, aber nur wenige unter ihnen, wie Anjang Njahu und Sorong, übten durch ihre hohe Stellung beim Häuptling einen indirekten Einfluss auf die Stammesangelegenheiten aus. Während bei den Kajan am Mendalam viele Sklaven ein selbständiges Leben führten, einige selbst gegen den Willen des Häuptlings sich jahrelang bei anderen Stämmen auf hielten, wurde ihnen dies am Mahakam nicht gestattet. Kwing Irang hatte einen Teil seiner Sklavenfamilien unter Aufsicht einiger Mantri gestellt; während des Reisbaus wohnten die meisten auf den Feldern, die sie für den Häuptling zu bestellen hatten, und in der Niederlassung mussten sie ihre Wohnungen zu beiden Seiten des Häuptlingshauses bauen, nicht zwischen denen der Freien.
Eigener Grundbesitz ist den dipe̥n bei den Kajan nicht erlaubt, doch [96] erhalten sie neben den Feldern des Häuptlings ein Stück Fand zur eigenen Nutzniessung zugewiesen. Anjang Njahu hatte sich zwar ein selbständiges Reisfeld angelegt, war dafür aber verpflichtet, ein anderes für Kwing zu unterhalten. Im allgemeinen kommen bei den Sklaven 2 Arbeitstage für den Häuptling auf einen für sie selbst; auch tritt der Häuptling denjenigen seiner Familienglieder, die mit ihm keine gemeinsamen Äcker bebauen, zeitweilig einige Sklaven ab, um sie bei den Feld- und anderen Arbeiten zu unterstützen: so besass sowohl Kwings Sohn Bang Awan, als sein zu den Kajan von der Gegend unterhalb der Wasserfälle geflohener Neffe Ding Lalau einige Sklaven zur Aushilfe.

Drei wohlhabende Frauen der Kajan am Mahakam in Festkleidung.
Die Lebensverhältnisse der Sklaven hängen in hohem Masse von dem Charakter des Stammeshäuptlings ab; von den mehr als 150 dipe̥n des gutmütigen, sanften Kwing war noch nie einer durchgegangen, beim Pnihinghäuptling Bĕlarè jedoch kam dies mehrmals vor, selbst ganze Familien hatten es mit Erfolg versucht, nach dem Kapuas zu entfliehen. Früher war es allerdings auch bei den Kajan vorgekommen, dass ein Sklave sich zu einem anderen Häuptling, z.B. nach Lulu Njiwung, begeben hatte; in solch einem Fall gelangt er in den Besitz und unter den Schutz des neuen Häuptlings, der den Fall dann mit dem früheren Herrn ausmachen muss. Bei den Kajan konnten es ausnahmsweise, wie gesagt, einige Sklaven weit bringen, sowohl der im Stamme geborene, wie Anjang, als der neu erworbene, wie Sorong; selbst der Vorfechter gehörte bei ihnen dem Sklavenstande an.
Die Stellung der Freien, panjin, zum Häuptling ist im ganzen die gleiche wie am Mendalam. Nur ist die Kluft zwischen den Familien der Häuptlinge und denen der Freien am Mahakam weniger tief, weil die Vielweiberei der Häuptlinge und die Schwierigkeiten, die mit der Heirat einer Frau gleichen Standes verbunden sind, die Fürsten häufig dazu führen, ihre Frauen aus den Familien der panjin zu wählen.
Ein sehr grosser Gegensatz ist auch in der Stellung, welche die Frauen am Mendalam und Mahakam einnahmen, bemerkbar. Während sie dort in allen Angelegenheiten das Wort führten und in vieler Hinsicht grössere Rechte als die Männer genossen, spielten sie hier eine viel untergeordnetere Rolle, wurden in öffentlichen Angelegenheiten nicht zu Rate gezogen und durften bei Unterhandlungen mit Fremden nicht mitbeschliessen. Doch fehlte es auch unter den Mahakamfrauen nicht an kräftigen Persönlichkeiten, die in allen Angelegenheit einen grossen [97] indirekten Einfluss übten, wie z.B. Hiāng, Kwing Irangs älteste Frau, deren Meinung mehr Gewicht hatte, als die des Häuptlings selbst. Sie verstand unter den zahlreichen Sklaven die Ordnung aufrecht zu erhalten und durch ihren Mann im ganzen Stamm eine grosse Macht zu entfalten. Obgleich sie aus keiner Häuptlingsfamilie stammte und kinderlos blieb, heiratete sie doch drei aufeinanderfolgende Häuptlinge der Kajan, allerdings konnte sie nicht verhindern, dass Kwing noch eine zweite Frau, Uniang Anja, und während meines Aufenthaltes eine dritte, Lirui Anjang aus Long ’Kup, ehelichte. Sie hatte ihre Nichte Kĕhad adoptiert, die nach ihr Kĕhad Hiāng genannt wurde und im Häuptlingshause lebte. Auf Hiāngs Betreiben hatte ihr Mann früher einige seiner anderen Frauen aus dem Kajanstamm fortschicken müssen, obgleich eine derselben ihm seinen Sohn Bang Awan geschenkt hatte, der jetzt bei ihm wohnte. Übrigens erging es Hiāng wie es öfters willensstarken Personen ergeht, sie wurde ihrer Herrschsucht wegen von den meisten Stammesgliedern, die nicht zu ihrer Familie gehörten, gehasst, hauptsächlich von den Leibeigenen, die mehr als alle übrigen unter ihrem unmittelbaren Einfluss zu leiden hatten.
Uniang Anja, die zweite, viel jüngere Frau, erfüllte im Hause nur ihre Mutterpflichten gegenüber ihrem 12 jährigen Sohn Hang; sie war eine gute Seele, die in ihrer Jugend von einer Krankheit, die den Gaumen und die inneren Nasenteile verwüstet hatte, heimgesucht worden war; vielleicht verlor sie durch ihr Leiden die Energie, um sich gegen Hiāngs Tyrannei aufzulehnen. Sie gehörte einem angesehenen Geschlecht der Long-Glat an und brachte aus ihrem Kreise ein besonderes Talent im Rotangflechten und in der Herstellung von Perlenarbeiten mit, das von den Ihrigen sehr geschätzt wurde.
Auch Kwings dritte, noch sehr junge Frau Lirui, eine Tochter des Pnihinghäuptlings Anjang, übte auf den Lauf der Dinge im Hause wenig Einfluss aus; sie hatte überhaupt erst nach der Geburt ihres Sohnes Parèn beim Kajanstamm Einzug gehalten, teils aus Raummangel in Kwings provisorischer Wohnung, teils weil Hiāng ihr Kommen nicht wünschte.
Die Vielweiberei der Häuptlinge am oberen Mahakam muss dem Einfluss der am Unterlauf des Flusses wohnenden Mohammedaner zugeschrieben werden, denn nur die zur Häuptlingsfamilie der Long-Glat gehörigen Häuptlinge gestatteten sich diese Abweichung von der [98] vorväterlichen Sitte; keiner ihrer Freien besass mehr als eine Frau; auch die noch ursprünglicheren Sitten huldigenden Häuptlinge der Pnihing, Ma-Suling und, wie wir sehen werden, der Kĕnja lebten monogamisch. Die Tatsache, dass die Polygamie sich unter den Mahakam-Bahau verbreiten konnte, spricht vielleicht ebenfalls für die niedrigere Stellung, welche ihre Frauen im Vergleich zu denen am Kapuas einnehmen.
Dasselbe Moment liegt wohl auch dem besonders bei den Blu-u Kajan herrschenden Brauch, die Mädchen bisweilen schon bei ihrer Geburt mit einem jungen oder sogar älteren Manne zu verloben, zu Grunde. Auch diese Sitte kann ursprünglich bei ihnen nicht heimisch gewesen sein, weil sie nach dem Glauben der Kajan selbst ihren Geistern ein Dorn im Auge ist, die sie dafür mit Krankheit und Unglück heimsuchen. Die Folge dieser Vernunftheiraten ist denn auch, dass die Mutterschaft bei den Frauen viel früher eintritt, als wünschenswert ist. Am Blu-u sieht man auch auffallend viele junge, beinahe kindliche Mütter. Die Sitte, ihre Töchter in sehr jugendlichem Alter zu verheiraten, haben die Kajan vielleicht von ihren zahlreichen Sklaven aus den Baritostämmen, bei denen sie allgemein verbreitet ist, übernommen. Über Heirat, Scheidung und Ehebruch ist bereits an anderer Stelle (T. I p. 364–67) einiges mitgeteilt worden, das folgende möge als Ergänzung dienen.
Die meisten Eheschliessungen gehen derart vor sich, dass ein heiratsfähiger junger Mann seine Eltern oder, in Ermangelung derselben, andere Familienglieder über eine vorläufige Verbindung mit einem etwa 6 jährigen Mädchen unterhandeln lässt. Er tritt dann sogleich in die Familie seiner Schwiegereltern ein, nachdem er diesen sowie der kleinen Braut ein Schwert oder ein anderes von seinen Angehörigen aufgebrachtes Geschenk übergeben hat. Seine Arbeit kommt den Schwiegereltern zu Gute, und oft wird er, sobald das Mädchen ungefähr heiratsfähig geworden ist, ohne fernere Heiratszeremonie zu deren Manne.
Ist das Mädchen bei der Abmachung zwischen den beiderseitigen Familien älter, dann leben die jungen Leute etwa einen Monat lang zusammen, und gefallen sie einander, so schliessen sie mit einer einfachen, in einer kleinen Festmahlzeit bestehenden Feier den Heiratsbund. Beim nächsten Neujahrsfest folgt dann ein grösseres Mahl, bei dem ein Schwein geopfert wird, von dem jede Dorffamilie ein Stück erhält.
Fühlen sich erwachsene Männer und Mädchen zu einander, hinge [99] zogen, so bietet ihnen über Tag die gemeinsame Feldarbeit Gelegenheit zu intimem Verkehr; abends geben sie sich mit ihren Liegmatten im hohen Grase unten am Fluss ein Stelldichein. Durch Ausspülen beim Baden sucht das Mädchen den unerwünschten Folgen ihres Verkehrs vorzubeugen, was aber nicht stets gelingt.
Bleiben diese nicht aus, so müssen die Schuldigen ein Schwein und eine bestimmte Menge Reis opfern, um von ihren Angehörigen den Zorn der Geister abzuwenden, die sonst ein Missglücken von Ernte, Fischfang und Jagd verursachen würden. Zeigt sich das Paar zur Heirat nicht geneigt, so wird diese auch nicht für notwendig angesehen, auch verhindert ein derartiges Erlebnis ein Mädchen nicht, später eine passendere Ehe mit einem anderen Manne einzugehen.
Über die Heiratszeremonien ist bereits Teil I pag. 87 u. 365 berichtet worden.
Das Eheband wird bei den Blu-u Kajan leicht wieder gelöst. Ich sah häufig Scheidungen stattfinden, weil ihre beiderseitigen Charaktereigenschaften Mann und Frau nicht gefielen, oder die Ehe kinderlos blieb. Ein Mann liess sich von seiner Frau scheiden, weil er ein Kind aus ihrer früheren Ehe nicht leiden mochte, ein anderer machte sich einfach davon, weil ihm die Versorgung seiner immer grösser werdenden Familie zu schwierig vorkam.
Auch Heiraten zwischen Freien und Sklaven, zu denen der Häuptling bisweilen gezwungenermassen seine Zustimmung erteilt hat, sucht man, besonders beim Kajanstamm, wo eine Vermengung mit Leibeigenen sehr ungern gesehen wird, bald wieder zu lösen.
Der junge Mann, der eine Sklavin heiratet, nimmt alle Pflichten eines Sklaven auf sich, erhält jedoch bei einer Scheidung- seine Freiheit zurück; sind Kinder vorhanden, so folgen diese dann dem Stande der Mutter, bis auf eines, das der Vater in seine Familie mitnimmt. Tritt ein Sklave aus dem Häuptlingshause als Schwiegersohn in eine panjin-Familie, so muss ihn eines seiner männlichen Kinder beim Häuptling als Sklave vertreten. Bei den Long-Glat und Ma-Suling bestehen diese strengen Regeln nicht, mit dem Resultat, dass die Leibeigenen ständig in den Stamm heiraten und ihre Anzahl fortwährend abnimmt. Auch unter den Kajan hat im einzelnen Falle das Ansehen der betreffenden Familie auf die vom Häuptling und seinen Mantri zu fassenden Beschlüsse grossen Einfluss.
Die Ehe wird von den Kajan trotz ihrer leichten Lösbarkeit durch [100] aus als bindend angesehen, und ein Treubruch seitens des Mannes oder der Frau mit einer Busse an den beleidigten Teil gestraft. Auch wird solch ein Ereignis als eine Schande und als ein Unglück für den Stamm angesehen.
Die Häuptlinge nehmen hinsichtlich der Ehe, wie gesagt, eine gesonderte Stellung ein, indem ihnen allein das Recht zusteht, mehrere Frauen zu heiraten; diese geniessen als Gattinnen eines Häuptlings zwar das gleiche Ansehen im Stamme, aber für ihre Kinder gelten die mit der Geburt der Mutter verbundenen Erbschaftsrechte; ferner darf das Abzeichen der Frauen von hohem Stande, eine mit Hundezähnen verzierte Perlenmütze, nur von geborenen Fürstinnen getragen werden.
Die adat und menschliche Eitelkeit verlangen eigentlich von ihren Häuptlingen eine Verbindung mit einer ebenbürtigen Fürstentochter, doch legt eine solche Heirat dem künftigen Gatten die Verpflichtung auf, mindestens 2 Jahre im Hause der Schwiegereltern zu arbeiten. Die jungen Häuptlinge der Kajan trösten sich daher oft mit Frauen aus den Familien der Freien, die ihnen zwar keine Kinder von so hoher Geburt schenken, von ihnen aber auch nicht die Erfüllung so hoher Forderungen verlangen. Besonders wenn die erste Frau bereits aus vornehmem Geschlechte stammt, braucht der Häuptling bei der Wahl der folgenden nicht mehr so streng auf die adat zu achten.
Eine Heirat zwischen Häuptlingen und Leibeigenen kam bis jetzt nicht vor.
Stirbt eines der Eheleute, so darf der überlebende Teil, wenn er zu einer Häuptlingsfamilie gehört, erst nach Verlauf eines Jahres eine neue Ehe eingehen, ist er ein panjin, bereits nach einem halben Jahr.
Bei den panjin und dipe̥n der Blu-u Kajan wird die Vorschrift, dass ein junger Ehemann zur Familie seiner Frau zieht, nicht so streng gehandhabt wie am Mendalam; sind beide Teile erwachsen, so zieht das Mädchen wohl auch gleich in das Haus ihres Gatten oder das seiner Eltern, besonders wenn dieser ein einziger Sohn ist und seine Familie ihn nicht entbehren kann.
Die Heiratsgebräuche stehen nach dem Glauben der Kajan unter der Obhut des Schöpfers Tamei Tingei und eine Übertretung derselben wird bisweilen auf eigentümliche Weise gesühnt, z.B. durch Herstellung von Menschenfiguren (te̥patong). Schliesst nach dem Tode eines der Ehegatten der überlebende Teil vor Ablauf der bestimmten [101] Frist eine neue Ehe, so lässt man fusshohe Figuren, zwei männliche und zwei weibliche, als Opfer auf einem Floss (sahn) den Fluss abwärts treiben. Die Neuvermählten opfern bei einer me̥lā darauf Schweine und Hühner und richten ein allgemeines Gastmahl an.
Bei einem Ehebruch rächt sich Tamei Tingei an dem ganzen Stamm, indem er ihn mit Krankheiten und Missernten heimsucht. Die Kajan nehmen daher in diesem Fall ein “ne̥me̱ urib” vor, wörtlich: “Verbesserung des Daseins.” Sie setzen an Stelle der Holzbilder die beiden Schuldigen auf das Floss und lassen sie mit der Strömung abwärtstreiben. Ursprünglich wurden die Ehebrecher wahrscheinlich tatsächlich geopfert, gegenwärtig retten sie sich aber durch Schwimmen; aus Übermut treiben sogar manche freiwillig auf dem Floss ein Stück weit mit (Mehr hierüber T. I p. 367).
Von der Zeit vor seiner Geburt bis zu seinem Tode ist jede Lebensperiode eines Mahakambewohners an bestimmte religiöse Vorschriften geknüpft. Beide Eltern dürfen während der Schwangerschaft keine geschlachteten Hühner berühren; der Mann darf keinen Griff mit Guttapercha auf ein Schwert befestigen, keine Erde stampfen, z.B. beim Einrammen von Pfählen, da das Kind sonst nicht zum Vorschein kommen will. Eine Übertretung noch anderer Vorschriften hat zur Folge, dass das Kind bald nach der Geburt stirbt.
Am Mahakam geschieht es öfters als am Mendalam, dass man ein Kind, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist oder dessen Eltern auf irgend eine Weise erschreckt worden sind, in den Wald aussetzt, wo es umkommt oder von kinderlosen Eltern aufgenommen wird.
Während ein Kind heranwächst, durchläuft es mehrere, durch Opfer von einander getrennte Zeitperioden, die es allmählich den Vorrechten der Erwachsenen zuführen. Für Knaben muss z.B. im 12ten Lebensjahr geopfert werden, damit sie ein echtes Schwert tragen dürfen, später wird ein Huhn geopfert, damit der Griff mit kurzen Haaren verziert werden darf. Um lange Haare am Griffe anbringen zu dürfen, ist die Opferung eines Schweines erforderlich. Ein zweites Schwein verlangen die Geister, wenn der Knabe seine Kleidung durch eine Sitzmatte vervollständigen will. Diese Opfer werden mit be̥t lāli bezeichnet, ein Ausdruck, der allgemein die Aufhebung einer Verbotszeit bedeutet. Erst wenn alle Vorschriften erfüllt worden sind, wird der junge Mann zu den Erwachsenen gerechnet. Für Mädchen gelten ähnliche Bestimmungen. [102]
Die Freien und Sklaven bringen diese Opfer nicht selbständig, zu beliebigen Zeiten dar, sondern sie warten hierfür grosse religiöse Zeremonien in der Häuptlingsamin ab. Wird dort ein ajo̱ (Kopfjagd) bei der Ablegung der Trauer oder beim Einzug in ein neues Haus gehalten oder ein dangei gefeiert, so gehen sie im be̥t lāli des Kindes einen Schritt vorwärts. Bevor dieses erwachsen ist, dürfen seine Kleider nicht beseitigt oder verkauft werden, sehr wahrscheinlich, damit die noch schwache bruwa des Kindes den Kleidungsstücken nicht folge, wodurch es krank werden würde. Aus demselben Grunde will man auch die hăwăt der Kinder nicht verkaufen; nur einige Male gelang es mir, die Tragbretter lang verstorbener Personen zu erstehen. Die Kajan trennen sich auch nicht von ihren Tragkörben, ingan dawan; die Long-Glat dagegen verkauften mir einige, aber zu hohem Preise.
In anderen Punkten sind die Long-Glat übrigens viel abergläubischer als die anderen Stämme; so verschieben sie z.B. das lāli parei wegen eines hadui (= me̥lā) bei Krankheit oder eines ajo̱ für ein neues Häuptlingshaus so lange, bis der Reis überreif auf der ladang abfällt. Ferner wagen sie auch beim grössten Nahrungsmangel nicht zu ernten, wenn auf dem Felde der Tragriemen eines Reiskorbes bricht oder dieser umfällt.
Krankheiten suchen die Mahakambewohner teils durch Schreckfiguren aus Holz, teils durch Beschwörungen zu vertreiben. Betrifft es einen ganzen Stamm, so werden über 1 m hohe menschliche Figuren beiderlei Geschlechts am Flussufer aufgestellt, um die bösen Geister in die Flucht zu jagen. Auch in jedem Privathause werden dann solche te̥patong, wenn auch in kleinerem Massstabe, verfertigt.
Wird nur eine Familie durch sehr schwere Krankheit getroffen, so wendet nur diese die te̥patong an.
Gefürchteter als die aus der Umgegend stammenden bösen Geister sind die aus fernen Gegenden, welche die Reisenden begleiten. Als mich im Jahre 1897 eine Gesellschaft vom mittleren Mahakam bei den Blu-u Kajan besuchte, zeigte sich keine Frau ausserhalb ihres Hauses ohne ein brennendes Bündel Plehidingbast, dessen stinkender Rauch die bösen Geister vertreibt.
Dass diese für besonders verhängnisvoll gehalten werden, wenn sie aus der Ferne kommen, ist begreiflich, denn von weitem heimkehrende Bewohner bringen häufig Infektionskrankheiten in ihr Dorf mit, hauptsächlich influenzaartige. Die Kajan bezeichnen denn auch Husten und [103] Schnupfen, die wichtigsten Symptome dieser Infektion, mit demselben Namen wie die fremden Geister, nämlich mit “bĕngĕn”. Da auch Cholera und Pocken auf diese Weise verbreitet werden, erscheint die Furcht der Eingeborenen vor den Geistern aus der Fremde völlig berechtigt.
Die Krankenbeschwörungen am Mahakam beruhen auf derselben Idee wie am Mendalam, nur sind die Äusserungen desselben Glaubens bei den Priestern der einen und anderen Stämme eigentümlich verschieden. Während der grobe Betrug, den die dājung am Blu-u treiben, indem sie krankheiterzeugende Tiere und Gegenstände aus dem Körper der Patienten zum Vorschein bringen, sofort ins Auge springt, beobachtete ich nichts ähnliches am Mendalam, auch äusserte sich eine Beseelung hier niemals in Begleitung von Zittern und Krämpfen.
Zur Veranschaulichung des Gesagten mag hier die Beschreibung eines grossen Beschwörungsfestes folgen (Beschwörung halten = ĕnah abei), das Kwing Irang, als seine Familie durch Krankheit heimgesucht wurde, zur Beschwichtigung der Geister im Jahre 1897 vornehmen liess.
Den eigentlichen Festtag leiteten 3 der obersten weiblichen und Bo Bawan, der oberste männliche Priester mit einem Opfer an die unter dem Flusse wohnenden Geister ein. In netter, aber gewöhnlicher Kleidung begaben sich die Vier zum Blu-u, unter Vortritt von 4 jungen Männern, von denen zwei grosse Gonge, die anderen Priesterbecken ertönen liessen, um die Geister auf die kommende Zeremonie aufmerksam zu machen. An der Ufertreppe stehend boten alle zugleich in altem Busang den Geistern ein Küchlein, ein Bambusgefäss mit Salz, Reis und essbare Blätter, sowie einen weissen Kattunlappen zum Opfer an. Nachdem alle die Gegenstände in die Hand genommen hatten, schleuderte Bo Bawan sie über den Fluss. Eine der dājung schnitt dem Küchlein den Hals durch, alle Anwesenden bespieen das Tier, damit die Geister am Geruch die Geber erkennen sollten, dann warf der Priester auch dieses ins Wasser. Nur der Kattunlappen wurde unter Beckenschlag ins Haus zurückgetragen.
Etwas später erklangen die Becken aufs neue, diesmal in der Häuptlingswohnung, zum Zeichen, dass eine andere Zeremonie begonnen hatte. Bei meinem Eintritt, der die versammelte Menge nicht zu stören schien, sah ich unter dem geöffneten Dachfenster 8 dājung sitzen, vorn männliche, hinten 6 weibliche. Erstere waren damit beschäftigt, unter dem ohrenzerreissenden Gebrumm der Gonge den guten Geistern in singendem Tone die von Kwing und den Seinen gebotenen Opfer [104] anzutragen. Diese lagen in Form von zwei gebundenen Schweinen, einem Huhn und zwei Küchlein rechts von den dājung, und einige Männer bemühten sich redlich, die Tiere durch Krauen von einem Überschreien der Gonge zurückzuhalten. Vor der Priesterschar lag ihr Lohn, bestehend in Schwertern, Zeug, Perlen und einem neuen tempajan. Alle Familien der amin aja und auch viele andere hatten hierzu beigetragen. Die Schweine hatte Kwing einige Tage zuvor im Dorfe gekauft, da er selbst keine besass.
Der Häuptling und seine Familie sassen links um die dājung geschart; vorn Klang selbst unter einem Regenschirm europäischer Herkunft, rechts von ihm sein Sohn Bang unter einem grossen kajanischen Hut. Hinter ihnen sassen die Frauen und Kinder in ihrer besten Kleidung, völlig unter dem ernsten Eindruck der vorsichgehenden Feierlichkeit. Der gleiche Ernst lag auch auf den Gesichtern der zahlreich versammelten Menge, die den übrigen Teil des Raumes füllte. Die Diele, die bisher gewiss nur selten eine solche Menschenmasse getragen hatte, war am vorhergehenden Tage durch Pfähle unterstützt worden. Zum Glück war in dem allseits offenen Genrache von starker Ausdünstung nichts zu merken, sonst hätte man es unter den 200 Personen bei dem entsetzlichen Lärm kaum aushalten können.
Nachdem die Priester eine halbe Stunde lang die guten Geister von Apu Lagan angerufen hatten, wurde den beiden Küchlein der Hals durchschnitten und darauf der Bauch mit einem Längsschnitt geöffnet, um aus dem Fehlen oder Vorhandensein der Gallenblase zu schliessen, ob die Geister den Augenblick zum Opfern der Schweine für günstig hielten oder nicht.
Beide Tierchen besassen eine gut gefüllte Gallenblase, so dass mit dem Schlachten der Schweine begonnen werden durfte. Das Huhn, das mir zum Geschenk angeboten wurde, bildete eine willkommene Abwechslung in unserem damals sehr einförmigen Menu.
Nun wurden die Schweine abgestochen und zwar, wie gewöhnlich, auf äusserst ungeschickte Weise. Das Blut floss teils in einen eisernen Topf, teils auf ein Pisangblatt mit rohem Reis, auf dem bereits das Blut der Küchlein aufgefangen worden war. Alle Anwesenden mussten dieses erste Opfer berühren, damit die Geister am Geruch merkten, dass es von ihnen allen gespendet wurde. Auch wir verliehen ihm durch Berührung unsere europäischen Gerüche, worauf eine dājung aus dem Dachfenster in die Luft hinaus schleuderte. [105]
Den Schweinen wurde ebenfalls nach dem Verenden der Bauch durch einen Längsschnitt geöffnet, man führte aber noch einen Querschnitt unter dem rechten Rippenbogen aus, um die Unterseite der Leber und die Milz bequem untersuchen zu können.
An der Leber ist das Verhältnis des kleinen Lappens zur Gallenblase massgebend; ist letzterer gut ausgebildet und mit ersterer fest verbunden, so ist das Vorzeichen günstig, im entgegengesetzten Fall aber ungünstig. Ein tief eingeschnittener Rand der Milz prophezeit Unglück, ein gerader dagegen Glück. Zur allgemeinen Befriedigung liessen die Eingeweide beider Tiere nichts zu wünschen übrig.
Hiermit war das eigentliche Opfer abgelaufen und die gute Gesinnung der Geister festgestellt, was für alle, besonders aber für Kwings sehr gläubige Frau Hiāng eine grosse Beruhigung bedeutete. Mit einem Seufzer der Erleichterung konstatierte sie denn auch das günstige Aussehen der Lebern und Milze.
Nachdem auf diese Weise den Geistern und Seelen der Anwesenden Genüge getan worden war, schickte man sich an, die materiellen Genüsse der Menge vorzubereiten. Den Opfertieren wurden zuerst die Borsten mit brennenden Holzspähnen versengt; dann übergoss man sie mit heissem Wasser, schabte mit Schwertern den Rest der Borsten ab, nähte ihnen mit wenigen Stichen den Bauch zu und trug sie zum Flusse, wo einige Männer alle geniessbaren Teile, auch die Därme, reinigten und darauf alles wieder zum Hause hinauftrugen. Hier zerlegten sie das Schwein in kleine Stücke und kochten diese in grossen Töpfen mit Wasser. Darauf wurde das Fleisch ohne weitere Zuspeisen mit Reis und Klebreismehl, das die Frauen schon am Tage vorher zubereitet hatten, genossen. Alles, was mit den Opferspeisen in Berührung kommen musste, war vorher im Blu-u gut gewaschen, und die grünen Bambusinternodien, in denen der Reis gekocht werden sollte, in schweren Lasten mit Wasser gefüllt hinaufgetragen worden. Die Frauen hatten den Reis und das Mehl für diese Gelegenheit in ±4 cm breite und a dm lange platte Päckchen von Pisangblättern gewunden und in die Bambusgefässe gesteckt. Diese füllten sie nun mit Wasser und stellten sie dann in schräger Lage in Reihen auf Gerüsten, halb neben, halb über langen Feuern, so dass ihr Inhalt genau gar war, als der Bambus vom Feuer versengt zu werden anfing. Auch wir erhielten unseren reichlichen Anteil an den Speisen, und der Reis schmeckte mit etwas Zucker, infolge des eigenartigen Aromas des Bananenblattes, [106] nicht schlecht, dagegen hatten wir uns noch immer nicht daran gewöhnen können, das Fleisch ohne Salz zu geniessen.

Frauen der Mahakam-Kajan in Alltagskleidung.
An dem Tage, wo das Opfer und Festmahl stattfanden, durfte das Feuer in der amin aja nicht ausgehen, in allen anderen Wohnungen dagegen durfte überhaupt keines angemacht werden. Männer und Frauen benützten jetzt zum Anzünden ihrer Zigaretten vorzugsweise Hölzchen aus dem Herdfeuer des Häuptlings, während sie sich sonst ihres Feuerzeugs bedienten.
Mittags nach dem grossen Mahl traf man in der amin Vorbereitungen für die eigentliche Krankenbeschwörung. Das wichtigste war dabei ein senkrecht gestellter Holzrahmen, in dessen Mitte ein verzierter Pfahl aus bräunlichem Holz aufgerichtet wurde. Dieser diente als Träger für die Opfergaben: Halsketten und Gürtel aus Perlen, über diesen eine hohe kegelförmige Bahaumütze, in hübschen Mustern mit kleinen bunten Perlen bestickt und umgeben von einem Kranz von Hundezähnen. Unter diesen Gaben hingen die Schnauzen und Schwänze der geschlachteten Schweine, verbunden mit einem Hautund Speckstreifen von der ganzen Rückenlänge der Tiere, um Tamei Tingei die Grösse der getöteten Opfer anzugeben. Den Pfahl, kaju arön genannt, hatte man überdies reich mit langen Holzspiralen behängt, welche die Männer tags zuvor sehr geschickt aus geeignetem Fruchtbaumholz in über 1 m Länge und nur 1 cm Breite geschnitten hatten. Sie stellten mit ihren Messern, nju, bisweilen 10 solcher Spiralen derart her, dass sie an einem Ende mit dem Holz verbunden blieben und dann als langer Büschel mit dem Spahn vom Holze abgeschnitten werden konnten.
Zu beiden Seiten des Opferpfahls, innerhalb des Rahmens, wurden nun parallel zwei Reihen über 2 m hohe Bambusstöcke aufgestellt, also im ganzen vier Reihen, von denen jede nach der heiligen Zahl aus 8 Stöcken bestand, die ebenfalls mit Holzspiralen geschmückt wurden. So entstand eine Art von doppeltem Heckwerk mit dem kaju arön in der Mitte, an den man noch eine Menge schöner Dinge, hauptsächlich Perlensachen und Päckchen von Reis und Schweinefleisch hängte, um ihn für die Geister noch verlockender zu machen.
Über dem Ganzen thronte aus schwarzem und rotem Zeug nachgebildet die mĕnjiwan, die öfters erwähnte Schlange mit rotem Kopf und Schwanz, eines der wichtigsten wahrsagenden Tiere, das von den bösen Geistern sehr gefürchtet wird. Am Fuss dieses Opfergerüstes, das [107] bis nach dem me̥lo̱ (Ruhen nach dem Opfer) stehen bleiben musste, lagen und standen Gonge und wertvolle tempajan, wie seinerzeit auch am lăsa̱ der Mendalam Kajan (Teil I pag. 177). Die dājung sollten hier erst spät abends, nachdem alle nochmals gespeist hatten, ihres Amtes walten; vorher, bei Einbruch der Dunkelheit, mussten Kwing und seine beiden Söhne noch ein besonderes Opfer bringen. Zu diesem Zweck richteten einige Männer vor dem Hause eine Reihe von 4 × 8 Bambusstöcken auf, deren oberes Ende gespalten und auseinander gebogen wurde. Ringsherum bedeckten sie die nasse Erde für die Teilnehmer an der Zeremonie mit Brettern. Ein lebhaft rauchendes Feuer diente zur Vertreibung der zahlreichen Moskitos, damit diese die Aufmerksamkeit der Leute nicht ablenkten.
Zuerst kamen Kwing und sein Sohn Bang, beide mit hübschem Lenden- und Kopftuch bekleidet und mit einem Schwert bewaffnet, von ihrer Wohnung herab, gefolgt vom Priester Bo Bawan und einer ganzen Reihe von Männern, die sich alle auf den Brettern niederliessen. Einige junge Leute mit grossen Gongen und Becken stellten sich zur Seite, worauf Bo Bawan in der Busangsprache die Luft-, Wasser- und Erdgeister anrief, unter lautem Dröhnen der Instrumente. Darauf steckten die beiden Hauptpersonen in jedes gespaltene Bambusende ein Ei, wobei sie ständig die Geister um Hilfe anflehten.
Die Dämmerung war bereits längst vorüber, als man sich in derselben Reihenfolge wieder hinauf begab. Die geopferten Eier werden niemals gestohlen, sie bleiben auf den Stöcken, bis diese umfallen oder verwesen.
Erst gegen 9 Uhr ertönte aus dem Hause das eigentümliche Rezitativ des Priestergesanges, das eine neue Feier in des Häuptlings amin ankündete. Wir fanden dort Männer, Frauen und Kinder bereits versammelt. Nur für die dājung war um das Opfergerüst ein freier Platz übrig geblieben; sie sassen je zu vieren einander gegenüber auf der Diele, mit einem Raum zwischen sich für die Priesterin, die gerade das Wort zu führen hatte. Der Reihe nach stand nämlich eine von ihnen auf und begann in singendem Tone, augenscheinlich in Prosa, die Schicksale des Stammes und andere Überlieferungen aufzusagen, wobei die Anwesenden an bekannten Stellen einfielen; einige junge Leute zeigten dabei eine besondere Begabung.
Im allgemeinen bediente man sich der alten Busangsprache, nur wenn es die Ereignisse der letzten Zeit und den Zweck dieser Versammlung [108] zu erzählen galt, eine Aufgabe die Bo Bawan zufiel, gebrauchte man das moderne Busang. Die meisten dājung leierten mehr als dass sie sprachen, die Bambusreihe umschreitend, ihre Worte her und brachen nur dazwischen mit einem o—é und darauffolgenden Satz ab, wobei sie nach dem Kopf griffen und heftig aufstampften. Auch fielen ihnen dann die Augen zu; wie die Leute behaupteten, liess sich ein beseelender Geist für einen Augenblick in den Priester oder die Priesterin nieder, wodurch sie das Bewusstsein völlig verloren. Eine der Frauen, die viel Eindruck machte, war von Natur augenscheinlich sehr nervös, denn sie bewahrte nicht wie die übrigen während ihres Vortrags und des Niedersteigens ihres Geistes ihre Ruhe, sondern geriet in Erregung, machte eigentümliche Schritte, blieb plötzlich stecken, ergriff die Bambusstöcke und schüttelte sie heftig, wobei ihre o—é-Rufe und Gebärden die Ankunft des Geistes ankündeten. Dieser Priesterin, Sari (Taf. 26 T. 1), fiel auch die Aufgabe zu, Kwings zweite Frau, Uniang, zu einer dājung auszubilden; zu diesem Zweck sagte sie ihr die richtigen Worte vor, falls diese nicht schnell genug zum Vortrag kamen. Die beiden Frauen standen dabei vor der Bambusreihe, und, sobald der richtige Augenblick zum Niedersteigen des Geistes nahte, empfing Uniang ein Zeichen mit dem Fuss, worauf sie in sehr unbeholfener Weise die gewünschten Gebärden folgen liess. Nach einiger Zeit schien Uniangs Geist sich wirklich zu nähern; das spärliche Licht der wenigen Harzfackeln wurde von den Nächstsitzenden durch einen Schirm gedämpft, die älteste dājung fing den Geist in einem Tuch auf, legte Uniang ein Schwert aufs Haupt, wie um es zu spalten, und blies ihr dann den Geist in diesen Spalt ein.
Während dieser auf die Dauer sehr langweiligen und einschläfernden Vorgänge lagen oder sassen in dem halbdunklen Raume 2–300 Männer, Frauen und Kinder beieinander, folgten mehr oder minder andächtig den Beschwörungen oder vertrieben sich die Zeit mit Rauchen und Sirihkauen. Mehrere Frauen sorgten dafür, dass die Rauch- und Kaulustigen nicht zu kurz kamen; Bambusrohre mit seitlichen Öffnungen, in welche die Frauen Zigaretten gesteckt hatten, machten unter den Anwesenden die Runde. Die Kinder schliefen beinahe alle an ihre Eltern gelehnt oder in Gruppen in den Ecken oder den gesonderten kleinen Kammern. Auch die Erwachsenen waren nicht imstande, die ganze Nacht über munter zu bleiben, und da ihre Haltung ebensogut ein Wachen als ein Schlafen zuliess, versanken sie ab und zu [109] ins Traumland, aus dem sie erst wieder zurückkehrten, wenn ihre Nachbarn sich zu stark bewegten, oder die dājung zu laut wurden. Auch für die Hungrigen hatte der Häuptling gesorgt, indem er gegen 2 Uhr nachts Reis und Schweinefleisch umherreichen liess, nur die jüngsten Fürstenkinder vermochte auch kein Schweinefleisch mehr aus dem Schlaf zu erwecken.
Erst gegen Morgen endeten die Zeremonien und fand die eigentliche Beschwörung der bösen Geister statt, welche die Krankheit verursacht hatten. Während man den Raum verdunkelte, wurden Bo Bawan und die Priesterinnen von ihren Geistern besessen, gerieten in Aufregung, jagten den bösen Geistern nach und vertrieben sie endlich aus der Wohnung. Die aus Apu Lagan niedergestiegenen guten Geister, welche die dājung beseelt hatten, brachten auch Flusswasser von dort mit, mit dem die dājung alle Glieder der Häuptlingsfamilie besprengten, während die übrigen Anwesenden sich beeilten, die Finger in dieses Wasser zu tauchen und sich den Körper damit einzureiben. Nach dieser Zeremonie zu urteilen, stellen sich die Kajan ihre Priester und Priesterinnen vor einem Geist aus Apu Lagan beseelt vor, der sich nicht ständig in ihnen aufhält, sondern sie nur bei einer Anrufung erfüllt und ihnen dann die Kraft verleiht, vor allem gegen böse Geister anzukämpfen. Daher rufen die Bahau in Krankheits- und Unglücksfällen die Hilfe der dājung ein. Die Priester besitzen einen männlichen, die Priesterinnen einen weiblichen Geist. Werden Nachkommen der Priester von Geistern beseelt, so stammen auch diese Geister von väterlichen oder mütterlichen Geistern ab. Ob jemand zur Beseelung geeignet ist, können nur Eingeweihte beurteilen; diese scheinen es hierbei nicht auf besonders nervöse Personen abgesehen zu haben, wenigstens zeichnete sich hier am Blu-u, wie wir gesehen haben, von den 8 Frauen nur eine durch leichte Erregbarkeit aus.
Die älteste Priesterin der Kajan schien auch bei den Pnihing und Long-Glat Ansehen und Praxis zu besitzen, jedenfalls erzählte sie mir, sie habe nicht nur einen Geist der Kajan, sondern auch einen der Pnihing und einen der Long-Glat zur Verfügung. Wahrscheinlich glaubte sie selbst nicht daran. Bei verschiedenen Gelegenheiten merkten wir nämlich, dass die dājung der Kajan ihre Gemeinde mit vollem Bewusstsein betrogen. An einem seiner Zauberabende, die Demmeni bisweilen zu allgemeinem Ergötzen veranstaltete, ahmte er das Kunststück der dājung nach und brachte mittelst einer in den Ärmel genähten [110] Kautschukspritze Wasser aus Apu Lagan zum Vorschein. Er erfreute sich denn auch desselben Erfolges wie die Priester, denn die erstaunten Zuschauer rieben sich auch mit diesem Himmelswasser sehr eifrig ein. In der Hoffnung, dass ihm dieses Kunststück in seinem Priesteramt gut zu statten kommen könnte, suchte Bo Bawan Demmeni dazu zu bewegen, sein Geheimnis zu verraten, wozu dieser sich aber nicht geneigt zeigte. Darauf erklärte Bawan sich bereit, Demmeni als Gegendienst die Methode der dajakischen Priester, um Wasser zu zaubern, anzuzeigen; doch ging er selbst später nichtmehr darauf ein.
In Krankheitsfällen holen die dājung Schlangen, Eidechsen, Würmer, Blätter, Reis oder Zigarettenhüllen aus dem Körper der Patienten hervor. Die mit dieser Prozedur verbundenen Vorschriften gelten dann für den Kranken als lāli und müssen von ihm während seines ganzen Lebens befolgt werden. Einst sah ich eine Priesterin um eine junge Frau bemüht, die abends vor Schreck ohnmächtig geworden war. Man hatte zuvor alle Mittel angewandt, um sie ins Leben zurückzurufen, doch ohne Erfolg. Darauf begann die unter den Anwesenden sitzende dājung ihre Verse aufzusagen, um ihren Geist herbeizurufen, näherte sich tanzend der Kranken, kniff sie einige Mal in die Haut und wies dann ein augenscheinlich gekautes, gerolltes Stück Bananenblatt vor, als hätte sie es aus der Patientin herausgeholt. Die Ohnmächtige bewegte sich jedoch nicht, und die Familie begann sich bereits zu beunruhigen, obgleich derartige Fälle öfters bei ihnen vorkommen. Aus Besorgnis holten sie mich aus dem Schlafe, und zu aller Verwunderung brachte etwas an die Nase gehaltene Watte mit Ammoniak bald wieder Leben in die regungslose Gestalt. Später durfte ich nicht abreisen, bevor ich den vornehmsten Personen etwas Ammoniaklösung gegen den herannahenden Tod ausgeteilt hatte.
Die Priesterschaft lässt sich ihre Dienste so gut bezahlen, dass bei langdauernder Krankheit häufig ein grosser Teil des Besitzes der Patienten in ihre Hände übergeht. Allerdings werden auch den dājung durch ihr Amt viele Opfer auferlegt. Der sie beseelende Geist macht z.B. zweimal jährlich auf ein grosses Schwein oder mindestens auf Hühner und Eier Anspruch; wird er enttäuscht, so sendet er aus Rache Krankheit oder Tod.
Das gleiche gilt für alle unter dem Schutze eines Geistes stehenden Menschen, wie Schmiede, Hirschhornschnitzer und andere Künstler; [111] auch diese müssen sich vor einem Erzürnen ihres Geistes hüten. Bei meiner Abreise zur Küste liess einer meiner Kajan, der im Schnitzen von Schwertgriffen besonders geschickt war, dem Geiste, dem er seine Begabung zu verdanken hatte, durch seinen Vater, den alten blinden dājung Bo Jok, 2 × 8 Eier opfern.
Ein Schmied, der im betreffenden Jahr auf seinem Reisfelde keine Schmiede eröffnet und in der letzten Zeit überhaupt nur wenig gearbeitet hatte, träumte nachts, seine ganze Wohnung liege voll rohen Eisens, und bald darauf entstand auf seinem Rücken ein grösser Karbunkel, ein Beweis, dass sein Geist über die erlittene Vernachlässigung zürnte. So beeilte er sich denn, noch vor Eintritt der Genesung sein fettestes Schwein zu opfern, unter grossem Zulauf esslustiger Gäste auch von entlegenen Feldern.
Ausser den genannten Personen sollen auch die Häuptlinge einen besonderen Geist besitzen, der, wie auch der der Priester und Künstler, einen eigenen Namen trägt.
Im vorhergehenden ist ausführlich geschildert worden, wie die Priester vorgehen, wenn eine Häuptlingsfamilie von Krankheit getroffen wird. Gilt es nun eine Familie der panjin von Krankheit, bösen träumen oder Unglück zu befreien, so handeln die dājung im Prinzip wie bei den fürstlichen Personen, nur geschieht alles in kleinerem Massstab. Sie stellen dann unter dem offenen Dachfenster aus 8 Bambusstöcken ein kleines Gerüst wie einen lăsa̱ her und behängen dieses mit Kostbarkeiten. Als bestes Lockmittel für die Geister gelten auch hier wieder Halsketten und Gürtel aus Perlen, besonders aus alten. Ein Priester oder eine Priesterin setzten sich dann auf eine Matte und legen unter dem Fenster auf der Diele ein altes, häufig ein eigenes Schwert nieder sowie das Zeug, die Perlen, die Schwerter und den Reis mit einem Ei, die sie später als Lohn zu empfangen haben. An das Fenster wird für die Geister ein kleiner Bambusrahmen mit 8 kawit gehängt, die meist Reis mit Schweine- oder Hühnerfleisch enthalten. An dieser geweihten Stelle werden mittags und abends die Himmelsgeister um Hilfe angefleht. Abends geschieht diese Anrufung der Geister auch ausserhalb des Hauses, und, handelt es sich um einen Schmied, dessen Werkstatt (le̥po te̥mne̱) stets in einiger Entfernung vom Dorfe liegt, so begibt sich die dājung auch dorthin.
Die Priester suchen nicht nur die Menschen, sondern auch die Geister zu betrügen. In Krankheitsfällen z.B. schnitzen sie aus einem Pisang [112] stamm ein sehr rohes Bild, in das sie an Stelle von Augen, Nase und Mund Löcher bohren. Um diese Figur, die den Kranken vorstellen soll, schlagen sie einige alte Lappen und werfen sie dann in das Gestrüpp hinters Haus, um den bösen Geistern weiszumachen, sie empfingen ihre Beute.
Nach einer Krankenbeschwörung, die von den Mendalam Kajan mit me̥lā, den Mahakam Kajan mit e̥nah abei und im Mahakam-Busang mit e̥nah hadui (Arbeit) bezeichnet wird, umgeben die dājung den Patienten und sein Lager mit einem Netz, damit die bösen Geister sich in den Maschen wie Fische verwickeln und so ferngehalten werden.
Den Frauen legen die Priester nach einer Krankheit um eines der Handgelenke ein kleines Armband aus zwei Reihen von Perlen (inu be̥ne̱ng), das basei djani-u genannt wird und als Schutzmittel gegen Krankheit niemals abgelegt werden darf. Während die dājung mit dem Umlegen dieses Armbandes beschäftigt ist, entfernen sich die Männer, aus Furcht, dawi zu werden. Dawi bedeutet Misserfolg in den männlichen Tätigkeiten wie Jagd, Fischfang und Krieg (T. I p. 350) leiden. Auch sonst wagen die Männer nichts speziell Weibliches zu berühren.
Den verschiedenen Beschwörungen wohnte ich absichtlich nur selten bei, weil die Eingeborenen fürchteten, meine Anwesenheit könnte den Geistern unerwünscht sein und ihre Hilfe daher beeinträchtigen. Erst nach langdauerndem Aufenthalt am Blu-u war ich einige Male bei einer me̥lā zugegen und erlebte sogar, dass mich die Kajan darum baten, ihre Gebete an die Geister zu unterstützen. Es geschah dies bald nach der oben beschriebenen grossen Beschwörung, als wir uns alle nach trockener Witterung sehnten, um bei fallendem Wasser zur Küste reisen zu können. Kwing Irang hatte schon einige Beschwörungen vornehmen lassen, aber vergebens. Ich zweifelte bereits an der Möglichkeit einer Abreise im Laufe des Monats, als in der Luft endlich eine Veränderung bemerkbar wurde. Wahrscheinlich hatten auch die Kajan sie beobachtet, denn während wir abends mit Kwing und 6 jungen Männern auf der Holzplattform am Ufer standen und schwatzten, erschien der alte, beinahe blinde Bo Jok mit zwei Stöcken, an deren Enden stark gekrümmte Stücke von Baumwurzeln mit einer Schnur gebunden waren. Er hatte die Wurzeln durch tiefe Einschnitte getötet und bereitete sich nun vor, mit ihrer Hilfe die Geister dazu zu bewegen, den Regen aufhören zu lassen. Seinen eigenen [113] Einfluss allein schien er jedoch nicht stark genug zu finden, denn er übergab mir einen der Stöcke, um ihn neben unserer Hütte in die Erde zu pflanzen. Er selbst begab sich mit dem seinen zum Fluss hinunter, bohrte ihn in die Erde und steckte in das gespaltene Wurzelende ein Ei. Dann musste jeder von uns bei seinem Stock die Wind- und Regengeister beschwören und zwar in den folgenden Worten, die mir der Alte vorsagte: “Wenn ihr imstande seid, es so regnen zu lassen, dass diese Wurzel zu einem Baum heranwächst, so lasst es nur regnen; wenn aber nicht, so haltet ein mit dem Regen und lasst es trocken werden, damit wir ohne Gefahr hinunterreisen können.” Ich fürchtete, meinen Ernst nicht bewahren zu können, aber Kwing kam mir mit dem Rat zu Hilfe, meine Beschwörung in holländischer Sprache zu halten, um zu verhindern, dass ich im Busang meiner Würde vor den Zuschauern zu viel schadete. Die Kajan genossen also nur die packende Rede, die Bo Jok an die Geister richtete.
In einer stillen Nachmittagsstunde erzählte mir derselbe greise Priester, wie sich die Kajan die Menschen, Götter und Geister auf Erden entstanden dachten. Bo Jok kannte mein Interesse für alles, was das Geistesleben der Kajan betraf; indem er mir nun ihre Schöpfungsgeschichte anvertraute, wollte er mir augenscheinlich die Teilnahme vergelten, mit der ich seine Klagen über das Verschwinden der guten alten Zeit am oberen Mahakam angehört hatte. Die Erzählung lautete folgendermassen:
Zwei alte Leute im Himmel Apu Lagan waren einst damit beschäftigt, sich mit einer kleinen Kupferzange, tso̤̱p, die Augenbrauen auszuziehen. Sowohl die Frau Bua Langnji als der Mann Dalè Lili Langnji wurden aber bei ihrem hohen Alter von der Arbeit so müde, dass sie in Schlaf sanken, wobei ihnen die Zange entglitt und zur Erde niederfiel. Sie lag dort auf einem nackten Felsen am Ufer des Mahakam, als ein Riesenwurm (dukung) aus dem Wasser zum Vorschein kam, an dem ungewöhnlichen Gegenstand sog und dabei seine Exkremente absetzte. Dies sah eine Krabbe (kujo), die sich in der Nähe unter einem Stein verborgen hielt, und, sobald der dukung fortging, scharrte sie mit ihren Beinen den Kot auseinander, wodurch der Fels mit Erde bedeckt wurde. In dieser Erde trieb die tso̤̱p Wurzeln, so dass die Schwester von Bua Langnji, als sie unten nach der Zange suchte, bereits ein Bäumchen mit einigen kupfernen [114] Blättern fand. Schnell wuchs das Bäumchen in die Höhe; durch eine Öffnung, die sich dabei im Stamm bildete und die der Himmelsgeist Uwang bemerkte, wurde es von diesem befruchtet. Als Folge hiervon entwickelten sich unten am Bäumchen zwei Sprossen, ein männlicher, Amei Klowon, und ein weiblicher Inei Klion. Es waren menschliche Wesen, aber ohne Arme und Beine, denn einer der Bewohner des Landes, in welches die Zange gefallen war, hatte den Baum verwundet, indem er mit seinem Schwert unten am Stamm einen Blutegel tötete, den er von seinem Bein gestreift hatte. Auf diese Weise waren die ersterschaffenen Menschen verstümmelt worden. Sie waren immerhin noch sexueller Gemeinschaft fähig, und so gab Inei Klion 3 Kindern das Leben: Kiït La Bĕlálang Ka, Kiït Lui Bĕlálang Ubui und Kiït Lang Bĕlálang Uwang. Von diesen Dreien stammen die Bahau ab. Der kupferne Baum, Poön Kawat, wuchs jedoch weiter und lieferte noch viele Sprossen, aus denen von unten nach oben zuerst die bösen, dann die guten Geister hervorgingen, danach die Hauptgeister wie Djājā Hipui u.s.w., schliesslich, am Gipfel, Amei Tingei, der das Dasein der Bahau beherrscht.
Unter den zahlreichen Geistern, die auf das Geschick der Mahakambewohner Einfluss ausüben, gibt es einige, die im ganzen Gebiete eine aussergewöhnlich grosse Macht entfalten und über sämtliche allgemeine Interessen der Bevölkerung zu bestimmen haben. Wie sonst bei der Erforschung ihrer Religion hatte mich auch hier nur ein besonders günstiger Umstand die Existenz dieser Schutzgeister, sĕniang genannt, entdecken lassen. Das erste Mal erfuhr ich von ihnen im Jahre 1897 durch das Opfer; das die Long-Glat von Long Tĕpai für die sĕniang unterhalb der Wasserfälle den Fluss abwärts treiben liessen (T. I p. 367). Später, hauptsächlich auf meiner Fahrt zur Küste, hatte ich versucht, Näheres über diese Geister zu erfahren, doch hörte ich nur, dass einer dieser sĕniang in alten Monumenten hauste, die an der Ratamündung liegen mussten. Als wir jedoch in dem betreffenden Jahr über die Wasserfälle zogen und uns dem heiligen Orte näherten, war aus meinen Kajan nichts herauszubekommen; nur verriet mir ein junger unvorsichtiger Ruderer, dass bei Long Bagung noch eine zweite, ähnliche Gruppe vorhanden sei, man sich aber gehütet habe, von ihr zu sprechen, bevor wir sie längst passiert hatten, aus Furcht, dass ich sie sonst hätte besuchen wollen. So drohten denn, damals meine Nachforschungen nach der wahren Beschaffenheit dieser Monumente [115] und ihrem Fundort durch die Angst meiner Kajan zu missglücken, und meine Enttäuschung war nicht gering, als auch die Hwang-Boh, die Bewohner eines in der Nähe des Rata gelegenen Hauses, jede Auskunft über die Monumente verweigerten. Mit grossem Misstrauen nahm ich denn auch Kwings Vorschlag auf, erst bis Long Howong hinunterzufahren, dort zu übernachten und am folgenden Tage die Bilder mit Hilfe der dortigen Bewohner aufzusuchen. An der Ratamündung lebte jedoch niemand mehr, der mir Auskunft geben konnte über die wissenschaftlichen Schätze, die der Wald hier barg, und so blieb mir nichts anderes übrig, als nach Long Howong weiter zu fahren und dort Umschau zu halten.
Die Sonne stand noch hoch am Himmel, als wir das Dorf erreichten. Auf Baumtreppen stiegen wir den Uferwall hinauf, um durch eine hölzerne, zu beiden Seiten mit grotesken Menschenfiguren verzierte Pforte hindurch über sehr hohe Bretterstege zum Hause zu gelangen. Auf einer Plattform am Ufer erwarteten wir plaudernd die Dorfautoritäten. Diese waren nämlich den Rata hinaufgefahren, um mit dem dortigen Häuptling Ding Bajow über einen Diebstahl zu verhandeln, der dort stattgefunden hatte. Ein Bakumpai war von einem Buginesen als der Täter angeklagt worden, und da Ding Bajow der Beschuldigung Glauben schenkte, drohte ein Zwist zwischen beiden Parteien der Buschproduktensucher auszubrechen.
Die Häuptlinge, die gegen Abend zurückkehrten, schienen ganz vom Schlage der Bahau zu sein, denn sie drängten sich, obgleich ich mit vielen Kajan, die sie seit langer Zeit nicht gesehen hatten, auf der Plattform stand, an uns zum Hause hindurch, ohne uns zu beachten. Allerdings kamen später die angesehensten zu unserer Begrüssung wieder herunter. Sie schützten aber ebenfalls hinsichtlich der Bilder am Rata gänzliche Unwissenheit vor, doch merkte ich, dass mein Besuch eben durchaus unwillkommen war. Ich hatte übrigens an diesem Tage übergenug von der Angelegenheit und kehrte nach meinem Boot zurück, wo ich nach einer kärglichen Mahlzeit im Schlaf meinen Kampf mit Misstrauen und Aberglauben zu vergessen und eine neue Dosis Geduld zu gewinnen suchte. Letztere hatte ich in der Tat sehr nötig, denn auch am anderen Morgen wollten mich weder meine eigenen Bahau noch die von Long Howong zu den Monumenten hinaufführen. Da kamen mir unerwartet die Bakumpai zu Hilfe, die sich wegen der Diebstahlaffaire in Schwierigkeiten befanden. Ihr Anführer ersuchte [116] mich, Ding Bajow und den Häuptlingen von Long Howong mitzuteilen, dass der Buginese sie fälschlich des Diebstahls beschuldigte. Mittags sollten die Häuptlinge vom Rata eintreffen und, falls ich einen Tag bleiben wollte, könnte ich durch meinen Einnuss als Europäer und Freund Kwing Irangs einen drohenden Konflikt aus dem Wege räumen. In meiner schlechten Stimmung fühlte ich mich jedoch zu einer Einmischung in fremde Angelegenheiten nicht aufgelegt, noch minder zum Verlust eines ganzen Tages. Der Bakumpai, der merkte, wie viel mir an der Besichtigung der sĕniang lag, schlug mir nun vor, mich mit einigen seiner Leute, die den Platz kannten, hinbringen zu wollen, falls ich ihm als Gegendienst aus der schwierigen Lage hülfe. So ging ich denn auf seinen Vorschlag ein und machte mich gleich vormittags in zwei Böten zu den so schwierig zu erreichenden Bildern auf. Die Bakumpai brachten mich ein Stück weit, bis etwa 400 m unterhalb der Ratamündung den Fluss wieder hinauf, wo wir das rechte Ufer bestiegen und uns ungefähr 30 m landeinwärts vor den ersehnten Steinfiguren befanden. Ihrer Form nach stammten sie von den Hindu her. Am eigentümlichsten erschien mir eine Stierfigur, die auch von den Bahau als der wichtigste Teil der Gruppe angesehen wurde. Wie diese mir nämlich erzählten, wollte, der Überlieferung nach, Hang Lawing, dessen Grab wir am Batu Tĕwang sahen, einst, als er mit über 100 Mann an dieser Stätte vorüber in den Krieg zog, diesen Stier mitnehmen. Keiner der Krieger war jedoch stark genug, um die Figur aufzuheben, obgleich diese nicht höher ist als ein mittelgrosser Hund; hierüber geriet ein Bahau in solche Wut, dass er dem Stier mit dem Schwerte die Ohren abschlug. Als Strafe für dieses Vergehen starb der Übeltäter innerhalb 10 Tage; sein Tod war allen Bewohnern des Mahakamgebietes ein neuer, deutlicher Beweis für die Macht des sĕniang.

Überreste eines Hindugrabes.
Ausser diesen Hinduüberresten am Rata, weist der Mahakam noch viele anderen auf; die nördlichsten befinden sich, wie schon gesagt, bei Long Bagung, andere etwas oberhalb Ana und noch an einigen Orten weiter unten. Der letzte, am rechten Ufer unterhalb Tengaron, ragt in Form einer leicht abgerundeten Spitze aus einem horizontal liegenden Felsblock hervor; oberflächlich gesehen lässt die Figur jedoch keine Spuren einer Bildhauerarbeit erkennen.
Alle diese Monumente bezeichnen die Bahau, wie gesagt, als “sĕniang”, die den grossen Geistern, welche das Los der Flussbewohner [117] beherrschen, zum Wohnplatz dienen. Der sĕniang bei Tengaron regiert über alle anderen, daher opfern die Bahau hauptsächlich diesem, wenn einige Gebiete am Mahakam von Krankheit oder Missernte getroffen werden. So sandten die Bewohner von Long Tĕpai einst diesem sĕniang ein Floss mit einem Schwein und einem schuldigen Liebespaar zu, dem man die Ankunft einer grossen Schar von Vögeln zuschrieb, welche den Reis auf dem Felde auffrass. Sobald ein Glied der Häuptlingsfamilie erkrankt, opfern die Priester vom Dorfe aus dem sĕniang Schweinefleisch und Hühner und lassen die Opfer den Fluss hinab treiben.
Da sich nur die dājung diesen Bildern nähern, wissen viele der gewöhnlichen Leute tatsächlich nicht, wo diese sich befinden, so auch meine Kajan; das Haupthindernis für einen Besuch der Bilder liegt jedoch in der Furcht der Dajak, durch eine Erzürnung der sĕniang deren Rache auf ihre Häuptlinge zu ziehen.
Als ich auf meiner zweiten Reise nochmals die sĕniang am Long Rata besuchte, gelang es Demmeni, die nebenstehende Aufnahme von ihnen zu machen; die erste war infolge anhaltenden Regens missraten.
Wie viele anderen Gebräuche tragen auch die Begräbniszeremonien am Mahakam einen ursprünglicheren Charakter als am Kapuas.
Stirbt ein Häuptling eines Bahaustammes am oberen Mahakam, so brechen alle Anwesenden in lautes Wehklagen aus; Gonge und grosse Trommeln werden geschlagen, um die bösen Geister zu vertreiben, den Todesfall auch in weit abgelegenen Dörfern bekannt zu machen und den Seelen der Verstorbenen in Apu Kĕsio das Ereignis mitzuteilen. Zu ersterem Zwecke schlagen die alten Krieger wohl auch mit ihren Schwertern in der Häuptlingswohnung in die Luft, wobei es oft wild hergeht und, die Hiebe Pfosten und Wände treffen und sogar kostbare Tempajan und Gonge bisweilen zertrümmern.
Beim Tode von Freien, banjin, findet ebenfalls ein Wehklagen statt und werden die Seelen der Vorfahren benachrichtigt. Die Pnihing schlagen dabei mit einem Reisstampfer laut auf die Bretterdiele, wodurch sie übrigens jede neue Handlung, die sie mit der Leiche vornehmen, den Geistern ankündigen. Für Häuptlinge stampfen 2 × 8 Personen, für vornehme Freie 7 und für niedrige Leute nur 1 Person. Man glaubt, dass die Seele auf dem Wege nach Tĕlang Djulan in Apu Kĕsio auf das Wetter Einfluss ausüben, starke Regen und Trockenheit [118] verursachen könne. Die langen Schatten, die Berggipfel und Wolken bei Sonnenuntergang bisweilen auf den Himmel werfen, werden als Begleiter der Seelen betrachtet. Man nennt sie awon alut, Bootsschatten, und unterscheidet die der Sonne zugekehrte Seite als dulong, Vordersteven, die andere als ore̱, Hintersteven.
In vollem Umfang dürfen die Begräbniszeremonien nur, wenn die Familie keiner Verbotszeit unterworfen ist, ausgeführt werden. So befand man sich beim Tode des ’Ma-Sulinghäuptlings Bo Li in einer Zwischenperiode, weil das Maus des Verstorbenen noch nicht ganz vollendet und das lāli noch nicht vollkommen vorüber war; es durften wohl die Gonge ertönen, aber das Schwerterschlagen musste unterbleiben. Aus demselben Grunde baute man auch kein neues Prunkgrab, sondern setzte die Leiche bereits nach 4 Tagen in demjenigen eines anderen Häuptlings bei.
Am Tage nach dem Ableben wird die Leiche mit gewöhnlichem Wasser gewaschen; die von Häuptlingen wird bei den ’Ma-Suling zum Flusse gebracht und untergetaucht, die von Freien in der amin Gewaschen. Darauf werden dem Verstorbenen schöne Kleider angetan, die entweder vorher schon bereit lagen oder in den ersten Tagen mit der ganzen Totenausrüstung eilig hergestellt werden. Bevor die Leiche eingesargt wird, wickelt man sie noch in ein weisses Tuch.
Den Sarg, der bei den Kajan aus einem Stück besteht, verfertigt man aus dem Stamm eines grossen Baumes mit weichem Holz; ein Durianstamm wird meist für vornehme Leute, ein Tengkawangstamm für einfachere gewählt.
Die zwischen Tod und Beisetzung verlaufende Anzahl von Tagen ist sehr verschieden, sowohl bei den einzelnen Stämmen als bei den Ständen. Je höher jemand steht, desto länger wird seine Leiche im Hause aufgebahrt, was zum Teil in der umfangreicheren Ausrüstung der vornehmen Toten seine Erklärung findet. Kinder und Personen einfachen Standes werden bei den Kajan bereits 1–2 Tage nach dem Tode begraben, Häuptlinge nach ebensoviel Mal 8 Tagen. Ähnliche Unterschiede gelten auch inbezug auf die Trauer.
Stirbt jemand während der Ernte, so setzt man die Leiche in einer provisorischen Hütte neben dem grossen Hause ab, aus Furcht, dass die bruwa parei (Reisseele) bei einer definitiven Bestattung mit in die Felshöhle (liang) ziehen könnte, was eine gänzliche Missernte im folgenden Jahre verursachen würde. [119]
Die Kajan und auch die anderen Stämme begraben ihre Toten nicht in der Erde, sondern setzen die Särge an bestimmten Orten nieder, am liebsten unter einer grossen überhängenden Felsmauer oder in einer Felsenhöhle, wie es deren im Kalkgebirge am oberen Mahakam so viele giebt. Eine derartige Begräbnisstätte, die ich bei den Pnihing am Tjehan besuchte, ist auf Tafel 73 und 74 Teil I abgebildet. Die Särge, auf denen man die Deckel mit Rotang lose anbindet, werden nicht verziert, wohl aber die Behälter von sehr ähnlicher Form, in welchen den Verschiedenen ihre Ausrüstung mitgegeben wird. Die Verzierungen dieser Kisten bestehen hier aus schwarzen Figuren.
Für Angehörige der Häuptlingsfamilie und vornehme Tote werden Prunkgräber (sālo̱ng, bila) errichtet; im allgemeinen sind dies auf Pfählen ruhende Holzhäuschen mit weit vortretendem Dach und schöner Verzierung von Schnitzwerk und farbigen Figuren (Taf. 66 T. I).
Sowohl Männer als Frauen begleiten den Sarg zur Grabstätte, letztere unter lautem Wehklagen. Auf dem Wege zum Begräbnisplatz wehrt ein neben der Leiche hergehendes Familienglied mit gezogenem Schwerte die bösen Geister ab. Bei den Kajan werden die früher Verstorbenen von den Hinterbliebenen angerufen. So hörte ich einst eine Frau beim Wegtragen einer Leiche “Ino̤̱ alo̤̱ ko̤̱ (Mutter, hole mich)!” rufen.
Aus Furcht vor den ton luwa, die sich häufig auf Grabstätten aufhalten und der bruwa der Lebenden sehr gefährlich werden können, verlässt man diese nach der Bestattung so schnell als möglich.
Die Kajan schnitzen für ihre verstorbenen Häuptlinge hölzerne Hundefiguren (aso̱ od. le̥djọ), welche die bösen Geister von der lila fernhaften müssen. Die Figur wird mit Rotang unter dem Grabmal festgebunden, damit sie nicht davonläuft, auch steckt man ihr bisweilen einen Schädel ins Maul, damit sie nicht hin- und herläuft, sondern aufpasst.
Alle Teilnehmer an einem Begräbnis müssen sich abends durch ein Bad reinigen und ein Huhn opfern, um zu me̥lă und be̥t djă-ăk, das “Schlechte abzuwerfen.” Zwei Tage nach dem Leichenbegängnis dürfen sie nicht arbeiten, sondern müssen me̥lo̱ (ruhen).
Bei allen Bahaustämmen am oberen Mahakam ist dieses Begräbnis ursprünglich nur ein zeitweiliges gewesen. Später wurden die Gebeine, sobald die weichen Teile gänzlich oder grösstenteils verwest waren, gereinigt, in einen grossen irdenen Topf gelegt und dann in diesem in einer Grotte beigesetzt. Den Schädel verzierte man mit einer Maske, die vorn mit Blattzinn oder einem anderen Metall [120] beschlagen wurde, weil man den Anblick von Augen und Nase in einem Schädel unangenehm fand. Am oberen Mahakam ist diese Sitte noch am meisten bei den Kajan im Schwange, bei den übrigen Stämmen minder und die Long-Glat, die ihr früher sicher auch folgten, begnügen sich gegenwärtig mit blosser Beisetzung ihrer Toten. Kwing Irang war gegen diesen Brauch, weil er ihn unangenehm und gefährlich fand und suchte ihn daher aufzuheben. Nach diesem definitiven Begräbnis richtet die Familie des Verstorbenen ein Festmahl an, zu dem jedermann willkommen ist.
Die eigentliche Trauerzeit beginnt erst nach dem Begräbnis. Nach dem Tode eines Häuptlings dürfen seine Untergebenen während der Zeit der tiefen Trauer keine Feldarbeit verrichten, nicht eine oder mehrere Nächte ausserhalb des Hauses verbringen, keine Näharbeit vornehmen. Die Kleider dürfen keinerlei Schmuck tragen; die Frauen schneiden die untere Hälfte ihres Rockes ab, die jungen Männer und Frauen ihre langen Haare bis zum Halse. Der trauernde Stamm darf während 1–2 Monaten nicht mit anderen in Berührung kommen, Fremde dürfen die Niederlassung nicht verlassen, der Fluss, an dem das Dorf liegt, wird für jeden abgesperrt.
Die adat der Long-Glat ist in dieser Beziehung, wie in mancher anderen, noch strenger. Die Leiche eines Häuptlings bleibt mindestens 2 × 8 Tage unbestattet; in der Trauerzeit dürfen die Angehörigen der Häuptlingsfamilie nicht mit den panjin sprechen. Den Ertrunkenen richten die Long-Glat ebenfalls einen sālo̱ng auf, auch wenn sie die Leichen nicht finden. Die Vorüberfahrenden legen dann an dem Grabmal kleine Gaben, z.B. Kautabak, nieder.
Die Ma-Tuwan und andere Stämme, die mit den Long-Glat in derselben Niederlassung wohnen, folgen nicht deren Gebräuchen, sondern behielten mit ihrer Sprache auch ihre eigene adat.
Einem vornehmen Häuptling trauern ausser den eigenen Untertanen alle Stämme nach, deren Häuptlinge mit dem Verstorbenen verwandt sind. So trauerten mit den Ma-Suling beim Tode von Bo Li auch die Kajan und Long-Glat. Bei diesen beschränkte sich die Trauer jedoch auf das Ablegen von buntfarbigen Kleidern und Schmucksachen, wie Ohrgehänge, Halsketten, Perlen, hübsche Kopfbinden und Mützen; ferner durften keine Feste, wie Maskenvorstellungen, stattfinden, auch war das Tätowieren verboten. Von diesen Adatbestimmungen sind kleine Kinder wie gewöhnlich ausgeschlossen. Der fremde Stamm trauert so lange als der eigene die volle Trauer nicht ablegt. [121]
Die Trauerkleidung der Hinterbliebenen besteht wie am Kapuri eigentlich aus Baumbast, doch wird sie auch am Mahakam infolge der Einfuhr von weissem Kattun durch diesen ersetzt, nur gibt man ihm, wie anderen Ortes schon angeführt, durch Vergraben im Morast den hellbraunen Ton des Baumbastes.
Beim Ablegen der Trauerkleidung darf diese nicht eigenhändig entfernt werden, sondern man sucht ein dichtes Gestrüpp auf, das einem die Mütze vom Kopf und die Jacke von den Schultern streift.
Die Bevölkerung am oberen Mahakam lebt infolge der isolierten Lage ihres Landes, die eine Zufuhr von Gebrauchsartikeln von auswärts sehr erschwert, unter viel ungünstigeren Bedingungen als ihre Verwandten am Kapuri, die wegen der Nähe der Handelsniederlassung Putus Sibau und der Dampferverbindung mit dieser und der Küste sich alles auf billige Weise verschaffen können. Haben die Kapuasbewohner durch den unvermeidlichen innigeren Kontakt mit den Malaien und Chinesen auch viel von ihren ursprünglichen Sitten eingebüsst, so leben sie doch durch denselben unter viel günstigeren materiellen Bedingungen. Bei ihnen lässt sich begreiflicher Weise der frühere Kulturzustand dieser Stämme viel schwerer nachweisen als bei ihren Verwandten am oberen Mahakam, die in der Beschaffung ihrer Lebensartikel beinahe gänzlich auf sich selbst angewiesen sind. Am meisten gilt dies in bezug auf ihre Nahrungsmittel, die wegen ihres Umfangs und ihrer Schwere nicht aus entlegenen Gebieten angeführt werden können. Die meisten Stämme haben es dem grossen Fleiss, mit dem sie sich dem Ackerbau widmen, zu danken, dass sie von einer schweren Hungersnot nur selten zu leiden haben; hochgradiger Nahrungsmangel kommt dagegen in allen Dörfern in der Zeit vor der neuen Ernte vor, wenn die alte teilweise oder gänzlich missglückt war. Bei den Sĕputan, die noch mehr als die Pnihing ihren Ackerbau vernachlässigen, ist allerdings eine Hungersnot, die viele Opfer fordert, keine Seltenheit. Oft sind diese schlechten Ackerbauer denn auch völlig auf die Walderzeugnisse angewiesen, die übrigens auch in normalen Zeiten neben dem Landbau zu ihrer Ernährung beitragen.
Die Feldbewirtschaftung am Mahakam stimmt völlig mit derjenigen am Kapuas überein, die bereits im vorigen Teil ausführlich behandelt worden ist. Was die mit dem Reisbau verbundenen Festlichkeiten betrifft, so ist das Saatfest (tugal) ebenfalls bereits besprochen worden; [122] eine kurze Beschreibung des Erntefestes dagegen mag hier folgen.
Das Fest zerfällt in zwei Teile: das lāli parei ok = die kleine Verbotszeit für den Reis, und das einige Tage später folgende lāli parei aja = die grosse Verbotszeit für den Reis. Vor den genannten Festzeiten ist es streng verboten, Reis zu schneiden; sollten einige Dorfbewohner bei Hungersnot hierzu gezwungen gewesen sein, so dürfen sie den Festen im Häuptlingshause nicht beiwohnen. Daher wird auch das lāli parei ok gefeiert, sobald nur einige halbreife Halme auf dem Felde des Häuptlings gefunden worden sind. Die ungünstigen Mondphasen werden hierbei aber vermieden.
Vor dem Fest kommen viele Böte mit Männern, Frauen und Kindern von den Feldern heim, besonders erstere erscheinen früh, um eine grosse Menge Brennholz zu beschaffen, das für die grossen Mahlzeiten nötig ist. Die Sklaven der amin aja tun dies stets einen Tag früher als die Freien, welche ihr Holz erst sammeln, wenn die Häuptlingsfamilie feierlich aufs Feld gezogen ist, um den ersten Reis von ihrer ladang oder luma zu holen. Wenn Wetter und Wasserstand es zulassen, begeben sich gegen Mittag die beiden Frauen von Kwing Irang, Hiāng und Uniang, in hübscher Kleidung und mit grossen Sonnenhüten aufs Feld. Wie bei jeder religiösen Zeremonie geht auch hier ein junger Mann voran, der ein Becken schlägt. Kwings Frauen und noch einige andere, wie seine Pflegetochter Kĕhad Hiāng, tragen alle ingan lāli, Reiskörbe mit hohen Deckeln, an welche für diese Gelegenheit einige kawit, Reisähren und krautartige Pflanzen gebunden werden, um den ersten Reisschnitt in ihnen zu bergen. Bei der Verzierung dieser Körbe dürfen die Häuptlingsfrauen die heilige Zahl 8 anwenden, sie bringen z.B. 2 × 8 Knoten aus Reisstroh an; die panjin müssen sich mit einer kleineren Zahl begnügen z.B. mit 6 und befestigen also 2 × 6 Knoten am Korbe. Wenn die Gesellschaft nach einigen Stunden mit gefüllten Körben zurückkehrt, werden in der Häuptlingswohnung einige Zeremonien ausgeführt, die ich nicht näher kenne. Später am Tage wird der Reis von den dājung gestampft, die sich ebenfalls in ihre schönsten Kleider geworfen haben; überdies leiht ihnen der Häuptling für diesen Tag breite Perlengürtel.
Der erste halbreife und daher noch nicht trockene Reis muss erst gedörrt werden, um ihn durch Stampfen entspelzen zu können. Die beinahe platt gestossenen Körner werden von den Kajan ohne weitere Zubereitung gern gegessen. Am folgenden Tage begeben sich [123] auf die gleiche Weise die Frauen der panjin aufs Feld. Nach dem ersten Tag folgen 2 Tage me̥lo̱, am vierten muss man be̥t lāli (die Verbotszeit ablegen), was wiederum auf der ladang geschieht. An diesem Tage müssen noch alle ruhen, dann kann in den folgenden 4 Tagen das lāli parei aja gefeiert werden. Wenn aber in dieser Zeit jemand stirbt und die Leiche noch über der Erde ist, oder man in eine ungünstige Mondphase kommt (ga bulan djă-ăk), so muss die Feier verschoben werden, bis die Zeichen günstiger geworden sind.
Nach Ablauf des lāli parei aja, das auf die gleiche Weise gefeiert wird, darf jedermann mit der Ernte beginnen.
Während bei den Bahau am Kapuri am Schluss der Ernte alljährlich das so wichtige dangei gefeiert wird, können ihre Verwandten am Mahakam sich diesen Genuss nicht gestatten, da sie nur selten den hierfür erforderlichen Überfluss an Lebensmitteln besitzen. Am Mahakam wohnte ich diesem Feste nicht bei. Für die dortige Bevölkerung ist dieses ebenso wichtig wie für die am Mendalam, weil die kleinen Kinder bei dieser Gelegenheit einen Namen erhalten und das be̥t lāli für die Heirat aufgehoben wird. Bei den meisten Stämmen wird das dangei etwa alle 3 oder 4 Jahre gefeiert.
Ausser zahlreichen Reisvarietäten kultiviert die Bevölkerung am Mahakam auch Knollengewächse, Mais u.a. Bei den Sĕputan und Pnihing, die, wie gesagt, nicht regelmässig auf gute Reisernten rechnen können, werden Knollengewächse, wie Ipomoea batatas, Manihot utilissima und Caladium weit mehr angepflanzt, als bei den tiefer wohnenden Stämmen und mit Reis gemengt das ganze Jahr über gegessen. Auf die Zubereitung der Knollen wird denn auch bei ihnen mehr Gewicht gelegt als an anderen Orten, wo sie einfach gekocht gegessen werden. Bei unseren eigenen Mahlzeiten fanden wir das aus obi kaju (Manihot) hergestellte Mehl am schmackhaftesten. Es wird erhalten, indem man die Knollen in feine Scheiben schneidet, diese in der Sonne stark trocknet und dann auf dem Reisblock feinstampft. Das so entstandene feine weisse Mehl liefert mit Zucker und Öl gebacken, wie wir es taten, wohlschmeckende Kuchen. Die Zubereitung dieses Mehls sowie das Stampfen des Reises macht die tägliche Hauptarbeit der Frauen aus.
Ein beliebtes Gericht, besonders auf Reisen, bilden die noch weichen Sprossen verschiedener im Walde wachsender Monocotyledonen, welche in Wasser gekocht werden. An erster Stelle gehört hierher der sog. Palmkohl von Eugeisonia tristis, der Hauptlieferantin für Sago [124] (nanga oder bulung) am oberen Mahakam. Da dieser Palme bei Nahrungsmangel so stark nachgestellt wird, ist sie in der Nähe der Niederlassungen bereits völlig ausgerottet und es müssen jetzt bei Hungersnot weite Expeditionen auf hohe Berggipfel unternommen werden, um noch Standorte von Eugeisonia zu finden. Arme Familien oder solche, die keine schweren Lasten zu tragen vermögen, ziehen dann lieber zeitweilig mit Kind und Kegel ins Gebirge und nähren sich dort ganz von Sago. Die Gebiete, in denen die Sagopalmen wachsen, sind Eigentum eines bestimmten Stammes, dessen Glieder, sowohl Sklaven als Freie, sie nach Belieben ausbeuten dürfen. Die Sagogewinnung geschieht folgendermassen: man sucht eine Palme aus, die im Aufblühen begriffen ist, weil sie dann im Mark ihres Stammes am meisten Sago angehäuft hat, entfernt ihre zahlreichen, geraden, dünnen, 1 m und höher hinaufreichenden Wurzeln und zerlegt den Stamm zum Transport nach einem kleinen Fluss in Stücke. Dort spaltet man diese der Länge nach, klopft die sagoenthaltenden Gewebe mit schweren Holzhämmern mürbe und legt sie dann in lange Tröge, weiche aus ausgehöhlten Stämmen und grossen Blattstielen von Palmen hergestellt werden. Die Tröge werden samt Inhalt in einen Bach gesetzt und die mürben Massen mit den Füssen gestampft, bis der Sago vom strömenden Wasser mitgerissen und etwas weiter unten am Grunde abgesetzt wird. Ist der Sago etwas feucht, so haben am Ertrag eines einzigen Stammes beinahe zwei Mann genügend zu tragen (30–35 kg.).
Der auf diese Weise von Eugeisonia gewonnene Sago hat eine hellbraune Farbe und trocknet schwer, weswegen er sich auch nur etwa 8 Tage aufbewahren lässt. Der Gedanke, nicht nur einmal, sondern mehrmals aus dem gleichen Stamm Sago gewinnen zu können, scheint den Kajan früher nicht fremd gewesen zu sein. Wenigstens weist eine alte Erzählung hierauf hin. Nach dieser enthielt der Sagobaum früher Reis statt Sago und ein Mann, dem es leid tat, gleich den ganzen Stamm zu fällen, hackte nur ein Loch hinein, holte den Reis heraus und verstopfte die Öffnung mit einem Stück seines Lendentuches aus Baumbast. Als er aber später noch einmal Reis aus dem Baum holen wollte, fand er das Stück Baumbast durch das ganze Innere des Stammes gewachsen und den Reis in feinen Sago verwandelt. Seit der Zeit müssen die Kajan sich die Mühe nehmen, den Sago vom Holzgewebe zu scheiden.
Im Gebiete der Pnihing kommt noch eine andere Sagopalme vor, [125] die sie bulung te̥lāng nennen und die weissen Sago liefert (Caryota purfuracea Blume).
Sehr gebräuchlich sind bei den Mahlzeiten am Mahakam die essbaren Blätter verschiedener Pflanzen. Von den angebauten ist Batatas edulis die wichtigste, von den wild wachsenden der Farren Polypodium nigrescens. Die Blätter einer sike̱ genannten Lianenart werden ihres salzigen Geschmackes wegen an Stelle von Salz gebraucht.
Alle diese Blätter werden mit viel Wasser gekocht und mit diesem in garem Zustand zum Reis gegessen. Häufig hat jede Person bei der Mahlzeit. einen Holzteller mit dieser Blättersuppe neben sich stehen und trinkt sie mit einem einfachen europäischen Porzellanlöffel oder mit einem schüsselförmig gefalteten Pisangblatt, das, um das Einreissen zu verhindern, kurze Zeit über dem Feuer gedörrt wird und bisweilen auch als Teller und Hülle für den Reis dient. Bei den verschiedenen Stämmen sind zahlreiche kleine Unterschiede in den Gewohnheiten zu bemerken. Während die Ma-Suling und Long-Glat z.B. Kürbisarten pflanzen, um deren Früchte später als Wasserbehälter zu gebrauchen, verwenden die Kajan wiederum niemals Kalebassen, sondern nur Bambusstücke zum Wassertragen.
Am Mahakam gebrauchen nur die Reichen regelmässig Salz bei den Mahlzeiten, die übrigen erlauben sich diesen Luxus nur zeitweilig. Wie am Kapuri wird auch hier das Salz niemals mit den Speisen zusammen gekocht, sondern in kleinen Stücken als Zuspeise gereicht. Die Pnihing gestatten sich nicht einmal bei Festmahlzeiten stets den Salzgenuss.
Nach einer reichen Ernte von Tengkawangfrüchten wird das aus ihnen gewonnene Fett bei den Mahlzeiten viel verwendet; doch sollen nach Aussage der Eingeborenen die betreffenden Bäume nur alle Jahre einmal grosse Mengen von Früchten produzieren.
Im Hungerjahr 1896, während meines ersten Besuches am Mahakam, war gerade ein grosser Vorrat an Tengkawangfett vorhanden, den wir zum Braten gebrauchten, wodurch wir unsere sehr frugalen Mahlzeiten etwas verbesserten. Das Fett wird gewonnen, indem man die Früchte von verschiedenen Dipterocarpeenbäumen fein stampft und mit Wasser auskocht; es sammelt sich dann aus den Samen eine grosse Fettmenge an der Oberfläche an. In Bambusgefässe gegossen erhärtet das Fett zu einer festen, hell gelbgrünen Masse, die jahrelang gut bleibt und von der Bevölkerung in kleinen Stücken zum Reis [126] gegessen wird. Den Prozess des Bratens, den die Bahau nicht kennen, wies ich ihnen, nachdem ich das erste Fett erstanden hatte, in meiner eigenen Küche vor. Abgesehen von einem eigentümlichen, süsslichen Geruch, an den wir uns bald gewöhnten, war das Tengkawangfett zum Braten ebensogut geeignet wie Kokosnussöl.

Quer durch den Bach gelegter Deich.
Fleischnahrung tritt bei den Stämmen am Mahakam sehr zurück gegenüber denen am Kapuas, hauptsächlich wohl deshalb, weil die Flüsse bewohnter Gegenden bei ersteren viel fischärmer als bei letzteren sind. Die Ursache hierfür ist in der bei den Mahakambewohnern üblichen Methode der Fischerei mit Gift (tuba) zu suchen, welche sie nicht nur, wie am Kapuri, in den Bächen, sondern auch in den Hauptflüssen anwenden. Die tuba vergiftet vor allem die jüngsten, noch unbrauchbaren Fische und verhindert dadurch eine Wiederbevölkerung der Flüsse. Die Fischerei wird denn auch, z.B. bei den Kajan am Blu-u, mit grosser Anstrengung und sehr schlechtem Resultat betrieben. Die wenigen Fische im Blu-u sind wegen der ständigen Verfolgung, der sie ausgesetzt sind, so scheu, dass man sie mit dem runden Wurfnetz (djăla) bei klarem Wasser überhaupt nicht fangen kann, sondern nur, wenn ein Regenfall das Wasser trübt. Im Gegensatz zu den Eingeborenen am Mendalam tauchen die am Blu-u, nachdem sie ihre Netze ausgeworfen haben, auf den Grund, um zu sehen, ob der Fang geglückt ist. Die Methode ist besonders zweckmässig, wenn auf dem Boden liegende Felsblöcke und Holzstämme die am Rande des Netzes befindliche Metallkette daran verhindern, sich platt der Erde anzuschmiegen, beim Aufziehen die Fische einzuschliessen und im Netz zu verwirren. Die Stämme am oberen Mahakam können das Untertauchen auch gefahrloser üben als die am Kapuas, weil bei ihnen oberhalb der Wasserfälle keine Krokodile mehr vorkommen, trotzdem der Hauptfluss immer noch 200 m breit ist. Diese Tatsache ist um so unerklärlicher, als Krokodile nicht nur am mittleren Mahakam, sondern auch zwischen der östlichen und westlichen Reihe von Wasserfällen verbreitet sind.
Am Blu-u beobachtete ich zum ersten Mal das Fischen mit dem Wurfnetz und zugleich mit Köder; dies war sogar ein Lieblingssport von Kwing Irang. Er legte an geeigneten Stellen, oft unter oder zwischen Steinen, gekochten Reis oder Sago aus und warf einige Stunden später sein Netz darüber hin; so überlistete er häufig einen Fisch, aber für den Fang im Grossen kam diese Methode nicht in Betracht. [127]
Eigentümlicherweise herrscht nicht bei allen, sondern nur bei einem Stamm, den Ma-Suling am Mĕrasè, der Brauch, dem Fischmangel durch eine Art künstlicher Zucht abzuhelfen; sie wird in Weihern betrieben, die man durch Abdämmung der Bäche erhält. Einst führte mich der Weg über einen solchen, durch einen Deich abgedämmten Bach. Quer durch das Flüsschen war eine schräge Bretterwand aufgerichtet, die unter einem Winkel von etwa 60° flussabwärts neigte. Gestützt wurde diese auf dem Boden, auf halber Höhe und oben am Rande, durch schwere, horizontal gestellte und mit ihren Enden in die beiden Uferseiten versenkte Balken, die ausserdem noch durch parallele Balken, welche ungefähr 1 m flussabwärts im Ufer steckten und als Stütze für die Verbindungsbalken zwischen den ersteren dienten, in der richtigen Lage gehalten wurden.
Um diese Bretterwand wasserdicht zu machen, diente eine meterdicke, so fest anliegende Lehmschicht, dass sie ständig als Weg über den Bach benützt wurde. Nur bestimmte Fischarten leben und vermehren sich stark in dem Weiher, andere dagegen, die stillstehendes und bisweilen sehr warmes Wasser nicht vertragen, gehen in ihm zu Grunde. Die meisten der grösseren Ma-Sulingfamilien besitzen einen eigenen Weiher, aus dem sie nach Bedürfnis Fische holen.
Zu den für die Ernährung in Betracht kommenden Haustieren der Mahakambewohner gehören das Schwein und das Huhn. Hunde und Katzen werden nicht gegessen, und die wenigen Ziegen, die in manchen Dörfern der Seltsamkeit wegen gehalten werden, ebenfalls nicht, weil sie wie Hirsche, wilde Rinder und andere Horntiere lāli sind.
Schweine und Hühner dürfen, wie am Mendalam, nur bei religiösen Festen geschlachtet werden und dienen offiziell nur den Geistern als Speise, während sie tatsächlich von den Festteilnehmern bei fröhlichem Mahl verzehrt werden.
Verschiedenen Überlieferungen nach sind die Schweine und Hühner den Menschen ähnlich und mit diesen gleichen Ursprungs, daher ist es nicht unmöglich, dass diese Tiere in einigen Fällen gegenwärtig die früheren Menschenopfer ersetzen sollen, wie die Barito und andere ihnen verwandte Dajakstämme Rinder ausschliesslich zu dem Zweck halten, sie beim Ablegen der Trauer und ähnlichen religiösen Zeremonien statt Menschen zu opfern, seitdem diese Sitte ihnen von den Niederländern verboten worden ist. Es ist jedoch nicht denkbar, dass bei den zahlreichen Gelegenheiten, bei denen gegenwärtig Schweine und Hühner [128] geschlachtet werden, früher stets Menschen geopfert worden sind, so dass die in den Legenden so häufig wiederkehrende Verwandtschaft zwischen Menschen und Opfertieren nur in einigen Fällen obiger Vermutung als Basis dienen kann.
Nach einer dieser Legenden, welche bei den Mahakam-Kajan kursiert, sind Schweine und Hühner aus einer Verbindung zwischen Bruder und Schwester hervorgegangen, indem aus dieser blutschänderischen Ehe ein Schwein und ein Ei geboren wurden. In der Schöpfungsgeschichte der Mendalam-Kajan ging der Mensch mit einem Huhn und einem Schwein gleichzeitig aus Baumbast hervor (Teil I p. 129).
Von den Schweinen werden bei den Kajan, Ma-Suling und Long-Glat nur die männlichen Tiere geopfert. Die Long-Glat gebrauchen die weiblichen Exemplare überhaupt nicht, lassen sie vor Alter sterben oder tauschen sie bei den Pnihing, von denen sie gegessen werden dürfen, gegen männliche um. Bei den Kajan ist das Fleisch weiblicher Schweine nur Frauen zu essen erlaubt. Den Long-Glat ist der Genuss von Schweinen und Hühnern zur Erntezeit gänzlich verboten.
Dass die Dajak beim Schlachten der Schweine ungeschickt zu Werke gehen, habe ich bereits mehrmals erwähnt. Folgende Einzelheiten beobachtete ich einst, als ich während eines anhaltenden Fleischmangels gegen hohen Preis ein Schwein gekauft und einige junge Kajan gebeten hatte, das Tier für mich schlachten und zerlegen zu wollen. Ich wollte nämlich das Fleisch mittelst Salz zu konservieren versuchen.
Die Männer banden dem Tier die Pfoten zu je zwei aneinander, steckten zum Tragen von hinten nach vorn einen Bambusstock durch die Beine und legten es auf zwei Paar gekreuzte im Boden stehende Hölzer nieder, so dass es etwa 75 cm über der Erde zu liegen kam. Die Schnauze banden sie ihrem Opfer nicht nur zu, sondern hielten sie auch mit den Händen fest, so dass es keinen Laut von sich gab, obgleich sie die Luftröhre nicht durchschnitten und es sehr lange dauerte, bis alles Leben entflohen war. Augenscheinlich finden die Kajan das Geschrei der Tiere beim Schlachten unangenehm; aus demselben Grunde drücken sie wohl auch den Hühnern den Schnabel und die Kehle zu, bevor sie diese durchschneiden. Erst jetzt begriff ich, warum ich gelegentlich eines Festes bei der Ablegung der Trauer, das die Punan am Mandai einige Jahre vorher feierten, nicht gemerkt hatte, dass sie dicht neben mir nach Art der Ulu-Ajar-Dajak 8 Schweinen die Kehle durchschnitten. Meine Aufmerksamkeit wurde damals [129] allerdings durch die Opferung eines Stiers abgelenkt, doch blieb mir bis dahin ihr Verfahren trotzdem unerklärlich.
Die Kajan empfanden mit den Leiden ihres Schlachtopfers keinerlei Mitleid; sie bereiteten ihm einen langsamen Tod, indem sie ihm vom Halsschnitt aus durch Drehen von Hand und Messer alle grossen Blutgefässe in der Brusthöhle öffneten. Bei dieser Schlachtmethode konnte alles Blut ausfliessen und aufgefangen werden; auch sonst wurde nichts einigermassen Brauchbars fortgeworfen. Darauf brannten sie dem Tier mit glimmenden Holzscheiten die Borsten ab und legten es in den Fluss, wo Bauch und Brusthöhle ausgeweidet und der Inhalt gereinigt wurde, um mit dem Kopf als Lohn für ihre Arbeit von den Schlächtern später verspeist zu werden. Das Tier wurde sodann mit Schwertern in kleine Stücke zerlegt, um diese in Blechgefässen aufbewahren zu können. Wahrscheinlich geschah die darauf folgende Bearbeitung des Fleisches nicht nach allen Regeln der Kunst, wenigstens begann es bereits nach 2 Tagen einen unangenehmen Geruch zu verbreiten und mussten wir es den Kajan schenken, die es sehr zu würdigen verstanden, hauptsächlich des vielen Salzes wegen, das sich zwischen den Fleischstücken befand. Die Eingeborenen selbst machen das Fleisch haltbar, indem sie es in kleine Stücke schneiden und lange kochen; das Räuchern wird ebenfalls angewandt, aber mit schlechterem Erfolg. Auch die Fische, die stets durch Räuchern über einem Feuer von feuchtem Holz konserviert werden, halten sich nur wenige Tage. [130]
Kapitel VI.
Religiöse Bedeutung einiger Spiele der Mahakam-Dajak—Spiele der Männer: Waffentanz (kĕnja), Ringkampf, Wettlauf, Hochund Weitsprung, Ball- und Kreiselspiel, Scheinkämpfe (Wasserspritzen. Blasrohrschiessen)—Spiel der Frauen: Tanz zwischen Reisstampfern—Volksspiele—Kinderspiele Spielzeug, Steinewerfen (aus freier Hand; mit Schleudern), Figurenbilden mittelst einer Schnur, Häuserbau—Singtänze (ngarang)—Rezitationen—Musikinstrumente: Gonge, klĕdi, Flöten, Guitarre (sape̱), Mundharmonika (tong)—Singen und Pfeifen.
Die Spiele der Bahau-Dajak greifen, wohl ihres teilweise religiösen Ursprungs wegen, tief in ihr Volksleben ein. Rechnet man zu ihren Spielen nicht nur Vergnügungen an sich, wie Tänze, Ball- und Kreiselspiel, sondern auch gymnastische Übungen und rein musikalische Genüsse, so verdienen diese ihres Umfanges wegen hier eine besondere Betrachtung.
Der Einfluss des Kultus, der das ganze Leben der dajakischen Stämme beherrscht, lässt sich auch in ihren Spielen nachweisen. Dies gilt hauptsächlich für die von allen Erwachsenen gemeinsam, meist zu bestimmten Gelegenheiten vorgenommenen Vergnügungen, weniger für die mehr individuellen, an keinen Termin gebundenen. Erstere finden nur sehr selten zu gewöhnlichen Zeiten statt, auch erlangen sie ihre volle Bedeutung eigentlich nur gelegentlich der Ackerbaufeste, die einen streng religiösen Charakter tragen. Aber auch dann unterhält man sich nicht nach Belieben, sondern zu bestimmten Festen gehören auch bestimmte Spiele, so sind bei den Saatfesten (tugal) andere Belustigungen üblich als beim kleinen Erntefest (lāli parei ola) oder dem grossen Erntefest (lāli parei aja), beim Anfang der Ernte und beim Neujahrsfest (dangei). Beim tugal wird Masken- und Kreiselspiel vorgenommen; beim ersten Einholen des Reis (lāli parei) beschiesst man einander aus Blasrohren u.a.; zur Neujahrsfeier gehören Gymnastik und Wasserspritzen. Ist dieser Zusammenhang zwischen Festen und Spielen nun ein zufälliger oder ein innerlich begründeter? Letzteres erscheint mir wahrscheinlicher, denn bei einem der wichtigsten Männerspiele, [131] dem hudo̱ kājo̱, habe ich eine religiöse Bedeutung direkt nachweisen können (T. I p. 325); obgleich mir dies bei den anderen nicht gelungen ist, vermute ich doch, dass auch allen übrigen, mit bestimmten Festen verbundenen Spielen ein religiöser Gedanke zu Grunde liegt. Bemerkenswert ist, dass Handlungen, welche von den Priestern bei ihren Zeremonien verrichtet werden, bei den übrigen Stammesgenossen nur zur Belustigung dienen. So werden die unter diesen dajakischen Stämmen sehr verbreiteten Schwerttänze (kĕnja) auch von Priestern beiderlei Geschlechts beim Neujahrsfest ausgeführt und zwar hauptsächlich zur Abwehr der bösen Geister von den gebrachten Opfern; ferner bietet, wie anderen Ortes berichtet worden ist (T. I p. 182), die älteste Priesterin, mit Kriegsmütze und Schwert bewaffnet, zuerst das Opfer, dann das Fruchtbaumholz der Dangeihütte tanzend den Himmelsgöttern zum Geschenk an. Da beim kĕnja nicht nur Kriegsszenen, sondern die verschiedensten Vorfälle aus dem täglichen Leben dargestellt werden, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich dieser Tanz aus den obigen religiösen Zeremonien entwickelt hat. Ähnlich verhält es sich mit dem nangeian (Rundtanz T. I p. 176). Dieser gehört zu denjenigen Zeremonien des Neujahrsfestes, die von den Priesterinnen eingeleitet und von den Laien stundenlang auf die gleiche Weise fortgesetzt werden. Ferner wird der von jungen Männern und Frauen so gern gepflegte ngarang auch von den Priestern getanzt, nur nach anderen Melodien. Dasselbe gilt für die übrigen Vergnügungen; bei der me̥lā z.B. trachtet die dājung auf ihren Geist in Apu Lagan durch das Rezitieren der Legenden von Bĕlawan Buring, von Bakong oder von Bun Einfluss zu gewinnen und ihn zum Niedersteigen zu bewegen. Den gleichen Legenden lauscht aber auch bisweilen der ganze Stamm Nacht für Nacht, wenn sie von einem geübten Rezitator vorgetragen werden. Ist dieser in den umfangreichen dajakischen Überlieferungen gut bewandert, so wird er gleich einem Künstler oder Priester für beseelt angesehen. In diesem Fall ist zweierlei möglich: das dājung (Singen, Rezitieren) der Priesterinnen kann das Ursprüngliche gewesen sein und bei den Laien Nachahmung gefunden haben, oder die Priester können versucht haben, die Geister auf die gleiche Weise zu unterhalten und anzulocken, wie es bei den Menschen üblich ist.
Von den Spielen der Erwachsenen habe ich das Masken- und Kreiselspiel, den Kampf mit Blasrohren und das gegenseitige Bespritzen mit Wasser ausschliesslich während der religiösen Ackerbaufeste vor [132] nehmen sehen; die anderen dagegen finden bisweilen auch zu gewöhnlichen Zeiten statt. Ob es jedoch direkt verboten ist, sich mit obengenannten Spielen ausserhalb der festlichen Gelegenheiten zu unterhalten, ist mir nicht bekannt. Kinder halten sich jedenfalls nicht an die bestimmten Festzeiten, sondern spielen mit dem Kreisel, Blasrohr etc., sobald sie Lust dazu haben, allerdings sind sie ja auch den pe̥māli der Erwachsenen nicht unterworfen.
Die Maskenspiele sind bereits im ersten Teil ausführlich behandelt worden. Für das tägliche Volksleben von weit grösserer Bedeutung sind dagegen die Waffentänze (kĕnja), weil diese nicht auf gewisse Festlichkeiten beschränkt sind und von kleineren oder grösseren Gesellschaften häufig vorgenommen werden.

Kriegstanz.
Bei den Bahau und Kĕnja werden diese Waffentänze beinahe stets nur von einem Mann ausgeführt, der sich mit Schild und Schwert bewaffnet und in der Regel auch noch mit Kriegsmantel und Mütze schmückt. Auf Tafel 12 ist ein solcher Schwerttänzer in einer der höchst eigenartigen Bewegungen des kĕnja dargestellt. Dieser wird stets nach der Melodie des klĕdi ausgeführt, den hier ein daneben hockender Knabe spielt. Einem Kriegstanz, an dem sich zwei Männer beteiligten, wohnte ich niemals bei. Ein einziges Mal sah ich auch eine Frau mit einigem Talent den Schwerttanz ausführen, zum grossen Ergötzen der männlichen Zuschauer. Der kĕnja wird meist in der breiten Galerie der Häuptlingswohnung vorgenommen und besteht aus lebhaften, oft sehr graziösen Körperbewegungen, die mit weiten Sprüngen und Ausrufungen abwechseln. Der Refrain der Melodie wird oft vom Publikum wiederholt. Die Gewandtheit im Tanz ist sowohl bei den einzelnen Stämmen als bei den Individuen sehr verschieden.
Nach allgemeiner Ansicht der Dajak selbst haben es die Kĕnjastämme in diesem Tanz am weitesten gebracht, auch tragen sie nach dieser Kunst ihren Namen; aber in der Regel zeichnen sich auch bei ihnen nur einzelne Personen im Tanze aus. Sämtliche Kriegstänze haben zwar den Zweck, die Geschicklichkeit in der Handhabung der Waffen zu beweisen, doch dienen sie gleichzeitig auch zur Darstellung irgend eines Vorfalls aus dem Kriegs- oder Alltagsleben. So wird dem Publikum z.B. das Sähen, Mähen, Jagen, Früchtestehlen u.s.w. durch einen bestimmten Schwerttanz vorgeführt. Für einen Europäer ist es jedoch, auch wenn er die Bedeutung des Tanzes kennt, nicht immer leicht, zwischen diesem und dem Vorgestellten eine Beziehung zu er [133] kennen. Mit dem Sinn des Tanzes verändert sich auch stets die auf dem klĕdi gespielte Melodie. An der Vorstellung beteiligen sich der Reihe nach verschiedene junge Männer, die nicht nur in der Geschicklichkeit, sondern auch in der Sicherheit des Auftretens eine grosse Verschiedenheit an den Tag legen. Einige Jünglinge sind aus lauter Verlegenheit kaum zum Tanzen zu bewegen. Am häufigsten werden derartige Tanzbelustigungen auf die Abende während eines me̥lo̱ (Ruhetag oder Tage nach der me̥lā) verlegt; die Dorfbewohner, die dann alle zu Hause sind, versammeln sich in grosser Menge zu diesem sehr beliebten Schauspiel.
Die nicht zu den Bahau und Kĕnja gehörenden Stämme verstehen sich auch nicht auf diese Kriegstänze. Bei den Pnihing am oberen Mahakam sind sie z.B. ungebräuchlich, obgleich alle benachbarten Stämme sie gern betreiben, sie sogar so hoch schätzen, dass sie zu Ehren eines Europäers als ihre beste Kunstleistung zuerst einen kĕnja vorführen. Wie auf alle anderen eigenartigen Sitten dieser Stämme hat der Einfluss der Fremden, d.h. hier der Malaien, auch auf die Kriegstänze zersetzend gewirkt. So üben die Bahau am Kapuas den kĕnja viel weniger als die am Mahakam, auch sind es dort nur sehr junge Männer, die an ihm Vergnügen finden, während hier bei grossen Festen auch die Erwachsenen und älteren Männer noch gern mittun. Am nachteiligsten wirkt am Kapuas sicherlich die Furcht, von den vielen Fremden verspottet zu werden. Obgleich die Töne des klĕdi sehr sanft klingen und der kĕnja mit seinen Schritten und Sprüngen auf den harten Planken recht viel Lärm verursacht, folgt der Tänzer doch stets genau der vorgetragenen Melodie. Wenn der klĕdi-Spieler daher nicht auf der Höhe seiner Kunst ist, bringt er auch den Tänzer in Verwirrung, so dass er seine Vorstellung dann nicht nach allen Regeln zu Ende bringen kann. Ein bedeutendes Hindernis für die Aufführung von Tänzen kann daher darin liegen, dass der Musiker zufällig nicht die Melodien spielen kann, welche zu den Szenen gehören, die der Tänzer gerade vorzutragen versteht.
Unter den Priestern führen sowohl Männer als Frauen den Schwerttanz aus, wie gesagt, zur Vertreibung böser Geister, zur Darbringung von Opfern an die Geister u.s.f.; doch tanzen diese nicht unter Begleitung des klĕdi, sondern häufiger des Gongs. Der kĕnja der Laien findet niemals bei grossen religiösen Festen statt.

Ringende Männer der Bahau.
In Anbetracht, dass die Ausführung des Schwerttanzes eine grosse [134] körperliche Anstrengung erfordert, können sich ihm nur Stämme, die starke Leibesübungen gerne haben, widmen. In letzteren zeichnen sich übrigens die Bahau und Kĕnja vor allen anderen Stammgruppen Mittel-Borneos aus; sobald nur einige junge Männer an geeigneter Stelle, z.B. auf einer langen Geröllbank im Fluss, beieinander sind, beginnen sie einen Wettlauf oder andere gymnastische Übungen vorzunehmen.
Sehr beliebt ist der Ringkampf (pajo), von dem Tafel 13 eine Vorstellung gibt. Die Ringer, gewöhnlich zwei junge Männer, sind dabei nur mit einem Lendentuch bekleidet, das sie eng um den Leib schnüren, um dem Partner einen festen Angriffspunkt zu bieten. Sie beginnen nämlich damit, einander nach der auf dem Bilde angegebenen Weise anzupacken, und suchen dann durch Kraft und Gewandtheit ihren Gegner mit dem Rücken auf den Boden zu schleudern.
So weit ich habe beobachten können, werden hierbei keine bestimmten Regeln befolgt und keine schmerzerregenden Mittel angewandt, auch sah ich nie eine Vorstellung in einen ernsthaften Kampf ausarten, wobei man einander auf andere Weise als durch Geschicklichkeit zu besiegen versucht hätte. Trotzdem sind diese Ringkämpfe nicht gefahrlos, weil die Gegner einander bisweilen sehr heftig zu Boden schleudern. Ich sah denn auch mehrmals, wie besorgte Mütter ihre Söhne vom Kampfe zurückzuhalten versuchten und sie in Gegenwart ihrer Kameraden warnten. Keiner der Jünglinge folgte jedoch den mütterlichen Ermahnungen, hauptsächlich natürlich aus Furcht vor Spott seitens des Publikums. Ab und zu kommt allerdings auch ein Arm- oder Beinbruch bei diesen Ringkämpfen vor. Frauen sah ich niemals am Ringen teilnehmen.
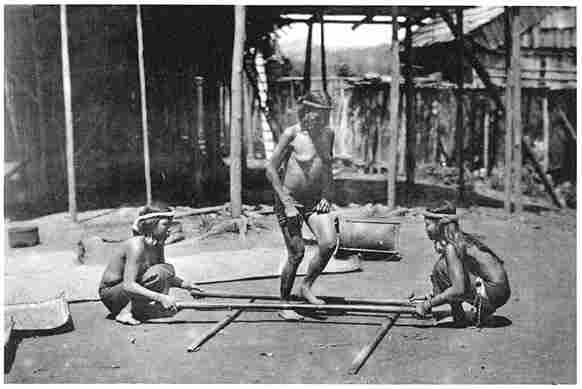
Tanz der Frauen.
Bei allen Spielen der Bahau ist von einem eigentlichen Siege, einer materiellen Belohnung oder einem Ehrenpreise keine Rede, ebensowenig sah ich die Zuschauer auf den Ausgang eines Kampfes wetten.
Neben dem Ringen ist der Wettlauf und Wettsprung bei den Bahau sehr im Schwange, Vergnügungen, die spontan, nicht zu bestimmten Zeiten, vorgenommen werden. Grosse Abwechslung in der Art des Wettlaufes beobachtete ich nicht, meist nahmen es nur zwei Personen mit einander auf. Stets beteiligen sich nur sehr junge Leute an diesem Spiel; sobald sie einmal über 25 Jahr alt sind, verlieren die Männer an dergleichen die Lust. Dasselbe gilt für das Springen. Auf den Hochsprung wird weit mehr Gewicht gelegt als auf den Weitsprung. Man springt mit oder ohne Anlauf, ganz frei oder mit Hilfe eines [135] Stockes. Ebensowenig wie Sprungbretter und Matratzen werden andere Hilfsmittel gebraucht. Beim freien Hochsprung bringt der junge Mann es oft nicht weiter als bis zur Höhe seines Schultergürtels. Für höhere Sprünge gebraucht man lange Stöcke, in der Regel die aus dem zähen, elastischen Holz bestimmter Baumarten hergestellten Bootsstangen. Das Stockspringen geschieht auf zwei verschiedene, auf Tafel 14 durch Momentaufnahmen dargestellte Weisen. Der Springer befindet sich in beiden Fällen auf dem höchsten Punkte.
Links sieht man, wie er sich, mit beiden Händen auf den Springstock gestützt, über den zwischen zwei Bootsstangen geklemmten Stock hinüberschwingt. Hat er im folgenden Augenblick die andere Seite erreicht, so wirft er den Stock nach rückwärts und springt selbst auf die Füsse. Durch diese Sprungart werden bisweilen grosse Höhen genommen.
Der Springer auf dem Bilde rechts hat sich mit Hilfe des Stockes kräftig zur erforderlichen Höhe hinaufgeschwungen, aber anstatt diesen zurückzuwerfen, führt er ihn in der einen Hand mit sich über die Schnur, hier ein Rotang. Dieser Sprung erfordert eine grössere Kraftentwicklung als der vorige. Derartige Springübungen werden besonders unter den Mahakamstämmen oft und gern betrieben.
Allgemein verbreitet ist bei den Bahau auch das Ballspiel, bei welchem ein in grossen Maschen aus Rotang geflochtener und daher äusserst leichter Ball verwendet wird. Das Spiel findet in der Weise statt, dass einige im Kreise stehende Männer den Ball einander, hauptsächlich mit Hilfe der Beine, hoch durch die Luft zuwerfen. Wahrscheinlich haben die Eingeborenen dieses Spiel von den Malaien übernommen, die es sehr allgemein üben.
Im Gegensatz zu den gymnastischen Spielen und dem Ballspiel darf das Kreiselspiel der Erwachsenen, wie gesagt, nur zu bestimmten Zeiten vorgenommen werden (Kreisel = asing; spielen mit dem Kreisel = pasing). Von den gebräuchlichen Kreiseln sind zwei unter m und n auf Tafel 15 abgebildet, während das Spiel selbst bereits im ersten Teil p. 329 besprochen und auf Tafel 63 wiedergegeben worden ist.
Beim Beginn der Ernte, dem lāli parei, ergötzte man sich am Mahakam mit bestimmten Spielen, die früher in allerhand Arten von Scheingefechten bestanden haben müssen. Jetzt sah ich nur noch die Kinder kleine Kämpfe in Parteien abhalten; sie beschossen einander dabei mit Lehmpfropfen aus kleinen Blasrohren oder bespritzten ihre [136] Gegner mit Wasser aus niedlichen Spritzen (Taf. 15, Fig. j). Diese bestehen aus zwei Teilen, einem Bambusinternodium, an dessen einem Ende sich der mit einer zentralen Öffnung versehene Knoten befindet, und einem am Ende mit Lappen umwickelten Holzstück, dem Sauger. An letzterem Vergnügen nahmen auch Erwachsene Teil; besonders Männer und Frauen setzten einander unter Scherzen und Lachen mit grossen Bambusgefässen mit Wasser nach. Die älteren Leute erinnerten sich noch, dass man früher hölzerne Schwerter verfertigte und mit ihnen Scheinkämpfe veranstaltete.

Übungen mit dem Springstock.
Von dergleichen Spielen hat sich einiges noch bei den jungen Männern erhalten; sie beschiessen einander aus nächster Nähe mit Lehmpfropfen aus Blasrohren, und zwar kommt es bei diesem Spiel darauf an, seine Unempfindlichkeit gegen Schmerz zu bezeigen. Benützt werden sehr lange Rohre, so dass die feuchten Erdklümpchen heftig an die dicht vor die Mündung gehaltenen Körperteile anprallen. Meistens richtet man die Geschosse auf Bauchwand und Schenkel und sie treffen häufig mit solcher Kraft, dass die Haut unter den plattgeschlagenen Ballen sich sogleich rötet und anschwillt. Jeder sucht möglichst stark zu blasen und möglichst wenig Zeichen von Schmerz zu äussern; ein wirklicher Wettkampf mit einem oder mehreren Siegern findet jedoch auch hierbei nicht statt. Während die Erwachsenen ruhig beieinander stehend die Schmerzproben ablegen, unterhält sich die Kinderschar mit kleinen Blasrohren, die sie aus einer dünnen Bambusart mit langen Internodien hergestellt haben, und mit denen sie einander aus der Ferne mit Lehmkügelchen beschiessen. Bisweilen kämpfen sie in Parteien, wobei in der Regel die Gleichaltrigen zusammentreten, oder sie suchen einander in die Flucht zu jagen oder auch sie beweisen ihre Unempfindlichkeit gegen Schmerz, indem sie ihre Beine den Geschossen ihrer Kameraden entgegenhalten. Obgleich die Lehmkugeln aus der Ferne sehr harmlos treffen, ergriff auch beim Parteikampf bald dieser bald jener wie in panischem Schrecken plötzlich die Flucht, bisweilen ohne merkbaren Anlass, meist infolge einer plötzlichen Beschiessung von unerwarteter Seite; die Gegenpartei stürmt dann unter lautem Gejauchz über Gestrüpp, gestürzte Bäume und Balken hinterdrein, um dann ihrerseits vor einer Ladung Lehmkugeln Halt zu machen und den Rückzug anzutreten. Ein kleines, zugleich als Flöte dienendes Blasrohr ist auf Taf. 15 unter k abgebildet.

Übungen mit dem Springstock.
Bei allen diesen Gefechten und Schmerzproben merkte ich nie etwas [137] von Erbitterung, und nur sehr selten brach ein kleiner Wicht, der sich unter die grösseren gewagt hatte, über ein Lehmgeschoss, das ihn getroffen, in Tränen aus. Ausser mit Lehmkugeln beschoss sich die Jugend auch mit Grasbüscheln oder mit langen Grashalmen als Wurflanzen.
Die Frauen pflegen nur wenige Spiele, die nicht auch von den Männern geübt werden. Auf Taf. 13 unten ist ein solches Spiel dargestellt, das von den Frauen besonders in ihrer freien Zeit, z.B. zwischen dem Trocknen und Stampfen des Reises, vorgenommen wird; auf der hier abgebildeten Szene sieht man denn auch hinter den Frauen grosse Matten mit Reis zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet.
Das Spiel besteht darin, dass eine Frau zwischen zwei Reisstampfern tanzt, die von zwei Gefährtinnen an beiden Enden festgehalten und in einem bestimmten Rhythmus erst auf zwei am Boden liegende Stampfer, dann gegen einander geschlagen werden. Je geschickter die Tänzerin, desto seltener werden ihre Füsse zwischen die zusammenschlagenden Stampfer geklemmt. Der Rhythmus des Tanzes ist sehr verschieden, auch werden die Stampfer bisweilen schneller und schneller bewegt, so dass die Frau zuletzt die Füsse nur durch sehr flinke Bewegungen zwischendurchziehen kann. Dieses Spiel ist nicht an feste Zeiten gebunden.
Zu den Volksspielen der Bahau können gegenwärtig auch die Hahnenkämpfe gerechnet werden, die vor ungefähr zwei Generationen am oberen Mahakam eingeführt wurden und auch jetzt noch mehr bei den Long-Glat und Ma-Suling als bei den Pnihing und Sĕputan im Schwange sind. Diese Liebhaberei hat bei den Bahau selbst von dem für die Volkswohlfahrt so verderblichen Charakter eines Hazardspiels, wie es z.B. bei den Malaien üblich ist, noch sehr wenig angenommen. Eine eingehende Behandlung haben die Hahnenkämpfe bereits in Teil I pag. 347 erfahren.
Über zwei Spiele habe ich keine nähere Auskunft erhalten können. Das eine erinnert sehr an unser Tric-Trac und wird mit einem mit a Reihen von Aushöhlungen versehenen Block gespielt; das andere ist ein einfaches Schachspiel. Beide werden hauptsächlich unter den Kajan gepflegt.
Was die Kinderspiele der Bahau betrifft, so sind sie, wie mehrmals bereits gesagt, nicht, wie die meisten Spiele der Erwachsenen, religiösen Beschränkungen unterworfen. Kinder unterhalten sich denn auch das ganze [138] Jahr über mit dem Kreiselspiel, Blasrohrschiessen, Wasserspritzen und bisweilen auch mit dem Maskenspiel. Für das Kreiselspiel schnitzen die Männer den Knaben aus hartem Eisenholz kleine Kreisel (Taf. 15 e und f), die sie entweder gut polieren (e) oder hübsch mit Schnitzwerk verzieren (f); meist sind sie rund statt platt, wie die der Erwachsenen. Sie werden mit den gleichen Schnüren geschleudert, und wie beim pasing der grossen Männer sucht ein Knabe den Kreisel des anderen herauszuschlagen. Ausser den genannten Vergnügungen, die sie mit den Grossen gemein haben, besitzen sie jedoch noch einige andere, die mit ihrem Älterwerden zusammenhängen und gelegentlich bestimmter Feste geübt werden.

Kinderspielzeug und Kreisel.
Bei den Erntefesten dürfen kleine Knaben z.B. zum ersten Mal Schwert und Schild aus Holz (Fig. l. Taf. 15), kleine Mädchen Reiskörbe tragen; beide Geschlechter spielen dann auch zum ersten Mal mit einem Bambus und einem Klopfer (Fig. i. Taf. 15). Mitten in diesem Bambus ist eine Öffnung angebracht, auf die das Kind beim Schlagen abwechselnd einen Finger setzt, so dass zwei in der Höhe stark abweichende Töne hervorgebracht werden und der Bambus also zugleich ein primitives Musikinstrument darstellt.
Wird der erste, noch nicht ganz reife und harte Reis gepflückt, so trocknet man ihn zuerst in grossen Schüsseln und entfernt durch Stampfen die Spelzen, wonach die Körner plattgeschlagen aus dem Blocke hervorkommen. Dieser halbreife Reis bildet einen sehr beliebten Leckerbissen der Kinder, die dann den ganzen Tag mit kleinen Behältern umhergehen, aus denen sie den Reis essen. Die Form derselben ist oft sehr eigentümlich, wie zwei unter g und h abgebildete Modelle auf Taf. 15 zeigen. g hat die Gestalt eines der gewöhnlichen, kleinen, aus Rotang geflochtenen, flaschenförmigen Behälter, wie sie auf Reisen viel gebraucht werden. Hier jedoch ist das Flechtwerk mit Figuren aus buntem Zeug benäht, die durch Steppstiche noch deutlicher hervorgehoben sind. Der Deckel ist mit Figuren bestickt, die Augen, Nase und Mund eines Gesichtes erkennen lassen. h ist ein aus Pandanusblättern geflochtener Korb in Form eines geflügelten, vierfüssigen Tieres, dessen langer Hals einen kopfförmigen Stöpsel trägt. Dergleichen Tiergestalten, besonders die von Vögeln, werden häufig verwendet. Später, wenn der Reis ganz reif ist, füllt man die Behälter für die Kinder mit gedämpftem Klebreis.
Einige Spielsachen der Dajak stimmen ganz mit denen unserer Kinder [139] überein, so z.B. die Puppen. Doch sind diese bei den Bahau nicht allgemein verbreitet und werden auch nur Säuglingen und sehr kleinen Kindern gegeben; sobald die Mädchen einmal ausserhalb des Hauses spielen, sieht man sie nicht mehr mit Puppen. Tafel 15 (b und c) giebt zwei solcher Puppen vom oberen Mahakam wieder. Ihr Rumpf besteht aus Baumbast; im Gesicht sind bei b mit schwarzem Faden Augen, Nase und Mund gestickt, während zwei Metallringe an Baumwollfäden die an den ausgereckten Ohrlappen hängenden Ringe vorstellen. Die Kleider sind aus gewöhnlichem buntem Kattun verfertigt. Puppe c besitzt zwar keinen Kopf, doch sind die Ohrringe an den Schultern befestigt.
Lieber als Puppen haben die Mädchen kleine Kindertragbretter (hăwăt), mit denen sie umhergehen. Zwei dieser hăwăt sind unter a und d abgebildet, letztere mit à jour Schnitzwerk verziert und beide zur Abwehr böser Geister mit Muscheln behängt. So häufig ich auch die kleinen Mädchen mit Tragbrettern spielen sah, fand ich in diesen doch nie eine Puppe, die ein Kind vorstellen sollte; stets wurde die hăwăt leer umhergetragen.
Die Knaben unterhalten sich gern damit, flache Flusssteine nach selbstgegrabenen Erdlöchern zu werfen. Bei diesem Spiel kommt es darauf an, das Loch von einem bestimmten Abstand aus gut zu treffen; nie sah ich dass gespielt wurde, um als Erster hervorzugehen oder einen Einsatz zu gewinnen.
Abends beim Baden findet die Bahaujugend, ganz wie die europäische viel Vergnügen daran, Steine übers Wasser ans andere Ufer zu werfen oder flache Steine auf der Wasseroberfläche möglichst oft hinterein ander aufschlagen zu lassen.
Eine sehr bemerkenswerte Methode des Steinewerfens beobachtete ich einst bei den Ulu-Ajar-Dajak am Mandai, nämlich das Werfen mittelst einer Schleuder. Die Knaben benützten hierfür sehr lange, schmale Blätter, deren Enden sie mit einer Hand fassten, worauf sie den Stein in den so gebildeten Bausch legten und ihn ans andere Ufer zu schleudern suchten, indem sie beim Werfen das eine Ende der Schlinge losliessen. Das Prinzip der Schleuder ist diesen Stämmen also bekannt, nur hat sie in diesem Buschland als Waffe zu keiner Bedeutung gelangen können.
Ein eigenartiges, auch in Europa sehr bekanntes Spiel ist das Bilden von Figuren mit Hilfe einer zusammengebundenen, über die Finger [140] der beiden Hände gelegten Schnur. Auch die kleinen Dajak nahmen einander auf bestimmte Weise die Schnur von den Fingern und erhielten dann stets neue Figuren. Als wir ihnen einmal einige unserer europäischen Figuren lehren wollten, zeigte es sich, dass sie selbst deren weit mehr kannten und auch viel geschickter waren als wir.

Kajanknaben auf dem Gerüst ihres selbstgebauten Häuschens.
Auch die dajakischen Kinder ahmen gern die Arbeiten der Erwachsenen nach. Auf Tafel 16 sind vier Knaben zu sehen, die auf dem Gerüst ihres selbstgebauten Häuschens stehen. Von den beiden vordersten ist der eine mit Schild und Schwert bewaffnet, der andere hält ein Blasrohr umgekehrt in der Hand. Angeregt wurden sie zu ihrer Unternehmung durch den Bau von Kwing Irangs Haus, der das Interesse des ganzen Stammes in Anspruch nahm. Im Hintergrunde ist denn auch noch das unvollendete grosse Haus zu sehen (Der Leser sei hier auf das provisorische Gerüst am Ende des Dachfirstes aufmerksam gemacht, das zur Anbringung der bang pakat, der grossen Firstverzierung, dient).
Derartige Bauwerke werden von Gruppen von Knaben an verschiedenen Stellen um die Niederlassung und zwar aus altem Material errichtet. Steht das Hains fertig da, so nehmen die jungen Baumeister mit ihren kleinen Freundinnen tagüber allerlei herrliche Spiele in ihm vor.
Bevor wir uns zu den rein musikalischen Vergnügungen der erwachsenen Bahau wenden, mögen hier als Übergang die Singtänze und Rezitationen behandelt werden.
Ein Hauptvergnügen der erwachsenen Jugend bildet der erwähnte “ngarang”, ein schlichter Tanz von Männern und Frauen, der nach dem Mass verschiedener, von den Tanzenden selbst in Rezitativform gesungener Lieder ausgeführt wird. Diese werden immerzu wiederholt, wobei Männer und Frauen hintereinander im Tanzschritt durch die grosse Galerie des Hauses schreiten und das Mass durch lautes Aufstampfen auf den Boden angeben. Wenn abends nach beendigter Tagesarbeit eine Anzahl junger Leute beisammen ist und lang genug mit einander geschwatzt hat, verbringt sie oft noch Stunden mit dem ngarang. Zuschauer gibt es dann nicht mehr und der grosse Galerieraum ist ganz dunkel oder mit einer Harzfackel nur dürftig erleuchtet. Je nach Stimmung setzt die Jugend den Tanz kürzere oder längere Zeit, nach Festen häufig bis Tagesanbruch fort. Obgleich ein derartiges Vergnügen von den religiösen oder politischen Verhältnissen [141] innerhalb eines Stammes gänzlich unabhängig ist, führen die unter malaiischem Einfluss am Kapuas und mittleren Mahakam sesshaften Bahau den ngarang doch viel seltener aus als die am oberen Mahakam; wahrscheinlich ist auch hier der Spott seitens der zahlreichen Fremden daran Schuld.

Junges Kajanmädchen, die Stammessages rezitierend.
Reichen Beifall finden bei den Bahau die Rezitationen ihrer zahlreichen Überlieferungen aus der Stammesgeschichte oder ihrer Legenden aus der Geisterwelt. Stets finden sich eine grosse Menge Zuhörer zu diesen Vortragsabenden ein. Die Rezitationen werden von Schlägen auf einen über einen Schild gespannten und von zwei kleinen Holzsäulchen getragenen Rotangbogen begleitet (Taf. 17). Die Schläge werden von der rezitierenden Person selbst ausgeführt und geben den Rhythmus an. Erwägt man, dass der Vortrag frei nach dem Gedächtnis stattfindet und häufig eine ganze Nacht, bisweilen mehrere Nächte hintereinander dauert, so erscheint es begreiflich, dass nur wenige Personen mit ausgezeichnetem Gedächtnis und der besonderen Fähigkeit, ihre Gedanken nach bestimmtem Mass wiedergeben zu können, hierzu im stande sind. Der Wert der Vorträge ist denn auch individuell sehr verschieden, und die guten Sänger und Sängerinnen werden von ihren Dorfgenossen als besonders begabt und mit einem besonderen Geist aus Apu Lagan beseelt angesehen. Sowohl Männer als Frauen halten diese Vorträge und jeder beschränkt sich auf eine oder mehrere bestimmte Überlieferungen; diese sind bei jedem Stamme verschieden. Die Rezitatoren können zu den Priestern gehören, doch ist dies keine Notwendigkeit. Auch zeichnen sich nicht immer nur Erwachsene durch ihr Talent aus. Die auf nebenstehender Tafel abgebildete Künstlerin ist z.B. ein erst 16–17 jähriges Kajanmädchen vom Mahakam, das sich durch die Richtigkeit ihrer Erzählungen und ihre angenehme Vortragsweise bei ihren Stammesgenossen einer aussergewöhnlichen Bewunderung erfreute. Derartige Rezitationen finden nicht häufig statt, stehen auch nicht mit religiösen Gebräuchen in Verbindung; sie werden vorgenommen, wenn zufällig viele, von des Tages Last und Mühe nicht zu stark ermüdete Menschen beieinander sind.
Die Rezitationen finden in der grossen Galerie vor der Häuptlingswohnung statt; der Vortragende lehnt sich an die Wand und die Zuhörer lagern sich um ihn herum. Einige singen den Refrain der verschiedenen Verse, in welche die Erzählung zerfällt, mit; die meisten jedoch sitzen oder liegen schweigend auf dem Boden und kürzen [142] sich die lange Nacht ab und zu durch ein Schläfchen; die kleinen Kinder in den Armen der Mütter wachen meistens überhaupt nicht auf. Im Scheine der Harzfackeln bietet eine solche Zuhörermenge die eigenartigsten Bilder: vorn lagern ganze Familie in nächtlicher Ruhe, mehr im Hintergrunde machen junge Leute einander den Hof und hier und da sinkt ein aufmerksamer Zuhörer vom Schlaf überwältigt in den seltsamsten Stellungen zu Boden.

Junger Kajan, Kledi spielend.
Der Vortragskünstler erhält für seine Mühe keine Belohnung. Am beliebtesten sind die Legenden von den erwähnten Bĕlawan Buring, Bun und Bakung, drei Bahauhelden, die in früherer Zeit grosse Taten verrichteten. Die Mahakam-Kajan bezeichnen den Vortrag einer Legende von Bun z.B. mit “ĕnah (= machen, tun) Bun.”
Die Rezitationen führen uns zu den rein musikalischen Genüssen der Bahau, für die insbesondere die Jugend viel Sinn zeigt. Die Musik trägt ganz den Charakter eines Vergnügens und bildet bei keinem religiösen Feste einen Teil der Zeremonien, wenigstens wenn man das nach dem Mass einer Mundharmonika oder tong von den Frauen aufgeführte hudo kajo nicht unter die Zeremonien aufnehmen will, wozu man berechtigt wäre. Zwar wird bei jeder An- oder Herbeirufung von Geistern und Göttern auf kupferne Gonge verschiedenster Form und Grösse geschlagen, aber ohne dabei auf irgend welche musikalische Ausführung zu achten. Die alten und gebräuchlichsten Becken mit niedrigem Rand geben auch nur sehr wenig harmonische Töne. Anders verhält es sich mit den grossen Gongen mit aufstehendem Rand; bei diesen wird wirklich auf reinen Klang geachtet, auch bestimmt dieser hauptsächlich den Preis eines Exemplars, der bisweilen sehr hoch sein kann, während Gonge von gleicher Form und gleichem Gewicht, aber mit unschönerem Klang viel weniger wert sind. Diese Gonge dienen überdies hauptsächlich als Warnsignale auf grosse Entfernungen. Die Bewohner Borneos haben nicht wie die auf Java verstanden, sie zu einem System, wie dem Gamelan, zusammenzufügen.
Das, sowohl was seine Konstruktion, als was seinen Gebrauch betrifft, wichtigste dajakische Musikinstrument ist der klĕdi, eine Art von Dudelsack, der aus einer bestimmten, hierfür besonders gezogenen Kürbissorte labe (Taf. 19 e) hergestellt wird. Diese Kalabasse läuft in einen langen, als Mundstück dienenden Stiel aus, während im Fruchtkörper eine Öffnung angebracht ist, in welche 5 zu einem Bündel vereinigte Bambusstücke als klanggebende Pfeifen mittelst Guttapercha [143] luftdicht eingefügt sind. Oben auf der einen, weit über die anderen vorragenden Pfeife befindet sich zur Verstärkung des Tones in verschiedenster Form, hier in der eines Rhinozerosvogelkopfes, ein Resonanzboden. Bei den richtig hergestellten und daher rein gestimmten klĕdi bilden die Bambusrohre Meisterstücke der Technik, indem sie an ihrem unteren Ende einen Spalt tragen, in dem eine lange Zunge durch ihre eigene Federkraft vibriert, sobald die Luft aus der Kalabasse durch den Spalt in die Pfeife geblasen wird. Die Vibrationen der Zunge bringen die Luft in der Pfeife in Bewegung, wodurch ein Ton entsteht, der, je nach der Länge des Rohres, höher oder tiefer ist. Indem nun die Längen der Pfeifen in ein bestimmtes Verhältnis zu einander gebracht werden, erhält man ein Instrument, auf dem Melodien gespielt werden können. Jede Pfeife ist mit zwei Öffnungen, die mit den Fingern geschlossen werden können, versehen, wodurch das gleiche Rohr beim Blasen mehrere Töne hervorbringen kann. Auf die Herstellung eines gut tönenden Instrumentes verstehen sich nur sehr wenige Personen, die meisten klĕdi werden von der Bevölkerung daher auch als minderwertig betrachtet. Der klĕdi ist ausschliesslich ein Musikinstrument der Männer und wird nach der auf Tafel 18 dargestellten Weise gehandhabt. Man spielt das Instrument im Hause, auf dem Felde, zur Erholung auf Reisen oder zur Begleitung beim Waffentanz.
Neben dem klĕdi ist die Flöte, suling oder sĕlingut, ein Lieblingsinstrument von Männern und Frauen; wie sie behandelt wird, zeigt uns die Frau rechts auf Taf. 20 und der Mann auf Taf. 21. Eine solche Flöte besitzt am Mundende keine besondere Vorrichtung zur Erregung von Vibrationen, sondern wird durch Blasen auf den Rand zum Tönen gebracht. Zwei schöne Flötenexemplare sind unter b und c auf Tafel 19 abgebildet. Sie werden aus einer Bambusart mit sehr langen Internodien hergestellt, so dass sich zwischen zwei Knoten ein gleichmässiges Rohr ohne Unebenheiten an der Innenfläche ausschneiden lässt. Sehr wichtig ist das Anbringen der Öffnungen auf richtiger Höhe, worin die Bahau, zu urteilen nach den reinen und sanften Tönen, die sie ihren Flöten zu entlocken wissen, sehr geschickt zu sein scheinen.
Fig. c zeigt vier solcher Öffnungen, die beim Spielen mit den Fingern geschlossen und abwechselnd wieder geöffnet werden. Bei der sehr fein ausgearbeiteten Verzierung dieser Flöte hat man diese Öffnungen zu hübschen Motiven zu verwenden verstanden. Bei b sieht [144] man die Unterseite einer solchen Flöte, die nur eine und zwar ebenfalls in das Verzierungsmotiv aufgenommene Öffnung trägt.
Am oberen Kapuas kommen Flöten mit einem besonderen, in den Bambus gefügten Mundstück vor, ungefähr nach Art der europäischen Flöten.

Musikinstrumente der Bahau.
Von einer dritten Flötenform, der sogenannten Nasenflöte, gibt Fig. d eine Vorstellung. Auf der Abbildung ist sie kleiner als b und c, aber in Wirklichkeit kommt sie in sehr verschiedenen Grössen, auch in denen der beiden anderen vor. Für diese Flöte wird die gleiche Bambusart wie für die vorigen gewählt, nur gebraucht man ein Internodium mit einem Knoten. Das Mittelstück dieses Knotens wird glatt abgeschliffen, bis es noch heil bleibt, aber sehr dünn geworden ist. Die eine Hälfte wird dann noch weiter bearbeitet, bis eine Öffnung mit scharfem Seitenrand an der noch unverletzt gebliebenen Hälfte entsteht. Beim Blasen wird dieses halbgeschlossene Ende der Flöte derart an die Nasenöffnung gehalten, dass der Luftstrom auf den scharfen Rand trifft, wodurch Vibrationen entstehen, die die Luft in der Flöte in Schwingungen versetzen. Das Instrument wird horizontal an die Nase gehalten, so dass der scharfe Rand an der Unterseite zu liegen kommt. Die mit der Nase geblasenen Flöten geben der beträchtlichen Schwäche des Luftstromes wegen auch einen viel weniger starken Laut als die mit dem Munde geblasenen. Trotzdem sind sie bei den Bahau ebenso gebräuchlich wie die anderen Arten; am beliebtesten sind sie bei den Frauen, die, wenn sie allein oder mit Männern in grösserer Gesellschaft Vergnügungsfahrten unternehmen, die Stille der Tropennacht mit ihnen beleben.
Auch die Flötenmusik fällt je nach dem Talent des Spielers sehr verschieden aus; ältere Leute sah ich fast nie die Flöte blasen, auch wird sie nie zur Begleitung von Tänzen oder anderen Spielen verwendet.
Die Guitarre oder sapè dagegen dient gerade als Begleitinstrument bei den verschiedenen Tänzen der Frauen und Männer gelegentlich der Erntefeste, bei denen übrigens auch die Mundharmonika benützt wird. Die Guitarre, deren Vorderseite auf Fig. a (Tafel 19) zu sehen ist, besteht aus Holz und zwar aus einem Stück, sie ist nicht hoch (± 10 cm) und an der Unterseite völlig offen. Sie besitzt stets zwei Saiten die mit Holzschrauben gespannt und gestimmt werden und wird stets durch Schnellen mit den Fingern zum Klingen gebracht. Bei guten Instrumenten [145] geben Linien am Halse den Platz für die Finger an. Im allgemeinen sind die sage nicht so reich verziert wie die abgebildete, auch variieren sie bedeutend in der Form. Einige, besonders die, welche den Priestern gehören und von diesen bei manchen Zeremonien gespielt werden, sind sehr alt. Die Guitarre wird von Männern und Frauen gespielt und zwar meist in Gesellschaft, besonders bei religiösen und profanen Tänzen; wie Flöte und tong, zur Unterhaltung der jungen Paare bei Ausflügen, sah ich die sapè nie gebrauchen.
Ein anderes sehr beliebtes Instrument ist die genannte tong (Taf. 19 f), die auf demselben Prinzip beruht wie die europäische Maultrommel, insofern nämlich eine kleine Bambuszunge, durch Schnellen bewegt und an die Mundhöhle gehalten, zum Tönen gebracht wird. Indem man die Grösse der Mundhöhle verändert bringt man verschiedene, einer Melodie gleichende Töne hervor. Das Instrument besteht aus einer flachen Bambuslamelle, in welche eine langgestreckte Öffnung so geschnitten ist, dass eine lange, sehr schmale Zunge erhalten bleibt. Diese kann durch ihre Federkraft in der Öffnung vibrieren, wenn man auf das eine Stäbchenende klopft, während man das andere festhält. Auf Fig. f unterscheidet man ein langes, dunkles Bambusstäbchen, das rechts in eine schön geschnitzte Hirschhornspitze endet, an welcher eine Quaste von bunten Zeugstreifen hängt. In der Mitte des Stäbchens ist die aus der Öffnung getretene Zunge zu sehen, die links mit einem viereckigen schwarzen Stück Guttapercha beschwert ist; ein gleiches Stück wird oft auch auf die andere Seite der Zunge geklebt, um diese zu beschweren und die Anzahl der Schwingungen zu regeln. Ich fand solche Guttaperchastückchen auf allen tong.
Die Art, wie das Instrument gehandhabt wird, ist an der Frau links auf den Tafeln 20 und 21 zu sehen. Sie hält mit der rechten Hand das verzierte Ende des Bambusstäbchens fest, das zwischen ihre offenen Lippen geklemmt ist Und klopft mit der Linken auf das andere Ende, also auf die Seite, wo die Zunge noch an dem Bambus festsitzt. Die auf diesem Instrument hervorgebrachten Laute sind durchaus nicht melodisch, trotzdem haben junge Männer und Mädchen die summenden Tonvariationen in der Mundhöhle gern. Bei dem hudo̱ ădjāt der Frauen wird zur Angabe des Rhythmus häufig die tong anstatt der Guitarre verwendet.

Musizierende Kajanfrauen.
Ausser auf Instrumenten äussern die Bahau ihre musikalischen Empfindungen [146] auch durch Singen und Pfeifen. Ersteres hört man selten in der von uns verstandenen Form, besonders bei den Priestern ist es mehr ein Rezitieren, und andere Personen singen überhaupt wenig. Dass auch unsere europäische Art zu singen diesen Stämmen nicht unbekannt ist, beobachtete ich einst bei einer Fischpartie am Mendalam, wo eine Frau, auf dem Rücken liegend, eine Improvisation vortrug, die mich sehr angenehm und europäisch anmutete. Diese Frau genoss übrigens auch den Ruf grosser musikalischer Begabung.
Den äusserst unmelodischen Gesang der Malaien habe ich jedoch nie bei einem Bahaustamm gehört. Auf das Pfeifen verstehen sich die Eingeborenen oft sehr gut, doch tun sie es nur wenig; es scheint, dass abergläubische Furcht sie daran verhindert, denn man wollte nicht einmal, dass wir Europäer nach Abendanbruch pfiffen, aus Angst, die bösen Geister könnten dadurch angerufen werden und Unheil stiften.

Gemütliches Beisammensein.
[147]
Kapitel VII.
Häuserbau bei den Bahau- und Kĕnjastämmen—Unterscheidung dreier Baustile—Vorschriften bei der Wahl des Baumaterials und Baugrundes—Bau von Kwing Irangs Haus—Hilfeleistung seitens der Dorfgenossen und fremden Stämme—Zeremonien bei der Aufrichtung der Pfähle Konstruktion des Gerüstes, des Fussbodens und Dachs—Innere Einteilung—Ausstattung der Galerie (ăwă) und des Wohngemachs (amin)—Äusserer Hausschmuck—Herstellung von Schindeln—Opferzeremonien bei der Dachdeckung -Verbotsbestimmungen für ein unvollendetes Haus—Feierlicher Einzug ins neue Haus—Entzündung des ersten Herdfeuers—Kopfjagdzeremonien—Opferung und Schlussfeier—Hausbau bei den Freien—Bau von Scheunen.
Die Bahau- und Kĕnjastämme bewohnen im allgemeinen langgestreckte auf Pfählen ruhende Häuser, welche aus zahlreichen, aneinander gebautem Familienwohnungen bestehen. In der Regel besitzt jeder Stamm ein einziges Haus; wenn die Geländeverhältnisse es jedoch erfordern, werden mehrere gebaut. Die Häuser werden, ausschliesslich zum Schutz gegen Feinde, hoch über dem Erdboden errichtet. Nur wenn ein Stamm ein, Überschwemmungen ausgesetztes Grundstück bewohnt, dient diese Bauart auch zum Schutz gegen Wassergefahr, doch bauen die Dajak am Kapuas, oberen Mahakam und oberen Bulungan auf solch einem Gelände nur Hütten, nie grosse Dorfhäuser. Auch auf hohen Hügeln stehen die Häuser in gleicher Höhe über der Erde. Da diese Stämme ihre Wohnungen nicht mit Palisaden umgeben, bildet diese Bauart ihr einziges Verteidigungsmittel; indem sie nämlich die Treppen, die von der Erde ins Haus führen, heraufziehen, erschweren sie dem Feinde den Zugang; ausserdem verteidigen sie sich vom Hause aus wie von einer Festung.
Bei den verschiedenen dajakischen Stämmen finden sich drei verschiedene Baustile, für welche die Häuser der Kajan am Mahakam, der Long-Glat und der ’Ma-Tuwān in Long Dĕho als Beispiele dienen mögen. Die verbreitetste dieser Bauarten ist die der Kajan; man trifft sie bei den Pnihing, ’Ma-Suling, Pagong, Kĕnja und einigen anderen kleinen Stämmen an.

Altes Haus des Long-Glathäuptlings in Batu Sala.
[148]
Ein Kajanhaus setzt sich aus einer Reihe von Einzelhäusern oder -Wohnungen zusammen, die je einer Familie oder Sippe gehören (Siehe Taf. 48, T. I). Jede Wohnung ist etwa 8 m breit, 12–14 m tief und 8 m hoch und ruht auf 1–5 m langen Pfählen. Das hohe Dach trägt einen geraden, der Wohnungsbreite parallelen First und ragt vor und hinter den Wohnungen ungefähr ½ m über den Fussboden hinaus. An der hinteren Hausseite sind Dach und Fussboden durch eine völlig geschlossene, etwa 3 m hohe Wand verbunden; an der Vorderseite befindet sich eine gleich hohe, aber gitterförmig offene Wand. Die Wohnungen werden durch etwa 3 m hohe Seitenwände geschieden. Zwischen dem vorderen Teil des Hauses, der als Galerie (ăwă) dient und dem hinteren, den die Familie als Wohn- und Schlafraum (amin) benützt, befindet sich eine 3–4 m hohe Wand. Die Wohnungen sind derart aneinander gebaut, dass ihre Dielen, Mittelwände und Dächer in ihren gegenseitigen Verlängerungen liegen, wodurch eine lange Reihe von Familienhäusern unter gemeinschaftlichem Dach zustande kommt, deren vordere Hälfte aus einer durchlaufenden Galerie und deren hintere Hälfte aus gesonderten Wohngemächern besteht. Galerie und Wohngemach sind durch eine Tür in der Mittelwand miteinander verbunden.
Wenn möglich, bauen Bahau und Kĕnja ihre Häuser aus Holz, ist dies nicht in genügender Menge vorhanden, so werden auch Bambus und Palmblätter verwendet. Die Gesamtlänge eines Dorfhauses ist sehr verschieden und hängt hauptsächlich von der Anzahl Familien ab, die es bewohnen. Das Haus in Tandjong Karang war etwa 150 m lang, das in Tandjong Kuda dagegen 250 m (T. I Taf. 2) Die Kajan am Blu-u bauten wegen der kleinen Oberfläche des Hügelrückens, auf dem sie sich niederliessen, vor und neben einander und in verschiedener Höhe 4 getrennte, 100 bis 150 m lange Häuser (T. I Taf. 48). Die Wohnungen der Häuptlinge, Freien und Sklaven sind ungefähr auf die gleiche Weise eingerichtet. Äusserlich ist nur die des Häuptlings von den übrigen zu unterscheiden, sie ist in der Regel breiter und .tiefer als die der anderen Familien, und da ihr Dach die gleiche Neigung hat, liegt es etwas höher als die anderen Dächer und unterbricht die lange gerade Linie des Firstes, der sich über die ganze Häuserreihe erstreckt (T. I Taf. 2 u. 48). Das Häuptlingshaus zeichnet sich ferner durch die grössere Tiefe seiner Galerie aus, die daher vorspringt. Sie wird als Versammlungsraum [149] und Gastgemach benützt. Da, wo mehrere Häuptlinge in einem Stamme wohnen, wie bei den Pnihing und Ma-Suling, überragen alle Dächer der Häuptlingswohnungen das gemeinschaftliche Dach und zwar im Verhältnis zum Rang der betreffenden Häuptlinge (T. I. Taf. 46). Je 10–15 Wohnungen besitzen eine gemeinsame Treppe, die aus einem mit Einkerbungen versehenen Baumstamm besteht. Diese Art Häuser besitzt ursprünglich keine offene Plattform an der Vorderseite, wie die Häuser der Ot-Danum, Batang-Lupar, Kantu etc. Nur bauen sich einzelne Familien für den Privatgebrauch hinter der eigenen Wohnung eine kleine Plattform aus Bambus (Taf. 14 u. rechts Taf. 85).
Der Stamm der Long-Glat hat eine andere Bauart (Taf. 22). Auf gleicher Höhe mit den Wohnungen befindet sich keine gemeinsame Galerie, sondern jedes Familiengemach nimmt die ganze Tiefe des Raums unter dein Dache ein. Man gelangt in die Wohnungen von unten durch Öffnungen in der Diele. Die einzelnen Räume, die etwas grösser sind als diejenigen der Kajan, werden durch Türen in den Seitenwänden miteinander verbunden.
Ungefähr dem gleichen Zweck wie die Galerie in einem Kajanhause dient hier ein zweiter Fussboden, der etwas oberhalb des Erdbodens zwischen den Pfählen des Hauses gebaut wird. Diese Diele dient erstens als Weg durch die Niederlassung, zweitens zur Verrichtung- aller Arbeit, für die das Wohngemach zu klein ist, z.B. zum Reisstampfen, zum Flechten grosser, grober Matten, zum Präparieren von Rotang u.s.w., ausserdem befinden sich hier die Verschläge für die Schweine.

Häuser der Ma-Tuwan.
Die heitere Geselligkeit, die in der Galerie der Kajan durch das Zusammenleben der Familien herrscht, findet man jedoch nicht bei den Long-Glat. Für Versammlungen besitzen die Männer nur die ăwă der Häuptlinge. Diese wohnen nicht, wie die Häuptlinge der Kajan und anderer Stämme, in gleicher Reihe mit ihren Dorfgenossen, sondern stets in besonderen Häusern, meist in der Mitte der Niederlassung. Diese Häuser unterscheiden sich von denen der übrigen Bewohner nur durch eine an der Vorderseite angebaute Galerie oder Veranda, die dadurch zustande kommt, dass man die vordere Hauswand nach unten, die unter dem Hause befindliche Diele nach vorne fortsetzt und die eine Hälfte des Daches nach vorn, bis auf eine Höhe von 1 m über der Diele verlängert. Das Dach wird an allen Seiten durch Wände gestützt. Der so entstandene geschlossene Raum wird wie die [150] offene Galerie der Kajan ăwă genannt und dient ebenfalls als Gastund Versammlungsraum. Der Eingang zur ăwă befindet sich unterhalb der amin. Von dieser aus kann man zwar in die ăwă hinuntersehen aber nicht umgekehrt, auch sind beide Räume nicht durch eine Treppe verbunden.
Derartige Häuser im Long-Glat-Stil sieht man auch vielfach unterhalb der Wasserfälle am mittleren Mahakam, u.a. in Long Howong. Hier sind die verschiedenen Häuserreihen so in Quadratform aneinander gebaut, dass man unterhalb der Wohnungen, auf dem zweiten Fussboden, die ganze Niederlassung passieren kann, ohne dass man, wie an anderen Orten, Bretterstege von der einen Reihe zur anderen benützen muss.
Von der dritten dajakischen Bauart kann man sich am besten nach dem auf Tafel 23 (oben) abgebildeten Hause der ’Ma-Tuwān in Long Dĕho eine Vorstellung machen. Diese Häuser gleichen in vieler Hinsicht denen der Long-Glat-Häuptlinge, nur besitzt hier jede Familie eine derartige Wohnung, und da die Seitenwände der ăwă hier fehlen, bildet diese eine Galerie, die an der Vorderseite des Hauses längs der ganzen Reihe Wohnungen durchläuft und mit diesen, zum Unterschied von der ăwă der Long-Glat, durch Treppen in Verbindung steht. In dieser ăwă spielt sich das Tagesleben der Bewohner ab, ganz wie in den Galerien der Kajan. Diese Stämme benützen auch Plattformen, die sie aus Bambus in einem geringen Abstand vom Hause bauen. Auf ihnen werden Reis und andere Viktualien, ausserhalb des Bereiches von Schweinen und Hunden, getrocknet.

Herstellung von Schindeln.
Die verschiedenen Stämme halten sich, wie an ihre besonderen Sitten, so auch an ihren eigenen Baustil. Daher findet man in Niederlassungen, die von mehreren Stämmen bewohnt werden, die erwähnten drei Bauarten neben einander, so z.B. in Lulu Njiwong. Die beiden ersten Bauarten sieht man in Batu Sala und in Long Tĕpai. In Long Dĕho stehen nebeneinander Häuser der zweiten und dritten Form, während in geringem Abstand von diesen die Uma-Wak in einem Hause nach dem ersten Stil wohnen.
Vergleicht man diese Arten von Häusern mit denen vieler Stämme am Barito, die mit festen Palisaden und Standplätzen für Krieger versehen sind, so erscheint es zweifellos, dass sie mehr dem friedsamen Leben von Ackerbauern als dem kampflustiger Kriegerstämme angepasst sind. In Apu Kajan, wo die Bewohner mutiger sind und ausserhalb [151] der Dörfer zu kämpfen pflegen, standen die Häuser von drei Stämmen, die ich besuchte, nur 1 m über der Erde und waren daher als Festung nicht zu gebrauchen. Wahrscheinlich haben die Bahau erst, nachdem sie aus ihrem Stammland zum Mahakam gezogen waren, hohe Häuser zu bauen angefangen. Dass sie auch beim Häuserbau fremde Gewohnheiten annehmen, beobachtete ich beim Pnihing-Häupthng Bĕlarè, der nach Art der englischen Niederlassungen in Sĕrawak eine “kubu”, ein kleines Gebäude aus Eisenholz, das als Festung benützt werden konnte, vor sein grosses Haus gebaut hatte (Taf. 46 T. I); auch hatte er, wie die Baritostämme, Palisaden zu errichten angefangen, diese jedoch nicht beendet. In Udju Halang waren die Palisaden wenigstens an der Vorderseite vollständig ausgeführt und mit Bastionen versehen worden.
Dass auch die Sitte, gemeinsam in langen Häusern zu wohnen, mehr durch die Verhältnisse als durch den Volkscharakter bedingt wird, geht daraus hervor, dass die Bahau, wenn die Umstände es erfordern oder erlauben, auch getrennt wohnen. Die Familien der Bahau und Kĕnja besitzen nämlich nicht nur ein gemeinsames langes Haus in der eigentlichen Niederlassung, sondern auch noch mehr oder weniger grosse Einzelhäuser auf ihren Reisfeldern. Liegen diese nicht in der Nähe des Dorfes, so wohnen die Familien wenigstens in der drückendsten Arbeitszeit in diesen lĕpo luma (= Reisfeldhaus); befinden sich die Felder jedoch in weiter Entfernung, so bleiben die Besitzer während der ganzen Reisbauperiode in dem Ladanghäuschen wohnen. Die Ma-Suling, die nicht am Hauptstrom, sondern am Mĕrasè leben, hatten in späterer Zeit so wenig von Feinden zu leiden gehabt, dass ihre Familien nicht nur während des Reisbaus, sondern auch während des übrigen Teils des Jahres auf dem Felde wohnen blieben, sich in der eigentlichen Niederlassung kaum noch zeigten und ihre Wohnungen dort verfallen liessen. Ich hörte die Häuptlinge öfters darüber klagen, dass der Verband zwischen den Dorfbewohnern, somit die Kraft des Stammes, dadurch schwer geschädigt würde.
Als ich im Jahre 1896 die Kajan am Mahakam zum ersten Mal besuchte, herrschten hier die gleichen Zustände wie bei den Ma-Suling, aber aus umgekehrten Gründen. Die Batang-Lupar hatten 1885 das gemeinsame Haus der Kajan verbrannt, worauf diese, in ständiger Angst vor einem neuen Einfall ihrer Feinde, sich an den Oberlauf [152] des Blu-u zurückzogen und in kleine Häuser auf den Reisfeldern verteilten. So boten sie dem Feinde keinen Angriffspunkt und waren imstande, einander rechtzeitig vor einer drohenden Gefahr zu warnen. In einer stockdunklen Nacht mit Sturm und heftigen Regengüssen erlebte ich einst selbst eine derartige Alarmierung. Aus weiter Ferne drangen Gongschläge zu uns, die in grösserer Nähe und verschiedener Richtung wiederholt wurden. Sogleich war alles in Kwing Irangs Hause, neben dem meine Hütte stand, in heller Aufregung. Die jungen Männer legten ihr Kriegskostüm an und uns wurde ge meldet, eine Bande ajo̱, Kopfjäger, sei im Anzuge, worauf wir unser Licht auslöschten und unsere Gewehre zur Hand nahmen. Als der Sturm sich etwas gelegt hatte, und man die Töne besser unter schied, stellte es sich heraus, dass es kein ajo̱-Signal bedeutete, sondern dass man die Gonge zur Vertreibung der Sturmgeister geschlagen hatte.

Das vollendete Haus von Kwing Irang.
Nachdem von den Batang-Lupar keine Gefahr mehr drohte, wandte Kwing Irang alle Mühe an, um wenigstens einen Teil der Bevölkerung dazu zu bewegen, ein gemeinsames Haus am Mahakam zu beziehen, und noch im Jahre 1900 wurden einige Familien ersucht, sich mit den übrigen zu vereinigen. Die Furcht, der Stammesverband könnte sich lösen, bildete für Kwing Irang und die Seinen den Hauptbeweggrund, um den Bau des langen Hauses zu beschleunigen. Die Gleichgültigkeit der Kajan in Bezug auf das Zusammenwohnen erschien mir unbegreiflich, wenn ich an die wichtige Rolle dachte, welche der Häuptling und sein Haus im Stammesleben spielen.
Die Gründe, welche einen Stamm dazu bewegen, einen bestimmten Platz zum Bau seines Hauses zu wählen, sind sehr verschieden; auch die Dauer seines Aufenthaltes in einem Hause hängt von äusseren Umständen ab. Bei der Wahl eines geeigneten Bauplatzes ist man natürlich an die Grösse und Beschaffenheit des Geländes gebunden. Für eine grössere Niederlassung ist am oberen Mahakam ein geeigneter Boden sehr schwer zu finden, weil das Gebirgsland keine ebenen Flächen besitzt. Ferner müssen in der Nähe Ackergründe, die Jahre lang brach gelegen haben und wieder mit Wald bestanden sind, vorhanden sein. Auch müssen die Vorzeichen entscheiden, ob ein Gelände günstig ist, und beim Beginn des Baus darf kein schlechtes Omen vorkommen, weswegen es bisweilen sehr lange dauert, bevor man sich durch alle Schwierigkeiten hindurch gerungen hat. [153]
In Anbetracht, dass der Bau einer Niederlassung sehr zeitraubend ist, kann er nur dann begonnen werden, wenn eine reiche Ernte einen zeitweiligen Überfluss bewirkt hat. Kommen Missernten, Krankheiten und andere Hindernisse vor, so kann es Jahre dauern, bevor die Häuser völlig hergestellt sind. Trotz aller mit dem Bau verknüpften Schwierigkeiten werden sie oft nur sehr kurze Zeit bewohnt.
Die Erschöpfung der umliegenden Ackergründe zwingt einen Stamm zwar erst nach Jahren zum Umzug, doch findet dieser oft schon lange vorher aus ernsteren Ursachen statt. Treten nämlich Krankheiten auf, die aussergewöhnlich lange dauern und eine grosse Sterblichkeit verursachen, so entschliessen sich die Bewohner leicht zum Verlassen des Hauses, um den Geistern der Umgebung, welche die Krankheiten erzeugten, zu entgehen. In ernsten Fällen sucht sich ein Stamm bereits nach 3 Jahren einen neuen Wohnplatz. Ich selbst erlebte, dass die Pnihing am Long Pakatè ihr grosses, starkes Haus 1897–1898 beendeten und bereits im folgenden Jahre provisorische Hütten weiter unten am Tjĕhan bezogen, um dort Material für den Bau eines neuen Hauses an der Mündung dieses Flusses zu suchen. Häufige Krankheits- und Todesfälle hatten hierzu die Veranlassung gegeben. Zu gleicher Zeit vollendeten die Pnihing von Long ’Kub ihr Haus, das sie ganz aus neuem Material aufgebaut hatten, zogen aber bereits 1901 nach einem Ort oberhalb der Kasomündung.
Die Wahl und Bearbeitung der erforderlichen Pfähle, Planken und Dachbedeckung gehört zum beschwerlichsten Teil des Hausbaus; man benutzt zwar so viel als möglich altes Material, aber dies ist meistens nach mehrjährigem Gebrauch nicht mehr verwendbar. Dieser ständige Wohnungswechsel beeinträchtigt die Arbeit der Dorfbewohner in hohem Grade, 60-jährige Leute haben in ihrem Leben 10 bis 12 Häuser erbauen helfen. Wo die Verhältnisse es erlauben, bauen Bahau und Kĕnja ihre Häuser vollständig aus Holz, das ineinander gefügt und mit Rotang gebunden wird. Daher findet man auch am oberen Mahakam, wo der Wald gross und die Bevölkerung relativ gering ist, ausschliesslich Holzhäuser; nur Plattformen und provisorische Gebäude werden bisweilen aus Bambus hergestellt. Anders verhält es sich in Gebieten, wie die am oberen Kajan, in denen seit Jahren eine dichte Bevölkerung lebt; dort werden wegen Holzmangels für die Dachbedeckung und die Wände grosse Baumblätter benützt, die auf bestimmte Weise aneinander gereiht und in Form von Matten [154] zusammengefügt werden. Palmblätter sah ich als Dachbedeckung nur für zeitweilige Hütten auf Reisen gebrauchen.
Wird ein Haus nicht von Feinden niedergebrannt, so benützt der Stamm, wie gesagt, die Eisenholzpfähle und Planken des alten Gebäudes für das neue, da diese ein Menschenalter überdauern können. Für das Gerüst verwenden sowohl Bahau als Kĕnja nie Bambus sondern stets Holz als Material.
Obgleich in der Konstruktion und in der Verteilung der Räume eines langen Hauses Unterschiede bestehen, ist die Einrichtung einer Familienwohnung doch überall ungefähr gleich. Da ich Gelegenheit hatte, die Kajan am Mahakam beim Bau ihrer Niederlassung zu beobachten, lasse ich hier eine Beschreibung desselben und der mit ihm verbundenen Gebräuche folgen. Besonders die mit dem Bau der Häuptlingswohnung zusammenhängenden Zeremonien werden dem Leser eine lebhafte Vor. Stellung von den zahlreichen Beschränkungen geben, durch welche die adat das ökonomische Leben der Bewohner Borneos beeinträchtigt.
Bevor die Kajan an den Hausbau gingen, suchten sie sich auf dem Grundstück, das für die neue Niederlassung gewählt worden war, einen Platz für ihre Privatwohnung aus. Jede Familie ist nämlich für den Bau ihres eigenen Hauses verantwortlich. Sie wählt sich stets Verwandte oder Freunde als Hausnachbarn aus, so dass z.B. in den verschiedenen langen Häusern des Dorfes ebensoviele durch Familien- oder Freundschaftsbande verbundene Gruppen wohnten.
Bei der Wahl des Platzes muss jedoch darauf geachtet werden, sass das Häuptlingshaus in der Mitte zu stehen kommt und zu beiden Seiten genügender Raum für die Wohnungen der Sklaven übrig bleibt, die rechts und links vom Häuptling bauen müssen. Die Form ihrer Wohnungen unterscheidet sich jedoch nicht von der der Freien.
Da das alte Kajanhaus verbrannt war, musste alles Material neu beschafft werden, und ich hatte bereits im Jahre 1896 Eisenholzpfähle im Blu-u liegen sehen, die später verwendet werden sollten.
Für die Pfähle und die Dachbedeckung der Häuptlingswohnung wird so viel als möglich Eisenholz benützt. Die langen, geraden Stämme der Tengkawangbäume dienen hauptsächlich als Dachsparren und Dielenbalken. Den Freien und Sklaven ist ausdrücklich verboten, Verzierungen aus Eisenholz und Dielenbalken aus Tenkawang, oder, wie die Kajan sagen, Kawang-Holz herzustellen; dagegen ist ihnen gestattet, Tengkawang-Holz zu Schindeln zu verwenden. [155]
Beim Sammeln des Materials müssen allerhand Vorschriften befolgt werden. Zur Zeit des Vollmonds darf nie etwas Wichtiges unternommen, also auch kein Haus gebaut werden, da es sonst verbrennen würde. Das Suchen von passenden Bäumen und deren Bearbeitung zu Pfählen, Brettern oder Schindeln erfordert eine genaue Beachtung der Zeichen des tsit, tĕlandjang, kidjang, u.s.w. Ausserdem muss, je nach dem Zweck, den man mit dem Holz im Auge hat, besonderen Vorschriften nachgekommen werden. So dürfen z.B. aus einem Baum, auf dem viele Epiphyten, wie Orchideen, wachsen oder auf dem viele Ameisen umherlaufen, keine Schindeln verfertigt werden, wenn man nicht Epiphyten und Ameisen auch auf dem neuen Dache sehen will. Auch wenn ein kleiner Baum gegen einen grossen wächst oder wenn ein Baum rechtwinklig gegen den Ast eines benachbarten Baumes anstösst, ist er für Schindeln ungeeignet. Dielenbretter, die während des Transports, der fast immer zu Wasser geschieht, nass wurden, dürfen nicht mehr benützt werden.
In Bezug auf die Herstellung von Pfählen sind die Bestimmungen weniger zahlreich. Beim Fällen muss ein Baum vollständig seitwärts niederfallen; er darf dagegen nicht vom Stumpf abgleiten und dann stehen bleiben, wie es im dichten Walde leicht vorkommen kann. Ein solcher Baum darf weder für Häuser noch Böte noch andere Zwecke verwendet werden.
Jeder Bahau und Kĕnja hat das Recht, in den Wäldern innerhalb des Gebietes seines Stammes nach Belieben Bäume zu fällen; nur die grossen Tengkawangbäume, die in fruchtreichen Jahren einen ganzen Stamm mit Fett versorgen, werden meist geschont. Hat jemand einen Baum gefunden, der ihm zum Bau seines Hauses oder Boots geeignet scheint, so bezeichnet er denselben als sein Eigentum, indem er eine zwei Faden lange Stange in die Erde steckt und an den Stamm lehnt.
Sobald das Material zum Hausbau in genügender Menge zusammengebracht worden ist, wird eine Versammlung berufen, welche eine passende Zeit zum Beginn der Arbeit zu wählen hat. In der Regel fängt man mit dieser nach der Reissaat an, und wenn gute Erntejahre vorangegangen sind, da die Feldarbeit dann viel Zeit übrig lässt und Nahrungsmittel reichlich vorrätig sind. Ein Hausbau ist eine Angelegenheit des ganzen Stammes, indem jede Familie eicht nur für ihre eigene Wohnung zu sorgen hat, sondern sich auch am Bau des Häuptlingshauses beteiligen muss. [156]
Sobald ein Grundstück gewählt worden ist, zieht der Häuptling mit den Oberhäuptern der Familien aus, um den Wald an der betreffenden Stelle zu fällen. Diese Arbeit bedeutet jedoch noch nicht den definitiven Anfang des Baus. Durch ungünstige Umstände gezwungen liessen die Kajan z.B. den Wald auf dem als Bauplatz gewählten Bergrücken an der Blu-u Mündung drei Mal wieder heranwachsen, nachdem sie ihn ebensoviele Mal gefällt hatten. Erst dann wagten sie es, sich dort endgültig ans Werk zu machen. Vor dem Beginn des Baus ziehen die meisten Familien, die dem Häuptling helfen und auch ihr eigenes Haus schnell errichten wollen, nach dem Bauplatz und stellen dort ein provisorisches Haus her, nach Art der lĕpo luma, aus altem Material (Siehe die kleinen Häuser auf Taf. 48 T. I).
Handelt es sich um den Bau einer neuen Niederlassung, so muss der Häuptling vor dem Anfang des eigentlichen Baus ajo̱, d.h. die Geister in günstige Stimmung versetzen, indem er mit einem Menschenschädel eine bestimmte Zeremonie ausführt. Gegenwärtig wird dabei ein alter, von einem benachbarten Stamme geliehener Schädel benützt, wie es auch jetzt noch beim Ablegen der Trauer (be̥t lāli lumu) gebräuchlich ist. Diese Sitte deutet wahrscheinlich darauf hin, dass der Hausbau früher mit der Opferung eines Menschen eingeleitet wurde. Der Häuptling verrichtet diese Zeremonie für den ganzen Stamm.
Sowohl bei den Kajan als bei den anderen Stämmen ist es sehr gebräuchlich, dass die Dorfgenossen einander beim Hausbau Beistand leisten. Die gegenseitige Unterstützung wird mit pala-dow bezeichnet; den gleichen Namen tragen auch die Gehilfen. Die Familien beteiligen sich nicht nur am Bau des Häuptlingshauses, sondern sie versichern sich, auch wenn es den Bau des eigenen Hauses gilt, der Mitwirkung einer so grossen Anzahl von Männern, dass am gleichen Tage die alte Wohnung niedergerissen und die neue unter Dach gebracht wird. Wer an eine derartige Arbeitsweise nicht gewöhnt ist, staunt über die Leistungen, die auf diese Weise in einem Tage ausgeführt werden. Die weitere Bearbeitung findet später mit Hilfe einer kleineren Leutezahl statt. Besteht eine Familie aus nur wenigen Gliedern und nimmt deren täglicher Unterhalt fast alle Zeit in Anspruch, so dauert es Monate, bisweilen auch Jahre, bevor ihr Haus ganz fertig dasteht.
Obwohl beim Bau eines so grossen Hauses wie das von Kwing [157] Irang von einer schnellen Vollendung keine Rede sein konnte, wurde die Arbeit doch nach dem gleichen Prinzip vorgenommen. An bestimmten Tagen kam eine grosse Anzahl Männer zusammen, um eine bestimmte Arbeit auszuführen; nötigenfalls stellten sie sich auch noch am folgenden Tage ein, aber dann verging wieder eine lange Zeit, bevor sie fortfuhren. Sie mussten dazwischen neues Material sammeln oder sie hatten andere Dinge zu tun. Auch seine Sklaven liess der Häuptling nicht ständig arbeiten, obgleich sie immerhin durch Sie Herstellung von Brettern und Verzierungen mehr zu tun hatten als die übrigen Familien, die nur einen bestimmten Anteil zu liefern hatten.
Der Familie, die bauen lässt, fällt die Beköstigung ihrer pala-dow zu. Da beim Bau eines gewöhnlichen Hauses etwa 40 Mann mithelfen, bedeutet deren Ernährung eine grosse Last für die betreffenden. Dazu verursacht später die sorgfältige Bearbeitung des Hauses neue Kosten. Wenn sich der ganze Stamm am Bau des Häuptlingshauses beteiligt, müssen zur Beköstigung der Hilfskräfte mehrere Scheunen mit Reis geopfert werden. Die weiblichen Familienglieder und einige Sklavinnen sind bereits mehrere Tage vor Begin des Hausbaus mit dem Stampfen des Reises und die Männer mit dem Fang von Fischen als Zuspeise beschäftigt. Bisweilen wird auch zu diesem Zwecke eine tuba-Fischerei in einem Bache veranstaltet. Die reichen, aus zahlreichen Gliedern bestehenden Familien unterstützen den Häuptling bei derartigen Gelegenheiten mit Reis und anderen Artikeln.
Wird für einen vornehmen Häuptling, wie Kwing Irang, ein Haus gebaut, so kann dieser auch auf die Mitwirkung der benachbarten Stämme rechnen. Da alle Häuptlinge der Bahau am oberen Mahakam verwandt sind, hätte man ihre Unterstützung als eine Ehrenbezeigung ansehen können, die sie dem ältesten Familienglied, Kwing Irang, bewiesen. Es scheint jedoch, dass es sich hier eher um einen pflichtgemässen Beistand handelt; denn die Niederlassung Lulu Njiwung, deren junger unbedeutender Häuptling Ding Ngow an Vornehmheit der Geburt Kwing Irang übertraf, weil er in gerader Linie von einem männlichen Häuptling der alten Long-Glat abstammte, Kwing dagegen in weiblicher Linie, durch seine Mutter, steuerte keinen Pfahl zum Hause bei, wie die Pnihing, Ma-Suling und Long-Glat von Long-Tĕpai es taten.
Zuerst mussten alle Pfähle, auf welchen Kwing Irangs Haus ruhen [158] sollte, vom Fluss aus den 30 m hohen Hügelrücken hinaufgeschafft werden (Siehe Taf. 48 T. I). Hierzu wurde ein 5–7 cm dicker Rotang durch das Loch gezogen, das bereits im Walde in das obere Ende der schweren Balken gebohrt worden war. An diesem Kabel zogen 20–30 Mann einen Pfahl den Hügel hinauf, während andere ihn an der Spitze durch, untergeschobenen Rotang hoben oder ihn über Rollen gleiten liessen.

Opferszene.
Zu dieser Arbeit wurden die jungen Leute hauptsächlich abends, wenn sie von der Feldarbeit heimkehrten, zusammengerufen. Ausser den grossen Pfählen hätte man auch kleinere; die für Gerüste und Hilfstreppen verwendet werden sollten, aus dem Walde herbeigeschafft; überdies auch grosse Mengen verschiedener Rotangarten: dünne, zähe Sorten zum Aneinanderbinden der verschiedenen Holzteile, schwere, bis 7 cm dicke Arten als Kabel zur Aufrichtung der Pfähle.
Nachdem die Kajan einige Tage lang Klebreis gestampft; in samit-Blätter gewickelt und gekocht, Fische gefangen und in grossen Pfannen mit Wasser zubereitet hatten, kamen sie eines Abends zusammen, um mit. Hilfe von Rotangstücken den Platz zu messen, auf dem das Haus stehen sollte, und die Stellen anzugeben, wo die Pfähle eingerammt werden sollten (Siehe T. I Pag. 387).
Der erste Tag, an dem die Gruben gegraben und der erste Pfahl aufgerichtet wurde, bedeutete einen Festtag für den ganzen Stamm. Die grössten und schwersten Pfähle wurden mit Hilfe sämtlicher Männer, auch der Frauen und Kinder, hinaufgezogen: besondere Anstrengung verursachte die Aufrichtung der grossen, mit Schnitzwerk verzierten Pfähle.
Der schwerste Pfahl war 10 m lang; hatte einen Umfang von 1.80 m und bestand aus Eisenholz, dessen sp. Gewicht 1,3 beträgt. Im Ganzen wurden 10 solcher Pfähle für das Haus verwendet.
Die Kajan waren übereingekommen, den Hauptpfahl nachts aufzurichten, weil eventuelle schlechte Vorzeichen dann nicht gesehen werden konnten. Wir hatten daher, mit Rücksicht auf die Zeremonien, welche interessant zu werden versprachen, Vorbereitungen für eine Blitzlichtaufnahme getroffen; aber nach Mitternacht begann es so stark zu regnen, dass die schweren Gonge erst bei Tagesanbruch die Leute zum gewichtiges Werk herbeiriefen. Bald waren 150 Männer beisammen, die alle damit begannen, aus armdicken Stämmen von hartem Holz lange Schaufeln zu schneiden, mit denen sie die Erde ausgruben; [159] oder sie spalteten einen langen, dicken Bambus an dem einen Ende, bogen die Streifen wie einen Trichter auseinander, umflochten diese zur Befestigung mit Rotang und schafften so die lockere Erde herauf, indem sie das becherförmige Ende in den Boden stiessen und gefüllt wieder nach oben zogen. Auf diese Weise wurden für sämtliche Pfähle Löcher gegraben; für die längsten und schwersten Pfähle betrug die Tiefe der Gruben 2 m, für die kürzeren und dünneren 1 m. In der Richtung, in welcher der Hauptpfahl in die Grube gleiten sollte, wurde eine Rinne gegraben und ihr gegenüber, an die senkrechte Wand der Grube, ein Brett gestellt, so dass auch ein sehr schwerer Pfahl nicht in die Erde dringen, sondern an der Gleitfläche abwärts sinken konnte.
Die Erde auf dem Bauplatz war gelbbraun und in einer Tiefe von ½ m mit kleinen, verwitterten Steinen gemischt, die sich 1½ m tiefer als roter Jaspis erwiesen. Augenscheinlich bestand dieser lange Hügelrücken aus alten Kiesablagerungen des Flusses.
Die grösste Feierlichkeit fand nicht beim Haupt-, sondern beim Mittelpfahl statt, obgleich gerade dieser zu den kleineren Exemplaren gehörte. Nachdem der Pfahl aufgerichtet worden war, führte man den alten halb blinden Oberpriester Bo Jok zu ihm. Der Greis wandte sich den Geistern, welche diesen Ort bewohnten, hauptsächlich denen auf dem dicht daneben stehenden Andesitkegel Batu Kasian zu und erzählte ihnen, dass der Kajanstamm hier eine Niederlassung bauen wolle und sie um ihren Segen bitte. Dabei opferte er den Geistern ein Küchlein und ein Ei und steckte Eisen in Form einiger Nägel und zwei gelbe und zwei blaue alte Perlen als Opfergabe in die Erde. Das Küchlein und das Ei klemmte er in ein gespaltenes Stück Bambus und stellte dieses neben den Pfahl, während er auf der anderen Seite, zur Abwehr böser Geister, Blätter von daun long (Aroïdeae sp.) an den Pfahl band (Siehe Taf. 25 in der Mitte).
Darauf steckte er neben dem Pfahl mit Holzspiralen verzierte Haken im Kreise in die Erde, um auch den Segen der Erdgeister dem künftigen Gebäude zuzuführen. Auch den Luftgeistern opferte er, indem er nach allen Richtungen Reis in die Luft warf; doch war seine Ansprache wegen der heftigen Schläge auf die Gonge nicht zu verstehen. Die nebenstehende Tafel giebt die Schlussszene dieser Feierlichkeit wieder. In der Mitte steht der Hauptpfahl, an dem rechts der lange Stock mit dem Ei, vorn die schutzbringenden Blätter zu sehen [160] sind. Die eine Hand auf den Pfahl gestützt steht der alte Bo Jok da; seine Ohren schmücken zur Feier des Tages Tigerzähne. Rechts vom Priester stehen die beiden vornehmsten Frauen des Stammes, Bo Hiāng, Kwing Irangs älteste Frau, und deren Nichte Lirong (auf dem Eisenholzbrett). Um ihre Seele, die sich wie sie selbst vor den vielen aufgerufenen Geistern fürchtet, am Entfliehen zu verhindern, hat Bo Hiāng sich ein Stück weissen Kattuns aufs Haupt gelegt, während Lirong auf das ihre mit beiden Händen ein hübsches buntes Tuch drückt. Dass auch Bo Jok voller Angst war, merkte man daran, dass er ein altes Schwert und ein weisses Zeugstück in der Hand hielt und nach beendeter Feier aufs Haupt legte. Links hinter Bo Jok sitzt auf einem grossen Pfahl aus Eisenholz ein Kajan und schlägt auf einen Gong, den er auf den Knieen hält. Die übrigen Personen sind Arbeiter und Knaben.

Aufrichtung des Hauptpfahls von Kwing Irangs Haus.
Nach beendeter Feier verteilten sich die Kajan in Gruppen, die gesondert Pfähle in die Erde setzten und feststampften. Da die Leitung hierbei nicht in den Händen einiger Hauptpersonen lag, sondern jeder seine Meinung äussern zu dürfen oder zu müssen glaubte, herrschte auf dem Platze grosse Konfusion und Geschrei. Hauptsächlich war dies beim Transport der schwersten Pfähle der Fall, die zum Teil noch ihren Gruben gegenüber in die richtige Lage gebracht werden mussten. Dessenungeachtet schritt die Arbeit gut vorwärts. Die kleinen Pfähle wurden mit den Händen aufgerichtet und in die Gruben gestellt, für die grösseren benützte man, um sie beim Heben lenken zu können, hölzerne Gabeln.
Gegen 9 Uhr morgens gingen die Kajan an die Aufrichtung der grossen, mit Bildhauerarbeit verzierten Pfähle aus Eisenholz, welche die Vorgalerie stützen sollten. Diese ungefähr 3500 kg schweren Säulen konnten von den Leuten nicht ohne Hilfsmittel aufgerichtet werden, weil sie mit ihrer Spitze so hoch gehoben werden mussten, dass ihr unteres Ende in die Grube gleiten konnte. Zu diesem Zwecke gebrauchten die Kajan dicke Rotangkabel, die am oberen Ende des Pfahls in einer Höhe von 7 m befestigt und über einen vor der Grube errichteten Galgen geleitet wurden; sie boten mehr als 50 Menschen Gelegenheit zum Ziehen. Auf Tafel 26 sieht man in der Mitte des Vordergrundes den verstärkten Galgen, der für solch einen Pfahl gebaut, hier aber noch nicht benützt worden ist. Der Balken, über den die beiden Kabel laufen sollen, liegt auf den Spitzen von zwei gleichseitigen [161] Dreiecken, die aus geraden, jungen, mit Rotang aneinander gebundenen Stämmen bestehen. Diese Dreiecke werden zu beiden Seiten des Pfahls, der gehoben werden soll, errichtet und sind mit einander durch andere Quer- und Stützbalken verbunden und verstärkt. Oft werden diese Dreiecke auch an den bereits aufgerichteten kleineren Eisenholzpfählen befestigt. Das Bild stellt den Augenblick dar, wo eine grosse Anzahl Menschen (rechts) den grössten, mit schöner Bildhauerarbeit verzierten Pfahl (links im Hintergrunde) an Rotangkabeln in die Höhe zieht; einige Männer stehen und ziehen auch auf dem Gerüst selbst. Die grossen Pfähle tragen mächtige Kriegsmützen aus Rotang, welche mit nachgemachten Federn des Nashornvogels geschmückt sind. Alt und jung, Männer und Frauen ziehen an den Kabeln, wo nur ein Platz frei ist. Die beiden seitlichen Dreiecke sind so fest in den Boden gesetzt, dass sie nicht nur die vielen Männer tragen, sondern eventuell auch den Pfahl, falls er seitwärts ausweichen sollte, zurückhalten können.
Anfangs fiel die Zugrichtung zu stark in die des liegenden Pfahls, daher wurden an dessen oberem Ende ständig mehr Balken untergeschoben, bis der Pfahl durch eine stärkere Neigung in eine günstigere Lage gebracht wurde. Als der Pfahl beim Ziehen in die Rinne glitt, die von seinem unteren Ende in die Grube führte, fand er an der gegenüberstehenden Planke einen Stützpunkt.
Da auch bei dieser Arbeit eine Leitung fehlte und viele der ältesten und einflussreichsten Männer gleichzeitig ihre Meinung zum besten gaben, wurde nicht stets gleichmässig und im erforderlichen Moment gezogen. Jeder kleine Arbeitsfortschritt wurde anfangs durch Unterschieben von Holz gesichert, dann ging es immer schneller vorwärts; der Pfahl erhob sich höher und höher unter den ängstlichen Zurufen der zahlreichen, zuschauenden Mene, die einen Fall oder ein Aasweicher. des Balkens fürchtete. Dieser wurde übrigens von vielen Männern mit hölzernen Gabeln gestützt. Unter diesen Männern durfte keiner sein, der eine Frau verloren und daher den Zorn der Geister bereits empfunden hatte. Es dauerte eine Stunde, bevor der Pfahl, zur grossen Erleichterung der Zuschauer, mit einem Ruck in die Grube schoss. Fällt nämlich ein Pfahl, so darf er zum Bau überhaupt nicht mehr verwendet werden. Dieser Pfahl war aber besonders gross und schwer, hatte daher viel Mühe verursacht, bis er an Ort und Stelle geschafft war, ausserdem hatten die beiden talentvollsten jungen Holzschnitzer, [162] Sawang Jok und Imun, viel Zeit darauf verwendet, um das obere Balkenende mit einem schönen Relief zu verzieren. Aus einer Erhöhung am Stamm, von der ein dicker Ast ausgegangen war, hatten sie ein 1 dm hohes Relief eines Tierkörpers modelliert. Die übrigen Figuren waren 1–2 cm tief in den Stamm geschnitten (Taf. 27).
Der Priester Bo Jok hatte vor der Aufrichtung des Pfahls über der Grube den Erdgeistern ein Ferkel geopfert. Wie am mittleren Pfahl wurde auch hier eine Ansprache an die Geister gehalten, aber ausserdem verherrlichte man auch noch das Opfer und pries das kleine Ferkel als kostbares Schwein an. Darauf schnitt man dem Tier die Kehle durch und liess das Blut in die Grube fliessen; nur ein kleiner Teil wurde auf einem Bananenblatt aufgefangen, um damit alle übrigen Pfähle zu bestreichen. Als der Pfahl fest in der Grube stand, steckte man neben ihm einen Stock in die Erde, in dessen oberes, gespaltenes Ende das Ferkel eingeklemmt wurde. Hier blieb das Tier bis es verweste (Taf. 28).
Nach dieser gewichtigen Handlung trat für alle festliche Ruhe ein und man erfreute sich an einer vorher zubereiteten Mahlzeit von Klebreis und Fisch. Bei derartigen Festmahlzeiten ist gewöhnlich Wildschweinfleisch sehr beliebt, doch ist dieses während der Dauer des Hausbaus lāli; auch Blätter von bestimmten Waldpflanzen als Gemüse zu gebrauchen, ist dann verboten.

Bildhauer.
Die Männer liessen sich gruppenweise in langen, parallelen Reihen nieder und hockten mit gekreuzten Beinen einander gegenüber. Jeder erhielt entweder eine grosse Menge in ein Bananenblatt gewickelten Reises oder einige dreieckige Päckchen pulut. In kleinen Schüsseln und Schalen wurde jedem auch ein in Wasser gekochtes Stück Fisch angeboten.
Nach der Mahlzeit begab man sich wieder an die Arbeit und richtete im Laufe des Tages noch eine ganze Reihe der schwersten Pfähle auf. Von diesen wurden je 4 (a1 bis a4 Taf. 29) in die Tiefe und je 5 (b1 bis b5 Taf. 30) in die Breite des Dauses gestellt, also 20 im Ganzen; von den kleinen Eisenholzpfählen c, die hauptsächlich die Dielenbalken zu stützen hatten, wurden je 9 in die Breite und je 9 in die Tiefe gestellt, also 81 im Ganzen; somit ruhte das Haus auf 101 Pfählen. Erwies sich ein Pfahl später als zu schwach, so wurde ihm noch ein anderer zur Stütze an die Seite gestellt.

Geopfertes Ferkel.
Die Pfähle der Reihen a2 und a4 wurden besonders stark mitein [163] ander verbunden, indem man in deren obere Enden hohe, schmale Öffnungen hackte und durch diese lange, schmale Balken (djăpi d Taf. 29) aus Eisenholz schob. Auch die Pfähle der mittleren Reihe wurden untereinander durch Balken e verbunden, aber diese wurden nur mit Rotang befestigt oder in Aushöhlungen der oberen Enden gelegt, da diese Pfähle nicht so dick waren. Diese 3 Reihen von Balken (d und e), die auf den Enden oder in Aushöhlungen der Hauptpfähle liegen, dienen 17 Paar walang bahi-u f als Stütze. Dieses sind Balken, die senkrecht zu den djăpi d und e liegen und die vorderste Reihe Pfähle mit der mittleren und diese mit der hintersten verbinden. Sie haben einen dreieckigen Querschnitt, ihre Basis ist nach oben gekehrt und sie greifen mit einer groben, tiefen Einkerbung in die djăpi hinein (Taf. 30).
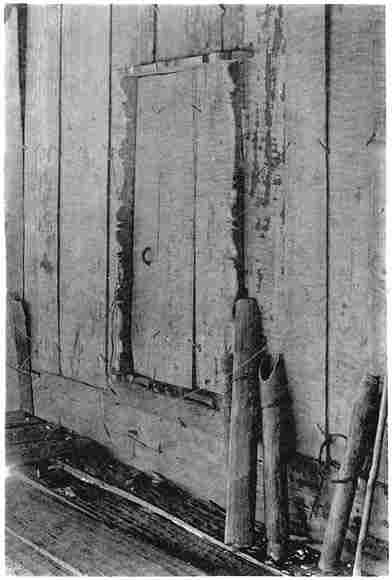
Verzierte Tür.
Die walang bahi-u ragen mit ihren geschnitzten Enden weit über die Reihe Pfähle a2 und a4 hinaus (Taf. 29). Auf der mittleren Reihe Pfähle a3 liegen diese Balken zu je zwei mit ihren inneren Enden aneinander, während ihre Aussenenden das Dach tragen. Mittelst der djăpi und walang bahi-u werden also die 3 Reihen grosser Pfähle a2, a3, und 4, wenn auch nicht unverrückbar, so doch zu einem festen Gerüst miteinander verbunden.
Die Konstruktion des Dachs (hapo) von Kwing Irangs Haus tritt am deutlichsten auf Tafel 30 hervor. Etwas seitlich von der mittelsten Pfahlreihe a3, parallel der Breite des Hauses, werden auf die inneren Enden der 34 walang bahi-u f schmale Bretter g aus Eisenholz gelegt und mit Pflöcken aus dem gleichen Holz auf den walang bahi-u, die aus dem viel weicheren Tengkawangholz bestehen, befestigt. Senkrecht auf diesen Brettern, in vorher hergestellten Öffnungen, stehen 18 kleinere Balken h, die an ihren oberen Enden den First i (mobong) tragen. Dieser wird sowohl durch Pflöcke als durch Rotang auf diesen Balken befestigt. Zur grösseren Verstärkung werden noch lange, dünne Balken j angebunden. Auch auf die äusseren Enden der walang bahi-u f werden Eisenholzbalken k (Taf. 29) gelegt, die man ebenfalls mit Pflöcken aus Eisenholz, die in vorher gebohrte Löcher getrieben werden, befestigt. Die Dachsparren 1 (kaso̱) werden aus Tengkawangholz hergestellt. Ihre dünnen oberen Enden werden mit dünnen Eisenholzpflöcken und Rotang mit dem First verbunden und die Aussenenden an die Balken k befestigt. Ihre Zahl beträgt an jeder Hausseite 38. Für die hintere Hälfte des Hauses, die eigentliche Wohnung (amin) des Häuptlings, [164] benützt man die längsten Sparren, welche die walang bahi-u weit überragen, für die vordere Seite, über der ăwă, verwendet man dagegen kürzere, die genau bei den walang bahi-u enden, weil man hier die kaso̱ l später durch geschnitzte Balken v verlängert. Hierbei kommt das schöne Baumaterial der borneoschen Wälder zu voller Geltung; die Tengkawangstämme sind nämlich so gerade und gleichmässig dick, dass man sie an den Verbindungsstellen nur etwas zu behauen braucht, um sie gleichmässig den Sparren anfügen zu können. Im Innern des Hauses, wo das Holz nicht nass wird, hält sich dasselbe sehr lange, aussen verdirbt es dagegen sehr bald. Wegen der Weichheit des Tengkawangholzes lassen sich Eisenholzpflöcke leicht in dieses hineintreiben.
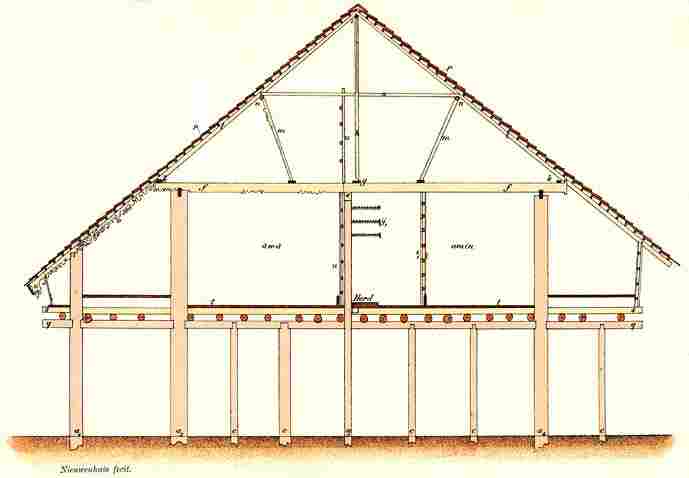
Querschnitt durch Kwing Irangs Haus.
Die kaso̱ 1 erhalten noch eine andere Stütze, denn sonst könnten sie die schwere Dachbedeckung nicht tragen. Der Querschnitt von Kwing Irangs Haus Taf. 29 zeigt, dass die kaso̱ im mittleren Teil, oberhalb der walang bahi-u, noch durch schräge, dünnere Balken m (dje̥he̱ balăng bo-ong) gestützt werden. Diese finden mitten auf einem dicken Brett, das ungefähr in der Mitte jeder Reihe walang bahi-u befestigt ist, einen Stützpunkt und sind oben mit den Sparren durch dünne Dachträger n verbunden. Diese Dachträger n, balăng bo-ong genannt, sind an die schrägen Stützen m mit Rotang festgebunden, auch werden sie zu beiden Seiten durch dünne Querbalken o (balăng ka-ai) verbunden.
Auf diese weise bringen die Bahau das Hauptgerüst eines Hauses zu Stande. An der Vorderseite der Galerie ruht das Dach noch auf einer vierten Reihe dicker Pfähle a1, die während des Dachbaus gesetzt wird und an der Hinterseite (amin) bietet die hintere Wand, da sie auf den Balken des Fussbodens ruht, den kaso noch einen besonderen Halt.
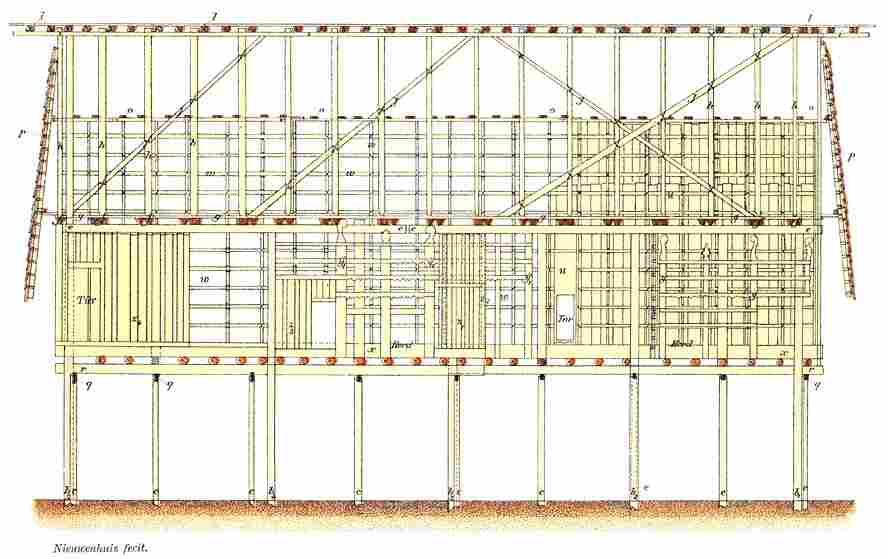
Längsschnitt durch Kwing Irangs Haus.
Um die Dachbedeckung, 1 m lange und 1½-2 dm breite, dünne Schindeln (ke̥pāng) aus Eisenholz auf den kaso̱ anbringen zu können, gebraucht man Querlatten p (dje̥he̱) aus nibung (Palmenart), die man in der Regel mit dünnem Rotang auf die kaso̱ bindet; Kwing Irang benützte hierfür jedoch Nägel, die er an der Küste gekauft hatte.
Die Lage der Latten p und die Art und Weise, wie an jede derselben eine Reihe von Schindeln gebunden wird und wie diese mit ihren unteren Enden übereinander liegen, ist auf dem Längsschnitt des Hauses angegeben. Das Dach erforderte im Ganzen ungefähr 25000 [165] Schindeln. Auf den First werden, zum Abschluss des Ganzen, rinnenförmige Stücke Holz umgekehrt aufgesetzt.
Die Diele (Taf. 29) wird ungefähr 3 m über dem Erdboden angebracht, indem man lange, dünne Eisenholzbalken q (āling) in seitliche Öffnungen der dicken Pfähle a1 a2 etc. steckt und diese āling durch die dünnen Eisenholzpfähle c senkrecht unterstützt. Letztere ruhen mit ihrem unteren Ende in der Erde, mit dem oberen, zapfenförmigen greifen sie in entsprechende Öffnungen der āling. Senkrecht zur Breite des Hauses liegen 9 Reihen āling neben einander. Sie dienen als Stütze für eine Lage 2–3½ dm dicker Tengkawangstämme r (pe̥njăpai), die in der Breite des Hauses, in Abständen von etwa 1 m voneinander, auf den ding ruhen. Wegen der grossen Länge der Tengkawangstämme nahmen zwei Balken, die in ihre gegenseitige Verlängerung gelegt wurden, die ganze Breite des Hauses ein. Um die Unebenheiten und die ungleiche Dicke aufzuheben, wurden in die āling mehr oder minder tiefe Ausrandungen gekappt und in diese die pe̥njăpai gefügt. Die Unebenheiten oben an den pe̥njăpai wurden mit dem Schwert entfernt.
Senkrecht auf die pe̥njăpai, parallel zur Tiefe des Hauses, wurde eine zweite Schicht derselben Balken s (dọro̤̱ng) gelegt, welche der eigentlichen Diele t (tasu) als Unterlage dienen sollte (Taf. 29 u. 30). Indem man hier und da etwas weghackte und die pe̥njăpai und dọro̤̱ng mittelst Rotang aneinander band, erhielt der Fussboden einen genügenden Halt und Zusammenhang, wozu auch die grosse Schwere der Balken beitrug. An ihren dünnen Enden wurden die Stämme mit Pflöcken aus Eisenholz verbunden. Auf die dọro̤̱ng wurden die Dielen bretter t lose hingelegt; ihrer grossen Schwere wegen rückten sie nicht vom Platze.
Auf diese Weise kam ein 24 m breiter und 20.5 m tiefer Wohnraum zu stande, über dem das Dach ein riesiges Gewölbe bildete. In den Häusern der gewöhnlicheren Familien, welche nach demselben Prinzip bauen, werden jedoch die walang bahi-u zum Aufbewahrender Ackergerätschaften und dergl. benützt, so dass diese eigentlich die Rolle eines Bodens spielen. Der grosse Raum über den walang bahi-u wird beim Häuptling aber nicht benützt, weil die Balken zu weit von einander abstehen und eine Diele fehlt.
Das Wohnhaus wird in zwei Teile getrennt, einen vorderen, die ăwă und einen hinteren, die amin (Taf. 29). Diese beiden werden [166] durch eine hohe Bretterwand u, die ungefähr senkrecht unter dem First liegt, von einander geschieden. Eine Tür führt von der ăwă in die amin. In Kwing Irangs Hause stand die Bretterwand vor der mittleren Reihe Pfähle und reichte bis zu den balang ha-ai p, dadurch war die ăwă etwas kleiner als die amin geworden.

Gerüst von Kwing Irangs Haus.
Die Galerie wird viel sorgfältiger ausgebaut als das Wohngemach. Die roh bearbeiteten kaso̱ 1 reichen dort, wie gesagt, nur bis zu den walang bahi-u f, die an ihrer unteren Seite über der ăwă mit Schnitzereien verziert sind. Die kaso̱ werden durch schön geschnitzte Stücke v verlängert, welche den Raum vor der in gleicher Weise bearbeiteten vordersten Reihe Pfähle überdecken. Von diesem sorgfältig ausgestatteten Raum aus geniesst man einen freien Überblick über den Fluss und die ganze Landschaft; hier kommen abends die Hausgenossen zum Plaudern zusammen und hier werden die Gäste empfangen.
Diese Verlängerungsbalken v bestehen aus hartem Holz; jede angesehene Familie im Stamm liefert einen solchen Balken und ein oder zwei ihrer männlichen Angehörigen geben sich alle Mühe, um sie so schön als möglich zu schnitzen. Wie die walang bahi-u haben auch sie einen dreieckigen Querschnitt; eine Seite ist nach oben gekehrt, die beiden anderen, die sich nach unten zu einer Rippe vereinigen, werden ausgehöhlt und die Rippe in zierliche Ornamente ausgeschnitten. Jeder Schnitzer wendet Verzierungen eigener Erfindung an, in der Regel Variationen des Motivs ke̥lot, des männlichen Geschlechtsorgans. Nur wenige bringen Stilisierungen der weiblichen Geschlechtsorgane an. Diejenigen jungen Leute, die ihren Balken besonders schön bearbeiten wollen, schnitzen Tierfiguren (hudo̱).

Gerüst von Kwing Irangs Haus.
Auch die grosse Mittelwand u (liding) ist, der Galerie zu, mit zahlreichen Figuren in Hochrelief, die Menschen und Tiere vorstellen, verziert. Die Wand besteht aus gut bearbeiteten Brettern, die fest aneinander schliessen und mittelst Nägeln und Rotang auf ein Holzgitter w (Taf. 30), das man hierfür an der Seite der amin angebracht hat, befestigt werden. Diese Bretter ruhen nicht auf der Diele, sondern auf dem rinnenförmig ausgehöhlten oberen Rande eines dicken Getäfels x, das ¾ m hoch ist. An den Verzierungen des Getäfels hatten 4 der besten Schnitzkünstler des Stammes lange Zeit gearbeitet. Das ganze, der Galerie entsprechend, 24 m lange Getäfel bestand nur aus zwei Brettern, die, wie gewöhnlich, aus einem einzigen Stamm verfertigt [167] waren, indem man diesen halbiert und das überschüssige Holz an der runden Seite weggehackt hatte. Hierbei hatte man in der Mitte und an den beiden Enden der Bretter über 2 dm dicke und 1 m lange Holzstücke stehen gelassen. Aus diesen wurden die 6 Figuren modelliert, die auf nebenstehender Tafel 33 zu sehen sind. Drei derselben (a, c, f) bilden Stilisierungen des Hundes, die vierte (b) stellt eine Kombination ähnlicher Tiere vor, die beiden übrigen (d, e) sind Masken. Schön geschnitzt ist auch ein Brett, das als Lehne für den Häuptling gegen das Gitter gestellt wird, welches auch hier die Vorderseite der Galerie nach aussen bis auf 1 m Abstand vom Dache abschliesst (Siehe Taf. 34; das Gitter fehlt hier noch).

Bildhauerarbeit.

Bildhauerarbeit.

Bildhauerarbeit.

Bildhauerarbeit.

Bildhauerarbeit.

Bildhauerarbeit.
Auf den Besitz grosser, schwerer Dielen legt ein Stamm grosses Gewicht; auch die Kajan gaben sich alle Mühe, sie besonders schön herzustellen. Jedes Brett war ungefähr 8 m lang, 15 cm dick und ½–1 m breit, je nach der Grösse des Baums, aus dem es gehauen worden war. Je zwei Familien des Stammes sind verpflichtet, ein derartiges Brett zu stellen. Sie vereinigen sich zu dieser Arbeit mit zwei anderen Familien, suchen im Walde einen schweren Tengkawang-Baum aus und verfertigen aus ihm gemeinschaftlich zwei Bretter. Aus der Schwere und Breite der Bretter kann man auf den Reichtum und die Anzahl der Familienglieder schliessen. Die Familien der Mantri übertreffen hierin alle anderen. Obgleich diese Bretter so dick sind, fürchtete man doch, dass sie beim Trocknen krumm werden könnten und band sie daher mit Rotang an die geraden Reihen Pfähle unter dem Hause fest, wo sie stehen blieben, bis sie trocken genug waren, um bearbeitet werden zu können (Taf. 24). Da die Bretter mit wochenlangen Unterbrechungen herbeigeschafft wurden, musste mit ihrer Verwendung ohnehin gewartet werden, bis sie alle beisammen waren. Man hatte die ăwă (Taf. 34) anfangs provisorisch mit den Brettern für die Mittelwand belegt, als diese noch nicht gegen die alten Bretter, mit denen man sich anfangs beholfen hatte, vertauscht waren.
Der Bau der amin geht am deutlichsten aus dem Grundriss (Taf. 35) und dem Längsschnitt (Taf. 30) des Hauses hervor, die zugleich auch die Konstruktion der Mittelwand zeigen. Die Diele zwischen der Hinterwand der amin und der Reihe von 5 Pfählen a1–a5 ist um 3 dm höher gelegt als der mittlere Teil des Raumes. In diesem erhöhten Teil wird am Tage gearbeitet und nachts geschlafen. Ebenfalls erhöht ist die Diele zu beiden Seiten der amin; auch hier wird [168] gearbeitet. Einige Bretterverschläge dienen als gesonderte Schlafräume. Die Vorderseite des Gemachs wird von Kochherden, Vorrats- und Schlafkammern eingenommen, auch befindet sich hier die zur ăwă führende Tür. Betrachten wir auf Taf. 30 den Bau der Mittelwand zwischen amin und ăwă etwas genauer. Wir sehen hier die Stützbalken h des Firstes i, die senkrecht auf den quer durchschnittenen walang bahi-u f stehen, die wiederum auf den djăpi e der grossen Pfähle der mittleren Reihe ruhen. Die Stützbalken des Firstes sind untereinander durch schräg angebundene, lange, dünne Tengkawang-Stämme j verbunden. Ferner ist zur Stütze der Mittelwand ein Holzgitter w aus rechtwinklig sich schneidenden dünnen Stämmen angebracht worden, das von der Diele bis zu den balang ka-ai o reicht. An diesem Gitter ist auf der Galerieseite eine Bretterwand u, welche die ganze Höhe einnimmt, befestigt; diese Wand besteht aus zwei übereinander stehenden Reihen von Brettern u, die jedoch auf der Zeichnung nur an der rechten Seite angegeben sind. Die unterste Bretterreihe wird nur von der Tür unterbrochen, die aus einem einzigen breiten Brett gehauen ist.

Die Galerie von Kwing Irangs Haus.
Auf derselben Tafel ist ferner die Einteilung der amin vor dieser Mittelwand angegeben. Von rechts nach links sieht man geschnitzte Regale y, welche zur Aufbewahrung von Küchengerät und Brennholz dienen; sie befinden sich über einem Feuerherde. Dann folgt eine in die amin einspringende Wand z, welche diesen Herd von dem Raum bei der Eingangstür trennt. Die Türschwelle ist, wie in allen Bahauwohnungen, 50 cm hoch. Weiter links folgt die grösste Herdstätte y1, deren Schuppen und Regale bis zum 4. grossen Pfahl b, reichen. Die vorn schön geschnitzten tiefen Regale springen von der Mittelwand weit vor. Von der Eingangstür an ist dieser Raum folgendermassen verteilt: erst folgt ein Aufbewahrungsraum für Wassergefässe, dann wieder eine in die amin vorspringende Wand z2, an welche sich nach links eine senkrecht stehende Wand z1 anschliesst, die den grossen Küchenraum von dem übrigen Teil der amin gewissermassen trennt.
Hinter dieser Wand z1 liegt der Schlafplatz der Sklavin, welche die Aufsicht über die Küche führt. Von den 4 Regalen über dem Herde setzen sich die beiden obersten nach rechts bis über den Schlafplatz der Sklavin und den Aufbewahrungsraum für Wassergefässe, nach links bis über den grossen Vorratsschrank fort, dessen Tür sich gleich links [169] vom Herde befindet. Hinter der Scheidewand z3 verborgen, links vom Schranke, liegt ein dritter, kleinerer Herd, auf dem nur für den Häuptling und dessen Familie gekocht wird. Auf den beiden anderen Herden wird für die verheirateten Kinder des Häuptlings, für die Sklaven und die Schweine gekocht. Links von diesem Herde, wo der Fussboden, gleichwie an der Hinterwand und zu beiden Seiten der amin, um 3 dm erhöht ist, läuft parallel der Mittelwand eine grosse Bretterwand z4, die mit Hilfe einer senkrecht zu ihr stehenden Verbindungswand zwei verschieden grosse Räume bildet. Der kleinere, halb offene Raum rechts dient der Küchensklavin und deren Familie als Schlafstelle, der grössere, geschlossene Raum links, in den eine Tür führt, bildet die Schlafkammer für den Häuptlingssohn und dessen Familie.
Vergleichen wir deutlichkeitshalber diesen Plan mit dem Grundriss von Kwing Irangs amin auf Tafel 35, so erhalten wir einen Überblick über die horizontale Verteilung dieses Raums. Von rechts nach links gesehen finden wir in der Ecke den Platz mit den Küchenregalen, dann den Herd. Die einspringende Wand z trennt diesen Küchenraum von dem freien Platz bei der Eingangstür. Links von dieser befindet sich der Aufbewahrungsraum für die Bambusgefässe mit Wasser. Wie aus der Zeichnung zu ersehen ist, hat man die Diele hier halb offen gelassen, damit das Wasser event. beim Übergiessen zwischen den Brettern zur Erde abfliessen kann. Dieser Raum ist von dem Schlafplatz der Sklavin durch die senkrecht zu einander stehenden Wände z1 und z2 geschieden. Dann folgt der grosse Herd, der Küchenschrank, der kleine Herd der Häuptlingsfamilie mit dem freien Platz davor und einem kleinen, halb offenen Raum als Schlafstätte für die Sklavenfamilie und schliesslich der ganz geschlossene Raum für den Häuptlingssohn.
Die Seitenwände und die Hinterwand der amin bestehen aus aneinander schliessenden Brettern, nur sind hier Öffnungen als Fensterluken ausgespart. Vor diesen sitzen die Frauen mit ihren Handarbeiten und schnitzen die Männer ihre Schwertgriffe und -scheiden. Am meisten Licht dringt jedoch durch das grosse Fenster ein, das sich oben, im hintersten Dachteil befindet. Dieses Fenster ist 1 qm gross und wird mittelst einer Klappe, die an der oberen Seite aussen am Dach befestigt ist, geschlossen. Bei gutem Wetter wird die Klappe durch einen senkrecht gestellten Stock offen gehalten.
Auf den erhöhten Plätzen zu beiden Seiten der amin sollen später noch mehr Kammern gebaut werden; sie dienen alle als Schlafräume [170] teils für die unverheirateten Töchter und verheirateten Kinder des Häuptlings, teils für die Sklavenfamilien.
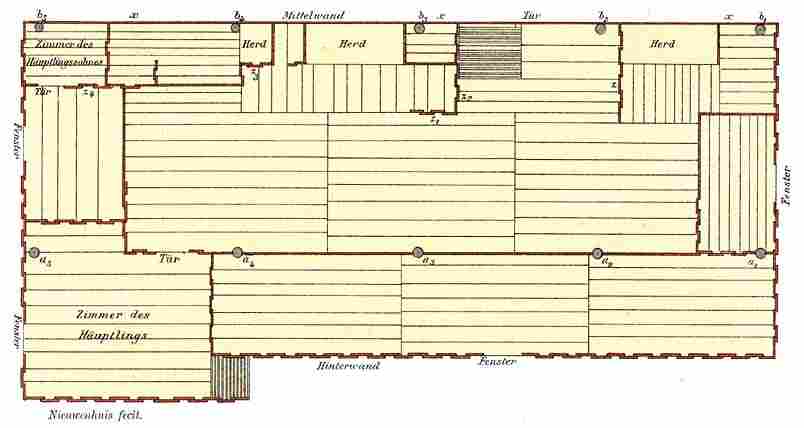
Grundriss von Kwing Irangs amin.
Für sich selbst und seine Frauen hat Kwing Irang links in der hinteren Ecke der amin ein Zimmer bauen lassen (Taf. 35). Der Fussboden, der hier ebenso hoch wie in der Mitte der amin ist, war bis hinter das Haus unter dem weit über die Hinterwand vorspringenden Dache verlängert worden. Gegen die amin zu ist dieses Zimmer vollständig geschlossen und nur durch eine Tür zugänglich, dagegen endet es hinter der Rückwand des Hauses, in dem verlängerten Teil, offen nach aussen; auch ist die Diele an dieser Stelle durchbrochen.
Da alle Dorffamilien sich am Sammeln des Materials und am Bau dieses grossen Gebäudes beteiligten, keine von ihnen jedoch spezielle Kenntnisse im Häuserbau besass, und alle ausserdem für ihre eigenen Wohnungen und ihren Lebensunterhalt zu sorgen hatten, schritt der Bau nur langsam und unter grossen Schwierigkeiten fort.
Der Transport von Baumaterial aus einem weglosen Tropenwald ist äusserst schwierig, denn bestimmte Holzarten wachsen dort nicht, wie in Europa, nebeneinander, sondern inmitten einer grossen Anzahl anderer Arten. Daher müssen die passenden Tengkawang-Bäume z.B. in einem ausgedehnten Gebiet gesucht, gefällt und oft über Hügel und durch Täler bis an einen Nebenfluss geschleift werden, von dem aus sie zum Mahakam befördert werden können. Eisenholz muss stets mittelst Flössen transportiert werden, da es viel schwerer als Wasser ist. Nachdem ein solcher Stamm mit vieler Mühe durch den dichten Gebirgswald zum Flusse geschafft worden ist, wird er unter ein eigens für ihn gebautes Floss gebunden. Die Kajan waren denn auch stolz darauf, dass für Kwing Irangs Haus 9 dieser schweren Pfähle verwendet worden waren. Die meisten derselben wurden auf folgende Weise bearbeitet: zuerst entfernte man die Rinde und die Unebenheiten mit Beilen, dann verbesserte man hie und da auch die Rundung. Mit dieser Bearbeitung begnügte man sich bei den Pfählen der hinteren Reihe, an denen der vorderen wurde überdies noch mit kleinen Dexeln eine flache Kannelierung angebracht, wie auf Taf. 27, wo Imun und Sawang Jok mit der Bildhauerarbeit beschäftigt sind, zu sehen ist. Die gewöhnlichen, eisernen, europäischen Instrumente sind für Eisenholz zu weich und daher unbrauchbar; darnach kann man sich von der Geschicklichkeit und Geduld, welche diese Arbeit erfordert, eine Vorstellung machen. [171]
Für die kaso̱ und die Dielenbalken entfernt man von den Tengkawang-Bäumen nur den obersten Kronenteil, die grössten Äste und die Rinde; die feinere Bearbeitung findet erst beim Bau selbst statt.
Von den verschiedenen Verzierungen der ăwă ist oben bereits gesprochen worden, wenden wir uns jetzt dem äusseren Hausschmuck zu. Hierher gehören die bang pakat (Taf. 24), die verzierten Giebelbretter, die zu beiden Enden des Firstes frei in die Luft hinausragen. Bei den Bahau und Kĕnja besitzen nur die Häuptlinge das Recht, diese Verzierungen in reich ausgearbeiteter Form an den Firstenden anzubringen. Kwing Irang hatte sich denn auch sehr eingehend mit der Frage, welche Gestalt er ihnen geben sollte, beschäftigt. Auf seinen Reisen nach dem unteren Mahakam hatte er die Häuser anderer Häuptlinge bereits Jahre vorher daraufhin angesehen. Den rechten bang pakat liess er nach dem Modell, das er auf dem Hause von Brit Lĕdjü bei Long Iram gesehen hatte, anfertigen; den anderen überliess er der Phantasie von zweien seiner besten Holzschnitzer. Solch ein bang pakat muss aus einem einzigen Stück sehr harten Holzes geschnitzt werden und da er 3 m lang und 0.70 cm breit sein muss, so war es bereits schwierig, einen Baum von hartem Holz und den erforderlichen Dimensionen zu finden. Man benützte hierfür eine Holzart, die sich nicht gut spalten liess und daher für andere Zwecke, z.B. für Schindeln, untauglich war.
Beide bang pakat wurden von den zwei Söhnen des alten Priesters Bo Jok verfertigt, die sich auf die Schnitzerei in Holz und Hirschhorn gut verstanden. An jeder Figur arbeiteten sie ungefähr 6 Tage. Der Schmuck wurde angebracht, sobald die Sparren auf dem Dache lagen, bevor aber deren geschnitzte Verlängerungsstücke über der Galerie befestigt worden waren.
Die Anbringung dieser Figuren bedeutete, dass das Haus unter Dach war, daher feierte man diese wichtige Handlung mit der Opferung eines grossen Schweines. Das Tier wurde geschlachtet und ein Teil seines Blutes auf sawang- (Dracaena-)Blättern aufgefangen. Der alte Bo Jok tränkte mit dem Blute Reis in einer Schale, dann bewegte er diese in der Luft hin und her und warf schliesslich den Reis nach allen Richtungen, hauptsächlich aber nach dem Batu Kasian, als Opfer für die Geister, in die Luft. Die bang pakat selbst wurden ebenfalls mit Blut bestrichen und dann beide gleichzeitig mit Rotang hinaufgezogen und befestigt. Die Stelle lag 25 m über dem Erdboden, so dass es nicht licht war, diese schweren, langen, fein [172] ausgeschnittenen Bretter anzubringen. Man hatte an den beiden Enden des Firstes aus jungen, mit Rotang zusammengebundenen Stämmen Gerüste gebaut, auf denen sich die Männer mit Sicherheit bewegen konnten (Taf. 16). Sie zogen die bang pakat hinauf, brachten sie vorsichtig über das Gerüst und dann mit ihrem zu einem Stiel zugespitzten Ende in die Öffnung eines festen Holzstücks, das zu diesem Zwecke bereits an der Unterseite des Firstes befestigt worden war. Darauf wurde das Hinterende des Stiels noch mit Holz und Rotang an den First und zu beiden Seiten an die Sparren gebunden.
Während der folgenden Tage beschäftigten sich alle mit dem Anbringen der geschnitzten Verlängerungsstücke der kaso̱ über der ăwă.
Die Bahau verstehen sich sehr gut auf die Herstellung von Schindeln (ke̥pāng). Für die Häuser von Häuptlingen benützen sie gut spaltbares Eisenholz, für die der übrigen Stammesgenossen meist Tengkawang-Holz. Zuerst suchen sie im Walde einen Baum von Eisenholz aus, der sich gut spalten lässt, was bereits beim Anhacken des Stammes zu konstatieren ist. Haben sie unter vielen einen solchen Baum gefunden, so schlagen sie, je nach seiner Grösse, 600–800 ke̥pāng aus ihm. Sie zerlegen den Baum in Stücke von der Länge der Schindeln und spalten die Stücke mit Hilfe eines langen, hölzernen Keils, den sie mit einem Holzklotz hineintreiben, in Segmente (Taf. 23 unten rechts). Zur weiteren Bearbeitung stellen sie diese Segmente auf primitiven Gerüsten ihrer Länge nach senkrecht vor sich auf und schlagen mit einem Schwert zu beiden Seiten das überschüssige Holz ab. Wie auf dem Bilde zu sehen ist, wird das Schwert vor dem festen Schlage mit beiden Händen erhoben.
Da die Schindeln von Kwing Irangs provisorischem Hause für das neue, das 25000 Stück erforderte, lange nicht reichten, wurde jeder Familie aufgetragen, 200 Schindeln zu liefern, was wiederum viel Zeit in Anspruch nahm. Um nicht allzu lange warten zu müssen, deckte man zum Schluss noch einen Teil des Daches mit alten Tengkawang-Schindeln, die später durch andere aus Eisenholz ersetzt werden sollten.
Als man eine genügende Menge Schindeln beisammen zu haben glaubte—man hatte sich von der erforderlichen Anzahl nur eine allgemeine Vorstellung gemacht—wurde der ganze Stamm zusammengerufen, um die Geister vor der Anbringung der Dachbedeckung durch die Opferung eines sehr grossen und hauptsächlich fetten Schweines günstig zu stimmen. Dies war unumgänglich nötig, weil das [173] Dach aus Eisenholz gebaut wurde; hätte man Tengkawang-Holz benützt, so wäre ein bescheideneres Opfer genügend gewesen. Nun waren alle Stammesglieder, jung und alt, versammelt, was insofern wünschenswert war, als die Dorfgenossen das Opfer gemeinsam bringen und daher das Schwein und ausserdem zwei Hühner berühren sollten. Die Geister erkannten dann am Geruch, wer geopfert hatte und die Betreffenden brauchten sich später nicht zu fürchten, takut parid, d.h. krank zu werden, sobald sie unter dieses Eisenholz-Dach traten. Diese Auffassung entspringt dem starken Eindruck, denn ein so festes, kostbares Dach auf den Bahau macht; er fürchtet daher, seine Seele (bruwa) könnte beim imposanten Anblick erschrecken und fliehen, wodurch er selbst krank werden würde. Aus demselben Grunde brachte man auch keine kleinen Kinder in die Nähe der Eisenholz-Pfähle, selbst als diese noch weitab lagen und behauen wurden. Erst nachdem ihre Bearbeitung vollendet war und die Mütter den Geistern der Pfähle Eier oder ein Huhn geopfert hatten, durften die Kinder sich ihnen gefahrlos nähern.
Im Unterschied von anderen Gelegenheiten brachte diesmal der Häuptling selbst und nicht der Priester den Geistern das Opfer. Man hatte für diese Zeremonie einen grossen, viereckigen Platz mit Brettern und Matten überdeckt und darunter sass der Häuptling inmitten seiner Ältesten in vollem Ornat d.h. mit einem besonders schönen Lendentuch und Kopftuch bekleidet. Sie alle legten die Hand auf das feiste Tier, worauf Männer, Frauen und Kinder bis auf die Säuglinge in einem langen Zuge das Opferschwein berührten. Darauf trug der Häuptling den Geistern das Opfer an, indem er ihnen berichtete, wer opferte und warum geopfert wurde. Hierbei bediente er sich der Kajansprache, vielleicht weil er das Busang, das gewöhnlich bei solch einer Gelegenheit gebraucht wird, nicht gut sprach. Der alte Bo Jok wiederholte die Worte, hatte aber vorsichtshalber seine Seele vorher gründlich gestärkt, indem er in ein altes Schwert gebissen und darauf ein Stück weissen Kattuns auf sein Haupt gelegt hatte. Er sprach unter dröhnenden Schlägen auf die Gonge, so dass ich ihn nicht verstand. Darauf schlachtete man das Schwein und die Hühner, zerlegte sie in gleiche Stücke und kochte sie in Pfannen (Taf. 36), so dass alle Anwesenden zu ihrem Klebreis, den der Häuptling ihnen ebenfalls angeboten hatte, auch Fleisch zu geniessen bekamen. Wir erhielten eines der Hühner und ein Stück Schweinefleisch, die wir uns trefflich munden liessen, da es in der letzten Zeit mit der Kost schlecht bestellt [174] gewesen war. Zuletzt wurden noch einige Eier als Opfer beim Hauptpfahl aufgelegt.
Es folgten zwei Tage me̥lo̱, in denen niemand unter dem Hause hindurchgehen durfte. Als Verbotszeichen wurde ein Rotang um das Haus gespannt.
Am Abend des Opfertages fand noch eine andere Zeremonie statt. Es hatte sich nämlich die dje̥le̥wăn, die rotköpfige Schlange, beim Hause gezeigt, und nun glaubte der Häuptling, diesem Boten der grossen Geister unter einem Opfer noch einiges über den Hausbau mitteilen zu müssen. So opferte er denn an der Stelle, wo das Tier gesehen worden war, 2 × 8 Eier und einige kawit mit Schweinefleisch, die er in die gespaltene Spitze in die Erde gepflanzter Bambusstöcke einklemmte. An einem dieser Opferstöcke befestigte er einen Streifen von der Rückenhaut mit Baransitzendem Speck des geopferten Schweines, der von der Schnauze bis zum Sehwanze reichte, um die Geister von der Grösse und Fettheit des gebrachten Opfers zu überzeugen.

Kochen von Schweinefleisch.
Viele Männer zeigten sich jetzt bereit, die Schindeln auf dem Dache anzubringen; augenscheinlich hatte die Festfreude sie in gute Stimmung versetzt. In einem Tage befestigten sie 11000 Schindeln, indem sie mit einem Hohlmeissel oder Drillbohrer ins obere Ende der Bretter zwei Löcher bohrten, Rotangschnüre hindurchzogen und an die Querlatten festbanden. Die Schindeln waren alle sehr dünn und gleichmässig, doch bildeten ihrer 50 eine schwere Last selbst für einen starken Mann. Dank den fest angebrachten Leitern kam aber während des ganzen Hausbaus kein einziges Unglück vor. Geschieht ein solches aber dennoch, so wird es als ein Beweis für den Unwillen der Geister aufgefasst und dementsprechend behandelt. Fällt z.B. jemand vom Gerüst herab, so wird sein Lendentuch an der betreffenden Stelle begraben. Auch muss er me̥lo̱, ein Schwein opfern und den dājung Kattun und ein Schwert geben. Dann muss er wieder bis zu 8 Tagen me̥lo̱, währenddessen an dem Hause nicht gearbeitet werden darf. Auch Kleidungsstücke und Werkzeuge werden an Ort und Stelle, wo sie niedergefallen sind, vergraben. Überdies werden bei einem Neubau noch andere Vorsichtsmassregeln getroffen, um sich die günstige Stimmung der Geister und somit ein gutes Gelingen zu sichern. In gleicher Weise wie z.B. ein Mann, aus Furcht takut dawi zu werden, keine getragenen Frauenkleider und keine Webeutensilien berühren will, darf auch kein Webeapparat unter einem unvollendeten Hause hindurchgetragen [175] werden. Auch den von weit her kommenden Fremden ist der Durchgang unter einem unvollendeten Hause verboten, wahrscheinlich weil man auch in diesem Fall die unbekannten Geister, die sie mitbringen, fürchtet. Stirbt jemand im Stamme, so muss der Hausbau, solange die Leiche nicht begraben ist, unterbrochen werden.
Trotz aller Hindernisse war Kwing Irangs Haus im März 1899 unter Dach und die amin mit Hilfe alten Materials soweit fertiggestellt, dass sie bezogen werden konnte. Der Galerie fehlte hauptsächlich eine Diele, aber diese war nicht unumgänglich nötig; auch musste man voraussichtlich wegen der Ernte noch Monate lang mit der Herstellung der Bretter warten.
Als der Tag, an dem Kwing Irang sein neues Haus beziehen sollte, nach dem Vogelflug bestimmt worden war, wurden alle Personen, die die amin bewohnen sollten, also die Familienglieder und die Haussklaven, ausserdem auch noch ein Teil der Sklaven, der eigene Häuser bauen durfte, zusammengerufen.
Gegen Mittag wurde zuerst gegen die Haustreppe zu eine Art Gang hergestellt, indem man eine Reihe hölzerner Galgen errichtete und mit weissem Kattun überspannte. Mit einem gleichen weissen Baldachin überdeckte man auch die Treppe von unten bis zur ăwă. Alle Hausgenossen in Begleitung eines Priesters mit Frau und Kindern und des alten Bo Jok bildeten einen Zug, an dessen Spitze sich Kwing Irang stellte. Der Häuptling trug seine gewöhnliche Kleidung. Ihm folgten ein Mantri, seine Frauen Bo Hiāng und Anja, dann der alte Bo Jok und zuletzt die Sklavinnen mit ihren Kindern. Erst schritt der Zug durch den Gang zur Treppe, bog dann links ab, ging einmal unten um das Haus herum und lehrte dann zur Treppe zurück. Hier hatte man auf einem flachen Stein ein altes Schwert niedergelegt, auf welches der Häuptling und alle, die ihm folgten, erst den Fuss setzten, bevor sie die Treppe hinauf ins Haus stiegen. Dieser feierliche Einzug diente zur Vorbereitung der Seele, damit diese beim plötzlichen Anblick dieses grossen, imposanten Gebäudes nicht entfloh. Der dājung und seine Familie betraten nicht das Haus, sondern begaben sich nach rechts, ihrer eigenen Wohnung zu.
In der amin angelangt begannen die Hausbewohner sogleich, nachdem sie die Tragkörbe samt Inhalt vom Rüchen genommen hatten, Herde zu errichten. Der kleine Herd, auf dem hauptsächlich für den Häuptling gekocht wird, kam zuerst an die Reihe. Zwei junge Männer [176] holten von draussen, zur Seite des Hauses Erde und bedeckten mit ihr einige Bretter aus hartem Holz. Dies ist die gebräuchliche Weise, um Herde herzustellen. Dann berichtete Bo Jok den Geistern, wem dieser Herd gehörte, auch bat er um ein glückliches Leben und Reichtum für die künftigen Bewohner. Als symbolisches Zeichen hierfür steckte er 2 × 8 Haken aus Fruchtbaumholz und zwei Büschel von daun sawang und noch einer anderen Blätterart in die Erde. In die Mitte legte man einen platten, nierenförmigen Stein von 10 cm Durchmesser, holte noch mehr Erde und stampfte diese über dem Stein fest. Damit war der Herd vollendet. Die Erde darf nie gewechselt werden; nur darf nötigenfalls bei religiösen Festen neue hinzugefügt werden.
Das erste Feuer muss auf die in früherer Zeit gebräuchliche Weise entzündet werden, indem man ein Stück Rotang über ein trockenes, weiches Holzstück hinund herzieht (Taf. 62, Fig. h). Die Funken, die hierbei entstehen, werden mittelst einer Art Schwamm aufgefangen. In den ersten Tagen darf dieses Feuer nicht ausgehen. Wenn die panjin und dipe̥n später ihre eigenen Wohnungen beziehen, holen sie ihr erstes Feuer von diesem Herde in der amin aja.
Die beiden ersten Tage nach dem Einzug müssen die Hausbewohner me̥lo̱. In dieser Zeit darf im Hause nicht geweint werden, Kwing schickte daher ein halbidiotisches Mädchen, das ihm von deren Familie anvertraut war, nach seiner Reisfeldwohnung, weil das Kind leicht in Tränen ausbrach.
Nach beendetem me̥lo̱ musste man ngajo̱, Köpfe jagen, um die vielen Verbotsbestimmungen, denen man sich während des Hausbaus hatte unterwerfen müssen, aufheben (be̥t lāli) zu können. Die Bewohner durften in der verflossenen Periode z.B. keine Bären, Gibbon und dongan, einen sehr beliebten Fisch, essen. Die von anderen Stämmen gebürtigen Sklaven mit anderer Religion mussten auf den verbreiteten grauen Affen (ke̥ră), dessen Fleisch sie für gewöhnlich geniessen, verzichten.
Das ngajo̱ gelegentlich des be̥t lāli führt der Häuptling allein aus. Die panjin feiern es gemeinschaftlich, sobald sie alle ihre Häuser beendet und bezogen haben, beim ersten Neujahrsfest. Das ngajo̱ des Häuptlings bestand darin, dass er einen seiner Mantri nach dem me̥lo̱ den Vogelflug beobachten liess. Der Mantri baute an der Stelle, wo er den tĕlandjang oder hissit zu seiner Rechten gehört hatte, eine [177] Hütte, die vom Häuptling und seinem Geleite für zwei Tage bezogen wurde. Darauf kehrte die Gesellschaft mit einem alten Schädel heim und beobachtete alle Zeremonien, die früher bei einer echten Kopfjagd gebräuchlich waren.
In Anbetracht, dass eine ungünstige Mondphase (Vollmond) eintreten sollte, beeilte man sich und stellte sich mit wenigen guten Vorzeichen zufrieden. Der adat wurde vorläufig genügt; später, wenn das Haus gänzlich fertig gestellt war, wollte man nochmals die Vögel befragen. Kwing, der viel zu tun hatte, liess nur den Mantri und sein Geleite in der Hütte schlafen.
Ein derartiges be̥t lāli mit ngajo̱ des Häuptlings bedeutet für alle Stammesglieder eine Aufhebung einer eventuellen Verbotsperiode. So darf z.B. bei dieser Gelegenheit die Trauer für ein Familienglied abgelegt werden. Die Knaben und jungen Männer dürfen bei diesem Anlass, wie die Erwachsenen, eine Kopfjagd mitmachen, um sich dadurch das Recht zu erwerben, je nach dem Alter ein Schwert zu tragen, die Schwanzfedern des Rhinozerosvogels (ke̥rip tingang) auf ihre Kriegsmütze zu heften oder einen Kriegsmantel umzulegen. Die gleichen Sitten herrschen bei den Long-Glat. Sie weisen darauf, dass bereits seit langer Zeit eine Kopfjagd des Häuptlings für alle Dorfgenossen zum be̥t lāli genügte. Daher beteiligten sich auch viele Familien an diesem ngajo̱. Die panjin begaben sich bereits abends vor dem bestimmten Tag zur Hütte, in welcher der Mantri sich befand. Bei Tagesanbruch machte sich auch der Häuptling in 3 Böten, bemannt mit von Kopf bis zu Fuss bewaffneten Kriegern, dorthin auf. Nach etwa einer Stunde hörten wir den Fluss herunter den Kriegsruf der Bahau erschallen; in Long Buleng schossen die Malaien ihre Gewehre ab und bald darauf kamen die Böte in Sicht. Sie waren aneinander gebunden worden und bildeten so ein Floss, auf dem die Krieger standen und in der Morgensonne in ihren phantastischen Rüstungen einen prachtvollen Anblick boten. Die mit langen, aufrechtstehenden Bambuswedeln geschmückten Böte trieben feierlich langsam den Fluss herab und hielten bei dem Anlegeplatz des Häuptlings still, wo schön geschmückte Frauen und Mädchen ihre männlichen Angehörigen erwarteten, ihnen die Schwerter und die überflüssige Kriegsrüstung abnahmen und ins Haus trugen, um ihnen statt dessen einen hübschen, Schal um die Schultern zu schlingen. Sie tun dies, um die bruwa der Krieger, die unter dem unangenehmen Eindruck von abgeschlagenen [178] Köpfen, geraubter Habe und verbrannten Häusern steht, durch etwas Angenehmes zu beruhigen. Als alle Festteilnehmer in der Galerie versammelt waren, hing man die Kriegsrüstung auf und bereitete dort alles zu einem mehrtägigen Aufenthalt vor. Die Krieger durften nämlich während des ngajo̱ ihre amin nicht betreten und nur in Bambus gekochten Reis ohne Fische, Hühner, Schweinefleisch, Salz oder andere Zuspeisen geniessen. Die eben erwachsen gewordenen jungen Männer durften während der ersten 4 Tage kein Wildschweinfleisch essen und für die Knaben, die sich zum ersten Mal an einem Kriegsunternehmen beteiligten und noch nicht allen Verbotsbestimmungen folgten, erstreckte sich diese Vorschrift auf 6 Tage.
Die Böte wurden von einander gelöst und jeder Besitzer führte das seine wieder mit, nur die beiden mittelsten, die mit Bambus und Büscheln halb entfalteter, noch weisser Palmblätter verziert waren, blieben am Ufer liegen. In diesen Büscheln hingen zwei alte Köpfe, die der Sultan von Kutei Kwing Irang einst geschenkt hatte. Mit diesen Köpfen nahmen diejenigen Kajan, die auf ihren Reisfeldern wohnten und sich nicht so früh zum be̥t lāli hatten einstellen können, im Laufe des Tages das ngajo̱ vor. Sie kamen mittags zusammen und fuhren, wenn ihr Alter es zuliess, in Kriegskostüm unter den Schlägen der Gonge zu einer Geröllbank am jenseitigen Ufer. Ein Priester und einige Männer in voller Kriegsrüstung begleiteten sie. Die Knaben, die noch keine Federn des Rhinozerosvogels tragen durften, hatten mit Palmblättern und Palmblattstielen verzierte Kriegsmützen aufgesetzt.
Auf der Geröllbank wurde einer der Schädel an Land gebracht und niedergelegt; der Priester brachte ein Ei zum Vorschein, redete die Geister des Batu Kasian an und zerschlug das Ei, worauf alle neuen Teilnehmer ein Blattstück in die Eimasse tauchten, in den Fluss warfen und hinabtreiben liessen. Dann tranken sie etwas Flusswasser, badeten sich und legten die Kriegsrüstung wieder an. Auch der Priester nahm ein Bad, nachdem er das Ei in den Fluss geworfen hatte. Darauf bewiesen alle Jünglinge ihren Mut, indem sie mit ihren Schwertern den Schädel berührten, mit ihren Speeren hineinstachen oder mit ihren Blasrohren Pfeile auf ihn abschossen. Die Mutigsten setzten sich auf den Schädel, nachdem sie ihren Kriegsmantel über ihn gebreitet hatten. Nach beendeter Zeremonie würde der Bambus, der den Schädel trug, wieder ins Boot gepflanzt und die Gesellschaft kehrte nach Hause. [179]
Die gleichen Zeremonien fanden am folgenden Tage mit den Nachzüglern statt.
Der zweite Tag wurde hauptsächlich dem Vorzeichensuchen an Opfertieren gewidmet. Den Anfang machte der Häuptling; alle übrigen folgten.
Der Häuptling opferte ein männliches Schwein und einen Hahn, diesmal vor allem den Geistern auf dem Batu Mili. In seiner schönsten Kleidung, umgeben von seinen vornehmsten Mantri und dājung, sprach der Häuptling auch jetzt die Geister selbst an; doch verstand ich ihn wegen der dröhnenden Schläge auf die Gonge nur schlecht. Während er sprach, hielt er den Hahn, um den man einen schönen, kostbaren Leibgürtel aus alten Perlen gelegt hatte, in der Hand. Das Tier wurde geschlachtet und der Bauch geöffnet, um nach der Beschaffenheit des Darmes, der Gallenblase und des Pankreas die Zukunft zu bestimmen. Ein glatter, nicht roter Darm, ein Pankreas, das nicht viel länger oder kürzer ist als die Darmschlinge, zwischen welcher es befestigt ist, und eine volle Gallenblase sind günstige Omina. Da der erste Hahn des Häuptlings die gewünschten Vorzeichen nicht aufwies, schlachtete er einen zweiten, der in der Tat eine bessere Zukunft prophezeite.
Darnach wurde auch das Schwein geschlachtet und seine Leber und Milz untersucht. Die Milz muss lang, dünn und ohne Ausbuchtungen am Rande sein, die Leber eine normale Grösse und Farbe zeigen und die gut gefüllte Gallenblase in richtigem Verhältnis zu den Lappen an der Unterseite der Leber stehen.
Glücklicherweise waren die Vorzeichen hier sogleich zufriedenstellend und konnte das Blut des Schweines und des zweiten Huhnes aufgefangen und mit gekochtem Reis und Hühnerfleisch den to̱ angeboten werden.
Inzwischen hatten alle Männer, die an der Kopfjagd beteiligt gewesen waren, in der Galerie ihr Kriegskostüm angelegt und ihren Müttern und Angehörigen einen Hahn und ein Küchlein gebracht, um durch einige Priester und Priesterinnen für jede Familie gesondert die Vorzeichen zu beobachten.
Die dājung schnitten dem Küchlein den Hals durch und suchten dann die Zeichen. Darauf schlachteten sie den Hahn als Speise für Götter und Menschen. Sind die Vorzeichen bei dem ersten Küchlein nicht befriedigend, so werden andere getötet, bis die Omina günstig sind.
Die Opferspeise wurde den Geistern gelegentlich des ngajo̱ auf besondere Weise angeboten, so wie es nach grossen Expeditionen üblich [180] ist. Alle Familien flochten aus Bambus einen Rahmen von 2½ dm Seitenlänge. An die 4 Ecken des Rahmens wurden Schnüre befestigt und an einen Stock gebunden und darauf Kopf, Schwanz und Füsse des Hahnes unten an den Rahmen gehängt. Der Reis, das Huhn und das Blut wurden zwischen 8 Bananenblätter gelegt, zu einer kawit zusammengerollt und mit einem Bambus auf den Rahmen festgesteckt. Das Ganze stellte also, wie am Mendalam, eine blăkă ajo̱ dar (T. I p. 126). Nachdem gegen Abend alles bereit war, hing man alle blăkă unter Kriegsrufen und Schlägen auf die Gonge oben in der Galerie auf.
Die an der Kopfjagd Beteiligten durften jetzt wieder Hühnerfleisch geniessen.
Nicht nur die Geister, sondern auch die Schwerter, Speere, Schilde, Gonge u.s.w. wurden gespeist, um sie günstig zu stimmen und ihre amei (Vater), inei (Mutter) und harin (Blutsverwandten) dazu zu bewegen; zu den Kajan zu kommen. Die Sklaven boten ihre kawit dem Schwerte des Häuptlings an.
Abends bemerkte ich, dass man auch den Schädeln Speise in Bananenblättern angeboten hatte. Mit einem der Schädel wurde wiederum eine Zeremonie vorgenommen. Alle Teilnehmer, auch der Häuptling, legten ihre schönste Kriegskleidung an und berührten wiederum mit Schwert und Speer den Schädel, worauf der älteste und angesehenste Mantri des Stammes eine me̥lă mit ihnen vornahm, indem er die Männer mit Blättern, die er in Schweine- und Hühnerblut getaucht hatte, bestrich. Die Betreffenden mussten während der Zeremonie den einen Fuss auf einen alten Gong setzen. Kwing Irang in seinem malerischen Kostüm mit Kriegsmantel, grosser, mit tingang-Federn verzierter Kriegsmütze und schönem Schild mit Haarschmuck wurde als erster behandelt. Der tiefe Ernst auf den Gesichtern, die feierliche Stille in der grossen, schwach beleuchteten ăwă wirkten ergreifend, und die Krieger, die zu vieren gleichzeitig vortraten, bildeten im schräge einfallenden Schein der Fackeln phantastische Gruppen.
Bei der Angst der Männer vor den Schädeln und den aufgerufenen Geistern liess sich ihre Gemütsverfassung begreifen, ebenso, dass sie zur Beruhigung ihrer Seele eine ernste me̥lă nötig hatten.
Nach beendeter Zeremonie betraten immer mehr Menschen die ăwă, alle so schön gekleidet, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Es sollte nämlich ein allgemeiner Tanz, ngarang, stattfinden, der erste seit vielen Jahren, da die Kajan nach der Brandschatzung ihres Dorfes im [181] Jahre 1885 noch keine so grosse ăwă besessen hatten. Nun war die 11 × 25 m grosse Galerie voll von Leuten, die in zwei grossen Kreisen am Tanze teilnahmen. Die Männer in Kriegsrüstung, die Frauen und Kinder in Festkleidung, fügten sich alle fröhlich und voller Eifer in den Reigen, der unter den Tönen der Gonge bis zum anderen Morgen fortgesetzt wurde.
Nach einer mehrstündigen Rast begaben sich die Männer gegen Mittag in 12 Böten ans andere Ufer, wo sie sich in malerischen Gruppen auf der Geröllbank und den Felsen lagerten. Jeder warf etwas Reis und Fischfleisch in den Fluss und ass selbst etwas davon. Hiermit war das ngajo̱ beendet. Kwing Irang wollte jedoch jetzt, wo er nach dem Einzug ins neue Haus an eine Reise mit uns zur Küste denken durfte, die Gelegenheit benützen, um ein Vorzeichen für das Unternehmen zu suchen. Er nahm daher einen Flusskrebs in die Hand, erklärte dem Tier den Zweck der Probe und setzte es dann ein Stück weit in ein mit einem Spalt zum Beobachten versehenes Bambusrohr. Kroch das Tier zum langen Ende des Bambus, so war das Omen günstig, im entgegengesetzten Fall aber ungünstig. Zum Glück wählte der Krebs das lange Ende.
Nach der Heimkehr richtete jeder Festteilnehmer am Ufer vor dem Hause einen zugespitzten Pfahl auf und damit war das Fest beendet. Die Schädel wurden nicht in der ăwă, sondern unter dem grossen Hause aufgehängt.
Die Häuser der Freien werden auf die gleiche Art wie die der Häuptlinge gebaut, nur ist das verwendete Material leichter und die Einrichtung einfacher. Das auf Taf. 37 und 1–8 als Beispiel abgebildete panjin-Haus hatte eine etwa 8 m tiefe und 8.5 m breite amin, während die ăwă gleich breit aber weniger tief war. Betrachten wir zuerst den Querschnitt, dann die Seitenansicht und den Grundriss dieses Hauses.
Der Querschnitt fällt mit der Richtung des Dachfirstes zusammen und schneidet den Grundriss c der Wohnung über die Linie 1–2. Er zeigt, dass die Konstruktion der panjin-Häuser mit der der Häuptlingshäuser übereinstimmt, dass sie jedoch in diesem Fall einfacher ist.
Das Gebäude wird getragen von den Eisenholzpfählen (h, dje̥he̱), welche die āling g unterstützen. Auf diesen ruht eine doppelte Reihe von Balken r und s, welch letztere als Unterlage für die eigentlichen [182] Fussbodenbretter v dient. Die Diele zeigt von rechts nach links erst den Querschnitt der Bretter vor dem Eingang zur ăwă (a auf dem Grundriss C), dann derjenigen vor dem Herdplatz, welche etwas höher liegen und schliesslich der viel höheren Bretter vor der Aussenwand, vor der die Schlafräume c2 und c3 liegen.
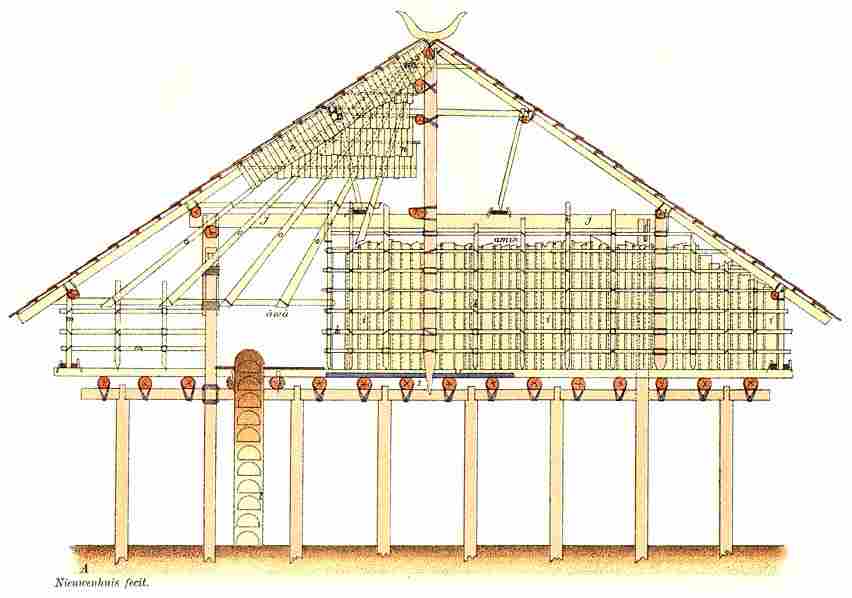
Seitenansicht eines panjin-Hauses.
Die Dachkonstruktion is derjenigen von Kwing Irangs Hause sehr ähnlich. Rechts wird der Firstbalken von dem hohen Eisenholzpfahl h getragen, links von dem Eisenholzbalken u, der mit seinem zugespitzten Unterende in dem horizontalen pe̥njăpai r eine Stütze findet. Ausserdem ruht der Firstbalken auf einem Holzgitter, das von dem Mittelbalken t gestützt wird. Getragen wird dieser Balken von den walang bahi-u j und an der linken Seite überdies von dem Balken, an dem das kleine dreieckige Dach o und u befestigt ist. Auch hier sind die verschiedenen Teile entweder ineinander gefügt und mit Rotang gebunden oder mit Holzstiften befestigt, wie sie am Balken t zu sehen sind.
Die Seitenansicht (A Taf. 37) dieses Hauses zeigt nicht nur seine innere Anlage von vorn nach hinten, sondern auch den Bau der freien Seite, da ich als Beispiel das letzte Familienhaus der langen Häuser reihe gewählt habe, um die Konstruktion der Seitenwand vorführen zu können. Rechts auf der Zeichnung sieht man, dass die ganze hintere Haushälfte bei der amin mit Brettern i verschalt ist, die beinahe bis zu den balang bahi-u j reichen und an einem Holzgitter k befestigt sind, das durch die Stützbalken der walang bahi-u und des Daches gestützt wird. Die Galerie ist seitlich durch keine Wand abgeschlossen; wie die Treppe 1 andeutet, dient ihre hintere Hälfte als Eingang, die vordere ist, wie auch die Vorderseite des ganzen Hauses, durch ein offenes Holzgitter abgeschlossen.
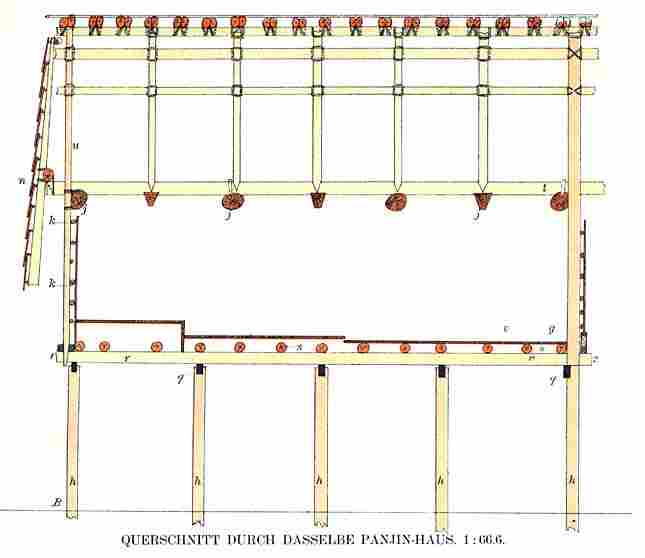
Querschnitt durch dasselbe panjin-Haus.
Über der Seitenwand liegt das dreieckige Dach, das aus oben zusammenlaufenden Sparren o besteht, die hier nur in der linken Hälfte gezeichnet sind und, wie auch an der Vorder- und Hinterseite, mit vielen Reihen von Schindeln n (ke̥pāng) bedeckt sind. Auch die panjin wählen für diese in der Regel das gut spaltbare Tengkawang-Holz. Angegeben ist ferner noch, wie das Seitendach an der Berührungslinie mit dem Vorder- und Hinterdach durch eine Reihe schräg angebrachter Schindeln p geschützt wird.
Ein Blick auf den Grundriss C orientiert uns über den Bau dieses Hauses in horizontaler Ausdehnung.
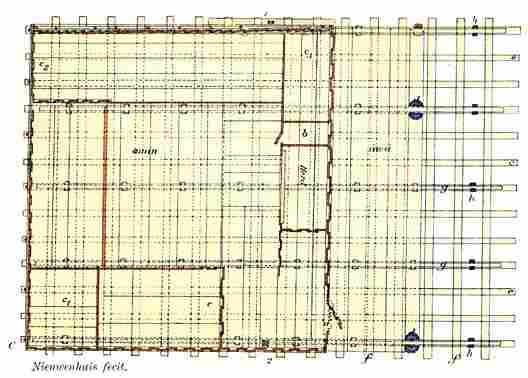
Grundriss des panjin-Hauses.
[183]
Von der ăwă gelangt man über eine geschnitzte Türschwelle a in einen Raum, der rechts durch eine Wand vom Herdplatz geschieden ist und gradeaus durch die Vorderwand einer Schlafkammer c begrenzt wird. Der mittlere Raum der ăwă ist viereckig, an allen Seiten von einem um 1 Fuss erhöhten, beinahe 2 m breiten Fussboden eingeschlossen. In den Ecken finden sich auf letzterem Kammern, c, c2 und c3; in denen die Familienglieder schlafen oder ihre Sachen aufbewahren. Zwischen der Tür und dem Schlafplatz c3 in der rechten Ecke befinden sich, durch Wände voneinander getrennt, der Herdplatz und eine Vorratskammer b mit oder ohne Tür. Rechts, unmittelbar neben der Eingangstür, stehen gewöhnlich die Bambusgefässe mit Wasser.
Bei der ăwă sind auch die beiden grossen Pfähle d im Durchschnitt angegeben; sie unterstützen die Vorderenden der walang bahi-u auf dieselbe Weise wie bei Kwing Irangs Hause. Die Pfähle d scheiden, wie in der Galerie des Häuptlings, den hinteren Teil der ăwă, der als Durchgang für den ganzen Stamm dient, von dem vorderen, den die Familie als Arbeitsplatz benützt. Auf dem Grundriss ist nur der hintere Teil der ăwă gedielt gezeichnet, auf dem vorderen sind die Bretter zum Teil weggelassen, so dass man von oben auf die dọro̤̱ng e und die pe̥njăpai f sieht. Auch die hier in der Regel kleinen, aber sehr festen āling g aus Eisenholz mit den zugehörigen dje̥he̱ h, ebenfalls aus Eisenholz, sind angegeben.
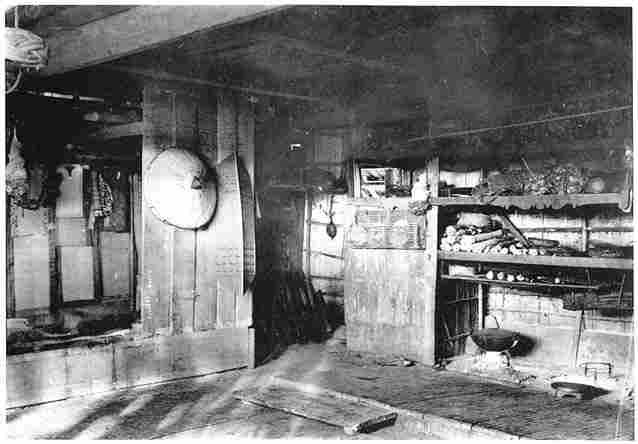
Inneres einer Kajanwohnung A.
Die innere Einrichtung der amin lernt man am besten durch eine Betrachtung der beiden Tafeln 39 und 40 kennen. Erstere zeigt deutlich den Bau des Herdes. In der dunklen Ecke des Hintergrundes befindet sich die Eingangstür, links von ihr die erhöhte Diele mit der Bretterwand, an welcher ein Schild und ein Sonnenhut hängen. Die Hinterwand dieser Kammer ist mit aufgerollten Palmblattsäcken verziert. Links oben hängt ein Fischnetz und eine Rotangmütze. Rechts von der Tür sieht man eine Bretterwand und dann den Herd nebst den Regalen mit Brennholz und Küchenvorräten, die hier durch den Rauch getrocknet und konserviert werden. An der Bretterwand hängt ein Bambusgestell mit europäischen Tellern und darüber wieder ein aufgerolltes Wurfnetz, unter welchem die Kette (awit) deutlich zu sehen ist. Gut sichtbar ist ferner die erhöhte Diele vor dem Herde und auf diesem die Dreifüsse und das eiserne Kochgefäss. Der Mitte zu liegen Rotangmatten auf der Diele ausgebreitet. Taf. 40 giebt die andere Hälfte derselben amin wieder. Hier sehen wir links die Fortsetzung [184] der Küchenregale, dann nach rechts zu einen Vorratsraum mit einem Reiskorbe unten und darüber Regalen. In der Ecke befindet sich eine halbgeschlossene Schlafkammer, in der das in eine Matte gerollte Kissen (hle̱n) liegt. Die Wand ist auch hier mit Palmblattmatten verziert und mit allerhand Gegenständen behängt. Die rechte Hälfte des Bildes zeigt die linke Seitenwand des Hauses, längs welcher die erhöhte, mit einer grossen Rotangmatte bedeckte Diele läuft. Den Reichtum des Besitzers dieser amin, des alten Oberpriesters Bo Jok, beweist die Reihe schöner, wenn auch neurer tempajan, die hauptsächlich zur Aufbewahrung von Reis dienen. Links von den tempajan stehen zwei ingan dawan (Körbe), welche den Hausschatz enthalten. Um sie beim ersten Alarmzeichen in Sicherheit bringen zu können, stehen sie in kiāng, Tragbutten (Siehe Taf. 54 a). Auf die ingan sind zwei Gonge gebunden, wie sie bei religiösen Zeremonien von den Priestern benützt werden. Rechts von den tempajan steht ebenfalls ein ingan dawan, aber ohne kiāng und zu beiden Seiten psau, Tragkörbe aus Rotang, voller aufgerollter Matten (samit).

Inneres einer Kajanwohnung B.
An der Holzwand, an welcher die mit einem Dechsel bearbeiteten Bretter zu unterscheiden sind, hängen Schwerter, eine dicke Kriegsjacke und eine Sitzmatte (tabin) für Männer. Über dem allem ein Regal aus dünnen, runden Stöcken, auf dem Matten und Körbe aufbewahrt werden. Rechts in der Ecke hängen von der Decke wieder Kriegsmützen mit Federschmuck herab.
Von dem Bau der Mittelwand und der Eingangstür (be̥taman) macht man sich am besten nach Tafel 28 eine Vorstellung. Die übereinander greifenden Wandbretter sind mit Rotang aneinander gebunden und stehen auch hier auf einer horizontalen Planke, welche als Getäfel dient. Bemerkenswert ist die Umrahmung von Tür und Schwelle, die ganz aus hübsch geschnitzten Figuren besteht, denen das Genitalmotiv zu Grunde liegt. Die an die Wand gelehnten Bambusgefässe dienen, um das Schweinefutter nach unten zu tragen.
Beim Einzug eines panjin in seine neue Wohnung begeben sich alle Familienglieder, die wertvollsten ingan dawan auf dem Rücken, unter Beckenschlag in die amin aja und tun, als ob sie das gute Vorzeichen, das der Häuptling seinerzeit für sein eigenes Haus gesucht hatte, mitnähmen. Nachdem sie in der eigenen amin etwas gegessen haben, holen sie aus derselben Grube, welche der Häuptling gegraben hatte, Erde für den Herd. Das erste Feuer wird aus der [185] amin aja herübergebracht; es darf zwei Tage lang nicht ausgehen. Dicht neben ihrem Wohnhause bauen die Bahau und Kĕnja kleine Scheunen (le̥po parei) zur Aufbewahrung von Reis und Wertgegenständen. Diese Scheunen stehen ebenfalls auf Pfählen, welche zum Schutz gegen Mäuse und Ratten auf halber Höhe oft grosse Holzscheiben durchsetzen oder mit Blech beschlagen werden. Die Pfähle sind weniger hoch als die der Wohnhäuser und die Bodenfläche der Scheunen selbst beträgt meist nicht über 4–5 qm. Die Scheunen werden aus dem gleichen Material wie die Häuser gebaut. Der gerade First wird nur von den Häuptlingen an den beiden Enden mit bang pakat verziert.
Über den Häuserbau der Kĕnja, der in mancher Hinsicht von dem der Bahau abweicht, soll bei späterer Gelegenheit noch einiges berichtet werden. [186]
Kapitel VIII.
Charakter der Industrie bei den Bahau und Kĕnja—Herstellung von Kleidung: Spinnerei-, Weberei; Verzierung durch Figuren, Stickereien, Knüpfarbeiten; Baumbastkleidung—Schmieden: Werkzeuge—Eisengewinnung; Herstellung von Arbeitsgerätschaften, Lanzen, Schwertern; Verzierung der Schwerter—Schnitzerei: Griffe und Scheidend Holz- und Bambusschnitzerei—Flechterei: Zubereitung von Rotang, kĕbalan, tika, samit; Flechten von Körben, Matten, Hüten; Flechtarbeit für Waffen—Töpferei—Bootsbau: Wahl und Behandlung des Materials; Roharbeit; Endbehandlung—Kalkbrennerei—Herstellung von Schmuck aus Steinen und Perlen: Wert der Perlen, ihre Herkunft, Verwendung; Rolle der Perlen in der Kulturgeschichte.
Die Industrie trägt bei den Bahau- und Kĕnjastämmen völlig den Charakter einer Hausindustrie. Jede Familie stellt nur für sich selbst oder ihre unmittelbare Umgebung die erforderlichen Gegenstände her. Dass jemand mit einer grossen Anzahl Gehilfen arbeitet, kommt denn auch nicht vor; höchstens hält sich ein Schmied einen Knecht, der ihm regelmässig hilft; aber auch Meister und Knecht üben ihr Handwerk nur neben dem Landbau aus, der häufig auch bei ihnen die Hauptsache bleibt. Von Grossindustrie ist also keine Rede, und bei der Beurteilung des auf diese Weise Produzierten muss berücksichtigt werden; dass die Arbeit nicht von Personen geleistet wird, die sich ihr ausschliesslich widmen, wie in der europäischen Industrie. Den eingeborenen Handwerkern fehlt daher die durch ständige Herstellung gleicher Gegenstände erworbene Fertigkeit. Ferner arbeiten sie mit mangelhaften Hilfsmitteln und werden durch ihre einfachen und ärmlichen Verhältnisse gezwungen, billiges Material zu verwenden. Sowohl Bahau als Kĕnja verarbeiten denn auch selbst kein Silber oder Gold; was an Zierraten aus diesen Metallen in ihrem Lande verfertigt wird, stammt von Malaien her.
Ein anderer auf den Fortschritt lähmend wirkender Umstand ist, dass in den verschiedenen Industriezweigen kein Unterricht erteilt wird, sondern jeder Anfänger selbst in mehreren Fächern Übung zu erlangen suchen muss; höchstens bietet sich ihm Gelegenheit, von einem [187] anderen Handwerker die Arbeit abzusehen oder ihm bei derselben zu helfen.
Fühlt sich jemand zu einem bestimmten Fach hingezogen, so verhindern ihn oft die Sorgen um seinen und seiner Familie Unterhalt, seiner Neigung Folge zu leisten.
Da jeder die meisten zum Leben erforderlichen Dinge selbst herstellt und die Ausübung eines bestimmten Handwerks keinen einträglichen Erwerb bildet, wird ein eingeborener Fachmann nicht, wie bisweilen ein europäischer, gerade durch Sorge und Not zu den höchsten Leistungen angeregt; die besten Produkte werden im Gegenteil von Gliedern wohlhabender Häuptlingsfamilien oder Freien hervorgebracht; Unbemittelte dagegen leisten nur selten etwas Besonderes.
Ein Vorteil für die dajakische Industrie liegt darin, dass ihr ganzes künstlerisches Können und ihr Geschmack sich auf das Gebiet des Handwerks konzentrieren, da bei ihnen nicht, wie in höherstehenden Gemeinwesen, eine bestimmte Kunst, wie z.B. die Bildhauerkunst oder Malerei, vorhanden ist, die nur der Kunst halber Gegenstände hervorbringt. Die Industrie der Bewohner Borneos kann, trotz der bescheidenen Grenzen, innerhalb welcher sie sich bewegt, in einigen Zweigen als Kunstindustrie bezeichnet werden. Mit der reinen Kunst entwickelterer Völker steht diese sogar in engem Zusammenhang.
Dass unter den oben geschilderten Umständen die Industrie der Dajak nicht zur vollen Ausbildung hat gelangen können, vielmehr das Kennzeichen einer beschränkten, Umgebung trägt, ist also begreiflich; immerhin sind ihre Leistungen noch so bedeutend und umfassend, dass jedes Fach im folgenden eine eingehende Betrachtung verdient. Alles, was sich speziell auf das Kunstgebiet bezieht, wie z.B. die Erklärung der dajakischen Verzierungsmotive, wird im folgenden Kapitel gesondert behandelt werden.

Arbeitende Kajanfrauen.
Von allen Industriezweigen ist die Bekleidungsindustrie für die Bevölkerung Mittel-Borneos die wichtigste. Nach den noch aus alten Zeiten erhalten gebliebenen Kleidungsstücken zu urteilen, haben die Dajak diese ursprünglich hauptsächlich aus Baumbast verfertigt und ist die Weberei erst später bei ihnen eingeführt worden. Zu dieser Ansicht führte mich vor allem die Tatsache, dass bei fast allen Stämmen für die Weberei dieselben beschränkenden Bestimmungen zu finden sind, die für alles Fremdländische zu gelten pflegen: so darf bei den zu den [188] Ot-Danum gehörenden Ulu-Ajar am Mandai nicht im Hause selbst, sondern nur in besonders zu diesem Zwecke errichteten Hütten gewebt werden; derselbe Brauch herrscht bei den Kĕnja. Bei den Kajan am Blu-u ist den Priesterinnen das Weben verboten, und so bestehen noch mehr derartiger Vorschriften. Doch muss die Webekunst bereits vor langer Zeit in Mittel-Borneo eingeführt worden sein, denn bei einigen Stämmen ist sie schon wieder verschwunden. Letzteres hängt mit der auch in so mancher anderen Hinsicht auf die inländische Kultur zersetzend wirkenden Berührung mit der Küstenbevölkerung zusammen. Die Herstellung eins Stoffes kostet nämlich Männern und Frauen viele Arbeit, da sie auch das erforderliche Material erst anbauen (Baumwolle und Ananasfasern) oder im Walde suchen müssen (Lianenfasern). Dann muss dieses zu Fäden verarbeitet, gesponnen oder aneinandergeknüpft und schliesslich gewebt werden. Alle diese auf primitive Weise vorgenommenen Prozeduren erfordern viel Zeit und Mühe. Infolgedessen bevorzugen die Eingeborenen den bei ihnen eingeführten europäischen Kattun, der nicht teuer und nach ihrer Ansicht schön bedruckt ist, und verfertigen das eigene Fabrikat nur noch für starke grobe Kleidung; in den reichen Familien wird auch noch zum Luxus gewebt.
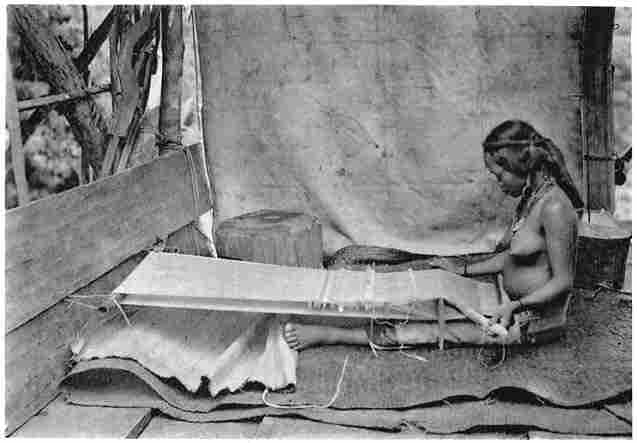
Webende Kajanfrau.
Weniger als die eigengewebten Stoffe sind die aus Baumbast durch europäische Produkte verdrängt worden, weil die Baumbastkleidung viel müheloser herzustellen und dabei dauerhaft ist.
Augenblicklich weben von den Stämmen der Bahau und Kĕnja nur noch diejenigen, die in zu grosser Entfernung von der Küste leben, um sich in billiger und genügender Weise mit eingeführten Zeugen versehen zu können. So weben hauptsächlich die Frauen der Kajan und Pnihing am oberen Mahakam und die der Kĕnja in Apu Kajan. Die südlicher wohnenden und überdies reicheren Long-Glat und Ma-Suling betreiben die Weberei jetzt überhaupt nicht mehr, doch liessen sie mich noch alte Webereien ihrer Vorfahren sehen, wie sie auch die Bahaustämme am oberen Kapuas noch aufweisen konnten.
Die Dajak verwenden zum Weben folgendes Material: zwei Arten von selbstgebauter Baumwolle; Ananasfasern, die man erhält, indem man von langen Blättern auf hierfür bestimmten Brettern (Taf. 61, c) mit scharfen Bambusspähnen die weichen Teile fortkratzt, die übrigbleibenden Fasern ausspült, trocknet und in der Sonne bleicht; eine Art von Lianenfasern, die man tengāng nennt und vor allem für Stricke und Netze gebraucht und endlich 3 Arten von Baumbast kĕdĕob, nĕgong [189] und damei, die sich nach dem Auswaschen und Trocknen zu langen Fäden spalten lassen. Der tengāng besteht aus dem Stamm einer Liane, die sich nach dem Trocknen auch mit den Fingern leicht in lange feine Fasern spalten lässt. Die Baumbastfasern werden nicht wie die des tengāng zu Fäden zusammengedreht, sondern aneinander geknüpft und dann nicht als Einschlag, sondern nur als Kette benützt; zu ersterem wird dann Baumwolle oder tengāng verwendet.
Die Pnihingfrauen am Mahakam wussten sich auf besondere Weise dunkelblaue Baumwollfäden zu verschaffen. Sie kauften eine Art von lose gewebtem dunkelblauem Kattun, der für weiche Lendentücher bei ihnen eingeführt wird, zogen aus dem Zeug die Fäden aus und verwebten diese dann zu ihren eigenen Stoffen.
Das Spinnen der Baumwollfäden geschieht mittelst Stäbchen, welche auf die in der oberen Abbildung von Taf. 45 dargestellte Weise gehandhabt werden. Die Frau rechts hält in der rechten Hand die Baumwolle, während sie mit der linken das mit einer schweren Scheibe aus Stein, Muschel oder Baumfrucht versehene und auf einer harten glatten Unterlage ruhende Stäbchen zum Drehen bringt. Die Feinheit des so hergestellten Fadens ist sehr verschieden und hängt hauptsächlich von der Geschicklichkeit der Spinnerin ab.
Die Frau links auf dem Bilde dreht aus den Fasern von tengāng einen Faden. Die hierfür gebräuchlichen Faserstücke sind etwa 3–4 dm lang und werden zu zweien derart zusammengedreht, dass ihre Enden auf verschiedener Höhe liegen. Die Fasern werden auf bestimmte Weise mit dem Ballen der Hand auf dem blossen Bein gerieben und so zu einem sehr gleichmässigen Faden vereinigt, der durch Hinzufügung neuer Faserstücke stets verlängert wird.
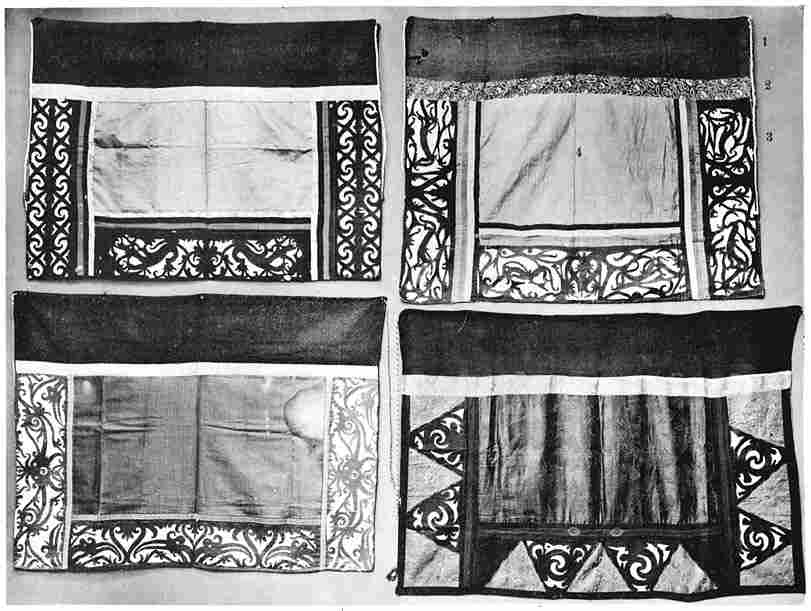
Röcke der Kajanfrauen.
Früher war auch das Färben von Baumwolle sehr im Schwange; man färbte sie braun, indem man die Fäden im Morast liegen liess, rot durch Eintauchen in Drachenblut, grün durch Kochen in dem grünen Farbstoff einer Liane. Gegenwärtig finden die von den Malaien vielfach eingeführten Anilinfarbstoffe mit ihrem sehr lebhaften Kolorit allgemeine Verwendung. Bei den Bahau und Kĕnja sah ich nie die Methode des ikat, der Knotenfärberei, anwenden, d.h. das Bedecken gewisser Teile der zu färbenden Fäden mittelst Pflanzenfasern, wohl aber unter den Batang-Luparstämmen und Ot-Danum. Ein einfaches Tuch, das ich bei den Mahakamkajan kaufte, war allerdings mit Anwendung der Bindemethode gefärbt worden, doch ist seine Herkunft unsicher. [190]
Das Weben geschieht bei den Dajak nach der auf Taf. 42 dargestellten Weise mit dem gewöhnlichen, einfachen Apparat, der im indischen Archipel sehr verbreitet ist. Mit diesem Webstuhl stellen sie nur einfache Arten von Zeug her. Das Weben in Mustern verstehen sie nicht, sie können nur Rauten herstellen, die in allerhand Variationen bei den verschiedenen Stämmen wiederkehren. Eine Abwechslung im Gewebe rufen sie hauptsächlich dadurch hervor, dass sie die Fäden der Kette in Farbe und Material ändern, ein Verfahren, das als Beginn einer Figurenweberei betrachtet werden kann. Die so gewebten Zeugstücke sind so schmal, dass für einen Frauenrock zwei übereinander genäht werden müssen.
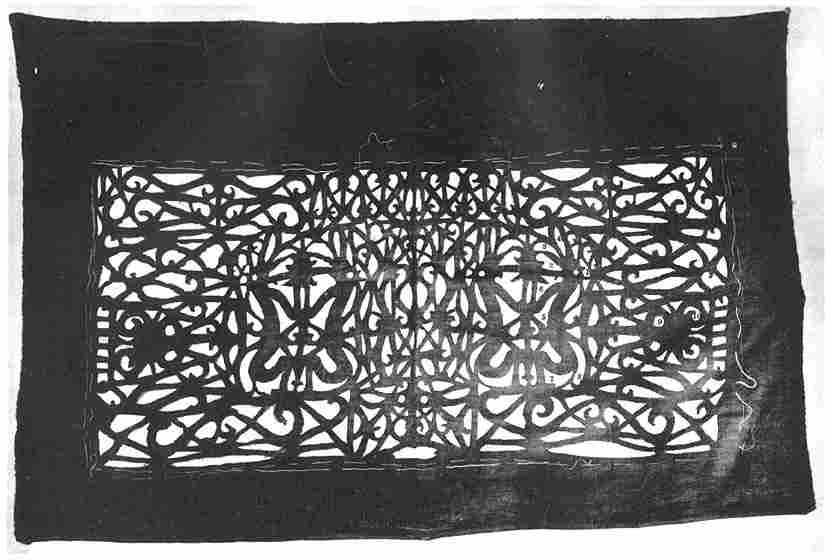
Unfertiger Frauenrock.
Das Spinnen und Weben wird von den Bahau als eine ausschliesslich weibliche Arbeit aufgefasst; die Männer fürchten, bereits durch die Berührung eines Webstuhls an ihrer Männlichkeit einzubüssen (takut dawi T. I p. 350) und sind daher zum Tragen desselben nicht zu bewegen.
Die verschiedenen Stoffe der Dajak dienen alle zur Herstellung von Kleidungsstücken; die aus Baumbast und Lianenfasern gewebten werden für Arbeitskleider gebraucht; für Frauen verfertigt man aus ihnen einfache Röcke (Taf. 19 T. I) und Jacken mit oder ohne Ärmel nach dem Modell von Taf. 49, für Männer Lendentücher und die gleichen schlichten Jacken. Die weissen und farbigen Zeuge aus Baumwolle (bura) und Ananasfasern (usan) werden vorzugsweise für hübsche, bei Festen getragene Kleider verwandt.

Arbeitende Kajanfrauen.
Die Verzierung dieser Festkleider wird für Männer und Frauen auf gleiche Weise vorgenommen, nämlich durch ausgeschnittene Zeugfiguren, Stickereien und Knüpfarbeit. Auf erstere Art verzierte Frauenröcke sind auf Taf. 43 und 44 abgebildet. Die Ränder der 4 Röcke der Kajanfrauen bestehen aus geschmackvoll ausgeschnittenen Figuren von dunklem Zeuge, die auf weissen Kattun als Grund geheftet sind. Während die Borten von a, b und c gänzlich aus Streifen solcher Figuren bestehen, sind sie bei d in Dreieckform mit ebenfalls dreieckigen Stickereien kombiniert, derart wie sie auf Tafel 46 abgebildet sind.

Arbeitende Kajanfrauen.
Röcke von dieser Form werden allgemein von den Kajanfrauen getragen; die Pnihing ziehen ein verziertes Mittelfeld vor, wie Taf. 44 es in unvollendetem Zustande darstellt. An diesem Exemplar lässt sich die Art der Herstellung gut verfolgen: das ausgeschnittene dunkelblaue Kattunstück ist mit Pflanzenfasern um das Figurenfeld herum [191] auf darunterliegenden weissen Kattun geheftet; auch die Linien der Figuren sind zu beiden Seiten mit schwarzen, auf dem Bilde kaum sichtbaren Fäden auf die Unterlage genäht. Einige Schatten auf der linken Seite deuten darauf, dass die Figuren hier noch nicht alle befestigt sind, wie es rechts der Fall ist. An dieser komplizierten Figur ist die Symmetrie eine absolute; sie kam zustande, indem man das noch unbearbeitete Zeugstück einmal zusammenfaltete, die Figuren ausschnitt und die beiden Teile dann auseinanderschlug. Während das Nähen der Röcke ausschliesslich von Frauen besorgt wird, ist das Ausschneiden der Figuren Sache der Männer. Diese legen das Zeug auf eine harte Unterlage, ein Brett z.B., und schneiden dann mit ihrem langen Messer (nju) die Figuren aus freier Hand aus. Dabei gebrauchen sie keine Vorlage oder Zeichnung auf dem Zeug, sondern schneiden nach freier Phantasie aus. Den ganzen Entwurf haben sie augenscheinlich bereits fest im Kopfe, denn sie ziehen die Hauptlinien schnell und ohne Zögern; die Einzelheiten des Ornaments scheinen sie sich erst allmählich auszudenken und erst während der Arbeit sorgfältig auszuarbeiten. Dass sie später auf die Verbesserung eventueller Fehler nicht viel Mühe verwenden, beweisen die Fäden, die an den ausgefransten Figurenrändern noch überall zum Vorschein kommen. Die Verzierung dieses Rockes zeugt in hohem Masse von den künstlerischen Fähigkeiten des Pnihing, der sie zustande brachte; der Entwurf ist sehr schön und reich kombiniert, die Gruppierung der Figuren als Mittelstück mit zwei Seitenstücken gut gedacht. Die Anwendung einer so komplizierten Arbeit für einen so vergänglichen Gegenstand wie einen Rock spricht für die geringe Mühe, die sie dem Künstler gekostet haben muss. Das Werk beweist zugleich eine grosse Geschicklichkeit in der Handhabung von Linien. Die dajakische Vorliebe für Tiermotive verleugnet sich auch hier nicht; zu beiden Seiten des Mittelstückes erkennen wir je zwei aufgerichtete Tierfiguren mit 4 Füssen und Schwänzen (1–8). An den Rändern seitlich sind noch je zwei Masken wiedergegeben, wie die Augen (g) und die stilisierten Nasenöffnungen (10) beweisen (Siehe Näheres folg. Kap.). Die Röcke der Kajanfrauen auf Taf. 43 sind alle nach dem gleichen Prinzip zusammengesetzt: in der Mitte ein Feld (Fig. b, 4) aus einfarbigem, un- oder schwachgemustertem europäischem Stoff, womöglich aus Seide, zu beiden Seiten und unten verzierte Ränder (3), die durch Streifen von einer (bei Fig. c) oder mehreren Zeugarten (Fig. a, b, d) [192] vom Mittelfelde abgegrenzt werden. Eine derartige begrenzende Borte, nur breiter, wird auch zwischen dem Felde 4 und dem breiten oberen Rand des Rockes angebracht, der stets aus einem Streifen von dunkelrotem Flanell oder Kattun bestehen muss. Gegenwärtig verwendet man für diese Borten am liebsten eingeführte Gold- oder Silberposamente, wie dies auch bei Fig. c der Fall ist; doch sind für die unteren und seitlichen noch immer am gebräuchlichsten Streifen von verschiedenfarbigem Flanell oder Kattun, die sich meistens sehr hart neben einander ausnehmen und einen lebhaften, aber unschönen Effekt hervorrufen. Besonders grosse Sorgfalt wird auf den breiteren, trennenden Streifen zwischen dem Oberrand des Rockes und dem unteren Teil verwendet. In den Figuren a und c besteht er aus einem breiten Stück Goldposament, in b (2) und d aus einem zwar nicht hübschen, aber doch besonderen Stoffe.
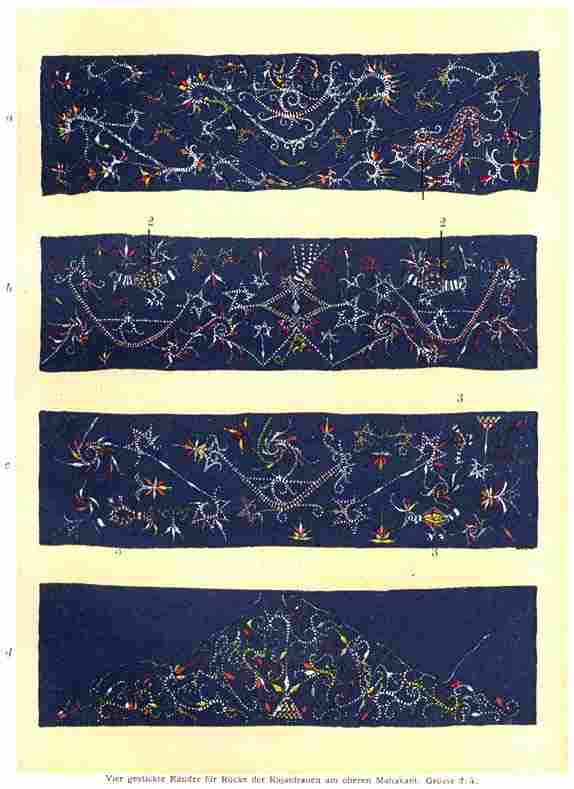
Gestickte Rockränder.
Bei den Kajan gelang es mir noch, einige alte bestickte Streifen zu erstehen, die zu obigem Zweck, zur Trennung des Oberstreifens vom Mittelfelde, benutzt wurden. Sie sind auf Tafel 47 unter a, b und c abgebildet. Sie sind alle aus eingeführtem, weissem oder schwarzem Kattun verfertigt und mit Figuren aus bunten Fäden bestickt. Wegen der Einfuhr- von bedrucktem Kattun geben sich die Frauen jetzt jedoch nur noch selten die Mühe, solche Streifen zu sticken. Als Verzierungsmotiv für die Rockränder mit ausgeschnittenen Figuren dienen Tiere; öfters jedoch besteht der Entwurf ausschliesslich aus Linien.
Ausser den eben genannten Rändern sind auch vielfach gestickte modern, von denen Tafel 46 einige vorführt. Meistens wird auf einfachen schwarzen oder dunkelblauen Kattun gestickt, bisweilen aber auch auf roten Flanell. Auf Tafel 41 sehen wir die Frau links damit beschäftigt, eine derartige Stickerei auf dem Zipfel eines Lendentuches anzubringen und zwar in der charakteristischen Form spitzer Dreiecke, wie sie für diese Kleidungsstücke gebräuchlich sind. Für diese Stickereien werden von den Männern keine Entwürfe hergestellt, sondern die Frauen führen die Figuren ohne vorausgehende Zeichnung während der Arbeit selbst aus.
Von dem Formen- und Farbensinn, den sie dabei entwickeln, Gibt Taf. 46 einen Begriff. Fig. a muss noch längs der die Stickerei durchziehenden Pflanzenfaser in drei Dreiecke zerlegt werden, um dann ebenfalls als Verzierung für Rockränder dienen zu können. Von den Dreiecken bestehen das mittelste und das linke aus Linien [193] figuren, das rechte dagegen hat zum Hauptmotiv eine stilisierte Hundefigur (1) mit nach links gewendetem Kopf, von dem ein Auge und die beiden langen Kiefern mit der Zunge dazwischen am besten erkennbar sind; die übrigen Körperformen, wie Hals, Leib, Beine und Schwanz sind in gefällig gebogenen Linien ausgeführt.
Rand b bildet ein fast völlig aus dekorativen Linien zusammengestelltes Ganzes, nur links und rechts (bei 2) sind Vogelfiguren mit nach aussen gewendeten Köpfen angebracht. Die schwarz und weiss gestreiften Schwänze deuten einen Nashornvogel an. Dasselbe gilt für Rand c, bei dem sich zwischen zierlichen Linienfiguren 3 Vogelformen (bei 3) unterscheiden lassen. Rand d ist nur halb ausgearbeitet und trägt erst ein stark verziertes mittleres Dreieck.
In gleichem Charakter ausgeführte Stickereien, aber, anstatt auf den Rändern, im Mittelfelde des Rockes, sind bei den Long-Glat im Schwange. Einen derartigen Rock trägt die mittelste Frau auf Tafel 8; dies ist Kwing Irangs zweite Frau, Uniang Anja, eine Long-Glat von Geburt. Die Hauptfiguren dieser Stickerei bestehen aus 6 Hundekörpern mit zur Mitte gekehrten Köpfen, welche je zu dreien über einander zu beiden Seiten angebracht sind. Im Gegensatz zu Uniang hat Kĕhad Hiāng, die rechts auf dem Bilde steht, einen Rock an, bei dem nach Kajanart nicht das Mittelfeld, sonder die Ränder bestickt sind.
Eine andere Art von Stickerei ist auf Tafel 47 an dem oberen Rande von Fig. d in 1 und an e in 3 zu sehen. Diese schmalen Streifen werden von den Frauen entweder als selbständige Verzierung oder, wie hier, in Verbindung mit einer weiter unten zu besprechenden Borte auf Jacken gestickt. Das Material besteht aus verschiedenfarbiger, eingeführter, dünner Baumwolle und auch der Stoff der Jacken ist häufig fremdes Fabrikat. Die mit sehr langen Kreuzstichen gearbeitete Stickerei ist nur dadurch beachtenswert, dass die Künstlerin sich bemüht, beim Durchstechen an der Rückseite des Zeuges von den Fäden so wenig als möglich sehen zu lassen, was ihr sogar auch bei dünnem Kattun merkwürdig gut gelingt. Ich glaube diese eigentümliche Nähweise darauf zurückführen zu müssen, dass auf diese Art früher und auch jetzt noch gelegentlich auf Baumbast gestickt wird, wobei die Fäden ebenfalls nicht bis auf die Innenseite durchgezogen werden dürfen. Ein bei der Dicke des Baumbastes sehr einfaches Verfahren erfordert jedoch bei dünnem Kattun grosse Geschicklichkeit.
An die eben beschriebenen Streifen auf Taf. 47 schliessen sich die [194] oben schon erwähnten Ränder an, die auf ganz besondere Weise hergestellt werden und am besten vielleicht als Knüpfarbeit (sĕrāwang) zu benennen sind. Das mit a bezeichnete Stück in Fig. d stellt einen Teil eines solchen Randes dar; er ist völlig ausgeführt und dient als untere Verzierung einer Kattunjacke. Der bei 4 in Fig. e abgebildete zweite derartige Rand ist noch unvollendet und daher geeignet, uns eine Vorstellung von der Entstehung dieser Knüpfarbeit zu geben.

Handarbeiten der Bahau.
Die Frauen arbeiten von rechts nach links mittelst eines Fadenbündels, das aus ebensovielen Fäden besteht als im Muster Farben vorkommen, hier also 5, und aus einer etwas dickeren Schnur. Den roten Faden, der z.B. auf dem Muster sichtbar werden soll, fädelt sie in eine Nadel und, indem sie mit der linken Hand die übrigen Fäden des Bündels festhält, zieht sie diesen roten Faden durch den unteren Rand der Jacke und knüpft dann mit ihm um das Bündel eine Schlinge, wodurch dieses an den Jackenrand fest angenäht wird; dann fährt sie fort, immer von rechts nach links so viele rote Schlingen um das Fadenbündel und durch den Jackenrand zu ziehen, als die Breite der roten Farbe im Muster sie erfordern. Für die links folgende Farbe, z.B. weiss, sucht sie den weissen Faden aus dem Bündel hervor, fädelt ihn durch die Nadel und knüpft wiederum die erforderliche Anzahl weisser Schlingen durch das Zeug des Jackenrandes und um das Fadenbündel. Indem sie so fortfährt, entsteht unten um den ganzen Jackenrand ein Streifen in den gewünschten Farben und von der Dicke des umknüpften Bündels der farbigen Fäden; unter diesem bringt sie nun ein zweites Fadenbündel an, indem sie auf die oben geschilderte Weise in den vom Muster vorgeschriebenen Farben eine neue Reihe von Schlingen knüpft. Die Nadel steckt sie aber diesmal natürlich nicht durch den Zeugrand der Jacke, sondern durch den untersten Rand des ersten Bündels. Die in jedem Fadenbündel steckende Schnur dient erstens dazu, dieses zu verdicken, zweitens um dem Knüpfwerk, dessen Schlingen nur schwer dicht genug aneinander gebracht werden können, durch nachträgliches Anziehen die nötige Festigkeit zu verleihen. Ein solches Bündel wird stets nicht auf einmal längs des ganzen Jackenrandes ausgearbeitet, sondern, sobald die Frau ein Stück weit gekommen ist, beginnt sie stets wieder eine neue Reihe von Bündeln untereinander anzubringen. In diesem Stadium sehen wir den unvollendeten Rand von 4 in Fig. e. Hier ist [195] der oberste Teil bereits fertig geknüpft, der unterste jedoch nur so weit gefördert, als die Fadenbündel 5–11 angeben; von diesen liegt 5 am höchsten, 6 darunter u.s.f. Soll an diesem Rand weiter gearbeitet werden, so beginnt man damit, den braunen Faden von Bündel 5 in eine Nadel zu fädeln, diese durch den vollendeten unteren Rand der Borte zu stecken und nun so viele Schlingen um Bündel 5 zu knüpfen, als die Breite der braunen Farbe sie erfordert. Dann vertauscht man den braunen Faden mit dem grünen und gebraucht diesen nun auf dieselbe Weise, bis die rote Farbe sichtbar werden muss u.s.w. Nach derselben Methode wird später Bündel 6 unter 5 befestigt und ferner 7, 8, 9, 10, 11, wodurch der Rand um die Dicke von 7 Bündeln breiter geworden ist. Während der Arbeit wird die Schnur im Bündel immer wieder straff angezogen. Eine derartig gearbeitete Borte ist äusserst fest und dauerhaft, obgleich die einzelnen Bündel nicht auf eine Unterlage von Zeug, sondern nur aneinander geknüpft worden sind.
Da das Knüpfen viel Zeit und grosse Übung heischt, sind solche Ränder sehr wertvoll und nur selten käuflich. Ich sah diese Verzierungsmethode ausschliesslich bei Jacken anwenden. Dagegen wird eine andere Art von Knüpfarbeit, nicht mit bunten, sondern mit weissen Fäden, auch längs den Zipfeln von Lendentüchern angebracht. Hierbei benützt man die frei hängenden weissen Fäden von der Kette des selbst verfertigten Baumwollstoffes, um sie in hübschen, den europäischen ähnlichen Mustern zu knüpfen.
Ausser aus selbstgewebten und eingeführten Stoffen verfertigen die Bahau ihre Kleidung, wie gesagt, auch aus Baumbast (kapuwa, njamau), dessen Zubereitung bereits in Teil I p. 222 beschrieben worden ist. Tafel 48 giebt eine Vorstellung von der Behandlung des Baumbastes; der Mann rechts löst den Bast von einem Stamm, indem er auf dessen Aussenseite schlägt, wodurch die Verbindung der Bastteile mit dem darunter liegenden Holz zerstört wird. Nachdem auch die Rinde von dem Bast geschieden worden ist, rollt man diesen auf, klopft ihn mürbe und verbreitert ihn, wie es der Mann links tut, durch Klopfen mit einem gekerbten Stück Holz. Ein derartiger Klopfer, auf Tafel 62 bei i abgebildet, hat bei allen Stämmen die gleiche Form.
Ungefähr zehn in Farbe und Feinheit der Fasern voneinander deutlich verschiedene Arten von Baumrinde werden für die Herstellung von Kleidern verwendet. Besonders schönen Bast liefert Antiaris toxicaria, [196] nämlich ganz weissen, feinfaserigen, der überdies in grossen, breiten Lappen erhalten werden kann, was mit anderem weissem Bast nicht der Fall ist. Die schmalen Arten gebraucht man meistens zu Kopfbinden, den breiten Bast von Antianis, am Mahakam njamau tatje̥m, am Kapuas kapuwa tasem genannt, meist für hübsche Jacken, wie Tafel 49 oder für Kriegsmäntel, wie Taf. 50 sie vorführen. Die meisten Baumbastsorten sind jedoch mehr oder weniger von dunkel brauner Farbe und werden weniger, wie die weissen, für Fest- als für Arbeits- und Trauerkleider verwendet.

Klopfen von Baumbast.
Für den täglichen Gebrauch ist Bast besonders geeignet, weil er billig und dauerhaft ist und überdies auch bei längerem Tragen nicht die schmutzige Farbe annimmt, die weissem Kattun bald eigen ist, da die Kleider der Bahau wohl ausgespült, aber nicht mit Seife gewaschen werden. Die verschiedenen Arten von Baumbast heissen am Mahakam: 1°. njamau tatje̥m; 2°. njamau ke̥hān; 3°. njamau sike̥n; 4°. njamau ke̥lo̤p; 5°. njamau te̥kunoi; 6°. njamau asāng; 7°. njamau puro; 8°. njamau awong kate̥; 9°. njamau ajuw; 10°. njamau tăhāb. Von diesen stammen 1–4, 6, 7, 9 und 10 von grossen Bäumen, die Rinde von 5 und 8 wird aber nicht breiter als 2 dm. In bezug auf ihre Eigenschaften sind diese Baumbastarten sehr verschieden; i und 8 sind nach der Bearbeitung sehr weiss und dabei stark, für Kleidungsstücke deshalb sehr gesucht. Die übrigen sind alle braun, zeigen aber, was Stärke und Dicke der Fasern betrifft, eine grosse Verschiedenheit. So ist 3 für grobe Kleidung sehr beliebt. Dabei lässt sich diese Art, was die Stärke der Fasern betrifft, sogar wie tengāng zur Seilerei verwenden. Diese Seile zeichnen sich durch grosse Dauerhaftigkeit aus.
Die Baststoffe, deren Fasern alle ungefähr parallel laufen und ausserdem durch Klopfen auseinander gedrängt werden, trennen sich beim Gebrauch leicht völlig, ein Nachteil, dem man dadurch abzuhelfen sucht, dass man starke Pflanzenfasern oder Schnüre quer durch den Bast zieht, wodurch den Fasern ein seitlicher Halt gegeben wird. Bei den Bahau geschieht dies bei der Alltagskleidung auf einfache, aber oft sehr nette Weise; das Durchsteppen hat sogar eine sehr hübsche Verzierung der für die Festtracht bestimmten Baststoffe veranlasst. Zwei Beispiele hierfür sind die ärmellose Jacke auf Tafel 49 und die Kriegsjacke auf Tafel 50. Bei beiden sind die Bastfasern nicht einfach quer durchstickt worden, sondern die Ma-Sulingfrauen haben bei diesen Jacken einen grossen Reichtum an verschiedenartigen [197] Stickmustern angebracht. Eine gleiche Bewunderung verdient auch die ausserordentlich regelmässige Arbeit, bei der noch berücksichtigt werden muss, dass das Zählen der Fäden, ein Hilfsmittel bei gewebtem Zeug, hier fortfällt und die Stickerin ausschliesslich auf ihr Augenmass angewiesen ist. Wie mitten auf der Vorderseite auf Tafel 49 und in der Halsöffnung auf Tafel 50 zu sehen ist, sind die Fäden horizontal durch die Dicke des Bastes gezogen worden, nur wenige kommen an der Innenseite zum Vorschein.

Jacke aus Baumbast.
Die Trauerkleider aus Baumbast werden stets auf einfache Art durchsteppt und niemals verziert; auch gebraucht man für diese keine hübschen weissen, sondern nur braune Bastsorten.

Jacke aus Baumbast.
Bastkleider werden nicht ausschliesslich aus wenigen grossen Stücken, sondern auch aus vielen kleinen verfertigt, indem man diese aneinander heftet, eine Arbeit, mit der wir die Frau rechts auf Tafel 55 beschäftigt sehen. Ausser für Kleider wird Bast auch für andere Artikel, wie Säckchen zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten u.a.m. verwendet.
Die mehr oder weniger ausgedehnte Verwendung von Baumbast zur Kleidung und die Bewertung dieses Stoffes bei den verschiedenen dajakischen Stämmen sind davon abhängig, ob diese sich leicht oder schwer mit europäischem Kattun versehen können. So ist, wie gesagt, am Mendalam der Gebrauch von Baumbast sehr zurückgegangen, niemand wählt ihn jetzt mehr zur Festkleidung. Da hierdurch auch eine Verzierung dieses Stoffes mit Stickereien unmodern geworden ist, wird auch das Sticken auf gewebten Zeugen überhaupt nicht mehr oder nur in sehr mangelhafter Weise noch ausgeführt. Das Gleiche ist bei den Mahakambewohnern unterhalb der Wasserfälle und den Long-Glat der Fall, während die Kajan, Pnihing und Ma-Suling zur Kleidung noch vielfach Baumbast gebrauchen, diesen noch sorgfältig bearbeiten und ihn für einzelne Teile der Festtracht, wie z.B. ihre grossen Kopfbinden, dem eingeführten Kattun sogar noch vorziehen (siehe Tafel 20).
Bei den Kĕnjastämmen wird Baumbast ebenfalls noch sehr viel getragen, im Walde und auf grossen Reisen beinahe ausschliesslich.

Kriegsmantel aus Baumbast.
Allen Stämmen der Bahau und Kĕnja ist die Schmiedekunst bekannt. Die für den Ackerbau, den Busch etc. notwendigen Werkzeuge verfertigen sie selbst. Ursprünglich wendeten diese Stämme selbstgeschmolzenes Eisen an, jetzt weit mehr aus Europa eingeführtes. Während [198] man auf Form und Bearbeitung der täglich gebrauchten eisernen Gegenstände nicht viel Gewicht legt, geschieht dies in hohem Masse beim Schmieden von Waffen, in welcher Kunst die Bahau und Kĕnja es sehr weit gebracht haben und Erzeugnisse liefern, die auch bei der Küstenbevölkerung sehr geschätzt sind.

Kriegsmantel aus Baumbast.
In jeder Niederlassung sind ein bis mehrere Schmiede zu finden, die für die Eingesessenen alle neuen Geräte herstellen und die alten ausbessern. Jeder Schmied besitzt eine eigene Schmiede ausserhalb des langen Hauses, aber in dessen Nähe. Sehr einfache Schmiedearbeiten versteht beinahe jeder Dajak selbst auszuführen, z.B. seine Ackergeräte gerade zu schlagen oder zu schärfen, eine abgebrochene Spitze zu erneuern oder aus einem Nagel einen Angelhaken zu schmieden. Doch wird ein Berufsschmied als etwas Besonderes angesehen und daher wie ein echter Künstler von einem Geiste (to̱ te̥mne̱ = Schmiedegeist) beseelt gedacht. Ist dies nicht der Fall, so kann er auch nichts Hervorragendes in seinem Fach leisten. Bisweilen lässt sich eine Person durch eine dājung mit einem to̱ te̥mne̱ aus Apu Lagan beseelen, ohne noch für die Schmiedekunst besondere Anlage oder Lust zu zeigen; dies geschieht bei jungen Männern während einer ernsten Krankheit, um den Patienten mit Hilfe eines mächtigen Schmiedegeistes zu heilen. So hatte man für Awang Kĕlei, einen der beiden Kajanschmiede am Blu-u, bereits in früher Jugend einen to̱ te̥mne̱ herbeigerufen und mit ihm verbunden, weil er sehr lange an syphilitischen Ulzerationen gelitten hatte, deren Spuren er noch später trug. Wie alle beseelten Individuen, müssen auch die Schmiede zu bestimmten Gelegenheiten ihrem Schutzgeist opfern, hauptsächlich bei Krankheit; sie bewahren auch stets in ihrer Schmiede einige alte Perlen als Lockmittel für ihren Geist, wie die Tätowierkünstlerinnen in ihrem Instrumentenkörbchen.
Die Werkstatt eines Schmieds besteht gewöhnlich nur aus einem 8–10 qm grossen Dach, das an den Ecken auf Pfählen ruht und zu niedrig ist, um unter ihm aufrecht stehen zu können. Bei den Bahau wird das Dach mit Schindeln gedeckt und das Ganze ringsum gegen die frei umherlaufenden Schweine mit einer Hecke umgeben.

Eiserne Gerätschaften und Töpfe.
Die Utensilien eines Schmieds sind recht primitiv; das wichtigste Stück, der Ambos, ist ein nicht sehr grosses viereckiges Stück Eisen, das in Holz gefasst mitten auf dem Boden steht. Das zu schmiedende Stück Eisen wird mit einer Zange (Taf. 51 Fig. 10) festgehalten und [199] mit einem Hammer (Fig. 11) weiter bearbeitet. Stets befindet sich ein Schweinetrog mit Wasser in der Nähe, zur Abkühlung oder Härtung des Eisens. Der Schmied gebraucht das gleiche Feuer wie der Kalkbrenner. Die Heizung geschieht immer mit Holzkohlen, welche die Schmiede selbst im Walde brennen. Angeblasen wird das Feuer mittelst eines doppelten Glasbalgs, von dessen beiden Teilen jeder so eingerichtet ist, wie der eine auf Taf. 58. Den Hauptbestandteil bildet ein in die Erde gepflanzter ausgehöhlter Baumstamm, in dem sich ein oben mit einem elastischen Stock verbundener Sauger befindet. Wie die Abbildung zeigt, drückt der junge Mann den Stock nach unten, um die Luft unter dem Sauger fortzupressen, der durch die Elastizität des Stockes wieder hinaufgezogen wird.
Die unter dem Sauger ausgepresste Luft dringt durch eine unten am Baumstamm befindliche Öffnung in eine Abfuhrröhre aus Holz oder Bambus, und wird von hier in ein Verlängerungsstück aus feuerfestem Lehm, das im Feuer selbst liegt, geleitet. Der Sauger besteht aus einer meist mit einem dichten Federkranz versehenen Holzscheibe, welche die Öffnung- verschliesst. Die beiden neben einander stehenden Luftpumpen werden durch eine zwischen den Saugstangen sitzende Person, welche in jeder Hand eine derselben hält, abwechselnd in Bewegung gebracht.
Fügt man zu den oben genannten Werkzeugen noch einige selbstverfertigte Meissel, so ist hiermit, ausser zur Herstellung besonders feiner Gegenstände, die ganze Ausrüstung eines Bahauschmieds aufgezählt.
Das billige und bessere europäische Eisen hat, wie gesagt, das früher ausschliesslich verwendete selbstgeschmolzene Eisen bei diesen Stämmen verdrängt. Die am Mittellauf des Mahakam, und Kapuri lebenden Eingeborenen haben das Schmelzen eigenen Eisens gänzlich aufgegeben; oberhalb der Mahakamwasserfälle wird es noch ab und zu bei den Long-Glat geübt. Zu diesem Zwecke wird zuerst im Walde eine grosse Menge Holzkohle gebrannt, dann in den Schuttbänken einiger kleiner Nebenflüsse des Mahakam Eisenerz gesucht, das hier in gelbbraunen Brocken in Form stumpfer Ästchen und kleiner Zylinder vorkommt und, je nach den Flüssen, von verschiedener Qualität sein soll. Darauf wird in einem Erdloch ein starkes Feuer entzündet und in diesem werden abwechselnde Lagen von Holzkohle und Erz bis zur völligen Verbrennung in Glut gehalten. Nach der Abkühlung findet man am Grunde des [200] Loches einen mit Schlacken vermengten Eisenklumpen. Begreiflicherweise ist der Kohlengehalt in diesem sehr verschieden und sind Gusseisen, Stahl und Schmiedeeisen in ihm unregelmässig vermengt. Von einem derartigen Klumpen schlägt nun der Schmied ein Stück von der Grösse des Gegenstandes, den er herstellen will, ab. Auch die besten Waffenschmiede verstehen die verschiedenen Arten von Eisen nur schlecht zu unterscheiden und ineinander überzuführen.
Will daher ein Waffenschmied ein Schwert mit den Eigenschaften von Stahl herstellen, so trifft er nur durch Zufall sogleich das Richtige; die meisten Schwerter, die eine bestimmte verlangte Eigenschaft haben müssen, werden wiederholt umgeschmiedet und mit neuen Eisenarten gemengt. Die Schmiede wissen zwar, dass man Stahl härten kann, Eisen dagegen nicht, und dass Eisenstücke von gewissen Eigenschaften durcheinander geschweisst ein gut härtbares Metall liefern können; doch bleibt es bei ihnen stets beim Probieren, und eine homogene Masse wird denn auch beinahe niemals erzielt. Das Härten geschieht auch nur in der rohesten Form, indem der ganze glühende Gegenstand plötzlich in Wasser getaucht wird; ein Härten mit Ö1 oder ein partielles Härten, z.B. beim Schmieden eines Schwertes, ist gänzlich unbekannt.
Aus obigen Gründen sind die besonders guten Schwerter, denen die Bahauschmiede ihren Ruhm verdanken, nur selten zu finden und nur zufällig entstanden; sie können nie in Qualität mit den besten Waffen europäischer Schmiede konkurrieren. Weitaus die meisten Schwerter besitzen mehr die Eigenschaften eiserner, als stählerner Waffen und auch diejenigen mit schöner Einlegearbeit habe ich oft von den Eigentümern geradebiegen sehen, wenn sie durch den Gebrauch gelitten hatten. Bisweilen springen aus den Schneiden Teile heraus oder fliegen grosse Stücke ab u.a.m. Somit ist es, abgesehen von den mit dem Schmelzen des Eisens verbundenen Schwierigkeiten, begreiflich, dass die Eingeborenen unter den an den Küstenplätzen eingekauften Artikeln hauptsächlich auch grosse Mengen guter Eisenstäbe ins Innere hinaufführen, trotz der Schwere der Lasten. Aus diesem Eisen geschmiedete Schwerter werden denn auch viel höher geschätzt, als die aus eigenem Material verfertigten.
Von den im täglichen Leben der Bahau viel gebrauchten geschmiedeten Gegenständen sind einige auf Tafel 51 abgebildet. Vor allem das eigentümliche dajakische Beil (ase̱) Fig. 1, von kleinem Umfang [201] und besonderer Form, das vielfach von einheimischen Schmieden hergestellt, aber auch in grosser Anzahl von der Küste eingeführt wird. Da diese Beile den Dajak nur, wenn sie billig sind, verkauft werden können und diese sich bereits seit Jahrhunderten mit ihrer Herstellung befassen, sind ihre eigenen Produkte häufig, aber nicht immer, besser als die eingeführten. Mit guten Exemplaren leisten die Eingeborenen beim Fällen der bisweilen sehr harten Waldbäume Wunderbares, auch sind sie, was für ihren Wert spricht, zum Verkauf derselben nicht zu bewegen.
Die Beile werden an den Stielen in der auf Fig. 3 gezeigten Weise befestigt; das Eisen 3b ruht mit seinem schmalen Ende auf einer Verbreiterung 3a des elastischen Stielteils 3c. Die Befestigung geschieht durch ein Flechtwerk von Rotang, das mit besonderer Sorgfalt in der Regel derart angebracht wird, dass das Beil zwar nach vorn gleiten kann, beim Schlagen jedoch stets fester ins Flechtwerk hineingetrieben wird. Nach dem gleichen Prinzip ist auch der Hammer (Fig. 11) auf seinem Stiel befestigt. Zum Schutz der Schneide beim Tragen wird diese mit einem Rotangfutteral versehen, was bei kostbaren Werkzeugen öfters geschieht, wie z.B. auch beim Dechsel (Fig. 8) eine geflochtene Scheide am Stiele hängt. Der Stiel des Beils besteht aus zwei Teilen, dem dickeren Holzgriff 3f und dem dünneren biegsamen Teil 3 c, der den Schlägen die nötige Elastizität verleihen muss. c ist mittelst einer Art von Guttapercha (d) im Griff befestigt. Die gleiche Einrichtung ist an den Werkzeugen 8 und 11 zu sehen.
Bemerkenswert an Fig. 3 ist noch das hübsche Flechtwerk von kĕbalan am oberen Ende des Griffs, das zwar, wie auch 8 und 11 zeigen, fast stets angebracht wird, um eine Spaltung des Holzes zu verhindern, hier aber besonders breit und sorgfältig ausgeführt ist.
Nach den Beilen verdienen die Dechsel die meiste Beachtung; sie kommen in zahlreichen Modellen vor: zur Herstellung von Brettern werden die breiten, platten gebraucht (Fig. 8), beim Bau von Böten, zur Abplattung der runden Oberfläche, mehr die runden, wie Fig. 5, während die kleinen, Fig. 7, z.B. zur Entfernung der Aussenrinde eines Hirschhorns dienen. Dechsel mit langen Stielen werden auch wohl wie in Europa zum Glätten von Planken angewendet. Wie die Dechsel bei der Bearbeitung von Böten gebraucht werden, ist auf Tafel 57 dargestellt.
Das Jäteisen (Taf. 51 Fig. 2) ist im Grunde nur ein roh geschmiedeter [202] Dechsel, mit dem die Frauen das Unkraut von den Feldern wegkratzen. Ein anderes Gerät aus rohem Eisen ist der Hohlmeissel (Fig. 9), mit dem man in die Rinde der Guttaperchabäume Rinnen schlägt, um den Milchsaft abzuzapfen. Fig. 4 stellt eine Harpune zum Fang grosser Fische dar. Ihr oberstes Stück, das allein aus Eisen besteht, ist mit seinem hohlen unteren Ende sehr locker auf dem zugespitzten Ende des Stockes befestigt. Um das Unterende des Eisens ist jedoch einige Mal eine Schnur gebunden, die bei 4b und 4c nochmals um den Stiel gewickelt ist, so dass der eiserne Haken, sobald er mit dem Fisch vom Stocke gleitet, doch an der Schnur befestigt bleibt.
In Fig. 6 und 20 sind einige Werkzeuge abgebildet, deren Herstellung etwas mehr Geschicklichkeit erfordert. Das erste ist ein dünnes, zweischneidiges, spitz endendes und in der Fläche gebogenes Messer, das wiederum mit Guttapercha in einem hölzernen Griff befestigt ist. Es dient zur letzten Bearbeitung eines Schildes, nachdem dieser mit einem Dechsel bereits völlig auf die gewünschte Dicke gebracht worden ist; die letzten Splitter werden mit diesem Messer entfernt und die Oberfläche wird damit geglättet. Das zweite Werkzeug (Fig. 20) ist ein Bohrer, dessen Stiel beim Gebrauch zwischen den Handballen gerieben wird.
Während beinahe jeder Schmied die beschriebenen Gegenstände selbst verfertigen kann, verstehen sich auf das Schmieden von Warfen, d.h. Schwertern und Speeren, wie gesagt, nur wenige wirklich gut. Doch haben es einige unter ihnen für Eingeborene zu einer in unserem Auge bewunderungswürdigen Höhe gebracht, wenn man bedenkt, dass auch sie nur über die eben besprochenen unvollkommenen Gerätschaften verfügen.
Gerade die Schwertfegerei hat unter der Einführung europäischer Ware von der Küste am meisten gelitten; ferner hat auch der Umstand ungünstig gewirkt, dass die Gegenwart einer europäischen Verwaltung die Kriegführung unter den Bahaustämmen sehr eingeschränkt hat. Infolgedessen werden z.B. am Kapuas schöne Schwerter von guter Qualität überhaupt nicht mehr geschmiedet. Während meines Besuchs bei der dortigen Bevölkerung konnte mir der Schmied zwar ein Schwert herstellen und es mit Gravierungen nach altem Muster verzieren, aber die Beschaffenheit des Eisens liess viel zu wünschen übrig und machte die Waffe für Kriegszwecke völlig untauglich. Als [203] Beispiel für ein derartiges Schwert der Kapuas-Kajan mag das in Teil I Taf. 28 abgebildete dienen. Wie das Eisen für Ackergerätschaften werden auch einfache Arbeitsschwerter in grosser Menge bei ihnen eingeführt; die schönen Schwerter, die eventuell im Kriege dienen könnten, verschaffen sich die Kapuasbewohner alle vom oberen Mahakam, wo die Schwertfegerei noch jetzt sehr im Schwange ist. Doch ist dies nicht bei allen dortigen Stämmen der Fall: die Pnihing schmieden überhaupt keine Schwerter, die Kajan leisten in dieser Beziehung nur Mangelhaftes, nur die Ma-Suling und Long-Glat bringen viel Schönes hervor und versehen alle anderen Stämme mit Schwertern, die daher ihren wichtigsten Tauschartikel bilden.
Obgleich in minderem Masse als in anderen Handwerken, findet man auch in der Schmiederei die besten Arbeiter unter den Häuptlingen und Reichen, weil es den übrigen sowohl an Zeit zur Übung, als an Mitteln für Opferspenden an die Geister mangelt. Beim Schmieden erfordert nämlich jedes weitere Stadium, das der betreffende Gegenstand erreicht, ein neues Opfer, das sich mit dem Fortschreiten der Arbeit stets vergrössert.
Bei der Herstellung eines mit Kupfer- oder Silbereinlagen hübsch verzierten Schwertes verfährt der Schmied folgendermassen: erst bringt er das Schwert auf das auf Tafel 52 in Fig. a dargestellte Stadium. In diesem wird Teil I später mit Guttapercha im Griff befestigt; bei 2 sind die oberflächlichen Rinnen und bei 3 die Löcher angegeben, in welche das Metall eingelegt werden soll. Die Löcher, die bei a nur Vertiefungen darstellen, sind erst bei Fig. b völlig ausgearbeitet; sie werden mit den unter f, g, h und i abgebildeten Instrumenten erzeugt, während das Schwert sich noch in glühendem Zustande befindet. Das Einschlagen der Gruben geschieht mittelst Meisseln von verschiedener Form. Um die Löcher in gleichen Abständen zu erhalten, benützt man die meisselförmige Klinge mit doppelter Spitze g, die in den Dorn (3 bei Fig. i) gesteckt und dann mit einem Hammer in das glühende Metall getrieben wird. Ebenso entstehen auch die Rinnen 2 in Fig. a; doch gebraucht man für diese Meissel von der Form 3 in Fig. i und von der Form in Fig. f, bei welcher zwei dieser Keile aneinandergebunden abgebildet sind. Die S-förmige Schneide dieses Meissels bringt Linien wie bei Fig. a2 hervor.
Bei einer folgenden Erhitzung erhalten die oberflächlichen Gruben durch Hineintreiben des Eisens h die nötige Tiefe; meistens dringen [204] die Öffnungen nicht bis zur anderen Seite durch, doch geschieht dies gelegentlich durch Ungeschicklichkeit. Reihen derartiger Löcher, die zur Aufnahme des einzulegenden Metalls bereit sind, zeigen die Modelle b und c. Bei b, 5 und 6, sind auch noch neue Rinnen zu sehen, welche mit hierzu passenden Meisseln, deren Handhabung grosse Geschicklichkeit erfordert, hergestellt sind.
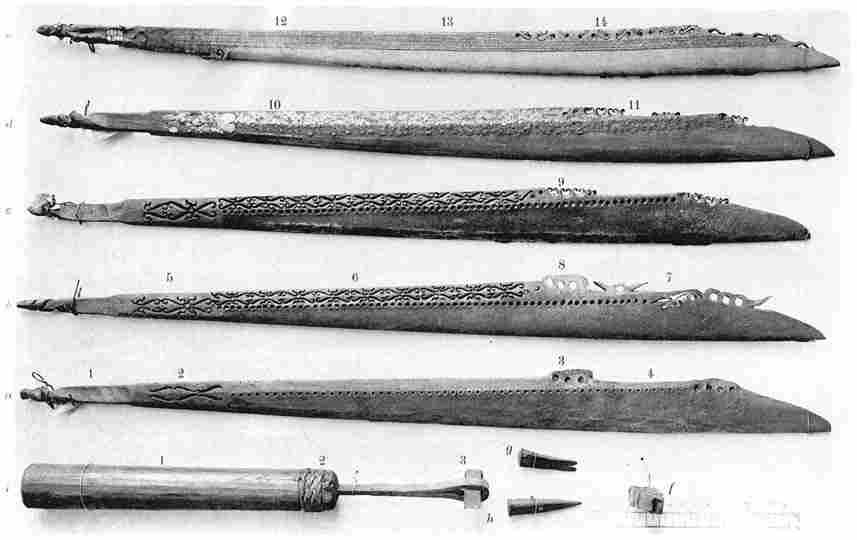
Unvollendete Schwerter der Bahau.
Die für die Bahauschwerter so charakteristische Einlegearbeit in Kupfer und Silber wird an den auf die beschriebene Weise präparierten Schwertern derart vorgenommen, dass man in kaltem Zustande dünne Splitter dieser Metalle in die Gruben bringt und sie mittelst kleiner Hämmer fest in diese hineinklopft. Nach der Füllung sehen die Gruben aus wie 10 in Fig. d und müssen dann erst durch Wegfeilen der überschüssigen, nach aussen vorragenden Metallteile weiter bearbeitet werden.
Die Ausarbeitung des Teils 3 in Fig. a bis zum Stadium 9 in c giebt bereits eine gute Vorstellung von den Leistungen der Bahau in der Schmiedekunst; die meisten Schwerter vom Mahakam tragen auch nicht viele andere Verzierungen als Einlegearbeit und diese Schnörkel. Dass die Schmiedekünstler auf Borneo in ihrem Fach jedoch noch viel Grösseres leisten könnten, wenn ihre beschränkten Verhältnisse sie nicht beeinträchtigten, beweist die Verzierung 7 in Fig. b. Sie wurde von einigen Schmieden der Ma-Tuwan in Long Tĕpai hergestellt und besteht der Hauptsache nach aus 4 übereinander gelegten Spiralen aus dünnen Eisenstreifen, von denen die längste von rechts über eine zweite Spirale nach links unter die linke, nach oben gebogene Spirale verläuft, hier nach rechts umschlägt, um mitten in der Figur in einen Schnörkel zu enden. Sie zeugt von einer bewundernswerten Gewandtheit im Schmieden und von einem sehr richtigen Augen-mass; mancher europäische Kunstschmied würde die Arbeit nicht leicht nachahmen können.
Leider finden derartige aussergewöhnliche, praktisch nutzlose Verzierungen im Gemeinwesen der Bahau keine Gelegenheit zur Vervollkommung und man trifft sie daher auch höchst selten. Für gewöhnlich werden die Schwerter, sobald sie fertig geschmiedet sind, von anderen Personen, die darin Übung haben, mit feinen Sandsteinen geschliffen. Das Polieren der Schwerter ist unbekannt.
Die bei den Mahakambewohnern vorkommenden Formen von Schwertern sind in den Fig. a, b, c und d auf Tafel 52 und a und b auf [205] Taf. 29, Teil I abgebildet, von denen die beiden letzten deutlich die eigenartige Einlegearbeit zur Geltung kommen lassen.
Die anderen Bahaustämme, wie die Kajan am Kapuas und die am Batang-Redjang oder Balui, benützen ähnliche Schwerter, doch sind die der letzteren mehr hohl gebogen, wie e auf Tafel 52 andeutet. Bei diesem ist zugleich auch eine andere, am Kapuas (Teil I Taf. 28) und bei den Kĕnja (Teil I Taf. 29) gebräuchliche Verzierungsweise angebracht, nämlich eine Ziselierung auf der Rückseite der Schwertfläche, die an dem völlig ausgearbeiteten Schwerte ausgeführt wird, indem man mit kleinen harten Meisseln Linien ins Eisen schlägt. Dies geschieht aus freier Hand, ohne vorhergehende Zeichnung. Schwert e (Taf. 52) zeigt überdies auch an seinem äusseren Ende noch eine hübsche Verzierung 14, von deren einzelnen Teilen im folgenden Kapitel ausführlicher die Rede sein wird.
Eine andere Art von Metallbearbeitung hat sich bei den Bahau am Mahakam zugleich mit der Sitte der Hahnenkämpfe von der Küste her eingebürgert, nämlich das Schleifen von Eisen und Stahl mit Hilfe von drehbaren Schleifsteinen, die sie ebenfalls an der Küste kaufen. Doch werden auf diese Weise ausschliesslich Sporen für Kampfhähne verfertigt, von denen einige Modelle auf Taf. 60 in Fig. e abgebildet sind. Auf das Schleifen und Anbringen der stählernen Sporen verstehen sich die Häuptlinge meistens selbst: vorzugsweise stellen sie diese aus Rasier- und Fischmessern her, die sie nicht enthärten, sondern mittelst der drehbaren Schleifsteine in den gewünschten Formen und Dimensionen schleifen. Die so verfertigten Sporen sind so rein von Form, dass man sie für europäisches Fabrikat ansehen könnte, und die schweren Verwundungen, die sich die Hähne mit ihnen beibringen, zeugen von ihrer Tauglichkeit. Die Bahau messen dieser Art von Stahl einen sehr grossen Wert bei, daher kostete es mir stets Mühe, meine eigenen Rasiermesser vor dem Schicksal zu bewahren, von den allzu sportlustigen Häuptlingen in Hahnensporen verwandelt zu werden. Die auf Taf. 60 unter e abgebildete Büchse mit Sporen ist eine Arbeit Kwing Irangs, der sie mir als persönliches Geschenk verehrte, weil er meine Vorliebe für schöne Arbeiten der Eingeborenen kannte. Die Modelle zu diesen Sporen, deren es noch mehr gibt, stammen von den Malaien. Die gewöhnlichen Kajan schmieden die Sporen selbst, oder lassen sie von einem mehr oder weniger in diesem Fach geübten Schmied verfertigen; derartige Sporen tragen denn [206] auch deutliche Zeichen ihrer weniger vornehmen Herkunft und biegen und brechen häufig während des Gefechts.
Die Bahau wissen zwischen grobem und feinem Sandstein beim Schärfen ihrer Schwerter und Hahnensporen wohl zu unterscheiden; hauptsächlich für letztere suchen sie in bestimmten Bächen nach einem sehr feinen Sandstein, von dem ein Stück auf Taf. 60 Fig. o in Form eines Rhinozerosvogelkopfes zu sehen ist. Dieser Stein mit sehr ebener Schlifffläche rührt von den Kajan am Mendalam her.
Hat die Schmiedekunst bei den Bahau infolge ihrer vielseitigen Anwendung eine beträchtliche Höhe erreicht, so gilt dies auch inbezug auf ihre Holz- und Knochenschnitzerei. In dieser Richtung hat sich der Schönheitssinn und die Kunstfertigkeit der Dajak sogar voll entwickeln können. Eine künstlerische Bearbeitung von Holz wird nicht nur bei grossen Verzierungen, wie der eines Häuptlingshauses, sondern auch bei kleinen Gegenständen, besonders Griffen und Scheiden von Schwertern, angewendet.
Jeder Bahau, dem es an Zeit und Fähigkeit nicht mangelt, verziert seine täglichen Gebrauchsgegenstände gern mit mehr oder weniger hübschem Schnitzwerk; doch leistet er selten etwas sehr Gutes, weil er ausschliesslich für sich selbst arbeitet. Anders verhält es sich mit der Schnitzerei von Griffen und Scheiden; diese Kunst wird von Personen betrieben, die sich in ihr besonders üben und überhaupt nur dann zum Schnitzen der schönsten Produkte, u.a. Schwertgriffe aus Hirschhorn, berechtigt sind, wenn sie dem Geist, der sie beseelt, Opfer von bestimmter Grösse gebracht haben. Die primitive Schnitzerei der Laien wird also ohne Beseelung geübt, während ein Kunstwerk nur mit Hilfe eines Geistes aus Apu Lagan entstehen kann. Bei den Mahakamkajan muss ein junger Mann, bevor er aus Eisenholz einen hübschen Griff oder eine Scheide zu schnitzen beginnt, erst durch eine dājung seinem Geiste ein Huhn zum Opfer anbieten lassen (me̥lā), und will er seine. Kunst an Gegenständen aus Hirschhorn erproben, so muss er vorher eine me̥lā mit einem Schwein als Spende abgehalten haben. Nachher muss er sich monatelang verschiedener Speisen und Beschäftigungen enthalten. Demselben Glauben an eine Beseelung muss auch der Brauch zugeschrieben werden, dass ein Schnitzkünstler seine Arbeiten nur dann verkaufen darf, wenn man ihm vor dem Preise erst einige alte Perlen von bestimmter Beschaffenheit (2 [207] blaue und 2 weisse) ausbezahlt hat; diese müssen wohl als eine Entschädigung des Geistes für den Verlust des Gegenstandes aufgefasst werden.
Mit den meisten Handwerken ist auch die Schnitzerei verschiedenen Verbotsbestimmungen unterworfen, die nicht bei allen Stämmen gleich sind. Während der Saatzeit (tugal) und der Schwangerschaft seiner Frau darf ein Mendalamkajan kein Hirschhorn schnitzen, aus Furcht vor einem Absterben der Frucht. Für Holz und Bambus sind diese Verbote ungültig.
Die Berührung mit der Küstenbevölkerung hat auf die Schnitzkunst der Bahau kaum einen nachteiligen Einfluss geübt, man könnte eher behaupten, sie habe hierdurch insofern eine Anregung empfangen, als die Malaien selbst nicht imstande sind, dergleichen Griffe und Scheiden herzustellen, aber gern in den Binnenlanden Bahauschwerter zum Schmucke oder Schutz gebrauchen und deswegen beträchtlich viel Geld für sie auszugeben bereit sind. Aus diesen Gründen widmeten sich am Mendalam z.B. einige Männer ganz der Schnitzerei, besonders der von Hirschhorngriffen und leisteten in ihrem Fache daher auch weit mehr als sonst der Fall gewesen wäre. Von diesen Leistungen geben die Abbildungen c, d, e und f auf Tafel 63 eine Vorstellung. Die 3 ersten Griffe stimmen im Entwurf stark überein, nur sind sie nach Grösse und Form des gebrauchten Horns verschieden und mehr oder weniger fein ausgearbeitet. Eigentümlicherweise sind die Griffe vom Mahakam, obgleich sie auf dieselbe Weise verfertigt, mit denselben Motiven verziert und sicher nicht minder sorgfältig ausgeführt sind, von ersteren gleich zu unterscheiden (Fig. a). Dasselbe gilt für die Griffe der Kĕnja (Fig. b), die ebenfalls sehr charakteristisch sind. Die Bahau selbst unterscheiden denn auch verschiedene Stile bei ihren Stämmen und ahmen diese bisweilen nach; so ist f ein Griff, der am Mendalam im Kĕnjastil verfertigt worden ist. Ein Beispiel für diesen Stil sind auch die Griffe der Schwerter Fig. c und d auf Tafel 29, Teil I.
Die Instrumente, mit denen die Bahau ihre schönen Schnitzwerke ausführen, sind äusserst einfach und wenig zahlreich. Sowohl für Holz als für Knochen wird das lange Messer, nju, (Tafel 28, Teil I, Fig. h) eigentlich als einziges Werkzeug benützt. Zum Löcherbohren wendet man allerdings kleine Bohrer (Taf. 51 Fig. 20) an, welche durch Drehen zwischen den Handballen in Bewegung gebracht werden, ferner [208] wird mit dem kleinen Dechsel (Taf. 51 Fig. 7) die Rinde des Hirschhorns entfernt, bevor man ans Schneiden geht. Letzteres findet nun nach der auf Tafel 53 oben wiedergegebenen Weise statt. Der Mann hält das Messer derart in der rechten Hand, dass das Aussehende des langen Stils ihm unter die rechte Achsel reicht, wodurch er bei der Hantierung des Messers eine Stütze findet. Der Künstler hält den zu bearbeitenden Gegenstand (hier eine hölzerne Schwertscheide) mit der Linken fest und bewegt beim Schnitzen nicht nur das Messer, sondern auch das Objekt. Stellt er einen Griff aus Hirschhorn her, so führt er seinen Entwurf zuerst in Gedanken mit Berücksichtigung der Form des zur Verfügung stehenden Horns aus, entfernt die unregelmässige Oberschicht und schneidet dann erst mit dem Messer den Griff in rohen Umrissen aus.

Schnitzender Kajan.
Darauf bearbeitet er erst die eine Hälfte weiter und dann die andere. Form und Ausarbeitung des Griffes hängen nicht nur von der äusseren Gestalt des Horns ab, sondern auch von dem Verhältnis zwischen der soliden äusseren Schicht und dem schwammartigen Gewebe der Mitte. Ist dieses sehr entwickelt, so ist ein tiefergehendes Schnitzen unmöglich, fehlt es gänzlich, so braucht der Künstler sich nicht auf eine oberflächliche Bearbeitung zu beschränken. Ein Beispiel für einen Horngriff mit wenig brüchigem Gewebe ist Fig. a auf Taf. 63.
Die Schnitzer verstehen gebrochene Griffe auch zu reparieren; sie tun dies, indem sie die abgebrochenen Stücke mittelst Knochenstiften, welche sie durch gebohrte Löcher stecken, mit einander verbinden; auch werden auf diese Weise neue Teile in einen Griff eingesetzt.
Auf den Wert eines Horngriffes hat auch die Farbe viel Einfluss; je weisser diese ist, desto höher der Preis. Am Mendalam kostete ein gut gearbeiteter Griff 8–10 Dollar, also 10–12 Gulden; am Mahakam jedoch, wo zahlreiche Buschproduktensucher unter der Bevölkerung verkehrten, wurden für gleich gute Produkte 25 fl bezahlt. Während meines Aufenthaltes am Mahakam befanden sich unter den Pnihing keine Schnitzkünstler; schöne Griffe wurden, wie auch Schwerter, bei den weiter unten wohnenden Stämmen durch Tausch erworben, besonders von den Long-Glat, die sich auf diesem Gebiete auszeichnen. Auch vom mittleren Mahakam, unterhalb der Wasserfälle, sah ich einige schön ausgeführte Stücke.

Zubereitung von Rotangstreifen.
Wie die Griffe, haben sich auch die alten Schwertscheiden unter den Bahau behauptet, weil sie infolge der Berührung der Eingeborenen [209] mit der Küstenbevölkerung, wenn auch in bescheidenem Masse, zu einem Ausfuhrartikel geworden sind und die Malaien an ihrer Statt nichts Besseres haben einführen können. Beispiele für Schwertscheiden sind in Teil I auf Taf. 28, 29 und 30 zu finden; der bedeutende Unterschied zwischen den Scheiden der Bahau am Mendalam und denen am Mahakam und Kĕnja fällt dabei ins Auge.
Sämtliche Scheiden bestehen aus zwei platten Brettern, die an den einander zugekehrten Innenseiten etwas ausgehöhlt sind, um das Schwert aufnehmen zu können, und durch Flechtwerk von dünnen Rotangstreifen an einander gehalten werden. Für die einfachen, z.B. beim Ackerbau gebräuchlichen Schwerter wählt man gewöhnliches glattes Holz, für schöne Schwerter dagegen benützt man für die nach aussen gekehrte Häche der Schwertscheide hübsch geflammte oder harte, gut polierbare Holzarten.
Die Mendalambewohner zeigen besondere Vorliebe für Schwertscheiden, welche mit kunstvollem Schnitzwerk verziert sind, wie die Figur von Taf. 28 und die Scheiden a, b, c, f, g und h von Taf. 30 Teil I beweisen; das Flechtwerk bringen sie so unsichtbar als möglich an. Die Mahakamstämme bevorzugen dagegen mehr schönes Holz, das sie nur oberflächlich mit Schnitzwerk verzieren, dafür aber besonders sorgfältig mit Rotang umflechten (d und e auf Taf. 30 Teil I). Die Kĕnja legen auf eine schöne Verzierung der Schwertscheiden überhaupt wenig Gewicht.
Inbezug auf die Scheidenschnitzerei gelten nicht die gleichen strengen Vorschriften wie für die von Griffen; wahrscheinlich weil für erstere selten Hirschhorn oder Knochen als Material gewählt wird und ihre Herstellung keine so grosse Übung erfordert. Es sind denn auch viel mehr Leute imstande, eine hübsche Scheide zu verfertigen als einen hübschen Griff. Die Knochenschnitzer verstehen jedoch, dank ihrer grösseren Erfahrung, unter anderen Schnitzarbeiten auch die schönsten Scheiden zu liefern.
Das Messer, das in einem besonderen Futteral an der dem Träger zugekehrten Seite getragen wird, ist, wenn auch in geringerem Grade als die übrigen Teile der Waffe, ebenfalls mit Sorgfalt gearbeitet. Das obere Ende (siehe Teil I Taf. 28 h) trägt häufig eine Verzierung von Knochenschnitzerei; der anschliessende hübsch polierte Stiel besteht aus sehr hartem, rotem oder braunem Holz, während das untere Ende, an dem die Klinge mit einer schlechten Guttaperchasorte befestigt ist, [210] entweder mit feinem Rotanggeflecht und kĕbalan oder, nach Ansicht der Bahau auf besonders schöne Weise, mit feinem Kupferdraht umwunden ist.
Das Polieren der Stiele aus sehr hartem Holz geschieht derart, dass man zuerst das Holzstück roh mit dem Messer beschneidet, es mit diesem durch Kratzen bearbeitet und zum Schluss mit stark kieselsäurehaltigen Baumblättern glatt scheuert. Der Glanz wird dem Holz stets durch Einreiben mit Wachs und Nachreiben mit Tüchern verliehen.
Erwähnenswert ist, dass auch hölzerne Gegenstände auf die gleiche Weise wie weisser Kattun, Rotang u.s.w. durch Vergraben in Moder dunkel, oft schwarz gefärbt werden. Die Griffe aus Holz werden nämlich beinahe ausnahmslos in schwarz verlangt, doch ist keine der harten Holzarten, aus denen man sie schnitzt, ursprünglich schwarz. Um nun die gewünschte Farbe zu erhalten, vergräbt man die Griffe nach ihrer vollständigen Bearbeitung für einige Tage unter dem Haus in Moder, wonach sie ein tiefes Schwarz zeigen. Nach dem Reinigen und Trocknen legt man mittelst Reibblättern und Wachs die letzte Hand an sie an.
Die Vorliebe der Bahau für verzierte Gegenstände in ihrer Umgebung äussert sich auf die mannigfachste Weise. Die verschiedenen Unterteile des Hauses werden, wenn möglich, mit Bildhauerarbeit geschmückt, und alle Gerätschaften, besonders diejenigen, die lange Zeit dienen müssen, werden so schön als möglich ausgestattet. Auf Tafel 61 sind verschiedene hübsch geschnitzte Artikel des dajakischen Hausrats abgebildet, während die Tafeln 65–68 uns von den Leistungen der Bahau in der Bambusschnitzkunst eine Vorstellung geben.
Bei der Herstellung dieser Gegenstände gilt durchweg als Regel, dass ursprünglich zwar ein Stück in roher Form geschnitzt oder modelliert wird, von einem vorhergehenden Entwurf mittelst Zeichnung oder einer Angabe der anzubringenden Figuren aber keine Rede ist. Dies ist ein sehr bemerkenswerter Umstand, besonders wo es sich um so komplizierte Figuren, wie die auf Bambusbüchsen und anderen Schnitzwerken, handelt. Ferner mag darauf hingewiesen werden, dass die Anwendung so einfacher Instrumente, wie die eines Messers und Bohrers, doppelte Bewunderung verdient, wo es sich um so hartes, brüchiges Material wie Hirschhorn handelt, das noch viel härter als Elfenbein ist, und um die ebenfalls sehr harte und brüchige Oberfläche von Bambus und anderen ähnlichen Holzarten. In dieser Hinsicht sind die Bahaukünstler wahre Meister in ihrem Fach. Die Gewohnheit, mit [211] so brüchigem Material umzugehen, scheint sie vorsichtig und geschickt gemacht zu haben, denn nur selten missglückt ein Gegenstand durch Brechen oder Absplittern.
Einen bedeutenden Industriezweig bildet bei den Bahaustämmen auch das Flechten von Rotang, Bambus, Pandanusblättern etc. Zwar wird auch diese Arbeit nicht in grossem Massstab betrieben, sondern im allgemeinen verfertigt jede Familie das für den Hausstand nötige Flechtwerk selbst, doch hat dieses Handwerk infolge mannigfacher Anwendung gleich einigen anderen eine grosse Höhe erreicht. Im grossen ganzen tragen die Flechtarbeiten der Bahau denselben Charakter wie die anderer dajakischer Stämme, doch sind sie meistens weniger fein als die aus dem Baritogebiet stammenden. Möglicherweise jedoch danken letztere ihre Entstehung dem Reichtum der bandjaresischen Bevölkerung, die für feine Matten u.a. viel ausgeben kann. In einigen Spezialitäten, wie in dem Flechtwerk von Schwertgriffen und Messern, liefern auch die Bahau sehr feine Arbeit.
Die den Malaien am nächsten wohnenden Bahaustämme leisten auch im Flechten am wenigsten, daher suchen sich die Mendalambewohner z.B. schöne Matten vom Mahakam zu verschaffen.
Dauerhafte Gegenstände werden meistens aus Rotang, kleine, beim Kultusdienst gebräuchliche Körbe und Matten dagegen aus Pandanusblättern geflochten. Für feine Flechtarbeit ist das dunkelbraune kĕbalan beliebt, die Stengelfasern einer hoch im Gebirge vorkommenden Schlingpflanze, die zu den Farnen zu gehören scheint. Bambus findet beim Flechten wenig Verwendung.
Die Bahau flechten nicht mit allen, sondern nur mit bestimmten Arten von Rotang; auch sah ich diesen nur für Kriegsmützen, die Schwerthieben standhalten müssen, in seiner ganzen Dicke oder halb gespalten anwenden; meistens wird nur die äusserste Schicht des Stammes in gröbere oder feinere Streifen präpariert, je nachdem das Flechtwerk grob und stark oder fein sein muss. Die allerfeinsten Flechtarbeiten werden aus dem bekannten Rotang sĕga und noch dünneren Arten hergestellt.
Die Zubereitung der Streifen findet nach der auf Tafel 53 dargestellten Weise statt. Von den drei Männern sind zwei mit dem Spalten des Rotangs beschäftigt. Hierbei verfahren sie folgendermassen. Zuerst machen sie an dem einen Ende des Stammes mit dem Messer [212] einen Einschnitt, dann biegen sie die beiden Hälften auseinander, so dass die Spaltung weiter geht und sich bei geschickter Behandlung gleichmässig bis zum Ende fortsetzt. Auf die gleiche Weise spalten sie die beiden Hälften in Segmente, bis der Streifen der Aussenfläche die gewünschte Breite erlangt hat. Darauf trennen sie die innersten Fasern mit dem Messer von den äusseren Schichten, wonach man diese in bestimmter Breite übrig behält. Die Streifen sind dann jedoch zum Flechten noch viel zu ungleich breit. Der Mann links auf dem Bilde zieht diese Streifen, um sie gleichmässig werden zu lassen, auch wohl, um die innersten Fasern gleichmässig abzuschneiden, zwischen zwei in einen Holzblock geschlagenen Messern hindurch. Diese stehen mit ihren Schneiden in bestimmtem Abstand einander zugekehrt. Während er mit der Rechten den Streifen zwischen den beiden aufrechtstehenden Messern hindurchzieht, sorgt er mit der Linken dafür, dass der Rotang die Messer in richtiger Stellung passiert. Mitten im Block ist ein Stiel angebracht, auf den der Mann sein rechtes Bein legt, um den Block festzuhalten.

Körbe der Bahau.
Müssen die Flechtstreifen ganz besonders fein sein, wie z.B. der kĕbalan für Schwertgriffe, so zieht man sie der Reihe nach durch stets kleiner werdende, in ein Blech geschlagene Löcher. Die scharfen Blechränder entfernen alle Unregelmässigkeiten. Die feine, kieselhaltige Oberhaut des Rotang verschwindet bei allen diesen Manipulationen von selbst.
Die Zubereitung der Rotangstreifen ist beinahe ausschliesslich Männerarbeit. Pandanusblätter dagegen werden sowohl von Männern als von Frauen bearbeitet. In frischem Zustande werden zuerst die Ränder mit den feinen Stacheln abgeschnitten und dann die Blätter in Streifen von der erforderlichen Breite gespalten; vor dem Gebrauch hat man sie dann nur noch zu trocknen. Am Mahakam, wo diese Pandanusstreifen unter dem Namen “tika” bekannt sind, finden sie ihrer einfachen Zubereitung wegen vielfache Anwendung für Matten, Körbe, Hüte u.s.w.
Körbe und Matten werden mit wenigen Ausnahmen von Frauen geflochten. Dies gilt sowohl für feine Matten, mit deren Herstellung die beiden Kajanfrauen auf Tafel 45 beschäftigt sind, als für die von grober Qualität, welche in der amin zur Bedeckung des Fussbodens, zum Trocknen von Reis u.s.w. dienen. Auf einer derartigen Matte sitzen auch die beiden Spinnerinnen auf dem oberen Bilde derselben Tafel. [213]
Einzelne Gegenstände sind Frauen zu flechten verboten, so dürfen sie z.B. nicht die 4 aufrechten Stöcke an den Reis- oder Gepäckkörben (b auf Taf. 54) mit Rotang umwickeln; dies müssen ausschliesslich alte Männer tun.
Das Flechten selbst geschieht mit nur 2 Instrumenten, einem eisernen Haken, mit dem die mit der Hand durcheinander geflochtenen Streifen fest zusammengedrückt werden, und einem Flechtpfriemen, von dem einige Modelle auf Tafel 60 j–n zu sehen sind. Die Pfriemen dienen dazu, in feinem, hübschem Geflecht Öffnungen anzubringen, in welche dann neue Streifen gesteckt werden können. Die Enden der Flechtstreifen werden zwar häufig gespitzt, doch benützt man zum Durchziehen keine Nadeln.
Für feine Rotangmatten wird das Material oft teilweise gefärbt; schwarz, indem man die fertigen Streifen in den Moder steckt, rot, indem man sie in Wasser mit bestimmten Pflanzen kocht. Die weissen Streifen, die so hell als möglich sein müssen, werden noch vor der Zubereitung in der Sonne getrocknet und gebleicht. Diese verschiedenfarbigen Streifen werden von den Kajanfrauen zu hübschen Figuren verflochten, doch verstehen sie auch den weissen Rotang allein zu geschmackvollen und sehr komplizierten Mustern zu verarbeiten.
Beispiele für Flechtarbeiten findet der Leser ausser in den genannten Matten auf Tafel 54 abgebildet. Die beiden Körbe b und d haben infolge ihres sehr dichten Flechtwerks eine unveränderliche Form, während der Reisesack c aus dünnen Streifen lose geflochten ist und daher nach Bedürfnis weit aus einander gezogen oder verschmälert werden kann.
Sehr kunstvolles Geflecht findet man, wie schon gesagt, an den Warfen der Bahau, vor allem an den Griffen, von denen a, c und d auf Tafel 63 eine gute Vorstellung geben; ferner zeichnen sich die auf sehr verwickelte Weise geflochtenen Knöpfe auf den Schwertscheiden der Mahakam- und Kĕnjastämme durch schöne Arbeit aus (Siehe Teil I Taf. 29 Fig. a, a1, b, b1, c und Taf. 30 d und e). Das Beflechten von Schwertgriffen und Scheiden wird durch Männer ausgeführt.
Eine sehr wichtige Rolle im Haushalt der Bahau spielen die Blätter einer in Mittel-Borneo einheimischen Fächerpalme, samit genannt. Diese Blätter werden im Walde gesammelt und getrocknet und bilden dann ein starkes, biegsames Material, aus dem durch Aneinandernähen [214] allerlei leichte Matten, Säcke zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände u.s.w. verfertigt werden. Die sehr leichten Palmblattmatten bewähren sich besonders auf Reisen ausgezeichnet und gehören denn auch zur Ausrüstung eines jeden Trägers, um ihm als Schlafmatte oder als wasserdichte Dachbedeckung zu dienen. Zu letzterem Zwecke binden die Reisenden ihre 1½–2½ m langen und mehr als 1 m breiten Matten nebeneinander auf das Holzgerüst der Hütte. Behandelt man diese Matten, nachdem sie vom Regen nass geworden sind, mit einiger Vorsicht, so halten sie auch bei ständigem Gebrauch eine 2 monatliche Reise aus.

Kajanfrauen bei der Arbeit.
Die Blätter der samit-Palme sind am Aussenrande nicht gespalten, sondern zusammenhängend und stumpf. Für den Gebrauch nähen die Frauen die trockenen Blätter mit ihren Seitenrändern derartig aneinander, dass abwechselnd ein breites und ein schmales Fächerende neben einander zu liegen kommen; überdies heften sie zwei Blätterlagen übereinander. Auf Tafel 41, wo der Hintergrund durch solch eine Matte gebildet wird, sieht man überdies, dass diese durch Aneinandernähen zweier Streifen doppelt so breit wird als ein Blatt lang ist.
Auch als Wandverzierung in der amin werden diese hell gelbbraunen Matten verwendet (Taf. 39, links); man verschönert sie dann mit breiten Rändern von rotem Zeug und bestickt sie in der Mitte und an den Seiten, wie an den samit, welche auf Tafel 45 in der oberen Abbildung den Hintergrund bilden, zu erkennen ist. Werden aus diesen Matten Beutel zur Aufbewahrung von allerhand kleinen Kostbarkeiten, Nähzeug, Perlenarbeiten oder Tabak hergestellt, so überzieht man sie bisweilen vollständig mit weissem oder buntem Zeug, das mit Stickereien oder Zeichnungen verziert wird.
Letztere werden hauptsächlich bei Totenausrüstungen angebracht, bei denen Matten und Säcke aus samit nie fehlen dürfen. Einen derartigen Sack, aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und mit Zeichnungen hübsch verziert, stellt Fig. 1e auf Tafel 27 Teil I dar. Auch der in Teil I Taf. 24 Fig. 2 abgebildete Hut ist aus schief aneinander genähten samit-Blättern verfertigt. Da die schreit-Palme nur in den hohen Gebirgen des Binnenlandes wächst, sind aus ihr hergestellte Artikel bei den weiter unten am Fluss wohnenden Stämmen nicht zu finden.
Eine ähnliche Arbeit wie das Flechten und Nähen von Matten und Mützen aus Rotang und samit ist die Herstellung von Hüten aus [215] Pandanusblättern. Von diesen bringen die Fig. 1, 3, 4 und 5 Taf. 24 Teil I gute Beispiele. Die Frau links auf Tafel 55 sehen wir damit beschäftigt, einen schön verzierten Hut aus kleinen Pandanusstreifen zusammenzusetzen. Die Hüte lassen bereits erkennen, dass man die Blattstreifen nicht flicht, sondern in bestimmter Weise in kleineren und grösseren Stücken neben- und untereinander näht, um so gewisse Figuren zu erhalten, die dadurch noch mehr hervortreten dass man einen Teil der Blätter mit Drachenblut rot, mit Russ schwarz färbt, den übrigen aber ihre natürlichen Farbe lässt.
An dem in Teil I Taf. 24 Fig. I dargestellten Hut sieht man, dass die Bahau auch durch Zeichnungen auf den Blättern ihre Kopfbedeckung zu verschönern trachten.
Die Art der Hutverzierungen ist für die verschiedenen Stämme charakteristisch; so haben die Hüte der Pnihing (Fig. 3, 4 und 5 Taf. 24 T. I) ein ganz anderes Aussehen als die der Long-Glat (Fig. 1), während die Kajanfrau auf Taf. 55 eine dritte Weise der Verzierung anwendet.
Das Färben der Blätter und Zusammensetzen der Hüte ist Arbeit der Frauen, die Zeichnungen jedoch werden von Männern ausgeführt.
Von allen Industrien der Bahaustämme hat die Töpferei durch den Einfluss der Küstenbevölkerung am meisten gelitten; an allen Orten, wo eiserne Töpfe eingeführt werden, hat die Töpferei überhaupt gänzlich aufgehört und sind nur noch Spuren ihrer früheren Existenz nachweisbar. Unter den fern von der Küste lebenden Kĕnjastämmen dagegen sind selbstgebrannte Töpfe noch sehr in Brauch; die Männer nehmen sie sogar auf weiten Reisen mit, um ihren Reis darin zu kochen.
In früheren Zeiten haben sämtliche Bahaustämme ihre Töpfe selbst gebrannt. Die Mendalambewohner stellen jetzt nur noch einige für den Kultus erforderliche irdene Gefässe selbst her (Fig. e und f Taf. 15 Teil I); vielleicht ist dies auch noch bei den Mahakamstämmen der Fall. Bei diesen fand ich jedoch auch Töpfe, welche der vorigen Generation im Haushalt gedient hatten und jetzt noch aus Pietät aufbewahrt wurden.
Im Jahre 1896 konnte ich nur noch zufällig einige von diesen Lehmtöpfen entdecken und kaufen, obgleich der kleine Stamm der Uma-Tĕpai, der bei Bo Lea in Long Tĕpai wohnte, erst vor kurzem wegen [216] seines Umzugs in eine Gegend, wo guter Lehm zum, Brennen nicht mehr zu finden war, die Töpferei aufgegeben hatte. Der Hauptgrund lag natürlich darin, dass diese unsoliden Gefässe durch die dauerhafteren eisernen verdrängt worden waren. Bei meiner Rückkehr im Jahre 1898 hatten auch andere Stämme von meinem hohen Angebot für Töpfe gehört, daher brachten mir besonders die Ma-Suling noch mehrere alte Exemplare zum Kauf. Augenblicklich hat sich die Töpferei also unter den Bahaustämmen am Kapuas und Mahakam nur noch in rudimentärer Form im Kultusdienst erhalten.
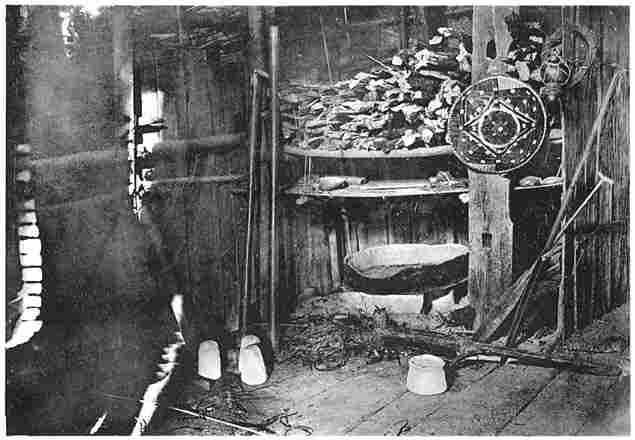
Herd in der Wohnung eines Freien.
Bei einigen dieser Stämme, wie den Ma-Suling, werden auch noch einige andere Gegenstände aus Lehm gebrannt, z.B. beim Anfang der Ernte grosse viereckige Schüsseln, in denen der halbreife Reis über dem Feuer getrocknet wird, um ihn dann später durch Stampfen entspelzen zu können. Ob dieser Brauch zum Kultus gerechnet werden muss, weiss ich nicht, soviel ist aber sicher, dass andere Stämme für dieses Reistrocknen grosse eiserne Pfannen benützen.
Unter den Kĕnja von Apu Kajan ist, wie gesagt, die Töpferei noch in vollem Schwange; sie wird dort vor allem beim Stamm der Ma-Kulit eifrig betrieben, der diese Töpfe als Tauschartikel auf Handelsreisen mitnimmt. Die Töpfe werden für den Transport zu je 6–8 aufeinander gestülpt und diese Reihen dann durch parallel gelegte Holz- oder Bambusstöcke und Rotang zu einem Packen verbunden.
Bei allen diesen Stämmen wird die Töpferei von Frauen betrieben. Sie gebrauchen hierzu eine besondere Lehmart, die nur an einigen Orten am Mahakam und Kajan zu finden ist. Der Lehm wird in der Sonne gut getrocknet, im Reisblock feingestampft und dann durch Sieben von kleinen Steinen und anderen groben Bestandteilen gesäubert. Dann feuchten ihn die Frauen an und mengen ihn mit Reisspelzen, um seine Festigkeit zu erhöhen. Aus dieser Masse formen sie mit der Hand, indem sie den Lehm um einen runden Stein von der gewünschten Grösse pressen, die Töpfe, die sie dann in die Sonne zum Trocknen stellen. Zur Bearbeitung der Aussenseite dient ein mit Schnitzfiguren versehenes Brettchen (Fig. 19 Taf. 51); die Töpfe sind daher von aussen nicht glatt, sondern mit einfachen Figuren verziert, wie an allen auf der gleichen Tafel abgebildeten Exemplaren deutlich zu sehen ist (Fig. 12–18). Das Härten der in der Sonne getrockneten Töpfe geschieht mittelst Harzpulver, mit dem in sehr dicker Schicht die innere und äussere Oberfläche überzogen wird. Werden [217] nun die Töpfe einem starken Feuer ausgesetzt, so verbrennt ein Teil des Harzpulvers und dient zur Härtung der Oberfläche, während der schmelzende Teil des Harzes in die poröse Lehmmasse eindringt und so die Dauerhaftigkeit des Gefässes bedeutend erhöht. In derartigen Töpfen lassen sich sehr gut Reis u.a. Speisen kochen, aber wenn sie zu lange im Wasser liegen, fallen sie meistens auseinander oder werden rissig. Die Kĕnja gebrauchen diese Töpfe nur aus Mangel an etwas Besserem; sobald sie sich eiserne Gefässe verschaffen können, ziehen sie diese begreiflicher Weise vor.
Auch grössere Töpfe als die in Fig. 18 abgebildeten werden in Apu Kajan gebrannt. Zwischen den Töpfen, die ich noch am Mahakam auftreiben konnte, und denen vom Kajan herrscht ein grosser Unterschied, der sich auch an den auf Tafel 51 abgebildeten Exemplaren feststellen lässt. Bei ersteren (Fig. 12–15) ist die Form runder und die Wand viel dicker als bei letzteren (Fig. 16–18). Im allgemeinen sind die Töpfe der Mahakambewohner roher und unregelmässiger bearbeitet als die der Kĕnja; doch kann es sehr wohl sein, dass die letzten Produkte einer aussterbenden Industrie allmählich schlechter geworden sind und dass auch die Bahau ursprünglich bessere irdene Waren geliefert haben.
Die am Mahakam zum Trocknen des Reises verfertigten Schüsseln sind etwa 3 × 5 dm gross; eine derselben ist auf dem Herd von Taf. 56 zu sehen. Man stellt sie auf die gleiche Weise wie die Töpfe her, doch werden sie nur in der Sonne getrocknet und nicht, oder nur mangelhaft, von aussen mit etwas Harzpulver gehärtet. Sie vertragen natürlich kein Wasser und werden daher ausschliesslich zum Trocknen von unreifem Reis benützt, auch stellt man sie bei jeder Ernte von neuem her. Gleichzeitig werden auch noch einige andere einfache Gegenstände aus Lehm gebrannt, vor allem die langen schmalen Unterlagen, auf welchen diese Schüsseln über dem Feuer ruhen. Auf dem erwähnten Herde sind zwei dieser Unterlagen zu sehen, ferner noch andere, mehr pyramidenförmige Unterlagen für gewöhnliche Kochtöpfe, von denen 3 links vom Herde stehen.
Der Fackelhalter rechts im Vordergrunde, mit der Vertiefung in der Mitte für den Stiel der Harzfackel, ist ebenfalls ein Produkt der Töpferkunst.
Der Bau von Böten gehört in einem Lande, wie das der Bahau, in welchem der Verkehr zwischen den verschiedenen Siedelungen und [218] der Transport zu und von den Feldern beinahe ausnahmslos auf den Flüssen stattfindet, zu den wichtigsten Arbeiten der Bevölkerung. Neben der Sorge für Nahrung, Obdach und Kleidung nimmt die Herstellung von Booten in der Tat einen grossen Teil ihrer verfügbaren Arbeitskraft in Beschlag. Jede Familie sucht, sei es auch unter Beistand der paladow (Mithelfer), die erforderlichen Fahrzeuge selbst zu bauen. Aber nicht jeder Mann ist in gleichem Masse imstande, einen passenden Baum auszusuchen, ihn zu bearbeiten, im Feuer auszulegen u.s.w.; jeder Stamm besitzt daher 1–2 anerkannte Autoritäten auf diesem Gebiet, denen, sobald es sich um den Bau sehr grosser Boote handelt, die Leitung desselben übertragen wird. So grosse Fahrzeuge bauen jedoch meistens nur die Häuptlinge, weil diese am ehesten die Beköstigung ihrer Hilfskräfte bestreiten können und sie überdies auf eine Unterstützung seitens ihrer männlichen Stammgenossen ein Anrecht haben.
Die Boote sind ausnahmslos Einbäume; sie werden aus einem einzigen Stück verfertigt, für welches man im Walde einen geeigneten Stamm wählt. Zur Vermeidung von Streitigkeiten bezeichnet jeder Besitzer sein Eigentum nach der auf pag. 155 angegebenen Weise.
Die Bahau unterscheiden verschiedene für Boote geeignete Baumarten, die je nach dem Zweck, für den die Fahrzeuge bestimmt sind, ausgesucht werden. So gebraucht man kleine, leichte Boote aus festem Holz, um nach den Feldern zu fahren, grössere aus biegsamem Holz mit dickerem Boden gegen den Anprall auf Steine zum Befahren der Flussoberläufe mit ihren Wasserfällen und Stromschnellen, sehr lange Boote mit besonders grossem Laderaum für lange Handelsreisen an die Küsten, ferner sehr lange, schmale Fahrzeuge für Kriegszüge und schliesslich besonders grosse, um sie am Unterlauf der Flüsse zu verkaufen. Für die kleinen soliden Boote gebraucht man das schwere aber feste Eisenholz, für die biegsamen, aber weniger starken Tengkawangholz. Für die grössten Boote besitzen nur bestimmte Baumarten die erforderlichen Dimensionen, so dass man in ihrer Wahl sehr beschränkt ist; die Eisenholzstämme sind zwar sehr hoch, aber für grosse Fahrzeuge zu schwer. In den kühleren Oberläufen der Flüsse sind Boote aus weichem Holz eher brauchbar als in den warmen Unterläufen, in deren Wasser weit mehr Organismen vorkommen, die das Holz anfressen; daher werden neben den grossen Frachtbooten aus weicherem Holz auch viele kleine Eisenholzboote in den Küstengegenden verkauft. [219] Es wird nämlich, besonders am Mahakam, zwischen den Gebieten ober- und unterhalb der Wasserfälle ein sehr reger Handel in Booten betrieben, weil weiter unten zum Bau grosser Fahrzeuge beinahe keine Bäume mehr zu finden sind. Im Innern ist zwar die Ausrottung dieser Waldriesen weniger weit fortgeschritten, aber auch dort finden die am höchsten flussaufwärts wohnenden Stämme, wie die Pnihing und Kajan, leichter dergleichen Bäume als die Ma-Suling und Long-Glat. Vielleicht ist es diesem Umstand zuzuschreiben, dass die Pnihing als die besten Bootsbauer bekannt sind; ihre Fahrzeuge zeichnen sich in der Tat durch Grösse, Form und gute Arbeit aus. 20 m lange Boote, für die ich bei den Pnihing 100 fl pro Stück bezahlte, verkaufte ich später, nach dem Gebrauch und trotz der Konkurrenz mit den Dampfbooten, am unteren Mahakam noch leicht zum gleichen Preis.
Für den täglichen Gebrauch benützen die Bahau Boote von etwa 8–12 m Länge und 60–75 cm Breite, für die Quellflüsse 10–14 m lange, während die grössten Boote 20–23 m lang und 1,5–2 m breit sind; letztere bestehen meist aus Tengkawangholz.
Der Bau von Booten wird, wie bereits gesagt, von den Bahaufamilien als eine sehr wichtige Arbeit betrachtet, da sie von den männlichen Gliedern viel Mühe und Zeit erfordert. Weitaus die meisten Boote, besonders die langen, werden denn auch mit Hilfe von Bekannten und Freunden hergestellt. Die Anzahl der sich zur Arbeit vereinigenden Männer hängt ausser von der Grösse des Bootes auch von anderen Umständen ab, ob es z.B. weit über Land geschleppt werden muss; in diesem Fall werden wohl auch besondere Hilfskräfte beigezogen. Häufig wird die Zeit nach der Reissaat zum Bootsbau gewählt, weil die Felder bis zur Ernte nicht mehr viel Pflege erfordern und die Männer daher dann am besten Arbeiten, die bisweilen einen wochenlangen Aufenthalt im Walde erfordern, unternehmen können.
Derjenige, der sich von anderen helfen lässt, übernimmt diesen gegenüber eine Schuld von einer gleichen Anzahl von Arbeitstagen, wie er selbst genossen hat, auch hat er für den Unterhalt seiner Gehilfen zu sorgen; bisweilen erhalten diese auch nur eine Belohnung.
Der Bau von Booten wird zu den grossen Arbeiten gerechnet, die von den Mondphasen beeinflusst werden; ein günstiger oder ungünstiger Stand des Mondes bestimmt nicht nur das Gelingen eines Bootes, sondern hauptsächlich auch dessen künftiges Schicksal. Arbeitet man zu ungünstiger Zeit am Boote, so zerschellt dieses beim Gebrauch bald [220] an einem Felsen, oder es wird durch plötzliches Hochwasser leicht vom Tau losgerissen und fortgetrieben, oder es schlägt in den Wasserfällen um und geht zu Grunde.

Abarbeitung eines Bootes.
Bei den verschiedenen Stämmen gelten nicht die gleichen Mondphasen als ungünstig; die Kajan am Obermahakam bezeichnen die zwei Tage vor und nach dem Vollmond als bulan (Mond) djă-djă (schlecht), die Long-Glat dagegen zwei Tage des zunehmenden und zwei des abnehmenden Halbmondes. An diesen Tagen dürfen auch keine Häuser gebaut werden, weil diese dann leicht durch Feuer vernichtet werden könnten. Ebenso dürfen in diesen Tagen, wie auch in denen des unsichtbaren Mondes, keine grösseren Reisen angetreten werden. Bei ungünstiger Mondphase lässt man auch keine Verbotszeit, z.B. für den Landbau, beginnen, geht man nicht auf die Vogelschau u.s.w. Natürlich sorgt man vor allem beim Anfang des Bootsbaus, dass man nicht “ga bulan djă-ăk”, den schlechten Mond trifft, sondern mit guten Vorzeichen den Weg antritt. Beim Auffliegen eines Vogels zur Linken oder ähnlichen schlechten Zeichen kehrt man, wie bei jeder anderen Arbeit, für Tage wieder nach Hause zurück.
Ein zum Bau eines Bootes gut befundener Baum wird in einigem Abstand vom Erdboden, wo er weniger breit ausläuft, umgehackt und darf, wie beim Häuserbau, nur, wenn er völlig seitwärts niederfällt, verwendet werden, gleitet er dagegen von seinem Stumpf ab und bleibt stehen, so ist er lāli und darf nicht weiter gebraucht werden. Bisweilen erhält der Stamm beim Niederstürzen einen Riss, wodurch er entweder gänzlich untauglich oder nur für ein kleineres Boot benützbar wird. Sind die Äste und der unbrauchbare Gipfel abgehackt und befindet sich der Stamm in geeigneter Lage oder ist er bei bedeutender Grösse und Schwere mittelst Hebeln in diese gebracht worden, so hackt man die rohe Form des Bootes aus ihm heraus. Ein solches noch unbehauenes Boot ist auf Tafel 57 zu sehen. Der Querriss zeigt noch die Rundung des Baumes und die Seitenwände sind nicht flach und gerade, sondern laufen in der Mitte rund nach oben zu. An den beiden Innenseiten sind einander gegenüber Holzteile stehen gelassen, die später, bei der Anbringung der Bänke, als Spanten dienen müssen. Überdies hat man den Rumpf des Bootes absichtlich dicker gelassen, um ihn, ohne Risse zu riskieren, durch den Wald nach Hause schleifen und dort fertigstellen zu können. Für diese Roharbeit gebraucht man nur Beile (Fig. 3 Taf. 51) und runde Dechsel (Fig. 5) an langen [221] Stielen, um mit diesen das Holz von innen wegzuhacken. Die feinere Bearbeitung wird allmählich und bei der Wohnung vorgenommen, wie Taf. 57 es uns vorführt. Um den Wänden die erforderliche Dünne und Glätte zu geben, wendet man platte Dechsel an kurzen Stielen an (Fig. 5 und 8 Taf. 51), wie sie von den Männern auf der Abbildung gehandhabt werden.
Sollen die Boote nicht sogleich gebraucht werden, so lässt man sie vom Wasser auslaugen. Bestehen sie aus Eisenholz, das im Wasser sinkt, so versenkt man sie ins Wasser, ist das Holz aber leichter als dieses, so lässt man die Boote mit einigen Balken als Unterlage auf dem Lande stehen, bis der Regen sie mit Wasser füllt. Indem man das Regenwasser einige Mal durch eine Öffnung im Boden ausfliessen lässt, wird die Auslaugung des Holzes befördert.
Da ein solches rundes Boot im Wasser nicht stabil genug ist, wird es erst durch Auslegen im Feuer für den Gebrauch tauglich gemacht. Zu diesem Zweck stellt man das Boot auf einige, ein paar Fuss hohe Unterlagen und setzt es dann während etwa 8 Stunden in seiner ganzen Länge zwei Reihen von gut flammenden Holzfeuern aus, wobei man durch Schlagen mit grünen, beblätterten Zweigen, die man in das im Boote befindliche Wasser taucht, ein Verbrennen des Holzes an der Aussenwand verhütet. Die Seitenwände biegen sich dann langsam nach aussen; man lässt ihre Ränder anfangs absichtlich soviel höher, damit sie nach der Auslegung mit dem Vor- und Hintersteven ungefähr in eine Ebene zu liegen kommen. An noch nicht genügend ausgebogenen Stellen wird das Feuer etwas länger unterhalten, doch beeilt man sich gleichzeitig, die im voraus fertig gearbeiteten Ruderbänke auf die innen zu beiden Bootsseiten stehengelassenen Spanten (Taf. 57) festzubinden. Dies geschieht mittelst Rotang, den man durch die in die Bretter und Spanten gebohrten Löcher zieht und dann festknüpft. Auf diese Weise wird bei der Abkühlung eine nachträgliche Einwärtskrümmung verhindert, die bei einigen Holzarten leicht vorkommt.
Am Mendalam kennt man zwei Formen von Booten, nämlich solche mit spitzen Enden (harok) und mit stumpfen (bung). Am Mahakam sah ich nur die erste Art.
Die Bootsränder werden, um ein Eindringen des Wassers zu verhindern, durch Bretter erhöht. Diese Schanzkleidung wird auf die gleiche Weise wie die Ruderbänke mit Rotang an die Ränder befestigt. Ein Verkleben der Öffnungen mit dumpul (Harzpulver, Pflanzenfasern und Petroleum) ist [222] mehr bei den Malaien als den Bahau üblich. Für Fahrten auf stillen Flüssen werden die Ränder nur mit einer Reihe von Brettern erhöht, für Quellflüsse dagegen mit ihren Stromschnellen und Wasserfällen mit 2–3 Reihen. Mit derartig verstärkten Booten wagen die Dajak denn auch mit voller Ladung grosse Stromschnellen hinabzufahren.
Am Kapuas und Mahakam werden die Boote wenig verziert; nur die grössten Exemplare tragen innen und aussen am Vorder- und Hintersteven bisweilen eine Holzmaske. Bei den Kĕnja in Apu Kajan dagegen ist ein Verzieren der vorderen und hinteren Bootsenden mit Drachenköpfen allgemein Sitte.
Einen besonders schönen Schmuck tragen bei den Kĕnja die grossen Kriegsboote, die am Kapuas und Mahakam infolge der friedlichen Beziehungen der Stämme unter einander überhaupt nicht vorkommen.
Dass die Bewohner des oberen Mahakam ihren Booten viel mehr Sorgfalt zuwenden als diejenigen des Kapuas, ist wohl hauptsächlich dem Umstand zuzuschreiben, dass bei ersteren in den Flüssen viel mehr Stromschnellen und Wasserfälle mit spitzen Felsblöcken vorkommen als bei letzteren. Die Boote der Mahakamstämme haben auch einen viel dickeren Boden und ihre ganze Bauart ist schwerer. Ein sorgsamer Blu-ubewohner setzt sein Boot auch alle 2–3 Monate von neuem der ganzen Länge nach einem Feuer aus, um die von den Flusssteinen gelösten Holzfasern abzubrennen, wodurch die Gleit-fähigkeit erhöht und das Holz durch Schrumpfen gehärtet wird. Auch kratzt er an der Innenseite sorgfältig die äussere Schicht ab, die durch einfallendes Regenwasser oder durch die Ritzen dringendes Wasser, das sich in den Böten stets in grösserer oder geringerer Menge ansammelt, verfault ist. In der Regel geschieht diese Arbeit mit dem Schwert.

Brennen von Muschelkalk.
Kwing Irang beschäftigte sich oft Tage lang mit der Ausbesserung seiner Boote. Die zeitweilig nicht gebrauchten Fahrzeuge lässt man weder auf dem Wasser treiben, noch stellt man sie Wind und Wetter bloss, sondern bewahrt sie trocken in umgekehrter Lage auf Gestellen unter den langen Häusern, wie Tafel 23 oben es zeigt; oder man bindet sie, auf den Rand gestellt, an die Stützbalken des Hauses, wie rechts oben auf der unteren Abbildung von Tafel 53 zu sehen ist.
Den Bahau und Kĕnja sind Boote aus Baumrinde, wie sie von den Batang-Luparstämmen gebraucht werden, zwar bekannt, doch finden sie bei ihnen keine praktische Verwertung, wahrscheinlich weil sie seit [223] lange die Gebirge Borneos bewohnen, deren Bergströmen nur feste Fahrzeuge stand halten können. Selbst wenn die Mahakamer auf Reisen nach der Überschreitung der Wasserscheide zum Hinabfahren auf den Flüssen neue Boote im Walde bauen müssen, stellen sie diese doch auf die gewohnte Weise her. Allerdings begnügen sie sich dann mit einer unvollkommeneren Bearbeitung, weil die zur Verfügung stehende Zeit auf solchen Reisen infolge von Nahrungsmangel sehr beschränkt ist. Die Bemannung eines Fahrzeugs, die die nötigen Beile, Schwerter und Dechsel stets mit sich führt, braucht auf Reisen 4–5 Tage, um aus einem Baum ein Boot herzustellen.
Mit der Einführung des Sirihkauens, das sich erst seit ein oder zwei Menschengeschlechtern bei den Eingeborenen des Innern eingebürgert hat, haben diese auch die Kalkbrennerei übernommen. Diese liefert ausschliesslich Kalk zum Sirihkauen, denn der Gebrauch von weissem Kalk als Farbstoff ist zu gering, um eine allgemeine Industrie zu veranlassen. Die meisten dicht an der Küste wohnenden Stämme, besonders die Malaien, brennen den Sirihkalk aus eingeführten Muscheln; die weiter oben an den Flüssen wohnenden Stämme wissen, dass man auch durch Brennen gewisser Teile der Kalkfelsen guten, zum Kauen geeigneten Kalk erhalten kann. Merkwürdigerweise suchen diese Stämme im Gebirge gerade diejenigen Kalkfelsen aus, die reich an fossilen Muscheln sind. Die Kajan am Blu-u nahmen auf ihren Fahrten zu den Pnihing Stücke von einem Felsen im Oköp mit, der bei näherer Besichtigung ganz aus Kalk von zahllosen nur 2–4 mm grossen Muscheln bestand.
Das Brennen des Kalkes geschieht nach der auf Tafel 58 dargestellten Weise. Man benützt hierfür ein Feuer von Holzkohlen, das, wie in der Schmiede mit einem Blasbalg angefacht wird. Der stehende Mann handhabt mit der Linken den Sauger, der die Luft ins Feuer treibt, während der hockende mit einem Stocke das vor ihm brennende Kohlenfeuer schütt.
Das Kalkbrennen darf nicht in irgend einer Schmiede vorgenommen werden, sondern man richtet unter den langen Häusern einen oder mehrere solcher Blasbälge auf, mit denen jede Familie selbst ihren Kalk brennen darf.
Erwähnenswert ist noch eine eigentümliche, in früheren Zeiten, wie [224] es scheint, mehr als gegenwärtig geübte Industrie der Bahau, nämlich die Bearbeitung von Natursteinen zu verschiedenen Gebrauchsgegenständen, vor allem zu Schmuck. Die einzige Gesteinsart, die ich bei den Dajak für Gürtelscheiben, Ohrgehänge und Perlen benützen sah, ist ein Serpentinstein, schwarz mit hellgrünen Flecken, der nach seinem Vorkommen im Boh batu Boh genannt wird; er kommt im anstehenden Gestein oberhalb der Ogamündung vor. Aus diesem Serpentin bestehen auch die auf Tafel 60 in Fig. q und r abgebildeten Ohrbammeln. Die grosse Gewandtheit, mit der dieser Stein umgeformt wird, ist staunenswert. Die zum Gebrauch als Gürtelscheibe im Stein erforderlichen Löcher werden mit Hilfe von Holz, Sand und Wasser gebohrt und besitzen oft einen beinahe vollkommen runden Querschnitt, zugleich aber auch die für diese Art der Bearbeitung bezeichnende trichterförmige Erweiterung zur Oberfläche hin. Noch mehr Bewunderung verdient die Genauigkeit, mit der sie einigen Gürtelscheiben, ohne die ihnen unbekannte Drehscheibe, eine beinahe tadellose kreisförmige Aussenfläche zu geben verstehen oder eine rein birnförmige Gestalt mit kreisförmigem, horizontalem Durchschnitt, wie die Steine der erwähnten Ohrbammeln q und r sie zeigen. Dies sind alte Ohrgehänge der Long-Glat, die gegenwärtig aus der Mode sind; r ist einigermassen asymmetrisch, aber q ist so rein von Form, dass nur mit einem Vergrösserungsglas durch Feststellen von Ritzspuren an der Oberfläche bewiesen werden konnte, dass der Stein ohne Drehscheibe verfertigt worden ist. Nicht minder Zweifel erweckten hinsichtlich der Herstellungsmethode die oben um den Stein angebrachten Rinnen; doch bewiesen auch hier einige Unregelmässigkeiten, dass sie aus freier Hand hergestellt sein mussten.
Aus Naturstein geschliffene Perlen, die man bei so vielen auf niedriger Kulturstufe stehenden Völkern findet, trifft man auch bei diesen Stämmen an. Sie werden aus demselben Serpentin hergestellt, indem man die äussere Oberfläche rund schleift und eine zentrale Öffnung anbringt. Diesen Steinperlen begegnete ich jedoch, besonders im Vergleich mit den allgemein verbreiteten eingeführten Perlen aus Glas, Porzellan und Ton, nur sehr selten, auch sah ich nur solche von mangelhafter Zylinderform.
Während mir die Dajak die Serpentinperlen nur als interessante, kostbare Altertümer vorzeigten, gebrauchten sie die alten und neuen Kunstperlen täglich zum Schmuck oder zu anderen Zwecken. Auch [225] diese wurden, hauptsächlich wenn sie alt waren, hoch geschätzt, ja sogar neben Nahrung und Wohnung als die wichtigsten Lebenserfordernisse angesehen. Als Schmuck dienen sie Männern, Frauen und Kindern in Form von Halsketten, Gürteln und Armbändern oder in schönen Mustern zusammengefügt zur Verzierung von Kleidungsstücken. Einen praktischen Zweck erfüllen die Perlen als gangbare Münze im Tauschhandel innerhalb eines Stammes oder im Verkehr mit anderen Stämmen. Ferner wird das Vorhandensein von Perlen bei religiösen Zeremonien gelegentlich der verschiedensten Lebensereignisse als unumgänglich nötig angesehen. Alte Perlen gelten auch an und für sich als ein Schatz, den man sich mit den grössten Entbehrungen erwirbt und in dem man sein gespartes Geld anlegt.
Da die Kunstperlen weite Handelsreisen veranlassen und auch bei anderen Stammgruppen als den Bahau und Kĕnja auf Borneo eine grosse Bedeutung besitzen, ist es wohl der Mühe wert, im folgenden auf die Rolle, die sie im Leben der Dajak spielen, auf ihre Herstellung, ihre Herkunft und ihr Vorkommen auch ausserhalb Borneos ausführlich einzugehen.
Bei sämtlichen Stämmen, die das Innere der Insel Borneo bewohnen, sind Kunstperlen im Schwange; doch werden sie nicht überall in gleichem Masse verwandt, auch benutzen die verschiedenen Stämme verschiedene Arten von Perlen. Die von den Bahau und Kĕnja in ethnographischer Hinsicht sehr abweichenden Ot-Danum, die im Süden und Westen von Mittel-Borneo leben, gebrauchen im Gegensatz zu ersteren nur selten Glasperlen, sondern, besonders für Halsketten und Armbänder, Natursteinperlen aus rotem Achat, der daher, echt oder auch nachgemacht, in grosser Menge bei ihnen eingeführt wird.
Zwischen den Bahau und Kĕnja und der Stammgruppe, deren wichtigste Vertreter die Batang-Lupar sind und zu denen auch die Kantuk gehören, die aus dem Seengebiet des Kapuas stammen und jetzt an diesem Flusse selbst wohnen, macht sich dieser Gegensatz weniger scharf geltend. Bei letzteren sind ausser den Steinperlen auch viele Arten von Glas- und Porzellanperlen, wenn auch in geringerem Masse als bei den Bahau und Kĕnja, im Gebrauch. Erwähnenswert ist der Stamm der Taman-Dajak am oberen Kapuas wegen seiner Fertigkeit, aus bestimmten Arten von Glasperlen geschmackvolle Jacken und Röcke herzustellen.
Die folgenden Ausführungen über den Gebrauch von Perlen auf [226] Borneo beziehen sich zwar nur auf die Stammgruppen der Bahau und Kĕnja, geben aber doch eine allgemeine Vorstellung von der Rolle, welche Perlen bei Stammen spielen können, die auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehen.
Die Perlen, die sich bei den genannten Stammgruppen allgemeiner Beliebtheit erfreuen, sind beinahe alle in früheren Zeiten oder in der Gegenwart aus Glas, Porzellan und Fayence hergestellt und eingeführt worden. Solche Perlen (Siehe Taf. 59 Fig. 1–10, 12–14, 17, 20, 27 und 36) stellen diese Stämme nie selbst her. Diejenigen Perlen, welche sie selbst als neu bezeichnen, werden hauptsächlich aus Singapore eingeführt, während die alten Perlen, die man von Alters her auf der Insel findet, in sehr frühen Zeiten aus unbekannten Gegenden zu ihnen gelangt sein müssen.
Das Alter der Perlen bestimmt zwar hauptsächlich ihren Wert, aber nicht ihre Verwendung. Die Rolle, welche die Perlen im Lebenslauf eines Dajak zu erfüllen haben, hängt mehr von ihrer Form als von ihrem Alter ab; Häuptlinge und Reiche verwenden im allgemeinen häufiger alte Perlen, Unbemittelte neue. Für religiöse und andere Zeremonien sind bestimmte Perlenarten vorgeschrieben, bemerkenswerterweise bestehen hierin selbst unter verwandten Stämmen Unterschiede. Alte und neue Perlen der gleichen Art tragen keine scharfen Erkennungszeichen. Von den Perlen, welche die Eingeborenen als sehr alt und kostbar bezeichnen, führen zahlreiche Übergänge zu den minder alten und wertvollen und von diesen wiederum zu den neusten Perlen, die ihnen noch heutigen Tages zugeführt werden.
Da die neueren Perlen nach dem Muster der älteren aus dem gleichen Material und mit den gleichen Zeichnungen hergestellt werden und die alten Perlen der gleichen Art durchaus nicht immer unter einander völlig übereinstimmen, besitzen die neuen keine charakteristischen Formen oder Farben, die sie von den alten scharf unterscheiden. Dennoch ist es unmöglich, neue Perlen als alte zu verkaufen, weil diese infolge des langen Gebrauchs an der Oberfläche verschlissen, vom Fett der Haut durchzogen und, wenn sie in der Erde gelegen haben, an der Oberfläche verwittert sind. Die neuen Perlen können daher, trotzdem sie in Form und Farbe den alten gleich sind, von Sachverständigen doch unterschieden werden; eine genaue Nachahmung würde dem Fabrikanten wahrscheinlich zu teuer zu stehen kommen. Da bestimmte Perlenarten nur von bestimmten Stämmen geschätzt werden [227] und wiederum bei den anderen oft so gut als wertlos sind, und da ferner das Kaufvermögen der Eingeborenen sehr gering ist, kann dem Fabrikanten, wenigstens für Borneo, eine genaue Nachahmung einzelner alter Perlen, die viel Zeit und Mühe erfordert, keinen Vorteil bieten. Einer Perle, die nach einem gegenwärtig unbekannten Verfahren hergestellt worden wäre, bin ich unter vielen Hunderten von Perlensorten in Borneo nicht begegnet. Der Preis einer Perle richtet sich nicht nur nach ihrem Alter, sondern auch nach ihrer Art. Eine verbreitete Art alter Perlen (lĕkut sĕkala) wurde in den Jahren 1896–1900 am Kapuas und oberen Mahakam für 100 fl das Stück verkauft; dagegen zeigte mir der Sultan von Kutei eine Perle, die, nach seiner Aussage, 40000 fl wert war. Sie war doppelt kegelförmig, 2 cm gross und bestand aus gelbem Porzellan, durchzogen von Bündeln verschiedenfarbiger Glasurstreifen. Die Malaien hätten jedoch einen so hohen Preis für die Perle nicht bezahlen wollen und von den Dajak-Häuptlingen wären nur wenige hierzu im stande gewesen. Jede der verschiedenen alten Perlenarten besitzt ihren bestimmten festen Preis. Wie bei allen derartigen Artikeln ist aber auch bei diesen Perlen der Preis von Nachfrage und Angebot abhängig. Da, wo sich malaiischer Einfluss geltend macht, findet ein starkes Sinken der Preise statt. Gegenwärtig schätzen unter den Bahau und Kĕnja auf holländischem Gebiet nur noch die Stämme am Oberlauf des Kapuas, Mahakam und Kajan den Besitz alter Perlen höher als den von Geld. Am Mittel- und Unterlauf dieser Flüsse dagegen, wo die Eingeborenen oft mit Malaien in Berührung kommen, veräussern sie ihren Perlenbesitz, was einen lebhaften Handel zwischen Binnenland und Küste veranlasst.
Für die ursprünglichen Dajak bildet der Einkauf von Perlen den wichtigsten Anlass zur Unternehmung monat-, ja selbst jahrelanger Reisen aus dem einen Gebiet ins andere. Vom Kapuas aus machen hauptsächlich die bei Putus Sibau lebenden Taman-Dajak Züge zum mittleren Mahakam, Wo alte Perlen stark im Preise gefallen sind. Sie begeben sich an den oberen und mittleren Mahakam, um dort Guttapercha und Rotang zu suchen, die sie in Udju Tĕpu an den Mann bringen. Für den Erlös kaufen sie bei den benachbarten Stämmen alte Perlen, die sie als einzigen Besitz nach einer Reise von 6 Monaten bis zu 1½ Jahren in ihre Heimat am oberen Kapuas mitbringen, wo sie mit den Perlen unter den eigenen Dorfgenossen und benachbarten Stämmen sehr vorteilhaften Handel treiben. Auch die Kajan [228] am Mendalam besuchen die verwandten Stämme am Mahakam und Tawang hauptsächlich, um von dort alte Perlen mit nach Hause zu bringen. Abgesehen vom Einfluss der Malaien, ist der Preis für alte Perlen auch noch aus einem anderen Grunde am mittleren Mahakam niedriger als am Kapuas. Es kommen nämlich, besonders beim Stamm der Kĕnja am Tawang, alte Perlen an einigen Stellen in der Erde vor. Nun wissen die benachbarten Stämme sehr gut, dass diese Perlen aus sehr alten Gräbern stammen, von denen ihre Überlieferung ihnen nichts mehr berichtet, und gebrauchen diese Perlen aus Abscheu nicht selbst. Fremde dagegen finden hier gute Gelegenheit für einen vorteilhaften Kauf, und wenn sie auch etwas über die Herkunft der Perlen verlauten hören, so verraten sie doch ihren Kunden am Kapuas nichts davon, auch finden sie die Sache, da es sich um so weit entfernte Gegenden handelt, nicht so schlimm.
In Anbetracht, dass die Toten mit ihrem kostbaren Besitz an Perlenhalsketten und -gürteln und mit Mützen und Kleidern mit Perlenverzierungen begraben werden, wodurch järlich ein Teil der Perlen dem Verkehr entzogen wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein bedeutender Teil der jetzt getragenen alten Perlen bereits einmal oder mehrmals mit einer Leiche begraben worden ist. Nach deren Verwesung gelangen die Perlen in die Erde, wo sie während längerer oder kürzerer Zeit liegen bleiben. Bei einem Besuch des Begräbnisplatzes der Pnihing am Tjĕhan sah ich denn auch viele Perlen auf dem Erdboden umherliegen. Hierdurch haben die meisten alten Perlen ihre glänzende Oberfläche eingebüsst, auch sind sie zum Teil bis tief zur Mitte verwittert. Da in dem Stoff der Perlen zahlreiche Bläschen vorkommen, die durch den Verwitterungsprozess geöffnet werden, zeigt ihre Oberfläche bisweilen sogar tiefe Gruben. Bei vielen emaillirten Perlen fällt die Emaille aus den Gruben heraus oder geht rascher als die übrige Masse zugrunde.
Perlen bilden nicht nur einen Handelsartikel zwischen den Stämmen, sondern dienen, wie erwähnt, auch innerhalb des Stammes als Geld. Für den täglichen Gebrauch werden daher mehr oder weniger wertvolle Perlen, um sie nicht zu verlieren, an eine Schlinge aus Lianenfasern von 5–6 cm. Durchmesser gereiht. Für diese werden Schweine, Mais, Bataten, Reis u.s.w. eingekauft, und so erstand ich auch die alten und neueren Perlen, die ich im ethnographischen Reichs-Museum in Leiden deponierte. [229]
Die Bewohner Zentral-Borneos haben von der Herkunft der alten und neuen Perlen nur eine sehr undeutliche Vorstellung. Da sie den alten Sorten nicht wie den eigentümlich geformten Flusssteinen und Rotangstücken, die als Amulette getragen werden, übernatürliche Kräfte zuschreiben, hat ihre Phantasie sich nicht viel mit deren Herkunft beschäftigt. Erzählungen, die hierauf Bezug hätten, habe ich auch nie gehört. Die malaiischen Händler, welche neue Perlen von der Küste bei den Dajak einführen, machen diesen zwar weis, dass sie diese, wie auch andere schöne Gegenstände, am Eingang grosser Höhlen gefunden hätten, in denen sie von den Geistern verfertigt würden, die Bahau sind aber klug genug, diesen Erzählungen nicht unbedingten Glauben zu schenken, wenn sie den wahren Sachverhalt auch nicht kennen.
Wie ich früher bereits sagte, ist Singapore der Ort, von dem aus die neuen Perlen aus Glas, Fayence und Porzellan nach Borneo eingeführt werden. Unter der grossen Anzahl Sorten, die von dort aus versandt werden, stammen die meisten aus europäischen Fabriken und zwar aus Gablonz in Böhmen, Birmingham und Murano bei Venedig. Ich vermute, dass einige Arten von Glasperlen aus China kommen oder doch noch vor kurzem von dort eingeführt wurden, da sie noch jetzt in chinesischen Schachteln und chinesischem Papier in Singapore verkauft werden. Dies sind rein blaue, durchsichtige und gelbe, undurchsichtige Glasperlen (Fig. 8), meist zylinderförmig, 7 mm lang und 8 mm dick. Auch andere, runde rote, durchsichtige Glasperlen von 4 mm Durchmesser stammen meiner Vermutung nach aus China.
Die Grösse der Perlenarten ist sehr verschieden und bestimmt mit den Zweck ihrer Verwendung. Die allerkleinsten einfarbigen Perlen werden zur Zusammenstellung farbiger Perlenmuster als Verzierung für Schwertscheiden, Kopf binden und Röcke gebraucht, bisweilen auch für Gürtelquasten. Neben diesen Perlen wird eine grössere Art auch zur Herstellung grosser Schmuckstücke für Kindertragbretter, Hüte und Mützen benutzt. Aus derselben Perlenart bestehen gänzlich oder zum Teil die prachtvollen Röcke und Jacken der Taman-Dajak. Die allgemein getragenen Halsketten und Armbänder werden aus grösseren Perlen verschiedener Form und Farbe hergestellt. Die einfarbigen, runden und zylindrischen werden der Farbe nach auf bestimmte Weise zu ein- oder mehrreihigen Halsketten zusammengefügt. In der Mitte [230] dieser Ketten, zwischen den beiden völlig gleichen Seitenteilen, finden sich bunte, mit Rosetten und Streifen verzierte Perlen in unbestimmter Reihenfolge eingefügt. Dies Mittelstück enthält die allerverschiedensten Sorten, sowohl die schön gezeichneten neuen als die alten sehr wertvollen neben einander. Da die Bahau sonst viel Geschmack zeigen, scheinen sie in diesem Falle mehr auf die Schönheit der einzelnen Perlen Wert zu legen als auf den Eindruck, den sie im ganzen machen. Das gleiche gilt für die Gürtel, die aus noch grösseren und den grössten Perlen zusammengesetzt und von Frauen, bisweilen auch von Männern, getragen werden. Auch diese Schnüre bestehen aus zwei Seitenteilen, für die eine oder zwei verschiedene Perlenarten gleicher Farbe verwendet werden, während man für das Mittelteil mehr oder weniger alte und hübsche Perlen ohne Rücksicht auf Form und Farbe aneinander reiht. Einige Stämme bevorzugen jedoch für diesen Leibesschmuck bestimmte Perlenarten. Während z.B. die Anwohner des Kapuas und Mahakam sowohl für Halsketten als Gürtel am liebsten Perlen mittlerer Grösse verwenden, ziehen die Kĕnja für den gleichen Zweck grosse, schön gearbeitete Perlen aus Glas, Porzellan oder Fayence vor; auch sie achten auf bestimmte Formen und schöne Zeichnung.
Die wichtigste Rolle spielen die Perlen bei den Dajak gelegentlich verschiedener Lebensereignisse und beim Gottesdienst. Den alten Perlen werden zwar keine schutzbringenden oder übernatürlichen Kräfte zugeschrieben, aber bei religiösen Zeremonien opfert man sie als schöne, kostbare Geschenke den Geistern, um diese in gute Laune zu versetzen. Ferner bringt man die beiden Seelen des Menschen häufig mit alten Perlen in Berührung, um ihnen etwas Angenehmes zu erweisen, besonders um die mit dein lebenden Körper nur locker verbundene bruwa am Entfliehen zu verhindern oder zur Rückkehr zu bewegen.
Die Art und Weise, in welcher Perlen im allgemeinen bei bestimmten Lebensereignissen und religiösen Zeremonien von Laien, Priestern und Künstlern verwendet werden, ist gelegentlich bereits ausführlich behandelt worden.
Der Umstand, dass Perlen im Leben der Bevölkerung Borneos nicht nur als täglicher Schmuck und kostbare Kleinodien dienen, sondern auch für die Herstellung künstlerisch schöner Arbeiten und religiöse Zeremonien benützt werden, spricht dafür, dass Perlen von Alters her bei ihr in Gebrauch gewesen sein müssen. Bei den gegenwärtigen Bahau [231] fand ich keine Spur, die darauf hinwies, dass sie in früheren Zeiten mehr aus Natursteinen, von ihnen selbst verfertigte Perlen benutzt hätten, obgleich dies sehr gut möglich wäre. Da alle alten, kostbaren Perlen, die ich sah, eingeführt worden waren und ans Glas, Porzellan oder glasiertem Ton bestanden, kann eine eventuelle Herstellung von Perlen aus Natursteinen nur während einer sehr frühen Periode statt-gefunden haben.
Betrachtet man die vielen verschiedenen Perlenarten, die bei den Eingeborenen Borneos einen eigenen Namen tragen und daher lange unter ihnen zirkuliert haben müssen, so zeigt es sich, dass sowohl alle alten als alle neuen Perlen mit den vielen Arten von Kunstperlen, die auch in anderen Gegenden des indischen Archipels vielfach vorkommen und nicht nur gegenwärtig in allen Weltteilen verbreitet sind, sondern auch als Überreste lang verschwundener Kulturzentren gefunden werden, völlig übereinstimmen.
Einen Beweis dafür, dass in der Tat viele Perlenarten, die man über den indischen Archipel verbreitet findet, übereinstimmender Natur sind, erhielt ich im Jahre 1898 in Batavia, als mir Dr. C. Snouck Hurgronje alte Perlen zeigte, die ein Araber in den Lampong-Distrikten in Süd-Sumatra aufgekauft hatte, um sie später auf Timor sehr vorteilhaft zu verkaufen. In Süd-Sumatra sind diese gelbbraunen Perlen nämlich infolge der zunehmenden Entwicklung der dortigen Bevölkerung, gleichwie auch an den Küsten Borneos, sehr billig zu haben, während sie auf Timor, wo sie unter dem Namen muti salah oder muti tanah bekannt sind, noch einen hohen Wert besitzen. Auch unter den Bahau sind diese Perlen sehr geschätzt. Noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass Einwohner von Kroé in Benkulen, an der Westküste Sumatras, gegenwärtig (1902) nach West-Borneo und von dort den Kapuas aufwärts ins Innere der Insel ziehen, um ihre alten Perlen den Bahaustämmen zu verkaufen. Aus dem Kapuasgebiet zogen sie sogar über die Wasserscheide zum Mahakam, fuhren den Fluss hinab bis zur Ostküste und kehrten von dort in ihre Heimat zurück, nachdem sie auf dieser Reise quer durch die Insel ihre Perlen sehr vorteilhaft an den Mann gebracht hatten.
Während die Herkunft der Perlen aus Natursteinen leicht bestimmbar ist, da der Batu Boh z.B. aus dem Boh selbst stammt oder als Geröllstein im unteren Teil des Mahakam gefunden wird, fehlen für Kunstperlen derartige Anhaltspunkte. Die auf Tafel 59 in Fig. 1–10 [232] etc. abgebildeten Kunstperlen der Bahau und Kĕnja repräsentieren nur wenige Arten von den vielen Hunderten, welche unter den dajakischen Stämmen verbreitet sind. Sie sind auch keineswegs für Borneo bezeichnend, sondern kommen ebenso auf anderen Inseln des indischen Archipels vor, z.B. Fig. 18 auf Timor, 19 auf Celebes, welch letztere in der Zusammensetzung mit 11, 12, 13, 14 und 17 übereinstimmen. Die Perle 27 unterscheidet sich nur durch ihre Grösse von 25 und durch ihre Form von 24, die beide als muti salah von Timor stammen. Berücksichtigt man, dass jede dieser Perlenarten in zahlreichen kleinen Abweichungen vorkommt, so wird die Übereinstimmung noch grösser.

Kunstperlen.
Diese Übereinstimmung ist auch an den Kunstperlen bemerkbar, welche aus anderen Weltgegenden und längst verflossenen Zeiten stammen. Zum Vergleich sind auf Tafel 59 auch einige ausserhalb des indischen Archipels gefundene Perlen abgebildet. Hiernach sieht man, dass Fig. 20, eine Perle aus Borneo, sich nur in der Grösse einigermassen von Fig. 21, einer aus einem alten Grabe in Ungarn stammenden, unterscheidet, oder von Fig. 29, die aus Utrecht, vom Anfang unserer Zeitrechnung stammt. Selbst die phoenizische Perle (Fig. 28) aus Sardinien ist der vorigen in der Zusammensetzung, jedoch nicht in der Farbe, gleich. In der Form stimmt die ke̥l-o̤m diān aus Borneo (Fig. 36) mit Fig. 30, 31, 33 und 34 aus alten Römergräbern der Provinz Gelderland, mit Fig. 35 aus der Provinz Groningen, mit der allemannischen Perle (32) aus Nieder-Breisich, mit der altägyptischen (37 u. 38) und mit einer Perle (39) aus einem alten Grabe bei Smyrna überein.
Ein anderes Beispiel für die grosse Übereinstimmung der Perlen aus Borneo mit denen aus anderen Ländern und Zeiten liefern noch Fig. 15 und 16 aus sehr alten Gräbern der Provinz Utrecht und Fig. 11, eine alte ägyptische Perle, alle Varietäten der so stark verbreiteten Form der “chevron pattern.”
Da alle diese so sehr ähnlichen Perlenarten seit der Zeit, wo die Ägypter mit ihrer Herstellung begannen, von zahlreichen hochentwickelten Völkern wie den Phöniziern, den Etruskern, den Römern, den Bewohnern von Vorder-Indien und den Venetianern verfertigt wurden und gegenwärtig ebenso in Birmingham und Gablonz hergestellt werden, ist es unmöglich zu konstatieren, von wo und wann die alten Perlen bei niedrig entwickelten Völkern, wie den Dajak, eingeführt worden [233] sind. Der Versuch, mit Hilfe dieser Kunstperlen alten Verbindungen zwischen niedrig stehenden Völkern und hochstehenden Bildungszentren, in denen allein diese Perlen hergestellt sein können, nachzuspüren, muss daher aus obigen Gründen scheitern (Siehe Archiv für Ethnog. Bd. XVI 1903). [234]
Kapitel IX.
Allgemeines über die Kunstäusserungen der Bahau- und Kĕnjastämme—Zahl und Art der in der Ornamentik angewandten Motive—Verwendung von Menschenfiguren—Erkennungszeichen für bestimmte Motive—Tierfiguren (Hund, Tiger, Rhinozerosvogel)—Verwendung einzelner Tierteile (Feder des Argusfasans, Pantherfell)—Genitalmotive—Stilisierungen—Verwendung der Motive im Kunsthandwerk: bei Hirschhorngriffen, Schwertscheiden, Bambusköchern, Kleiderverzierungen, Perlenarbeiten—Einfluss fremder Völker und Stämme auf die Entwicklung der Kunst bei den Bahau und Kĕnja.
Der Einblick in die Industrie der Bahau- und Kĕnjastämme, den der Leser im vorigen Kapitel gewonnen hat, überzeugte ihn auch von dem Drang dieser Dajak, alle Gegenstände ihrer täglichen Umgebung durch künstlerische Verzierungen zu verschönern. Aufgabe des folgenden Kapitels ist, zu zeigen, in welcher Weise diese künstlerische Anlage sich bei ihnen äussert, in welcher Richtung sie sich entwickelt hat, welche Motive die Dajak ihrer Ornamentik zu Grunde legen, welche Vorbilder diese veranlasst haben und welche Bedeutung letztere für sie besitzen.
Der Wunsch und die Fähigkeit, schöne Gegenstände hervorzubringen, ist bei beiden Geschlechtern der Dajak entwickelt, nur macht sich bei beiden eine Spezialisierung bemerkbar, die in unwillkürlichem Zusammenhang mit ihren Hauptbeschäftigungen steht. So verzieren Frauen vor allem die von ihnen selbst verfertigten Kleidungsstücke, Matten, Schmucksachen, Männer dagegen Gegenstände aus Bambus, Holz, Horn und Eisen, gewisse Teile der Häuser, Böte und Schwerter, Dinge, mit denen sie täglich umzugehen haben. Bemerkenswerterweise ist diese Verschiedenartigkeit der beiden Geschlechter in der praktischen Anwendung ihres Kunstsinnes bei allen Individuen und Stämmen zu finden; selbst dann, wenn Mann und Frau gemeinschaftlich einen bestimmten Gegenstand zu verzieren beginnen, nimmt doch jedes einen bestimmten Teil desselben vor. Also nicht nur in der Art des zu verzierenden Gegenstandes, sondern auch in der Art der Ornamentik [235] selbst macht sich diese Verschiedenheit bei beiden Geschlechtern bemerkbar. Um einige Beispiele anzuführen: die geschmackvollen Perlenarbeiten (Taf. 70–75) entstehen derart, dass die Männer die Muster in Holz schnitzen (Taf. 69 c u. e), die Frauen dagegen nach eigenem Geschmack in verschiedenen Farben die Perlen darüber hinreihen. Die Tätowierkünstlerinnen drücken die darzustellenden Figuren mittelst Holzpatronen, welche die Männer für sie hergestellt haben, ihren Kunden auf die Haut. Die farbigen Zeugfiguren, mit denen die Frauen ihre Kleider und die Totenausrüstungen schmücken, werden von den Männern geschnitten. Auf den Pandanusblättern, aus welchen die Frauen einiger Stämme Hüte flechten, bringen die Männer mit Wasser und Russ zuvor Zeichnungen an u.s.w. Im allgemeinen arbeiten die Männer diejenigen Dinge, deren Herstellung Formensinn und Gewandtheit in der Handhabung von Messer, Hammer und Meissel erfordert, die Frauen dagegen zeichnen sich durch ein feines Gefühl für Farbenharmonie und durch Fertigkeit im Nähen, Weben und in der Töpferei aus. Da wir einen so durchgreifenden Unterschied in der Äusserung des Kunstsinns bei den Männern und Frauen konstatieren können, sind wir auch einigermassen berechtigt, auf eine Verschiedenheit in der Anlage dieses Kunstsinnes bei beiden Geschlechtern zu schliessen.
Das Kunstgefühl ist, eigentümlicherweise, unter den Gliedern dieser Stämme viel verbreiteter und entwickelter als bei denen zivilisierter Gemeinwesen. Weitaus die meisten Männer und Frauen sind im stande, ohne andere Anleitung als das Absehen von anderen, mit sehr primitiven Werkzeugen Verzierungen anzubringen, obwohl sich auch bei ihnen eine sehr grosse individuelle Verschiedenheit im Talent bemerkbar macht. Die Verhältnisse, unter denen die Individuen leben, entwickeln diese Anlage in sehr verschiedenem Masse. Sowohl Männer als Frauen können jedes in seinem Gebiet durch Anlage und Übung zwar einen hohen Grad von Kunstfertigkeit erreichen, doch bringen es nur wenige zu solcher Höhe. Wie schon früher gesagt, finden meist nur Glieder der Häuptlingsfamilien die nötige Musse, um sich eingehend dem Kunsthandwerk zu widmen.
Bemerkenswert ist, dass sich der dajakische Kunstsinn weitaus am häufigsten in der Pubertätszeit zu regen beginnt. Sobald bei beiden Geschlechtern die gegenseitige Neigung einen bestimmten Charakter angenommen hat, die Zeit des “Hofmachens” angebrochen ist, beginnen [236] sie ihre Kunstfertigkeit in der Herstellung schön verzierter Gegenstände für einander zu erproben. Diese besitzen meistens an und für sich keinen Wert, sondern erhalten diesen nur durch die auf sie gewendete Arbeit und künstlerische Ausführung.
In dieser Periode beginnt sich in den jungen Dajak auch der Wunsch zu regen, ihre eigene Person möglichst vorteilhaft erscheinen zu lassen, daher bemüht sich der Jüngling, seine Warfen zu verschönern und sich kunstvoll geschnitzte Armringe herzustellen, während das Mädchen sich mit Kopfbändern aus Perlen, gestickten Kleidern und Hüten schmückt.
Ferner beginnt der Jüngling, für seine Auserkorene Bambusbüchsen (te̥lu kalong), Kleiderhänger (lawe̱ kalong), Brettchen zum Aneinanderreihen von Baststreifen, Messerschäfte und Ruder (be̥se̱) zu schnitzen, während diese den Mann mit Stickereien, Perlenarbeiten und feinem Flechtwerk beschenkt. Es ist sehr begreiflich, dass diese Beweggründe auf die Entwicklung der jungen Künstler sehr anregend und fördernd wirken, besonders auf diejenigen, die aus irgend einem Grunde länger als gewöhnlich unverheiratet bleiben (Männer heiraten mit etwa 20, Frauen mit etwa 17 Jahren). Einige von ihnen finden auch noch nach ihrer Verheiratung Zeit, mit der Herstellung schöner Gegenstände fortzufahren, in der Regel nimmt aber die künstlerische Produktivität nach der Heirat ab oder sie hört sogar ganz auf. Infolge der besonderen Umstände, unter denen die Kunst der Dajak sich entwickelt hat, muss bei ihrer Beurteilung auf einige Eigentümlichkeiten derselben Rücksicht genommen werden. So geben z.B. die Produkte ihrer Kunstindustrie uns vielmehr ein Bild von der mittleren Leistungsfähigkeit des ganzen Volkes als von dem höchsten Können einzelner sehr begabter Personen. Ferner muss im Auge behalten werden, dass die meisten Gegenstände nur zum eigenen Gebrauch verziert werden und dass der Reiz des Geldverdienens, der in höheren Gemeinwesen oft einen sehr fördernden Einfluss ausübt, bei ihnen fehlt. Ohne Übertreibung kann man denn auch behaupten, dass die so geschmackvoll verzierten Ethnographica, welche von diesen Stämmen gesammelt wurden, zwar ein sprechendes Zeugnis für deren grosse Begabung, aber in keinem Falle für deren höchste Leistungsfähigkeit ablegen. Als Beweis hierfür mag dienen, dass ich während meines jahrelangen Aufenthaltes unter diesen Stämmen durch Ankauf sehr schöner Gegenstände und durch Aussetzung hoher Preise für besonders gelungene Kunstarbeiten [237] auch die Künstler weit entlegener Dörfer dazu anspornte, viel schönere Produkte zu liefern, als sie gewöhnlich unter der Bevölkerung gefunden werden.
Trotzdem der Kunstsinn unter diesen Stämmen so allgemein verbreitet und häufig so stark entwickelt ist, hat er doch nicht zu einer Ausübung der Kunst um ihrer selbst willen geführt; diese bleibt ausschliesslich Verzierungskunst. Sie trägt denn auch ganz den Charakter einer solchen und es hat sich auf Borneo weder eine eigentliche Malerei noch eine Bildhauerkunst ausgebildet.
Der diesen Stämmen eigene Kunstsinn darf nicht als ein unmittelbarer Ausfluss ihrer religiösen Überzeugungen oder ihres Kultus aufgefasst werden. In den meisten Fällen steht er hiermit in keinem Zusammenhang; aber da bei einem Volke von niedrigem Bildungsstandpunkt das ganze Gemeinwesen von religiösen Vorstellungen beherrscht wird, üben diese auch auf das Gebiet der Kunst ihren Einfluss aus. Die Kultusgegenstände der Dajak sind durchaus nicht immer schön verziert und auf ihre Herstellung wird nicht einmal besondere Sorgfalt verwendet. Wenn die dājung sich dennoch bisweilen schön gearbeiteter Gegenstände bedienen, so hängt das nicht mit der Verehrung der betreffenden Geister zusammen. Hiervon legen die in Teil I auf Taf. 15–21 abgebildeten religiösen Gegenstände ein beredtes Zeugnis ab. Dagegen spürt man in den Motiven, die diesen Volksstämmen zur Komposition ihrer Verzierungen dienen, allerdings einen überwiegenden Einfluss ihrer religiösen Vorstellungen.
Die Zahl der allgemein angewandten Motive ist relativ gering; sie werden den verschiedenen Gegenständen ihrer Umgebung entlehnt, besonders denjenigen, die den stärksten Eindruck auf ihr Gemüt ausüben, daher die Häufigkeit von Motiven, die in ihrem Religionsleben auch eine grosse Rolle spielen. Von den tierischen Lebewesen wird am meisten der Mensch, als Ganzes oder in einzelnen Teilen, wie der Kopf mit den Gliedmassen oder auch diese allein, benützt, ferner alle in der dajakischen Geisterwelt vorkommenden Tiere, vor allem der Hund (aso̱), der nach meinem Dafürhalten mehr an Stelle des für sie mythischen Tigers (rimau oder le̥djọ) tritt, den sie als mächtigen Geist nur ungern nennen. Ferner die Weltschlange oder Naga, der Rhinozerosvogel (tinggang), daneben Waldtiere wie der Blutegel (utak), die Schlange (njipa), die Eule (manok wăk) und der Argusfasan (manok kwẹ). Andere Waldtiere und auch die Haustiere, wie Schweine, Katzen [238] und Hühner, Werden nicht als Verzierungsmotive gebraucht; sie korn: men nur in seltenen Fällen, bei der Darstellung von Szenen aus dem täglichen Leben vor (Taf. 65 Fig. a). Von den Himmelskörpern sah ich den Mond (bulan) und von den Gebrauchsgegenständen das Boot (haro̱k) und den Haken (krawit) in der Ornamentik benützen (Vergl. Tätowierungen von Taf. 35 Teil I).
Motive aus dem Pflanzenreich wenden diese Stämme beträchtlich seltener an, wenigstens benennen sie ihre Motive nicht nach Pflanzenteilen, obgleich ihr Gefühl für schön gebogene Linien zweifellos unbewusst durch die Vielen Schlingpflanzen ihrer Umgebung beeinflusst werden wird.
Betrachten wir im folgenden an den abgebildeten Beispielen die Art und Weise, in welcher die Bahau die genannten Motive in ihrer Ornamentik zu verwerten pflegen.
Als Beispiele für die Anwendung ganzer Menschenfiguren als Verzierungsmotiv können die auf Taf. 70 in Farben abgebildeten Stücke von Perlenmustern (tăp inu) dienen, die am Mahakam zur Verschönerung der Rückseite von Kindertragbrettern (hăwăt) gebraucht werden. In den 3 gelben Figuren des obersten Musters a erkennen wir 3 in gleicher Form und gleichen Farben ausgeführte Menschengestalten. Die Frau, die dieses Muster arbeitete, hat sich nicht nur bemüht, Menschenfiguren im allgemeinen darzustellen, sondern diesen auch die Eigentümlichkeiten der Bahau, die stark ausgereckten Ohrläppchen mit den darin hängenden grossen Ringen gegeben. Die gelben Ohrläppchen reichen bis auf die Schulter und die Ringe, deren eine Hälfte in Schwarz ausgeführt vor der Schulter liegt, während die andere in Grün hinten hervortritt, sind so gross, dass die Arme durch sie hindurchgesteckt sind. Die Phantasie der Künstlerin ist in diesem Fall nicht so übertrieben, als man meinen könnte, denn einige Bahau, die Long-Glat z.B., sind tatsächlich im stande, ihre Arme durch die Ohrringe zu stecken (“In Centraal Borneo” Tafel 93).
Sämtliche Körperteile sind an den Figuren genau wiedergegeben: der Kopf mit Augen, Nase und Mund, der Rumpf mit den Brustwarzen und dem Nabel, die Arme mit den Händen und den fünf aufwärts gerichteten Fingern und die Beine, die auf den Knien die Ellbogen stützen, mit den Füssen und den abwärts gewandten Zehen, Ferner sehen wir an den Figuren einen schwarzen Gürtel, vielleicht ein Lendentuch, und sehr stark ausgeprägte Genitalien, an denen die [239] Testes zu beiden Seiten, das membrum virile nach oben gerichtet ist. Bedenkt man, dass sich an die Verzierung der hăwăt ursprünglich gewiss auch der Wunsch knüpfte, die bösen Geister vom Kinde fernzuhalten, dann erscheint eine solche starke Hervorhebung der Genitalien, die ja die bösen Geister vertreiben sollen, nicht unerklärlich. Übrigens werden bei den Mahakamstämmen noch gegenwärtig Muscheln an die hăwăt gehängt (Taf. 69 Fig. 6) und am Mendalam wird die Aussenseite mit ganzen Bündeln von Gegenständen, welche die Geister abschrecken oder befriedigen sollen, behängt (Teil I Taf. 14 u. Beschreibung).
Ungefähr die gleichen Menschenfiguren finden wir auf derselben Tafel zu beiden Seiten der zweiten tăp inu b wieder, die in ihrer Farbenharmonie zwar mangelhaft wiedergegeben ist, die Einzelheiten der Darstellung aber deutlich hervortreten lässt. Die Figuren sind in derselben Haltung wie oben, jedoch in schwarz, ausgeführt.
Hier treten die ausgereckten Ohrlappen mit den grossen roten Ohr, ringen noch mehr hervor. Das Scrotum ist rot, das membrum virile grün angegeben. Der Gürtel ist hier rot; ausserdem tragen diese Figuren noch weisse, blaue und rote Arm- und Beinringe.
Ein gutes Beispiel für die Anwendung stark umgebildeter Menschenfiguren für Verzierungen liefern die beiden tăp inu a und b auf Tafel 71. Hier finden wir in der unteren Hälfte drei solcher sehr stark stilisierter Figuren als Motiv dieses Musterteils angewandt.
Bei a ist jede Büste in gelb dargestellt; sie besteht aus einem fünfseitigen Kopf, in dem die auch bei der stärksten Stilisierung nur selten fehlenden Augen in rot und schwarz, die Nase in grün und der Mund in rot und grün mit schwarz angedeutet sind. Dieser Kopf geht in den oberen Teil des Rumpfes über, an welchem die beiden roten und schwarzen Punkte die Brustwarzen bedeuten. Zu beiden Seiten hiervon laufen nach oben zwei lange Linien in nach aussen gekrümmte Haken aus, dies sind die Arme. Verfolgt man den Rumpfteil der Mittelfigur nach unten zu, so erkennt man auch stark stilisierte Beine mit kurzen auswärts gerichteten Schenkeln und nach oben und seitwärts gewandten Unterbeinen. Das schwarze Viereck zwischen den Schenkeln bedeutet wahrscheinlich die häufig dargestellte Vulva. Dies erscheint doppelt wahrscheinlich bei der Betrachtung der mittelsten Menschenfigur von tăp inu b, die in der Form ungefähr mit a übereinstimmt, in ihren Originalfarben jedoch schlecht wiedergegeben ist. Bei dieser sind die Beine abwärts gewandt und die Schienbeine nicht nach [240] oben umgeschlagen. An den Seitenfiguren ist ein Schienbein nach unten gerichtet, während das zweite fehlt.

Verzierte Gegenstände der Bahau und Kĕnja.
Man merkt bereits an diesen Figuren, wie weit die Bahau in der Umbildung ihrer Motive gehen, um in ihrem Auge geschmackvolle Verzierungen hervorzubringen. Sehr häufig könnte man das ursprüngliche Motiv nicht wiedererkennen, wenn nicht oft trotz der starken Stilisierung einige Erkennungszeichen bestehen blieben. Diese sind für den Kopf oder lieber für die Maske, die sehr häufig auch selbständig angewandt wird, sowohl beim Menschen als beim Tier die Augen oder das Auge, oder die Zähne des Mundes bzw. der Schnauze. Das Unterscheidungsmerkmal für die gleichfalls häufig angewandten Gliedmassen wird sogleich erwähnt werden, doch mag vorher darauf hingewiesen werden, dass man derartige, auf die einfachsten Formen zurückgebrachte Masken in den Schenkeltätowierungen der Tafeln 83 und 84 Teil I wiederfindet. Hier sehen wir bei 83 Figuren aus zahlreichen Linien auf verschiedene Weise um zwei runde Punkte gruppiert, um welche eine Doppelspirale Augenhöhlen, Nase und Mund repräsentieren. Wie verschiedenartig diese Motive gestaltet sind, zeigt eine Vergleichung der Figuren in der Schenkeltätowierung mit denen an der Knietätowierung. Dass diese zwei Punkte mit der Doppelspirale mit Recht als Menschenmaske aufgefasst werden, beweist der Name, den die Mendalamer ihm geben; sie nennen sie kọho̱ng (Kopf) ke̥lunan (Mensch). Dies ist das beinahe ausschliesslich vorkommende Tätowierungsmotiv, das die Mendalamfrauen für ihre Schenkeltätowierung anwenden. In noch komplizierterer Form kommt dieses Motiv auf Tafel 84 vor, wo inmitten einer noch grösseren Anzahl Linien die zwei Augen mit der Doppelspirale zu erkennen sind. Diese Schenkeltätowierung ist nach einer nach dem Original gezeichneten Skizze mit den Tätowierpatronen von Taf. 82 Fig. n zusammengestellt worden. Es scheint, dass der Schnitzkünstler in dieser Maske mit den unter den Augenspiralen angebrachten Schnörkeln Nase und Mund habe andeuten wollen.
Ein gutes Beispiel für eine mehr plastische Darstellung einer Maske als Verzierung liefert uns Fig. f auf Taf. 60. Die Maske bildet hier den Deckel eines Bambusköchers. Als wichtigste Gesichtsteile sind hier leicht erkennbar die beiden weissen, glotzenden Augen in der Mitte, darunter die breite vorragende Nase, die sich über die breiten Lippen des grossen Mundes biegt. Erkennbar sind ferner zwei Arme, [241] welche in der für Gliedmassen beinahe stets charakteristischen Form angebracht worden sind, nämlich um das Haupt hinaufgeschlagen und dieses mit den Händen umfassend. So unterscheiden wir die Oberarme bei 1, die bei 2 ansetzenden Unterarme und an diese gefügt die Hände mit den 3 stark stilisierten Fingern bei 3. Finger werden im allgemeinen bei der Stilisierung am meisten umgebildet und kommen dann in verschiedener Anzahl vor. Von den dreien, die hier erkennbar sind, sehen wir einen an die Aussenseite des Auges gelegt, den mittelsten wie eine Spitze in der Verlängerung des Unterarms auf die Stirn gestützt und den dritten stark verbreitert und abgerundet an der Seitenwand. Beachtenswert ist, dass sowohl am Ellbogen bei 2 als am Puls bei 3 ein linienförmiger Halbring um den Arm angebracht ist; diese Verdickung, besonders die am Ellbogen, wird bei der Verwendung des Arms oder Beins als Verzierungsmotiv beinahe nie fortgelassen und kann daher als Erkennungszeichen dienen. Dies gilt sowohl für menschliche als für tierische Gliedmassen. Diese feinen Verdickungen kommen z.B. vor an den Vorderpfoten (bei 3) des Monstrums auf Deckel g Taf. 60 und an den Pfoten der Tierfiguren a, b, c und f auf Taf. 33.
Dass derartige Erkennungszeichen in der Tat notwendig sind, um die ursprüngliche Bedeutung der einzelnen Teile einer Verzierung unterscheiden zu können, kann aus den Deckeln g und i auf Tafel 60 ersehen werden, wo bei 4 eigentümliche Verzierungsmotive als Wülste gebraucht sind, die man beim Fehlen der Hände nur schwerlich als Gliedmassen hätte erkennen können. Dieses Zeichen ermöglicht es uns, auch die Bedeutung bestimmter Teile im Schnitzwerk der Griffe a, c, d und e auf Tafel 63 festzustellen. Auf den eigentümlichen langen Teilen, die bei c unter 5 angedeutet sind, treten diese Verdickungen ebenfalls mehr oder minder deutlich hervor, wodurch also ein Arm, ein Bein oder eine Pfote als Ausgangsmotiv dieser Partie des Schnitzwerks angenommen werden muss, auch dort, wo diese Verdickungen gänzlich fehlen sollten.
In der Verzierungskunst dieser Bahau begegnet uns noch eine andere Maske, die von der des Menschen abgeleitet ist, nämlich die Menschenmaske mit grossen Hauzähnen im Ober- und Unterkiefer, welche nach der Vorstellung dieser Stämme dem Antlitz der bösen Geister entspricht. Die zwei Holzmasken in Teil I Tafel 57 sind ein gutes Beispiel für diese Motive, die man mehr oder weniger stilisiert [242] auf sehr verschiedenartigen Gegenständen der Bahau und Kĕnja findet. Angewendet sehen wir diese Verzierung z.B. an der auf Taf. 61 Fig. b abgebildeten Arbeitsbank, die zwei solcher Masken trägt, um die sich zu beiden Seiten die Arme hinaufschlingen. Die verschiedenen Gesichtsteile, wie Augen, Nase und Mund sind trotz starker Stilisierung sehr gut zu erkennen. Zu der ganzen geschmackvollen Komposition tragen in nicht geringem Masse die langen, gebogenen, spitzen Hauzähne bei, die von den Kiefern aus der Mundhöhle zum Vorschein kommen und auf der gegenüberliegenden Lippe stark hervortreten.
Andere Beispiele für die Verwendung der Masken böser Geister als Verzierung finden wir in den sehr bekannten, ursprünglich von diesen Stämmen herrührenden, bunt bemalten Schilden, an deren Vorderfläche eine Art von Gorgonenhaupt dem Feinde Schrecken einflössen soll. Eine derartige Wirkung auf den ängstlichen Bahau, der sich stets von bösen Geistern umringt und verfolgt glaubt, ist sehr wohl denkbar.

Verziertes Hausgeräte der Bahau.
Um nicht zu stark abzuschweifen, soll das menschliche Genitalmotiv, das in der Bahaukunst zu einer ganz eigentümlichen Art von Verzierung Anlass gegeben hat, später behandelt und hier zur Besprechung des als Ornament ebenfalls häufig verwendeten Tierkörpers übergegangen werden.
Bahau und Kĕnja gebrauchen auch die Tierformen sowohl als Ganzes als in ihren Teilen als Verzierungsmotiv, doch pflegen sie Tiere ebensowenig wie Menschen so naturgetreu als möglich abzubilden; selbst wenn sie Tiere in Holz nachbilden, um sie als Schreckmittel bei den Gräbern ihrer Verstorbenen aufzustellen, verfertigen sie nur Ungeheuer.
Das am häufigsten im Ornament verwandte Tier ist, wie gesagt, der aso̱ oder Hund, weniger beliebt ist der rimau oder le̥djọ, der mythische Tiger. Wie oben bereits bemerkt, ist letzteres Tier das ursprüngliche Motiv, aber weil man so gefürchtete Tiere wie einen Tiger nicht gern nennt, gibt man ihm lieber den Namen des Hundes.
Als Typus des aso̱, wie man ihn plastisch abbildet, kann die Figur gelten, die auf dem Deckel von Tafel 60 Fig. g zu sehen ist. Hier sind alle Körperteile in Relief geschnitzt und daher deutlich erkennbar. Der auf der Abbildung nach unten gekehrte Kopf lässt bei 2 den eigentlichen Schädel mit den beiden grossen, runden Augen zu beiden Seiten und darunter die Schnauze mit zwei in Spirale stilisierten [243] Nasenöffnungen unterscheiden. An den Kopf schliesst sich, hier nach oben gerichtet, bei 8 der Rücken an, der nach hinten zu (hier nach oben) zu beiden Seiten die Hinterbeine I trägt. An diesen sind die nach aussen gerichteten Schenkel und die zum Deckel gewandten Unterbeine zu erkennen, die in die Füsse übergehen. Letztere bilden mit den stark stilisierten Zehen 5 den Übergang zu den anderen Figuren der Verzierung, wie zu dem unabhängig angebrachten Arm 4. Beim Knie 2 ist wieder der für die Gliedmassen charakteristische Ring zu sehen. Hinter dem Kopf biegen sich die vorderen Gliedmassen vom Körper ab. An diesen sind alle zugehörigen Teile gut zu erkennen. Zuerst der Oberarm 3, der mit dem rechts und links hervortretenden Ellbogenring in den ungefähr rechtwinklig darüber gebogenen Unterarm übergeht, der wiederum die Hand 6 mit den zu Spiralen und Linien stilisierten Fingern trägt. Nur selten findet man wie hier den Übergang vom Unterarm zur Hand durch zwei gleichweite Ringe bezeichnet.
Ein zweites Beispiel für solch einen aso̱, aber ihrem Zweck entsprechend etwas mehr umgebildet, liefern die Sessel d und e auf Tafel 61. Bei d sind die einzelnen Teile gut unterscheidbar, doch sind hier nur das linke Hinterbein und das rechte Vorderbein des Tieres dargestellt. Am Kopf ist wiederum zuerst das runde Auge 1 sichtbar, vom dem sich nach oben der grosse Oberkiefer 2 und nach unten der kleinere Unterkiefer 3 abbiegt. Diese Kiefer lassen uns besser als die übrigen Körperteile die Einzelheiten sehen, an denen sie auch in ihrer stärksten Umbildung zu erkennen sind. Zunächst die Zahnreihen 2 und 3, die hier sorgfältig ausgearbeitet sind und nur selten fehlen. An dem Unterkiefer ist nur noch ein nach vorn gerichteter Haken zu sehen, den der Künstler als Endverzierung hinzugefügt hat. Der Oberkiefer dagegen besitzt ausser der Zahnreihe 2 noch das Nasenloch 6, das hier die eigentümliche Form einer Spirale zeigt, die diesem Körperteil häufig gegeben wird. Auch ineinandergreifende Doppelspiralen werden oft zur Wiedergabe von Nasenlöchern angewandt. An diesen ist bei starker Stilisierung und beim Fehlen der Zähne häufig die Absicht des Künstlers, einen Kiefer darzustellen, erkennbar. Zwischen den beiden Kiefern tritt hier die kleine Zunge 4 hervor, ein Teil, der in der Profilansicht einer Maske ebenfalls nur selten fehlt. Darüber biegt sich dem Auge zu der grosse Hauzahn 5, der hier merkwürdigerweise in die Mundecke gesetzt ist, mehr dem Schönheitsgefühl der Bahau, als seiner natürlichen Stellung entsprechend. [244] Der Kopf geht hier in den nach hinten gebogenen Hals über, der sich in dem ebenso gebogenen Körper 12 fortsetzt. Dieser endet in den beinahe wieder dem Kopf anliegenden dicken Schwanz 11. Unter dem Schwanz wendet sich das linke Hinterbein 9 vorn Rumpf ab; wir erkennen wieder ein Oberbein 9 und ein Schienbein 10 und ferner einen eigentümlich geformten Fuss, dessen eine Zehe als lang gewundener Teil über den Rücken gelegt ist. Vorn am Rumpf, unter dem Halse, ist auf ähnliche Weise der rechte Arm 7 geschnitzt, der aus Ober- und Unterarm und Hand 8 besteht, die den Hals hinter dem Unterkiefer umklammert und von der ein langer Finger auf dem Halse zu sehen ist. Hinter dem Köpfe erhebt sich ein gebogenes Horn, das häufig als Zierrat angebracht wird.
Der Sessel e stellt ein ähnliches vierfüssiges Tier dar, aber in anderer Stellung, so dass nur der Rumpf und der zur Seite gewandte Kopf in ihren Teilen gut hervortreten.
Nach den gegebenen Beschreibungen fällt es nicht schwer, auch die ganze dekorative Figur f auf Tafel 33 zu begreifen. Diese stellt die Stilisierung eines vierfüssigen Tieres im Profil dar, die inmitten von zahlreichen Schnörkeln zur Verzierung eines Getäfels dient. Das Tier ist nach links gewandt, wo wir denn auch das grosse runde Auge finden, das hier wie in zwei grosse, einander zugekehrte Haken gefasst erscheint. Auf gleiche Weise wie vorhin biegen sich hier die beiden mit Zahnreihen bewaffneten Kiefer weit klaffend nach oben und unten; zwischen ihnen befindet sich eine kleine, beinahe horizontale Zunge und über dieser ein hier stark nach rückwärts gebogener Hauzahn. Hinter dem Auge sehen wir auch hier ein grosses gewundenes Horn, das auf der Schulter des Tieres liegt. Unter diesem Horn erkennen wir den langen Hals, auf dem der Kopf sitzt. Der aufwärts gekrümmte Körper trägt ein Vorder-, ein Hinterbein und einen Schwanz, welch letzterer vorn unter dem Hinterbein hindurchläuft und in einer zierlichen Spirale auf dem Rumpf endet. Diesen hat der Künstler nicht glatt gelassen, sondern an der Schulter und im Beckengürtel reich mit gebogenen Linien verschönert. Betreffs der Vorder- und Hinterbeine ist nicht viel mehr zu bemerken als die besonders deutliche und schöne Weise, inder hier der nach vorn gekehrte Vorderfuss stilisiert ist. Die Spiralen am Fuss des Hinterbeins dienen ausschliesslich zur Verzierung des Hintergrundes.
Auf derselben Tafel gibt c eine ähnliche Verzierung mit einem [245] stilisierten aso̱ wieder, aber hier hat man den Kopf des Tieres auf die gleiche Weise nach rückwärts gedreht, wie die Bahau es in ihren Wäldern das Tarsius spectrum tun sehen. Die grosse, hier mehr geschlossene Schnauze ist denn auch nach hinten und oben gewandt.
Schwieriger sind die beiden Verzierungen a und b auf dieser Tafel zu zerlegen, weil sie zwar mit Hilfe von im Profil genommenen Tiefen, wie sie bei c und f beschrieben wurden, zusammengestellt sind, aber in jedem Ornament mehr als ein Tier vorkommt. In diesem Fall zeigt es sich, wie wichtig es ist, für bestimmte Körperteile charakteristische Eigentümlichkeiten zu kennen, weil die ursprünglichen Formen im Gebrauch als Verzierungsmotiv ganz verloren gehen. Sie geben uns jedoch gute Beispiele von der reichen Phantasie dieser borneoschen Künstler.
Bei a bemerkt man zuerst einen nach rechts gekehrten grossen aso̱, dessen verschiedene “Feile leicht zu erkennen sind. Hinter dessen Kopf ist jedoch noch ein zweiter angebracht, der einem aso̱ mit nach oben gerichteten Beinen gehört. Als Erkennungszeichen für diesen zweiten aso̱ findet man mitten in der Oberseite zwei Reihen Zähne und einen grossen Hauzahn, der nach unten weist. Sowohl diese Richtung als die nach oben geöffnete Schnauze deuten bereits auf einen aufwärts gewandten Kopf. Der grosse Hauzahn weist auf das grosse glotzende Auge, das unten von einem dicken Ring umgeben ist. Rechts von diesem Augenring läuft ein grosses Horn nach rechts hinunter, wo es als Hauzahn der Hauptfigur endet. Dies ist eine bei den Bahau sehr gebräuchliche Weise, um zwischen den verschiedenen Unterteilen einer Verzierung eine Verbindung herzustellen. Diese kommt übrigens auch noch auf andere Art zustande, denn suchen wir nach dem Körper, der zur zweiten Maske gehört, so sehen wir, dass der Hals hinter der Basis des erwähnten grossen Horns verborgen liegt, ferner, dass der Körper hauptsächlich an seiner Brust- und Bauchseite zu erkennen ist, die in den deutlichen Hinterkörper mit Hinterbein und Schwanz auslaufen. Letztere bilden den wichtigsten Teil auf der rechten Seite der Verzierung. Der Rückenteil des zweiten aso̱ bildet nun einen Unterteil des grossen Kopfes des ersten. Dies sind, ausser den hinzukommenden Spiralen, die Hauptbestandteile der Verzierung a.
Auf dieselbe Weise mit der Zerlegung von b zu Werke gehend, finden wir zuerst 3 Doppelreihen von Zähnen: eine nach oben geöffnete links oben, eine grosse mit Zunge und Hauzahn rechts unten [246] und eine kleinere noch weiter rechts, nach oben geöffnet, so dass mindestens 3 Masken in diesem komplizierten Relief vorkommen müssen. Die zu diesen Gesichtern gehörenden Augen sind, was den Kopf links betrifft, etwas unterhalb der beiden Zahnreihen zu sehen; das Auge des grossen Kopfes rechts liegt in der Verlängerung des Hauzahns, während das des kleineren Kopfes noch weiter rechts etwas undeutlich Unter dem Oberkiefer zu sehen ist.
Hübsch sind die spiralförmigen Nasenlöcher in den verschiedenen Oberkiefern angebracht. Suchen wir nach den zu diesen Tiermasken gehörigen Körpern, so zeigt es sich, dass die der beiden am weitesten links liegenden Köpfe einander derart umfasst halten, dass die Hinterpfoten des einen Tieres den Hals des anderen umklammern, während die Vorderpfoten um die Hinterschenkel geschlagen sind. Der as o der linken Maske liegt somit auf dein Rücken, der der grossen Maske steht. Die Haltung des dritten Tieres ist sehr gewunden, da zu der nach oben geöffneten Schnauze der kleinen rechten Maske der aufwärts gestreckte Körper gehört, so dass der Schwanz im Relief als die am meisten rechts liegende obere Spirale erscheint und die rechte Hinterpfote horizontal nach links läuft. Als Vorderpfoten muss man die beiden krummen, um den Augenteil der Maske nach unten sich hinziehenden länglichen Erhebungen betrachten; die linke derselben trägt deutlich den typischen Extremitätenring. Dass es den dajakischen Bildhauern nicht an Vorstellungsvermögen fehlt, beweist die Kompliziertheit dieser Verzierung zur Genüge.
Wie sehr man ihrer eigentümlichen Auffassung von der Kunst Rechnung tragen muss, geht daraus hervor, dass auch die Figur f auf Tafel 82 Teil I unter die aso̱ gereiht wird, mit der Begründung, das hier wiedergegebene Wesen mit seiner schlangenförmigen Gestalt und seinem grossen Kopf mit aufgesperrten Kiefern (bei 2) besitze noch Pfoten. Diese stark umgebildeten Gliedmassen sind noch unter den beiden Bögen, die der Körper nach oben zu bildet, zu sehen, wo sie rechts und links an der Unterseite jedes Bogens entspringen und zur Mitte zu sich mit den dünnen linienförmigen Zehen einander nähern. Sind diese Gliedmassen nicht mehr vorhanden, so bezeichnet man ein derartiges schlangenförmiges Wesen als naga oder Schlange.
Diese aso̱-Figur ist mit nur wenigen Linien auf der Holzpatrone Fig. e von Tafel 69 angegeben.
Das Muster besteht hier aus vier aso̱, deren Körper in einander übergehen, [247] und einer kleinen, aus Spiralen zusammengestellten Figur in der Mitte. An dem aso̱ links unten ist bei 1 das Auge zu sehen, bei 5 der Körper, der in denjenigen einer gleichen Figur rechts unten übergeht, und bei 6 ein Beinpaar. Die vielen Spiralen auf den beiden Köpfen über dem Auge tragen zur Verschönerung des Ganzen bei, während jede Maske durch eine lange Spirale mit der anderen verbunden ist, in gleicher Weise wie die Körper, wodurch ein doppelter Zusammenhang zwischen den beiden aso̱ zustande kommt.
Neben dem ganzen Körper wird auch die Maske des aso̱ allein häufig angewandt. Die Unterscheidung einer solchen Maske von der anderer vierfüssiger Tiere ist jedoch sehr schwierig, weil die Charakteristika der Kopfform durch Stilisierung völlig verloren gehen und nur das Vorkommen von Augen, Zahnreihen oder Nasenlöchern dazu berechtigen, eine Verzierungsfigur auf Tiermasken zurückzuführen. Ein gutes Beispiel für eine solche Verzierung mittelst einer Tiermaske liefert der Griff an der Flechtnadel k auf Tafel 60. Hier besteht der Griff gänzlich aus dieser Maske, von der man bei I das Auge, bei 2 und 3 den mit Zähnen versehenen Unter- und Oberkiefer und bei 4 das in Form einer Spirale wiedergegebene Nasenloch erkennt.
Derartige Tiermasken sind ferner noch zu unterscheiden an beiden Enden des Messerhängers j auf Tafel 61. Die obere gibt vorerst die beiden Zahnreihen in den Kiefern gut wieder, auch ist ein Hauzahn vorhanden; das grosse Auge liegt unter der Schnauze, und auf dem stark verzierten Oberkiefer, der den obersten Teil bildet, hat der Künstler das Nasenloch durch eine schöne, reich gewundene Spirale wiedergegeben. An diese Maske schliesst sich unterhalb des Unterkiefers noch eine Extremität an, deren Finger wieder zur Verzierung der Oberfläche gedient haben.
Die Maske am Unterende besteht nur aus einem Auge mit Umgebung und dem Oberkiefer. Das Auge ist hier durch eine weisse Muschel angedeutet und der hübsche Oberkiefer ist an einer Zahnreihe erkennbar.
Eine eigentümliche Anwendung der Maske als Verzierungsmotiv zeigt uns der Deckel i auf Tafel 60. Dieses symmetrisch auf den zwei Hälften angebrachte Ornament besteht aus 3 Tiermasken neben einander; der Rest des halben Kreisrandes wird von einem Bein (4) eingenommen. Von den 3 Masken ist die eine, mit I bezeichnet, zum Rande hin am Auge, den Zähnen und einem Nasenflügel leicht zu unterscheiden. [248] Dann folgt Maske 2, die radial gestellt ist und ein ganz anderes Aussehen trägt, da man sie nicht von der Seite, sondern von oben sieht. Am charakteristischsten sind die beiden Augen, über denen der Schädel und unter denen die Schnauze sehr naturgetreu ausgearbeitet sind. Ob die langen Streifen zu beiden Seiten dieser Maske Gliedmassen vorstellen, ist auf dieser Abbildung schwer zu konstatieren.
Die dritte, nur an einer Seite vollständige Maske ist eine sehr phantastische Verzierung, deren deutlich hervorglotzendes Auge am besten erkennbar ist. Unter diesem Auge laufen in der Maske 3 rechts unten zwei parallele bogenförmige Furchen über eine runde Stirn, und eine ähnliche Rundung rechts vom Auge gibt eine Art Nase auf einem runden Oberkiefer an. Dieser ist durch eine tiefe, radial verlaufende Kluft von dem Unterkiefer getrennt, der durch eine oberflächliche Grube wieder in zwei Teile geschieden ist.
Eine sehr eigenartige Variation des Maskenmotivs sehen wir in Fig. a auf Tafel 65, wo in der rechten Figurenhälfte 6 äusserst phantastische Masken das Ornament zusammensetzen. An allen lassen sich ein oder zwei Augen gut unterscheiden, die übrigen Teile sind stark umgebildet, und nur, was Zähne, Zunge und Kiefern betrifft, mehr oder weniger deutlich ausgearbeitet.
Ein anderes Beispiel für diese Art von Verzierung finden wir in der Mittelfigur von b auf Tafel 70, die ein kọho̱ng le̥djọ, einen Tigerkopf darstellt. Die in schwarz ausgeführte Figur zeigt zuerst sehr deutlich zwei blaue, rot umränderte Augen mit schwarzen Pupillen; die beiden weissen spiralförmigen Linien umschliessen die Nase mit den Nasenlöchern, während in dem gelben Teile darunter mit roten Linien die Schnauze wiedergeben ist. Unten wird die Maske durch schwarze, in einem Punkt einander schneidende Linien abgeschlossen. Die 4 Paar schwarzen, von der eigentlichen Maske ausgehenden Spiralen dienen zur Verzierung.
Unter den der Vogelwelt entlehnten Motiven nehmen diejenigen, welche sich auf den Rhinozerosvogel oder tinggang beziehen, die Hauptstelle ein, sowohl wegen der Häufigkeit ihrer Anwendung als wegen ihrer sehr charakteristischen Formen. Diese bestehen in dem sehr grossen Schnabel, auf dem sich das häufig nach rückwärts gekrümmte Horn erhebt, und dem Schwanz aus rein weissen Federn, über welche ein breites schwarzes Band läuft.
Wir finden diesen Vogel zuerst in ganzer Gestalt, oft nur schwach [249] stilisiert, wie in Fig. b auf Tafel 65, angewandt. Im Felde oben, rechts von der Mitte füllt ein solcher tinggang mit einem sehr grossen Kopf neben zwei Kugeln ein Fach und hebt sich mit seinen charakteristischen Teilen gut von dem schwarzen Hintergrund ab.
Auch in den Stickereien, von denen einige Streifen auf Tafel 46 abgebildet sind, kommt dieser Vogel vor, z.B. in Streif b und c bei 2 und 3. Hier sind deutlich Vögel mit weissen, schwarz gestreiften Schwänzen gestickt, was deren Identität genügend beweist, wenn auch die Hörner auf den Schnäbeln nicht sehr deutlich sichtbar sind.
Nach dem häufigen Vorkommen zu schliessen, wendet man jedoch auch den Buceroskopf allein sehr gern an. Am besten ist dieser auf dem Rockrand von Fig. c auf Tafel 43 zu sehen, der auch zur Verzierung des Einbandes dieses Werks gedient hat. Im unteren Rand bilden 4 tinggang-Köpfe den Hauptbestandteil der Verzierung. Sie sind je zu zweien einander zugewandt und lassen deutlich den Schädel erkennen, der nach vorn in einen langen Schnabel ausläuft, dessen oberer und unterer Teil nicht aufeinander schliessen, sondern erst in der gebogenen Spitze wieder zusammentreffen. Das oben auf dem Schnabel angebrachte, rückwärts gekrümmte Horn ist stilisiert und geht hier mehr als beim lebenden Tier selbst unmittelbar in den Schädel über. Der Hals ist insoweit umgebildet, als er in zwei Teilen, mit einem weissen Raum in der Mitte wiedergegeben ist. Zwei dieser Köpfe kommen auch in jedem der Seitenränder vor, in jeder Ecke einer. An einem dieser Köpfe hat man das Auge auszuschneiden vergessen und zwar in beiden Rändern, was darauf hinweist, dass man die Ränder gleichzeitig aus aufeinanderliegenden Zeugstücken ausgeschnitten hat. Der untere Rockstreifen wurde in derselben Weise in der Mitte zusammengefaltet und dann ausgeschnitten, wodurch die beiden Hälften symmetrisch geworden sind.
In den Schenkeltätowierungen der Mahakamfrauen ist dieser tinggang das gangbare Motiv; in welcher Weise er hier angebracht wird, geht aus Fig. f auf Tafel 89 Teil I hervor, wo man an der Unterseite rechts und links von der Mitte die Vogelköpfe als Ausläufer der dicken, krummen Linien erkennt, die durch die ganze Figur ziehen und sich oben in der Mitte vereinigen. An jedem dieser Köpfe ist das Auge mit der Pupille zu sehen, während der grosse Schnabel nach oben und aussen gerichtet ist. Den Schnabel stellen hier zwei Linien dar, die zu einer gebogenen Spitze zusammenlaufen und in der [250] Mitte einen dreieckigen weissen Raum einschliessen, in den an der Kopfseite noch eine kleine Zunge hineinragt. Inbezug auf Form und Stellung des Horns hat man sich die Freiheit erlaubt, es oben auf dem Kopf entspringen zu lassen und es nach vorn gerichtet, während nach hinten noch ein kleineres Horn angebracht ist. Eine derartige Figur heisst usung (Nase) tinggang (Rhinozerosvogel).
Auch für die Komposition des Mittelstückes a von Tätowierung E auf Tafel 86 Teil I ist ein klinge̱ usung tinggang gebraucht worden; hier hat der Kopf im allgemeinen die gleiche Form, das Horn ist nach hinten gebogen und vor ihm sind noch drei kleine Vorsprünge angebracht.
Da jede Tätowierfigur sich von der anderen in Einzelheiten unterscheidet, ist die Abwechslung im Motiv des usung tinggang sehr gross; in dem hier behandelten klinge̱ wechselt der tinggang jedoch mit dem aso̱ ab, der ebenfalls die eigentümlichsten Formen annehmen kann, jedoch stets durch die in der Schnauze sichtbaren Zähne zu unterscheiden ist. Dies ist z.B. sehr deutlich der Fall bei Fig. d auf Tafel 88 und Fig. b auf Tafel 87 Teil I. Um auf dieser Tafel auch in a eine aso̱-Figur zu sehen, muss man der Bahauphantasie einen sehr weiten Spielraum lassen. Auch hier kommen aso̱ an der Unterseite, rechts und links von der Mitte vor, aber stark stilisiert. Am erkennbarsten sind die Kiefern 2 und 4 mit den Zähnen 5, während die Zunge 3 dazwischen liegt. Die Spiralen über dem Oberkiefer muss man .am Ende als ein stilisiertes Nasenloch auffassen, die an der Stelle des Kopfes vielleicht als das stilisierte Auge. Man hat es hier also der Zähne wegen in der Tat mit einem aso̱ und nicht mit einem tinggang zu tun.
Auch bei der Zusammenstellung der klinge̱ für die Handtätowierung gebraucht man gern den Kopf des Rhinozerosvogels und benennt diese denn auch nach ihm. Von solchen klinge̱ usung tinggang geben uns die untersten von b auf Tafel 92 Teil I und die untersten von b auf Tafel 93 Teil I eine gute Vorstellung. Bei b auf Tafel 92 kommt der tinggang-Kopf in der Mitte von jeder Hälfte vor und ist am Auge unterscheidbar, das als weisser runder Fleck mit schwarzem Punkt angegeben ist. Hieran schliesst sich nach unten und innen der lange Schnabel, auf dem sich oben ein einfaches Horn erhebt, das nur wenig gebogen ist und beinahe parallel der Oberseite des Schnabels nach unten läuft.
Stark umgebildet sind die usung tinggang auf Taf. 93 Teil I Fig. b. [251] In dem untersten klinge̱ dieser Figur ist zu beiden Seiten der Mitte als weisser Kreis in einem schwarzen Fleck das Auge eines Buceroskopfes erkennbar, der nach unten und aussen schmäler verläuft und dort in eine grosse schnabelförmige Figur endet. Diese besteht aus zwei dünnen, zur Schnabelspitze zusammenfliessenden Linien, zwischen denen ein länglicher weisser Raum, rechts mit einer kleinen Zunge zu unterscheiden ist. Auf diesem Schnabel, vor den Augen, laufen zwei gebogene Linien als Hörner nach oben und aussen.
Unter den Verzierungsmotiven, welche nicht ganzen Tiefen, sondern nur einzelnen Teilen derselben entlehnt werden, verdienen noch zwei genannt zu werden. Zuerst der ke̥rip (Feder) kwẹ (Argusfasan). Von den besonders schön gezeichneten Federn dieses Tiers fallen die Flugfedern, auf denen eine lange Reihe von Augen vorkommt, am meisten auf. Diese Augenreihe gebrauchen die Bahau als Motiv für die Seitenstücke der Schenkeltätowierungen. Sie bezeichnen sie auch in stilisierter Form mit kalong (Verzierung) ke̥rip kwẹ. Fünf dieser Stilisierungen sind auf Taf. 90 Teil I zu sehen, eine sechste ist b in der Schenkeltätowierung E auf Tafel 86 Teil I benützt worden.
Die Bahau bringen die Figuren, wie sie auf der Handtätowierung a von Taf. 92 Teil I vorkommen, mit dem gefleckten Fell des borneoschen Panthers in Verbindung. In der Tat kommen mitten in der sehr hübschen Kombination von feinen Linien viele grosse dunkle Flecken vor, die mit der kulit kule̱ (Pantherhaut) einige Ähnlichkeit zeigen. Meiner Meinung nach ist es jedoch nicht wahrscheinlich, dass dies Motiv dem Künstler vorgeschwebt habe; viel eher wird die entfernte Übereinstimmung zu diesem Namen geführt haben.
Eine besondere Bedeutung als Ornamentmotiv hat bei den Bahau und Kĕnja der männliche und weibliche Genitalapparat erhalten, was teilweise auf der in hohem Grade schutzbringenden Wirkung, die ihm zugeschrieben wird, beruht. Diese Überzeugung hat dazu geleitet, dass Abbildungen von Genitalien überall, wo böse Geister abgeschreckt werden sollen, angebracht werden. Am Mahakam sieht man sie denn auch vor allem auf den vom Fluss zum langen Hause führenden Holz-stegen, wo man sie roh mit dem Beil aus Brettern gehauen zugleich mit Masken von Ungeheuern und Menschenfiguren mit grossen Genitalien angebracht findet.
An den Häusern selbst sieht man diese rohen Nachahmungen nicht mehr; hier hat der den Dajak innewohnende Schönheitsdrang dazu [252] geführt, dass die ursprünglichen Formen in hübsch stilisierte Verzierungen verändert wurden.
Wenn die Bahau im Walde Hütten für einen längeren Aufenthalt bauen, z.B. um dort zu me̥lo̱ njaho̱, wobei sie von einem Besuch der bösen Geister besonders verschont bleiben müssen, so stellen sie auf den grösseren Pfählen in sehr roher Form häufig derartige Genital-bilder dar. Wir finden sie abgebildet auf den Balken b und c auf Tafel 62, die von solch einer Hütte zum Vorzeichensuchen herstammen. Bei b sind die männlichen Genitalien mit 1 und 2 angegeben, wobei die breite Erhebung 2 das Scrotum und die schmale 1 das männliche Glied vorstellt.
Um die hiervon abgeleiteten Figuren zu begreifen, muss man sich diese Teile im Durchschnitt vorstellen. Eine solche Figur heisst noch, ebenso wie die von ihr abgeleitete, ke̥lo̱t, männliches Organ. Sie kommt bei a vor, doch ist sie hier durch den allmählichen Übergang zwischen den beiden zusammengestellten Teilen bereits mehr umgestaltet. Das männliche Glied ist hier wieder mit 1, das Scrotum mit 2 bezeichnet; das Ganze ist zwischen zwei Spitzen gefasst, von denen die rechte kleiner als die linke ausgefallen ist. Dieses Holzstück ist aus der Stützwurzel eines Baumes gehackt, der auf der Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam stand. Zu dem gleichen Zweck, zu dem den Geistern des neu betretenen Gebiets zahlreiche Opfer gebracht und viele Mittel, wie allerhand Pflanzendorne und künstliche Haken angewandt werden, um den Geistern des verlassenen Gebiets das Überschreiten dieses Scheidepunktes zu verbieten, hatte man auch diese geisterverjagenden Figuren in die platten Stützwurzeln der Bäume gehackt.
Weibliche Genitalien werden ebenso einfach imitiert, wie an den auf Balken c bei 3 und 4 vorkommenden Figuren zu sehen ist. Es sind vier gleich breite Erhebungen, welche die inneren und äusseren Schamlippen nachahmen, an der Oberfläche des Holzes stehen gelassen sind und von der Seite auch am besten als Motiv für komplizierte Figuren erkannt werden können. Im allgemeinen werden diese Figuren variiert, indem man die zwei mittelsten oder die zwei äussersten oder beide Gruppen dieser Erhebungen zu mehr oder weniger zierlich gebogenen Linien verlängert oder die Erhebungen weiter auseinander rückt und durch flach gebogene Stücke trennt.
Wie bereits gemeldet ist, wendet man dieses Motiv, in Übereinstimmung [253] mit dem ursprünglichen geisterverscheuchenden Zweck der Genitalien am häufigsten dort an, wo man eine Annäherung der Krankheit und Unglück bringenden bösen Geister verhindern will, also auf den Wohnhäusern. In sprechender Weise ist dies auf Tafel 28 an dem Rahmen der Tür zu sehen, die in die Wohnung einer der vornehmsten Kajanpriesterinnen am Blu-u führte. Dieser Rahmen ist vollständig aus Schnitzereien, welche männliche und weibliche Genitalien zum Motiv haben, zusammengesetzt.
Mehr im Detail sind derartige geschnitzte Bretter in den Stücken d, e und f auf Tafel 62 dargestellt. Dies sind Schwellen von ähnlichen Türen aus dem Hause der Pnihing am Tjĕhan; die ausgeschnittenen Stellen, die zur Befestigung der Bretter an der Wand dienen, und die Löcher zur Aufnahme der Türzapfen sind an den rechten Enden von d und e zu sehen. An diesen schön geschnitzten Eisen-holzschwellen sind die Motive noch leicht erkennbar. Für alle drei sind hauptsächlich männliche Genitalien benützt worden; je ein derartiges Organ ist mit 1 und 2 bezeichnet worden. Dieselben Figuren wiederholen sich an den beiden Aussenenden, doch ist hier der spitze Teil weniger deutlich dargestellt.
Bei e sieht man zu beiden Seiten des Mittelstückes ein durch die typischen Teile 1 und 2 vorgestelltes ke̥lo̱t; wegen starker Stilisierung weniger gut erkennbar ist dasjenige an den Aussenenden, rechts und links von 2.
Dasselbe ist bei f der Fall, wo die beiden ke̥l-ot in der Mitte bei 1 und 2 zwar deutlich sind, die beiden kleineren an der Aussenseite dagegen kaum noch von diesem Motiv abgeleitet werden können. Das rechte ke̥l-ot besitzt als Überbleibsel von Teil I nur noch eine schwache Erhöhung am Grunde einer Vertiefung und links ist diese Erhöhung überhaupt nicht mehr zu sehen.
Wieweit die Umbildung dieses Motivs gehen kann, zeigt sich am besten an der auf Tafel 34 abgebildeten Galerieverzierung von Kwing Irangs Haus. Man findet hier an den Unterrippen der dreieckigen walang-bahi-u einige deutlich dargestellte ke̥lo̱t; diese sind auch an den hübsch geschnitzten Stützbalken des Daches zu erkennen, aber hier ist das kleine Glied häufig zu einer spitzen Figur verlängert worden, die in einer zierlichen Spirale zum dicken Teil gerichtet ist. Eine derartige Figur kommt z.B. oben, am dritten Balken von links, vor. Von dieser durch einige Spiralen geschieden, befindet sich weiter unten [254] am selben Balken ein ähnliches, gleichgerichtetes ke̥lo̱t, dessen dicker Teil jedoch ausgehöhlt und mit einer weiteren Verzierung von einigen Spiralen versehen ist. Ohne die verschiedenen Übergänge zu kennen, würde man das ursprüngliche Motiv nicht wiederfinden und sich das Vorhandensein dieser eigentümlichen Verzierungen in diesem Versammlungs- und Empfangsraum nicht richtig erklären können.
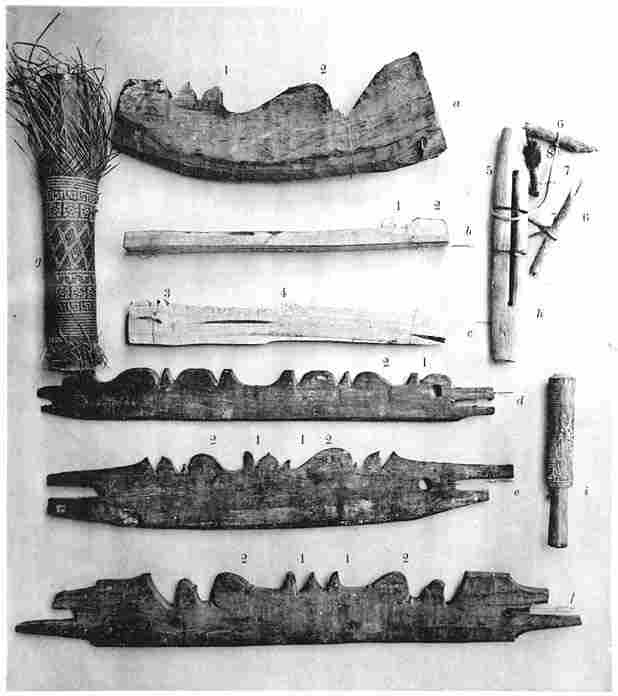
Verzierungen und Werkzeuge.
Typisch stilisierte weibliche Genitalien zur Ausschmückung von Unterteilen eines Hauses sind an der links aufgerichteten Wand des Türrahmens auf Tafel 28 zu sehen. Dieser Teil der Umrahmung ist symmetrisch hergestellt. Hier sind in der Mitte zwei männliche Organe mit einem dreieckigen Vorsprung dazwischen zu sehen, nach aussen folgen dann zwei flache Aushöhlungen mit einem runden dazwischengefügten Stück und dann wieder ein männliches Glied am Aussenende. Durch die zwei flachen Aushöhlungen kommen 4 Erhebungen zu stande, welche die weiblichen Genitalien darstellen, die zu je zwei durch eine flache Aushöhlung verbunden sind. Der rechte senkrechte Rahmen ist ebenso angelegt, aber während die unterste Hälfte gut gelungen ist, bemerkt man an der obersten nur eine flache Aushöhlung, vielleicht durch einen Bruch des Holzes bei der Bearbeitung verursacht. Dergleichen Abweichungen kommen besonders bei einfachen Verzierungen häufig vor. Dass man in diese Verzierung Einheit zu bringen versucht hat, zeigt die Schwelle und der Oberrand, die beide ebenfalls mit Motiven von männlichen und weiblichen Organen geschmückt sind.
Eine andere Anwendung dieser ursprünglich schutzbringenden Motive an den Häusern findet man bei den Verzierungen der Dachfirste, die besonders bei den Häuptlingswohnungen bisweilen mit einem schön geschnitzten, ausschliesslich aus diesen Genitalmotiven zusammengestellten Rand geschmückt werden. Einen solchen Rand auf dem First besitzt z.B. das Haus von Bo Ibau in Long Tĕpai, das in meinem Reisewerk “In Centraal Borneo” abgebildet ist (Teil II Taf. 80). Auch auf dem Grab-monument des Ma-Sulinghäuptlings (Teil I Tafel 66)kommt solch eine Firstverzierung vor. Während Bo Ibaus First ausschliesslich mit männlichen Motiven verziert ist, besteht derjenige des Grabmonuments aus einer Reihe von zwei männlichen Motiven mit einem weiblichen dazwischen, bei dem die inneren Lippen etwas verlängert und einander zugeneigt sind. Mit einer Lupe lässt sich dies an dem etwas beschädigten Rand noch feststellen. [255]
Das Motiv der vier Erhebungen wenden diese Stämme hauptsächlich bei der Schwertverzierung an; dabei werden durch Verlängerung und Biegung von diesen Erhebungen mannigfaltige Variationen abgeleitet. Dass man ursprünglich darauf aus war, die Leistungsfähigkeit eines guten Schwertes, die von den Eigenschaften der Schwertseele abhängt, zu hüten, indem man es mittelst nachgeahmter Genitalien vor bösen Geistern schützte,1 ist begreiflich. Wegen des häufigen Gebrauchs der Schwerter hat ihre Herstellung eine beträchtliche Höhe erlangt und hat sich die ursprüngliche Verwendung von Schutzzeichen zu der einer besonderen Spiralenverzierung entwickelt, die wir bei den Schwertern der Bahau und Kĕnja kennen gelernt haben.
An dem in Fig. d Taf. 29 Teil I abgebildeten Schwert kommen die wahrscheinlich ursprünglich angewandten einfachen Einkerbungen noch an der Spitze vor, doch sind sie an der Abbildung schwer zu unterscheiden, da sie auf dem Rücken des Schwertes angebracht sind und nicht tief ins Metall eindringen. Die hinter der Spitze auf dem Rücken vorkommenden Figuren geben dieses Motiv in verschiedene Spiralen ausgearbeitet wieder. Das grösser abgebildete Schwert der Kajan vom Balui (Fig. e Taf. 52) ist ebenfalls mit allerlei Variationen dieses Motivs versehen. Die ganze à jour Verzierung der vorderen Schwerthälfte ist aus weiblichen Genitalmotiven gebildet. Sie besteht aus zwei Teilen, dem an der Spitze des Schwertes und der eigentlichen Rückenverzierung 14. An der Spitze kann man dieses Motiv drei Mal in von einander verschiedenen Formen erkennen. Alle besitzen zu Schnörkeln und Spiralen verlängerte Aussenlippen und zwei sehr kurze, auf dieser Abbildung nur bei der am meisten rechts befindlichen Figur unterscheidbare Innenlippen. Bei dieser rechten Figur ist die rechte Aussenlippe zu einer gebogenen Linie ausgeschnitten worden, die dazu gehörige linke in einen Schnörkel, vielleicht weil für eine mehr gestreckte Linie kein Platz übrig war.
Die links folgende Figur ist symmetrisch und lässt hauptsächlich die beiden zu zierlichen Bögen geschmiedeten Aussenlippen erkennen. Die dritte Figur nach links bildet den Übergang von der Verzierung der Spitze zu der des Rückens, welche ihrer schwereren Formen wegen einen anderen Charakter trägt als die der Spitze. Auch bei diesem Motiv sind die beiden Aussenlippen in gebogenen Linien dargestellt, [256] aber die rechte Hälfte ist ebenso leicht und zierlich gearbeitet wie die Spitze, während die linke ebenso schwerfällig ausgearbeitet ist wie die ganze Rückenverzierung 14.
Diese besteht aus zwei weiblichen Genitalmotiven, die, was die Aussenlippen betrifft, dieselben gebogenen Linien wie die Schwertspitze zeigen, aber nicht à jour gearbeitet sind und eingekerbte Ränder besitzen. Die Innenlippen sind hier nicht zu einem Minimum reduziert, sondern in zwei gegen einander liegende, nach rechts und links gerichtete Schnörkel ausgearbeitet. Zwischen der dritten Figur der Spitzenverzierung und der ersten der Rückenverzierung, zwischen den zwei Rückenverzierungen selbst und links sind zur Verbindung zwei ähnliche Spiralen zwischengefügt, die jedoch über die Aussenenden der gebogenen Aussenlippen hingreifen. Eine wie eine Aussenlippe gebogene Linie bildet den Übergang zum geraden Rücken 13.
Bei der Besprechung der verschiedenen Motive ist bereits darauf hingewiesen worden, wie weitgehende Veränderungen diese erleiden können. Obgleich die Motive dieser Stämme hier nicht erschöpfend behandelt werden konnten, stellen uns die erwähnten Beispiele doch in Stand, zu zeigen, in welcher Weise aus einem ursprünglichen Motiv neue abgeleitet werden.
Vergleichen wir auf Tafel 82 Teil I die Figuren a, b, c, d und e mit einander, dann zeigt es sich, dass wir bei e mit einem zwar stilisierten, aber doch deutlich erkennbaren Kopf eines aso̱ zu tun haben, dessen mit Zähnen bewaffnete Kiefern 2 und 3 mit der dazwischen liegenden Zunge, sowie das links davon als Doppelspirale ausgeschnittene Auge gut zu unterscheiden sind. Das Tätowiermuster d ist ein ähnlicher aso̱-Kopf, aber einfacher, da in den Kiefern 2 und 3 die Zähne fehlen, die Zunge 4 zwar vorhanden ist, das Auge i aber den Platz des ganzen übrigen Kopfes einnimmt. Dieses klinge̱ bildet einen Übergang zu c, das einfach aus d abgeleitet worden ist, indem man dieselben Kiefern und die Zunge, die bei d rechts vorhanden waren, hier auch links anbrachte, also eine Verdoppelung von d mit Zusammenfallen des Auges, was sehr häufig bei den Stilisierungen der Bahau vorkommt. Bei b ist das Auge durch stärkere Ausarbeitung und durch geringere Verzierung der Kiefern völlig zur Hauptsache geworden; a ist sogar nichts anderes als das Auge ohne die Anhängsel von Kiefern und Zunge. So sehen wir, wie das Auge, das bei der Maske eine so [257] überwiegende Bedeutung behält, bei a selbständig geworden ist und u.a. bei der Männertätowierung als Rosette Verwendung findet.
Ein zweites vom Auge abgeleitetes Motiv lernen wir bei der Betrachtung von Tafel 85 Teil I verstehen. Hier kommen in beiden Handtätowierungen übereinstimmende Teile vor, die auseinander hervorgegangen sind. In der einfacheren Tätowierung b rechts sehen wir zwei Eulenaugen (māno̱k wăk), die in der den Vordersteven eines Fahrzeugs (do̱lo̱ng haro̱k) darstellenden Figur angebracht sind. Bei der Vergleichung dieser Teile mit den analogen in der schön stilisierten Tätowierung a links, zeigt es sich, dass der Künstler auf sehr einfache Weise, indem er diese Eulenaugen mit den angrenzenden Linien des haro̱k in Verbindung brachte, zu dem vollen Kreise mit der daraus entspringenden Spirale oder gebogenen Linie gelangt ist, ein Motiv, das bei der Komposition dieser reichen, linken Tätowierung in vortrefflicher Weise durchgeführt worden ist. Die Tätowierklötzchen g, h und i auf Tafel 82, die zur Zusammenstellung dieser Handtätowierung gedient haben, geben die so entstandenen Figuren sehr scharf wieder.
Diesen Übergang von einem mit einer Linie verbundenen Auge zu dieser Figur finden wir auch auf der Handtätowierung b auf Tafel 94 Teil I wieder. In dem unteren Ornament ist links oben deutlich ein Auge zu sehen, von dem ein Kiefer mit Zähnen nach rechts unten ausgeht. Der nicht sehr talentvolle Künstler hat die Symmetrie nur mangelhaft gewahrt und ist beim Schnitzen unwillkürlich auf der anderen Seite zu weit nach links oben geraten; bei der Anbringung des Auges ist dadurch dieses mit einer benachbarten Linie verbunden worden, was die gleiche Figur entstehen liess.
Die Tätowierfigur a auf Tafel 87 Teil I besitzt in ihrem Mittelstück noch eine Eigentümlichkeit. Der runde Raum zwischen der schweren gebogenen Linie ist dort mit einem doppelten aso̱-Kopf gefüllt, an dem bei i das gemeinsame Auge, bei 2 und 4 die Kiefer, bei 3 die Zunge und bei 5 die rudimentären Zähne zu unterscheiden sind. Die Schnörkel oben könnte man als stilisierte Nasenlöcher auffassen, wie dies bereits inbezug auf die beiden unten in diesem Modell vorkommenden aso̱-Köpfe bemerkt wurde. Stellt man sich nun vor, dass ein Schnitzkünstler die Zähne fortlässt, so gelangt er ohne grossen Sprung von der Füllung der Mittelfläche in a zu der von b, wo jedenfalls im Kreise in der Mitte ein Auge zu erkennen ist, während die [258] übrigen Linien dementsprechend als die übrigen Schädelteile, Kiefer und Zunge, aufgefasst werden müssen.
Die in diesem Werk geborenen Abbildungen von Kunstgegenständen gestatten uns, dem Ursprung einer noch grösseren Anzahl von Verzierungen nachzuspüren. Die reich verzierten Bambusbüchsen verdanken ihre Schönheit zum Teil den kunstvoll gewundenen Spirallinien, die, wie an den Verzierungen auf Tafel 68 mehrfach zu sehen ist, mit ihren Enden ineinander verschlungen sind. Diese Spiralen laufen häufig in viele Enden aus und tragen an diesen eigentümliche Verzierungen, wie z.B. in Fig. b. In diesem Unterteil der Verzierungen bestehen zahlreiche Variationen; die bei i in Fig. a gibt uns jedoch Aufschluss über die ursprüngliche Bedeutung derselben. Aus der Form der Spiralenden ist nämlich zu ersehen, dass diese umgebildete Köpfe von Rhinozerosvögeln darstellen. In dieser Figur a sind bei I an beiden ineinander geschlungenen Spiralenden folgende Teile zu erkennen: zunächst der Kopf mit dem schwarzen Auge, der in den langen Schnabel ausläuft. Dieser bleibt hier in seiner oberen und unteren Hälfte getrennt; die Erhebungen auf ihm stellen das Horn vor. Die beiden Unterschnäbel winden sich völlig umeinander hin, während die Oberschnäbel parallel an diesen hinlaufen, jedoch etwas kürzer sind. Ebenfalls in derselben Figur a kommen bei 2 einige Spiralenden vor, von welchen das oberste zwar als Kopf des Rhinozerosvogels zu unterscheiden ist, wenn man die vollständigeren Formen bei I kennt, aber dort fehlt bereits das Auge und der Kopf selbst ist stark umgebildet. Die unterste Spirale 2 zeigt einen Ausläufer, dessen Motiv überhaupt nicht mehr festzustellen ist und der seinen Ursprung vielleicht ganz der Phantasie des Künstlers verdankt.
Ausser den Variationen dieser ineinander greifenden Spirallinien auf Tafel 68 kommen noch verschiedene andere vor in Fig. b auf Tafel 65, Fig. a, b und c auf Tafel 66 und Fig. a, b und c auf Tafel 67.
Wir können an diesen Figuren feststellen, dass, wenn sie auch auf den ersten Blick als reine Linienverzierungen erscheinen, sie ihren Ursprung doch Motiven aus der Tierwelt verdanken. So scheint es mir, dass bei der Entstehung der auf dem Perlenmuster a auf Tafel 69 vorkommenden beiden Linienfiguren ebenfalls ein Tiermotiv zu Grunde gelegen habe. Vergleichen wir das Perlenmuster von a mit dem von b, so sehen wir zu beiden Seiten von letzterem bei 1 zur Verzierung zwei mit dem Rücken einander zugekehrte, schlangenförmige aso̱- oder [259] vielleicht naga-Figuren. An diesen ist zuerst im Kopfe das weisse Auge zu unterscheiden und der nach aussen geöffnete Mund mit kurzem Oberkiefer und langem, in eine Spirale auslaufendem Unterkiefer, die beide mit Zähnen Versehen sind. An der anderen Seite des Kopfes befindet sich der rechteckig nach oben und unten geknickte lange Körper, welcher gegen die Mitte des Musters in eine Spirale endet. Nähert man diese Figuren einander derart, dass die Köpfe und der Hinterleib oberhalb des Schwanzes einander berühren und stellt man sich die bereits bestehenden 4 Spiralen von Unterkiefer und Schwanz verlängert vor, dann ist der Übergang zu den Figuren, die rechts und links das Muster a verzieren, kein gewaltsamer. Die zwischen den beiden aso̱-Figuren in b vorhandenen Figuren erinnern dann sogar an diejenige, welche die Vierecke von a füllen.
An der Hand des im vorhergehenden über die verschiedenen dajakischen Kunstmotive und deren Behandlung Mitgeteilten gehen wir jetzt dazu über, die Art und Weise, in welcher diese Motive von den Bahau und Kĕnja in ihrem Kunstgewerbe angewandt werden, näher zu betrachten. Bei der Besprechung des Gewerbes im vorigen Kapitel sind zwar auch die Kunstprodukte dieser Stämme behandelt worden, jedoch mehr vom industriellen Standpunkt aus, während wir uns hier auf den künstlerischen beschränken wollen. Einige Wiederholungen sind hierbei natürlich unvermeidlich.
Zu den bemerkenswertesten Erzeugnissen der dajakischen Kunst gehören unzweifelhaft die bereits mehrfach erwähnten Schwertgriffe aus Hirschhorn, die nicht nur von den Produzenten selbst, sondern auch von allen anderen Dajak und Malaien in so hohem Masse geschätzt werden, dass sie sogar bei den höchsten Malaienfürsten an den Küsten zu finden sind. Der Sultan von Kutei hält unter seinen Hofkünstlern sogar einen Mann, der nur für ihn Hirschhorngriffe schnitzen darf.
Jeder Stamm, bei welchem diese Kunstwerke hergestellt werden, besitzt seine eigenen Modelle, auch sind die Griffe früherer Zeiten von den modernen leicht zu unterscheiden. Im allgemeinen ist der Künstler natürlich an die Form des Horns gebunden, doch bleibt ihm immer noch die Möglichkeit, diese stark zu variieren, wie die abgebildeten Exemplare auf Tafel 63 und 64 beweisen.
Die Griffe von Tafel 64 stammen aus dem Mahakamgebiet, wo sie als haupt (Griff) aso̱ ausschliesslich verfertigt werden, es sei denn, [260] dass ein Schnitzer am Kapuas oder anders wo einen solchen Griff ausnahmsweise imitieren wollte.

Schwertgriffe aus Hirschhorn.
Die Griffe auf Tafel 63 zeigen im ganzen dieselbe Form, doch wird ein Kenner an a bemerken, dass er von einem Künstler der Long-Glat am Mahakam geschnitzt worden ist: c, d und e stammen vom Mendalam, während b und f die Form der Kĕnjagriffe zeigen. Von letzteren findet man noch einige gute Beispiele an den Schwertern c und d auf Tafel 29 Teil I.
Obgleich die Ausführung dieser Griffe charakteristisch verschieden ist, sind die Motive, die zugrunde liegen, im allgemeinen dieselben, sie unterscheiden sich nur durch mehr oder weniger starke Stilisierung. An Griff c sind diese Motive sehr gut erkennbar. Tier- und Menschenmasken. welche die Künstler auch in diesem Fall hudo̱ nennen; spielen hier eine Hauptrolle. An dem abgebildeten Griff c findet man zwei dieser Masken. deren verschiedene Teile mit den Zahlen 1, 2 und 3 bezeichnet sind. Von diesen gibt 1 die Augen. 2 die stilisierten Nasenlöcher, 3 die Kiefer an, die an den oben angeführten Merkmalen zu erkennen sind. Die eigentümlich gekrümmten, dünn auslaufenden Verzierungen (mit 4 bezeichnet), die in sehr verschiedenen Formen angewandt werden, nennen die Schnitzkünstler Blutegel: demselben Motiv entspringt auch die grosse Spirale im Zentrum desselben Griffs. Häufig ist das eine Ende des Blutegels dick, während das andere der Mitte zu immer dünner wird, bis es mehr oder weniger gekrümmt in einer Spitze endet. Bisweilen stimmen diese Blutegel in der Form mit den indischen Palmetten überein. Besonders an dem schönen Griff a kommen diese Blutegel in hübsch gerundeten Spiralen in verschiedener Form vor.
Mit 5 ist ein anderes, an Griffen häufig vorkommendes Motiv angedeutet, nämlich der Arm, der oft noch den charakteristischen, verdickten Ring trägt, aber auch wohl als glattes, dickes, reliefartig hervortretendes Band, wie in d, angetroffen wird. Diese Motive liefern die meisten Verzierungen für die Griffe, auch sind sie an diesen häufig gut zu unterscheiden, wie an a, d und e. Bei b und f tritt eine andere Art der Verzierung auf, nämlich doppelte, ineinander greifende Spiralen, die innen in sehr grosse, den Griff quer durchlaufende Kanäle geschnitten sind. Am deutlichsten sind diese Spiralen in zwei der drei Kanäle von Griff f zu sehen, jedoch ebenfalls in den beiden Kanälen von b. Da sie mit dem Ornament der Oberfläche häufig nur wenig in Verbindung [261] stehen, beweisen sie mehr eine grosse Fertigkeit im Schnitzen als einen feinen Kunstgeschmack. Stellt man sich die mangelhaften Hilfsmittel des Künstlers vor, so legen diese eingesenkten Spiralen in der Tat ein sprechendes Zeugnis für seine Geschicklichkeit ab. Ein bemerkenswertes Beispiel ist in dieser Hinsicht der Griff des Schwertes d auf Tafel 29 Teil I. Hier hat der Schnitzer, ein Kĕnja, an den äusseren Öffnungen der beiden Kanäle Hornstücke als Brücken stehen lassen, wie das Bild deutlich zeigt, so dass zu beiden Seiten von diesen nur schmale Öffnungen frei geblieben sind. Nichtsdestoweniger ist es ihm doch möglich gewesen, dort innen in dem schwammigen Horngewebe noch gut geformte Spiralen auszuschneiden.
Die beiden haupt aso̱, die auf Tafel 64 dargestellt sind, repräsentieren die schönsten Schnitzwerke, die ich bei diesen Stämmen sah. Besonders ist der Griff Kwing Irangs sehr kunstvoll entworfen und geschnitzt. Er stammt aus früherer Zeit und muss von einem der Vorväter des Häuptlings verfertigt worden sein. Die früher behandelten Motive nehmen in dieser Verzierung eine untergeordnete Stelle ein und haben noch eine weitere Umbildung erlitten. Die zwei im Unterrand vorkommenden Blutegel sind hier platt geschnitzt; zwischen ihnen ist ein kleiner Arm erkennbar. In dem an der Spitze gelegenen Teil kommt in der unteren Ecke eine auf dem Hinterkopf liegende kleine Maske vor, um welche unten ein Arm geschlagen ist. Über dieser Maske springt ein dicker Arm mit einem deutlichen Ellbogenring aus dem Schnitzwerk vor. In diesem Griff ist eine grosse Höhle ausgeschnitten, die gleich der Oberfläche reich mit hervortretenden feinen Linien verziert ist; den Boden derselben bilden einige Spiralen, die jedoch hinter der Brücke, die über diese Höhle läuft, nur undeutlich zu sehen sind. Die Qualität dieser Schnitzerei kann mit guter chinesischer Arbeit verglichen werden, wobei noch berücksichtigt werden muss, dass Hirschhorn sich viel mühsamer bearbeiten lässt als Elfenbein.
Der rechte Griff, der viel weniger fein ausgeführt ist, gehört doch noch zu den besten Exemplaren, die am Mahakam noch zu finden sind, und beweist ebenso sprechend wie der vorige, wie sehr die besten unter diesen eingeborenen Künstlern sich von den ursprünglichen Motiven unabhängig zu machen verstehen, ohne diese doch gänzlich zu verleugnen. So wird die rechte untere Ecke von einem breit ausgearbeiteten Blutegel eingenommen, der mit der Spitze in die [262] stilisierten Finger eines rechts im Ornament nach oben verlaufenden Armes greift. Links hiervon ist eine Maske geschnitzt, deren Auge oben liegt und deren zwei mit Zähnen bewaffnete Kiefer rechts und links nach unten gebogen sind; zwischen diesen liegt noch beim Auge die kleine Zunge. Auf dem Oberkiefer ruht links von der Zunge ein typischer Hauzahn, während am unteren Ende desselben Kiefers das Nasenloch ausgehöhlt ist, aus dem eine lange Spirale läuft, eine Verbindung mit dem übrigen Schnitzwerk darstellend. Auch in letzterem sind hie und da an derartige Motive erinnernde Teile zu bemerken, doch sind sie so stark umgebildet, dass man sie nur an den charakteristischen Merkmalen erkennen kann. So wird der vordere Teil an der Spitze wieder von einer Maske mit Auge, Zähnen und Nasenloch eingenommen. Besonders deutlich treten hier die auf dem Boden der beiden Kanäle ausgeschnittenen Spiralen hervor.

Hirschhorngriffe.

Hirschhorngriffe.
An die Behandlung der Schnitzerei von Schwertgriffen schliesst sich am nächsten die von Schwertscheiden an, eine Industrie, welche infolge des grossen Absatzes, den sie bei den Mendalam-Kajan hauptsächlich unter Fremden findet, noch immer mit viel Sorgfalt und Talent betrieben wird. Zum voraus mag bemerkt werden, dass die so nahe verwandten Stämme der Bahau am Kapuas und Mahakam und der Kĕnja in Apu Kajan eine ganz verschiedene Verzierungsweise für Schwertscheiden anwenden, obgleich sie alle diese Scheiden aus zwei aufeinander gebundenen Brettchen herstellen, die sie von innen zur Aufnahme des Schwertes aushöhlen. An der dem Träger zugewandten Seite wird aus einem Stück Palmblattscheide für das lange Messer (nju) ein besonderer Behälter angebracht, das sie mit einer langen Perlenverzierung, wie bei Scheide d auf Tafel 30 Teil I, schmücken. An derselben Seite ist mit dem Bindfaden, der oben die beiden Brettchen zusammenhält, auch der Gürtel befestigt, der in der Regel aus Rotang geflochten wird. Diese Perlenverzierung an der Innenseite fehlt meistens bei den Schwertern der Kĕnja.
Diese Stämme verfertigen auch die einfachsten Schwertscheiden, wie die Figuren d und c von Tafel 29 Teil I sie zeigen. Das sehr einfache, glatt polierte Holz ist über der Aussenseite mit Rotangstreifen aneinander gebunden und diese, auf die gewöhnlich besondere Sorgfalt verwendet wird, ist hier nur wenig oder gar nicht mit Schnitzerei verziert. Augenscheinlich mehr zur Zierde als zu einem praktischen Zweck, weil auch die gewöhnliche einfache Rotangumflechtung vorhanden [263] ist, hat man bei c an vier Stellen in kunstvollen Schlingen eine hübsche Flechterei um die beiden Brettchen angebracht, eine auch am Mahakam sehr gebräuchliche Verzierungsweise.
Von derartigen im Mahakamstil verfertigten Scheiden sind zwei unter a und b auf Tafel 29 und unter d und e auf Tafel 30 Teil I abgebildet. Auch hier sind drei hübsch gewundene Rotangschlingen um die Scheiden gelegt, doch dienen sie hier dazu, das Vorder- und Hinterbrettchen aneinander zu halten. Ausserdem ist die Aussenseite oben bei solch einer Scheide stets mit Schnitzwerk verziert, wenn nicht, wie bei c, das Holz, aus dem dieses Vorderbrett besteht, hierfür unbrauchbar ist. Am Mahakam bemüht man sich nämlich, dieses Vorderbrett aus einer anderen und schöneren Holzart herzustellen als das Hinterbrett.
Sehr häufig begegnet man einer weichen, schöngeflammten Holzart, wie bei b, die dann mit viel Geschick glatt gescheuert und poliert wird. Oder auch man wendet ein hartes, leicht polierbares Holz an, das mit Sorgfalt geschnitzt und poliert wird wie z.B. a Tafel 29 und d Tafel 30. Dass man auch eigentümliche Naturprodukte zu schätzen weiss, ersieht man aus der Scheide e, für deren Vorderbrett man das vom Flusswasser ausgelaugte Holz eines bestimmten Baumes benützt hat. Durch die Einwirkung des Wassers wird dieser Baum an der Oberfläche sehr unregelmässig angegriffen, wodurch bisweilen sehr eigentümliche Muster entstehen, deren regelmässigste Teile wie die Vorderseite dieser Scheide e aussehen. Die aus weissem Rotang gewundenen Schlingen sind hier in die breiten Gruben des Vorderbrettchens gelegt worden, deren rauhe Oberfläche weggeschnitten worden ist.
Vom künstlerischen Standpunkt sind die Schwertscheiden der Mendalam-Kajan die wertvollsten, da die ganze Verzierung mittelst Schnitz- und Einlegearbeit angebracht wird. Beispiele für diese Scheiden sind e auf Tafel 29 und a, b, c, f, g und h auf Tafel 30 Teil I. Wie aus diesen wenigen Stücken bereits ersichtlich, ist die angewandte Schnitzerei von sehr verschiedener Art. Erstens besteht sie, bei f und h, in Hochrelief, bei a, b und c in Flachrelief; zweitens ist ihre Verteilung auf der langen, platten Fläche sehr verschieden.
Sehr gebräuchlich ist eine Verzierung wie bei a, b und c. Bei der Zusammensetzung der hier angewandten Figuren sind die oben bereits besprochenen Motive benützt worden, hauptsächlich die vom Menschen abgeleiteten. Sehr leicht erkennbar ist z.B. bei b mitten auf der Scheide eine ganze Menschenfigur. Um den mit Augen, Nase und Mund versehenen [264] Kopf ist rechts ein Arm hinaufgeschlagen. Darunter folgt ein Körper mit zwei Beinen, von denen das linke oben liegt und in einen stark stilisierten Fuss mit Zehen endet.
Bei c sind einige Masken zu unterscheiden, von denen die eine in der obersten Verzierung, auf dem breitesten Teil der Scheide, unter dem Hals liegt. Man erkennt hier die beiden länglichen, nach Mongolenart schief gerichteten Augen, darunter eine kleine Nase, die durch zwei verzierte Brücken mit den Aussenwänden verbunden ist, ferner einen breiten, spaltförmigen Mund, in dem mit einer Lupe links noch einige Zähne zu unterscheiden sind. Unterhalb dieses Mundes wird der wichtigste Teil der Verzierung durch zwei nach innen gebogene dicke Wülste gebildet, die als Arme oder Beine betrachtet werden können. Am unteren Ende der Scheide wird die Verzierung von einer ähnlichen Maske abgeschlossen, die jedoch umgekehrt steht; auch fehlen hier die beiden von Gliedmassen abgeleiteten Verzierungsteile.
Merkwürdig sind die drei auf der Vorderfläche von Scheide f in Hochrelief geschnitzten Vierecke. Ihre Ecken werden von Gliedmassen gebildet, während in der Mitte der Seiten ein hoch ausgeschnittener Blutegel den Raum zwischen den Enden dieser Gliedmassen ausfüllt.
Für die Verzierung dieser Scheiden ist ein bei den Mendalam-Kajan sehr beliebtes Motiv benützt worden, dessen wahre Bedeutung nicht ohne weiteres zu bestimmen ist und auf welches ich bis jetzt noch nicht näher eingehen konnte. Ich meine ein Oval, durch welches eine erhöhte Mittellinie läuft, die an einem Ende oder an beiden über dem Oval hervortritt. Dies kommt z.B. in der untersten Verzierung der Scheide b vor und zwar dreimal unter der Menschenfigur quer zur Längsrichtung der verzierten Fläche; ferner unter dem Masken- und Gliedmassenmotiv im obersten Ornament von c und 5 Mal in der untersten Verzierung dieser Scheide, die am Unterende durch eine Maske abgeschlossen wird. Dieses hier überall liegend vorkommende Oval mit der an beiden Seiten vortretenden Mittellinie stellt einen Schädel dar und wird bisweilen selbständig, aber meistens in Verbindung mit mehr oder weniger umgeformten Kiefern angewandt. Schöne Beispiele hierfür finden wir in dem untersten Teil der Verzierung von c, wo alle 5 Ovale in Verbindung mit den zugehörigen zwei gezähnten Kiefern und der dazwischen liegenden Zunge vorkommen. Sehr deutlich sichtbar ist dies am obersten Oval, das im oberen Ende dieses Ornaments vorkommt und nach links an die beiden weit aufgesperrten [265] mit Zahnreihen bewaffneten Kiefer grenzt, zwischen denen eine sehr dicke Zunge nach links aus dem Maul hervortritt. Dies gleiche Motiv, aber mit nach rechts aufgesperrten Kiefern, hat man dicht unter dein ersten wiederholt, so dass das Schädeloval links liegt und die Kiefer rechts. Dasselbe wiederholt sich zwei Mal zwischen den beiden halbmondförmigen Figuren und noch ein Mal unterhalb der untersten dieser beiden. Auf diese Weise lässt sich beinahe die ganze untere Verzierung der Scheide c in ihre Hauptbestandteile zerlegen. Die beiden halbmondförmigen Figuren dieses Ornaments stellen deutlich Genitalmotive dar. An jeder derselben unterscheidet man zu beiden Seiten einen Vorsprung, dazwischen zwei einander etwas zugeneigte innerste Lippen und zwischen diesen eine Spirale, die bei den Hindu und Chinesen das Sinnbild der Männlichkeit bedeutet. Ist diese Auffassung richtig, so besteht das Ornament der Scheide c gänzlich aus Motiven, die auch an anderen Orten zur Vertreibung böser Geister angewandt werden. Ich wage jedoch nicht zu behaupten, der Künstler habe diese Scheide hauptsächlich zu diesem Zweck derartig hergestellt. Es erscheint mir wahrscheinlicher, dass solche Motive im allgemeinen bei den Mendalam-Kajan von alters her für die Verzierung von Scheiden verwandt worden sind.
Besondere Erwähnung verdient die Scheide e auf Tafel 29, die von einem Mendalam-Kajan für mich gearbeitet worden ist. Das Vorderbrett aus schwarzem Holz ist mit hübsch geschnitzten Stücken von weissem Hirschhorn eingelegt, und aus demselben Material ist die fein gearbeitete Spitze hergestellt. Das Ganze stellt ein besonders schönes Stück dar, nur kommt die Schnitzerei auf der mangelhaften Abbildung schlecht zur Geltung.
Diese Einlegearbeit scheint hauptsächlich bei den Batang-Luparstämmen von Sĕrawak sehr im Schwange zu sein, aber auch bei den Bahau ist das Einlegen von Knochen, Hirschhorn, Metall und selbst Porzellan und Glas in Holz wohl bekannt und sehr gebräuchlich.
Die Tafeln 65–68 geben einige Beispiele für Schnitzereien auf Bambusbüchsen, die von denselben dajakischen Stämmen herrühren. Diese Büchsen (te̥lu kalonog) werden entweder zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten wie Tabak, Nähzeug, Perlenarbeiten, Halsketten u.s.w. benützt oder als Pfeilköcher, wie z.B. die grossen Köcher, von denen die Verzierungen a und b auf Tafel 65 herstammen. Die beiden letzten Verzierungen lehren uns eine sehr seltene Art der Schnitzerei kennen; [266] sie versuchen nämlich beide, Szenen aus dem täglichen Leben wiederzugeben. Die mangelhafte Ausführung deutet darauf hin, wie wenig die Künstler hierin geübt sind.

Schnitzereien auf Pfeilköchern.
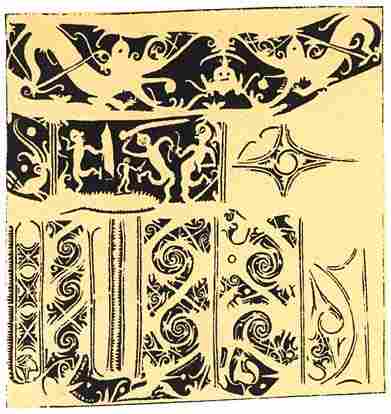
Schnitzereien auf Pfeilköchern.
Bei a ist links eine Jagdszene dargestellt, in dem Augenblick, wo ein mit einem Speer bewaffneter Mann, begleitet von einem Hunde mit borstig abstehenden Haaren, ein grosses Tier spiessen will. Auf dem Rücken dieses Tiers, das an seiner Form nicht erkennbar ist, steht ein Hahn. Das Mittelstück von b gibt einen Zweikampf wieder. Von den vier hier dargestellten Menschenfiguren hält die oberste, mit einem Schild bewaffnete, den freien Arm derart, als ob auch er eine Waffe trüge. Der Oberkörper ist im Verhältnis zu den Beinen viel zu lang. Der Fuss an dem ausgestreckten Bein, dessen Form sehr schlecht ist, ist augenscheinlich absichtlich, wie die Hände der unteren Figuren, umgebildet worden. Unter dem Schild steht eine kleine Figur, die einen länglichen Gegenstand, vielleicht ein Schwert, in der Hand hält. Mit der ersten Figur kämpft jedoch eine dritte, die ein ganz unverhältnissmässig langes Schwert schwingt und deren Arme und Beine auf ganz unnatürliche Weise gebogen sind. Die linke Hand, die sich gegenüber derjenigen der vierten Figur befindet, ist in der gebräuchlichen Weise stilisiert worden. Die letzte, ebenso mangelhaft gebildete Figur, scheint sich vom Schauplatz entfernen zu wollen. Ihre freie Hand ist auf gleiche Weise stilisiert wie die der dritten Figur. Der Rhinozerosvogel oberhalb dieser Szene ist früher bereits erwähnt worden.
Was die übrigen auf dieser Tafel abgebildeten Bambusverzierungen betrifft, so sind sie in vielen Teilen an der Hand des oben bereits Behandelten gut zu erkennen. Die rechte Hälfte von a ist auf eigentümliche Weise aus 6 sehr phantastischen Masken in Verbindung mit allerlei Linien und Spiralen zusammengesetzt. Ein zweites Beispiel einer derartigen Verzierung habe ich bei diesen Stämmen nie gefunden.
Von gewöhnlicherer Art sind die rechten und linken Hälften von b. Man findet hier links übereinander vier, mit dem so beliebten Spiralornament kombinierte Ränder, über die nicht viel mehr zu bemerken ist, als dass sie von einander sehr verschieden sind und die drei untersten links durch grosse Tiermasken gefüllt werden, von denen zwei deutlich Kiefer mit Zähnen und eine Zunge erkennen lassen; bei der dritten, der untersten, fehlen die Zähne. Die langen Oberkiefer verlaufen in Form grosser Schnörkel in die übereinstimmenden Ornamente und verbinden sich so mit den übrigen Schnörkeln. Der Streifen [267] rechts wird von zwei stilisierten Hundefiguren zu beiden Seiten einer rudimentären Menschenfigur gefüllt, an der nur die Maske gut zu erkennen ist. Bemerkt zu werden verdient, dass die eigenartig geformten Figuren, in denen das Auge vorkommt, in der Verzierungskunst häufig allein angewandt werden und dann als Erkennungszeichen für ein Maskenmotiv dienen. In die aus verschiedenen Teilen bestehende Verzierung b hat der Schnitzkünstler doch noch einige Einheit zu bringen versucht, indem er in den meisten Unterteilen kugelförmige Figuren anbrachte. So findet man diese an den Zungen der Hundefiguren rechts, in der Mitte oben beim Rhinozerosvogel, an einigen Stellen bei den Spiralrändern und ganz links wieder an den Zungen der Masken und einigen anderen Orten. Wir erkennen hierin das Bestreben des Künstlers, die geringe Harmonie des Ganzen durch einige technische Mittel zu erhöhen.
Auf Tafel 66 sind die Schnitzereien von drei Bambusbüchsen abgebildet, von denen a und b in vieler Hinsicht miteinander übereinstimmen, nur ist b einfacher gehalten als a. An letzterem Ornament lässt sich jedoch besser feststellen, in wie weit bestimmte Motive bei der Komposition desselben Dienst geleistet haben. Sehr deutlich sind hier schlangenförmige Tiere von der gewöhnlichen Form zu sehen, sie kommen beinahe unverändert vor, hauptsächlich im obersten Teil, wo sie bei I auf sehr zierliche Weise verschlungen sind.
Die gleichen Tierfiguren wie in der Randverzierung finden wir in der sehr geschmackvollen Füllung der Tumpal (längliche Dreiecke in Verzierungen) des mittleren Teils des Bambusornaments. Die ganzen Figuren sind leicht erkennbar, aber auch rechts im rechten Tumpal, auf gleicher Höhe mit dem Kreuz in der Mitte zwischen den beiden Tumpal, ist der gleiche Tierkopf zu unterscheiden. Der dazu gehörige Körper lehnt sich mit dein Rücken an die Mittellinie, welche den Tumpal fast bis nach unten durchzieht. Die gleichen Köpfe, immer kleiner und undeutlicher werdend, scheint der Künstler auch an den anderen Spiralenden angebracht zu haben, die zu beiden Seiten der Mittellinie in zwei Reihen sich bis in die Spitze des Dreiecks hinziehen. Die Verzierung unmittelbar um das Kreuz herum scheint aus der Vereinigung von zwei seitlichen Köpfen hervorgegangen zu sein.
Bei Fig. b auf derselben Tafel ist von Tiermotiven wenig mehr zu merken, alle Formen sind im Gegenteil äusserst vereinfacht worden, Körperformen haben Linienfiguren Platz gemacht. In wie weit einem [268] Künstler beim Schnitzen derartiger Büchsenverzierungen Tiermotive vor Augen schweben oder er nur Variationen der gebräuchlichen Füllverzierungen anbringt, ist schwer zu verfolgen.

Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.
Fig. c auf Tafel 66 trägt einen ganz anderen Charakter. Der Künstler hat hier keine besondere Randverzierung geschnitzt, sondern die Füllung der beiden Tumpal bis oben hinaufreichen lassen. Die Spitzen der beiden letzteren sind nach unten verlängert und verlaufen äusserst schmal in eigentümliche Figuren im Bambusrand des unteren Endes. Bei der Füllung dieses schwer zu verzierenden Raumes sind Tiermotive wahrscheinlich nicht bewusst angewandt worden; die Hauptfiguren bestehen nur aus Linien; nur in den Verzierungen, welche die Enden der Spiralen tragen, sind Formen zu finden, welche an Tiermotive erinnern. Die zierlichen Figuren hat der Schnitzer wirkungsvoll hervorzuheben verstanden, indem er den Hintergrund nicht, wie gewöhnlich, rot oder schwarz färbte, sondern sorgfältig schraffierte.
Das reich kombinierte Muster a auf Tafel 67 ist sicher ebenfalls entstanden, ohne dass sich die Formen eines Tierkörpers in der Vorstellung des Künstlers stark geltend gemacht hätten. Augenscheinlich war es ihm mehr darum zu tun, geschmackvolle Linien als ausgesprochene Tiermotive darzustellen.
Anders verhält es sich mit den Schnitzereien von b und c auf Tafel 67. Mit b liefert der Künstler den Beweis, sowohl mit als ohne Tierfiguren ein geschmackvolles Ganzes erfinden zu können. Im obersten Dreiviertel legt er eine grosse Fertigkeit in der Anwendung der gebräuchlichen Formen an den Tag, mit denen er durch Biegung der Tumpal und Einfügung anderer Teile eine sehr eigenartige Wirkung hervorzurufen verstanden hat. Recht verdienstvoll, wenn auch etwas verworren, ist das unterste Viertel mit zwei aso̱-Figuren gefüllt worden, deren Körper, Beine und Schwänze bei Figur I deutlich zu sehen sind, deren Kopf jedoch sehr gesucht phantastisch dargestellt ist. Rechts ist vom Kopf hauptsächlich der Oberkiefer mit Zähnen und der grosse Hauzahn zu erkennen, oberhalb der Zähne auch das stilisierte Nasenloch. Der Unterkiefer läuft vom Hauzahn aus nach rechts unten. Das längliche, spaltförmige Auge liegt wahrscheinlich neben dem Nasenloch. Die Fusszehen sind hier in der gewöhnlichen Weise stilisiert.

Schnitzereien auf Bambusköchern.
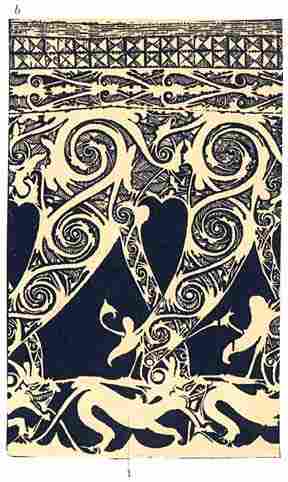
Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.
Stärker herrschen die Tierformen bei c auf derselben Tafel vor; die beiden Ränder übereinander, die den obersten Teil dieser Figur bilden, werden vollständig von zwei typischen aso̱-Figuren auf schraffiertem [269] Grunde eingenommen. Der Künstler hat, vielleicht um Einförmigkeit zu vermeiden, seine Tiere im obersten Rand auf dem Rücken liegend, in dem unteren dagegen stehend wiedergegeben. Die Formen dieser aso̱ sind derart bis in alle Kleinigkeiten ausgearbeitet und deutlich erkennbar, dass eine nähere Auslegung überflüssig erscheint. Für die Komposition des untersten Teils von c haben die gewöhnlichen Figuren gedient.
Von den Bambusverzierungen auf Tafel 68 sind a und b bereits früher zur Erklärung bestimmter Formen von Spiralenden benützt worden. Fig. c stellt einen Rand über einer gewöhnlichen Tumpalverzierung dar und weist ausser einer Reihe von 4 kleinen Tiefen als Füllung für die unterste Hälfte in der oberen noch einen schönen, in schweren Formen geschnitzten Spiralrand auf. Die bei I vorkommenden Tiere im unteren Teil bedürfen keiner Erklärung.
Fig. d ist in verschiedener Hinsicht merkwürdig. Zunächst ist das ganze Ornament ungewöhnlich wegen der doppelten Verzierung mit schiefen, länglichen Tumpal, welche auf die gewöhnliche Weise ausgefüllt sind. Eins von den beiden Paaren besteht aus zwei nach verschiedenen Seiten gebogenen Hälften, die an den Spitzen sehr eigentümlich durch eine Tierfigur (1) verbunden sind, in welcher man deutlich einen Vierfüssler erkennen kann. An der Basis des anderen Tumpal kommt eine ähnliche Tierfigur (2) vor, welche die scharfe Ecke füllt und mit ihrem Oberkiefer den ersten Schnörkel von der Füllung dieses Dreiecks ausmacht. Bei Fig. a Tafel 66 sahen wir, dass diese Rolle durch den Körper eines schlangenförmigen Tiers erfüllt wurde, und in b Tafel 65 waren es die Oberkiefer, die in gewöhnliche Spiralornamente übergingen; hieraus geht hervor, dass für derartige Spiralen zwar Tiermotive verwandt werden, dass aber sehr verschiedene Körperteile in die gleiche Form gebracht werden können. Wir bemerken in dieser Bambusverzierung d noch etwas Ähnliches wie in Fig. b Tafel 65, nämlich, dass in der ganzen Figur gleiche Einzelheiten angebracht sind, wahrscheinlich um die Einheit des Ganzen zu fördern. Dieses Einzelmotiv ist das mit einem Kreise (3) umgebene Sternchen, das man auch in den spitzen Winkeln der verschiedenen Tumpal wiederfindet.
Nach der Besprechung der vorhergehenden Beispiele bietet Fig. e nicht viel Merkwürdiges mehr, höchstens ist die Verbindung der beiden Spiralen in der Mitte aussergewöhnlich. [270]
Eine sehr eigentümliche Kunstfertigkeit der dajakischen Männer bildet das bekannte Ausschneiden von Figuren aus dunkelfarbigem Zeug, die dann zur Ausschmückung der Kleider von Toten (am Kapuas) oder von Lebenden (am Mahakam und Kĕdjin) benützt werden. Von solchen Totenkleidern findet man in Teil I auf Tafel 24 Fig. 6 und Tafel 27 Fig. 1–5 Beispiele abgebildet; ähnliche Kleider für Lebende sind auf Tafel 43 und 44 dieses Bandes zu sehen.
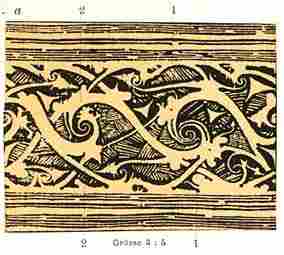
Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.

Schnitzereien auf Bambusköchern.
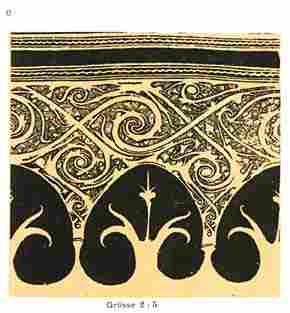
Schnitzereien auf Bambusköchern.
Bei diesen ausgeschnittenen Figuren treten die gleichen Motive in den Vordergrund, denen wir anderswo bereits begegneten. Bei den Totenkleidern von Taf. 27 Teil I finden wir vor allem die aso̱-Figuren wiederholt dargestellt; so stehen in Fig. 3 an beiden Enden der Leibbinde zwei aso̱-Figuren mit dem Rücken einander zugekehrt, die Köpfe nach innen und die zusammengekrümmten Hinterenden nach aussen gewandt. Die gleichen Figuren kommen auf dem Kopfkissen Fig. 2 und dem Rock Fig. 5 vor, ebenso auf der Jacke Fig. 4, aber hier ist der Kopf von oben noch mit verschiedenen hinzugefügten Schnörkeln etc. umgeben.
Ähnliche Figuren zeigt auch der bei i e abgebildete samit-Sack, nur sind sie hier mit Anilintinte auf den weissen Kattun gezeichnet, mit dem die verschiedenen Fächer dieses Sacks überzogen sind. Auf jedem dieser Fächer sind diese Figuren in anderer Form angebracht worden, wie bereits an den beiden in dieser Abbildung vorkommenden zu sehen ist. Im ganzen trägt dieser Sack 6 verschiedene Formen des aso̱.
Die vier Mittelfiguren der Leibbinde 3 sind ebenfalls leicht zu erkennen, es sind Menschenfiguren ohne Köpfe. Die Unterhälfte des Körpers ist zur Mitte gekehrt, die Beine sind aufgezogen, in den Knien gebogen; die Oberarme sind nach unten gerichtet, wo die Ellbogen mit einer Verdickung auf den Knien ruhen, während die Unterarme wieder hinaufgebogen sind und in nach innen gerichteten Schnörkeln endigen.
Bei der Verzierung des Tragkorbs 1 auf derselben Tafel sowie des Huts Fig. 6 auf Tafel 24 sind nur Linienfiguren zur Anwendung gebracht worden.
Was die Feinheit der Ausführung betrifft, kann diese Totenausrüstung vom Kapuas in keiner Hinsicht einen Vergleich mit den Kleidern vom Mahakam bestehen (Tafel 43 und 44); da die Mahakamstämme derartige Kleider täglich gebrauchen, ist ihre grössere Fertigkeit im Ausschneiden begreiflich. [271]
Die Ränder der auf Tafel 43 abgebildeten Röcke bilden schöne Beispiele für die Leistungen in diesem Kunstzweige; die Ränder von a und die ausgeschnittenen Dreiecke von d sind aus rotem Flanell auf weissem Kattun, die von b aus rotem Kattun, die von c aus gewöhnlichem, mit Indigo blau gefärbtem Kattun auf weissem Untergrund hergestellt worden. Zwischen die ausgeschnittenen dreieckigen Stücke von d sind Stickereien auf dunkelblauem Kattun geheftet, von derselben Art, wie sie auf Tafel 46 zu sehen sind.
Die Ränder von Fig. c mit den Bucerosköpfen sind bereits auf pag. 249 besprochen worden.
Von grösserem Interesse als diese Röcke ist der unvollendete Pnihingrock auf Tafel 44, der sowohl was den Entwurf des Ornaments als was die sehr grosse Fertigkeit im Ausschneiden betrifft, Beachtung verdient. Bewundernswert ist die Anordnung der Linien in der Füllung des Feldes und die Richtigkeit der Empfindung, mit der die Linien in dem Mittelteil dichter aneinander und dünner als in den Seitenteilen ausgeführt sind. Da auch dieses Ornament aus einem zusammengefalteten Zeugstück geschnitten worden ist, sind beide Hälften streng symmetrisch ausgefallen.
Ausser den zahlreichen Schnörkeln, die man hier sicher als selbständiges Verzierungsmotiv auffassen muss, sind zunächst 4 aso̱ in die Komposition aufgenommen worden und zwar zwei rechts und zwei links, wo sie mit den Füssen gegeneinander und mit den Köpfen in die Höhe gekehrt stehen. In der am meisten rechts befindlichen Figur sind die verschiedenen Körperteile mit Zahlen bezeichnet und zwar: das Auge mit i, der Unterkiefer mit 2, die in 2 Linien auslaufende Zunge mit 3, der Oberkiefer mit 4, der Körper mit 5, der Vorderfuss mit 6, der Hinterfuss mit 7, der Schwanz mit 8. Alle diese Teile sind in gleicher Weise an dem links stehenden aso̱ und an dem in der linken Hälfte vorkommenden Tierpaar zu sehen. Über die Form der seitlich auf halber Höhe befindlichen Verzierungen ist zu bemerken, dass der Künstler bei diesen an Masken gedacht haben muss, die mit dem unteren Teil zur Seite gekehrt sind. Rechts ist ein rundes, weisses Auge mit 9 angegeben; das Nasenloch bei 10 ist hier auch durch eine Spirale dargestellt, während die geraden, auf den Seitenwänden senkrecht stehenden Linien einen Mund mit Zähnen darstellen. Obgleich auch in dieser reichen Füllung des Rockfeldes Tier figuren und Masken vorkommen, nehmen sie doch keinen überwiegenden Anteil an der Komposition. [272]
In der Reihe der Kunsthandwerke der Bahau- und Kĕnjastämme nehmen die in bunten Farben aus kleinen Glasperlen gearbeiteten Muster eine wichtige Stelle ein. Letztere zeigen besonders deutlich, dass der Geschmack und die Kunstfertigkeit dieser Stämme sich nicht allein auf die Form beschränken, sondern dass auch ihr Farbensinn sehr entwickelt ist. Nach Vorlagen, welche die Männer ausschneiden, verfertigen die Frauen diese Perlenmuster zur Verzierungbestimmter Gegenstände. Zu diesen gehören vor allem die Kindertragbretter, hăwăt, auf welchen die grössten Muster (tāp) nach der in Figur d auf Tafel 69 wiedergegebenen Weise angeheftet werden. Die meisten tāp sammelte ich am Mahakam, wo sie oberhalb der Wasserfälle noch sehr in Gebrauch sind. Doch ist hier in diesem Gewerbe insofern bereits ein gewisser Rückschritt zu verzeichnen, als, soweit ich der Sache nachgehen konnte, die Frauen gegenwärtig nur die Formen der tāp aus früherer Zeit nacharbeiten, ohne neue zu erfinden, und sich mit der Wahl der Farben nach eigenem Geschmack begnügen.

Perlenarbeiten, Holzpatronen und Kindertragbrett.
Dies war auch bei den Kajan am Kapuas der Fall; so dass ich erst nach Jahren dahinterkam, von wo die ursprünglichen Formen stammten. Als ich nämlich am Ende meiner Reisen die Kĕnjastämme besuchte, sah ich, dass bei diesen noch die ursprüngliche Herstellungsmethode nach Vorlagen, welche die Männer auf Brettchen schnitzten, im Schwange war. Zwei solcher Holzpatronen sind auf Tafel 69 bei c und e abgebildet. Jede Hälfte von c ist mit zwei Tiermasken verziert, die mit einigen Schnörkeln ineinander greifen und zusammen eine geschmackvolle Figur bilden. Das bereits gebrauchte Brett e trägt zwei Paar aso̱, von denen jedes mit den Körpern zusammen-fliesst, ein bei den Kĕnja beliebtes Motiv. Oben und unten an den Rändern sieht man 5 Löcher, die dazu gedient haben, eine feste Schnur an einer Seite längs des Musterbretts zu spannen. An diese Schnur wurden dann die vielen kleineren Schnüre befestigt, an welchen nach dem Muster die farbigen Perlen aneinander gereiht wurden. Zweifellos sind auf diese Weise auch die jetzt noch unter den Mahakam und Kapuasbahau zirkulierenden Muster entstanden, doch beschränkt man sich bei diesen gegenwärtig auf die Nachahmung der alten Vorlagen. Für eine solche Nachahmung sind die beiden tāp auf Tafel 71 ein Beispiel: die unterste b ist sehr mangelhaft reproduziert, sie ist die älteste und in der Tat erscheinen ihre Farben auch unserem Auge altertümlich. Nach dieser ist mit neueren Perlen a nachgearbeitet, [273] die, wie man sieht, mit ihr ganz übereinstimmt. a kaufte ich bei den Kajan am Blu-u für eine Quantität Perlen, die genügte, um zwei tāp aus ihr herzustellen.
Die auf Tafel 70, 71 und 72 dargestellten Perlenmuster dienten ebenfalls zum Schmuck von hăwăt. Etwas kleinere Modelle werden zur Verzierung von Korbdeckeln gebraucht (siehe Taf. 54). Diese Muster werden mit einer etwas grösseren Perlenart hergestellt, weil sie, nach Angabe der Frauen, auf grösseren Abstand gesehen werden müssen und daher weniger fein in ihren Formen zu sein brauchen. Die allerfeinsten Perlen gebrauchte man dagegen zur Herstellung der fünf tāp (Muster) lawo̱ng (Mütze), die auf Tafel 73, 74 und 75 wiedergegeben sind, ebenso für den Überzug der Männermütze auf Tafel 75. Erstere dienen zum Schmuck der hohen Frauenmützen, die aus Rotang geflochten und mit rotem Flanell oder Filz von der gleichen Farbe wie der rote Grund auf der Abbildung überzogen werden. Eine derartige Mütze trägt z.B. die Frau links auf Tafel 8.
Bei den Long-Glat-Frauen herrscht die Sitte, die vier Ecken ihrer Röcke mit feinen Perlenmustern zu verzieren; ebenso werden die schmalen Kopf bänder vielfach mit längeren oder kürzeren Perlenstreifen von hübscher Farbenkombination geschmückt (siehe dieselbe Tafel 8).

Perlenverzierungen für Kindertragbretter.
Die Kapuasstämme legen besonderen Wert darauf, die Scheiden der kleinen Messer an den Schwertern mit Perlenstreifen zu verzieren. Dies geschieht auch am Mahakam, aber dort sind die Streifen anders geformt, nämlich nach Art der Quasten an den Schwertscheiden a und b auf Tafel 29 Teil I.
Die Verzierungen dieser Muster werden auf sehr verschiedene Weise und aus den verschiedensten Motiven zusammengesetzt. Sind diese noch erkennbar, so findet man unter ihnen die gleichen Figuren, wie sie in der Holzschnitzerei oder der Schnitzerei in Bambus, Knochen etc. gebräuchlich sind. Doch begegnet man auch vielen Mustern, in denen nur der Name oder auch dieser nicht mehr an die ursprüngliche Herkunft erinnert.
Von derartigen Motiven wurden sowohl die in der tāp hăwăt a auf Tafel 70 vorkommenden Menschenfiguren als diejenigen in b, die in Verbindung mit einem Tigerkopf in der Mitte dort auftreten, bereits besprochen. In bezug auf das Perlenmuster b muss noch bemerkt werden, dass seine Farben, die im Original wie beim Muster b auf [274] Tafel 71 einen altertümlichen Eindruck machen, nur mangelhaft wiedergegeben sind, beide Muster müssen daher in der Abbildung mehr nach der Form als nach der Farbe beurteilt werden.

Perlenverzierungen für Kindertragbretter.
Die Menschenfiguren auf den tāp hăwăt von Tafel 71 wurden zwar ebenfalls bereits behandelt (pag. 239), doch mag hier einiges hinzugefügt werden. In der Figur, die sich je in den oberen Ecken der Muster befindet, ist eine schwarze, nach aussen aufgesperrte Tiermaske zu erkennen, in der das rote, mit gelb umgebene Auge deutlich hervortritt, ebenso die beiden mit einigen Zähnen bewaffneten, nach oben und unten umgerollten Kiefer. Die anderen schwarzen Figuren lassen sich jedoch nicht mehr auf die bekannten Formen zurückführen. Das gleiche Muster, mit einer grossen schwarzen Hundefigur über der Menschenfigur, ist bei den Long-Glat sehr gebräuchlich.
Das Muster a ist in seinen Originalfarben wiedergegeben und macht aus einigem Abstand gesehen einen hübschen Effekt. Eigentümlich ist, dass diese Muster keinen unharmonischen Eindruck machen, trotzdem sie aus grellen, ohne Übergang nebeneinander gesetzten Farben bestehen. Dasselbe ist der Fall bei der gut wiedergegebenen tāp a auf Tafel 72 und denen auf Tafel 73, 74 und 75. Die Mittel, mit denen die Bahau die hübschen Farbeneffekte zu erzielen wissen, sind sehr bescheiden, öfters auch unzulänglich. Die Stickerinnen reichen z.B. oft mit einer bestimmten Perlenart nicht aus und müssen sich dann mit einer anderen begnügen. Da die kleinen Perlen, aus denen diese Muster bestehen, wie die grossen auf langdauernden Reisen von den Männern aus den Küstenplätzen in die Dörfer eingeführt werden und ihr Preis an sich für die Verhältnisse der Eingeborenen hoch ist, kommen sie im Innern sehr teuer zu stehen. Der Perlenvorrat eines Stammes ist infolgedessen in der Regel sehr beschränkt, so dass die Künstlerinnen bei der Arbeit nur selten die Farben frei wählen können. An weitaus den meisten Mustern merkt man denn auch, dass der Stickerin eine Farbe oder ein Ton ausgegangen war und sie dann gegen die Symmetrie hatte sündigen müssen, indem sie z.B. rechts und links verschiedene Farben anbrachte. Bei den abgebildeten Mustern, die zu den schönsten meiner Sammlung gehören, hat die Symmetrie gewahrt werden können, doch geschieht dies, wie gesagt, nur selten. Ich selbst habe mich davon überzeugen können, wie schwierig es ist, sich die zu einem bestimmten Muster erforderlichen Perlen zu verschaffen. Nachdem ich nämlich auch nach einjähriger [275] Unterhandlung die besonders hübsche tāp lawo̱ng die unten auf Tafel 73 abgebildet ist, nicht hatte erstehen können, trug ich Kwing Irangs zweiter Frau Uniang Anja auf, mir dieses Muster während meiner Reise zur Küste 1899 nachzuarbeiten, worauf die Besitzerin auch einging. Bei meiner Rückkehr nach 3 Monaten erhielt ich jedoch statt der bestellten tāp die oberste auf Tafel 73, weil im ganzen Kajanstamm nicht genügend braune Perlen, die in dem Muster vorherrschen, zu erhalten gewesen waren. Erst im Laufe des folgenden Jahres gelang es mir, um hohen Preis auch das ursprüngliche Modell b auf Tafel 73 zu erstehen; seine alte Besitzerin hatte es nach ihrem Tode nach Apu Kĕsio mitnehmen wollen und sich daher nur sehr schwer von ihm zu trennen vermocht.

Tāp hăwăt, Perlenverzierung der Kajan.
Die beiden tāp hăwăt auf Tafel 72 sind nicht sehr glücklich reproduziert worden, besonders bei der untersten ist das Gelbgrün des Originals zu grün geraten, die obere dagegen gibt eine richtigere Vorstellung von den Farben des Originals. Nach den höchst phantastischen Stilisierungen eines Pantherkopfes, der das Zentrum der beiden Muster bildet, heissen diese tāp kule̱ (Panthermuster). Um diese Formen zu begreifen, müssen wir sie mit dem kọho̱ng le̥djọ von b auf Tafel 70 vergleichen. Bei der in der Mitte dieses Musters vorkommenden Maske sind die Augen deutlich mit roten Kreisen begrenzt, in der Maske im Mittelstück von Fig. a auf Tafel 72 sind sie mit blauen und roten Perlen bezeichnet, die zwei dicke, eckige, nach aussen offene Bögen im braunen Grunde bilden. Im kọho̱ng le̥djọ ist die Nase durch zwei weisse, in Schnörkel auslaufende Linien angedeutet, in Fig. a durch die nach aussen und unten gerichteten schwarzen, dünnen Linien, die sich ebenso unten am Rand nach innen umbiegen, wo die schwarzen Schnörkel mit mehreren Strahlen versehen sind. Die beiden in schwarz oben auf dem kọho̱ng le̥djọ als Verzierung vorkommenden Schnörkel sind auch in dieser Maske zu finden, doch sind sie hier rot und nach aussen statt nach innen gerichtet.
Neben diesem Hauptmotiv kommen auch noch zwei Seitenstücke an jeder tāp vor, die wahrscheinlich ebenfalls eine Bedeutung haben. Beachtung verdient das schöne Hervortreten dieser Stücke infolge der schwarzen Farbe, die von diesen Stämmen häufig als Hintergrund oder besser zur Trennung der verschiedenen Figuren angewandt wird. Diese richtig empfundene Farbenkombination hat bei a einen malerischen Effekt zustande gebracht.

Zwei lāwong ăpăng, Frauenmützen der Mahakam-Kajan.
[276]
Die tāp hăwăt b auf derselben Tafel 72 zeigt den gleichen Entwurf aber in steiferen Formen und in einer Umrahmung, die gut mit ihm übereinstimmt. Das Mittelstück bei 1 und die beiden Seitenstücke bei 2 sind deutlich erkennbar, nur sind sie hier sowohl oben als unten verlängert und in den Unterteilen anders geformt. Hierdurch ist die Komposition erweitert worden, ohne dass jedoch der allgemeine Charakter dabei verloren gegangen wäre, und aus einigem Abstand erscheint auch die Einheitlichkeit nicht beeinträchtigt. Dies ist wohl hauptsächlich wieder der Übereinstimmung der Formen und Farben zuzuschreiben, die auf dem auch hier reichlich verwendeten schwarzen Untergrund schön hervortreten. Obgleich in der Farbenharmonie durch das zu starke Vorherrschen des Gelbgrün an Stelle des dunklen Gelb im Original eine grössere Eintönigkeit verursacht wird, ist sie doch auch in dieser Wiedergabe nicht zu verkennen.
Eine andere Stilisierung des kọhong le̥djọ kommt auf der in Fig. b auf Tafel 74 abgebildeten Mütze vor. Diese ist mit einem Rand von 4 Fächern umgeben, mit dem kọho̱ng le̥djọ als Mittelstück und zwei Seitenstücken. Hier kann in der Tat nur der Name zur Erkennung des Motivs im Mittelstück leiten, in dem nur die Augen als rote Bögen auf grünem Grunde erkennbar sind. Wahrscheinlich stellen die kleinen, aufwärts gerichteten gelben Schnörkel des Mittelstücks die Nasenlöcher vor, da sie zu den Augen in besserem Raumverhältnis stehen als die grossen, abwärts gerichteten Bögen.

Perlenverzierungen für Mützen.
Wenn wir auf einen anderen Teil in der am besten zu erkennenden Maske des le̥djọ auf Tafel 70 achten, dann sehen wir, dass dort in gelb unter den Nasenlöchern ein Mund mit roten Lippen angebracht ist. Auf allen Patronen mit einem kọho̱ng le̥djọ oder kọho̱ng kule̱ finden wir einen mit diesem Munde übereinstimmenden Teil wieder, ausser in a auf Tafel 72, wo die Figur dicht unterhalb der Nasenlöcher aufhört. So sehen wir mitten in dem Unterrand von b auf Tafel 72 einen schwarzen Schnörkel in gelbem Felde, von braun eingefasst, der sicher mit dem Mund in dem schwarzen le̥djọ-Kopf zu vergleichen ist. In dem ganz anders stilisierten Kopf b auf Tafel 74 ist dieser Teil ebenfalls vorhanden in Form eines roten, leicht nach oben gekrümmten Flecks auf dunkelgrünem Grunde, der von unten durch zwei rote, einen Winkel bildende Linien umgeben ist. Für diese Annahme spricht ferner, dass diese Teile auch auf den beiden Mützenpatronen (tāp lawo̱ng) von Tafel 73 nicht fehlen. Dreht man [277] sie um, so sind diese auf den ersten Blick so völlig verschieden aussehenden Muster nicht anderes als der eigentliche kọho̱ng le̥djọ, aber auf besondere Weise stilisiert und in anderen Farben ausgeführt. Man bringt diese Muster verkehrt auf den Mützen an, weil der breitere Teil der Augen in dem breiteren Teil des Musters, also unten liegen muss.
In a auf Tafel 73 werden die Augen durch rote, fragezeichenförmige Schnörkel auf grünem Grunde dargestellt, während die Nasenlöcher hier als schwarze Spiralen auf blauem Grunde, die links und rechts etwas unter der halben Höhe vorkommen, angegeben sind. Unten in der Mitte finden wir denselben schwarzen Doppelschnörkel auf gelbem Grund, der auch bei b auf Tafel 72 den Mund darstellt.
In b auf Tafel 73 sind die Augen in derselben Form eines Fragezeichens aber in braun auf blauem Grund ausgeführt, während rote Punkte auf diesen Schnörkeln vielleicht die Pupillen vorstellen sollen, möglicherweise sind sie aber auch nur zur Belebung des Musters angebracht. Die Nasenlöcher sind hier von zwei Paar gegeneinander laufenden schwarzen Spiralen umgrenzt, wobei zu beachten ist, dass die schwarzen, haarförmigen Vorsprünge auf den innersten Spiralen besonders dick angebracht sind. Diese Vorsprünge können als Charakteristikum für die Nasenspiralen in diesem Muster betrachtet werden, da sie auf allen Mustern der Tafeln 72, 73 und 74 vorkommen.
Der untere Mittelteil der Maske wird hier auch von einem stilisierten Mund in Form eines schwarzen Rahmens eingenommen, der von blau umgeben und mit braunen und roten Punkten gefüllt ist.
Also auch in diesen beiden tāp lawo̱ng fehlen die für einen kọho̱ng le̥djọ oder kule̱ charakteristischen Teile nicht. Der hübsche Eindruck, den die Frauen durch Nebeneinandersetzen greller Farben hervorzurufen gewusst haben, fällt hier besonders auf. Die mit Verständnis angebrachten schwarzen Linien haben sicher dazu beigetragen, diesen Eindruck, von einigem Abstand aus, zu erhöhen.
Vergleicht man b auf Tafel 75 mit a auf Tafel 73, so ist eine allgemeine Übereinstimmung zwischen beiden nicht zu verkennen; ferner sind auch die einander entsprechenden charakteristischen “Feile der Maske zu unterscheiden. Die hellroten und schwarzen Spiralen auf gelbem Grunde würden hier die Augen, und die hellbraunen Spiralen auf grünem Grunde, an denen auch eine haarförmige Verlängerung nach unten nicht fehlt, die Nasenlöcher vorstellen. Auch hier ist in rot ein Doppelschnörkel [278] in der Mitte als Mundteil angegeben. Bei diesem Muster tritt deutlich zu Tage, dass das ursprüngliche Motiv nur einen sehr entfernten Einfluss auf die Komposition geübt haben kann. Der Künstler, der die Formen schnitt, und die Künstlerin, die die Farben wählte, haben sich in der Tat viel eher von ihrem Formen- und Farbensinn leiten lassen als von der Erwägung, dass sie die Maske eines mythischen oder irdischen Tigers darzustellen hatten. Beweisend hierfür ist auch, dass auch b auf Tafel 74 einen solchen kọho̱ng le̥djọ darstellt. Doch ist ein allgemeiner Charakterzug bei den zuletzt behandelten Mustern nicht zu verkennen, besonders wenn man mit diesen die tāp lawo̱ng a auf Tafel 74 vergleicht, die das Naga-Motiv trägt.
Von einer anderen Form als die bisher behandelten Muster der Frauenmützen ist die unter a Tafel 75 abgebildete Perlenarbeit, die einen Schmuck für Männermützen darstellt. Dieses Muster hat die Frau des Häuptlings der Kajan am Ikang gearbeitet, des Nachfolgers von Kwing Irang nach dessen Tode. Der Entwurf ist hier ein völlig anderer als bei der tāp kọho̱ng le̥djọ oder der tāp naga. Da der Name des Entwurfs mir unbekannt ist, wage ich nicht, eine sichere Ableitung dieser Musterformen zu geben. Den einzigen Anhaltspunkt könnten die mit haarförmigen Vorsprüngen versehenen schwarzen Spiralen auf gelbem Grunde bieten, welche die beiden Nasenlöcher eines le̥djọ oder kule̱ vorstellen könnten, wobei dann die darüber und aussen gelegenen schwarzen, eckigen Spiralen als Augen anzusehen wären. In wieweit dies richtig ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Perlenverzierungen für Mützen.
Aus den vorhergehenden Ausführungen ergeben sich zum Schluss die folgenden zusammenfassenden Bemerkungen über die künstlerische Anlage und Eigenart bei den dajakischen Stämmen und Individuen. Eine bemerkenswert kleine, meist der Tierwelt entlehnte Anzahl von Motiven dient den Bahau- und Kĕnjadajak zur Komposition fast aller ihrer Ornamente. Wir finden bei ihnen die vom Menschen abgeleiteten Motive ebensogut in den Perlenmustern ihrer Kindertragbretter als in ihren Tätowiermustern, den Bildhauerarbeiten an ihren Häusern, ihren Schwertgriffen, Schwertscheiden und Bambusbüchsen. Dasselbe gilt für ihre Tiermotive, wie den aso̱ und rimau, den Rhinozerosvogel, Blutegel etc. Vergleichen wir diese Erscheinungen mit denjenigen, die uns unter den Kunstprodukten anderer Völker begegnen, so lässt sich nicht leugnen, dass die Erzeugnisse der Bahau-Dajak eine gewisse Armut an [279] Motiven verraten; ebenso auffallend ist es, dass bei dem sehr ausgesprochenen Sinn für Form und Farbe, von dem ihre Kunstgegenstände zeugen, eine Zeichen-, Mal- oder Bildhauerkunst, also eine Kunst, die um ihrer selbst willen geübt wird, sich nicht entwickelt hat. Mit der Annahme, diese eigentümliche Erscheinung hänge mit einer beschränkten künstlerischen Schöpfungskraft zusammen, stehen jedoch wieder andere Tatsachen in Widerspruch. Vor allem ist ihr Schöpfungsvermögen auf bestimmten Gebieten, wo die sozialen Verhältnisse zu einer weiteren Entwicklung anspornen, ein sehr reiches, so z.B. in der Tätowierkunst. Hierfür spricht bereits, dass die meisten Individuen, obgleich mit denselben Motiven, doch verschieden tätowiert sind und jedes für sich eigene Muster hat schneiden müssen oder schneiden lassen. Böte das Entwerfen neuer Figuren Schwierigkeiten, so hätte diese Sitte nicht entstehen können.
Ein Beweis für den Reichtum der Variationen, die ein und dasselbe Motiv liefern kann, ist, dass unter den relativ wenigen Tätowierpatronen, die ich mitbrachte und nur zufällig erlangte, von den 6 Stilisierungen des Motivs ke̥rip mano̱k kwẹ (5 auf Tafel 90 Teil I und eine in der Schenkeltätowierung Tafel 86) alle verschieden sind. Auch die 4 Schlussstücke a, b, c und d auf Tafel 91 steilen ebensoviele Variationen des gleichen Motivs dar, und zweifellos bestehen in Wirklichkeit noch fast ebensoviele andere, als Individuen in den Stämmen sind oder gewesen sind. Auch entwickelt sich bei jeder Stammgruppe ein eigener Stil aus denselben Motiven, so dass ein Stil der Kapuas-Bahau, der Long-Glat, der Uma-Luhat, der Kĕnja und der vielen anderen Stämme von den Dajak selbst unterschieden wird und der Hauptsache nach auch für Europäer unterscheidbar ist. Dasselbe gilt in bezug auf die Zeugfiguren der Kleiderverzierung, die Bambusschnitzerei und sogar die Schnitzerei von Horngriffen, trotzdem dieser durch die Beschaffenheit des Materials engere Grenzen gesteckt sind.
Von nicht geringem Einfluss auf die Wahl der Motive sind bei den Bahau, wie wir gesehen haben, ihre religiösen Vorstellungen. In ihren Ornamenten und in den Gegenständen selbst, welche diese tragen, spiegelt sich ihr Glaube an die Geister wieder. Die schönen Bildhauerarbeiten an ihren Häusern, auf ihren Gräbern, zahlreiche Verzierungen auf ihren Kindertragbrettern, Schilden, Schwertern u.s.w. danken ihr Entstehen dem Bestreben der Dajak, sich vor den bösen Geistern zu [280] schützen. Hat die Kunstentwicklung einmal diesen Weg eingeschlagen, so wendet sie sich ohne besonderen Anlass nicht mehr neuen, willkürlich gewählten Motiven zu, wie wenn sie sich gänzlich frei bewegt hätte. Bei einem Volke auf diesem Bildungsstandpunkt beherrscht der Glaube noch in so hohem Grade das ganze Dasein, dass auch der Künstler Motive wählt, die in diesem Glauben eine Hauptrolle spielen.
Für den relativ hohen Standpunkt, den die Kunst bei diesen Bahau und Kĕnja trotz deren ungünstigen Lebensumständen einnimmt, spricht die Art, wie sie die ursprünglichen Motive in ihrer Ornamentik verwenden. Bei einem grossen Teil der gegenwärtig erzeugten Kunstprodukte sind diese Motive, wie wir gesehen haben, so sehr umgestaltet, dass man nur durch eine sorgsame Vergleichung der Übergänge den Ursprung gewisser Figuren aus bestimmten Motiven erkennen kann. Unter den Stämmen selbst ist dieser Ursprung auch durchaus nicht mehr bei allen Figuren bekannt, sondern nur wenige tragen noch die ursprünglichen Namen. Gegenwärtig rechnet ein Künstler denn auch beim Entwerfen weit mehr mit den umgebildeten Motiven, die er auf bestimmten Gegenständen zu sehen gewöhnt ist, als mit den Formen, die diese Motive in Wirklichkeit tragen.
In bezug auf die künstlerische Anlage beim einzelnen Individuum macht sich bei der Vergleichung der Produkte von beginnenden und von bereits hochentwickelten Künstlern der Unterschied geltend, dass es ersteren anfangs leichter fällt, beim Entwerfen eines Ornaments Variationen eines Motivs anzubringen, als sich selbst zu strenger Durchführung des betreffenden Motivs zu zwingen; je mehr Talent und Übung in der Komposition ein Künstler dagegen besitzt, desto genauer wird er sich an sein Motiv zu halten wissen. So stammt die Handtätowierung a von Tafel 85 Teil I zweifellos von einem geübten und begabten Künstler, da die ursprünglichen Motive, die in der Tätowierung b vorkommen, hier schön stilisiert sind und das früher bereits behandelte Motiv streng angewandt und durchgeführt ist. Zugleich sind auch die Tätowierbrettchen oder anderen Produkte eines talentvollen und geübten Künstlers viel gleichmässiger und sauberer in den Linien geschnitzt als die eines Anfängers. Das in bezug auf die Durchführung des Motivs Gesagte gilt auch für die Beobachtung der Symmetrie: nur diejenigen, die einen Ruf als Künstler geniessen, halten sich genau an eine symmetrische Verteilung ihrer Verzierungen, insoweit sie hierfür Symmetrie überhaupt anzuwenden [281] gedachten. Dass eine exakte Durchführung der Symmetrie den Bahaukünstlern jedoch schwer fällt, lässt sich aus der relativ kleinen Anzahl wirklich symmetrischer Tätowierpatronen und anderer Muster, denen man begegnet, schliessen. Wie leicht die übrigens oft nur flüchtig geschnitzten Gegenstände asymmetrisch werden, geht deutlich aus Fig. e auf Tafel 91 Teil I hervor, die sicher von einem sehr talentvollen Mann entworfen sein muss und vor manchem sehr geschätzten europäischen Ornament nicht zurückzustehen braucht. Hier ist es dem Schnitzkünstler offenbar nicht geglückt, oder er hat es nicht der Mühe wert gehalten, die Symmetrie zu wahren, und so ist die rechte Hälfte viel schmäler geraten als die linke. Eine strenge Wahrung des Motivs und der Symmetrie im Kunstwerk bedeutet daher bei den Bahau und Kĕnja einen hohen Entwicklungsstandpunkt des Künstlers.
Was den Kunstgeschmack dieser dajakischen Stämme betrifft, so zeigt er eine eigentümliche Begrenztheit in der Fähigkeit, Produkte einer anderen Geistessphäre zu beurteilen. Während nämlich ihre eigenen Kunsterzeugnisse, wie wir sahen, von einem so hochausgebildeten Sinn für Form und Farbe zeugen, schätzen sie auch die aus Europa oder anders woher bei ihnen eingeführten Produkte, die für sie den Reiz des Aussergewöhnlichen haben, in Wirklichkeit aber unschön in Form und Farbe sind, und stellen aus diesem fremden Material Dinge her, die einen äusserst schlechten Geschmack bekunden.
Dieselben Frauen z.B., die sich mit grossem Opfer an Zeit und viel Kunstfertigkeit auf die Herstellung mit Stickereien und ausgeschnittenen Figuren verzierter Röcke legen, tragen andere, die aus verschiedenen Arten von eingeführtem geblümtem Kattun auf die unvorteilhafteste Weise zusammengesetzt sind. Auf anderen Gebieten tritt diese Erscheinung weniger hervor, weil die eingeführten Produkte, wie Eisen und Töpfe, besser sind als die eigenen Erzeugnisse.
Dass dieses Verhalten der Dajak die Entartung der Frauenarbeit befördert, ist selbstverständlich, es wirft aber auch ein interessantes Licht auf eine besondere Eigenschaft des bei den Bahau so stark ausgebildeten Formen- und Farbensinnes. Dieser hat sich ursprünglich bei jenen Stämmen unter dem Einfluss der sozialen Verhältnisse und der isolierten Lage in der für ihre Kunst charakteristischen Weise entwickelt, und sie waren deshalb gewöhnt, nur diese Kunst und deren Produkte zu sehen und zu beurteilen. Die eingeführten geschmacklosen Erzeugnisse einer anderen Kultur, die einen gänzlich anderen Charakter [282] tragen, sind ihnen dagegen so fremd und liegen so völlig ausserhalb ihrer engeren Sphäre, dass sie dieselben vom Standpunkt der ihnen eigenen psychischen Entwickelung aus nicht beurteilen können. Zwar üben diese fremden Erzeugnisse auf das Auge eines Bahau oder Kĕnja einen besonderen Reiz, doch sind sie von seinen eigenen Kunstgegenständen in Form und Farbe zu weit entfernt, um bei ihm in demselben Masse wie bei einem Europäer Anstoss zu erregen. Sie bewundern deshalb diese billigen Produkte eines schlechten europäischen Geschmackes und werden von ihnen nicht so unangenehm berührt, wie der mit einem ähnlichen Kunstgefühle ausgestattete Europäer, der aber gewöhnt ist, dieses Gefühl verschiedenartigeren Dingen aus einem weit grösseren Herkunftsgebiete anzupassen. Jener unter beschränkten Verhältnissen entstandene, staunenswert feine Sinn für Form und Farbe zeigt bei diesen Naturmenschen also dieselbe Begrenztheit, welche den anderen geistigen Fähigkeiten des Menschen eigen ist. Auch diese sind auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und gestatten ihm nicht, ausserhalb desselben Kritik zu üben.
In wie weit bei der Entwicklung der dajakischen Ornamentik fremde Einflüsse mitgewirkt haben, ist eine Frage, zu deren Lösung sicherlich eine Untersuchung der Erzeugnisse der gegenwärtigen Nachbarvölker beitragen würde. Die Gruppen der Dajak, die nicht zu den Bahau oder Kĕnja gehören, zeichnen sich ebenfalls im Gebiete der Kunst aus, doch hat diese bei ihnen, infolge der Abgeschiedenheit, in der sie leben, eine für sie charakteristische Richtung eingeschlagen.
Die malaiischen Küstenstämme dagegen, welche die Dajak von allen Seiten umringen, besitzen keine Anlage, die auch nur auf eine geringe Entwicklung des Kunstgefühls oder der Kunstfertigkeit weisen würde. Da überdies infolge der Berührung mit den Malaien die ganze Kultur der Dajak und zugleich ihr Kunstempfinden stark entartet sind, so dass die noch ursprünglichen Stämme im Zentrum von einem Kreise in jeder Beziehung zurückgegangener Stämme umgeben sind, erscheint es sicher, dass jene Malaien weder der Anlage noch der Entwicklung der dajakischen Kunst förderlich gewesen sind.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass in früheren Jahrhunderten, als sowohl Hindu-Javaner als Chinesen aus China viel auf Borneo verkehrten (pag. 61) und teilweise tief ins Innere vordrangen, wovon die Hinduüberreste am Mahakam bis unterhalb der Wasserfälle noch Zeugnis ablegen, diese Fremden auf den Entwicklungsgang der Stämme und dabei auch [283] auf einige gegenwärtig gebräuchliche Kunstmotive Einfluss ausgeübt haben. Der Name Naga, der von den Hindu stammt und der rimau, der auf Borneo nicht vorkommende Königstiger, deuten bereits auf derartige fremde Einflüsse hin. Auch die von den Küsten bis in das tiefste Innere eingeführten fremden Industrieerzeugnisse, unter anderem die tempajan, können die Entstehung solcher Motive veranlasst haben. Wie weit der fremde Einfluss in den früheren Jahrhunderten reichte, kann jetzt nicht mehr festgestellt werden, doch ist es gewiss, dass die jetzigen Erzeugnisse der Dajak als Äusserungen deren eigener Anlage und eigener Fertigkeit gelten müssen, wenn auch bisweilen, wie bei den Perlenarbeiten, fremde Stoffe verwendet werden.
Öfters ist bereits darauf hingewiesen worden, dass sich die Kunst der Bahau- und Kĕnjastämme von der der anderen Gruppen der ackerbautreibenden Dajak unterscheidet. Am deutlichsten ist dieser Unterschied in ihren Industrieprodukten zu merken. Die schön geschnitzten Hirschhorngriffe werden z.B. nur von den Bahau und Kĕnja hergestellt; die Ot-Danumgruppe ahmt diese Arbeiten nur in sehr mangelhafter Weise nach, während die Batang-Lupar Griffe von ganz anderer Form und weit minderwertigerer Arbeit gebrauchen. Die so bekannten, mit farbigen Masken und Tierfiguren bemalten langen Schilde werden ebenfalls alle, mit Ausnahme schlechter Imitationen, von diesen Bahau- und Kĕnjastämmen hergestellt. Übrigens gebrauchen auch nur diese Stämme im Kriege diese hohen Schilde. Ursprünglich waren bei den mehr westlich wohnenden Batang-Luparstämmen viel kleinere Schilde von anderer Form im Gebrauch, ebenso bei den Baritostämmen. Die Nomadenstämme von Ost-Borneo dagegen haben die Schildform der Bahau angenommen.
Die Perlenarbeiten der zu den Batang-Luparstämmen gehörenden Kantuk- Taman- und Embalau-Dajak tragen zwar einen ganz anderen Charakter als die der Bahau und Kĕnja, doch stehen sie jenen in bezug auf Formen- und Farbenreichtum keineswegs nach. Im Weben, vor allem in der ikat-Weberei, können sich die Bahau durchaus nicht mit ihren westlichen Nachbarn messen, die in ihren dunkel-, hellbraun und schwarz gewebten Decken (kumbu), Röcken und Jacken wahre Prachtstücke an Entwurf und Technik liefern. Eigentümlich dagegen ist, dass die Stickereien und die farbigen Knüpfarbeiten der Frauen am Mahakam bei den anderen beiden Gruppen nicht angetroffen werden. Im allgemeinen lässt sich in der Entwicklung der dajakischen Kunst [284] nicht nur ein Stillstand, sondern sogar ein Rückschritt beobachten. Schuld hieran trägt ausser der Einfuhr europäischer Erzeugnisse auch das Klima. Durch ihre Auswanderung aus dem gesunden Hochland Apu Kajan in die tiefer gelegenen Gegenden am Mahakam gerieten die Bahau in höherem Masse unter die Wirkung der Malaria und wurden dadurch geistig und körperlich so geschwächt, dass auch ihre Leistungen im Kunsthandwerk in Mitleidenschaft gezogen wurden. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass die Kĕnja, die ihr gesundes Bergland nicht verlassen haben, in ihren Kunstleistungen die Bahau übertreffen und dass die aus früheren Zeiten stammenden Produkte der letzteren von den gegenwärtigen nicht erreicht werden. Augenblicklich leisten die Kĕnja im Stammland Apu Kajan das Höchste im Kunstgewerbe, ihnen folgen die Stämme am oberen Mahakam, während diejenigen am mittleren Mahakam und am Kapuas weit hinter den Leistungen ihrer Vorfahren zurückgeblieben sind. [285]
1 Nach einer Pantherjagd und beim melo̱ njaho̱ werden die Schwerter wie auch die Menschen einer Me̥lă unterworfen.
Kapitel X.
In Long Dĕho—Auseinandersetzungen mit Bang Jok—Begegnung mit den Kĕnja-Dajak unter Taman Ulow—Missstände im Dorfe—Zusammenkunft mit dem Kĕnja-Häuptling Taman Dau—Ankunft Demmenis und Kwing Irangs am 3. April—Neue Beratungen über die Reise—Einverständnis der Häuptlinge mit dem Zuge nach Apu Kajan—Bo Adjang Lĕdjüs Tod und Beisetzung—Wahl und Vorbereitung eines Lagerplatzes am Boh—Widersetzlichkeiten seitens des Personals—Neue Hindernisse durch die Kajan—Midans Rückkehr von der Küste—Aufbruch zum Boh am 17. Mai.
Die ersten Tage meines Aufenthaltes in Long Dĕho führten bereits zu einigen Unterredungen mit Bang Jok, in denen ich anfangs, der guten Sitte gemäss, nur für ihn und seine Familienverhältnisse Interesse zeigte, dann aber deutlich zu verstehen gab, dass ich meine vielen Reiseschwierigkeiten und die Angst der Stämme oberhalb der Wasserfälle seinem hinterlistigen Treiben zuschrieb; ausserdem suchte ich ihn von der wahren Stellung des Sultans von Kutei und der Wahrscheinlichkeit einer Einsetzung eines Kontrolleurs in Long Iram zu überzeugen.
Bang Jok fand zum Nachdenken über das Gesagte noch kaum Zeit, als 8 Kĕnja vom Stamme Uma-Djalān vom Boh aus angefahren kamen und in Long Dĕho anlegten. Unter ihrem Anführer Taman Ulow befanden sie sich seit 3 Monaten auf Reisen nach dem Mahakam, um dort zwei Stammesgenossen zu suchen, die bei einer früheren Gelegenheit am mittleren Mahakam zurückgeblieben waren.
Nach Vereinbarung mit Bang Jok erklärte ich diesen Männern, die als gereiste Leute gut Busang sprachen, dass die Bevölkerung weiter unten wegen der von Taman Dau geübten Mordtaten den Kĕnja sehr feindlich gesinnt sei und sie daher alle, waren sie auch von einem anderen Stamme, bei ihr grosse Gefahr liefen. Innerlich war ich sehr erfreut, diese Leute einige Zeit aufhalten zu können, um sie an uns Europäer zu gewöhnen und von ihnen endlich zuverlässige und ausführliche Auskunft über Apu Kajan zu erhalten.

Kĕhad Njangoen, 17-jähriges Kajanmädchen.
[286]
Da sie stark an Reismangel litten, bot ich sogleich an, sie zu beköstigen; auch gelang es mir, einige von ihnen vom Fieber zu kurieren, wonach Taman Ulow sofort Vertrauen zu mir fasste und mit seinen Mitteilungen nicht sparte. Nach seinem Bericht war Bui Djalong erst vor kurzem von einer Reise ins englische Gebiet zurückgekehrt, wohin er sich mit vielen anderen Häuptlingen und 1200 Mann begeben hatte, um einem Ruf des Radja nachzukommen. Nach Bui Djalongs Heimkehr war dessen Tochter Kuling gestorben, um die er noch mit dem Stamme trauerte. Aus allem ging hervor, dass ich in den verflossenen Monaten zu ungelegener Zeit nach Apu Kajan gekommen wäre, ein Trost für mich, keine gute Gelegenheit verpasst zu haben. Die ferneren Berichte der Kĕnja spornten mich noch mehr zur Durchsetzung meines Plans an. Ich hatte nämlich bereits zu Beginn meiner Reise 1898 gelesen, dass man sich in Sĕrawak bemühte, mit den Bewohnern von Apu Kajan in Berührung zu kommen, und dass der Resident des Baramdistrikts, Dr. Hose, schon damals prophezeit hatte, er werde zwei Jahre brauchen, um die Häuptlinge des niederländischen Gebiets zu einer Zusammenkunft auf englischem Boden zu bewegen. Es sprach sehr für Dr. Hose’s Kenntnis der Menschen und Verhältnisse, dass die betreffenden Häuptlinge in der Tat zwei Jahre darauf, wenn auch nach langem Zögern, hinübergekommen waren. In einer Versammlung zu Claudetown waren Bui Djalong mit Gefolge dazu gebracht worden, sich durch einen Regierungsdampfer nach Kutjing vor den Radja bringen zu lassen; mit den im Range niedriger stehenden Häuptlingen, die mit ihrem Gefolge ebenfalls einer gleichzeitigen Einladung gefolgt waren, geschah dies nicht. In Kutjing hatte der Radja Bui Djalong vorgeschlagen, mit seinem ganzen Stamm auf englisches Gebiet überzusiedeln, worauf der Häuptling jedoch nicht eingegangen war. Diese Vorgänge überzeugten mich doppelt stark von der Notwendigkeit einer Reise zu den Kĕnja, um durch persönliche Berührung mit deren Stämmen den Erfolg späterer Bemühungen von Sĕrawakischer Seite zu vereiteln.
Alle beunruhigenden Gerüchte über Rachezüge, welche die Kĕnja ins Mahakamgebiet unternommen haben sollten, erwiesen sich als aus der Luft gegriffen; die Reise Taman Daus stand damit in keinem Zusammenhang, und von Bui Djalong war nur ein anderer tüchtiger Häuptling der Uma-Bom, Taman Li, zu den Kĕnja an den Tawang geschickt worden, um wegen der Busse für seinen ermordeten Enkel zu unterhandeln. [287]
Ich hatte nun keine Ursache mehr, mich selbst zu den Kĕnja von Taman Dau unterhalb der Wasserfälle zu begeben, und beschloss daher, um so schnell als möglich Nachrichten und Geld von Batavia und der Küste zu erhalten, meinen Diener Midan mit einigen Malaien den Fluss hinunter zu schicken, mit dem Auftrag, möglichst bald zurückzukehren. Midan hatte sich in den 3 Jahren, in denen wir zusammen reisten, ganz an das Leben der Dajak gewöhnt, trug im Walde und auf dem Flusse gern ihre Kleidung, ruderte und steuerte die Böte und verstand mit den Dajak sehr gut umzugehen. Über Ehrlichkeit hatte er zwar seine eigenen Ansichten, doch war er mir durch seine Energie und seinen Mut sehr viel wert; auch jetzt zeigte er sich, trotz der beunruhigenden Zustände am mittleren Mahakam, zur Reise bereit. Sobald der Wasserstand es zuliess, half mein ganzes Geleite von Malaien Midan mit seinem Boote über den Kiham Udang. Midan nahm einen Teil unserer neu angelegten Sammlungen von Vögeln und Ethnographica mit zur Küste und kehrte zwei Monate später nach erfolgreicher Reise zurück.
Bald nach unserer Ankunft in Long Dĕho hatten die Long-Glat, die mit mir gereist waren, meine Malaien und ich an Influenza zu leiden angefangen. Auch im Jahre 1897 waren wir, damals aber in Udju Tĕpu, an dieser Epidemie erkrankt. Bei vielen trat noch eine schwere Malaria hinzu, so dass die Long-Glat aus Long Tĕpai, die unter diesen Umständen schnell heimkehren wollten, sich nur durch den fortwährend hohen Wasserstand zurückhalten liessen. Nach Aussagen der Bevölkerung war die Krankheit wahrscheinlich durch einige Böte mit Ma-Suling von der Küste eingeschleppt worden.
Der alte Häuptling Bo Adjang Lĕdjü war, augenscheinlich auch infolge der Influenza, während meiner Abwesenheit körperlich sehr heruntergekommen. Chronisches Fieber, Husten und Appetitlosigkeit hatten den 90 jährigen Mann so geschwächt, dass er kaum noch auf der Matratze sitzen konnte. Trotz aller meiner Bemühungen, ihn wieder herzustellen, wollten Schwäche und Apathie nicht weichen, was mich ernsthaft besorgt um ihn machte.
Der Aufenthalt in Long Dĕho wurde mir, ausser durch die Influenza noch dadurch sehr unangenehm, dass auch jetzt wieder Händler und Waldproduktensucher von den verschiedensten Stämmen Borneos, die mehr auf ihr Glück im Spiel als auf ihre Arbeitsleistung rechneten, durch ihre Leidenschaft für Hazardspiel und Hahnenkämpfe viel Unruhe in das Dorfleben brachten. [288]
Zum Glück tranken diese Leute keine Alkoholika, sonst wären sie noch gefährlicher geworden. Zu welchen Schandtaten sie imstande waren, erfuhr ich in einer sehr dunklen Nacht, als bei Hochwasser das Rotangtau durchschnitten wurde, an dem ein Handelsboot befestigt war, in dem 6 Personen schliefen. Die Insassen wurden vor einem sicheren Tode in den Wasserfällen weiter unten nur dadurch gerettet, dass ein zweites Rotangtau bei dem hohen Wasserstande zu tief unter der Oberfläche lag, um erreicht werden zu können. Ein auf der Flucht begriffener Sklave hatte die Tat aus Rache gegen seinen buginesischen Herrn, der sich im Boote befand, begangen.
An das harmlose Leben der Stämme oberhalb der Wasserfälle gewöhnt, erregte die Spielhölle, zu der Bang Jok seine Familienwohnung erniedrigt hatte, in hohem Masse unseren Widerwillen. Ich teilte ihm daher mit, dass ich sein Haus nach dem ersten Besuch nicht mehr betreten wolle; mit seinen Stammesgenossen und den Bewohnern von Bo Adjang Lĕdjüs amin blieb ich dagegen in ständigem Verkehr.
Das Haus, das man uns in Long Dĕho zur Verfügung gestellt hatte, war das schlechteste, das wir seit langer Zeit bewohnten. In dem baufälligen Gebäude, das für Fremde und Versammlungen bestimmt war und daher von den anderen Häusern getrennt stand, konnten wir uns nur notdürftig vor Nässe schützen. Eine andere Unannehmlichkeit bildete die Sorge für die Beköstigung unserer grossen Gesellschaft während dieses langen Aufenthalts. Unser eigener Reisvorrat musste so gross bleiben, dass wir jeden Tag eine einmonatliche Reise nach Apu Kajan antreten konnten, dabei herrschte aber im Dorfe wieder so grosser Nahrungsmangel, dass die Bevölkerung selbst von obi kaju (Manihot utilissima) lebte. Reis war nicht vorhanden, jedenfalls nicht käuflich, dazu verhinderte der hohe Wasserstand eine Zufuhr von der Küste. Nur einige Büchsen mit schlechten Sardinen und anderen Fischen, vor Alter weiss gewordene Butter, etwas Zucker, Petroleum und Tabak, von Samarinda eingeführt, hatte ich kaufen können. Bei den von den Long-Glat abhängigen, weiter unten wohnenden Batu-Pala und Uma-Wak waren wenigstens noch Hühner, Eier und Fische zu haben; aber unsere Dorfbewohner besassen selbst nur wenig Hühner, und an Fischen lieferte der Mahakam hier nicht viel, besonders nicht bei hohem Wasserstande, wo ein Fischen mit Netzen unmöglich war. So bildeten denn Früchte oft unsere einzige Zuspeise zum Reis, auch sandte ich, so oft es ging, kleine Expeditionen nach Long Tĕpai, um Reis aufzutreiben. [289]
Am selben Tage, an dem Midan zur Küste fuhr, benützten auch zwei Böte mit Kĕnja den günstigen Wasserstand, um von unten aus die Wasserfälle zu passieren. Als ich mich daher am anderen Morgen zur Behandlung einiger seiner Leute zu Taman Ulow begab, fand ich die Kĕnjagesellschaft um eine bedeutende Anzahl Personen angewachsen, die meine Erscheinung anfangs viel scheuer betrachteten als die Kĕnja der Uma-Djalan selbst, die sich bereits an mich gewöhnt hatten. Nur zwei ältere Männer, augenscheinlich die Anführer, bewegten sich sehr unbefangen und berichteten mir bald auf Busang, dass sie möglichst bald nach Apu Kajan zurückkehren müssten und daher Taman Dau und die Seinen, die viel unter Krankheiten gelitten, unterhalb der Wasserfälle zurückgelassen hätten. Bereits am folgenden Tage wollten sie weiterreisen. Wie ich später hörte, hatten sie es deswegen so eilig, weil sie die am Medang erbeuteten Köpfe in ihren Böten mit nach Apu Kajan führten. Meiner Gewohnheit nach belästigte, ich die Fremden nicht zu lange mit meiner für sie ungewöhnlichen Erscheinung, sondern gab mir alle Mühe, ihnen von dem ersten Weissen, den sie wahrscheinlich gesehen hatten, einen günstigen Eindruck beizubringen, was mir denn auch, wie bei den Kĕnja Uma-Djalān, sehr bald glückte. Nur die jüngsten Männer blieben scheu und stumm, augenscheinlich beunruhigten sie die dicht in der Nähe versteckten Köpfe. Nachdem die Anführer mir noch versichert hatten, meinem Besuch in Apu Kajan stehe nichts im Wege, überliess ich sie den Uma-Djalān, von denen anzunehmen war, dass sie ihnen von mir und meinen Reisegefährten sicher viel erzählen würden. Bald darauf erschienen sie auch in meiner Hütte und baten um Arzneien und Tabak. Nachts lagerte die Kopfjägertruppe oberhalb Long Dĕho und fuhr dann am folgenden Morgen den Boh aufwärts.
Da ich mit Taman Ulow und dessen 8 Begleitern bereits auf so gutem Fuss stand, erschien es mir wünschenswert, dass sie in ihrer guten Meinung über uns Europäer durch eine Reise nach dem oberen Mahakam noch bestärkt wurden; bei den ihnen verwandten Stämmen konnten sie sich über unser Tun und Lassen besser unterrichten als hier in Long Dĕho. Dazu kam noch, dass die Kĕnja mir durch ihren urwüchsig grossen Appetit auf die Dauer ein kostspieliger Besuch wurden. Ihr Vorschlag, mit meinen Long-Glat nach Long-Tĕpai reisen und dort durch Rotangsuchen etwas verdienen zu wollen, fand daher sogleich meinen Beifall. Nachdem sie jetzt eine bessere Einsicht in [290] die Verhältnisse am mittleren Mahakam erhalten hatten, erschien es ihnen augenscheinlich auch selbst zu gefährlich, um dort ihre Stammesgenossen zu suchen. Ich hatte mir eine ernsthafte Unterredung mit Taman Dau vorgenommen; bei dem offenen Auftreten der Kĕnja glaubte ich diese auch durch Vermittlung Bang Joks oder einer der Häuptlinge aus Bo Adjang Lĕdjüs Hause stattfinden lassen zu können. Mit diesen stand ich wie immer auf sehr gutem Fuss, und obwohl Bang Jok sich mehr an Kartenspiel und Hahnenkämpfen als an unserer Gesellschaft gelegen sein liess, enthielt er sich jetzt doch seines früheren feindseligen Treibens, wenigstens berichteten mir meine Malaien, die täglich in der Niederlassung verkehrten, nichts dergleichen mehr.
Einige Kahajan-Dajak, die am 29. März von oben angefahren kamen, erzählten, dass Kwing Irang und die Seinen sich in Long Tĕpai befanden. Kwing war dort erst durch schlechte Vorzeichen aufgehalten worden, dann hatte er seinen ältesten Sohn Bang Awan abholen lassen und schliesslich, im Begriff abzufahren, hatte ihn der Tod eines kleinen Kindes noch 4 Tage Aufenthalt gekostet. Jedenfalls konnte ich ihn jetzt täglich in Long Dĕho erwarten und mit ihm Demmeni mit unserem ganzen Gepäck.
Bevor die Erwarteten eintrafen, erschien Taman Dau mit ungefähr 80 Mann Gefolge in Long Dĕho. Meinem Wunsche gemäss kam Bang Jok bald darauf mit der Meldung, dass er mir mittags mit den Kĕnja einen Besuch machen würde. Ich hatte mir in dem Glauben, dass meine Reise zu den Kĕnja wahrscheinlich doch nicht zustande kommen würde, vorgenommen, Taman Dau wenigstens deutlich auseinanderzusetzen, welche Absichten die niederländische Regierung mit der Einsetzung einer Verwaltung am Mahakam verfolge, und zu betonen; dass Kopfjagden, wie sie bisher bei den Kĕnja üblich gewesen, in Zukunft nicht mehr ungestraft stattfinden dürften. Hierbei konnte ich, als nützlichen Wink für Bang Jok, meine feste Überzeugung aussprechen, dass ein Kontrolleur in der Tat kommen werde.
Nach dem Mittagsmahl begann sich unsere Galerie zuerst mit allen fremden Elementen, die sich in Long Dĕho aufhielten, zu füllen; dann kam Bang Jok mit einigen der Ältesten, denen sich 20 neugierige Long-Glat angeschlossen hatten. Bang Jok hatte in Tengaron, ausser allerhand gefährlichen Liebhabereien, auch eine malaiische Feierlichkeit im Auftreten angenommen; er trug eine Hose aus gelber chinesischer Seide, eine dunkelviolette Jacke, ein seidenes Kopftuch und zur [291] Seite ein Schwert. Trotz dieses seltsamen Aufputzes und trotz der feindseligen Gesinnung und Verdorbenheit meines Gastes, von der ich mehr, als mir lieb war, erfahren hatte, konnte ich mich doch dem eigentümlichen Reiz, der von Bang Jok ausging, nicht entziehen. Er war ein Mann von etwa 35 Jahren, von langer, schlanker Gestalt und hellgelber Hautfarbe. Seine regelmässigen Gesichtszüge, seine lange, gerade Nase und sein welliges Haar bildeten einen scharfen Gegensatz zu den breiten, plattnasigen Gesichtern der übrigen Bahau. Aus seinen hellbraunen Augen sprach mehr Verstand als aus seinem Wesen, denn er bewegte sich und sprach langsam und ausdruckslos, wahrscheinlich weil er dies für fein hielt.
Einen ganz anderen Eindruck machte Taman Dau, der mit seinen Begleitern von der anderen Seite der ăwă eintrat. Auch er war etwa 35 Jahre alt, aber seine wohlgebaute, volle, geschmeidige Gestalt verriet den Mann der Tat, und sein Auftreten war, wie dasjenige seiner Landsleute, sehr sicher und unbefangen. Das Gefolge setzte sich in weitem Kreise um die Mitte, wo sich die beiden Häuptlinge mit gekreuzten Beinen niedergelassen hatten und wir drei Europäer auf unseren Klappstühlen sassen. Es fiel mir auf, dass nur wenige Kĕnja Warfen trugen.
Meine Malaien hatten für einen guten Empfang dieser auch in ihren Augen vornehmen Häuptlinge gesorgt und in der Mitte auf frischen Bananenblättern sowohl für diejenigen, die pinang und sirih kauten, als für die Kĕnja, die nur Zigaretten aus javanischem oder dajakischem Tabak mit einer Hülle von Blättern der wilden Banane rauchten, alles Erforderliche niedergelegt.
Nach Landessitte begann das Gespräch wiederum über allerhand uninteressante Dinge und nicht über das, was uns alle erfüllte. Taman Dau, der bereits bei dieser ersten Begegnung nichts weniger als zurückhaltend war, unterstützte Bang Jok eifrig in der Unterhaltung über Jagd und Fischfang, Erkrankung seines Gefolges, Schwierigkeiten beim Überschreiten der Wasserfälle und dergleichen. Darauf begann er, weniger politisch als Bang Jok, über die Unruhen am mittleren Mahakam und die dort ausgeführten Kopfjagden zu reden, die er auf Rechnung der Punan im Flussgebiet des Berau zu setzen versuchte. Bei dieser dreisten Lüge riss mir aber die Geduld und ich hielt den Augenblick für gekommen, um ihm den wahren Sachverhalt klar zu machen. Auf unzweideutige Weise gab ich ihm daher zu verstehen, [292] dass ich sowohl über die Kopfjagden am Tawang, an denen er die Hauptschuld trug, als über den Mord am Rata, an dein seine Stammesgenossen sich beteiligt hatten, und seine letzte Schandtat am Medang vollkommen orientiert war.
Während meines Ausfalls hatte die ganze Versammlung in stummem Staunen dagesessen; die eine Hälfte war erschreckt über eine derartige Sprache so grossen Häuptlingen gegenüber, die andere, Bang Jok und die Kĕnja, wussten augenscheinlich nicht, was sie gegen meine Beschuldigungen einwenden sollten. Einmal so weit gegangen und unter dem Eindruck der vielen Schwierigkeiten, die mir Bang Joks hinterlistige Handlungen verursacht hatten und die meine Reise nach Apu Kajan zu vereiteln drohten, wurde ich unvorsichtiger, als ich gewöhnlich zu sein pflegte, und zählte Taman Dau nicht nur seine Übeltaten auf, sondern warf ihm auch vor, dass er sich in den Augen der Europäer feige benommen habe, indem er sich von Häuptlingen, die selbst zu wenig Mut besassen, um ihre eigenen Zwistigkeiten auszukämpfen, als Jagdhund gebrauchen liess, erst durch Ibau Adjāng, jetzt durch Bang Jok. Diesen beschuldigte ich ausserdem, dass er zu verschiedenen früheren Kopfjagden angestachelt und den Zug der Punan und Uma-Bom im Juli an den Rata nicht verhindert habe. Dann versuchte ich ihnen den Unterschied zwischen ihrer Landessitte, in grosser Übermacht einzelne Personen heimtückisch zu überfallen, und der europäischen Kriegführung auf offenem Felde klar zu machen. Ich wollte noch hinzufügen, dass Bang Jok aus den Morden, die er auf des Sultans Befehl ausführen liess, seinen Vorteil zog, aber dein Häuptling wurde es bereits so heiss, dass er sich unter dem Vorwand, ein Bad nehmen zu wollen, entfernte und nicht mehr zurückkehrte.
In der Furcht; zu weit gegangen zu sein, schlug ich einen ruhigeren Ton an, so dass Taman Dau das Wort zu ergreifen wagte und erklärte, er und seine Kĕnja wären nur dumme Menschen und hätten noch nie derartige Anschauungen gehört. Da ich mich inzwischen etwas beruhigt hatte, war es mir angenehm, dass Taman Dau meine erste, etwas rauhe Begrüssung nicht schlimmer aufgefasst hatte und liess daher den Gegenstand fallen. Mit hübschem, geblümtem Kattun und javanischem Tabak suchte ich die Stimmung der Kĕnja noch weiter zu verbessern; sie blieben auch bis zum Einbruch der Dunkelheit bei mir und schienen mir meine Heftigkeit nicht mehr nachzutragen. Vor ihrer Abreise am anderen Morgen kamen sie noch, um sich von mir zu verabschieden. [293]
Zu meinem Leidwesen stieg das Wasser wieder so hoch, dass Demmeni und Kwing Irang unmöglich herunter kommen konnten; sie trafen erst am 3. April bei uns ein. Demmeni war von Long Tĕpai aus fünf Tage unterwegs gewesen, weil die Kajan sich bei den Wasserfällen gelagert hatten, um Wildschweine zu fangen. Diese Tiere ziehen nämlich in den ununterbrochenen Wäldern in grossen Herden von dem einen Ort, wo Früchte zu finden sind, nach dem andern und fallen, besonders wenn sie Flüsse passieren, den auf der Lauer liegenden Eingeborenen in die Hände. Während die Kajan mit Demmeni den Wasserfällen entlang zogen, waren die Schweine im Begriff gewesen, die Wasserfälle schwimmend zu durchqueren, wobei sie von der heftigen Strömung ein grosses Stück weit an ruhigere Stellen mitgerissen wurden, wo die Kajan sie abfingen. Selbst als das Wasser bedeutend stieg, liessen sich die Tiere nicht abschrecken und fielen den Bahau oft halb ertrunken zur Beute. Meistens wurden nur halb ausgewachsene Exemplare gefangen. Die Kajan brachten mir noch ein lebendes Tier mit, dem sie je die Vorder- und Hinterbeine aneinander gebunden hatten.
Mit Kwing Irang war auch Bo Ibau mit 50 seiner Leute von Long Tĕpai eingetroffen. Die beiden alten Herren liessen sich zuerst alle Vorfälle seit meiner Ankunft in Long Dĕho ausführlich berichten und schienen mit dem Gehörten recht zufrieden zu sein, denn obgleich ich sicher glaubte, sie kämen beide nur, um mich bis unterhalb der Wasserfälle zu bringen, merkte ich bald, dass Kwing Irang den Gedanken an eine Reise nach Apu Kajan noch nicht ganz aufgegeben hatte. Wir befanden uns jedoch in zu grosser Gesellschaft, um ernsthaft über eine so wichtige Angelegenheit reden zu können; aber abends erzählte mir Lalau, ein Malaie, der bei Kwing wohnte, dass dieser in der Tat die Reise mit mir unternehmen wollte.
Meine Verwunderung über diese Änderung der Dinge war nicht gering, als auch Kwing Irang mir, sobald wir allein waren, riet, den Zug dadurch, dass ich mich am Boh niederliess, zu beschleunigen, da seine Aufforderung an die Stammesgenossen, mit grossen Mengen Reis schnell abwärts zu kommen, dann mehr Eindruck machen würde. Er selbst wollte jedoch den anderen Stämmen gegenüber durchaus nicht den Schein auf sich Ziehen, die Reise zu den Kĕnja gewollt oder veranlasst zu haben, und die Kajan taten wahrscheinlich deshalb Bo Ibau gegenüber, als ob sie eigentlich gekommen wären, um eine Niederlassung [294] unterhalb der Wasserfälle zu besuchen, doch widersetzte ich mich diesem Plan heftig wegen des Zeitverlustes und weil dann kein Aufruf oberhalb der Wasserfälle erlassen werden konnte.
Auf mein dringendes Ersuchen, sich endlich für oder gegen die Reise nach Apu Kajan zu entscheiden, wurde am 7. April noch erst mit Bo Ibau und Kwing eine Zusammenkunft gehalten, in der ich nochmals zwei Stunden lang über die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Verbesserung des Verhältnisses zwischen den Kĕnja und den Bewohnern des Mahakamgebietes mit den Häuptlingen diskutierte. Kwing Irang sprach, wie gewöhnlich, selbst nur wenig und überliess das Wort hauptsächlich Bo Ibau, der, in die Enge getrieben, den Vorschlag machte, erst Bang Jok, als Herrn des Boh-Gebietes, nach seiner Meinung über das Unternehmen zu fragen und darauf zu dringen, dass er als Zeichen seiner Zustimmung ein bemanntes Boot mit nach Apu Kajan sende. Man müsse aber, sagte Bo Ibau, mit einer öffentlichen Besprechung bis zur Rückkehr Lawings, des jüngeren Bruders von Bang Jok, warten. Die Häuptlinge untereinander schienen jedoch nicht so lange warten zu müssen, wenigstens hörte ich nachts, als ich in meinem Klambu wach lag, in Bang Joks amin eine aussergewöhnlich lebhafte Diskussion, bei der ich nicht nur Bo Ibaus und Ibau Adjāngs Stimmen, sondern auch die verschiedener Frauen zu erkennen glaubte. Am folgenden Morgen erzählten meine Malaien, dass in der Tat eine grosse Zusammenkunft von Long-Glat-Häuptlingen stattgefunden, an der auch viele Bewohner aus der amin Bo Adjāng Lĕdjüs teilgenommen hätten. In Anbetracht, dass letztere, besonders die Frauen, mir alle sehr gewogen waren, war ich sicher, in ihnen bei der Beratung gute Advokaten gefunden zu haben, und obgleich die gefassten Beschlüsse geheim blieben, waren Bang Joks Freundlichkeit und Gesprächigkeit am anderen Tage doch auffallend, auch brachten mir seine Frau und sein kleiner Sohn abends Süssigkeiten. Wahrscheinlich infolge dieser geheimen Zusammenkunft teilte Kwing Irang mir mit, er habe seine Reise flussabwärts aufgegeben.
Am 9. April kehrte der erwartete Lawing von der Jagd zurück. Da das Wasser zu fallen begann, so dass Bo Ibau hinauffahren konnte, um die Männer aufzurufen, drang ich bei Bang Jok darauf, über die Reiseangelegenheit nochmals gemeinschaftlich zu überlegen.
Er schien mit meinen europäischen Reisegefährten besser als mit mir auskommen zu können, wenigstens schenkte er Demmeni eines [295] Morgens ein schönes Pantherfell und abends zogen Demmeni und Bier in seine amin, um das Grammophon ertönen zu lassen.
Die Versammlung sollte in der amin des Häuptlings stattfinden, aber diese war von der Spielgesellschaft so überfüllt, dass unsere baufällige ăwă nochmals vorgezogen werden musste.
Nachmittags erschienen die Kajan mit Kwing Irang, die Long-Glat von Long Tĕpai mit Bo Ibau, eine Menge neugierige Waldproduktensucher und endlich Bang Jok, wiederum in gelber Hose und Sammetjacke, das Schwert zur Seite. Sein glattes Gesicht zeigte nur dann Ausdruck, wenn er von mir nicht gesehen zu werden glaubte; einige Male fing ich einen forschenden, nichts weniger als wohlwollenden Blick von ihm auf.
Man begann wieder mit Trivialitäten, bis Bang Jok zögernden Tones zu erzählen anfing, dass der Sultan von Kutei ihm bei seiner Abreise von Tengaron aufgetragen habe, für meine Sicherheit zu sorgen, dass die geplante Reise sehr gefährlich sei u.s.w. Diese geheuchelte Besorgnis schnitt ich ihm mit der Bemerkung ab, dass ich mich selbst zu beschützen wisse. Mit allerhand wahren und unwahren Erzählungen fuhr er fort, die vorhandenen Schwierigkeiten breit auseinander zu setzen, worauf ich ihm wenig erwidern konnte, da er und alle Bahau bei ihrem ängstlichen Charakter und ihrer Auffassung der Dinge in der .Tat auf einer derartigen Reise grosse Schwierigkeiten zu überwinden hatten. Zuletzt gab Bang Jok sich aber durch die Erklärung, er sei noch zu jung, um einen so wichtigen Beschluss zu fassen, und werde sich daher ganz dem Urteil von Bo Ibau und Kwing Irang, die soviel älter seien, fügen, eine Blösse, denn er wusste sehr wohl, dass keiner dieser Häuptlinge eine Bestimmung treffen durfte oder konnte, besonders weil die Reise auf dem Bob durch sein Gebiet ging. So ergriff ich denn das Wort und machte ihm begreiflich, dass man oberhalb der Wasserfälle ihn als den Höchsten von Geburt unter den Long-Glat und als weit gereisten Mann für die zuständige Person halte, um eine endgültige Entscheidung zu treffen, und dass man, da die Reise sein Gebiet betreffe, von seiner Zustimmung abhängig sei. Indem ich nochmals darauf aufmerksam machte, dass man ohne seine Beteiligung oberhalb der Wasserfälle keinen Entschluss fassen könne, obgleich das Verhältnis mit den Kĕnja für die ganze Mahakambevölkerung von grösster Wichtigkeit wäre, bürdete ich ihm die ganze Verantwortung für das Zustandekommen oder Fehlschlagen der Reise auf. [296]
Trotzdem Bang Jok, besonders durch seinen Aufenthalt an dem für die Bahau so verderblichen Hof von Tengaron, viele gute Eigenschaften seiner Rasse eingebüsst hatte, war er doch im Herzen noch zu sehr Bahau geblieben, um deren allgemeine Furcht “haè”, beschämt, zu werden, nicht mehr empfinden zu können. Um ihm begreiflich zu machen, warum mir an dieser Reise so viel liege, nahm ich daher zu diesem Gefühl meine Zuflucht und erklärte, dass ich den hipui, den hohen Häuptlingen in Batavia, gegenüber in hohem Masse haè sein würde, falls ich zurückkehrte, ohne meinen Auftrag erfüllt zu haben. Die Anwesenden besassen für diese Argument augenscheinlich mehr Verständnis als für die Vorstellung, dass ihre eigenen Interessen durch diese Reise gefördert werden würden. Bang Jok, der sehr gut wusste, dass die Long-Glat und Kajan nur auf seine Beteiligung warteten, um mich zu den Kĕnja zu begleiten, wagte daher nicht, die Verantwortung, die Reise vereitelt zu haben, auf sich zu nehmen; auch kam ihm die Einsetzung einer niederländischen Verwaltung am Mahakam nicht mehr ganz unwahrscheinlich vor. So versprach er denn endlich, sehr gegen seinen Wunsch, ein Boot mitsenden zu wollen; dass er selbst an der Reise nicht würde teilnehmen können, konnte für mich nur vorteilhaft sein. Während dieser Unterhandlung hatte ich Bo Ibau und Kwing Irang, die sich beide dem unnatürlich gezierten Bang durchaus nicht gewachsen fühlten, nicht ins Gespräch gezogen und doch hatten sie, besonders Kwing, wie auf glühenden Kohlen gesessen. Er zog sich mit seinen Kajan, noch während ich mit Bo Ibau die Massregeln besprach, die er unter seinen Long-Glat treffen sollte, aus der unheimlichen Nähe seines Nebenbuhlers Bang Jok zurück und begab sich ins Haus der Ma-Tuwan, wo man ihm einige Räume zur Verfügung gestellt hatte. Seit langen Jahren war Kwing jetzt zum ersten Mal darauf eingegangen, in Long-Dĕho selbst zu übernachten; allerdings hatte er früher stets seine Kampfhähne bei sich gehabt, die ihre guten Schutzgeister vielleicht an die Hähne der Long-Glat hätten verlieren können.
Am Morgen vor der Versammlung hatte ich die Kajan und Long-Glat, die Demmeni und unser Gepäck von Long Tĕpai herunter gebracht hatten, aus Mangel an Silbergeld mit Gold bezahlt. Anfangs verursachte das Schwierigkeiten, aber einige Malaien zeigten sich schliesslich bereit, für das Gold Waren zu liefern. Eine Betrügerei vermutend machte ich die Kajan ausdrücklich darauf aufmerksam, dass jedes Goldstück [297] 4 Reichstaler wert sei, unter den Malaien, die aus dem Gold Schmucksachen herstellten, eigentlich noch mehr. Trotzdem erhielten die meisten an Tabak, Kattun, Salz etc. für ein Zehnguldenstück nur 7–8 fl.
Bo Ibau fuhr mit den Long-Glat und einigen Kajan noch am gleichen Abend den Mahakam aufwärts, um ihre Landsleute bei den Vorbereitungen für die grosse Reise zur Eile anzuspornen. Ich selbst erhöhte ihren Eifer, indem ich den Häuptlingen nach Überlegung mit Kwing erklärte, mit meinem Geleite an den Boh vorausreisen, dort ein Lager aufschlagen und auf den Nachschub warten zu wollen.
Noch ein anderer Umstand zwang die Häuptlinge, Long Dĕho bald zu verlassen, nämlich das nahende Ende Bo Adjāng Lĕdjüs. Es war mir zwar gelungen, den alten Mann vom Fieber zu befreien, aber Schlaf und Appetit wollten nicht zurückkehren, und besonders die letzten Tage hatte der Kranke sich kaum von der Matratze erheben können. Mit der Verschlimmerung seines Zustandes war auch das Interesse der Seinen für ihn gestiegen und der Zulauf an Besuchern so gross geworden, dass die Familie einen Einsturz des Hauses zu fürchten anfing. Zu dieser Befürchtung war in der Tat aller Grund vorhanden, denn die Häuser in Long Dĕho waren, wie schon gesagt, viel schlechter gebaut als die oberhalb der Wasserfälle und Reparaturen wurden nicht vorgenommen. Die Angehörigen des Kranken baten Kwing Irang, mit seinen Kajan aus dem Walde hinter dem Dorfe einige Balken herbeizuschaffen, um sie als Stütze unter den Fussboden zu stellen und schräg gegen die schon vorhandenen zu befestigen.
In der Nacht des 13. April wurde ich plötzlich durch lautes Rufen und Laufen in Bo Adjāngs amin geweckt. Der Kranke war ohnmächtig geworden, trotzdem seine Töchter und Frauen ihn seit Tagen ständig anriefen und schüttelten, aus Angst, dass er in Schlaf verfallen und nicht wieder erwachen möchte. Das Ende des alten Mannes wurde durch eine derartige Behandlung natürlich nur beschleunigt. In den letzten Tagen hatte ich immer wieder vergeblich auf Ruhe beim Kranken gedrungen, nur wagte ich nicht, in Anbetracht, dass er augenscheinlich doch sterben musste, allzu energisch aufzutreten, da man mir sonst seinen Tod zugeschrieben hätte. Je mehr sich sein Zustand verschlimmerte, desto mehr wurde der Unglückliche durch Schreien und Schütteln am Schlafen verhindert. Helfen konnte ich nicht, so zog ich mich denn, als die Familie die Absicht äusserte, im letzten Augenblick nochmals [298] die Hilfe einer Priesterin anzurufen, als Arzt ganz zurück und besuchte den Kranken nur noch ab und zu aus Teilnahme.
Nachts kam Bo Adjāng wieder zu sich, aber am folgenden Mittag trat eine neue Ohnmacht ein, worauf seine Angehörigen wieder stark auf die Gonge zu schlagen (buka), zu rufen und zu laufen anfingen. Nachdem das Bewusstsein des Kranken wiederum halb zurückgekehrt war, seine Töchter und Frauen einen erneuten Anfall auf ihn gemacht und die jungen Männer die Gonge wieder geschlagen hatten, tat Bo Adjāng abends seinen letzten Atemzug.
Obgleich ich den Wunsch geäussert hatte, den Handlungen, die mit der Leiche vorgenommen werden sollten, beizuwohnen, merkte ich doch, dass man auch in dieser mir sehr befreundeten Familie die Gegenwart eines Weissen bei den Zeremonien nicht gerne sah, und so war ich denn nur bei den über Tag stattfindenden Vorbereitungen zugegen.

Eroh Edoh, kinderlose, 18-jährige Frau.
Wie ich später hörte, hatte man, wahrscheinlich um die Leiche nicht erst steif werden zu lassen, diese gleich nach dem Tode gewaschen und schön gekleidet. Zum Waschen hatte man erst gewöhnliches, dann Wasser, in dem duftende Blumen gelegen hatten, benützt. Auch die Long-Glat stecken dem Toten Perlen in die Augen und Körperöffnungen.
Des Morgens früh fand ich die Leiche auf einer Matratze, bedeckt mit einem Tuche, mitten in der amin liegen, während die Frauen und Töchter für den Verschiedenen schöne Kleidungsstücke aus den Körben hervorholten, als passende Ausstattung fürs Jenseits. Eigentümlicherweise wurden dem Toten auch für längst verstorbene Angehörige Kleidungsstücke mitgegeben. So fügte Ibau Adjang, der Sohn des Verstorbenen, ein Röckchen für sein rotes Töchterchen bei. Zwei der ältesten Frauen überlegten mit einer alten Priesterin, wie sie den Anforderungen der adat am besten nachkommen könnten.
Sämtliche Familienglieder trugen Trauer, d.h. alle hatten ihren Schmuck abgelegt und sich in weissen oder hellbraunen Kattun gekleidet; die Frauen hatten sich ausserdem die langen Haare bis auf Halshöhe abgeschnitten. Die beiden jüngsten Frauen des Verstorbenen trugen Röcke aus Baumbast.
Am Abend des ersten Tages wurde in einer grossen Zusammenkunft bei Bang Jok überlegt, wie man das Begräbnis mit Rücksicht auf den hohen Wasserstand, der Long Dĕho von den ober- und unterhalb [299] der Wasserfälle wohnenden Angehörigen des Toten gänzlich abschnitt, gestalten sollte. Dass die Hilfe der Verwandten nicht beansprucht werden konnte, war insofern günstig, als man bei der herrschenden Reisnot nur schwer so viele Menschen hätte beköstigen können. Nun musste man sich mit den im Dorfe vorhandenen Arbeitskräften begnügen, die allerdings ebenfalls von der Familie bewirtet werden mussten, aber die panjin halfen nach Vermögen mit.
Augenscheinlich hatte man auch Leute gefunden, die den lungun (Sarg) herstellen sollten, denn am folgenden Morgen zogen in der Frühe 40 Männer und Frauen auf ein Reisfeld, um einen grossen Baum (kaju aro) zu fällen, der bereits lange zuvor zu diesem Zwecke ausersehen worden war. Während die Männer das Holz bearbeiteten, kochten die Frauen ihnen das Essen. Der Sarg wurde aus einem einzigen Stück hergestellt, und aus einem zweiten desselben Baumes ein gut schliessender Deckel verfertigt. An Ort und Stelle fand aber nur die Roharbeit statt. Bevor der Baum gefällt wurde, hatte man eine alte, geistesschwache Sklavin veranlasst, ihn 8 Mal im Tanzschritt zu umkreisen. Diese Sklavin hielt sich im Trauerhause ständig in der Nähe der Leiche auf und wurde von Hong, Bo Adjāngs Frau, die nur zum Schein den Dienst bei ihm verrichtete, unterrichtet, wie sie das Feuer anmachen, den Reis für den Toten kochen sollte etc. Die Leiche musste nämlich, solange sie noch nicht eingesargt war, 3 Mal täglich gespeist werden, d.h. es wurden Schüsseln mit Reis, Fisch und Zuspeisen neben sie hingestellt. Die Sklavin umkreiste die Leiche auch bei dieser Gelegenheit 8 Mal. Als Totenspeise darf das Fleisch des Wildschweins nicht benützt werden. Hong bot der Leiche jede Schüssel gesondert an und liess sich von der Sklavin nur ab und zu pro forma helfen. Wie man mir erzählte, verstand diese den Reis für Bo Adjāng gut zu kochen (“hămān e̥năh kane̥n dahin Bo Adjāng”). Auch sollte sie alle Vorschriften der adat ebenso gut kennen, wie ein alter Sklave in Lulu Njiwung, den man des hohen Wasserstandes wegen nicht hatte holen können. Man lässt gewöhnlich die Leichenzeremonien durch Sklaven aus anderen Gebieten verrichten, weil Fremde nicht, wie nach der adat der Bahau aufgewachsene Personen, bei einer Berührung der Leiche takud parid werden. Später werden, bei Eintritt eines neuen Todesfalls, stets wieder die gleichen Sklaven herbeigeholt.
Am ersten Tage hatte man aus weissem Kattun ein Klambu hergestellt [300] und es am anderen Morgen über die Leiche gehängt, wobei die Frauen laut weinten und die Gonge, wie bei jeder vorgenommenen Handlung, geschlagen wurden. Der gleiche Brauch herrscht bei den Kajan, Pnihing und anderen Stämmen, nur wird bei diesen mit dem Reisstampfer auf den Boden gestampft. Wahrscheinlich hat der Lärm den Zweck, die Geister in Apu Kĕsio darauf aufmerksam zu machen, dass etwas Wichtiges vor sich geht.
Der Sarg stand dank den vielen Hilfskräften noch am gleichen Tage in roher Form fertig da, aber abends und nachts wurde eifrig daran weiter gearbeitet. Morgens war die Arbeit denn auch so weit vorgerückt, dass einige Männer den Sarg, der oben und an den Seiten glatt gearbeitet war, mit schönen schwarzen Hundefiguren (aso̱) auf weiss gekalktem Grunde verzieren konnten. Zu beiden Enden des Sarges wurden Masken geschnitzt; für Häuptlinge höheren Ranges (Bo Adjāng hatte nur eine panjin zur Mutter) wird der Sarg auch an den Seiten mit Masken verziert. Abends war der Sarg fertig und nachts wurde die Leiche hineingelegt, worauf man den Deckel mit Harz luftdicht verschloss. So konnte mit dem Begräbnis gewartet werden, bis das lāli parei vorüber war und der jüngste Sohn des Verstorbenen, Lĕdjü Adjāng, der bei seiner Frau Bua Li am Mĕrasè lebte, von dort nach Long Dĕho abgeholt werden konnte.
Gewöhnlich werden zur Aufbewahrung der Särge in der Nähe der Wohnung provisorische Leichenhäuser gebaut. Diesmal fehlte aber hierzu die Zeit und so begnügte man sich damit, für Bo Adjāng Lĕdjü eine Galerie an der Vorderseite seines Hauses zu errichten, nach der Art der meisten Wohnungen der Long-Glat-Häuptlinge. Bereits nach 3 Tagen stand die Galerie fertig da, in welcher man den mit schönen Tüchern bedeckten Sarg abstellte. Solange die Leiche hier verblieb, schliefen auch die Frauen des Häuptlings nachts in dieser Galerie und tagsüber fuhren sie in allen Dienstleistungen fort, wie zu Lebzeiten des Toten. In dem Glauben, dass die Seelen des Verstorbenen sich noch in nächster Nähe aufhielten, liess die Familie häufig junge Männer zu Bo Adjāngs Unterhaltung Flöte oder klĕdi spielen. Kamen in dieser Zeit fremde Häuptlinge an der Niederlassung vorbei, so machten sie dem Toten stets einen Besuch. Dabei wurden, wie beim Tode, wilde Kriegstänze ausgeführt; man schlug mit den Schwertern in die Luft und in die Hauswände und brach in schmerzliches Weinen aus, worin dann alle Hausgenossen einstimmten. Die Verbotszeit begann hier erst [301] nach der endgültigen Beisetzung der Leiche in ihrem Prunkgrab (salong) und fiel somit nicht mit der Trauerperiode zusammen, die sogleich nach dem Tode eintrat.
Die beginnende Verbotszeit, in der niemand im Dorfe aus- noch eingehen durfte, liess mir eine möglichst schnelle Abreise unserer Expedition sehr notwendig erscheinen, überdies vertrieb uns auch die grosse Nahrungsnot, die im Dorfe herrschte. Im Vergleich zu Long Dĕho kam mir der unbewohnte Wald am Boh noch verlockend vor; dort waren wir in bezug auf den Reis nicht schlimmer dran als hier, und die Aussicht auf Fleischnahrung war da sogar viel grösser, weil die Long-Glat aus Furcht vor Kopfjägern im Boh nicht zu fischen und in den Wäldern nicht zu jagen wagten.
Unmittelbar nach der letzten Versammlung hatte ich bereits einige meiner Malaien flussaufwärts gesandt, um am Boh einen vor Überfällen sicheren Lagerplatz ausfindig zu machen. Die Männer hatten, etwas oberhalb des Wasserfalls, der die Mündung des Boh versperrt, eine Landzunge frei gehackt, welche an der einen Seite von einer tiefen Bucht des Flusses, an der anderen von diesem selbst begrenzt wurde. Nach dem dahinter liegenden Walde zu konnte man das Lager durch ein Heckwerk schützen.
Zwei Tage nach der Heimkehr der Malaien gestattete der Wasserstand bereits den ersten Gepäcktransport zum Lagerplatz; doch waren diesem erfreulichen Fortschritt für mich sehr unangenehme Tage vorangegangen. Meine Freude über die günstige Wendung der Dinge nach Ablauf der Versammlung war nur sehr kurz gewesen, denn kaum hatte mein javanisches und malaiisches Personal an die Verwirklichung des Reiseplans zu glauben angefangen, als es sich gemeinschaftlich weigerte, weiter mit mir zu ziehen, unter dem Vorwande, die Expedition würde zu lange dauern und zu gefährlich sein. Ersteres war sicher nicht wahr, weil Kwing Irang zur Bedingung gestellt hatte, dass ich mit ihm und seiner Gesellschaft nach zwei Monaten heimkehren müsste, da er es zu gefährlich fand, mich bei den Kĕnja allein zurückzulassen.
Guter Rat war teuer, denn mein gut bewaffnetes und geübtes einheimisches Geleite konnte ich nicht missen. Den folgenden Tag jedoch sprach ich mit einem der Leute, Abdul, der auf der Reise stets sein Bestes geleistet hatte, über die Weigerung seiner Kameraden, und sogleich erklärte er sich bereit, mich bis zu meiner Rückkehr zur Küste begleiten zu wollen. [302]
Hiermit schien der Aufstand beschworen; binnen weniger Tage entschlossen sich alle zum Mitgehen, falls ich nicht länger als zwei Monate bei den Kĕnja bleiben wollte. Dieser gute Verlauf des Konfliktes schien jedoch meinen beiden europäischen Gefährten nicht sonderlich zu gefallen, wenigstens erklärten sie eines Morgens beim Frühstück ihrerseits, dass, wenn auch meine Malaien und Javaner mit mir gingen, sie von der Reise und den vielen stets aufs neue aufsteigenden Schwierigkeiten genug hätten und mich deshalb nicht weiter begleiten wollten. Glücklicherweise teilte Kwing Irang meine Entrüstung über eine derartige Handlungsweise, von der sich die Kunde natürlich wie ein Lauffeuer in der Niederlassung verbreitete, und versicherte mir, auch allein unter meiner Leitung nach Apu Kajan reisen zu wollen.
Da mir kein Mittel zu Gebot stand, die Europäer, welche das Leben inmitten dieser Naturmenschen langweilte und beängstigte, zum Ausharren während noch einiger Monate zu zwingen, versprach ich ihnen, sie, sobald der Wasserstand es zulasse, zur Küste bringen zu lassen. Als es jedoch hierzu kam, wollten sie wieder bei mir bleiben, womit ich einverstanden war, weil ich die Gegenwart von mehr als einem Europäer bei den Kĕnja für wünschenswert hielt.
Wegen allerlei Angelegenheiten, in denen die Bewohner von Long-Dĕho meine Hilfe nötig zu haben glaubten, konnten wir vor der Hand noch nicht alle gleichzeitig zum Boh auf brechen; überdies fand ich ein ständiges Zusammensein mit Demmeni und Bier nach den höchst unangenehmen Vorfällen der letzten Tage nicht geraten. Auch Bier war es eine Erleichterung, als ich ihm vorschlug, während einiger Tage das Gelände längs des Mobong aufzunehmen, um zu sehen, ob dort nicht ein Weg von Long Dĕho zum Bunut angelegt werden könnte, zwecks einer besseren Verbindung mit den südlicheren Gebieten und einer Umgehung der Wasserfälle. Bereits am 25. April reiste Bier mit zwei Führern und meinen eigenen Malaien ab, denen das Nichtstun in Long Dĕho ebenfalls nicht gut bekommen war.
Wenige Tage darauf trafen von oben die ersten Kajan ein, um sich meiner Expedition anzuschliessen. Wie es sich herausstellte, war Bo Adjāng Lĕdjüs Tod oberhalb der Wasserfälle noch nicht bekannt, und unter dem Eindruck dieser Nachricht erklärten die Kajan sogleich, mit einem so schlechten Vorzeichen eine so gefährliche Reise unmöglich antreten zu können. Von seinen Leuten gezwungen, behauptete auch Kwing Irang, mit ihnen nach dem Blu-u zurück zu müssen, um [303] dort aufs neue günstige Vorzeichen zu suchen; vergeblich waren meine Vorstellungen, lieber am Boh auf die gewünschten Zeichen zu warten, damit ich endlich aufbrechen könne. Bald darauf begannen die Kajan ihren Reisvorrat gegen hohen Preis in Long Dĕho zu verkaufen, um, sobald der fast ununterbrochen hoch bleibende Wasserstand es gestattete, die Heimreise anzutreten. Als das Wasser schliesslich doch nicht fiel, machten sie sich in Kwings Gesellschaft mit fast leeren Böten trotzdem auf den Weg, mit dem Versprechen, möglichst bald dem Vogelflug nachgehen und beim nächsten Neumond wieder zurückkommen zu wollen.
Kaum waren alle fort, als Lalau, ein aus Long Blu-u bei mir zurückgebliebener Malaie, mir eine Botschaft von Kwing Irang, überbrachte. Nach ihm hatten die Kajan nicht die Absicht, zu mir zurückzukehren, falls ich ihnen nicht pro Mann und pro Tag. 2.50 fl und Kwing das Doppelte als Reiselohn ausbezahlen wollte. Sehr wahrscheinlich hatte ich diese hohe Forderung dem Chinesen Mi Au Tong zu danken, der, von der Küste wegen Schulden ins Innere geflohen, sich bei den Kajan auf hielt und in den letzten Wochen die Long-Glat um eine grosse Summe zu prellen versucht hatte, indem er vorgab, von der englischen Regierung mit der Einholung einer Busse für die Ermordung von 5 sĕrawakischen Dajak am Boh beauftragt worden zu sein. Durch meinen den Long-Glat gemachten Vorschlag, diese Angelegenheit lieber durch Vermittlung des Assistent-Residenten von Samarinda mit Sĕrawak zu behandeln, hatte ich seine bösen Absichten vereitelt, worauf er mit Kwing Irang wieder nach Long Blu-u gezogen war. Als Begründung für ihre Forderung gaben die Kajan an, dass ich auch den Long-Glat von Long Tĕpai, die mir an einem Tage über die Wasserfälle hinunter geholfen hatten, einen Reichstaler als Lohn gegeben hätte. Dies war nur aus Mangel an Gulden geschehen, doch glaubten die Kajan, der grossen Gefahren wegen auf den höchsten Reiselohn Anspruch machen zu dürfen.
Neben den vielen bereits bestehenden Hindernissen wirkte diese Nachricht sehr niederschlagend, und erst allmählich war ich imstande, über einen Ausweg aus dieser Kalamität nachzudenken. Im Laufe des Tages glaubte ich insoweit auf die Forderung eingehen zu können, als ich zwar jedem Kajan für jeden Arbeitstag 2.50 fl und Kwing Irang 5 fl als Lohn zusagte, dann aber keine beliebige Anzahl, sondern nur 50 kräftige Kajan mitnehmen wollte, die für ihre Beköstigung [304] selbst zu sorgen hätten. Die Kajan selbst hatten mich wissen lassen, dass sie ihren Taglohn nur auf der Hinreise bis zum Hause des Kĕnja-Fürsten Bui Djalong beanspruchten. Durch die Bestimmung, dass nur an Arbeitstagen Lohn ausbezahlt werden sollte, kam ich einem zu langen Hinziehen der Reise durch zu häufiges “me̥lo̱” nach schlechten Zeichen zuvor, was für den Nahrungsmittelverbrauch von grosser Bedeutung war. Es traf sich günstig, dass in Long Dĕho noch am gleichen Tage ein Boot mit Kajan erschien, die ursprünglich an der Reise zu den Kĕnja hatten teilnehmen wollen, nachdem sie aber von Kwing den Stand der Dinge vernommen, ihren Reis zu dem herrschenden hohen Preise im Dorfe verkaufen wollten.

Dĕwong Kĕhad, Frau der Mahakam-Kajan.
Am folgenden Tage bereits benützten sie das Sinken des Wassers zur Rückfahrt, und ich liess Lalau mit ihnen ziehen, um Kwing meinen Vorschlag zu überbringen und ihn zu baldigem Aufbruch anzuspornen. Stark wagte ich hierauf übrigens nicht zu hoffen, denn es war sehr wahrscheinlich, dass die Heimkehrenden die Influenzaepidemie, an der wir alle in Long Dĕho gelitten hatten, in das Gebiet oberhalb der Wasserfälle einschleppen, und dass Krankheit und Tod dann ein Hindernis für eine baldige Rückkehr bilden würden. Die Epidemie verbreitete sich in der Tat schnell unter den Kajanstämmen, doch fielen ihr diesmal nur alte Leute und kleine Kinder zum Opfer.
Kwing Irang hatte mir zwar vor seiner Abreise dringend geraten, mit meinen Leuten den Lagerplatz am Boh sogleich zu beziehen, um alle Beteiligten vom endgültigen Aufbruch der Expedition zu überzeugen und ihm dadurch seine Aufgabe zu erleichtern, doch war Bier von seiner Reise nach dem Mobong noch nicht zurück, auch erhielt ich von einigen Männern von unterhalb der östlichen Wasserfälle die Nachricht, mein Diener Midan sei von Tengaron aus auf der Rückfahrt, sodass ich ihn erwarten musste. Am 8. Mai liess er mir seine Ankunft unterhalb der Wasserfälle melden und um Beistand zum Passieren derselben bitten. Zufällig war gerade eine Gesellschaft Taman-Dajak vom Kapuas eingetroffen, die sich nach dem mittleren Mahakam hatte begeben wollen, um dort mit alten Perlen Handel zu treiben. Durch einen Hinweis auf die dort herrschenden, für Fremde sehr gefährlichen Zustände hatte ich die Leute in Long Dĕho zurückgehalten. So traf es sich, dass ich die Taman etwas verdienen und Midan schnell Hilfe bringen lassen konnte, denn bei mässigem Wasserstande und sinkendem [305] Wasser wagten es die Männer, mit ihren halb leeren Böten die Fälle zu überschreiten. Bereits am 15. Mai brachten sie Midan und seine Begleiter wohlbehalten nach oben. Unter vielen Zeitungen und Briefen waren die des Assistent-Residenten von Samarinda für mich die wichtigsten; sie teilten mir den definitiven Beschluss der Bataviaschen Regierung mit, Barth als Kontrolleur am mittleren Mahakam einzusetzen. Diese Nachricht musste auf die Bahau oberhalb der Wasserfälle grossen Eindruck machen; bereits am gleichen Tage setzte ich auch Bang Jok davon in Kenntnis.
Ferner brachte Midan das von mir verlangte Geld mit. Der Sicherheit wegen hatte man ihm in Samarinda drei bewaffnete Schutzleute als Geleite mitgegeben, die als die ersten, welche so tief in die Binnenlande vorgedrungen waren, in ihren Uniformen den Waldproduktensuchern und anderen Fremden in unserer Umgebung einen heilsamen Respekt einflössten. Wegen der äusserst unsicheren Zustände zwischen Udju Tĕpu und den Wasserfällen war dieses Geleite sehr notwendig gewesen, und ich war froh, dass mein Gesandter ohne Unfall davongekommen war. Seine Berichte über ein Komplott der Buginesen gegen die übrigen Fremden dieses Gebiets bewogen einige bandjaresische Kaufleute in unserer Niederlassung zu einer eiligen Rückkehr nach Udju Tĕpu, so dass ich die 3 Schutzleute schon nach zwei Tagen mit ihnen zurücksenden konnte.
Midans Berichte klangen in der Tat sehr beunruhigend. Um den Mord der Barito-Waldproduktensucher im oberen Medang an Taman Dau und den Seinen zu rächen, hatten einige Ot-Danum einem Mann und einer Frau in Laham die Köpfe abgeschlagen. Gleich darauf war ein buginesischer, an der Mündung des Merah wohnender Kaufmann nachts von Unbekannten getötet und seine Frau schwer verwundet worden, was seinen Stammesgenossen zum Vorwand diente, ihre Feinde, die Bandjaresen und die zu ihnen haltenden Ot-Danum, des Mordes zu beschuldigen und sich mit den buginesischen Waldproduktensuchern am Bĕlajan zu verbinden. Seitdem hatten sie sich in Long Howong zusammengetan und einen Einfall in das Rata-Gebiet gemacht, wo sie zwei Bandjaresen und einen Ot-Danum erschossen hatten. Infolgedessen waren alle Baritobewohner, denen es möglich war, in ihr Gebiet zurückgekehrt; eine Gesellschaft derselben hatte dabei am oberen Rata einen buginesischen Händler, dem sie begegnete, ermordet und sein Hab und Gut mitgenommen. Auf Blutrache in grossem Massstab [306] sinnend waren die Buginesen augenblicklich noch in Long Howong versammelt.
Einige Tage vor Midan war auch Bier von seiner Expedition zurückgekehrt und zwar mit sehr guten Resultaten auf topographischem Gebiet, aber mit weniger guten Aussichten auf die Anlage eines Weges, da sich das Quellgebiet des Mobong als sehr wild und gebirgig erwiesen hatte.
Unserem Aufbruch zum Boh stand nun nichts Ernsthaftes mehr im Wege. Mein sehr umfangreiches Gepäck schied ich in drei Teile: den einen, meine Sammlungen, die ich später selbst nach Samarinda mitnehmen wollte, liess ich in Long Dĕho bei Ibau Adjāng zurück; der zweite Teil, 12 für die Reise und den Aufenthalt in Apu Kajan bestimmte Kisten mit Nahrungsmitteln, blieben vorläufig ebenfalls liegen, um sie später, bei Kwing Irangs Ankunft, abholen zu lassen. Vom übrigen Gepäck sandte ich am 17. Mai unter Biers Aufsicht einen grossen Teil zum Lagerplatz und nahm das letzte 2 Tage darauf selbst mit, als unsere Männer Demmeni und mich abholten. [307]
Kapitel XI.
Dreimonatlicher Aufenthalt im Lagerplatz am Boh—Bier verlässt die Expedition—Anlage einer Fischsammlung—Günstige Nachrichten aus Long Blu-u—Offizieller Bericht von der Einsetzung eines Kontrolleurs am Mahakam—7 Kĕnja unter Taman Ulow schliessen sich der Expedition an—Jagdverhältnisse am Mahakam: Kastrierung der Hunde, Jagdmethoden, Fallenstellen, Beschwörung der Hunde, Vogeljagd—Kwing Irangs Ankunft am Boh—Reiseberatung—Schwierigkeiten durch den Tod von Kwing Irangs Schwester—Vorbereitungen zur Abreise—Aufbruch der Kĕnjagesandtschaft unter Taman Ulow.
Gleich nach unserer Ankunft im Lagerplatz am Boh traf ich Massregeln, erstens um uns so gut als möglich gegen Überfälle zu schützen, zweitens um unseren wahrscheinlich Monate dauernden Aufenthalt durch nützliche Arbeit ausfüllen zu können. Ersterem Zwecke entsprachen wir dadurch, dass wir unsere Landzunge hinten, nach der Waldseite, mit einer festen Hecke umgaben. Zur Vermeidung von Müssiggang und im Interesse einer topographischen Aufnahme des Boh beschloss ich, mit Bier und einer Anzahl unserer Malaien den Fluss so weit als möglich hinaufzufahren, eventuell einen hohen Berg zu besteigen und so dieses noch gänzlich unbekannte Stromgebiet aufzunehmen. Alle Massregeln zu einem Aufbruch am folgenden Tage waren bereits getroffen, als Bier mit der Erklärung zu mir kam, den Boh nicht weiter mit mir hinauffahren zu wollen, unter Vorgebung von allerhand Gründen, von denen einer unsinniger war als der andere. Der wichtigste war wohl seine Furcht, von mir direkt bis zu den Kĕnja mitgenommen zu werden, woraus ich ersah, dass nicht so sehr die Abneigung gegen das Leben unter den Eingeborenen meine Europäer so widerspenstig machte, als vielmehr die Angst vor ihrer Umgebung, die sich bei Bier am stärksten äusserte, weil er nach zwei Jahren noch immer nicht die Landessprache verstand und den Charakter der Dajak so wenig begriff, dass er allen Greueln, die man ihm von den Kĕnja berichtete, Glauben schenkte. Jedenfalls wurde es mir klar, dass die Anwesenheit eines von Furcht gequälten Europäers bei den [308] grossen Schwierigkeiten, welche stets wieder auftauchten, durchaus unerwünscht war und deshalb er und Demmeni, der nun ebenfalls fort wollte, so schnell als möglich zurückgeschickt werden mussten. Wegen des günstigen Wasserstandes liess ich sogleich ein Boot rüsten und bestimmte die Bemannung, so dass Bier bereits am folgenden Tage den Fluss abwärts und dann weiter nach Batavia reisen konnte. Demmeni hatte sich im letzten Augenblick wieder bedacht und zum Bleiben entschlossen. Ich benützte die Gelegenheit, um Briefe und anderes zur Küste zu senden, auch gab ich den Bootsleuten Geld mit, um unterhalb der Wasserfälle so viel Reis einzukaufen, als zu haben war, da wir unseren Vorrat für den Zug nach Apu Kajan ständig so gross erhalten mussten, dass wir nach Ankunft der Bahau jeden Augenblick weiterreisen konnten. Daher sandte ich auch während unseres dreimonatlichen Aufenthaltes in diesem Waldlager immer wieder ein Boot aus, das abwechselnd ober- und unterhalb der Wasserfälle Reis und andere Nahrungsmittel für uns einkaufen musste.
Meine Malaien schienen sich, nachdem die ersten Nächte ohne Überfälle verflossen waren, in dieser Waldeseinsamkeit bald heimisch zu fühlen und wurden, getrieben durch Mageninteressen, bald erfinderisch im Ausdenken von allerhand listigen Methoden des Fischfangs. Auch meine zwei- und vierfüssigen Jäger liessen sich dazu verleiten, in diese beinahe unberührten Wälder tiefer einzudringen, als wünschenswert war. Abdul und Dĕlahit verirrten sich sogar einmal und liessen uns eine Nacht in grosser Angst verbringen, als sie weder zurückkehrten noch auf unsere Gewehrschüsse antworteten. Den folgenden Morgen früh stellten sie sich wieder bei uns ein und behaupteten, es sei zur Rückkehr zu dunkel geworden und auf unsere Schüsse hätten sie nicht zu antworten gewagt, aus Furcht, ihre Anwesenheit etwaigen in der Nähe befindlichen Kopfjägern zu verraten. Mein Hund liess sich ebenfalls durch einen Hirsch oder ein anderes Wild zu tief in den Wald locken und kehrte während 24 Stunden nicht wieder zurück. Nachdem die Malaien länger als einen halben Tag nach dem Hund gesucht hatten, brachten sie ihn endlich ins Lager zurück. Jenseits einer Hügelreihe, die sich hinter unserem Lager befand, hatten sie das kläglich heulende Tier in einem tiefen Tal sitzen gefunden. Seitdem wurden Menschen und Tiere vorsichtiger, auch lernten sie ihre Umgebung besser kennen.
Die Fischerei der Malaien lieferte bald sehr gute Resultate, was [309] mich auf den Gedanken brachte, diesen gezwungenen Aufenthalt zur Anlage einer Fischsammlung zu benützen, für die sich wahrscheinlich nicht so bald wieder so günstige Gelegenheit finden würde. Ich liess daher auf die verschiedenste Weise fischen, hauptsächlich auch, um kleine Fische zu erhalten, die zum Essen nicht geeignet waren; es lag mir nämlich daran, nicht nur leicht konservierbare Exemplare, sondern auch die kleinen, von den Eingeborenen verschmähten und ihnen daher unbekannten Arten zu fangen. In dem zwar breiten, aber sehr schnellfliessenden Flusse war das Angeln schwierig; unsere Wurfnetze wiederum waren mehr für den Fang grosser Fische geeignet und ein kleines Netz, das ich aus Strickbaumwolle weben liess, die ich in Long Dĕho gekauft hatte, erwies sich für den Gebrauch auf dem steinigen, mit Ästen und Baumstämmen bedeckten Flussgrund als zu schwach. Dagegen verstanden die Malaien das fortwährende Steigen und Fallen des Boh, der ein ausgedehntes Quellgebiet besitzt und einen innerhalb weniger Stunden um einige Meter Höhe wechselnden Wasserstand aufweist, ausgezeichnet zu benützen. Die Fische konnten augenscheinlich der sehr heftigen Strömung nicht widerstehen und flohen in kleine Nebenflüsse oder geschützte Uferbuchten. Meine Leute holten aus dem Walde Bambus, spalteten ihn in dünne Streifen und stellten aus diesen ein Gitter her, das sie mit einem Rotanggeflecht mit schmalen Zwischenräumen (klabit) versahen. Mit dem Gitter schlossen sie die Mündung der Nebenflüsse bei Hochwasser derart ab, dass bei fallendem Wasser kein Fisch durch dieses hindurchschlüpfen konnte. Der aus sehr verschiedenen Fischarten bestehende Fang konnte oft bereits am folgenden Tage eingeholt werden; am beliebtesten, d.h. schmackhaftesten waren die grossen, forellen- und salmartigen Fische. Bisweilen war der Fang so gross, dass ein Teil durch Räuchern für die folgenden Tage konserviert werden musste. Auch die verschiedenen Reusenarten lieferten regelmässig einige Fische, wurden aber auf die Dauer durch das schnellfliessende Wasser von ihrer Befestigung losgerissen. Hübsche kleine Fische fing ich auch mehrmals mit dem Schöpfnetz in Lachen, die nach Hochwasser hinter Schuttbänken zurückgeblieben waren. Am meisten lieferten jedoch die Wurfnetze, mit denen die Männer täglich bei jedem Wasserstande fischten, was für sie einen sehr angenehmen Zeitvertreib bildete. Da sie im Walde weder bestimmte Sorten von Baumbast noch Pflanzen fanden, welche als Fischgift (tuba)dienen konnten, liess ich einmal bei den Bewohnern von Long Dĕho tuba-Wurzeln [310] aufkaufen, vor allem, um noch mehr kleine Fischarten zu erlangen. Infolge eines plötzlichen Regens schwoll das Flüsschen jedoch so stark an, dass nur wenige neue Fischarten gefangen wurden. Später jedoch fanden die Malaien im Walde eine Fruchtart, mit der sie das Wasser eines anderen Flüsschens vergifteten, wodurch sie viele kleine Fische, darunter mehrere neue Arten, erbeuteten. Als meine Leute nun zum ersten Mal in ihrem Leben die grosse Anzahl verschiedener Fischarten sahen, welche so ein Fluss beherbergt, machte ihnen die Sammlung allmählich selbst Freude und sie gingen öfters fischen, auch wenn sie für ihre Mahlzeiten keiner Fische mehr bedurften. Anfangs nahm die Sammlung sehr schnell zu, später vergingen oft Tage, bevor eine neue Art gefangen wurde, auch erhielt ich von einigen nur ein oder zwei Exemplare. Der grosse Reichtum meiner Sammlung musste denn auch unserem langdauernden Aufenthalt zugeschrieben werden und dem Umstand, dass seit vielen Jahren im Boh nicht mehr gefischt worden war, hauptsächlich, dass keine Tubafischereien stattgefunden hatten. Zum Schluss hatte ich 52 Arten beieinander, viele in zahlreichen Exemplaren. Da ich die Fische noch lebend in die Konservierungsflüssigkeit (1 Teil Formol auf 5 Teile Wasser) setzte und alle, ausgenommen die allerkleinsten, zum leichteren Eindringen der Flüssigkeit mit einem Bauchschnitt versah, kam die Sammlung selbst nach einem Jahr noch in aussergewöhnlich gutem Zustande im zoologischen Museum von Leiden an.

Kinderlose Frau der Mahakam-Kajan.
Die richtigen inländischen Namen der Fische und die Grösse, welche die einzelnen Arten erreichten, brachte ich nur sehr mühsam aus meinen Leuten heraus. Diese sogenannten Malaien gehörten zu einer aus den verschiedensten Gegenden Borneos zusammengewürfelten Menschenrasse; beim Suchen von Waldprodukten waren sie in diese entlegenen Gebiete geraten. Den meisten strömte, wenn auch in verschiedenem Grade, dajakisches Blut in den Adern. So stammten einige vom Kapuas der Wester-Afdeeling und vom Melawi, zwei vom unteren Mahakam, einige andere waren von einer Kajanmutter am Blu-u geboren u.s.f. Obgleich sie alle ihr Leben lang gefischt hatten, waren sie doch nur über die Namen der häufigsten Fischarten einig; die kleinsten kannten viele nicht und anderen gaben sie Namen, die ähnlichen Fischen aus anderen Flussgebieten zukamen. Wenn die Leute ihre Angaben daher auch nach bester Überzeugung machten, mussten diese doch mit Vorsicht aufgenommen werden; auch musste ich mich häufig mit Namen [311] der verschiedensten Dialekte begnügen. Soweit ich der Sache nachgehen konnte, fingen wir auch eine Art von braunem kĕto̱, der nur im Boh vorkommt, wenigstens hatte ihn keiner der Männer je gesehen; später erklärten auch die Kajan, dieser Fisch sei tatsächlich dem Boh eigen.
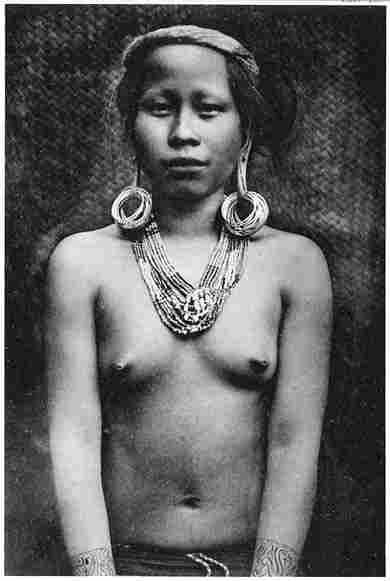
Kinderlose Frau der Mahakam-Kajan.
In unseren Gesprächen über Fischerei erzählten die Malaien vom Mahakam, dass am Unterlauf dieses Flusses und in den zu beiden Seiten von ihm gelegenen Seen (ke̥no̱han), an denen ein ausgebreiteter Fischfang getrieben wird, viele Arten vorkommen, die wir im Boh nicht fingen, anderseits waren hier verbreitete Arten dort unten nicht zu finden. Viel Merkwürdiges hörte ich auch über die grossen Mengen von Fischen, welche in der Trockenzeit bei niedrigem Wasserstande in diesen Seen gefangen und dann geräuchert und getrocknet werden. Es kommen dort viele Rochen (ikan pari) vor mit über 1 m Breite und grosse Sägefische (ikan prangan), von denen ich in Uma Mĕhak jedoch nur kleine Exemplare hatte kaufen können; auch Delphine werden dort erbeutet. Die Sägefische sollten über 2 m lang werden und schmutzig gelb von Farbe sein, die Rochen bis 1.75 m Durchmesser erreichen, schwarz von oben, weiss von unten sein und helle Flossen besitzen. Von den Rochen isst man nur die salzig schmeckenden Flossen, von beiden verwertet man die Leber, aus der man ein bei den Mahlzeiten gebrauchtes Öl presst. Beide Tiere sollen wegen der grossen Wärme des Wassers hauptsächlich in den Seen vorkommen, die kleinen Sägefische werden jedoch noch bis unterhalb der Wasserfälle, 75 m über dem Meeresspiegel, gefangen. In Kutei wird behauptet, dass diese beiden Fischarten aus dem Meere den Fluss hinaufschwimmen; als Begründung wird jedoch nur der salzige Geschmack ihrer Flossen angeführt.
Die Delphine (ikan mpush) werden bis 1.5 m lang und sind dunkelblaugrün gefärbt; sie kommen in grossen Mengen bis zum Fuss der Wasserfälle im Mahakam vor und man sieht ihre Wasserstrahlen und glänzenden Rücken täglich über der Wasserfläche erscheinen. Sie werden von den Malaien nicht gegessen, weil diese die Delphine für Menschen halten. Der Erzählung nach wohnte in Muara Pahu einst ein Mann, der seinen Hunger nicht schnell genug stillen konnte und daher den kupfernen Reistopf mit hinunterschluckte. Darauf fühlte er aber so heftige Beängstigungen, dass er ins Freie lief und am Flussufer den Stamm eines Steinpisang oder pisang mangala umfasste. Beim Anklammern gab der Stamm jedoch nach und stürzte mit dem Manne ins Wasser, der darauf in einen Delphin verwandelt wurde. [312]
Am 3. Juni erst kehrten die Malaien unter Dĕlahit zurück und da noch keine Berichte von den Kajan eingetroffen waren, benutzte ich den günstigen Wasserstand, um mit Dĕlahit ein Boot auf Kundschaft nach Long Blu-u zu senden. Neun Tage später kehrten meine Gesandten in Begleitung von Lalau mit ermutigenden Nachrichten zurück. Im Kajanstamm herrschten zwar immer noch grosse Vorurteile gegen die Reise, aber Kwing Irang drang ständig auf deren Durchführung, und auch die Pnihing unter Bĕlarè und die Long-Glat unter Bo Lea bereiteten sich zum Mitgehen vor. Ein grosses Hindernis bildete für die Kajan das Neujahrsfest, das im folgenden Monat zum ersten Mal im neuen Hause gefeiert werden musste, bei welcher Gelegenheit auch das lāli uma für die ganze Niederlassung aufgehoben werden sollte. Auf Kwings Betreiben hatten sie aber beschlossen, die Feier einen Monat früher stattfinden zu lassen und dann sogleich zum Boh aufzubrechen. Auf die Beschränkung, welche ich inbezug auf den von ihnen geforderten sehr hohen Taglohn getroffen hatte, waren sie bereitwillig eingegangen. Lalau war es auch gelungen, elfte seltene Perlenmütze zu erstehen, die mir ihres eigenartigen Modells wegen für meine ethnographische Sammlung wertvoll erschienen war. Mit vielem andern Schmuck hatte ich auch die Mütze gelegentlich eines grossen Festes bewundert, doch hatte sogar eine einjährige Unterhandlung noch zu keinem Kauf geführt. In Long Dĕho hatte ich Lalau noch einige sehr kostbare Tauschartikel mitgegeben, um zu versuchen, ob der Besitzer der Mütze jetzt, wo sich die letzte Gelegenheit bot, sich leichter zum Verkauf überreden liess. Für alle mitgenommenen Gegenstände brachte mir Lalau nun wirklich die Mütze, die man, wie er sagte, zum Schluss nur abgetreten hatte, um mir eine Freude zu machen (Siehe Taf. 74 b).
Die Malaien, welche ich die letzten Kisten aus Long Dĕho abholen liess, brachten nun auch ein nach Samarinda gesandtes Telegramm der Bataviaschen Regierung, das mir Barths bevorstehende Ernennung zum Kontrolleur meldete. Das Telegramm war zwar schon 2 Monate alt, doch erfüllte mich diese verspätete Belohnung meiner Arbeit und Ausdauer nicht mit minderer Genugtuung. Mit den Malaien gleichzeitig kamen auch die 7 Kĕnja Uma-Djalan unter Taman Ulow, die sich bis dahin in Long Tĕpai aufgehalten hatten, den Fluss abwärts gefahren und schlossen sich vorläufig unserer Gesellschaft an.
Teils um die Nachricht von der erfolgten Einsetzung eines Kontrolleurs [313] als feststehende Tatsache so schnell als möglich am Ober-Mahakam zu verbreiten, teils um mich vom Tun und Lassen der Kajan wieder zu unterrichten, sandte ich Dĕlahit am 17. Juni aufs neue nach dem Blu-u. Zum Einkaufe einer möglichst grossen Reismenge versah ich ihn überdies mit Geld; denn die 8 Kĕnja vermehrten die an unsere Vorräte gestellten Ansprüche auf unwillkommene Weise. Die Männer hatten bis jetzt vergeblich nach ihren beiden Landsleuten am mittleren Mahakam geforscht; wie ich gehofft, waren sie durch die gute Auskunft, die sie über unser Leben unter den Long-Glat erhalten hatten, uns gegenüber viel zutraulicher geworden, so dass sie ihre Hütte ruhig hinter Midans Küche aufzuschlagen wagten. Doch berührte sie unser Kreis von Europäern und Malaien noch sehr fremd, und besonders in den ersten Tagen nahm ihr Interesse an allem, was sie sahen, kein Ende. Um, wenn möglich, etwas über den Verbleib der Ihren in Erfahrung zu bringen, liess ich bald Taman Ulow mit einigen meiner Malaien nach Long Dĕho fahren, von wo sie mit der erfreulichen Nachricht zurückkehrten, die beiden Vermissten hätten sich mit einer dritten Person, zum Schutz vor nächtlichen Überfällen, in einem Baum unterhalb des Kiham Udang eine Hütte gebaut und verdienten sich dort mit Rotangsuchen ihren Lebensunterhalt. Bereits am folgenden Tage begaben sich die sieben Kĕnja mit Lalau auf die Suche nach ihren Landsleuten. Die Erzählung von der Hütte im Baum hatte mich anfangs misstrauisch gemacht, weil ich noch nie in Mittel-Borneo etwas Ähnliches gesehen oder gehört hatte, aber 3 Tage später stellte sich die Gesellschaft wieder ein, vermehrt um drei Personen, zwei Kĕnja und einen berüchtigten Long-Glat aus Long Dĕho, der dort so gut wie ausgestossen worden war. Sie hatten wegen der gefährlichen Zustände unterhalb der Wasserfälle und wegen ihrer grossen Schulden beim malaiischen Händler Raup in Long Bagung im Walde eine Zuflucht gesucht und sich nicht besser zu schützen gewusst, als indem sie sich hoch über dem Erdboden in einem Baum eine Hütte bauten, in der sie bereits sehr lange hausten und viel Rotang gesammelt hatten. Mit Hilfe ihrer Landsleute hatten sie den Vorrat nach Long Dĕho hinaufgeschafft und dort vorläufig zurückgelassen, weil man ihnen nur einen sehr geringen Preis für denselben geboten hatte. Die beiden Vermissten waren denn auch anfangs von einer Rückkehr mit ihren Landsleuten nach Apu Kajan nicht sehr erbaut, was diese, die eine monatelange Reise für die beiden nicht gescheut [314] hatten, höchst unangenehm berührte. Da mir bereits die 7 Kĕnja unter Taman Ulow zu verstehen gegeben hatten, wie leid es ihnen täte, zu ihren Familien mit leeren Händen zurückkehren zu müssen, begriff ich, dass es für die beiden anderen, die so viel länger fortgewesen waren, noch viel peinlicher sein musste, nach solch einem Misserfolg die Heimreise anzutreten. Mir selbst bot dieser Umstand eine passende und lang gesuchte Gelegenheit, um die Kĕnja uns zu verbinden, damit diese uns als Führer nach ihrem Lande dienten und uns dort bei ihren ängstlichen Landsleuten einführten. Ich schlug also Taman Ulow und den Seinen vor, dass sie bis zu unserem Aufbruch mit Kwing Irang bei mir bleiben sollten, dass ich sie alle ernähren und reichlich mit verschiedenen Dingen, die sie dann als Ertrag ihrer Reise ihren Angehörigen vorzeigen konnten, versehen und dass ich gegen ähnliche Artikel auch den Rotang Usats und seines Kameraden, die ich beide an dem für sie sehr gefährlichen Mahakam nur ungern zurückliess, kaufen wollte. Da die Kĕnja von meinen ehrlichen Absichten überzeugt waren, nahmen sie nach einigen Unterhandlungen über den Betrag meinen Vorschlag an. Lalau und einigen anderen, die ich tags darauf nach Long Dĕho sandte, gelang es leicht, dort den Rotang für mich zu verkaufen, weil dies nun auf Schuld geschehen konnte. Ibau Adjāng hatte sogleich einen annehmbaren Preis geboten, den er bei späterer Gelegenheit bezahlen wollte; auf diese Weise erwies ich ihm gleichzeitig eine Gefälligkeit, indem ich ihn in den Geldschwierigkeiten unterstützte, in welche seine Familie infolge des Begräbnisses seines Vaters geraten war.
Die Kĕnja erwiesen sich als weit weniger ängstliche Reisegenossen als die Bahau und fühlten sich in unserem Lager augenscheinlich sehr wohl. In ihren Mitteilungen über die Eigentümlichkeiten ihres Landes und Volkes waren sie durchaus nicht zurückhaltend, was für mich sehr angenehm und nützlich war und auf meine Malaien sehr beruhigend wirkte.
Inzwischen kehrte Dĕlahit noch immer nicht vom Blu-u zurück und erhielten wir von dort nur indirekte, sehr unzuverlässige Nachrichten aus Long Dĕho.
Obgleich das ständige Warten mit unsicheren Zukunftsplänen auf unsere Unternehmungslust sehr lähmend wirkte, liess ich in dieser Zeit, wo so viele Menschen müssig im Lager versammelt waren, doch mit Ernst die Jagd betreiben. Doris fand zwar den hohen Urwald um uns herum [315] für eine Jagd auf Vögel sehr ungeeignet, weil diese in Gestrüpp und auf freien Flächen viel zahlreicher erscheinen als in den mächtigen Gipfeln der Waldriesen, wo man sie nicht sehen, jedenfalls nicht schiessen kann. Die Aussicht auf einen Fang neuer Arten war hier auch nicht gross, denn Doris hatte bereits in Long Dĕho viel gejagt. Er erwies sich übrigens als Jäger auf Grobwild und kleinere Vierfüssler viel ungewandter und selbst das Fallenstellen überliess er am liebsten anderen. Hierin hatte es dagegen Abdul während unserer Reise, wie früher schon erwähnt, zur Meisterschaft gebracht; er zeigte sich übrigens auch auf vielen anderen Gebieten sehr gelehrig. Demmeni ging er in allen Dingen sehr geschickt zur Hand. Seine Talente im Beschleichen von Hirschen und wilden Rindern (le̥mbu) erregten das Staunen aller Kajan. Vielleicht bewunderten sie ihn deswegen so sehr, weil sie selbst kein Hornvieh essen und die Gewohnheiten der Tiere, auf die sie nicht Jagd machen, sehr wenig kennen. Von ihrer Unkenntnis in dieser Hinsicht hatte ich mich bereits auf meiner vorigen Reise überzeugt, als ich nicht einmal feststellen konnte, ob das wilde Rind (Bos sundaicus), das im ganzen Mahakamgebiet im jungen Wald und Gestrüpp getroffen wird, in nur einer oder zwei Arten vorkam. Die meisten Bahau gaben zwei Arten in ihrer Gegend an, eine grosse, dunkelbraune und eine kleinere, hellrote; in Wirklichkeit sind es die Stiere, die dunkelbraun, und die Kühe und Kälber, die hellrot gefärbt sind. In unserer Nähe am Boh merkten wir nichts von dem le̥mbu, weil die Herden den dichten Wald vermeiden und nur alte Männchen sich bisweilen in ihm verirren. Auch fanden wir in der Umgegend keine Salzquellen, die am Ober-Mahakam so viel Hornwild anlocken und daher gute Gelegenheit zum Fallenstellen bieten.
Eine sehr beliebte und praktische Methode Wildschweine zu jagen konnten wir aus Mangel an Hunden nicht anwenden. Die Bahau jagen die Tiere nämlich vorzugsweise mit einer Hundemeute, welche das Wild im Walde verfolgt und zum Stehen bringt, worauf die Jäger es mit dem Speere töten oder mit vergifteten Pfeilen schiessen. Mit einem schmalen Lendentuch bekleidet, ohne Kopfbedeckung, mit Schwert und Speer bewaffnet, ziehen die Jäger in den Wald, gefolgt von ihren Hunden, die, im Hause träge und ängstlich, im Busch ein ausgezeichnetes Spürtalent entwickeln und daher im Dickicht, in dem auch ein Eingeborener nur mit Mühe geräuschlos gehen kann, beim Aufspüren des Wildes von grösstem Nutzen sind. Ihr niedriger Entwicklungsstandpunkt [316] verhindert die Bahau jedoch daran, aus dem Überfluss an Wild in ihren Wäldern einen entsprechenden Vorteil zu ziehen. Aus Unwissenheit züchten und unterhalten sie ihre Hunde sehr schlecht, indem sie die besten Exemplare in der Jugend kastrieren, um sie zahmer und folgsamer zu machen, und ihnen auch nur selten geregelt Futter geben; meist müssen sie von Abfällen leben. Das Kastrieren geschieht so, dass man das Tier durch eine Öffnung im Fussboden mit dem Kopf nach unten hängen lässt, während die Hinterbeine über der Öffnung festgehalten werden. Ein Mann schneidet dann mit einem Bambusmesser in das Skrotum eine Öffnung, drückt die Testikel nach einander aus und schneidet sie vom Funiculus ab. Darauf wird die Höhle mit Kapok ausgefüllt und der Hund laufen gelassen. Hierdurch nehmen die besten Tiere an der Fortpflanzung der Rasse nicht Teil, was die Kajan am Blu-u z.B. nicht einsehen wollten. Die Punan und anderen Jägerstämme scheinen in dieser Beziehung aufgeklärter zu sein, auch versorgen sie ihre Hunde weit besser, so dass Jagdliebhaber wie der Pnihing-Häuptling Bĕlarè ihre Tiere bei ihnen kaufen. Auf der Schweinsjagd erweisen sich diese übrigens nur als Spürhunde von Nutzen, denn sie wagen keine grossen Schweine, sondern nur Ferkel anzufallen. Diese bilden denn auch häufig die einzige Jagdbeute, da die Bahau selbst nur ausnahmsweise mutig genug sind, um grosse Tiere aus der Nähe zu stechen und da mit giftigen Pfeilen verwundete Tiere noch weit laufen können und daher oft verloren gehen. Von anderem Wild werden hauptsächlich Ottern, Eichhörnchen, Wiesel, Leguane und dergleichen mit Hilfe der Hunde gejagt. Leguane dürfen Erwachsene übrigens nicht essen, für Kinder und Greise dagegen, welche in diese Periode noch nicht eingetreten oder über sie schon hinaus sind, ist dies Verbot ungültig.

Buring Pengai, neunzehnjährige Kajanfrau.

Buring Pengai, neunzehnjährige Kajanfrau.
Auch das andere Wild darf nicht ohne weiteres gegessen werden; die Eingeborenen schneiden jedem Tier den Bauch auf, weiden es aus und entfernen vorsichtig beiderseits der Wirbelsäule den psoas derart, dass sie ihn an den Anheftungsstellen lösen und ihn quer zu durchschneiden vermeiden. Nach ihrer Überzeugung fangen die Jäger, wenn sie einmal einen psoas durchschnitten haben, nie wieder ein solches Tier. Auch bei der Zubereitung von Fischen befolgen die Kajan eigenartige Gebräuche. Um Unglücksfällen beim nächsten Fischfang vorzubeugen, müssen sie den untersten Teil des Bauches von der Brust- bis zur Schwanzflosse in einem Stück wegschneiden, und beim darauffolgenden [317] Ausweiden darf die Schwimmblase nicht angeschnitten werden, hauptsächlich nicht in querer Richtung.
Ein sehr bevorzugtes Wildbret ist der von den Malaien lutung genannte schwarze Affe mit langem Schwanz und weissen Flecken auf der Stirn (Semnopithecus niger). Einige essen sogar die mit ihrem Inhalt von halbverdauten Blättern fein geschnittenen und in Wasser gekochten Eingeweide dieses Affen, andere, wie Kwing Irang, fanden an diesem Gericht keinen Geschmack.
Zu gewissen Zeiten, wenn bestimmte giftige Früchte reifen, werden Argusfasane, Stachelschweine und einige Fische nicht gegessen, weil diese durch den Genuss der Früchte ebenfalls giftig werden. Dass diese Vorsicht berechtigt ist, erfuhren wir auf meiner ersten Reise, als wir auf einer Jagdstation uns eines Abends nach dem Essen eines Argusfasans unbehaglich zu fühlen begannen. Mein Magen begann heftig gegen seinen Inhalt zu protestieren, aber dabei blieb es, und in dem Glauben, dass diese Erscheinung auf eine Erkältung oder eine andere harmlose Ursache zurückzuführen sei, begab ich mich in mein Klambu und schlief vor Ermüdung sogleich ein. Bald nach Mitternacht erwachte ich jedoch an heftigen Schmerzen zwischen den Schulterblättern, welche auf die Brust hinausstrahlten und die Atemholung sehr erschwerten. Später verbreitete sich der Schmerz, der am meisten einem heftigen Muskelschmerz nach Überanstrengung glich, über Rücken und Bauch, wodurch ein Liegen und Aufrechtstehen unmöglich wurde und ich mich auf einen Stuhl setzen und über einen Tisch lehnen musste, um den Zustand ertragen zu können. Noch immer stieg nicht die leiseste Vermutung einer Vergiftung in mir auf; ich dachte an eine rheumatische Ursache, als die Erscheinungen sich morgens durch häufiges Erbrechen bei leerem Magen komplizierten und auch die Darmfunktion sich stärker als gewöhnlich äusserte.
Da nun auch meine damaligen Reisegenossen Von Berchtold und Demmeni über Übelkeit und Muskelschmerzen klagten, trat der Gedanke an eine Vergiftung mehr in den Vordergrund, aber vor der Hand liess mich mein eigener Zustand an nichts anderes denken. Plötzlich stellte sich auch sehr heftiges Herzklopfen bei schwachem Puls ein, und wenn meine Gefährten sich nicht auf den Beinen gehalten hätten, wären die schlimmsten Befürchtungen in mir aufgestiegen. Gegen 2 Uhr mittags lokalisierten sich die Muskelschmerzen in Armen und Beinen und ich genoss während einiger Stunden der sehr notwendigen [318] Ruhe. Andere Folgen blieben bei uns allen aus. Die Ursache der Vergiftung war uns anfangs unerklärlich; da ich in der Regel mehr Fleisch, die anderen mehr Reis genossen, brachte uns dies auf den Argusfasan, der vielleicht mit Arsenik, das wir beim Präparieren der Vogelbälge so viel gebrauchten, in Berührung gekommen war. Eine böse Absicht seitens unserer Kajan erschien mir völlig ausgeschlossen, denn die Leute waren durch meine Krankheit sehr niedergeschlagen. Immer wieder kam einer, um aus der Ferne nachzusehen, wie es stand, und vertiefte sich dann mit seinen Kameraden in eine Diskussion über die Ursache meines Leidens. Hierüber waren die Meinungen geteilt: der eine schrieb es den Geistern des Berges Lilit Bulan zu, die ich durch mein Steineklopfen erzürnt hätte, die anderen erzählten, es kämen dann und wann Argusfasanen vor, nach deren Genuss auch sie krank würden. An die erste Erklärung konnte ich nicht glauben und auch die zweite kam mir sehr unwahrscheinlich vor, denn von Vögeln mit vergiftetem Fleisch hatte ich noch nie gehört. So blieb denn die Vorstellung einer leichten Arsenikvergiftung bestehen, obgleich Von Berchtold sie für unmöglich erklärte.
Er selbst lieferte uns später den Beweis, dass der Genuss eines Argusfasans in der Tat bisweilen Vergiftungen verursachen kann. Als er nämlich mit 4 Kajan in unserem Lager zurückgeblieben war, erkrankte die ganze Gesellschaft schwer nach dem Genuss eines anderen Exemplars dieses Vogels. Da er mehr nervös von Natur war, traten bei Berchtold neben lebhaften Schmerzen auch tonische und klonische Krämpfe auf, die mit heftigen und anhaltenden Erscheinungen in den Verdauungsorganen gepaart gingen. Dieser Zustand dauerte ganze vier Tage. Auch die vier Kajan litten so stark, dass keiner von ihnen Hilfe suchen konnte und alle fünf später sehr abgemagert und geschwächt aus dem Walde zu uns zurückkehrten.
So glaube ich diese Vergiftung dem Genuss des Argusfasans zuschreiben zu müssen, der wahrscheinlich selbst durch Früchte vergiftet worden war.
Bei der Jagd auf kleine Säugetiere und Vögel haben die Eingeborenen einen besseren Erfolg mit dem Fallenstellen als mit dem Blasrohrschiessen. Die Fallen werden in den Durchgängen von Hecken angebracht, welche aus umgehauenen Sträuchern in einer Länge von mehreren hundert Metern aufgerichtet werden. Die Öffnungen in der Hecke befinden sich in der Nähe dünner, gebogener Bäumchen, die [319] als Feder dienen, um die daran befestigte Schlinge in die Höhe zu ziehen, sobald der Widerstand, der sie gebogen hielt, entfernt wird. Dieser Widerstand wird durch eine dünne Schnur gebildet, deren eines Ende am Gipfel eines Stämmchens befestigt ist, deren anderes ein 6 cm langes Hölzchen trägt. Letzteres wird unten auf dem Boden zwischen einer gebogenen, an beiden Enden in der Erde steckenden Rute und dem Rand eines aus gespaltenem Rotang geflochtenen viereckigen Rahmens eingeklemmt gehalten. Mit dem einen Rande ruht dieser Rahmen schräg auf dem Grunde des Durchgangs, mit dem gegenüberliegenden auf dem anderen Ende des Hölzchens an der Schnur des Baumgipfels. Die Federkraft des gebogen gehaltenen Stämmchens zieht das Hölzchen so stark gegen den Rand des etwa 2 dm2 messenden Bambusrahmens, dass dieser geneigt gehalten wird. Dadurch, dass die eigentliche Schlinge mit dem einen Ende mit dem Stammgipfel verbunden und das andere in Form einer offenen Schlinge auf dem geneigten Rahmen ausgebreitet ist, wird bewirkt, dass durch einen Tritt auf den Rahmen dieser auf den Boden klappt, das Hölzchen losschiesst und der Stammgipfel, der dann nicht mehr nach unten gehalten wird, beim Hinaufschnellen die Schlinge mit nach oben zieht. Ein Sachkundiger legt die Schlinge unter einigen Blättern so auf dem Rahmen aus, dass jeder hier auftretende Fuss von der emporschnellenden Schlinge gepackt und das Tier gefangen wird. Für hühnerartige Vögel ist diese Fangmethode besonders zweckmässig, weil man diese Tiere ihrer Scheuheit wegen in diesem Chaos von totem und lebendem Holz und Laub nicht beschleichen kann. Auch der kantjil (Cervulus muntjac) und einige Affen werden mit diesen Fallen gefangen; grössere Tiere zerreissen die Schlingen, was häufig geschieht.
Derartige Fallen werden auch um die Tanzplätze der Argusfasanen aufgestellt, die an hochgelegenen Waldstellen oder häufig auch auf den Gipfeln von Bergrücken, wo sie eine Stelle zum Abhalten ihrer Wetttänze von Ästen und Blättern säubern, zusammenzukommen pflegen. Diese sonst so scheuen Vögel gehen an einem solchen Ort leicht in die Falle. Für diese Schlingen werden die Schnüre aus den Fasern eines braunen Baumbasts gedreht, weil diese im Busch weniger auffallen als die gewöhnlichen grauen Schnüre, die aus dem Bast der Lianen aka klẹa oder te̥ngāng verfertigt werden, indem man diesen in 3–4 dm lange Fasern auseinander zupft und dann zusammendreht.
Wie gesagt, verstehen sich lange nicht alle Bahau gut auf das Fallenlegen; [320] nach ihrer Überzeugung hängt der Erfolg auch viel mehr von der Beachtung aller Vorsichtsmassregeln beim Aussetzen der Schlingen als von der dabei befolgten Sorgfalt ab. Vor allem muss der Tag schön sein, ohne Regen und Nebel; Unbeteiligte dürfen von der Unternehmung eigentlich nichts wissen, auch mag man sich über das erwartete Resultat nicht auslassen. Eine grosse Gesellschaft ist beim Bau der Hecke unerwünscht; am besten ist es, wenn ein oder zwei Männer sich ohne Mitwissen anderer auf den Weg machen. Dem Fallensteller darf vorher auch kein guter Erfolg gewünscht werden, eine Regel, die übrigens für alle Jäger und Fischer gilt und gegen die ich mich anfangs aus Unwissenheit recht häufig versündigte.

Erlegter wilder Stier.
Nicht nur Menschen, sondern auch Hunde jagen bei den Mahakambewohnern nur nach einer vorhergehenden Beschwörung mit Erfolg. Während meines Aufenthaltes an unserer vorhin erwähnten Jagdstation am Blu-u fürchtete Kwing einmal, dass seine Hunde nach einigen schlechten Vorzeichen die ersehnte Wildschweinbeute nicht liefern würden. Er suchte daher einige Blätter von daun long, die gegen böse Geister wirksam sind, packte seinen besten Hund beim Nacken, klopfte ihm, einige Sätze murmelnd, mit dem Blatt 8 Mal auf den Kopf und nahm dann mit dem Hinterteil des Tieres dieselbe Prozedur vor, worauf er dieses in die Höhe hob und mit kräftigem Schwunge an einer tiefen Stelle ins Flüsschen Dingei warf. Auch seine beiden anderen Hunde kamen an die Reihe, und da ich Kwings Beschwörungen aus einiger Entfernung nicht verstehen konnte, brachte ich ihm meinen Sultan zur gleichen Bearbeitung. Während er nun auch diesen mit demselben Eifer beklopfte, gab er ihm den Auftrag, an diesem Tage im Aufspüren des Wildes sein Bestes zu leisten und sich besonders auf die Schweinejagd zu verlegen. Um den Erfolg seiner Bemühungen nicht zu vereiteln, warf nun auch ich meinen Hund mit kräftigem Schwung in den Fluss, voll Vertrauen auf ein günstiges Resultat. Leider brachte uns dieser Tag nur Enttäuschung, die Hunde schlugen sogar kein einziges Mal an.
Sehr auffällig war es, dass die Kajan so sehr wenig auf die Gewohnheiten des gesuchten Wildes zu achten verstanden; einst mussten wir ihrer Ungeschicklichkeit wegen die Verfolgung eines wilden Rindes sogar aufgeben. Zwar töteten sie später einen durch Verwundung erschöpften Stier, aber mit so vielen Speerstichen, dass sein Fell nicht mehr zu gebrauchen war. Einige Kajan eilten sogar nachdem [321] das Tier schon niedergemacht war, noch herbei und durchstachen zum Beweis ihres Mutes auch die Leiche noch mit dem Speer.
Die Punan verstehen sich als Jägerstamm wahrscheinlich besser auf die Jagd, doch habe ich sie nicht selbst beobachten können. Grosse Tiere, wie das Nashorn, wissen übrigens auch sie nicht auf rationelle Weise zu erlegen. Hat nämlich jemand die Spur eines Nashorns entdeckt, so vereinigt sich eine grosse Anzahl hauptsächlich mit Speeren bewaffneter Männer und beschleicht das Tier im Schlaf oder wenn es an Gegenwehr nicht denkt. Dadurch, dass man dem Opfer immer wieder einen Speerstich beibringt, verendet es allmählich vor Schwäche, bisweilen jedoch erst nach 8 Tagen, nachdem es oft mehrere Menschen verwundet oder getötet hat. Ähnliches berichteten mir einmal einige Kajan von ihrer Jagd auf die Riesenschlange (Boa constrictor). Sie verfolgten das Tier, dem sie beim Sammeln von Waldprodukten begegnet waren, über zwei recht hohe Hügelrücken und töteten es erst nach mehreren Stunden. Die Schlange soll den Umfang eines Männerthorax gehabt haben. Das Fleisch der Boa wird nur von den Punan genossen.
Die nichts weniger als glänzenden Jagdresultate unserer Kajan hätten in uns die Vorstellung geweckt, die tropischen Wälder seien arm an Wild, wenn uns nicht die Jagderfolge unseres Reisegenossen Von Berchtold auf unserem vorigen Zuge vom Gegenteil überzeugt hätten. Obgleich Von Berchtold alle gesammelten Tiere präparieren musste, wodurch ihm zum Jagen nicht viel Zeit übrig blieb, schoss er doch so viel Wild wie alle anderen zusammen. Er besass aber auch ein ganz anderes Verständnis für die Jagd, auch kamen ihm seine in europäischen Wäldern erworbenen Erfahrungen sehr zu statten. Bei der Vogeljagd verfuhr er folgendermassen: er setzte sich an geeigneter Stelle im Walde hin und wartete bewegungslos der kommenden Dinge. In der stillen, dunklen Umgebung begann es sich dann bisweilen bereits nach kurzer Zeit zu regen. In den Bäumen zeigten sich eine Menge sehr verschiedener kleiner Vögel und allerlei Arten äusserst zierlicher Eichhorne, auch Affen, die ihre Schlupfwinkel auf den Ästen verliessen und auf dem Erdboden nach abgefallenen Früchten suchten. Um einen Baum mit reifen Früchten sammelten sich eine Menge fliegender und laufender Waldbewohner; bei einigen Feigenbäumen mit orangefarbigen Früchten in unserer Nähe schoss er in 1 Stunde mehrere neue Vogelarten und einige rebhuhnartige Waldhühner, die unserem Mittagstisch eine Extraschüssel lieferten. [322]
Ein ausgezeichnetes Lockmittel, das Von Berchtold manchen sehr scheuen Vogel einbrachte, bestand in der Nachahmung seines Rufes. Hierzu gehörte viel Geduld, Übung und Talent, aber da er diese drei Erfordernisse besass, waren seine Resultate glänzend. Das Nachahmen der Männchen lockte Weibchen, das der Weibchen Männchen herbei. Die Tiere kündigten sich meist durch Ausstossen des Lockrufs selbst aus der Ferne an und liessen sich oft viel zu dicht vor dem Flintenlauf nieder, um mit einiger Aussicht auf Erhaltung der Haut geschossen werden zu können. In diesem Fall bedeutete eine Vergeudung der Munition auch ein nutzloses Morden, denn eine zerschossene Vogelhaut ist für die Präparation wertlos. Daher müssen bei verschiedenen Gelegenheiten auch verschiedene Patronen angewandt werden; ein zu grobes Schrot oder eine zu schwere Ladung, bei der die Körner zu dicht beieinander bleiben, verderben die Haut unvermeidlich. Da man im Urwalde nur in seltenen Fällen auf grossen Abstand schiessen kann, ist hier eine Flinte von sehr kleinem Kaliber am geeignetsten; nur wenn es grosse Nashornvögel oder ähnliche Tiere in 40–50 m hohen, oft dicht beblätterten Gipfeln zu schiessen gilt, ist ein Kaliber 12 oder 16 mit grobem Schrot vorzuziehen. Hat man in dem grünen Gewirr hoch über der Erde seine Beute tötlich getroffen, so ist man noch lange nicht sicher, diese auch heimbringen zu können. Behält der Vogel noch Kraft genug, um durch Ausbreiten seiner Schwingen dem Fall eine schiefe Richtung zu geben, so dass er in einem Abstand von 20 oder 30 m niedersinkt, so ist er nur mit grosser Mühe wiederzufinden. Da Sträucher, tote Bäume, grosse Äste und dicke Blätterschichten das Opfer verbergen und man sich durch allerhand Hindernisse zu ihm durcharbeiten muss, findet man den Vogel bisweilen erst nach langem Suchen. Kleine Vögel und kleine Säugetiere, die noch kräftig genug waren, um sich in den zahllosen Schlupfwinkeln und Höhlungen im Erdboden verkriechen zu können, werden in der Regel nicht wiedergefunden. Unter diesen Umständen erfordert die Jagd grosse Geduld, auch muss man sich auf viele Enttäuschungen gefasst machen. Findet der Jäger vom kleineren Wild etwa die Hälfte wieder und ist diese zum Präparieren tauglich, so kann er mit seinem Erfolge zufrieden sein. Mit dressierten Hunden und geschulten eingeborenen Knaben könnte man im Urwalde wahrscheinlich bessere Jagdresultate erzielen, doch fehlte es uns an beiden. [323]
Als Anfang Juli Dĕlahit nach 14 tägiger Abwesenheit noch nicht zurückkehrte und wir nichts von ihm vernahmen, überdies auch unser Reis und die anderen Nahrungsmittel einer Ergänzung sehr bedurften, sandte ich Midan mit einem Boote nach Long Tépai zum Einkaufen des Erforderlichen und gab ihm Lalau mit, damit dieser sich nach meiner Gesandtschaft umsehen sollte. Letztere traf 2 Tage später mit sehr günstigen Berichten bei uns ein: die Kajan am Mahakam waren sehr für unseren Zug und hatten ihr dangei-Fest bereits im vorigen Monat gefeiert, obgleich die Zeit hierfür wegen einiger Todesfälle ungünstig gewesen war. Kwing Irang hatte jedoch Dĕlahit nicht fortziehen lassen, bevor sie die Vögel befragt hatten, aus Furcht, dass ich aus Ungeduld die Reise aufgeben könnte. Die Todesfälle hatten die Kajan bis jetzt am Vorzeichensuchen verhindert, aber jetzt waren die verschiedenen Häuptlinge reisebereit und Kwing Irang sollte bald eintreffen.
Einige Tage später erschienen auch Midan und Lalau mit einer genügenden Menge Reis, Früchte, Tabak und anderen nützlichen Dingen. Jedesmal wenn ich ein Boot nach Long Dĕho schickte, gab ich auch einige eiserne Koffer mit den eben angelegten Sammlungen von Fischen und Vögeln mit, damit sie in Ibau Adjāngs Hause bis zu meiner Rückkehr aufbewahrt würden.
Als ein Tag nach dem anderen verging und wir noch immer nichts von der Ankunft unseres Bahau-Geleites hörten, wurde uns das Warten zu einer wahren Marter. Dĕlahit hatte übrigens die Bestätigung des Gerüchtes mitgebracht, das ich bereits von Taman Ulow und seinen Leuten gehört hatte, nämlich dass der Kĕnjafürst Bui Djalong (Taman Kuling) mit vielen anderen Häuptlingen auf eine Einladung des Radja hin nach Sĕrawak gezogen, auf der Rückreise aber von den Batang-Lupar angefallen worden war, wobei einer der Schutzsoldaten aus Sĕrawak, welche die Kĕnja begleiteten, das Leben verloren hatte. Dieser Vorfall überzeugte mich wiederum von der Notwendigkeit unserer Reise nach Apu Kajan; wahrscheinlich waren die Häuptlinge auch nach den jüngsten Erlebnissen zum Empfang der Niederländer besonders geneigt.
Am 10. Juli sandte ich nochmals Lalau und Dĕlahit mit 5 Mann nach dem Blu-u, um zu erfahren, wie es dort stehe. Bei Bang Jok in Long Dĕho waren die Reiseaussichten inzwischen günstiger geworden, die Böte lagen sogar zur Abfahrt bereit da. Lĕdjü Adjāng, der [324] erwartete jüngste Sohn des verstorbenen Häuptlings, war inzwischen von den Ma-Suling am Mĕrasè ins Elternhaus zurückgekehrt und in seiner Gegenwart hatte man des Vaters Leiche im bereits gebauten Prunkgrab beigesetzt. Man hatte dem salong, wahrscheinlich auf Wunsch des Verstorbenen, eine besondere Form gegeben. Bo Adjāng Lĕdjü hatte mir vor seinem Tode öfters seine Besorgnis darüber ausgedrückt, dass der Sultan von Kutei im Geheimen seinen Schädel aus dem Grabe würde holen lassen, wie er auch die Schädel einiger anderer Häuptlinge in einer Kiste in seinem Palaste aufbewahrte, um durch deren Besitz Macht über die Bahaustämme ausüben zu können. Adjāng Lĕdjü hatte daher gewünscht, dass man seinen salong an einer weit abgelegenen, verborgenen Waldstelle erbaute. Seine Kinder hatten das Prunkgrab sicherheitshalber statt über der Erde, wie gewöhnlich, unter der Erde anlegen lassen, die Holzkammer, in welcher der Sarg stand, mit dicken Planken geschlossen und darüber ein Dach wie bei einem gewöhnlichen salong errichtet; auch hatten sie keinen verborgenen Platz ausgesucht, sondern das Mahakamufer dicht unterhalb Long Dĕho gewählt, so dass jeder Anschlag der Malaien sogleich bemerkt werden musste.
Auf seiner Rückreise zum Mĕrasè machte Lĕdjü Adjāng, der Sohn des Verstorbenen, bei mir Halt, teils aus Neugierde, teils weil ein Besuch bei mir den Gästen meistens ein Geschenk einbrachte. Ich hatte den Grundsatz, nicht nach Gutdünken zu schenken, sondern abzuwarten, bis die Gäste mir ihre Wünsche zu verstehen gaben. Lĕdjü hatte augenscheinlich die Goldstücke gesehen, mit denen ich die Kajan bezahlt hatte, denn er bat mich, einige Stücke von mir kaufen zu dürfen, um aus ihnen Perlen für seine Frau Bulan Li schmieden zu lassen, natürlich wünschte er, sie unter ihrem Werte zu erstehen. Mit einem Verlust von einigen Gulden gewann ich Lĕdjü Adjāngs Gunst und wir schieden als die besten Freunde.
Am 16. Juli kam Dĕlahit nach schneller Fahrt vom Blu-u mit dem Bericht zurück, die Kajan würden am folgenden Tage abreisen, sie wären nur durch den Tod von zwei Dorfgenossen aufgehalten worden. Die Betreffenden, zwei sehr schwächliche Individuen, waren der Influenza erlegen. Um die Kajan im Auge zu behalten, war Lalau bei Kwing Irang geblieben.
Trotzdem gingen wieder etliche Tage ohne Berichte von oben vorbei, so dass ich das Warten nicht mehr ertrug und Dĕlahit am 22. [325] nochmals an den Blu-u schickte. Meine Malaien bereiteten indessen Kleider und Waffen zur Reise vor, augenscheinlich waren sie also von dem Zustandekommen derselben überzeugt, was auf mich, der ich nie sicher war, von den Eingeborenen die volle Wahrheit zu hören, sehr ermutigend wirkte. In diesen Tagen brachte mir auch Midan aus Long Dĕho die Nachricht, der Kontrolleur Barth sei in Begleitung von bewaffneten Schutzleuten und anderen Gehilfen bereits in Udju Tĕpu angekommen. Nach dem Bericht einiger von oberhalb der Wasserfälle bei uns einkehrender Kahajan-Dajak war Kwing Irang mit seinen Leuten in der Tat abgereist, aber bei seiner Ankunft in Lulu Njiwung war dort gerade ein Mann gestorben und noch nicht begraben, ein schlechtes Vorzeichen, das ihn zur Rückkehr nötigte.
Die Kĕnja von Taman Ulow zwang ich zum geduldigen Ausharren durch die Belohnung, die ich ihnen versprochen hatte, und die Tauschartikel, mit denen ich ihren Rotang bezahlen wollte. Sie unterhielten sich bei uns ausgezeichnet und die beiden Landstreicher assen sich wieder dick, nur waren sie wie wir durch die ständigen Reisehindernisse sehr enttäuscht und sprachen daher öfters den Wunsch aus, allein voraus zu fahren. Einige wollten gern weiter unten am Mahakam Rotang suchen, was ich nicht zulassen konnte, da die Kĕnja dort wegen der letzten Kopfjagden, die ihre Stammesgenossen verübt hatten, nicht sicher waren.
Sobald sie merkten, dass sich unser Aufenthalt im Lager dem Ende nahte, beschlossen sie, der Seele eines Kameraden, der auf einer früheren Reise im Kiham Burung aus dem Boot geschleudert worden und ertrunken war, ein grosses Opfer zu bringen. Letzteres sollte in einem Packen Kattun bestehen, um den sie mich baten, und den sie mit langen Holzspähnen verzierten. Mit Rücksicht auf die reichlich zur Verfügung stehende Zeit wurde das Opfer diesmal nicht wie gewöhnlich im Vorüberfahren mit etwas Salz in einem Korbe an einen niedrigen Strauch gehängt. Sie wählten einen hohen, kerzengerade neben unserem Lager auf dem Ufer sich erhebenden Baum aus, der unten seiner Dicke wegen nicht bestiegen werden konnte und dessen unterster Ast sich hoch über dem Erdboden befand. Sie suchten diesen, nach Art der Punan, von einem benachbarten, leichter zu erklimmenden Baume aus zu erreichen. Zu diesem Zwecke bauten sie im Gipfel des Hilfsbaumes eine Plattform, warfen von dieser aus einen an einen dünnen Rotang befestigten Stein über den betreffenden Ast des anderen Baumes und zogen dann [326] eine vorher hergestellte lange Rotangleiter erst bis zum Ast, dann halb über diesen hinüber, so dass ein Mann hinaufzuklettern wagte. Dieser brachte nun von Ast zu Ast einfache Rotangleitern oder auch Rotangkabel an, an denen er bis an die Stelle hinaufstieg, wo der Stamm selbst zum Klettern dünn genug war. Sämtliche Äste wurden darauf weggehackt, eine kleine Krone am höchsten Gipfel ausgenommen, unter welcher das verzierte Kattunbündel (sang) aufgehängt wurde. Dieses Geschenk sollte die Seele des Verunglückten angenehm stimmen und bei Amei Tingei im Himmel ein guter Fürsprecher für sie sein.
Ins Auge springend war der verschiedene Grad von Geistesentwicklung und Geschicklichkeit, den die Kĕnja bei dieser Beschäftigung äusserten; während der eine angab, wie alles vor sich gehen und der sang beschaffen sein musste, befand sich unter den Neun nur ein einziger, der diesen Baum zu erklimmen und dann alle Äste abzuhacken wagte. Wir benützten die Gelegenheit zum Messen des Baumes; seine Höhe betrug 55 m. Als Arbeitslohn und Zerstreuung für uns alle gab Demmeni abends eine Vorstellung mit seinem Grammophon, der stets die Bewunderung und Heiterkeit unserer braunen Reisegesellen erregte; besonders wenn er Lachen zum besten gab, brach auch die ganze Gesellschaft in schallendes Gelächter aus. Wegen der äusserst feuchten Atmosphäre in unserem Lager litten die Tonplatten durch den Stift, so dass wir nur selten diese Vorstellungen zu geniessen wagten.
Nach drei Tagen Regen und Hochwasser kam Dĕlahit endlich am 28. Juli mit der Meldung, dass Kwing Irang mit Gefolge bereits seit 4 Tagen in Long Kawat oberhalb des Kiham Hida kampierte, weil er die Fälle des hohen Wasserstandes wegen nicht passieren konnte. Er liess mich jedoch um Arzneien für seine Schwester Bo Uniang, die in Long Tĕpai schwer krank lag, und um Mittel gegen Fieber für sich selbst bitten, die ich ihm denn auch sogleich sandte.
Am 1. August, nachdem das Wasser gefallen war, erschien Kwing Irang endlich mit 50 seiner Leute und einem Boot mit Pnihing von Long Kup in unserem Lager. Bĕlarè war noch nicht mitgekommen und die Leute aus Long Tĕpai konnten ebenfalls nicht kommen, falls Bo Uniang starb, was Kwing für sehr wahrscheinlich hielt. Er war denn auch nicht bei der Schwester geblieben aus Furcht, durch ihren Tod von der Reise abgehalten zu werden; letzteres wollte er nicht nur meinetwegen vermeiden, sondern auch seiner jungen Männer [327] wegen, die sich nach dem so lange aufgeschobenen Zuge sehnten. Die Kajan hatten sich nur mit ihrem notwendigsten Gepäck über die Fälle gewagt und ihren Reis in Long Kawat gelassen; das starke Sinken des Wassers gestattete ihnen jedoch bereits am folgenden Tage, alle Vorräte herunter zu schaffen.
Am selben Tage sandte ich zum letzten Mal Postsachen und zwei Koffer nach Long Dĕho; erstere sollten mit der ersten Gelegenheit von den Händlern zur Küste gebracht werden, letztere bei Lĕdjü Adjāng aufbewahrt bleiben. Gleichzeitig sollten meine Leute Bang Jok Kwing Irangs Ankunft und unsere baldige Abreise melden. Auch die Kajan und Pnihing waren endlich von der Notwendigkeit eines schnellen Aufbruchs überzeugt, weil Kwing, im Fall dass seine Schwester starb, sicher von den Dorfbewohnern abgeholt werden würde; sie hatten denn auch unten bei unserem Lager nur sehr primitive Hütten aufgeschlagen. Sehr erfreut waren sie über die Anwesenheit der Kĕnja, besonders jetzt, wo die Long-Glat von Long Tĕpai, die einzigen, die den Weg nach Apu Kajan kannten, wahrscheinlich nicht würden mitreisen können. Ich bereitete die Kĕnja auch sogleich auf ihre künftige Führer- und Gesandtenrolle vor und entschädigte sie reichlich für die lange Zeit, die sie bei uns ausgeharrt hatten; diese Freigebigkeit durfte ich mir jetzt gestatten, weil ich die Tauschartikel ursprünglich für einen einjährigen Aufenthalt bei den Kĕnja berechnet hatte und ich jetzt, nach einer Abmachung mit Kwing, nicht über zwei Monate bei ihnen bleiben sollte. Auch die beiden Kĕnja, deren Rotang ich gekauft hatte, waren von meiner Freigebigkeit entzückt.
Abends wurden in einer Beratung Pläne entworfen, über die wir uns bald einigten, da jeder für rasches Weiterkommen war. Sowohl der Schnelligkeit wegen als um mit dem Zug einen Anfang gemacht zu haben, bevor Kwing von Long Tĕpai aus abgeholt werden konnte, wurde beschlossen, dass die Malaien bereits am 3. August morgens Koffer und Blechgefässe mit Salz so weit als möglich den Boh hinauftransportieren und dann abends zurückkehren sollten, was auch geschah. Ferner sollten wir nicht gemeinschaftlich, sondern etappenweise den Zug ausführen, weil unser Gepäck sehr umfangreich war und auch die Bahau selbst sehr viel Reis und Tauschartikel mit sich führten. Den einen Tag sollten die Bootsleute so viele Sachen als möglich an einen geeigneten Lagerplatz vorausschaffen und dann wieder zu uns zurückkehren, den anderen sollten wir mit ihnen bis zu dieser Stelle [328] den Fluss hinauffahren. Die Kĕnja sollten in Gesellschaft von 6 Kajan direkt nach Apu Kajan vorausreisen, um unsere Ankunft dort zu melden, auch beauftragte ich sie, sehr sorgfältig durch Zeichen an den Mündungen die Flüsse anzugeben, die wir hinauffahren mussten, damit wir uns in dieser Wildnis nicht verirrten.
Taman Ulow liess sich sehr ausführlich einschärfen und mehrmals wiederholen, was er seinen Häuptlingen als Grund für meinen Besuch angeben sollte. Ich hatte mir bereits seit langem vorgenommen, meine Reise damit zu motivieren, dass ich die in der letzten Zeit zwischen den Kĕnja und Mahakambewohnern wegen der Kopfjagden und hauptsächlich wegen der Ermordung von Bui Djalongs Enkel entstandenen Feindseligkeiten durch Unterhandlungen aus dem Wege räumen wollte. Die übrigen politischen Resultate, die unsere Expedition bezweckte, sollten sich dann während unseres Aufenthaltes von selbst ergeben. Kwing Irang war von diesem neutralen Reisemotiv, das häufig auch die Bahauhäuptlinge zu weiten Zügen veranlasst, sehr eingenommen.
An dem Ernst, mit dem die Bahau über das Geschenk, das ich dem Oberhäuptling Bui Djalong geben sollte, diskutierten, merkte ich ihre Besorgnis um den Verlauf der Reise. Augenscheinlich hatten sie über diese Frage bereits lange allein unterhandelt, denn Kwing Irang erklärte mir sehr bestimmt, dass mein Geschenk an Bui Djalong überhaupt nur in einem Sklaven bestehen dürfe, auch habe er bereits einen solchen in Long Tĕpai zu meiner Verfügung, den einige Kahajan-Dajak vor kurzem einem dortigen Häuptling verkauft hatten.
Ich kannte das Individuum sehr gut, hatte aber bisher nicht gewusst, dass es kein eingeborener sondern ein missachteter Kaufsklave war, den man für 240 fl abtreten wollte. Dieser Sklave sollte mit einigen Männern aus Long Tĕpai an unserer Reise teilnehmen, ohne von seinem Verkauf und dem Zweck desselben etwas zu ahnen; bei unserer Ankunft am Kajanfluss sollte ich ihn dann Bui Djalong zum Geschenk übergeben und in Apu Kajan zurücklassen. Dieser edle Plan fand bei mir jedoch gar keinen Beifall, obgleich auch Taman Ulow versicherte, sein Häuptling würde ein derartiges Geschenk sehr zu schätzen wissen. Ich erklärte mit Nachdruck, dass wir Europäer nicht gewohnt seien, Menschen zu Sklaven zu machen und ich nur dann den Sklaven kaufen wollte, wenn dadurch die ganze Tawang-Angelegenheit aus dem Wege geräumt und der Sklave an Statt des ermordeten Enkels in die Familie von Bui Djalong aufgenommen [329] werden würde. Wie meine Ratgeber aussagten, wird aber solch ein Sklave, wenn bei den Unterhandlungen vorher nicht eine bestimmte Abmachung getroffen worden ist, an Stelle des Ermordeten getötet, und so konnte vorläufig von der Mitnahme eines Sklaven keine Rede sein. Für Kwing Irang bedeutete meine Ablehnung eine harte Enttäuschung; er schien seine Angst vor einem Fehlschlagen unseres Zuges hauptsächlich in dem Gedanken an ein derartig kostbares Geschenk überwunden zu haben. Ich schärfte ihm jedoch meinen Abscheu vor einer solchen Handlung so gründlich ein, dass er den Gegenstand nicht mehr zu berühren wagte. Da ich wusste, welch einen hohen Wert gute Gewehre bei den Kĕnja besitzen, schlug ich nun meinerseits vor, Bui Djalong eines unserer guten Beaumontgewehre mit einem reichlichen Vorrat an Patronen als Geschenk anzubieten, obgleich ich der Einführung von Feuerwaffen bei den eingeborenen Stämmen nicht gern Vorschub leistete. In diesem Fall schwanden aber meine Bedenken wegen der Wichtigkeit der Angelegenheit, und dass ich mit meinem Vorschlag das Richtige getroffen, ging aus dem Eifer hervor, mit dem Taman Ulow auf ihn einging; dies bewog auch Kwing Irang zuzustimmen. Zwar kam er später nochmals auf seinen Vorschlag zurück, aber ich blieb bei meinem Beschluss.
Am frühen Morgen des 3. August fuhren alle meine Malaien und die Kĕnja mit einer grossen Menge Gepäck den Boh aufwärts, während die Kajan noch den Rest ihrer Sachen vom Kiham Hida nach unserem Lager schafften. Abends sollten sich die beiden Gesellschaften jedoch wieder bei uns vereinigen. Gegen Mittag desselben Tages meldeten uns zwei Personen aus Long Tĕpai den Tod von Bo Uniang, den wir jeden Augenblick erwartet hatten. Das Herz klopfte mir im Gedanken an eine Vereitelung meines Zuges im letzten Augenblick; Anjang Njahu, der mich nach Kwing Irangs Hütte abholen kam, gab mir jedoch im Geheimen zu verstehen, dass sein Häuptling selbst nicht nach Long Tĕpai zurück wolle, dass er aber des ungünstigen Eindrucks wegen, den es auf das Volk machen würde, seinen Wunsch nicht durchsetzen könne und ich ihn daher gleichsam mit Gewalt zurückhalten müsse, indem ich auf mein langes Warten, auf die bereits getroffenen Vorbereitungen u.s.w. hinweise. Gegen diesen Vorschlag hatte ich nichts einzuwenden und so liess ich mir ruhig von den Boten berichten, dass Bo Uniang bereits seit langer Zeit an einer Bauchkrankheit gelitten hatte und zuletzt, wohl auch infolge der vielerlei [330] schlechten Arzneien, welche Dajak, Malaien und Chinesen sie der Reihe nach hatten schlucken lassen, gestorben war. Die Boten waren nur mit der Verkündigung der Todesnachricht beauftragt und versuchten nur sehr schüchtern, Kwing Irang zurückzuhalten; sie fuhren auch sehr bald weiter nach Long Dĕho. Von diesem Dorfe aus hatte man mir sagen lassen, dass man mir 2–3 Tage später ein Boot mit vollständiger Bemannung nachsenden wolle, aber Midan, der Überbringer dieses Berichtes, erklärte, die vornehmsten Long-Glat hätten sich so sehr dem Spiel ergeben und jeder litte so stark an Nahrungsmangel, dass an eine Ausführung des Planes in nächster Zeit nicht zu denken sei.
Durch plötzlich eingetretenes Hochwasser aufgehalten kam die eigentliche Gesandtschaft erst 2 Tage darauf, um Kwing Irang offiziell nach Long Tĕpai zurückzurufen. Zum Glück hatte ich bereits morgens, laut unserer Vereinbarung, die Kĕnja in Gesellschaft von 6 Kajan in 2 Böten endlich den Boh hinauffahren lassen, um unsere Ankunft in Apu Kajan zu melden. Vorher hatte Taman Ulow nochmals in Kwing Irangs Gegenwart deutlich von mir hören wollen, was er Bui Djalong als Begründung meiner Reise angeben solle, wobei ich kurz das “nĕmè (Verbesserung) urib” (des Bestehens) der Bevölkerung am Mahakam und Kajan betonte, augenscheinlich zu beider Zufriedenheit. Zum Abschied musste ich Ulow noch ein Kopftuch und seinen Gefährten ein Stück rotes, golddurchwirktes Zeug schenken, wie er sagte: “nĕnè kĕnap dĕha njām” “zur Verbesserung der Stimmung seiner jungen Mitgesellen.” Taman Ulow selbst war übrigens über sein Extrageschenk ebenso glücklich wie seine Genossen.
Der Gesandte von Long Tĕpai war niemand Geringeres als Bo Tijung, der vornehmste Dorfälteste, der mit seinen Begleitern in Kleidung, Haltung und Stimme die tiefste Trauer ausdrückend über die letzten Ereignisse in Long Tĕpai ausführlich berichtete und sich dann in eingehende Betrachtungen über das, was “man” von Kwing erwartete, was die adat verlangte und dergleichen mehr vertiefte. Alles lief darauf hinaus, dass Kwing Irang zurückkehren und das Begräbnis seiner Schwester mit besorgen helfen müsse, wobei man mir das glänzende Vorbild von Bo Lĕdjü Aja vorhielt, der auf die Nachricht vom Tode seiner Schwester hin von seiner angetretenen Kopfjagd nach dem Barito ebenfalls heimgekehrt war. Obgleich ich in den letzten Tagen bereits gehört hatte, dass zwischen Kwing Irang und Bo Tijung im Lager [331] von Long Kawat bereits alle Massregeln für einen eventuellen Tod der alten Bo Uniang getroffen worden waren, ging ich auf die Komödie doch ernsthaft ein. Seitens der Long-Glat waren die Vorstellungen vielleicht doch wirklich ernst gemeint, weil sie selbst jedenfalls nicht mitdurften, was für sie eine grosse Enttäuschung bedeutete, und sie Kwing Irang überdies nicht die Ehre gönnten, als erster und mit mir die Reise zu den Kĕnja zu unternehmen. Sie zeigten sich denn auch nicht zufriedengestellt mit meiner Bemerkung, ein so grosser Häuptling, wie Kwing Irang, dürfe nicht wie ein gewöhnlicher Mensch dem Zug seines Herzens folgen, sondern müsse sich überwinden, wenn es wie hier im Interesse aller Mahakambewohner eine wichtige Reise zu unternehmen gelte. Wohl gab Bo Tijung dies alles zu und bestätigte die Notwendigkeit unseres Unternehmens, doch wiederholte er auf die verschiedenste Weise, was die adat bei solchen Gelegenheiten verlangte und wie man ihr früher gefolgt sei. Ich musste ihm denn auch deutlich machen, dass ich es ihnen allen sehr übel nehmen würde, falls Kwing, zurück ginge, nachdem ich so viele Monate auf ihre adat und alle ihre Hindernisse Rücksicht genommen hatte, auch äusserte ich meine Verwunderung über die geringe Einsicht, die er an den Tag legte. Gegen diesen Vorwurf hielt Bo Tijung nicht stand und behauptete, dass er die Verhältnisse selbst sehr gut einsehe, dass es aber seine Pflicht sei, mir die Ansicht der Leute auseinanderzusetzen.
Während unserer ganzen Unterhaltung sagte Kwing nur sehr wenig, doch erklärte er sich zum Schluss, falls ich so fest auf seinem Bleiben bestehe, geneigt, mit den Boten von Long Tĕpai über das Begräbnis seiner Schwester zu beratschlagen. Mit dieser Erklärung zufriedengestellt eilte ich nach meinem Zelt zurück. Als ich abends, nach der Abreise der Long-Glat, den braven, alten Kwing nochmals besuchte, äusserte er sich über seinen Beschluss, am Reiseplan festhalten zu wollen, sehr befriedigt. So wurden denn die letzten Vorbereitungen zu unserer eigenen Abreise getroffen. [332]
Kapitel XII.
Aufbruch von der Bohmündung am 6. August—Reise auf dem Boh und seinen Nebenflüssen Oga, Tĕmba und Mĕsĕai—Landweg über die Wasserscheide—Begegnung mit unserer Gesandtschaft—Freundlicher Empfang seitens der Kĕnja in Apu Kajan—Einzug in Tanah Putih am 5. September.
Am 6. August brach nach einem hastig eingenommenen Frühstück für uns alle die Erlösungsstunde an. Die Böte waren zwar schwer beladen, konnten aber doch alles Gepäck aufnehmen. Die Natur schien unsere Feststimmung zu teilen, ein freundlicher Sonnenschein belebte das vor uns sich ausbreitende Flusstal. Das sehr niedrig stehende Wasser gestattete eine schnelle Fahrt und ermunternd wirkte der Eifer, mit dem unsere Bootsmänner ihre Ruder kräftig ins Wasser schlugen und an untiefen Stellen ihre Fahrzeuge mit den Stangen vorwärtsstiessen.
Unser Lagerplatz hatte sich an einer sehr engen Flussstelle befunden, weiter oben erweiterte sich das Bett bis auf 100 m und mehr und breite Schuttbänke lagen bloss zu beiden Seiten. Wir hielten an diesem Tage ständig am linken Ufer und kreuzten nicht wie gewöhnlich, zur Vermeidung der starken Strömung, von der einen Uferbucht nach der anderen, auch blieb mein Boot während der ersten Hälfte der Fahrt immer das vorderste. Da wir zufällig an der linken Uferseite fuhren und die andere zu weit entfernt war, hörten meine Ruderer den ersten wahrsagenden Vogel zuerst rechts von sich. Er prophezeite also eine glückliche Reise, ein Umstand, der den Kajan und Pnihing, wie ich später erfuhr, während der vielen Schwierigkeiten, welche diese Reise mit sich brachte, zu grossem Trost gereichte.
Nach dreistündiger Fahrt passierten wir eine Landzunge, auf der unsere Malaien einige Tage vorher das Gepäck unter alten Segeltüchern niedergelegt hatten; gegen Mittag fuhren wir an der Mündung des Mujut vorbei und setzten die Reise noch bis ½ 4 Uhr nachmittags [333] in einem Stück fort, bis wir einen eben erst verlassenen Lagerplatz erreichten, auf dem unsere Gesandtschaft augenscheinlich übernachtet hatte. Dieser Fleck war günstig gelegen, nämlich an der Mündung eines kleinen Nebenflusses, wo eine Schuttbank am Ufer abends ein Ausruhen unter freiem Himmel gestattete, so dass man nicht zu ständigem Aufenthalt im schwülen Walde gezwungen war. Oberhalb Long Mujut verändern Bett und Ufer des Flusses sehr bald ihren Charakter; die breite Wasserfläche mit den flachen, waldreichen Ufern wird ziemlich plötzlich verengt durch steil aus dem Bett sich erhebende Hügel und Berge, welche auf einigen Strecken eine wilde, mit dichtem Busch bedeckte Landschaft bilden. Sehr bald gestattete die Höhe der Ufer überhaupt keine Übersicht mehr, und mussten wir uns bis zum Schluss der Reise mit unserer unmittelbaren Umgebung zufriedenstellen, die übrigens wegen der sehr schwierigen Fahrt unsere ganze Aufmerksamkeit zu erfordern begann.
Kwing Irang gab mir abends, als wir nebeneinander auf der Schuttbank sassen, einen Beweis von dem Ernst, mit dem er unser Unternehmen auffasste, durch seinen Vorschlag, nicht sämtliche Männer das im Walde zurückgelassene Gepäck abholen zu lassen, sondern diese Arbeit nur den Malaien aufzutragen und die Kajan inzwischen mit einem anderen Teil des Gepäckes so weit als möglich wieder flussaufwärts zu senden, damit wir bereits am übernächsten Tage weiterreisen konnten. Das geschah denn auch; bereits um 3 Uhr nachmittags waren die Malaien wieder bei uns zurück, während die Kajan erst nach Einbruch der Dunkelheit den Fluss wieder herabgefahren kamen; sie hatten jedoch den folgenden Lagerplatz unserer Gesandtschaft wieder erreichen können.
Am 8. August konnte ich den Kajan nur mit Mühe begreiflich machen, dass wir jetzt mit allem Gepäck zugleich die Fahrt fortsetzen konnten; sie hielten dies für unmöglich, weil ihnen augenscheinlich ein Überblick über Gepäck und Böte fehlte. Als aber alles geladen war und die Böte in dem noch stärker gefallenen Wasser doch noch fahren konnten, machten sich alle wohlgemut auf den Weg. Das Tal des Boh wurde enger und enger und die steilen Lehmfelsen der Ufer trugen nur noch an wenigen Stellen ein Pflanzenkleid; grosse Felsblöcke lagen auch im Flusse selbst und zwangen uns, mit viel Überlegung zwischen ihnen hindurchzufahren.
An einer Stelle, wo der Fluss eine 400 m hohe Hügelreihe durchbrach, [334] musste alles Gepäck 3 Mal nacheinander aus den Böten genommen werden, um diese mittelst Rotang die Wasserfälle hinaufziehen zu können. Dies geschah an der rechten Uferseite, weil sich links eine lotrechte Felswand hoch über die Wasserfläche erhob. Einer dieser Wasserfälle hiess Kiham Hulu; erst gegen 2 Uhr hatten wir sie passiert und ging die Fahrt zwischen sehr steilen Ufern und kleinen Felsblöcken im Flusse weiter. Das uns umgebende dunkel lehmfarbige Gestein und das über die Felswände hängende tiefe Waldesgrün machten einen finsteren Eindruck; die Abwesenheit jedes menschlichen Wesens wirkte noch dazu, wie übrigens auf der ganzen Reise, niederdrückend.
Anderthalb Stunden oberhalb des Kiham Hulu schien ein 30 m hoher Block den Fluss gänzlich abzuschliessen; in der Nähe jedoch zeigten sich zu beiden Seiten desselben 6–7 m breite Spalten, durch die wir die Böte hinaufziehen lassen mussten. Der schön rote, aus dünnen Jaspisschichten bestehende Felsblock bot seiner Steilheit wegen den Kajan zum Hinaufklettern keine Stützpunkte, so dass diese die Böte nicht, wie üblich, von oben mit Rotangseilen um ihn herumziehen konnten; wir hätten trotz des sehr günstigen Wasserstandes nicht gewusst, wie die starke Strömung in dieser Enge überwinden, da auch die beiden Ufer aus sehr steilen, unzugänglichen Felsen bestanden, wenn sich nicht an dem zu einer Art von untiefen Bai ausgehöhlten rechten Ufer eine grosse Menge toten Holzes, worunter schwere Bäume, aufgestapelt gehabt hätte, welch letztere so hoch an der Felswand hinaufreichten, dass die Kajan über diese hinweg eine niedrigere Stelle der Wand erklimmen konnten. Hier fanden ihre blossen Füsse einen genügenden Halt, um die Fahrzeuge an zugeworfenen Rotangkabeln durch die Enge zu ziehen. Diese war nur 25 m lang, doch lagen dicht oberhalb derselben wieder 3 grosse Blöcke im Flusse, der sich zwischen diesen mit vielen Stromschnellen hindurchwand. Auch hier mussten die Böte an Rotangkabeln gezogen werden, was bei höherem und daher ungestümerem Wasser unmöglich gewesen wäre. Zum Glück erreichten wir bald die Stelle, wo unser Gepäck lag, und konnten uns von allen Anstrengungen erholen. Nach Demmeni hatten wir an diesem Tage einen Abstand von 11 km zurückgelegt und zwar gerade in nördlicher Richtung. Ich hatte jetzt, wo Bier nicht mehr da war, um den Fluss sorgfältig topographisch aufzunehmen, mit Demmeni verabredet, dass er unseren Reiseweg auf dieselbe Weise messen sollte, wie er es im Jahre 1896 am Mahakam getan hatte, nämlich indem er die [335] Flussrichtung mit der Handbussole bestimmte und die Abstände schätzte. Damals hatten Demmenis Messungen eine Karte mit relativ kleinen Fehlern ergeben; so war es denn auch jetzt der Mühe wert, dass Demmeni sich während der ganzen Reise ernsthaft dieser Arbeit widmete.
Abends brachten mir die Pnihing einen ¾ m langen, eigentümlichen, rotbraunen Fisch, ke̥to̱ genannt, der nach der Meinung aller Anwesenden nur im Boh vorkam, während eine nahe verwandte Art im Mahakam lebte und eine graue oder graue und schwarze Marmorierung zeigte.
Am anderen Morgen luden Eingeborene und Malaien wieder ihre Böte und dehnten ihre Fahrt so weit aus, dass sie erst nach Sonnenuntergang zurückkehrten. Nach ihrem Bericht kamen in diesem Teil des Boh bis zur Mündung des Oga, den sie erreicht hatten und ein Stück weit hinaufgefahren waren, keine Wasserfälle mehr vor. Das war allerdings wahr, im übrigen erwies sich aber das Flussbett am folgenden Tage als äusserst ungünstig für die Fahrt. Trotz des noch tieferen Wasserstandes verhinderte die wegen der zahlreichen, das Flussbett verengenden Blöcke sehr heftige Strömung ein schnelles Vorwärtskommen, auch mussten wir ständig auf der Hut sein, nicht auf einen unter Wasser liegenden Felsen zu stossen; bei der so viel schnelleren Talfahrt musste diese Gefahr noch viel grösser sein. Häufig zogen die Kajan die Böte an Rotangkabeln längs des Ufers vorwärts. Gegen 1 Uhr erreichten wir die Ogamündung. Am rechten Bohufer hatten unsere Gesandten unter den überhängenden Bäumen einen langen Stock derart in den Boden gepflanzt, dass sein freies Ende nach dem Nebenfluss wies; ungefähr 1500 m weiter im Oga fanden wir unser aufgestapeltes Gepäck. Das Nachtlager der Kĕnja musste jedoch noch weiter oben liegen, weil sie mit ihren leichter beladenen Böten auch grössere Tagereisen zurücklegen konnten.
Das Gestein, das wir an diesem Tage im Boh angetroffen hatten, glich völlig demjenigen im Stromgebiet des Mahakam; es bestand meistens aus dunklen Schiefern, die mit sehr regelmässig gelagerten Jaspisschichten von weissgrauer, roter und schwarzer Farbe abwechselten. Der Oga erwies sich als 30–50 m breiter Nebenfluss, der sich in die dunklen Schiefer ein schmales, tiefes Bett mit steil aufsteigenden Seitenwänden gegraben hatte. Seine Ufer waren bis hoch hinauf gänzlich nackt, erst weiter oben setzte der Busch an mit senkrecht stehenden, 50–70 m hohen Waldriesen, während die in anderen Flüssen [336] so charakteristischen stark überhängenden Bäume hier im harten Gestein aus Mangel an Raum zum Wurzelfassen gänzlich fehlten.
Wir waren zeitig genug angekommen, um die Helligkeit noch zu allerhand Arbeit benützen zu können, besonders weil unsere Hütten bereits Tags zuvor aufgeschlagen worden waren.
Die Malaien wollten noch am Boh Hirsche jagen, wahrscheinlich trieb sie aber nur die Neugier noch weiter den Fluss hinauf. Tamoi, einer unserer besten Malaien, wollte sich jedoch gut ausrüsten und bat daher um mein Winchester Repetiergewehr, das ich ihm auch gab. Abends kehrte die Gesellschaft aber unverrichteter Sache heim und Tamoi gab mir das Gewehr mit sehr bedrücktem Gesicht zurück, über seine Jagderlebnisse, die bereits die Lachlust der Kajan erregten, berichtete er mir aber nichts. Seine Kameraden erzählten jedoch, ihr Anführer habe, dem Ufer des Boh entlang gehend, hinter einer Windung plötzlich vor 3 Hirschen gestanden und auf 30–40 m Abstand dreimal auf sie geschossen, ohne zu treffen, und die Tiere seien trotzdem stehengeblieben. Erst als auf die vielen Schüsse ein anderer Malaie angelaufen kam, seien die Hirsche im Walde verschwunden; die Tiere kannten in dieser friedlichen Gegend kein Misstrauen. Dieselbe Beobachtung hatten wir übrigens bei unserer Expedition ins Quellgebiet des Mahakam bereits gemacht. Die Fröhlichkeit unserer Malaien über das Abenteuer machte bald einer bitteren Enttäuschung Platz, weil wir alle seit Monaten nur Fische als Fleischspeise genossen und uns daher auf einen Wildbraten gefreut hatten; der arme Tamoi musste sich seiner Ungeschicklichkeit wegen viele Sticheleien gefallen lassen.
Die Kajan begannen früh am anderen Morgen hoch über der Erde eine kleine Reisscheune zu errichten; sie erzählten, es sei bei ihnen Sitte, auf dergleichen gefährlichen und langen Reisen hier und da im Walde einen Reisvorrat zu verstecken, damit sie bei einer eventuellen eiligen Flucht, bei der sie ihr Gepäck zurücklassen müssten, einen Reservefonds fänden. Auf der Rückreise von Apu Kajan würde uns dieser übrigens ebenfalls von grossem Nutzen sein. Kwings Sohn Bang Awan begrub überdies unter der Hütte einen emaillierten eisernen Teller, aus Furcht, dass die Kĕnja sich diesen von ihm ausbitten würden; andere hingen unter dem Dach einige dicke Kriegsmützen aus Rotang auf, die sie sich abends als wirksames Verteidigungsmittel gegen die so gefürchteten Kĕnja geflochten hatten. Leider konnte ich [337] nicht kontrollieren, wieviel Reis die Kajan in ihren Böten übrig behalten hatten, sonst wäre ich ernsthaft gegen die Zurücklassung einer so grossen Menge aufgetreten, denn, wie es sich später erwies, reichten sie bei weitem nicht damit aus.
Die Kajan hielten es in diesen so gut wie nie besuchten Wäldern für überflüssig, die Reisscheune besonders zu verbergen, auch würden in diesem Gebiet umherschweifende Punan sie nach ihrer Meinung doch entdeckt haben. Gegen diese baten sie mich aber, die Hütte durch Anhängen einiger Stücke Zeitungspapier zu schützen, das seiner geheimnisvollen Buchstaben wegen auf die Bewohner Mittel-Borneos stets einen sehr tiefen Eindruck macht. Kwing hatte früher bereits seinen Untertanen das Fischen weiter oben im Blu-u durch ein an einen Rotang befestigtes Papierstück verboten (Teil I Taf. 67). Aus der Vorstellung der Dajak, dass die Menschen lesen können, weil die Buchstaben ihnen etwas zuflüstern, lässt sich ihre Ehrfurcht vor allem Gedruckten und Geschriebenen begreifen. Ein eigenartiges Beispiel von der Wirkung, welche ein Brief ausüben kann, werden wir bei den Kĕnja kennen lernen.
Infolge der grossen Menge zurückgelassenen Reises war unser Gepäck stark vermindert, und da auch unsere 65 Mann täglich ein bedeutendes Gewicht verzehrten, brauchten sich an diesem Tage nicht alle mit dem Gepäcktransport abzugeben. Bang Awan fand daher die Musse, um sich zur Vorbereitung unseres weiteren Zuges nach dem oberen Oga auf Kundschaft zu begeben; gleichzeitig wollte er ein Wildschwein zu erlegen versuchen, weswegen der sachverständige Abdul ihn begleiten sollte. Einen Teil der Malaien behielt ich bei mir zurück, weil ich die Geröllbänke oberhalb der Ogamündung im Boh untersuchen wollte, teils um das Gestein dieses Stromgebietes kennen zu lernen, teils um mich davon zu überzeugen, ob der Schmuckstein der Bahau, der Batu Boh (ein Serpentin), von dort oder aus dem Oga stammte. Eine schöne Sammlung von Schmucksteinen aus alten Schiefern, Hornstein und Jaspis konnte ich abends als Resultat meines Ausfluges in ein leeres Salzgefäss verpacken und in die Reisscheune stellen, um es auf der Rückreise wieder mitzunehmen.
Unser Gepäck wurde an diesem Tage flussaufwärts bis oberhalb Long-Glat geschafft, der Mündung des Glat, eines rechten Nebenflusses des Oga, nach dem die Long-Glat ihren Namen tragen. Zu unserer aller Freude brachte Bang Awan abends wirklich ein Schwein mit, [338] so dass wir nach langer Zeit wieder frisches Fleisch zur Mahlzeit geniessen konnten.
Am 12. August brachte ich meine Malaien und Kajan nur mit Mühe und erst um ½ 9 Uhr in Bewegung. Nur zu bald lernte ich den Grund ihres geringen Eifers kennen. In dem engen, von hohen Bergwänden eingeschlossenen Tal des Oga, wo sich keine Schattenbäume über den Fluss neigten, war es drückend heiss und eine beinahe ununterbrochene Reihe von kleinen und grossen Wasserfällen erschwerte die Fahrt in hohem Grade. Nicht weniger als 27 Wasserfälle und Stromschnellen versperrten den Weg; von jenen war einer 3 m hoch, während diese bis zu 70 m lang waren. Die stets gleich steil bleibenden Ufer verhinderten häufig ein Schleppen der Böte mittelst Rotang und die Felsblöcke im Bette lagen so dicht beieinander, dass die meisten Fahrzeuge nur mit Mühe hindurchkonnten und das meine ab und zu hinübergehoben werden musste. Als wir um 4 ½ Uhr abgemattet und von Kopfschmerzen geplagt den Lagerplatz unseres Gepäckes erreichten, waren wir alle froh, die Böte verlassen zu können. Unsere Nachtruhe wurde jedoch stark durch unsere Hunde gestört, die unter grossen Mengen Agas (kleiner Mücken) sehr zu leiden hatten.
Auf Kwings Vorschlag, am anderen Tage auszuruhen, ging ich denn auch bereitwillig ein; übrigens war von eigentlicher Ruhe, wie gewöhnlich an solchen Tagen, keine Rede, nur benützte ihn jeder, um zu tun, was er wollte. Einige Männer beschäftigten sich damit, den Rotang an den Böten zu erneuern, die Haken an die Bootsstangen von neuem zu befestigen und die Speere zu untersuchen; andere begaben sich in den Wald, um den dicken Bambus, be̥tong, der am Mahakam beinahe nicht vorkommt, zur Herstellung von Bambusgefässen zu schneiden. Kwing Irang selbst begab sich in grösserer Gesellschaft und in mehreren Böten an den oberen Oga, um dort zu jagen und zu fischen, und kehrte abends mit der guten Nachricht zurück, dass er keinen Menschen noch frischen Spuren von solchen begegnet sei, einen Hirsch erlegt und nicht weniger als 12 njaran, salmartige Fische, gespiesst habe. Auch eine Truppe Pnihing, die den Glat hinaufgefahren, und eine andere, die zur Erforschung des Tĕmha oder Pawil ausgezogen war, hatte zur grossen Beruhigung aller keine Menschen gesehen.
Je weiter wir den Fluss hinauffuhren, desto ängstlicher war unsere Gesellschaft geworden und baute daher, wo das Gelände es zuliess, [339] ihre Hütten zum Schutze um die unsere herum. Einen zum Aufschlagen des Lagers geeigneten Platz zu finden, war übrigens nicht immer leicht; am Tĕmha, den wir vom Oga aus hinauffahren mussten, sollte dies nach Angabe der Kĕnja noch schwieriger sein; wir hatten daher mit ihnen vereinbart, dass sie uns durch Zeichen die Stellen angeben sollten, an denen wir übernachten mussten und nach 12 Uhr mittags nicht vorüberfahren durften.
Am 14. August machten sich alle schon sehr früh auf, um das Gepäck so hoch als möglich den Tĕmha hinaufzuschaffen, so dass wir mit Kwing einen sehr ruhigen Tag zubrachten. Erst beim liling duan (Singen der Zikade bei Sonnenuntergang) kehrten die Böte mit der Meldung zurück, dass sie bis zu einer sehr engen Stelle im Tĕmha gekommen seien, wo die sehr steilen Wände zum Stapeln des Gepäckes nur hoch über der Wasserfläche einen Platz geboten hätten.
Bereits um 6 Uhr morgens machten sich die Kajan an das Abbrechen des Lagers; sie wollten ihr Frühstück nämlich gern an der Mündung des Glat einnehmen, einem verbreiterten Teil des Ogatales, der wegen der zahlreichen Erzählungen aus ihrer Mythenwelt, die sich hier abgespielt haben sollen, für sie einen besonderen Reiz barg. Während der Vorbereitung zur Mahlzeit und dieser selbst äusserten sie denn auch eine grosse Lebhaftigkeit. Die romantische, bis jetzt sehr günstig verlaufende Reise nach Apu Kajan, der Aufenthalt an diesem denkwürdigen, sagenreichen Ort, wo ihr mythischer Held Bun nach der Überlieferung abends, morgens und nachts zu fischen pflegte, das alles versetzte sie in heitre Stimmung und liess sie die ausgestandenen Strapazen vergessen und der kommenden nicht achten. Allerdings war es ihnen in dieser Umgebung nicht ganz geheuer, auch hatten sie es während der ganzen Reise vermieden, ein Stück aus der Bun-Sage zu rezitieren, was sie sonst abends im Lager zu tun pflegen.
Eine aufgeräumte Stimmung hatten meine Leute wohl sehr nötig, denn gleich nach unserem Aufbruch mussten wir uns durch drei Stromschnellen hindurcharbeiten; darauf fuhren wir an einer kleinen Insel mit einer durch die Sage bekannten nĕha (Geröllbank) Kĕlai vorbei und befanden uns am Einfluss des Tĕmha, eines linken Nebenflusses des Oga. Während uns dieser mehr nach Westen geführt hatte, brachte uns der Tĕmha wieder gerade nach Norden. Es war dies ein sehr kleiner, nur 15–20 m breiter Fluss, der sich zwischen dunklen [340] Schieferfelsen sehr tief und mit starkem Gefälle hindurchpresste; alle 50 m hatten wir eine Stromschnelle zu überwinden, von denen einige eine bedeutende Länge erreichten. Infolge der anhaltenden Trockenheit war das Wasser besonders für mein grosses Boot nicht tief genug und musste es von den Männern ständig über das Geschiebe der Stromschnellen gestossen und gezogen werden. Die Verhältnisse wurden nicht besser, als der Tĕmha sich weiter oben gabelte und wir seinen linken Arm hinauffuhren. Hier waren die Ufer oft lotrecht, sogar überhängend, während der nur 5–8 m breite Fluss mit seinen zahlreichen Windungen besonders für die Talfahrt nichts Gutes versprach. Das Gebirge bestand hier auch aus dunklen Schiefern, stark durchsetzt von weissen Quarznestern. Bereits um 2 Uhr erreichten wir eine Stelle, an der uns ein Zeichen am Ufer zum Biwakieren aufforderte; aus Furcht, das nächste Zeichen nicht mehr erreichen zu können, wagten wir uns auch nicht weiter. Der Platz schien häufig zum Lagern benützt worden zu sein, denn es dauerte lange, bevor wir für unsere Hütten eine genügende Menge kleiner Stämme beisammen hatten, auch waren diese dicker und unser Zelt daher fester als gewöhnlich. Wir waren an diesem Tage etwa 40 m mit den Böten gestiegen. Nach aller Ermüdung hatte unsere ganze Gesellschaft hier stark unter den Stichen einer Milbe zu leiden, die zwar nur so gross wie der Kopf einer kleinen Stecknadel war, trotzdem aber heftiges Jucken und Schmerzen verursachte.
Am 16. Aug. machten sich die Leute mit dem Gepäck wieder voraus auf den Weg und kehrten abends wieder zurück, ganz unter dem Eindruck der Schwierigkeiten, welche sie an diesem Tage zu überwinden gehabt hatten. Nach ihrer Aussage bestand das Bett des Tĕmha weiter oben aus einem engen, finstern Spalt, ausserdem kamen in ihm viele hohe Stromschnellen vor; bei diesen hatten sie alles Gepäck aus den Böten nehmen müssen, um dann die flachen Fahrzeuge über die Felsblöcke ziehen zu können, auf die sie Baumstämme gelegt hatten. An der von Taman Ulow als Lagerplatz bezeichneten Stelle waren sie bereits früh vorbeigefahren, die folgende hatten sie jedoch nicht mehr erreicht und daher das Gepäck auf einem sehr hoch über den Fluss emporragenden Felsen niederlegen müssen.
Auch wir waren am folgenden Tage schon um 12 Uhr an der bezeichneten Stelle, nach einer äusserst schwierigen Fahrt durch den sehr finsteren, drohenden Felsspalt, der nirgends über 10 m breit war. Ich wagte nicht, an diesem Tage noch weiter zu fahren, weil der sehr [341] hohe Uferwald nirgends einen Lagerplatz bot. Am anderen Morgen arbeiteten wir uns auf dieselbe anstrengende Weise weiter fort, passierten gegen Mittag unser Gepäcklager und fanden weiter aufwärts bei Long Mĕngow an einer Flussverbreiterung mit grossem Platz zum Kampieren unsere Kajan bereits emsig mit dem Hüttenbau beschäftigt. Mit Rücksicht auf unseren kargen Vorrat an Nahrungsmitteln fand ich jedoch eine so frühe Rast trotz der Anstrengungen dieses Tages sehr gewagt. Als die Leute meinem Befehle, das Gepäck wieder einzuladen, diejenigen, die im Walde Holz hackten, zurückzurufen und weiter zu fahren, nicht geneigt schienen, Folge zu leisten, sandte ich Lalau zu Kwing, der bereits unter einem provisorischen Zelte sass, um diesem begreiflich zu machen, dass wir bis zum Einbruch der Dunkelheit noch lange fahren könnten und somit sicher einen anderen Lagerplatz finden würden. Kwing äusserte zwar seine Bedenken doch fand auch er, dass ein schnelles Weiterkommen dringend notwendig war, und so mussten denn alle wieder die Böte besteigen und sich von diesem Wildniseldorado trennen.
Die Weiterfahrt begann nicht ermutigend; der Tĕmha bildete in einer hohen Felswand einen neuen, diesmal nur 5 m breiten Spalt, in dem einige grosse Steinblöcke festgeklemmt lagen, so dass die Böte sogleich wieder ausgeladen und mit Hilfe von Stämmen, welche über die Blöcke gelegt wurden, aufwärts gezogen werden mussten. In dieser Enge musste überdies das eine Boot auf das andere warten, wodurch viel Zeit verloren ging; weiter oben mussten die Fahrzeuge ständig über Flussgeröll geschleppt und 2 Mal ein hoher Wasserfall passiert werden. Der erste wurde durch einen riesigen Eisenholzbaum gebildet, der von oben in den engen Spalt gestürzt war und jetzt als Wehr für das 3 m hoch darüber niederfallende Wasser diente. Das in grossen Massen aufgestaute tote Holz bildete einen wahren Damm. Das Vorwärtskommen wurde immer schwieriger, und da der Nachmittag seinem Ende nahte, beschlich mich die Angst, dass wir am Ende in den Böten würden übernachten müssen, was bei plötzlich eintretender Hochflut sehr gefährlich werden konnte. Das Wetter war uns bis jetzt zwar immer günstig gewesen, doch verliessen wir uns nie fest darauf, sondern packten die Böte für die Nacht stets aus und zogen sie meist aufs Land. In unserer spelunkenhaften Felsspalte begann es bereits zu dämmern, als wir zu unserer grossen Freude Holzspähne vorbeitreiben sahen; Kwing, der vorausgefahren war, fällte [342] also bereits Holz. Nach einer halben Stunde erreichten wir denn auch die Lagerstelle, auf der meine Hütte und einige andere bereits halbfertig dastanden. Auf einer kleinen Sandbank an dem etwas flachen rechten Ufer machten wir uns einige Bewegung; hier vereinigte sich nach und nach auch die ganze Gesellschaft, kochte ihren Reis und genoss der Abendkühle nach dem schweren Tag.
Wir hatten übrigens noch eine wichtige Angelegenheit zu behandeln. Die Kajan wollten nämlich am folgenden Tage nur das Gepäck weiter befördern und uns wieder zurücklassen, worauf ich mit Rücksicht auf den stark abnehmenden Reisvorrat meiner Malaien nicht eingehen durfte. Nachdem die Kajan so viel Reis deponiert hatten, konnte ich nicht mehr darauf rechnen, dass sie mir von ihrem eigenen Vorrat viel abtreten würden, worauf ich Kwing sehr eindringlich aufmerksam machte. Zu meinem grossen Erstaunen hielten die Kajan ihr am Oga gegebenes Versprechen, im Notfall aushelfen zu wollen, und schenkten meinen Malaien einen ganzen Pack (lẹwo) Reis. So erlaubte ich ihnen denn, am anderen Morgen nur das Gepäck hinaufzutransportieren, und Bang Awan, zur Untersuchung unseres weiteren Weges vorauszufahren. Wie dieser abends berichtete, hatte er den Mĕsĕai, ein linkes Nebenflüsschen des Tĕmha, von dem aus der Landweg zum Kajanfluss begann, gefunden, ihn aber wegen der Geröllmassen im Bette nicht hinauffahren können.
In der angenehmen Hoffnung, dass dieser Tag, der 20. August, der sehr schwierigen Fahrt in der niederdrückenden Umgebung ein Ende machen würde, kochten die Kajan morgens bereits sehr früh und nahmen den Reis in den Böten mit, um weiter oben zu frühstücken.
Bei dem grossen Eifer, der jetzt alle ergriff, mussten wir einige Kranke mit Gewalt bei uns zurückhalten und sie darüber beruhigen, dass die anderen sie nicht der Faulheit beschuldigen würden. In der Tat wären an diesem Tage alle Arbeitskräfte nötig gewesen, und endlose Stromschnellen und Wasserfälle hatten die Bootsleute überwinden müssen, bevor sie den taga (trocken) haro̱k (Boot), den Anlegeplatz der Böte vor dem Landwege zum Kajanfluss, erreichten und alles Gepäck dort niederlegten. Da nun aber die Baumstämme über die Wasserfälle bereits gelegt und die hinderlichsten Steine beseitigt waren, verbesserten sich unsere Reiseaussichten; auch fiel abends der erste Regen auf unserer Fahrt und beseitigte eine grosse Schwierigkeit, den sehr niedrigen Wasserstand. [343]
Am 21. August brachen wir also unser letztes Lager im Mahakamgebiet ab und fuhren bis zum Anfang des Landweges. Auf mich machte die Fahrt auf dem Mĕsĕai einen weniger düsteren Eindruck als die auf dem Tĕmha, weil die Felswände uns hier nicht so steil zu beiden Seiten einschlossen und wir ein grösseres Stück Himmel über uns erblickten. Die Schwierigkeiten, besonders das Schleppen der Böte, waren jedoch noch sehr gross, das Gepäck musste sogar ein grosses Stück weit getragen werden.
Eines der grossen Böte musste im Tĕmha zurückgelassen werden, wo die Kajan es an Land zogen und fest an die Bäume banden, damit es bei Hochwasser nicht fortgerissen würde. Das Steigen des Wassers gestattete, alle anderen Böte im Mĕsĕai bis zum taga haro̱k hinaufzuschleppen, wo sie so hoch auf dem Ufer untergebracht wurden, dass auch das stärkste Hochwasser sie nicht erreichen konnte. Auf dem übrig gebliebenen Uferplatz bauten die Bahau unsere Hütten, nur etwas fester als sonst, weil unser Verbleib hier länger dauern sollte. Seit mehreren Geschlechtern hatten die Reisenden, die aus dem Gebiet des Mahakam in das des Kajan oder umgekehrt zogen, die Bäume auf diesem kleinen, flachen Hügelgipfel gefällt und auch den umliegenden Wald stark gelichtet.
Welch eine enorme Arbeit mein Personal auf diesem letzten Zuge geleistet hatte, geht aus meinen Aufzeichnungen hervor, nach denen wir auf dem äusserst schlechten Gelände mit unseren Böten täglich um die folgenden Meterzahlen gestiegen waren:
| Am 6. Aug. | 8. Aug. | 10. Aug. | 12. Aug. | 15. Aug. | 17. Aug. | 18. Aug. | 20. Aug. |
| 20 m | 20 m | 30 m | 60 m | 60 m | 30 m | 60 m | 50 m |
Wir befanden uns also jetzt 330 m höher als an der Bohmündung.
Sehr zu statten kam uns ein von den Kajan gefundener Reispacken, den unsere Gesandtschaft augenscheinlich zurückgelassen hatte, weil er ihr zum Landtransport zu schwer war; ich erstand ihn zu mässigem Preise für meine Malaien. Einen Ruhetag glaubten die Kajan und Pnihing durchaus nötig zu haben, und da ich in dieser unbekannten Gegend die Träger nicht ohne weiteres vorausschicken konnte, sandte ich an diesem Tage 3 Malaien unter Dĕlahits Führung zur Untersuchung des Landweges aus. Die Kajan waren hierzu aus Furcht nicht zu bewegen.
Unter der ausdrücklichen Bedingung, dass sie ihren Lohn erst nach unserer Rückkehr zum Mahakam empfangen sollten, hatte ich die Bahau [344] in meinen Dienst genommen, weil ich so viel Geld nicht mitführen wollte und die Leute es zu verlieren riskierten. Trotzdem machten jetzt alle auf einen Teil ihres Lohnes Anspruch, um in Apu Kajan Handel treiben zu können. Der ziemlich geringen Menge Silbergeldes wegen, die ich bei mir hatte, kam mir diese Forderung recht ungelegen, doch stellte ich die Männer schliesslich mit einem Vorschuss von 10 fl pro Kopf zufrieden. Als ich ihnen dabei die Arbeitstage, welche sie gut hatten, vorzählte, meinte Bo Bawan, der auf der Reise auf seine Weise Rechnung geführt hatte, sie kämen nach meiner Angabe um 1 Tag zu kurz. Er hatte nämlich an seinem Schwertgürtel eine Schnur befestigt und an dieser jeden gültigen Tag mit einem Knoten bezeichnet; im Lauf unserer Unterhaltung gab er in der Tat von jedem Knoten an, welchen Tag er vorstellte. Dessenungeachtet erwies sich bei einer eingehenden Besprechung der Angelegenheit, der die übrigen mit grossem Interesse folgten, meine Rechnung als die richtigere. Von den anderen Kajan schien keiner die Anzahl Tage gut gemerkt zu haben. Die Malaien begannen sich nun auch mit Tauschartikeln zu versorgen und baten jeder um einen Packen weissen Kattuns, den ich ihnen meines grossen Vorrats wegen gern zugestand.
Abends nach Sonnenuntergang kehrten die malaiischen Kundschafter zurück; sie waren dem Pfad bis in das Tal des Laja, eines Quellflusses des Kajan, gefolgt; er war zwar lang, aber gut passierbar, so dass sie noch abends hatten zurückkehren können. Auf diesen Bericht hin wurde beschlossen, das Gepäck halbwegs auf die Wasserscheide, ngālăng (Berg) hāng (zwischen), bringen zu lassen und am folgenden Tage selbst nachzukommen.
So wurde denn am 23. August unser Hab und Gut so gerecht als möglich den verschiedenen Rücken aufgebürdet, und ausser den 4 Malaien, die von ihrer Entdeckungsreise tags zuvor steife Beine behalten hatten, machten sich alle auf den Weg. Dieser ruhige Tag schien mir zur Behandlung der Reisfrage mit Kwing, der selbst im Lager blieb, sehr geeignet. Besonders für uns und die Malaien war diese Frage sehr brennend geworden, denn wir lebten bereits seit mehreren Tagen von dem Reis, den die Kajan uns verkauft hatten, und nun behaupteten diese, uns nichts mehr abtreten zu können. Im Geheimen teilte Kwing mir mit, dass einige Kajan doch noch Reis zum Verkauf übrig hätten und er mit den Betreffenden nach ihrer [345] Rückkehr darüber reden wollte. Abends gelang es mir denn auch, noch einen Packen für 10 fl zu kaufen, also für 25–30 fl den Pikol, ein sehr hoher Preis, den die Umstände entschuldigten. Während ich nachts wach lag, beschloss ich, trotz des hohen Preises und der erwarteten Hilfe der Kĕnja doch noch einen zweiten Reispacken zu kaufen, aber morgens verlangte der junge Besitzer desselben 25 fl statt 10 fl, wie abends vorher. Die Häuptlinge verurteilten zwar eine derartige Ausnützung einer Notlage, besonders gegenüber einer Person, die dem Betreffenden am Mahakam mit vieler Sorge und Pflege das Leben gerettet und hierfür nichts empfangen hatte, doch meinten sie, nichts dagegen tun zu können. Trotz der vielen Schwierigkeiten, die sich mir seit Jahren entgegengestellt hatten, passierte es mir jetzt zum ersten Mal, dass ich meine Selbstbeherrschung verlor; ich stürzte in einem Anfall von Entrüstung und Wut nach der Hütte, wo der junge Mann (Sawang Ulo Tafel 7) vor seinem Reispacken sass, drohte ihm mit dem Stock, schleuderte ihn an der Schulter zur Seite, ergriff den Reispacken und warf ihn ein paar eiligst herbeilaufenden Malaien zu, mit dem Befehl, ihn nach meiner Hütte zu bringen. Während dieser heftigen, ungewohnten Szene, die mir vor Erregung Tränen in die Augen trieb, hatte sich niemand zu rühren gewagt, und ich sass bereits geraume Zeit wieder in meinem Zelte, bevor ich einige Bewegung im Lager bemerkte. Zuerst kamen Kwing und Bo Bawan zu mir, setzten sich sehr demütig auf den Boden und baten um Verzeihung wegen der Unannehmlichkeiten, die sie mir bereiteten, die jungen Leute (dĕha njām) wären zu dumm, um zu begreifen, was sie täten, besonders der betreffende Sawang, der mir jetzt den Reis gern für den vereinbarten Preis von 10 fl abtreten wollte. Obwohl innerlich froh über diesen Verlauf der Angelegenheit, hielt ich den beiden alten Anführern doch vor, dass sie bei einem so schwierigen und gefahrvollen Zug derartige Ausschreitungen einzelner selbst zu verhindern suchen mussten.
Ich glaube, die ganze Gesellschaft war nach diesem Auftritt froh, sich mit einer Last auf den Weg machen zu dürfen. Nach Vereinbarung sollten die Männer an diesem Tage für sich selbst tragen (măso̱), in Anbetracht dass ihre eigene Ausrüstung, besonders an Tauschartikeln, sehr schwer war. Einige boten sich an, auch für mich noch etwas zu tragen, so wurde ich noch ein paar Packen Kattun los. Mit Rücksicht auf die lange, bereits hinter uns liegende Reise glaubte ich höhere Anforderungen an meine Personal nicht stellen zu dürfen; meine Ungeduld, [346] jenseits der Wasserscheide zu gelangen, war so gross, dass ich überlegte, welches Gepäck zurückgelassen und später wieder mitgenommen werden konnte. Die Tauschartikel waren unentbehrlich, daher kam nur unsere persönliche Ausrüstung in Betracht, und da Demmeni von der seinen nichts missen zu können glaubte, liess ich meine Matratze, einen Klappstuhl und noch einiges andere zurück. Die Kajan banden die Sachen aut unsere Schlafbänke fest und bedeckten sie mit alten Palmblattmatten und Baumrinde; einige Monate später fand ich sie unversehrt wieder vor. Nachdem wir auch die Böte vor Unfällen aller Art gesichert hatten, traten wir am 25. August um 7 Uhr morgens den Marsch an. Erst ging es ein Stück weit durch den Mĕsĕai, dann bestiegen wir den von diesem aus sich erhebenden Bergrücken, der uns zum Gebirgspass bringen sollte. Auf dem in einem Winkel von etwa 30° geneigten und direkt nördlich gerichteten Abhang ging es, bald steil aufsteigend, bald absteigend, weiter. Von 7 bis ½ 1 Uhr morgens stiegen wir vielleicht nur 500 m auf einem zwar breiten und von den Kajan bereits ausgehauenen, aber sehr anstrengenden Pfade. Gleich nachdem wir die uns erwartenden Kajan eingeholt hatten, kamen Demmeni und ich an zwei grossen Bäumen vorüber, die der Sage nach von einer bekannten Person gepflanzt worden waren. Wir mussten mit unseren Revolvern auf sie schiessen, und die Kajan, die den Weg zum ersten Mal betraten, ihre Speere auf sie schleudern. Die Träger blieben bald hinter uns zurück und nur einige Malaien hielten aus Pflichtgefühl bei uns aus. Gegen 11 Uhr konnte Demmeni nicht weiter und blieb zurück, um auf das Essen zu warten, das die Kajan trugen. Ein Stück weiter stiess ich auf unser Gepäcklager und jetzt sehnten wir uns nach einer längeren Rast als nur einer Viertelstunde nach je 3 Viertelstunden Marsch, wie wir es an diesem Tage gehalten hatten. Einem der Koffer mit Konservierungsmaterial für Fische entnahm ich 6 Stöpselflaschen mit dem nötigen Formol für eventuell zu fangende Fische, dann erfrischte ich mich mit dem Saft einer Liane, da auf diesem hohen, scharfen Rücken kein Wasser zu finden war, und ruhte aus, bis gegen ½ 1 Uhr die ersten Träger wieder auftauchten. Ich fürchtete, die Leute möchten sich weigern weiterzumarschieren, und brach daher, um sie zur Eile anzuspornen, mit einigen starken Pnihing, Dĕlahit und ein paar Buginesen aus Samarinda sogleich wieder auf. Weiter oben, wo die Kajan den Weg noch nicht ausgehauen hatten, erschwerte uns das dichte Grün von [347] Farren, Rotang und Gemberpflanzen das Gehen. Die Kĕnja hatten über diesen tief liegenden und sumpfigen Teil des Rückens den Weg mit Baumstämmen belegt, aber diese waren bereits sehr lange nicht mehr erneuert worden und daher halb verwest und zerfallen. Auf der ferneren Strecke befanden wir uns denn auch ständig in einem wilden Kampfe mit dem Gestrüpp; zum Glück war die Steigung nur schwach und Dĕlahit tröstete mich damit, dass dieses “puko̤̣t” (Zugewachsene) nur bis zur Wasserscheide anhalte. Wir erkannten diese an der üblichen Reihe von Pfählen, die Anjang Njahu und die anderen die Kĕnja begleitenden Kajan hier beim Betreten des für sie neuen Gebietes den Geistern errichtet hatten. Auch an der Mündung des Mĕsĕai hatte jeder von ihnen einen derartigen Pfahl roh bearbeitet und aufgepflanzt. Auch verschiedene andere alte und halb verweste Pfähle waren noch zu sehen.
Der hier sehr schmale Rücken fällt sogleich sehr steil ins Tal des Laja, des südlichen Quellflusses des Kajan, ab. Ich lernte hier zum ersten Mal eine besondere Art des Wegbaus der Kĕnjastämme kennen: den ganzen Abhang hinunter waren Leitern angebracht; zwar waren diese jetzt verfallen, doch ermöglichten sie immerhin den Abstieg. Wie der Wald triefte auch hier die ganze Umgebung von Nebel und Regen, wodurch einige schwierige Stellen gefährlich wurden und ebensosehr den Gebrauch der Hände als der Füsse nötig machten. 100 m tiefer ging es besser, erst über Schieferfelsen, dann mehr über Bänke aus kleinem scharfkantigem Gestein oder durch das bereits sehr wasserreiche Flüsschen. Nach Dĕlahit war der Weg durch den Laja Dĕlèng (kleiner Laja) nicht mehr lang; zwischen hohen, beinahe senkrechten Felswänden gelangten wir denn auch nach ½ 4 Uhr an eine steile Landzunge, wo unser Flüsschen sich in den Laja Aja (grosser Laja) stürzte. Nach der adat musste es gewittern, wenn ein hipui aja (grosser Häuptling), das war ich, ein neues Land betrat, und das geschah denn auch.
Unglücklicherweise regnete es in den letzten Stunden in Strömen. So schlüpfte ich denn unter einige Palmblattmatten, während meine Begleiter das hier nur spärlich vorhandene Holz mit einiger Mühe für eine Hütte zusammensuchten. Nur die Hälfte der Malaien, 2 der Buginesen und die Pnihing hatten bei mir ausgehalten. Demmeni mit Abdul und einigen anderen Malaien stiessen erst eine Stunde später zu uns. Bald stellte es sich heraus, dass wir keine Lampe und [348] ausser einem sehr kleinen Vorrat der Pnihing keinen Reis bei uns hatten. Als ich mich aber unter dem vorzüglich schützenden Segeltuch in mein Klambu begab, empfand ich vor Übermüdung auch keinen Hunger, sondern nur Durst.
Demmeni hatte gesehen, dass unsere Träger an der Stelle, wo unser Gepäck lag, ihr Lager aufgeschlagen hatten; wahrscheinlich hatten sie dies für die Opferfeier, die sie vor dem Eintritt ins neue Gebiet abhalten mussten, nötig befunden, einige waren wohl auch zum Weitergehen zu müde gewesen. Wir glaubten in der Ferne einen Schuss zu hören und antworteten sogleich mit unseren Gewehren, aber niemand erschien, und so suchten wir denn unter unseren Decken die dunkle, nasskalte Umgebung in 800 m Höhe zu vergessen, während unsere Begleiter vor Angst wachend, vor Kälte zitternd und aus Reismangel hungernd die Nacht unter ihren Palmblattmatten verbrachten.
Beim Erwachen lag alles in dicke Nebel gehüllt und die enge, tiefe Schlucht vor uns erschien düster wie eine grosse tiefe Höhle ohne Ausgang. Auch war durch den heftigen Regen die Nacht über der schmale Laja so geschwollen, dass wir unmöglich in seinem Bette hinuntersteigen konnten. Das Wasser fiel übrigens bereits wieder, und einige Malaien, die ihr Lager auf einer Schuttbank aufgeschlagen hatten und nachts von dort durch die Flut vertrieben worden waren, sassen jetzt wieder auf der gleichen Bank und wärmten sich an einem Feuer.
Die erste Person, die von der Nachhut erschien, war Maïl, einer der Malaien aus Samarinda, den wir am wenigsten erwarteten, denn er hatte uns schon tags zuvor auf dem Landwege mit seinen an einer verbreiteten Hautkrankheit (Tinea albigena) leidenden Fusssohlen nur äusserst mühsam und vor Schmerz weinend folgen können. Als er von den anderen gehört hatte, dass ich ohne Essen war, hatte er sich trotz seiner Schmerzen noch um ½ 4 Uhr allein auf den Weg gemacht, um mir einige gebratene cabin biscuits zu bringen, die er mit sich führte. Er war jedoch nicht weiter als bis zum steilen Abhang an der Wasserscheide gelangt und zum Übermass des Missgeschicks einem Seitenarm statt dem Hauptfluss gefolgt. Er war es gewesen, der geschossen hatte, auch hatte er unsere Antwort gehört, aber die Nacht, aus Furcht sich noch weiter zu verirren, lieber unter einigen Rotangblättern zugebracht. Die Angst vor Kopfjägern hatte ihm den Schlaf geraubt und so langte er in traurigem Zustand bei uns an. [349] Als kurz darauf die ersten Kajan mit Kwing eintrafen, forderte ich diese auf, bis zum Anlegeplatz der Böte am Kajan weiterzugehen, da ich selbst auf die Reisträger warten wollte. Ich glaubte mich inzwischen mit Maïls Biscuits begnügen zu können, aber als die Träger noch immer nicht erschienen, blieb uns nichts anderes übrig, als Kwing zu folgen.
Hunger, Müdigkeit und Schmerzen in der linken Hüfte zwangen mich, nach einer Stärkung zu suchen; da meine Gesellschaft jedoch nichts Essbares bei sich hatte, war ich schliesslich froh, von einem zurückgebliebenen Kajan etwas Klebreis und von Maïl noch etwas Zucker zu erhalten. Obgleich bereits verschiedene Generationen kleiner Milben in dem Klebreis üppig schwelgten, mundete er mir doch ausgezeichnet und stärkte mich genügend, um den äusserst anstrengenden Weg fortsetzen zu können. Auf einer Geröllbank im Fluss fanden wir Abdul sitzen und auf uns warten. In dieser niederdrückenden Umgebung erschien er uns wie ein Glücksbote, als er meldete, dass Anjang Njahu, mein Hauptgesandter, mit guten Nachrichten und zwei Böten aus Apu Kajan angekommen war und ich mit einem derselben sogleich den Laja hinunterfahren konnte. Als eine Stunde später Anjang Njahu und Bang Awan mir mit dem zweiten Boot entgegen kamen, stieg ich in dieses um und erfuhr, dass sie gerade am Tage vorher von unten angekommen waren und der Kĕnjahäuptling Bui Djalong nur auf näheren Bericht über unsere Ankunft wartete, um uns abzuholen; inzwischen hatte er die Häuptlinge weiter unten am Kajan-Fluss durch Taman Ulow um Hilfe bitten lassen. Einige Häuptlinge hatten sich anfangs gegen meinen Empfang ausgesprochen u.a. Bo Anjè, Bui Djalongs ältester Bruder, der hauptsächlich eine “wang kapala” (Kopfsteuer) von den Niederländern fürchtete. Je zwei von diesen Widersachern hatte Anjang Njahu ein Stück weissen Kattuns geschenkt, wonach in ihren politischen Überzeugungen ein plötzlicher Umschwung eingetreten war. Meine Kajan bestätigten die Aussagen der Kĕnja, dass Bui Djalong nach der Unterwerfung aller Stämme unter die Uma-Tow als oberster Häuptling aller Kĕnja verehrt wurde.
Von den vielen anderen Berichten meiner Gesandten interessierte mich am meisten, dass Bui Djalong auf seiner Expedition nach Sĕrawak wirklich mit allen Häuptlingen vom Tĕlang Usān (Baram River) mit einem Dampfer nach der Residenz Kutching gebracht worden war, wo Radja Brooke ihn gefragt hatte, ob er mit seinem Volke nicht [350] nach dem Balui oder oberen Batang Rĕdjang, also auf englisches Gebiet, auswandern wollte. Der Häuptling habe darauf geantwortet, dass er seine Heimat nicht verlassen wolle, worauf ihm der Radja gesagt haben soll, er werde sich dann bald in den Händen der Niederländer befinden, da ich bereits auf dem Wege zu ihnen sei. Hierauf hatte Bui Djalong geschwiegen. Auf der Heimreise der Kĕnja längs des Tĕlang Usān war einer der ihnen zum Schutz mitgegebenen bewaffneten Polizeiagenten von den Batang-Lupar mit einem vergifteten Pfeil getötet worden—das Gerücht war diesmal also wahr gewesen.
Nach Bui Djalongs Rückkehr war seine Tochter Kuling gestorben; wir trafen gerade zur rechten Zeit, nach Beendigung der offiziellen Trauerperiode, bei den Uma-Tow ein. Der Häuptling hatte seinen Namen Taman Kuling “Vater von Kuling” eben abgelegt und seinen Knabennamen Djalong wieder angenommen, mit dem Beiwort “Bui”, der den Tod seines Kindes anzeigte. Wir mussten ihn daher stets Bui Djalong nennen.
War unsere Stimmung in den letzten Tagen gedrückt gewesen, so änderte sich nun durch die günstigen Berichte alles wie durch einen Zauberschlag und wir begannen uns über den glücklichen Verlauf der Reise, besonders die schnelle, wenn auch sehr schwierige Fahrt flussaufwärts zu freuen. Im allgemeinen hatte mir mein Geleite von Kajan und Pnihing alle Ursache zur Zufriedenheit gegeben, ich hatte ihm sehr viel überlassen können.
Unter dem Eindruck des guten Erfolges gingen am 27. August alle Leute sogleich ab, um das zurückgebliebene Gepäck abzuholen und liessen uns auch nachts in unserem Lager an der Mündung des Laja in den Kajan allein zurück, da sie unterwegs im Walde übernachteten; am folgenden Tage langten sie mit unserem Hab und Gut wohlbehalten im Lagerplatz an.
Der am 25. und 26. August von uns zurückgelegte Landweg über die Wasserscheide führte mit seitlichen Abweichungen von höchstens 10° direkt nach Norden. Trotz seiner Länge hatte er uns keine aussergewöhnlichen Schwierigkeiten geboten, weil er nirgends anhaltend steil aufstieg. Die Passhöhe musste etwa 850 m. ü.d.M. liegen; bis zur Lajamündung fällt der Weg um 200 m. Das Streichen der Schiefer im Tĕmha und Mĕsĕai war ungefähr W–O, also parallel dem Lauf der Wasserscheide. Von dieser gehen in nördlicher und südlicher Richtung Seitenrücken aus, zwischen denen kleine Flüsse dem Mahakam [351] resp. dem Kajan zuströmen. Die Entfernung vom Lagerplatz am Mĕsĕai bis zu dem am Kajan betrug etwa 22 km. Von den klimatischen Verhältnissen dieser Gegend erhält man eine Vorstellung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass in dem engen, finsteren Tal des Laja in einer Höhe von 700–800 m alle Bäume mit einer dicken Moosschicht bekleidet waren und die Felsen entweder blosslagen oder eine mehr aus Algen als aus Flechten bestehende Vegetation trugen.
Anjang Njahu begab sich bereits am 27. Aug. wieder den Kajan hinunter zu Bui Djalong, um diesem unsere Ankunft zu melden, die ihm überraschend schnell vorkommen musste; wir rechneten daher auch nicht zu fest auf eine baldige Hilfe, die in Anbetracht unseres grossen Reismangels sehr notwendig war.
Viele Kajan begaben sich am anderen Tage gruppenweise in den Wald, wo sie für sich selbst Böte bauen wollten, aus Furcht, die Kĕnja könnten am Ende nicht für alle genügend Fahrzeuge heraufbringen. In unserem Lager an dem hier nur 10 m breiten Kajan wurde es nun sehr still, besonders als die Malaien einige Tage später an Hunger zu leiden anfingen und dadurch alle Unternehmungslust verloren. Ich hatte ihnen nämlich für die Zeit bis zur Ankunft der Kĕnja nur halbe Reisportionen erteilen lassen und erwartet, sie würden mit Eifer im Walde nach allerhand essbaren Pflanzen suchen und mittelst Reusen Fische fangen. Hierzu schienen sie aber nicht aufgelegt, sondern zogen es vor, in den Hütten umherzuliegen; vielleicht waren sie auch von den ausgestandenen Strapazen zu ermüdet, um sich jetzt, wo das Ziel beinahe erreicht war, noch besonders anzustrengen.
Auch die Kajan, die ebenfalls nur noch sehr wenig Reis übrig hatten, beschränkten sich auf das Pflücken von essbaren Farrenspitzen und fingen nur in den ersten Tagen, wo sie sich mit dem Bau ihrer Böte beschäftigten, mit ihren Speeren Fische. Nach Sagobäumen zu suchen, zeigten sie keine Lust; wahrscheinlich wagten sie sich in dieser unbekannten Gegend nicht weit fort. Selbst die sehr frische Spur eines Rhinozeros, das eines Abends dicht unterhalb unseres Lagers den Fluss passiert hatte, vermochte ihren Jagdeifer nicht zu wecken. Sobald unser ganzes Gepäck im Lager untergebracht worden war, erklärte Kwing, die Kajan könnten mir nun nicht weiter helfen, sie verzichteten aber von diesem Augenblick an auch auf ihren Lohn von fl 2.50 pro Tag. Allerdings liess er durchschimmern, dass sie den Betrag trotzdem gern [352] empfangen würden. Hierin kam ich ihnen gern entgegen, da sie jetzt bereit waren, auch Goldgeld anzunehmen, worauf sie in Long Dĕho nur sehr widerstrebend eingegangen waren; sie wollten letzteres später am Mahakam wieder gegen Silber einwechseln. Damit sie in Zukunft nicht stets ein Taggeld von fl 2.50 verlangten, setzte ich ihnen nochmals auseinander, warum ich früher ohne Zögern auf ihre hohe Forderung eingegangen war; ich wollte ihnen die grosse Angst, mit der sie den Zug unternommen hatten, vergüten und sie für den durch den langen Aufenthalt in Long Dĕho erlittenen Verlust entschädigen. Sehr teuer kam mir übrigens ihre Hilfe wegen der vielen Ruhe- und Wartetage, die ich nicht zu bezahlen brauchte, nicht zu stehen.
Anjang Njahu, den wir bereits am 31. August von Bui Djalong zurückerwarteten, traf auch am 1. September noch nicht wieder ein. Morgens hatte ich den Malaien ihre letzte Ration Reis ausgeteilt, und da auch die Kajan Hunger litten, beschlossen sie, einige der Ihren beim Kĕnjastamm der Uma-Bom Reis holen zu lassen. Nach den eingezogenen Berichten wohnte dieser Stamm uns am nächsten an einem vom oberen Kajan zum Boh führenden Pfade. Anderen Morgens sehr früh begaben sich Bang Awan und der Malaie Lalau auch in der Tat auf den Weg, fuhren in einem selbst gebauten Boot den Kajan bis zum Beginn des Landweges hinunter und wollten dann dem Pfad zu folgen versuchen.
Der Hunger fing an stark auf uns alle zu wirken; meine Malaien lagen apathisch in ihren Hütten ausgestreckt und die Kajan hockten mit bedrückten Gesichtern beieinander. Jetzt, wo ihre Stammesgenossen mit den Kĕnja nicht zurückzukehren schienen, erwachte ihre frühere Angst mit erneuter Heftigkeit und steigerte sich unter dem Einfluss des Hungers zu phantastischen Vorstellungen von grossen Gefahren, die uns bedrohten. Einige kamen mich fragen, ob ich nicht auch glaubte, dass die Kĕnja die Unseren gefangen und vielleicht schon getötet hätten, und ob es nicht besser wäre, so schnell als möglich über die Wasserscheide zu unseren Böten zurückzukehren. Natürlich waren auch wir Europäer nichts weniger als fröhlich gestimmt, zwar nicht aus Angst, aber vor Hunger; auch bedrückte uns das Bewusstsein, dass dieser Zustand noch einige Tage anhalten konnte, da wir aus Erfahrung wussten, wie leicht zufällige Ereignisse die Eingeborenen von einer schnellen Hilfeleistung abhielten, besonders, wo es sich um so grosse Abstände handelte. Wir rechneten jedoch zuversichtlich auf den Reis [353] der Uma-Bom. Gross war daher unsere Enttäuschung, als gegen 9 Uhr morgens Bang Awan und Lalau mit leeren Händen ins Lager zurückkehrten, weil unterwegs ein links auffliegender hisit ihnen Unheil prophezeit hatte. Wenn in diesem Augenblick irgend ein Zeichen die Gesellschaft erschreckt hätte, so wären alle in den Wald geflohen und hätten uns und unser Gepäck ohne Gewissensbedenken im Stich gelassen. Das ängstliche Gemüt der Bahau kennend, wagte ich Bang Awan nicht einmal einen Vorwurf darüber zu machen, dass er auch unter diesen kritischen Umständen unser Rettungsmittel hatte fahren lassen.
Als wir in sorgenvolle Gedanken versunken dasassen, schreckten uns einige Kajan auf, die in der Ferne Geräusche zu hören glaubten. Nachdem wir eine Zeitlang gespannt gelauscht hatten, schien es uns, dass in der Tat Böte heraufgestossen wurden. Um die Flussbiegung erschien bald darauf ein Boot mit Anjang Njahu und seinen Begleitern, dann folgten viele andere, bemannt mit mir völlig unbekannten Gesichtern. Die meisten legten nicht an unserem Lagerplatz, sondern am jenseitigen Ufer des sehr schmalen, durchwatbaren Flüsschens an, von wo sie uns in ihren Böten stehend verlegen anstarrten. Anjang Njahu war mit zwei Böten der Kĕnja bis zu Kwing Irangs Hütte gefahren und trat dann nach einer kurzen Besprechung mit diesem an der Spitze von 6 Kĕnjahäuptlingen auf mich zu. Zu meiner Verwunderung ergriff er feierlich meine Hand und schüttelte diese, doch erklärte er sogleich, er tue dies nur, um den Kĕnjahäuptlingen, die er zu mir geleitete, zu zeigen, wie man einen Europäer begrüsse. Die Kĕnja schienen sehr gelehrig zu sein, wenigstens schüttelten sie mir so kräftig die Hand, als ob sie an eine derartige Begrüssung ihr Leben lang gewöhnt gewesen wären. Alle Sechs waren Glieder der Häuptlingsfamilie des Stammes Uma-Tow und von Bei Djalong beauftragt, meine Expedition so schnell als möglich den Kajan hinunter zu bringen, da der Häuptling selbst mich bei Batu Plakau erwartete, einer Flussstelle, die nicht befahrbar war und hinter der erst die Siedelungen der Kĕnjastämme lagen. Kwing Irang begann mir das alles selbst in der Busang-Sprache mitzuteilen, aber kaum merkten die Kĕnja, dass ich auch auf Busang antwortete, als sie sich unbefangen ins Gespräch mischten und mich zur Eile anspornten.
Mir blieb kaum Zeit, mich über das freie Auftreten unserer neuen Gastherren zu verwundern, denn sogleich stellte sich die neue Schwierigkeit [354] heraus, dass die zahlreichen kleinen Böte der Kĕnja uns bei weitem nicht alle aufnehmen konnten. Die Kĕnja berichteten, dass grössere Böte nicht herauffahren konnten, uns aber unterhalb Batu Plakau erwarteten. So wurde denn sogleich verabredet, dass die Kajan mit 5 Malaien fürs erste zurückbleiben, die übrigen Malaien und wir Europäer jedoch mit den Kĕnja flussabwärts fahren sollten. Letztere begannen sogleich von dem Reis und anderen Nahrungsmitteln, die sie uns mitgebracht hatten, eine reiche Mahlzeit zuzubereiten. Als die 6 Kĕnjahäuptlinge etwas vertrauter mit mir geworden waren, wozu unsere Kenntnis der Busang-Sprache viel beitrug, legten auch die Böte vom jenseitigen Ufer bei uns an. Diese hatten Anjang Njahu mit seinen Kajan vorausfahren lassen, damit wir nicht auf sie schiessen konnten. Die Verteilung und Einschiffung von Menschen und Gepäck nahmen mich so in Anspruch, dass ich nur halb darauf achtete, wie energisch die Kĕnjahäuptlinge ihren Untergebenen Befehle erteilten und wie schnell bei diesen die Ladung von statten ging. Für Leute, die zum ersten Mal mit dem Gepäck von Weissen zu tun hatten, war die Sicherheit, mit der sie dieses behandelten, sehr auffallend; ich sass bereits im Boote und hatte von Kwing und seinen Kajan schon vorläufig Abschied genommen, bevor ich mir hierüber Rechenschaft gab.

Brücke über eine Schlucht.
Die Fahrt abwärts erforderte indessen unsere ganze Aufmerksamkeit; das Flussgefälle war hier sehr schwach, nur ab und zu fuhren wir eine Stromschnelle hinunter, die bei höherem Wasserstande vielleicht kaum bemerkbar gewesen wäre, jetzt aber ein Schleppen der Böte notwendig machte. Die Umgebung war mit hohem, aber jungem Wald bedeckt, den alten hatten die Kĕnja gefällt; das anstehende Gestein an den Ufern zeigte horizontale Schichten von Schiefern und Sandstein, die miteinander abwechselten. Bis ½ 4 Uhr nachmittags fuhren wir hauptsächlich in westlicher Richtung, dann erreichten wir einen grossen, rechten Nebenfluss des Kajan, den Danum, an dessen Oberlauf der Stamm Uma-Bom wohnen sollte. An der Mündung des wie der Hauptfluss etwa 25 m breiten Danum begegneten uns die ersten menschlichen Wesen, ein alter Mann und ein Knabe, die am Ufer sassen und meinen Bootsleuten etwas zuriefen, worauf diese einen Augenblick zögerten, dann aber weiterruderten. Als ich mich zufällig danach erkundigte, was die beiden in dieser Wildnis eigentlich wollten, erzählten die Kĕnja, der Mann, einer der ältesten Uma-Bom namens [355] Bo Usat Jok, warte bereits seit 3 Tagen mit seinem Enkel an derselben Stelle auf meine Ankunft, um ein Heilmittel gegen seine Leiden von mir zu erhalten. Meine Ruderer hatten gedacht, ich wäre augenblicklich wohl nicht aufgelegt, um dem Manne zu helfen, und waren vorbeigefahren. Ich liess sie jedoch zurückrudern und sah mir den Mann an, der seit vielen Jahren bereits an einem Syphilid der Rückenhaut litt, gegen den eine Jodkalilösung von sehr guter Wirkung sein musste. Nach Aussagen der Kĕnja war Bui Djalongs Lagerplatz nicht mehr sehr weit von uns entfernt; so liess ich die beiden denn in eines der Böte aufnehmen, um dem Kranken erst nach unserer Landung Arzneien zu geben.
In der Tat dauerte die Talfahrt auf dem hier breiten und tiefen Flusse nur noch eine halbe Stunde, worauf die Kĕnja an einer freien Uferstelle anlegten und uns auszusteigen aufforderten, weil hier der Landweg längs den mit Böten nicht zu passierenden Wasserfällen von Batu Plakau begann. Alles Gepäck wurde unter die Kĕnja und Malaien verteilt und fort ging es durch den jungen Wald, in dem die Uma-Bom früher gewohnt hatten. Bald führte der Weg über lange Reihen behauener Stämme, die an gefährlichen Stellen wagrecht zu den Bergabhängen hintereinander auf Stützbalken angebracht waren, eine Weganlage, die ich bis dahin auf Borneo noch nicht gesehen hatte. An einer Steile, wo die Böte in 50 m Höhe auf diesem Wege um die Abhänge gezogen werden mussten, wurde der Bau noch grossartiger. Auf einigen Strecken war in den Abhängen ein sehr breiter Weg ausgegraben, den man zum besseren Gleiten der Böte mit dünnen Baumstämmen belegt hatte; wo Schluchten die Bergwände trennten, waren diese durch ebenfalls mit einer Lage von Stämmen bedeckte Gerüste überbrückt worden. Da dieses Bauwerk 2 km lang war, erregte es stets wieder Demmenis und meine Bewunderung, obgleich der Weg für uns beschuhte Europäer oft sehr unbequem war.
Einige Kĕnja waren vorausgegangen, um unsere Ankunft Bui Djalong zu melden. Nach einiger Zeit kamen uns zwei alte Männer entgegen, von denen der eine etwas schneller schritt und uns nach der hier eben eingeführten europäischen Sitte die Hand drückte. Dies war Bui Djalong, ein kräftig gebauter, etwa 50 jähriger Mann mit ruhigem, intelligentem Gesicht, der jedoch etwas gebeugt ging und hinkte. Nach der Begrüssung führte er mich der Kĕnjasitte gemäss in seine in der Nähe gelegene Hütte, wo er sich mit gekreuzten Beinen auf seinem Platz [356] niederliess und mich zum Sitzen neben sich aufforderte; als Sessel brachte man mir einen Packen Kattun. Während unseres Gespräches sahen wir einander forschend an und auch die grosse, um uns herum kauernde Kĕnjagesellschaft richtete ihre Augen durchdringend auf den ersten Weissen, der ihr Land besuchte. Bui Djalong, der zum Glück ebenfalls gut Busang verstand, lud uns als Gäste in sein Haus ein, wo man uns bereits mit Ungeduld erwartete.
Die Frauen sollten besonders gespannt sein, weil sie bisher den Berichten ihrer Männer, dass an der Küste weisse Menschen lebten, nicht hätten glauben wollen. Der Häuptling sprach auch von seinem Sohn und seiner Tochter, die vor kurzem gestorben waren, worauf ich als Grund meines Kommens den Wunsch angab, die bestehenden Streitigkeiten mit dem Mahakamgebiet aus dem Wege zu räumen. Die weitere Unterhaltung drehte sich um unwichtige Dinge, nur fiel es mir auf, dass der Häuptling auf meine Erklärung, warum ich als Sühngeld für die Ermordung seines Enkels keinen Sklaven mitgebracht hatte, keine Antwort gab. Die übrigen alten Männer begnügten sich damit, uns anzustarren. Unterdessen bauten einige junge Kĕnja dicht gegenüber der Hütte als Unterkunft für uns ein schräges Dach. Einige meiner Malaien übernahmen dabei die Leitung, spannten wie gewöhnlich das Segeltuch aus und stapelten darunter das Gepäck auf. Bei Einbruch der Dunkelheit konnten wir uns bereits in unser Zelt zurückziehen, mit dem befreienden Gefühl, seitens der Kĕnja über Erwarten gut empfangen worden zu sein.
Unseren Malaien, die sich wegen Kwings und der Kajan Abwesenheit unter so vielen Kĕnja zu fürchten begannen, suchte ich ernsthaft die Grundlosigkeit ihrer Angst klar zu machen. Anjang Njahu hatte uns bereits das erste Mal 3 Packen Reis von den Kĕnja mitgebracht, bei seiner Rückkehr aufs neue; alle erforderliche Hilfe hatten diese uns so schnell als möglich geleistet, den langen Landweg in Stand gesetzt, so viele Menschen und Böte herbeigeschafft, was uns in so prompter und vollkommener Ausführung noch nirgends begegnet war. Ein Zweifel an der freundschaftlichen Gesinnung der Kĕnja uns gegenüber war somit gänzlich unberechtigt, zudem flösste die Persönlichkeit des Häuptlings grosses Vertrauen ein. Auf den Vorschlag der Malaien, nachts Wache halten zu lassen, ging ich daher nicht ein; wie leicht konnte einer nachts aus Angst sein Gewehr abschiessen und dadurch grossen Schreck, womöglich Unglücksfälle [357] hervorrufen. Ich befahl denn auch, überhaupt keine Wache zu halten, und schlief mit Demmeni und meinem Jäger Doris in nächster Nähe des Häuptlings bald ruhig ein.
Des anderen Morgens begannen wir sogleich Umschau zu halten. Als Lagerplatz hatten die Kĕnja einen ebeneren Teil des Bergabhanges dicht beim Flusse gewählt; die Hütten standen unregelmässig durcheinander, je nach der Bodenbeschaffenheit, und waren nach der bei allen Bahau im Walde gebräuchlichen Art gebaut. Sie waren sehr zahlreich, weil Bui Djalong über 100 Mann mitgenommen hatte, um den Weg so schnell als möglich zu reparieren und uns mit den Böten zu Hilfe zu kommen. Die Kĕnja waren augenscheinlich an schnelles Arbeiten gewöhnt; sie hatten noch kaum ihr Mahl beendet, als der Häuptling ruhig aber entschieden befahl, dass ein Teil der Männer mit den Böten den Fluss wieder hinauffahren sollte, um Kwing Irang und die Kajan abzuholen, ein anderer einiges beim Landungsplatz zurückgelassene Gepäck nachtragen und ein dritter, der ins Dorf heimkehrte, einige unserer vielen Koffer mitnehmen sollte. Die weiteren Befehle teilten darauf einige seiner jungen Blutsverwandten ihren Mannschaften aus und zwar in viel lauterem Tone, als bei den Bahau üblich ist, aber zu meinem Erstaunen gehorchte man ihnen sofort und bald waren, ausgenommen einige Männer, die dem Häuptling Gesellschaft leisteten, alle unterwegs. Die Kĕnja traten ganz allgemein einander gegenüber viel energischer auf, als ich es von ihren Stammesgenossen gewöhnt war; so liess Bui Djalong dem alten Mann der Uma-Bom, den ich im Laufe des Vormittags behandelt und mit einem grossen Vorrat Arzneien versehen hatte, durch einen seiner Ältesten unzweideutig vorhalten, dass sein Stamm sich beeilen müsste, um ebenfalls etwas zu meinem Empfange beizutragen, was bis jetzt noch nicht geschehen sei. Mit dieser Botschaft wurden der Alte und sein jugendlicher Begleiter den Fluss bis zur Danummündung wieder hinaufgeschickt. Der still verbrachte Tag war zum gegenseitigen Kennenlernen wie geschaffen, und da unser Ruhebedürfnis sehr gross war, taten wir auch nicht viel anderes, als uns mit unseren neuen Gastherren unterhalten. Ein halbes Pfund Tabak, das ich dem Häuptling zur Verteilung übergab, erregte grosse Freude.
Im Lauf des Tages kamen alle unsere Koffer an. Im Vertrauen, dass die Kajan am anderen Tage nachkommen würden, beschlossen wir, unseren Lagerplatz unterhalb der Reihe Wasserfälle von Batu [358] Plakau zu verlegen und Kwing dort zu erwarten. Nach einer ruhigen Nacht, die uns wieder zu Kräften kommen liess, wurde auch dieser Plan ohne Schwierigkeiten seitens der Träger ausgeführt. Der fernere Weg war ebenso beschaffen, wie der vorherige; um die in einem Winkel von 60° zum Fluss abfallenden Berghänge war wieder ein 1.25 m breiter Weg ausgegraben und mit Stämmen belegt worden und über die Schluchten Brücken geschlagen. Die gut behauenen Balken und die festen, für uns von neuem hergestellten Brücken erweckten wiederum meine Bewunderung, der ich auch gegen Bui Djalong, der mit seinem kleinen Sohn Ului neben mir ging, Ausdruck gab. Nach einiger Zeit erreichten wir eine Geröllbank im Fluss, wo wir die Kajan erwarten sollten. Die Hütten waren bereits mit derselben Schnelligkeit wieder aufgeschlagen worden und alles wieder zur Ruhe gegangen, als fünf der bei Kwing zurückgebliebenen Malaien mit der Meldung eintrafen, dass nur ein Teil der Kajan den Fluss hinunter gekommen war, weil die Böte wieder nicht gereicht hätten und Kwing mit den übrigen daher aufs neue geholt werden müsse. Dies bedeutete einen unangenehmen Aufenthalt, da die Kĕnja ihren Reisvorrat nicht für so lange berechnet hatten. Der erste Teil der Kajan kampierte oberhalb Batu Plakau und erschien erst am 5. Sept. mit dem Bericht, es sei fraglich, ob die zugesandten Böte auch diesmal genügen würden, um Kwing mit dem Rest der Kajan abzuholen. Dank den Bemühungen unserer Gastherren wurde aber doch bereits am folgenden Mittag die Ankunft sämtlicher Kajan gemeldet. Die Kĕnja machten sich sogleich daran, die Böte auf dem Landwege herunter zu schaffen, eine Arbeit, an die sie mehr gewöhnt waren als die Kajan. Bui Djalong ging Kwing Irang ein Stück weit entgegen, als ihm dessen Kommen gemeldet wurde. Bald erschienen die beiden grossen Häuptlinge vom oberen Kajan und oberen Mahakam in unserem Lager und liessen sich in Bui Djalongs Zelt nieder. Ich hatte alle Mühe, das Gespräch in Fluss zu halten. Wie ich erwartet hatte, drückte auch Kwing seine Bewunderung über den grossen Wegebau aus, den auch er noch nirgends so gesehen hatte. Der Kĕnjahäuptling verhielt sich besonders schweigsam, augenscheinlich hatte ihn das kriegerische Aussehen meiner Kajan stutzig gemacht und verstimmt. Diese legten nämlich ihre schweren Rotangmützen, Kriegsjacken, Schilde, Schwerter und Speere überhaupt nicht ab, während die Kĕnja an Waffen nur einige kleine Schwerter zum Holzhacken mitgebracht hatten. Wie ich erfuhr, trugen [359] sie im Gegensatz zu den Bahau nur in Kriegszeiten Warfen.
Wir kamen überein, noch am gleichen Tage nach Tanah Putih (weisse Erde), Bui Djalongs Niederlassung, hinunterzufahren. Während der Zubereitung des Essens gelang es den Kĕnja, alle Böte bis in unser Lager zu ziehen, doch reichte ihre Hilfe für die grosse Anzahl Menschen und das viele Gepäck nicht aus. Als die Kĕnja aber den Kajan einen Pfad anwiesen, auf dem sie sich über Land allein nach Tanah Putih vorausbegeben konnten, fürchteten die Mahakamhelden jedoch einen Fallstrick und erfanden allerlei Ausflüchte, um zu bleiben, bis sie alle zusammen abgeholt werden konnten; auch Kwing behauptete, sich dem mit uns zugleich abreisenden Teil der Kajan nicht anschliessen zu können, da diese später ihre Landsleute nicht mehr von Tanah Putih aus würden abholen wollen, was sie für ihn dagegen gern tun würden. Nachdem alle vorhandenen Böte gut beladen und alles Personal, das mitfahren sollte, aufgebrochen war, bestiegen auch Bui Djalong, dessen Sohn und ich ein Boot und fuhren als letzte ab. Wegen der Schnelligkeit der Fahrt flussabwärts wurden uns verschiedene Stellen gefährlich, namentlich die zahlreichen Stromschnellen, die durch grosse, auf Schuttbänken liegende Blöcke verursacht wurden, an die wir bei dem niedrig stehenden Wasser anzuprallen und umzuschlagen riskierten. In einer besonders langen Stromschnelle, in welcher der Fluss um 20 m fiel, verliessen alle Männer das Boot, um dieses schwimmend im Gleichgewicht zu halten, wobei sie selbst vom Strome halb mitgerissen wurden.
Auf der Strecke bis zum Anlegeplatz von Tanah Putih senkte sich der nordwestlich strömende Fluss um 50 m. Die Umgegend war gebirgig und an den meisten Abhängen des rechten Ufers zeugten aufsteigende Rauchwolken von dem Vorhandensein vieler Reisfelder, von denen einige hoch über dem Fluss angelegt waren. Das Land zur Linken war unbewohnt, weil die Kĕnja dort Überfälle seitens der Batang-Lupar aus Sĕrawak fürchteten.
Das blossliegende Gestein bestand hier ebenfalls aus abwechselnden Schiefern und Sandsteinschichten, nur kamen an verschiedenen Stellen Basaltblöcke in diesen vor. Einmal passierten wir auch eine prachtvolle Basaltmauer, die ganz aus senkrechten Pfeilern zu bestehen schien.
Tanah Putih lag nicht am Kajan selbst, sondern an dessen Nebenfluss Djĕmhāng. Wegen der langen Reihe schwer passierbarer Wasserfälle, die sich kurz vor dessen Mündung befinden, hatte man etwas [360] weiter aufwärts eine Landungsstelle gebaut und diese durch einen gut unterhaltenen Fussweg mit dem Dorfe verbunden. Der augenscheinlich bereits seit lange benützte Weg war über eine grosse Strecke mit behauenen Baumstämmen (pālāng) belegt und führte über einige grösstenteils mit Gestrüpp bewachsene Hügel auf eine etwa 100 m hohe Wand des Djĕmhāngtals, von wo aus man einen prachtvollen Blick auf das Tal selbst mit dem darin gelegenen Dorf und das Land von Apu Kajan genoss. Für müde Reisende, die auf dem Heimwege ausruhen wollten, hatte man hier ein Aussichtshäuschen (kubu) gebaut, das aus einer erhöhten Diele mit einem Dach darüber bestand.

Kubu auf dem Wege nach Tanah Putih.
Auf Bui Djalongs Vorschlag machten wir hier Halt, um den Bewohnern seines Dorfes durch Abschiessen der Gewehre unsere Ankunft anzukünden. Während der Vorbereitungen hierzu bemerkte ich, dass der Charakter der vor mir liegenden Landschaft ein ganz anderer war als am Kapuas und Mahakam. Zwar erschien die Umgegend auch hier bis auf grossen Abstand hügelig und bergig, aber vom ursprünglichen Wald war nur noch hoch auf den Abhängen etwas zu sehen. An Stelle desselben erhob sich auch beinahe nirgends junger Wald (tālo̱n), sondern Gestrüpp und hohes Gras, mit vereinzelten Bäumen, eine Landschaft, der ich im ganzen übrigen Teil von Mittel-Borneo noch nicht begegnet war. Dies fand hauptsächlich darin seinen Grund, dass die Bevölkerung dieses Gebiets sehr dicht war und den Ackerbau intensiv betrieb.
So konnten wir denn in dem sehr flachen und völlig waldlosen Tal des Djĕmhāng unter uns Tanah Putih in seiner ganzen Ausdehnung übersehen. Sogleich fiel mir auf, dass hier nicht wie gewöhnlich nur 1–2 Reihen langer Dajakhäuser beieinander standen, sondern dass das Dorf aus etwa 10 regelmässigen Häuserreihen zusammengesetzt war. Hieraus liess sich bereits auf eine starke Bevölkerung schliessen, doch bestärkte Bui Djalong noch diese Vermutung, indem er uns auch auf die ausgedehnte Anlage der Reisfelder von benachbarten Niederlassungen in anderen Flusstälern aufmerksam machte. Wir erwarteten hier oben die Nachzügler, dann stieg unsere ganze Karawane, bestehend aus 60 Kĕnjaträgern, einigen Kajan und Pnihing, meinen Malaien und uns in einem imposanten Zug auf dem breiten Wege ins Tal hinab.

Kubu auf dem Wege nach Tanah Putih.
[361]
Kapitel XIII.
Empfang in Tanah Putih—Verhältnisse im Dorf—Erste politische Versammlung—Freundschaftlicher Verkehr mit den Dorfbewohnern—Überblick über die geographischen und geschichtlichen Verhältnisse in Apu Kajan—Besuch aus benachbarten Dörfern—Stellung der verschiedenen Stände bei den Kĕnja—Tod und Begräbnis eines Häuptlings—Ankunft der verirrten Long-Glat-Gesellschaft—2. und 3. politische Versammlung—Anerkennung der niederländischen Herrschaft in Apu Kajan.
Ein breiter, bequemer Weg, den die Kĕnja mit Stämmen und Brettern belegt hatten, führte uns um den Fuss des Bergabhangs ins Dorf. Hier waren unterdessen zwischen den Häuserreihen einige Gruppen von Frauen und Kindern zu unserem Empfang erschienen. Bei den ersten Reihen begrüsste uns ein alter, magerer Mann, der mir als des Häuptlings Bruder Bo Anjè vorgestellt wurde; er gehörte zu denen, die Anjang Njahu mit weissem Kattun für unseren Empfang hatte gewinnen müssen. Wir reichten diesem erkauften Freunde die Hand, stiegen am Ende des längsten und mittelsten Hauses der langen Reihe die Treppe hinauf und befanden uns in Bui Djalongs Heim.
Das Haus war zwar weniger hoch über der Erde, sonst aber wie alle übrigen ganz im Stil der Bahau gebaut, nur bestanden Dach und Wände nicht aus Holz, sondern aus Matten von schweren, aneinander gereihten Baumblättern. Auch war der Fussboden der Galerie, die wir betraten, vor den Wohnungen der gewöhnlichen Kajan nicht aus Brettern gebaut, sondern aus dünnen Stämmen; erst dicht bei der ăwă des Häuptlings und in dieser selbst bedeckten schwere Bretter den Boden.
Draussen hatten uns einige Menschengruppen aus der Ferne neugierig, aber nicht ängstlich angestarrt, und sobald wir in Bui Djalongs langem Haus an einer Wohnung vorüber waren, kamen die Bewohner aus ihr zum Vorschein und begleiteten uns zur ăwă. Hier wurden einige kupferne Gonge als Sitze für uns gegen die Aussenwand niedergelegt, dicht unter einer Reihe von vielleicht 30 geräucherten Menschenschädeln, die in Büscheln von jungen Palmblättern zwischen den [362] Hauptpfählen der Galerie hingen und durch den Rauch des Herdfeuers, das ständig unter ihnen brannte, geschwärzt worden waren. Rund um dieses Feuer, hinter dem wir sassen, befand sich der Platz für den Häuptling und die vornehmsten Ältesten, wenigstens liess sich Bui Djalong mit einigen ehrwürdigen Greisen dort nieder. Taman Ulow und die Kajan hatten uns schon am Boh auf die Neugier der Kĕnjafrauen und -Kinder vorbereitet und auch Bui Djalong hatte uns bereits dringend gebeten, nicht böse zu werden, wenn man uns lästig falle, denn der ersten Neugier müsse durchaus genügt werden. Da sie hinzugefügt hatten, dass die Kĕnja viel freier als die Bahau seien und sogar handgreiflich werden, bereiteten Demmeni und ich uns auf unseren Gongen, auf denen wir zur Schau dasassen, auf einige schwierige Augenblicke vor. Anfangs wurde es jedoch nicht so schlimm. Die den Schädeln gegenüber versammelte Menge wuchs zwar sehr an und das Gedränge war weit stärker, als ich es bei den Bahau je erlebt hatte, aber anfangs drückte sich das Erstaunen nur in den Gesichtern aus und äusserte sich nur in zahlreichen èh-èh-Rufen, die nicht aufhörten und bei jeder Bewegung, die wir machten, an Zahl und Stärke zunahmen. Augenscheinlich befriedigten wir noch nicht ganz die Neugier der Menge, obgleich wir bereits auf Verlangen einen Ärmel und ein Hosenbein hinaufgestreift hatten zum Beweis, dass unsere Haut auch unter der Kleidung weiss war. Eine freundliche, lebhafte Frau, des Häuptlings Gattin, konnte ihre Wissbegierde schliesslich nicht mehr bezwingen, packte meinen Arm, streifte den Ärmel auf und strich sacht über meine Haut, wobei sie in viele bewundernde èh-Rufe ausbrach. Von ihren, in der Kĕnjasprache gestellten Fragen verstanden wir kein Wort, aber wie Bui Djalong schmunzelnd verdolmetschte, bat sie uns, alle Kleider abzulegen. Auch die Menge rief laut “sow (ausziehen) mong (alles),” und begann sich um meine Person zu drängen; aber ich setzte meinerseits dieser Schaustellung einigen Widerstand entgegen, so dass ich die Zuschauer unbefriedigt liess. Unterdessen hatte der Häuptling den Umstehenden, hauptsächlich den alten Männern, über seine Erlebnisse mit uns ausführlich berichtet, wenigstens schloss ich das aus den immer wieder auf uns gerichteten Blicken der Zuhörer.
Zum Glück empfand man vor unserer Erscheinung noch zu viel Scheu, um zudringlich zu werden, und nur wenige Frauen wagten dem Beispiel von Bui Djalongs Gattin zu folgen und sich von der Echtheit unserer weissen Haut selbst zu überzeugen. [363]
So sassen wir denn etwa eine halbe Stunde da und liessen uns betrachten; glücklicherweise fanden wir unsererseits an den Menschen um uns herum ebenfalls viel Sehenswertes. Am meisten fiel uns das kräftige und gesunde Aussehen der Leute auf und das seltene Vorkommen der beiden Hautkrankheiten ki lān (Tinea imbricata) und bāk (Syphilis), welche den Anblick einer Menge von Bahau-Dajak für Europäer anfangs so abstossend macht. Dagegen waren Kröpfe hier viel allgemeiner verbreitet als am Mahakam und waren die Ohrlappen, besonders bei den Frauen, viel stärker ausgereckt, als ich es bei den Bahau je gesehen hatte. Die Ohrringe waren denn auch besonders zahlreich und schwer. Die Kleidung stimmte mit der der Bahau überein, nur bestand sie sehr einförmig aus weissem oder hellbraunem Kattun oder Baumbast, weil wegen der Trauer des Häuptlings um seine Tochter alle Bewohner der Niederlassung zum Ablegen ihrer schönen Kleider gezwungen waren.
Nach Verlauf der halben Stunde, als Bui Djalong glaubte, unsere erste Begrüssung habe lang genug gedauert, forderte er uns auf, nach unserer Wohnung zu gehen, und führte uns über eine Treppe und einen Holzsteg, die mit hübschen Geländern und Bambuszweigen sorgfältig verziert waren, an das Ufer des Djĕmhāng. Dort erhob sich eine ebenfalls verzierte Plattform und daneben ein langes, scheunenartiges Gebäude, das aus neuen Brettern und Schindeln verfertigt und 1 m über dem Boden gebaut war. Ich kam zuerst nicht auf den Gedanken, dass die Verzierungen am Wege unserem Empfange galten, weil ich eine solche Ehrung bei den Dajak noch nicht erfahren hatte, ich hielt den Schmuck vielmehr für den Überrest von irgend einem Fest. Meine Malaien erzählten jedoch, dass nicht nur die ganze Festverzierung zu unserer Ehre angebracht worden war, sondern dass man auch das Haus für unseren Empfang neu errichtet hatte. Die Höhe dieses Gebäudes schien zwar für lange Europäer nicht berechnet zu sein, aber die Grundfläche war sehr gross, so dass ich die eine Hälfte des Raumes meinem inländischen Personal, d.h. den Malaien, zum Wohnen anweisen, die andere für Demmeni und mich einrichten konnte. Wir hatten bereits eine Stelle zum Aufhängen unserer Moskitonetze ausgesucht und eine Tür erhalten, um sie als Tischbrett zu gebrauchen, als man uns aus einem unverständlichen Grunde wieder zur Häuptlingswohnung rufen kam. Bei unserer Ankunft fanden wir dort eine noch stärker angewachsene Menge und Bui Djalong erklärte, die Leute regten sich [364] darüber auf, dass sie unsere Körper eigentlich noch nicht gesehen hätten, und so bat er uns denn im Namen aller, einen Augenblick unsere Jacken und Hemden abzulegen, damit sie wenigstens unseren Oberkörper sehen könnten. In Anbetracht der grossen Herzlichkeit, mit der man uns hier empfangen hatte, und des Gedankens, dass diese Menschen sich das Unangenehme einer derartigen Schaustellung für uns nicht vorstellen konnten und überdies von ihrer anfänglichen Forderung von sow mong bereits zu bescheideneren Wünschen übergegangen waren, gab ich ihnen nach, und da auch Demmeni einverstanden war, sassen wir bald darauf wieder auf unseren Gongen da, diesmal aber mit entblösstem Oberkörper.
Anfangs nahmen die vielen èh èh kein Ende und es entstand ein lebhaftes Gedränge, um so dicht als möglich an uns heranzukommen. Zu Handgreiflichkeiten kam es jedoch nicht; nur stellte sich Bui Djalongs Frau eine Zeitlang neben uns zum Schutz gegen die andringenden Frauen und Kinder auf, die jetzt, wie vorhin, die Hauptmenge bildeten.
Allzu lange liessen wir die Vorstellung nicht dauern, sondern begaben uns bald wieder nach unserer Wohnung, um diese völlig einzurichten. Das ging jedoch nicht schnell von statten, denn die mutigsten Dorfbewohner waren uns gefolgt und starrten uns, unsere Handlungen und Sachen unermüdlich voll Interesse und Bewunderung an. Ab und zu wagte der eine oder andere, wenn wir auf ihre immer noch wiederholte Aufforderung “sow mong” nicht eingingen, einen Ärmel oder ein Hosenbein aufzustreifen. Übrigens erregten nicht wir allein Interesse, sondern auch unsere Malaien; Midan in seiner Küche und Doris, der Jäger, der seine Waffen reinigte, lockten viele an. Da alle sehr fröhlich und lebhaft waren, gab es ein munteres Bild, das uns sehr angezogen hätte, wenn wir uns nach dem monatelangen Aufenthalt im Walde nicht so sehr nach Ruhe gesehnt hätten. Seit ich den Blu-u verlassen, waren gerade 6 Monate vergangen. Als Doris nun auch noch seine Harmonika hervorholte und deren Töne die an derartige Musik nicht gewöhnten Eingeborenen zu erregen begannen, glich es bei uns mehr einem Jahrmarkt als einer stillen Behausung ermüdeter Reisender. Zum Übermass beeilten sich auch noch die Männer und Frauen, die tagsüber auf dem Felde gearbeitet hatten und abends heimkehrten, das Schauspiel zu geniessen, so dass es sehr spät wurde, bevor es uns unsere Bewunderer zu vertreiben [365] gelang. Wir lagen bereits hinter unseren Moskitonetzen, als man Demmeni noch um seinen Arm bat, um dessen Haut betrachten und befühlen zu können.
Bereits vor Tagesanbruch hockten Frauen und Kinder in unserer Wohnung und warteten auf unser Erwachen; sie waren unten durch das Segeltuch geschlüpft, mit dem wir den Hauseingang verschlossen hatten, daher schützten wir uns später durch eine Tür vor diesen Eindringlingen. Ein Aufstellen von Wachen nachts hielt ich der freundschaftlichen Gesinnung der Bevölkerung wegen für überflüssig; diese wurde uns auch nur durch ihre allzulebhafte Bewunderung lästig. Den ganzen Tag über strömte eine neugierige Menge zu uns, so dass Zeit und Raum zum Essen, Ankleiden und Schlafen beinahe nicht zu finden waren.
Die jungen Leute holten morgens die letzten Kisten vom Landungsplatz ab und gegen Mittag traf auch Kwing Irang mit den Seinen ein.
Nach meiner Gewohnheit liess ich auch hier die Besucher nicht ohne ein kleines Geschenk weggehen und begann daher, sobald wir uns etwas eingerichtet hatten, eine Austeilung von Fingerringen. Unter der Menge entstand aber eine Bewegung, wie ich sie noch in keinem dajakischen Dorfe erlebt hatte. Erst brach ein lautes Jauchzen los, dann wollte jeder als erster etwas erhaschen; einer verdrängte den andern und grosse und kleine Hände an langen und kurzen Armen streckten sich nach mir aus, so dass ich mich nur mit Anstrengung auf meinen Beinen hielt. Der stossenden und drängenden Masse musste ich denn auch erst begreiflich machen, dass eine Austeilung auf diese Weise unmöglich sei. Bui Djalong hatte einen seiner Ältesten beauftragt, meinen Verkehr mit den Dorfbewohnern zu vermitteln, und so übersetzte der Mann mein Busang, das Frauen und Kinder nicht verstanden, in die Sprache der Uma-Tow. Obgleich es augenscheinlich allen schwer wurde, sich zu beherrschen, trat doch etwas Ruhe ein und mit einiger Abwehr der allzu Habsüchtigen machte ich jung und alt glücklich.
Um diesen günstigen Eindruck unseres Besuches noch zu erhöhen, überliess ich es Bui Djalong zu bestimmen, welchen Lohn ich den Kĕnja, die mir zu Hilfe gekommen waren, geben sollte. Für die grossen Reismengen, die er uns entgegengeschickt hatte und auch jetzt wieder gab, wollte der Häuptling keine Bezahlung annehmen, doch war er damit einverstanden, dass ich seine Leute mit weissem Kattun [366] belohnte. Die Unterhäuptlinge der verschiedenen langen Häuser gaben mir die Zahl der Männer an, die etwas zu fordern hatten, im Ganzen waren es 160. Nach Rücksprache mit Kwing Irang gab ich jedem Kĕnja 6 m weissen Kattuns von einer Qualität, die sehr geschätzt wurde. Zur Vermeidung jeder Parteilichkeit bei der Austeilung und nachträglicher Klagen, mass und riss ich alle diese 6 m langen Stücke selbst ab. Eine unbedeutende Verhärtung am kleinen Finger der rechten Hand erinnert mich heute noch an diese ungewohnte Arbeit. Die Austeilung der Stücke konnte den betreffenden Häuptlingen überlassen werden, was sehr angenehm war; bei den Bahau entstanden stets Schwierigkeiten dadurch, dass jeder Träger dem Vorgesetzten gegenüber an seiner Belohnung Kritik zu üben wagte.
Das Gerücht von unserer Ankunft und den schönen Dingen, die bei uns zu erhalten waren, hatte sich bald weit verbreitet; am anderen Tage strömte ununterbrochen ein Zug neugieriger Besucher von den Feldern in unsere Wohnung. Auch Demmeni wurde so stark belagert, dass ich ihn nur bei den Mahlzeiten sah, obgleich er sich dicht neben mir auf hielt. Sehr viel wert war es, dass die Leute Lebensmittel als Tauschartikel herbeibrachten; unsere Dorfbewohner litten nämlich selbst an Reismangel und waren mit ihren Feldarbeiten im Rückstand, auch wollte ich mit meinem Personal nicht länger auf Bui Djalongs Kosten leben. Er hatte ohnedies bereits Kwing mit den Seinen als Gäste aufgenommen und sie in sehr freigebiger Weise mit allem Nötigen versehen.
Unter den Besuchern befanden sich eine Menge Kropfkranke, die bereits von meinen Arzneien gegen ihr Leiden gehört hatten. Sie brachten zu meiner Verwunderung alle gut gereinigte Flaschen mit, was mir bei den Bahau nie begegnet war; bei diesen hatte ich stets nur mit Mühe eine halbwegs reine Flasche erhalten können.
Die Kĕnja wurden mir bald sehr sympathisch. Nach wenigen Tagen verkehrte ich mit ihnen bereits ebenso unbefangen wie mit den Bahau am Mahakam nach gleich vielen Monaten. Dasselbe war auch mit meinen Malaien der Fall, auch sie wurden fortwährend von den Kĕnja besucht; diese wählten sogar einen ihnen sympathischen Malaien aus und wollten mit ihm se̥bilah, Freund werden, eine Art von Schutz- und Trutzbündnis eingehen. Als Freundschaftszeichen machen sie einander ein Geschenk; die Malaien baten sich zu diesem Zweck ein Stück Zeug oder ähnliches auf Abschlag ihres Lohnes von mir aus. [367] Da mein Vorrat an Tauschartikeln ursprünglich für einen einjährigen Aufenthalt berechnet war und wir jetzt nur zwei Monate bleiben sollten, durfte ich meiner Reisegesellschaft gegenüber freigebig sein.
Ich hatte anfangs darauf gerechnet, auch Kwing und sein Gefolge unterhalten zu müssen, aber davon wollten unsere Gastherren nichts hören, ich konnte ihnen sogar schwer begreiflich machen, dass ich wenigstens meine Malaien, die in meinen Diensten standen und Lohn empfingen, selbst ernähren müsste. Nach Landessitte wurden die Kajan unter die verschiedenen Familien im Dorfe verteilt, hauptsächlich bei den Häuptlingen; Bui Djalong hätte 60 Mann unmöglich selbst so lange beherbergen könnten. Kwing Irang, sein Sohn Bang Awan und einige Sklaven wurden jedoch von Bui Djalong in seiner eigenen grossen amin als Gäste aufgenommen. Einigermassen zur Vergütung der Gastfreundschaft ihrer Gastherren boten die Kajan den Kĕnja ihre Hilfe bei der Feldarbeit an, die in der Tat sehr willkommen war, da der Tod und die Trauer um Bui Djalongs Tochter die Arbeit über einen Monat in Rückstand gebracht hatte. Überdies war, wie gesagt, der Reisvorrat der Kĕnja gerade jetzt sehr gering, weil das Jahr zuvor sehr viele Männer mit dem Häuptling nach Sĕrawak gereist waren und der Reisbau deswegen weniger eifrig betrieben worden war. Bui Djalong bat mich auch öfters um die Hilfe meiner Malaien, die dann morgens früh mit den Dorfbewohnern aufs Feld zogen und den ganzen Tag dort verblieben.
Das rauhere Klima dieses in 600 m Höhe gelegenen Gebirgslandes machte seinen Einfluss in bemerkenswerter Weise auch auf die Artikel geltend, die von mir verlangt wurden. Vor allem forderten die Leute feste, dicke Stoffe; hübsche und feine, wie Seide und Sammet, wurden weit weniger gewürdigt. Mein weisser Kattun von guter Qualität fand z.B. so starken Anklang, dass ich trotz des grossen Vorrats bald sparsamer mit ihm umgehen musste. Für ein Stück dicken Kattuns, den ich zum Einpacken von Gesteinen mitgenommen hatte und der seiner Steifheit wegen nie die Kauflust der Bahau erweckt hatte, bot man mir hier sogleich grosse Mengen Reis u.a., so dass ich ihn vorläufig für einen Notfall aufzubewahren beschloss. Ich merkte sehr bald, dass ich hier trotz des kurzen Aufenthaltes auf ethnologischem Gebiet mit Erfolg würde arbeiten können, denn die Kĕnja waren lange nicht so misstrauisch wie die Bahau und im Auskunftgeben nicht zurückhaltend, auch konnte ich mühelos Gegenstände von allerlei Art, selbst [368] ihre Kleider von ihrem Leibe kaufen, wenn ich nur gut bezahlte. Glücklicherweise bildeten auch hier Glasperlen einen beliebten und bequemen Tauschartikel; es kam mir jetzt zu statten, dass ich in Samarinda dem Rat von Bo Ului Jok gefolgt war und für die Kĕnja hauptsächlich grosse Perlen gekauft hatte, denn diese hatten in der Tat viel mehr Wert als die kleinen.
Um die Niederlassung in aller Ruhe in Augenschein nehmen zu können, fehlte mir die Zeit, doch war es mir jedesmal eine Erlösung, wenn man mich nach aller Arbeit unter der lebhaften Menge in meiner Hütte in die Häuser abholte, wo ernstere Krankheitsfälle vorlagen. Dort fand ich zu mancherlei Beobachtungen Gelegenheit und bisweilen hielt ich mich dort länger als nötig war auf oder ich schloss mich auf der Galerie einer Gruppe an, von der ich mir dann gemütlich allerhand erzählen oder zeigen liess.
Alle 10 Häuserreihen im Dorfe waren im gewöhnlichen Bahaustil gebaut und zwar in dem der Kajan; doch standen sie auf nur 1–2 m hohen Pfählen und waren aus anderem Material hergestellt. Dies fand seinen Grund darin, dass die dichte Bevölkerung den hohen Wald in der Umgegend ausgerodet hatte und die zum Bau eines so grossen Dorfes erforderliche Menge Bauholz nur aus grosser Entfernung noch zu beschaffen war. Die Masse des Volkes hatte daher zu Bambus für den Bau der Fussböden und zu grossen, in Form von Matten aneinander gereihten Baumblättern für Wände und Dächer ihre Zuflucht genommen. Nur die Häuptlingshäuser werden ganz aus Holz gebaut, ferner die Teile des Hauses der gewöhnlichen Kĕnja, die bei einem folgenden Bau wieder verwendet werden können, z.B. der Fussboden der Galerie und die Innenwände. Ersterer bestand oft aus besonders dicken und grossen Brettern. Es ist möglich, dass die Häuser deshalb auf so niedrigen Pfählen stehen, weil grössere so schwer zu erlangen sind; doch wird diese Bauart wohl auch dadurch bedingt sein, dass die Kĕnja ihren Feinden auf freiem Felde entgegentreten und sich nicht von ihren Häusern aus verteidigen. Von den Häuserreihen gehörten 8 den Uma-Tow, 2 den Uma-Timé, die sich vor nicht langer Zeit unter Bui Djalongs Schutz gestellt hatten. Auffallend waren die etwa 1 m hohen Holzstege, die alle Häuser im Dorfe verbanden; die Kĕnja berühren mit den blossen Füssen nicht gern den Erdboden, besonders wenn dieser vom Regen durchnässt ist. Die Stege bestehen aus breiten Brettern, die auf Gerüsten ruhen; Geländestellen [369] von ungleicher Höhe werden wohl auch durch Baumtreppen mit einander verbunden. Geländer sind nicht gebräuchlich, doch sind sie den Kĕnja bekannt, sie brachten sogar selbst welche für uns Europäer an, weil uns das Gehen mit Schuhen auf den vom Regen schlüpfrigen Brettern oft unbequem war.
Merkwürdigerweise waren die amin der Familien, die bei den Bahau meist sehr ordentlich und reinlich gehalten werden, bei den Kĕnja viel schmutziger als die Galerie, obgleich sie in ihrer Kleidung und ihrem Hausrat bedeutend sauberer waren als ihre Verwandten am Mahakam. Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass die Kĕnja noch mehr als die Bahau gemeinsam auf der Galerie leben und in der amin oft nur essen und schlafen. Die Kĕnja ziehen die Galerie deswegen der amin vor, weil sie auf ersterer grosse Feuer anmachen können, die sie morgens und abends vor der bei ihnen herrschenden Kälte schützen; bisweilen schlafen sie sogar in der ăwă. Auffallend ist auch die grosse Menge Brennholz, die man in jeder amin oberhalb des Feuerherdes aufgestapelt findet, und der Eifer, mit dem die Frauen täglich neuen Vorrat herbeitragen.
An allen Wegen und Seiteneingängen der Häuser standen 3–4 m hohe und noch höhere Figuren (hudo̱), welche den Zweck hatten, die krankheitserregenden Geister vom Hause fern zu halten. Meistens waren es menschliche Gestalten mit Antlitzen von Ungeheuern; statt der Haare trugen sie Palmblätter oder lebende und tote Pflanzen und die Genitalien waren übertrieben gross und mit einem utang versehen. Auf Tafel 85 ist eine derartige Figur zu sehen; sie ist mit dem Beil aus einem grossen Holzstück gehauen, nur die hervortretenden Teile, wie Nase, Ohren und Arme sind gesondert eingesetzt. Die Schreckgestalt ist mit Speer, Schwert und Schild bewaffnet. Auch Ziegen und Hunde findet man als Schutzfiguren aufgestellt; die verschiedenen Häuser besassen auch verschiedene Figuren. Zur Abschrekkung der bösen Geister werden auch Pfähle mit queren Einkerbungen benutzt. Unter einem derartigen Schreckpfahl steht die Frau auf Tafel 85. Die Einschnitte im Stamm geben die Zahl der Köpfe an, die von den Bewohnern dieses Hauses erlegt wurden, und warnen die Geister vor einem Eintritt in das gefährliche Haus. Zwei Querschnitte nebeneinander bedeuten die Augen und ein Querschnitt in der Mitte darunter den Mund, so dass je drei Einkerbungen einen erbeuteten Schädel vorstellen.

Prunkgrab von Bui Djalongs Tochter Kuling.
[370]
Auch bei den Rasthütten werden Schreckfiguren aufgestellt (Taf. 83 oben), ebenso auf den Begräbnisplätzen der Häuptlinge und der gewöhnlichen Kĕnja.
Zum Schutz der Gräber werden grosse, stilisierte Hundefiguren auf hohen Beinen benützt; man findet sie sowohl unter dem Grabmal aufgestellt als auch auf dem Dache. Die zwei schönsten Prunkgräber von Bui Djalongs Sohn und Tochter sind auf Tafel 84 zu sehen. Die bila bestanden hier aus Kammern, in welchen die Särge auf 4–6 m hohen, schweren Pfählen ruhten. Groteske Figuren verzierten die Dächer und Wände der Monumente; auch die Pfähle waren hübsch bemalt und das ganze Gebäude von oben mit allerhand Kleidungsstücken und Waffen behängt. Auf dem Dache des Grabmals des Häuptlingssohns sieht man zwischen zwei stilisierten Hundefiguren einen Mann sitzen, der Flöte spielt; als Sessel dient ihm eine liegende Männerfigur. Aussen an der bila hingen hier Schilde, Kriegsjacken und -mützen und Sitzmatten, während in der Kammer selbst Schwerter lagen. Die Farben dieser Prunkgräber waren noch ziemlich neu und hoben sich daher lebhaft gegen den Hintergrund von dunkelgrünen Bergen ab. Derartige Monumente werden nicht auf dem allgemeinen Begräbnisplatz errichtet, sondern stets gesondert in kleinen Gruppen etwas ausserhalb des Dorfes. Man darf sich ihnen nur mit des Häuptlings Erlaubnis nähern.
Obgleich man bei einem Gang durch das Dorf nur selten den Erdboden zu berühren brauchte, war dieser doch sorgfältig von Pflanzen gereinigt, so dass sich zwischen den Häusern ganze Flächen nackter, fester Erde ausbreiteten, die von den Kindern als Spielplätze benützt wurden. Am Kapuas führten nur schmale Pfade durch das überall wuchernde Gestrüpp und am Mahakam wurde nur vor dem Häuptlingshause ein Stück Erde rein gehalten. Für uns Europäer bildete das Gehen auf festem Boden eine lang entbehrte Annehmlichkeit nach dem Aufenthalt im dicht bewachsenen Wald. Fruchtbäume sah man nur bei den Häusern der Häuptlinge und bei einigen ihrer panjin. Das rauhe Klima trug wohl die Schuld daran, dass die Bäume nicht üppig wuchsen.
Am 9. Oktober wurden wir früh morgens durch das buka geweckt, d.h. durch plötzliche Schläge auf die Gonge, welche die Dorfbewohner zusammenriefen. Obgleich ich dies unheilverkündende Geläut nicht verstand, blieb ich anfangs ruhig hinter meinem Moskitonetz, da auch [371] die Menschen, die in meiner Hütte bereits auf mich warteten, still auf ihren Plätzen sitzen blieben. Der Häuptling hatte beschlossen, an diesem Tage die Trauer für seine Tochter aufzuheben, damit das ganze Dorf nicht noch länger mit ihm zu trauern brauchte und man bei dem bevorstehenden Saatfest Schwerttänze vornehmen durfte.
Als ich nach dem Essen eine Hängebrücke aus Rotang besichtigen ging, die Demmeni am Djĕmhāng entdeckt hatte, bemerkte ich einen Priester und einige Männer, die am Ufer eine Beschwörung der Geister des Oberlaufs vornahmen. Tags zuvor hatte mir Kwing bereits mitgeteilt, dass man in der ăwă des Häuptlings eine Zusammenkunft halten wollte, auf der ich den Versammelten erklären sollte, warum wir nach Apu Kajan gekommen wären. Sowohl die Kajan als die Malaien, die sich in dem fremden Lande noch durchaus nicht heimisch fühlten, legten dieser Zusammenkunft ein grosses Gewicht bei, und so erwartete ich die Einladung mit einiger Spannung. Doch rief man mich auch jetzt erst um ½ 4 Uhr. In der ăwă fand ich viele Häuptlinge und alte Männer um ein Feuer unter der Schädelreihe vereinigt, hinter welcher wiederum die grossen Gonge als Sessel für uns bereit standen. Bui Djalong forderte mich jedoch auf, mich erst in seine amin zu begeben, um mich dort vorher mit allerhand guten Dingen zu stärken. Ich betrat jetzt zum ersten Mal diesen Raum. Seine Grundfläche betrug etwa 10 × 12 Meter und seine Einrichtung glich derjenigen anderer Hänptlingswohnungen. Zu beiden Seiten der Eingangstür, die mitten in das Gemach führte, befanden sich Herde mit Regalen darüber; der linke wurde von der Häuptlingsfamilie benützt, der rechte von Kwing und den Seinen, wenigstens sah ich hier die mir sowohl bekannten Tragkörbe stehen, neben denen einige Kajan sassen. Unsere gute Freundin, die Frau des Häuptlings, war damit beschäftigt, eine Schale mit gegohrenem süssem Reis und Früchte für uns herzurichten. Demmeni und ich bedauerten lebhaft, dass wir uns mit der freundlichen Frau so mangelhaft verständigen konnten, da sie kein Busang sprach. Sie forderte uns zum Sitzen auf und ermutigte uns wiederholt zum Zugreifen, wobei ihr Söhnchen Ului und ihre Tochter zuschauten. In dem Teil der amin, in dem wir uns befanden, standen an der Wand eine lange Reihe von Gongen und dazwischen einige hohe, schöne Satsuma-Vasen, die ich hier im Herzen von Borneo nicht zu finden erwartet hatte. Wie ich später erfuhr, hatte der Häuptling sie von seiner letzten Reise zum Baram-Fluss [372] mitgebracht. Dass er viel Geld für sie übrig gehabt hatte, sprach für seinen guten Geschmack, denn es waren in ihrer Art schöne Exemplare. Der süsse Reis (burăk) war von sehr guter Qualität und auch die Früchte waren sorgfältig ausgesucht; unser europäischer Appetit erweckte denn auch die Zufriedenheit unserer Gastgeberin.
Bis zu unserer Rückkehr in die ăwă hatte sich der Kreis der Versammelten noch sehr vergrössert; meistens waren es alte Kĕnja. Rechts von uns, die wir wieder auf den Gongen Platz genommen hatten, sass Kwing Irang mit seinem Gefolge. Über uns die lange Reihe von Menschenschädeln und vor uns die vielen fremden mit Spannung auf uns starrenden Kĕnja-Gesichter, verbrachten wir die erste Zeit mit gleichgültigen Plaudereien, während welcher alle Anwesenden uns mit Musse betrachten und sich an uns gewöhnen konnten.
Als geeignete Einleitung zu einem Gespräch über die Gegenden, aus denen wir hergereist waren, kam mein Hund Bruno angelaufen, der durch seine Grösse und seine den Dajak unbekannte Eigenschaft, Fremde anzubellen, auch hier grosse Bewunderung erregte. Darauf wurde namens des Häuptlings der Versammlung in zwei Gläsern Reiswein (tuwak) gereicht, wobei man uns zuerst bediente. Inzwischen war es unter dem hohen, überhängenden Dach bereits dunkel geworden, und da wir auf das vom Herdfeuer verbreitete Licht angewiesen waren, benutzte ich die Gelegenheit, den Leuten eines unserer Kulturwunder vorzuführen und liess eine Petroleumlampe kommen.
Die eigentlichen Verhandlungen hatten noch nicht angefangen, doch schien man zu erwarten, dass ich den Anfang machte, obgleich man mich nicht dazu drängte. Ich begann daher Bui Djalong und den Seinen in der Busangsprache zu berichten, warum ich aus dem Mahakamgebiet zu ihnen gekommen sei und was ich durch meinen Besuch bei ihnen erreichen wolle. Ich sprach von den Ereignissen, die sich in letzter Zeit, hauptsächlich durch Zutun der Uma-Bom am Mahakam und Tawang zugetragen hatten, und machte ihnen begreiflich, dass durch dieselben die Kluft zwischen den Bahau und Kĕnja zum Nachteil beider stets grösser geworden sei und auf diese Weise der Handelsweg zum Mahakam ihnen bald gänzlich geschlossen werden würde, besonders jetzt, wo sich ein Kontrolleur in Long Iram befinde, der dergleichen Kopfjagden durchaus nicht dulden werde. Das gespannte Verhältnis, fuhr ich fort, bildete auch für die Mahakamstämme eine Quelle ständiger Unruhe, welcher nur durch ernsthafte Behandlung [373] der Angelegenheit ein Ende zu machen wäre. Eine derartige Behandlung der inneren Zustände wäre aber wegen des grossen gegenseitigen Misstrauens unter den Stämmen selbst nur unter Leitung der Niederländer möglich, wie dies jenseits der Wasserscheide durch Vermittlung des Radja von Sĕrawak geschah. Kwing Irang meinte, dass meine Erklärung nicht allen deutlich wäre, und wiederholte sie daher auf seine Weise. Während er sprach, kam mir der Gedanke, es sei besser, nichts zu verschweigen und sogleich alles zur Sprache zu bringen, besonders da die Kĕnja von allen Umständen gut unterrichtet zu sein schienen. Daher behandelte ich den Mord am Tawang nochmals ausführlich und sprach zum Schluss die Meinung aus, dass ein Schadenersatz in Gestalt eines Sklaven unter niederländischer Vermittlung nur dann geboten werden könne, wenn man ausdrücklich erklärte, dass der Sklave als solcher in die Familie Bui Djalongs aufgenommen und nicht getötet werden würde.
Nach der Stille, die meinen Worten folgte, sagte Bui Djalong nur, dass die Kĕnja sich unmöglich widersetzen könnten, wo zwei grosse Häuptlinge (hipui), wie der Sultan von Kutei und die Niederländer darauf aus wären, ihr Bestehen zu verbessern (ne̥me̱ urib), dass er früher aus Furcht vor den Batang-Lupar aus Sĕrawak zum Tawang habe auswandern wollen, dass dies aber nach dem Vorgefallenen nicht mehr möglich sei, dass sie andrerseits auch nur sehr schwer an den Te̥lang Usān (Baram) ziehen könnten und daher einer guten Regelung der Verhältnisse gern Gehör schenken würden. Kwing Irang gab er im Geheimen den Wink, über den Vorschlag des Radja von Sĕrawak, auf englisches Gebiet auszuwandern, nicht zu sprechen. Um später nicht haè, verlegen, zu werden, wie er sich ausdrückte, wenn sich die anderen nicht an das Abkommen hielten, schlug er vor, zuvor auch noch mit den übrigen Stämmen, vor allem den Uma-Bom, zu überlegen und unsere Beratung (te̱nge̥ran) daher später fortzusetzen und vor unserer Abreise zum Abschluss zu bringen.
Darauf kamen noch viele andere, weniger wichtige Angelegenheiten zur Sprache, u.a. der Zug der Kĕnja nach Sĕrawak, von dem ich bereits viel erfahren hatte, gern aber von ihnen selbst noch Näheres hören wollte. Mit grosser Offenheit gaben Bui Djalong und seine Landsleute ihre Meinung über ihr Verhältnis mit Sĕrawak zu kennen, ganz anders als dies bei den Bahau üblich war, wo beinahe niemals jemand eine Ansicht öffentlich zu äussern wagte, aus Furcht vor Widerspruch [374] oder Widerstand seitens anderer. Wir erfuhren jetzt, dass, wie die meisten Fehden, auch die der Kĕnja mit den Batang-Lupar vor sehr langer Zeit ihren Ursprung genommen hatte. Vor einigen Jahren hatte nun der Radja von Sĕrawak diesen Zwistigkeiten ein Ende machen wollen und den Kĕnja als Strafe für ihre Kopfjagden eine sehr ansehnliche Entschädigung in Guttapercha auferlegt. Nach der zum Sammeln erforderlichen Frist hatten sich die Kĕnja mit der Guttapercha aufgemacht, um sie nach Fort Long Bĕlaga am Balui, dem Oberlauf des Batang-Rèdjang, zu bringen. Auf der Reise begegneten sie jedoch wieder grossen Batang-Lupar-Banden, die an den Quellflüssen Buschprodukte suchten, und bei dieser Gelegenheit entbrannte ein neuer Kampf, bei dem auf beiden Seiten Opfer fielen und alle Guttapercha verloren ging. Seit der Zeit waren die Kĕnja noch nicht dazu gekommen, ihre Busse aufs neue zu bezahlen, aber nachdem der Radja im Jahre 1895 die Kĕnjastämme Apo-Paja am oberen Danum durch seine Batang-Lupar hatte unterwerfen lassen, hatte er immer wieder Gesandtschaften geschickt, um eine Zusammenkunft mit den Kĕnjahäuptlingen zu veranlassen. Diese empfanden jedoch wenig Lust, sich aufs neue in grosser Anzahl auf englisches Gebiet zu wagen, besonders da man erzählte, sie wären es gewesen, die die 5 Batang-Lupar am Boh getötet hätten. Mit einer sĕrawakischen Gesandtschaft, welche die mit ihnen verwandten Häuptlinge der Uma-Dang, die sich gerade eben dem Radja unterworfen hatten, begleiteten, sandten die Kĕnja dem englischen Fürsten als Freundschaftszeichen zwar schöne Schwerter und Schilde, aber sie selbst erschienen zwei Jahre lang nicht vor ihm. Darauf sandte ihnen der Radja vom Batang-Rèdjang durch Boten einen Brief und der Resident am Baram, Dr. Hose, gleichfalls, was sie alle so erschreckte, dass sie trotz der schönen Tigerhaut und den Gongen, welche als Geschenke für sie mitgegeben waren, das Jahr zuvor beschlossen hatten, dem Rufe eiligst Folge zu leisten. Eine ungefähr 700 Mann starke Gesellschaft war unter den Häuptlingen der Uma-Tow, die weiter unten am Fluss in Long Nawang wohnten, den Batang-Rèdjang abwärts gefahren, um der Einladung dort nachzukommen, während Bui Djalong selbst indessen mit 500 Mann nach dem Baram gezogen und diesen dann hinabgefahren war. Die Häuptlinge beider Gesellschaften wurden mit Dampfböten nach der Residenz Kuching abgeholt, wo Bui Djalong sich jedoch weigerte, auf englisches Gebiet auszuwandern, was er mir [375] jedoch selbst nicht erzählte. Auch er berichtete, die Batang-Lupar hätten sie auf der Heimreise überfallen, wobei einige zur Begleitung mitgegebene englische Polizeibeamten verwundet und getötet worden wären.
Die zwei aus Sĕrawak gesandten Briefe, welche so grossen Eindruck gemacht hatten, wurden zum Vorschein gebracht und mir vorgelegt. Es waren nur ein paar Geleitsbriefe, um nach Sĕrawak zu kommen; sie enthielten weder irgend einen Befehl noch eine Drohung, aber die Kĕnja, welche die Briefe nicht hatten lesen können, hatten sich beim ungewohnten Anblick von Papierstücken das Schrecklichste vorgestellt. Zur Verstärkung dieses Eindrucks hatten die malaiischen Boten überdies noch das Ihre beigetragen. Bui Djalong war zwar etwas verlegen, als er den wahren Inhalt der Briefe vernahm, doch half er sich mit der Bemerkung, sie wären zu dumm, um solche Dinge zu begreifen. Es war spät geworden, als wir von der Versammlung heimkehrten.
Nach dem guten Verlauf der Zusammenkunft war es uns am folgenden Tage eine wahre Erleichterung, als die meisten Dorfbewohner auf Bui Djalongs Feld zogen, um dieses zur Saat vorzubereiten. So erfreuten wir uns zum ersten Mal eines ruhigen Tages. Auch der folgende verlief still, da die Dorfbewohner an diesem auf die gleiche Weise das Feld von Bo Anjè, des Häuptlings Bruder, bearbeiteten und Bui Djalong selbst mich um die Mithilfe meiner Malaien für diesen Tag gebeten hatte. Diese fanden die Bitte zwar anspruchsvoll und für ihre Würde als Mohammedaner (nur wenige unter ihnen waren von Geburt Malaien) einem Dajak gegenüber etwas erniedrigend, aber sie fürchteten eine Störung der guten Beziehungen so sehr, dass sie aus der Not eine Tugend machten und bereits morgens früh mit dem Häuptling aufbrachen, nachdem ich hierzu meine Zustimmung gegeben hatte.
Des anderen Tages erfuhr ich, wie sehr auch in der Kĕnjagesellschaft Eitelkeit und Eifersucht die Lebensfreude beeinträchtigten. Morgens nach dem Frühstück hatte ich zum Besuch meiner Patienten meine Wanderung durch die verschiedenen Häuser begonnen, als mich die Bewohner in der amin von Bo Anjè, wo sich ein Fieberkranker befand, zurückhielten, um mir einen ausführlichen Bericht über Bo Anjès Würde, seine älteren Brüderrechte gegenüber Bui Djalong und seine Verwandtschaft mit den Häuptlingen von Uma-Djalān zu erstatten. Mit allem diesem gaben sie mir zu verstehen, dass nicht nur Bui Djalong, [376] sondern auch Bo Anjè für den Tod von Usat, ihrem Enkel, am Tawang ein Sklave als Entschädigung zukam. Halb um das Gesagte zu bekräftigen, halb um mir für ein Gewehr, das ich bei meiner Abreise bei ihnen zurückzulassen versprochen hatte und für schönes langes bo̱k kading (Ziegenhaar) und ape̱ ke̥ndi (dicker Kattun) ein Gegengeschenk zu geben, verehrten mir Bo Anjès Angehörige einen sehr schön gezeichneten und mit Menschenhaar verzierten Schild. Unter der Hand erfuhr ich noch manches über das gegenseitige Verhältnis der Häuptlinge in Tanah Putih; über Bui Djalong wurde geklagt, er tue ganz, als ob er der erste wäre, während Bo Anjè doch eigentlich älter sei. Dass der schwache Bo Anjè vor dem kraftvollen Bui Djalong hatte zurücktreten müssen, erschien mir sehr begreiflich. Der energischere Charakter der Kĕnja schützte sie augenscheinlich nicht vor kleinlicher Eifersucht, die auch bei den Bahau eine so grosse Rolle spielte.
Gegen Ende des Tages erhielten wir den Beweis, dass man die Dinge am Kajan ganz anders behandelte als am Mahakam.
Gleich nach der Mahlzeit wurden wir nämlich durch Laufen und Rufen auf dem Wege an unserem Hause erschreckt und beim Hinausblicken sahen wir etwa 10 fremde Kĕnja in voller Kriegsrüstung, die eben in einem Boot angekommen waren, mit heftigen Gebärden eine ernste Nachricht mitteilen, von der wir nichts weiter begriffen, als dass es sich um Kampf und Tote handelte. Die herbeiströmenden Bewohner von Tanah Putih gerieten beim Anhören des Berichtes in grosse Aufregung, so dass es für uns eine Beruhigung bedeutete, als Bui Djalong in seiner gefassten Weise selbst auf dem Schauplatz erschien und sich berichten liess. Obgleich auch er voll Interesse zuhörte, regte er sich doch nicht dabei auf; ich nahm daher das unbekannte Ereignis nicht zu tragisch und ging, um zu hören, um was es sich handelte. Die Boten waren von den Dörfern weiter unten am Kajan gekommen und meldeten, vom Stamme der Uma-Tĕpai seien 100 Mann im Kampfe gegen den feindlichen Stamm der Alim, die am Pĕdjungan wohnten, gefallen. Der Vorfall schien Bui Djalong doch weit mehr zu treffen, als ich aus der Ferne gesehen hatte, denn er war bleich geworden und seine Lippen waren blau, doch zeigte er sich nicht erregt und war noch unbewaffnet, während die andren Männer von Tanah Putih sogleich zu den Warfen gegriffen hatten, als stände der Feind vor der Tür. Ich war daran gewöhnt, dass bei derartigen Berichten stark übertrieben wurde, und wagte daher Bui Djalong zu sagen, bei näherer Erkundigung [377] würde es gewiss nicht so schlimm stehen und mehr als 15 Uma-Tĕpai würden wohl nicht gefallen sein. Meine Worte schienen ihn zu beruhigen, denn er sagte lächelnd, das sei sehr gut möglich. Nachdem er zu der aufgeregten Menge gesprochen hatte, ging er ruhig nach Hause und alles zerstreute sich wieder. Der Bericht, den mir die Kĕnja gegeben hatten, war so gehalten gewesen, als wenn ich die Geographie ihres Landes, die Stämme, die in ihm wohnten, und ihr Verhältnis zueinander gut gekannt hätte. Erst am folgenden Tage konnte ich genauere Erkundigungen einziehen, aber es dauerte einige Zeit, bevor ich den Vorfall zu begreifen anfing; der Bericht des Häuptlings selbst war mir noch am wertvollsten. Er erzählte, dass der Handelsweg zur Küste auf dem Kajan für sie infolge ihrer Feindschaft mit den Uma-Alim verschlossen sei. Dieser Stamm wohnte hauptsächlich am Pĕdjungan, einem Nebenfluss, der unterhalb der grossen Reihe von Wasserfällen, Baröm genannt, dem Kajan zuströmt.
Neben den Uma-Alim wohnte ein kleinerer Stamm der Uma-Lisān, dem es bei ersteren nicht sonderlich gefiel (später hörte ich, die Lisān wären von den Alim halb abhängig) und der deshalb nach Apu Kajan, dem Gebiet oberhalb der Baröm, auswandern wollte. Ein Stamm der Uma-Tĕpai, die dicht oberhalb der Baröm lebten, war mit 300 Mann zum Pĕdjungan gezogen, um den Uma-Lisān beim Umzug in ihr Gebiet behilflich zu sein. Dies sollte mit Einverständnis der Uma-Alim geschehen sein, was jedoch unwahrscheinlich war, da die Alim den Uma-Tĕpai feindlich gesinnt waren und ihnen daher die Nachbarschaft eines verbündeten Stammes nicht gegönnt haben würden. Wie dem auch sei, die Uma-Lisān wollten bei der Ankunft der Uma-Tĕpai nicht mit ihnen ziehen, und als letztere auf dem Heimwege begriffen waren, wurden sie von den Uma-Alim, die sich in einer engen Gebirgsspalte versteckt hatten, überfallen und in dem darauf folgenden Kampfe sollten dann 100 Mann gefallen sein. Später stellte es sich heraus, dass die Zahl der Getöteten in der Tat nicht über 15 betrug. Der ganze Kampf nahm sich immerhin so viel ernster aus, als die Bahau es gewöhnt waren, so dass Kwing Irang und den Seinen beim Anhören dieses blutigen Berichts sicher das Herz vor Angst geklopft haben wird.
Während Bui Djalong mir dies alles vortrug, hatte ich ihm meine gänzliche Unkenntnis von Land und Volk in Apu Kajan bekannt. Zu meiner Freude war er sogleich bereit, mir über diese Verhältnisse ausführlich Auskunft zu erteilen; er schlug vor, bereits [378] am gleichen Nachmittag den Hügel mit der Kubu zu besteigen, weil wir von dort einen vorzüglichen Überblick über das Land geniessen würden. Nach dem Essen begaben wir uns auf den Weg und bereits während des Gehens machte er mich auf vieles aufmerksam. Auf dem Gipfel des Hügels angekommen gab mir Bui Djalong den folgenden geographischen Überblick über sein Land Apu Kajan, oder Po Kĕdjin, wie es von den Kĕnja selbst genannt wird. Nach seinen Ausführungen und dem, was ich bereits selbst gesehen und gehört hatte, lagen die Verhältnisse von Land und Leuten etwa folgendermassen: das Gebiet des oberen Kajan bildet wie das des oberen Mahakam ein nach allen Seiten abgeschlossenes Land; hohe Gebirge und unbewohnte Wälder umringen es und der Kajan, der einen natürlichen Verkehrsweg zu den tiefer gelegenen Gebieten bildet, wird durch eine unüberwindliche Reihe von Wasserfällen, Baröm genannt, für den Verkehr unzugänzlich. Das Land streckt sich nord-östlich vom Batu Tibang aus, dem Berg, von dem im Norden und Osten das Grenzgebirge von Apu Kajan ausgeht. Nach Norden ist letzteres anfangs sehr niedrig und erhebt sich erst weiter nördlich zu einiger Höhe. Das Grenzgebirge nach Osten kann man in Richtung und Formation als eine Fortsetzung des Ober-Kapuas-Kettengebirges auffassen, das sich bis zum Batu Tibang hinstreckt und hier durch das vulkanische Gebirge unterbrochen wird, dessen höchste Erhebungen dieser Gipfel, der Batu Tibang Ok, der Batu Bulan und vielleicht auch der Batu Pusing darstellen. Östlich von diesen, wo das Gebirge 1000–1500 m hoch ist, besteht es aus Schiefern, die im Quellgebiet des Oga und Tĕmha einige Rücken, mehr nach Osten hin aber ein beinahe 2000 m hohes Massiv bilden, den Batu Okang. Von diesem soll der Boh nach Südwesten strömen, der Tawang nach Südosten und der Kajan Ok, ein Nebenfluss des Kajan, nach Norden. Auf dem ganzen Wege vom Tĕmha über die Passhöhe zum Laja und auch im Quellgebiet des Kajan hatten die Schiefer eine mehr oder weniger starke Neigung nach Süden gezeigt, womit vielleicht im Zusammenhang steht, dass nach Süden lange Rücken allmählich sich in das Oga- und Bohgebiet niedersenken, während nach Norden sehr steile Wände nach den Flüssen des Kajangebietes zu abfallen.
Die ganze Gegend oberhalb der Baröm ist gebirgig und besteht, wie ich zu bemerken glaubte, aus Schiefern mit daraufliegendem Sandstein, einer Gesteinsbildung, die auch am Ober-Mahakam die grösste [379] Oberfläche einnimmt. Auch in Apu Kajan werden diese Lagen durch Basalt und Andesit unterbrochen, die bei der starken Abtragung, die dieses Gebiet erlitten hat, mehr Widerstand als das umgebende Gestein geleistet haben und jetzt hie und da als Hügel hervorragen.
An Flächen waren nur die weit ausgespülten Flusstäler zu sehen, die Kĕnja waren daher gezwungen, ihre Reisfelder bis hoch auf die Abhänge der Bergketten anzulegen und auf den Hügeln den Wald bis zu den Gipfeln zu fällen. Der Urwald beginnt daher erst in ansehnlicher Höhe, wo das kühle Bergklima keine erfolgreiche Reiskultur mehr gestattet. Der Reis hat hier ohnehin 1 Monat länger nötig, um zu reifen, als am Ober-Mahakam, also 6 Monate.
Der Kajan selbst, der auf dem Grenzgebirge zum Mahakam, auf dem Lasan Tĕlujön, östlich von dem Batu Pusing entspringt, strömt hauptsächlich in nördlicher Richtung und nimmt oberhalb der Baröm an seiner linken Seite den Tĕkuwau, Mĕtisei, Nawang, Pĕngian, Marong, Iwan und Pura auf; rechts dagegen den Laja, Danum, Djĕmhāng, Hungei, Anjè, Mĕton und dicht oberhalb der Baröm den Kajan Ok. In diesem Teil des Kajan bilden die Wasserfälle bei Batu Plakau das grösste Hindernis für die Schiffbarkeit, ferner befinden sich einige Fälle auch noch oberhalb von Long Djĕmhāng. Wenn der Kajan auch weiterhin bis zu den Baröm keine unpassierbaren Stellen mehr hat, so trägt er doch mit seinen vielen Felsblöcken und Schuttbänken im allgemeinen den Charakter eines für den Verkehr ungeeigneten Bergstroms (auf der von dem Kĕnja gezeichneten Karte sind die schwer passierbaren Stellen durch bootsähnliche Figuren c angegeben (Taf. 89).
Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass die Kĕnja im Fahren mit Böten viel ungeübter sind als die Bahau, dafür haben sie aber in ihrem ganzen Lande gute Wege angelegt, sowohl von den Dörfern zu den Reisfeldern als zu anderen Dörfern. (Letztere Wege sind auf der Karte mit einfachen Linien angegeben; die Kreise f, durch welche der Weg von Tanah Putih zu den Uma-Lĕkĕn führt, bedeuten Berge).
Die Apu Kajan bewohnenden Stämme, die sich alle verwandt fühlen, sind vor 2–3 Jahrhunderten vom Uān, dem linken Nebenfluss des Mittel-Kajan, hierher ausgewandert, nachdem sie sich vorher noch am oberen Bahau niedergelassen hatten. Aus der neuen Heimat hatten sie der Reihe nach die Stämme vertrieben, die jetzt unter dem Namen Bahau am Balui und Mahakam wohnen, Ein anderer Teil der Kĕnja [380] liess sich damals am Tĕlang Usān oder Baramfluss nieder, von wo er noch jetzt mit den Kajanbewohnern in enger Verbindung steht. Nicht alle Bahaustämme wurden damals aus Apu Kajan vertrieben; die Uma-Lĕkĕn, die zum oberen Balui geflohen waren, kehrten später zurück und wohnen jetzt am weitesten unten am Fluss, bei den Baröm. Dieser Stamm spricht auch ein von den übrigen Kĕnjadialekten abweichendes Busang. Sämtliche Stämme leben unter der Oberherrschaft des mächtigsten Stammes, der Uma-Tow, der zwei Niederlassungen bewohnt, Tanah Putih am Djĕmhāng (jetzt an den Kajan verlegt) und Long Nawang. Ihre Vorherrschaft haben die Uma-Tow ihren beiden letzten tatkräftigen Häuptlingen zu danken, Pa Sorang und Bui Djalong, seinem Neffen. Dieser wies mir mit Stolz einen Bergrücken, der von der Wasserscheide ins Kajangebiet verläuft und Batu Ajow heisst, nach dem Kampf, der auf ihm zwischen den beiden Bundesgenossenschaften der Kĕnja, nämlich den weiter oben wohnenden Uma-Tow, Uma-Kulit, Uma-Djalān, Uma-Bom und Uma-Tokong gegen die weiter unten angesiedelten Uma-Bakang, Uma-Tĕpu, Uma-Baka und Uma-Lĕkĕn stattgefunden hatte und aus dem die ersteren als Sieger hervorgegangen waren. Im allgemeinen besteht die Oberherrschaft der Uma-Tow darin, dass ihre Häuptlinge über Angelegenheiten von allgemeinem Interesse beschliessen, aber stets nach Rücksprache mit den Häuptlingen der übrigen Stämme. Direkte Steuern, auch in Arbeit, werden nicht regelmässig geleistet, wohl aber können die abhängigen Stämme zu Hilfe gerufen werden, z.B. bei Krieg oder grösseren Unternehmungen.
Nach Bui Djalongs Angaben setzten sich die Stämme aus der folgenden Anzahl von Familien zusammen:
| Uma-Tow | 500 Familien. |
| Uma-Djalān | 300 Familien. |
| Uma-Tokong | 200 Familien. |
| Uma-Bom | 300 Familien. |
| Uma-Bakang | 600 Familien. |
| Uma-Kulit | 400 Familien. |
| Uma-Tĕpu | 400 Familien. |
| Uma-Baka | 300 Familien. |
| Uma-Lĕkĕn | 300 Familien. |
| Im Ganzen: | 3300 Familien. |
Hierzu kommen noch einige kleinere Stämme, wie die Lĕpo-Lisān, [381] die Lĕpo-Aga und die nicht sesshaften Punanstämme, so dass die Bevölkerung von Apu Kajan auf 20000 Seelen geschätzt werden kann.
Der Verkehr zwischen den Stämmen ist bei den Kĕnja viel lebhafter als zwischen den Bahau, auch besitzen erstere mehr Verwandtschaftsgefühl. Dazu trägt nicht wenig die im Lande herrschende Sicherheit bei. Es finden denn auch von anderen Gebieten aus nur selten Kopfjagden in Apu Kajan statt; am ehesten sind diese von den Batang-Lupar-Stämmen aus Sĕrawak zu fürchten, so dass die Kĕnja sich denn auch nicht gern westlich vom Flusse oder zu nahe an seinem Ursprung niederlassen.
Sowohl der schweren Zugänglichkeit ihres Landes als ihrer Stärke und Energie haben die Kĕnja es zu danken, dass sie bis jetzt von einem Eindringen Fremder verschont geblieben sind.
Den Zugang zu den anderen Gebieten haben sich die Kĕnja selbst durch ihre berüchtigten Kopfjagden so gut wie abgeschnitten. Während sie selbst in ihrem Lande beinahe unbewaffnet reisen, wagen sie nur in grosser Anzahl Handelszüge in fremde Gebiete zu unternehmen. Den Verkehr mit den Bewohnern am unteren Kajan haben sich die Kĕnja durch ihre Kopfjagden mit den Uma-Alim unmöglich gemacht, die am Pĕdjungan und Bahau wohnen, den beiden Flüssen, die man zur Umgehung der Baröm berühren muss. Ebenso unsicher ist der Weg längs des Balui nach Fort Bĕlaga; hier sind wieder die Hiwan den Kĕnja feindlich gesinnt. Der in das nord-östlich gelegene Baramgebiet führende Handelsweg, an dem verwandte Kĕnjastämme leben, wird zwar viel benutzt, aber auf dieser Reise muss ein 10 tägiger Landweg zurückgelegt werden, bevor wieder ein Transport der Waren mit Böten möglich ist. Daher können sie vom Baram kein schweres Gepäck wie Salz herbeiführen. Einen Vorteil bietet dieser Weg insofern, als er durch Gebiete führt, in welchen die Kĕnja Waldprodukte, vor allem Kampfer sammeln können; auf den anderen Wegen zur Ostküste kommt der Kampferbau dagegen nicht vor. Der Ertrag eines Baumes beträgt höchstens 1 kati (= 0.61 Kilo). Der Kampfer kommt im Holz des Baumes in Stücken von der Grösse eines Sandkorns bis zu 3 cm3 vor. Die Bäume werden gefällt, wenn bereits aus dem Geruch der Kampfergehalt festgestellt worden ist, dann werden sie völlig ausgehöhlt, als ob man Böte aus ihnen herstellen wollte. Hinter jedem Span wird der in den Ritzen des Holzes abgesetzte Kampfer gesammelt. Beim Umhacken werden den Geistern Matten, Zeug und Reis geopfert; [382] hat man die Reise mit guten Vorzeichen angetreten, so ist der Gewinn an Kampfer gross, im anderen Falle aber klein.
Von den beiden anderen Handelswegen, die den Kĕnja noch übrig bleiben, ist der nach dem Mahakam der gebräuchlichste; nach dem Berau ist die Reise so schwierig, dass nur leichte Artikel von dort bezogen werden können. Die Kĕnja verbessern alle diese Wege, indem sie z.B. sumpfige Stellen mit behauenen Stämmen belegen, steile Abhänge mit Treppen versehen u.s.w.
Während wir noch auf dem Hügel standen und uns von Bui Djalong berichten liessen, hatte sich der Himmel plötzlich verfinstert und, ehe wir das Tal erreichten, brach ein furchtbares Ungewitter auf uns nieder. Einige starke Donnerschläge gingen den Regengüssen voran, dann folgte ein heftiger Hagelschlag, den ich zum ersten Mal in Indien erlebte. Die Kajan waren durch diese Naturerscheinung aufs tiefste erschreckt. In ihrem Lande kommt Hagel überhaupt nicht vor; nur wird nach einer ihrer Sagen, wenn es Steine regnet, alles in Stein verwandelt.
Wenn die gefürchtete Versteinerung auch nicht eintraf, so hatte dieser Hagelschlag auf die Nerven der Kajan und Malaien, die ohnehin durch das plötzliche Zusammenrufen (buka) der Dorfbewohner nach dem Fall der Uma-Tĕpai sehr erregt waren, so nachteilig gewirkt, dass Lalau mir am anderen Tage mit bleichem Gesicht meldete, es würden unter der Bevölkerung über uns sehr ernste Gerüchte verbreitet, die uns äusserst gefährlich werden könnten. Man erzählte, wir beabsichtigten in der Tat, die Kĕnja zu bekriegen, und warteten nur auf die Hiwan (Batang-Lupar) und die Ankunft der Boten von Long Dĕho, die den Boh hinaufgefahren waren, um den Angriff zu beginnen. Kwing, sein Gefolge und meine Malaien fürchteten, dass die Kĕnja uns zuerst anfallen würden. Unser Verhältnis zur Bevölkerung war indessen fortwährend besser geworden und bis jetzt war noch nichts Unangenehmes zwischen uns vorgefallen. Selbst als mein Hund einen kleinen Knaben recht stark gebissen hatte, wurde dieser Vorfall seitens der Betroffenen sehr verständig beigelegt. Auch verkehrten Frauen und Kinder von morgens früh bis abends spät in meiner Hütte, für mich der beste Beweis ihres grossen Vertrauens zu unseren Absichten. Einige Mütter mussten ihre Kinder sogar mit Gewalt zum Essen nach Hause holen und klagten, die Kleinen wären überhaupt nicht mehr in der amin zu halten. Es half nichts, dass ich die beängstigten Gemüter auf alle [383] diese beruhigenden Zeichen hinweis, sie kamen stets wieder auf das Gehörte zurück. Da es nicht ratsam war, dergleichen Geschwätz allzulange kursieren zu lassen, und auch zur Beruhigung meiner Leute versprach ich Kwing Irang, die Sache mit Bui Djalong in seiner Gegenwart besprechen zu wollen.
An diesem Tage kam es jedoch nicht dazu, weil ein Häuptling der Uma-Bakong mit zwanzig Mann Gefolge den Fluss heraufgefahren kam, um mich zu besuchen.
Bui Djalong führte mir die Gesellschaft selbst zu und erklärte, dass Emāng, so hiess der Häuptling, und die Seinen mich besuchten, um meine Absichten mit den Kĕnja kennen zu lernen. Da der Mann gut Busang sprach, liess Bui Djalong ihn mit seinen Begleitern allein bei mir zurück, augenscheinlich vertraute er, dass ich mit der Gesellschaft allein fertig werden würde. Die Besucher hatten auf meine Nachsicht gerechnet, denn sie brachten mir nur etwas Reis zum Geschenk, worüber sie selbst ihr Bedauern aussprachen. Ich war jedoch gar nicht daran gewöhnt, Geschenke zu empfangen, und half den Leuten mit einer Unterhaltung über tanah dipa, das Land “Übersee”, über ihre Verlegenheit hinweg. Ich gab jedem ein Gegengeschenk, dem Häuptling eine Jacke aus Kattun, den anderen ein Kopftuch aus batik. In bester Stimmung sagte Emāng beim Abschied, man werde uns in seinem Dorfe auf den Händen tragen, falls wir dorthin kommen wollten.
Nachdem die Gesellschaft am anderen Tage wieder abgereist und die ăwă des Häuptlings wieder frei geworden war, liess Kwing Irang mich zur Besprechung rufen. Bei meinem Eintritt sass er mit ernstem Gesicht allein unter seinen Kajan. Ich hatte somit noch Gelegenheit, ihm zu sagen, dass ich Bui Djalong und dessen Stammesgenossen gegenüber, die alles täten, um uns den Aufenthalt angenehm zu machen, wegen der Angelegenheit verlegen sei und dass ich dem Geschwätz nicht glaubte. Demmeni trat ebenfalls zu uns, und als auch Bui Djalong mit einigen Ältesten erschien und sich zu uns unter die Schädelreihe setzte, forderte ich Kwing auf, seine Sache selbst vorzutragen. Mit aller Redegewandtheit, über die er verfügte, wiederholte Kwing darauf das Geschwätz der alten Frauen und Kinder und gab dabei selbst so deutliche Zeichen von Angst zu erkennen, dass Bui Djalong eine ungeduldige Bewegung nicht unterdrücken konnte.
Bevor er antwortete, machte er uns gegenüber die Bemerkung, dass wir augenscheinlich dem Klatsch keinen Glauben schenkten und aus dem [384] Blick, mit dem er uns ansah, sprach seine Genugtuung hierüber. Kwing Irang selbst gab er in fast beleidigend kurzen Worten den Bescheid, dass alle diese Gerüchte nur von alten Weibern und Kindern stammten und Männer einen solchen Unsinn nicht ernsthaft nehmen sollten. Sehr überzeugt hatte er seinen Gast durch diese Bemerkung wahrscheinlich nicht, aber die Batang-Lupar-Frage erschien ihm als Gesprächsthema verlockender und so wandte er sich diesem zu. Ich vernahm von ihm jetzt denselben Bericht, den ich bereits häufig an der Sĕrawakischen Grenze gehört hatte, nämlich dass das ganze Land in ständiger Angst vor den plündernden Hiwan-Banden lebte, die der Radja auf die Grenzstämme an der niederländische Grenze hetzte, und vor den Hiwan, die in Truppen Buschprodukte suchten und dabei gelegentlich Köpfe jagten.
Die Kĕnja brauchten ihrer grossen Anzahl wegen vor diesen Stämmen keine Angst zu haben, aber Bui Djalong fürchtete, dass er, falls neue Morde vorfielen, sein Volk nicht in Schranken würde halten können, wodurch ernsthafte Konflikte mit dem Radja entspringen könnten. Über die früher verloren gegangene Entschädigung in Form von Guttapercha hatte der Radja nicht mehr mit ihm gesprochen, dagegen hatten die Hiwan selbst eine hohe Entschädigungssumme von ihm geheischt, da sie sich durch eine dem Sĕrawakischen Gouvernement aufgebrachte Busse nicht befriedigt fühlten. So lange diese Angelegenheit noch nicht beigelegt war, fürchtete Bui Djalong die Rache der Hiwan. Infolge der stets von neuem von den schwärmenden Punan verbreiteten Gerüchte über einen in Sĕrawak in Vorbereitung begriffenen Kriegszug (bala) gegen die Stämme von Apu Kajan und die Anwesenheit zahlreicher Truppen von Hiwan in den umliegenden Gebirgen befand sich das Land in ständiger Unruhe. Das Gebiet am linken Kajanufer war von den eingeschüchterten Bewohnern gänzlich verlassen worden und auch die Uma-Bom hatten teilweise dieser Gerüchte wegen ihre Siedelung am Kajan im Stich gelassen.
In dem Geschwätz, das Kwing so beunruhigt hatte, war auch von 2 Böten die Rede gewesen, die aus Long Dĕho angekommen sein sollten. Der Bericht war mir völlig unklar gewesen, jetzt hörte ich aber von Bui Djalong, dass in der Tat zwei Böte uns von Bang Jok nach unserer Abreise nachgesandt worden und bei den Uma-Bom in Apu Kajan angekommen seien. Die Leute hatten eine sehr ungünstige Reise gehabt. In ihrer Unkenntnis des Weges waren sie nicht den [385] Oga hinaufgefahren, sondern dem Boh gefolgt, worauf sie bald die Richtung verloren hatten. Nach mehrtägiger Fahrt waren ihre Nahrungsmittel erschöpft und sie selbst nur auf die Fische im Boh angewiesen gewesen. In diesem Zustand waren sie einer Punangesellschaft begegnet, die sie mit Nahrung versorgt und dann auf den richtigen Weg gebracht hatte, so dass sie doch noch in der Niederlassung der Uma-Bom angelangt waren. Sie wollten sich dort erst noch von ihren Reisestrapazen erholen, bevor sie sich zu uns nach Tana Putih begaben.
Im Gespräch über die wirklichen und vermeintlichen Landesfeinde kam die Rede auch auf den Kampf mit den Uma-Alim. Bui Djalong glaubte sich zu dem Rat verpflichtet, mich jetzt, wo Unruhe im Lande herrschte, nicht oder wenigstens nicht allzu weit den Fluss hinunter zu wagen. Er wollte für die geplanten Beratungen lieber die weiter unten wohnenden Häuptlinge nach Tanah Putih berufen, wodurch mir die Reise flussabwärts erspart wurde. Obgleich gegen diesen Vorschlag nicht viel einzuwenden war, gefiel er mir nur halb, da ich mich für die anderen Stämme und das Land weiter unten viel zu sehr interessierte; ich antwortete daher nur wenig und nahm mir vor, nach Umständen zu handeln.
Kwing Irang versuchte in seiner Angst nochmals auf den alten Klatsch zurückzukommen, aber er fand bei keinem von uns Gehör, und als er sogar über unsere Rückreise zu sprechen anfing, erinnerte ich ihn an unsere Abmachung, zwei Monate in Apu Kajan bleiben zu wollen, an die ich mich bestimmt halten wollte. Darauf ging die Beratung in eine gemütliche Plauderei über, nach der wir alle in unsere Wohnungen zurückkehrten.
Die Zusammenkunft hatte auf meine Gastherren nicht ungünstig gewirkt, denn ein Strom von Besuchern, in den letzten Tagen auch von den benachbarten Dörfern der Uma-Djalān und Uma-Tokong, ergoss sich wieder in meine Hütte, wo es so viele Merkwürdigkeiten zu sehen und stets eine Kleinigkeit als Geschenk mitzunehmen gab. Das fortwährende Sprechen mit Menschen, die die Busang-Sprache nur halb verstanden, wirkte in diesen Tagen ebenso ermüdend wie die unaufhörlichen Bitten der Besucher, ihnen meine Körperhaut zeigen zu wollen. Da wir über diesen Punkt eine sehr verschiedene Auffassung hatten, führten die Unterhandlungen nicht immer zu einem befriedigenden Resultat. Die meisten Gäste brachten in Gestalt von Reis oder Früchten ein Geschenk mit, besonders wenn sie mit der Absicht, [386] Arzneien zu holen, zu mir kamen; sie erwarteten aber alle ein kleines Gegengeschenk, wobei ich stets darauf achten musste, wer der Vornehmste und wer der Geringste in ihrer Gesellschaft war. Hieraus entstanden bisweilen viele Schwierigkeiten, da ich die Verhältnisse der Personen nur schlecht kannte und diese durch Fragen nicht in Verlegenheit bringen wollte. Als ich Bui Djalong meine Verwunderung darüber aussprach, dass meine Besucher aus der Ferne mit einer solchen Selbstverständlichkeit Ansprüche auf meine Tauschartikel erhoben, erklärte er mir, es sei Sitte bei den Kĕnja, dass Handelsreisende, die von weitem heimkehrten, ihren Familiengliedern und Bekannten ein kleines Geschenk (salamba) mitbrachten, und dass man daher mich, der ich ebenfalls aus der Ferne gekommen war und mich mit allen gut stellen wollte, für diese Freundschaft eine kleine Steuer bezahlen liess. Übrigens erhielt ich selbst oft auch auffallend grosse Geschenke; einige Häuptlinge brachten eine ganze Ziege oder verkauften diese um billigen Preis, andere reichten einen ganzen Korb voll Reis oder ein Ferkel dar, und da, wenn ich mit einiger Vorsicht zu Werke ging, meine Tauschartikel ausreichten, unterwarf ich mich gern ihrer Sitte.
Eines Mittags bewiesen die jungen Leute von Tanah Putih, dass ihnen sehr daran gelegen war, uns den Aufenthalt bei ihnen so angenehm als möglich zu machen. Bui Djalong kam mir melden, dass sie in Anbetracht der grossen Anzahl Besucher, die ich ständig bei mir hatte, meine Hälfte unserer Hütte vergrössern wollten und brachte gleich 60 Mann mit. Anfangs setzte ich, der vorgerückten Tagesstunde wegen, in einen Umbau meiner Wohnung nicht viel Vertrauen, aber ich ergab mich wie gewöhnlich in ihre Pläne, da ich sie nicht gut beurteilen konnte.
Meine Sachen wurden sehr geschickt in den von meinem Personal bewohnten Teil der Hütte hinübergetragen, wohin man auch mich zu gehen aufforderte. Letzteres war kaum nötig gewesen, denn schon während des Sachentransports waren andere auf das Dach gestiegen, hatten schnell die Rotangstricke von den Schindeln losgeschnitten und binnen kurzer Zeit das Dach fortgenommen. Sehr bald waren auch die Wände verschwunden und dann begannen die Männer die Hütte etwas breiter wieder aufzubauen. Das hierfür notwendige Material lag schon zur Hand, und noch vor Sonnenuntergang, sass ich wieder wohl eingerichtet in meinem Hause, jetzt weit bequemer als zuvor. Man hatte zu dieser Arbeit einen Tag ausgesucht, an dem [387] sich alle Bewohner in der Niederlassung befanden, weil das Saatfest beginnen sollte. Abends lag ich bereits sehr müde in meinem Klambu, als man mich nach oben ins Häuptlingshaus rufen liess, wo 50 Mann, die in der ăwă in einer Reihe standen, eine Art von “ngarang” aufführen sollten. Alle hatten ihre besten Kleider an. Die bewährten Krieger trugen besonders schöne und gut erhaltene Kriegsmäntel aus Pantherfellen und Tinggangfedern, auch wohl aus langhaarigen Ziegenfellen, und Kriegsmützen mit hübschen Federn auf dem Kopfe.
Die kräftig und schön gebauten jungen Männer standen mit dem Rücken zu uns gekehrt und bewegten sich nach den Tönen der kle̥di, welche von zwei Männern gespielt wurden. In langsamen Schritten zogen sie an uns hin und wieder zurück, erst rechts fortschreitend, dann wieder links. Einige Hundert Männer und Frauen, unter ihnen auch unsere Kajan und Malaien, bildeten die Zuschauer. Auf der grossen, dunklen, nur von einer Lampe und einigen Harzfackeln erleuchteten Galerie boten die kräftigen, malerischen Gestalten, die sich streng nach dem Rhythmus der Musik bewegten, ein sehr eindrucksvolles Schauspiel; für uns Fremde war der Anblick besonderes interessant, da wir gar nicht daran gewöhnt waren, so viele Personen auf Kommando mit einer bei den Bahau gänzlich unbekannten Genauigkeit sich bewegen zu sehen, überdies in einem Kriegskostüm, das nicht nur durch seine eigentümliche Form, sondern auch durch seine Schönheit alles, was ich an derartigem bei den Bahau gesehen hatte, bei weitem übertraf. Auf den Kriegstanz folgte erst ein Tanz jüngerer Männer und dann einer von Frauen; alle bewegten sich mit der gleichen grossen Ruhe und streng rhythmisch.
Auch meine Malaien und Kajan standen lebhaft unter dem Eindruck des für sie aussergewöhnlichen Schauspiels. Sie sassen alle bewegungslos in stummes Staunen versunken und waren nicht dazu zu überreden, auch ihrerseits etwas zum besten zu geben. Einer der Bandjaresen aus Samarinda versuchte zwar einen malaiischen Tanz vorzuführen, spielte aber nach dem eben Genossenen eine traurige Figur. Der ängstliche Kwing wusste nichts Besseres vorzubringen, als seine Besorgnis darüber auszudrücken, ob das Haus, das übrigens sehr fest gebaut war, die Last aller dieser Menschen wohl aushalten würde.
Als ich Bui Djalong am anderen Morgen meine Anerkennung über die Vorstellung ausdrückte, zeigte er mir einige Kisten in der Galerie, die speziell zur Aufbewahrung der Kriegsausrüstungen dienten; sie [388] waren hier also nicht, wie in der amin der Bahau, dem Rauch ausgesetzt. Abends wurde das Fest wiederholt, und fanden ausserdem Schwerttänze statt, bei welchen wir die Grazie und die Kraft bewunderten, mit der die Kĕnja sich bewegten. Wenn ein Krieger mir allzu nahe trat, kam mir unwillkürlich der Tod des Long-Glat-Häuptlings in den Sinn, dem ein Kĕnja beim Schwerttanz plötzlich den Kopf abgeschlagen hatte; es war mir ein beruhigendes Gefühl, dass ich zwischen dem Häuptling und dessen Frau sass. Von Müdigkeit überwältigt zogen Demmeni und ich uns früh zurück.
Die Kĕnja schienen ihre Versprechungen treuer zu erfüllen als die Bahau; zum ersten Mal lernte ich hier auch wahres Interesse für das allgemeine Wohl kennen, als anderen Tags Abing Djalong, einer der niedrigeren Häuptlinge, mit einigen anderen zu mir kam, um zu melden, dass sie sogleich abwärts fahren würden, um namens Bui Djalongs die Häuptlinge weiter unten zu einer Zusammenkunft in Tanah Putih unmittelbar nach dem Saatfest zusammenzurufen. Sie baten jeder um ein Stück Zeug für eine Jacke und ein Kopftuch für die Reise, die ich ihnen als Belohnung für so viel Mühe gern zugestand. Nachdem diese Sechs abgefahren waren, trat ein ruhiges Stündchen ein, das Bui Djalong abgewartet zu haben schien, denn er kam zum ersten Mal allein zu mir, um zu plaudern, gab mir Auskunft über diese Sendung nach unten, berichtete noch über allerhand Dinge, die ich gern wissen wollte, und bat mich zum Schluss um etwas Pulver und einige Tigerzähne. Da er mich noch niemals um irgend etwas für sich selbst oder andere gebeten hatte, war ich froh, ihm diesen Gefallen erweisen zu können, nur wunderte es mich, dass er so obenhin von ein paar Tigerzähnen sprach, die bei den Mahakambewohnern als sehr wertvolle Gegenstände galten, die nur von Häuptlingen berührt werden durften. Er besass bereits selbst mehrere Zähne, mit denen er seinen sonong, Kriegsmantel, verziert hatte, war aber doch sehr froh, als ich ihm noch einige grosse, rein weisse Exemplare reichte.
Ich benutzte Bui Djalongs gute Stimmung, um mir von ihm allerhand über die Verhältnisse in seinem Stamme erzählen zu lassen. Über die Stellung der Häuptlinge zu den Untertanen erfuhr ich das folgende: Jedes Haus in Tanah Putih bildete ein kleines Reich für sich, das von einem Häuptling regiert wurde. Die einzelnen Häuser standen wieder unter einem gemeinsamen Oberhaupt. Sowohl dieses als die Unterhäuptlinge durften in ihren breiten Galerien Schädeltrophäen aufhängen, [389] den panjin jedoch war dies nicht gestattet. Die Kĕnja besitzen nur eine geringe Anzahl Sklaven und diese gehören ausschliesslich den Häuptlingen. Bui Djanlong selbst, der allerdings der vornehmste aber nicht der reichste Häuptling war, verfügte nur über sehr wenig Sklaven, dasselbe sollte bei Pingan Sorong in Long Nawang der Fall sein. Kwing Irang besass dagegen eine bedeutend grössere Anzahl Sklaven. Auch die Kĕnja kaufen ihre Sklaven von den Punan und Bukat, welche diese auf ihren Kriegszügen bei oft weit entlegenen feindlichen Stämmen erbeuten. So erzählte mir Bui Djalong, dass er nach unserer Abreise einige Sklaven bei den Punanstämmen kaufen wollte, die sich in der Nähe aufhielten. Auch die Malaien an der Küste von Berau treiben mit den Kĕnja Sklavenhandel; die Ma-Kulit z.B. kauften vom Sultan von Berau für ein Boot und 2 pikol Guttapercha einen Sklaven, um diesen zu opfern. Die Punan sind den Kĕnja nicht unterworfen, doch üben die Häuptlinge der letzteren über die in der Umgegend schwärmenden Stämme grosse Macht aus.
Die Jägerstämme halten sich bald in Apu Kajan auf, bald am Batang-Rèdjang und Baram, wohin sie über die Wasserscheide ziehen. Nach einer Kopfjagd auf Sĕrawakischem Gebiet flüchten sie jedoch wieder auf das der Kĕnja zurück. Da die Punan die Pfade im umliegenden Gebirge am besten kennen, werden sie von den jungen Kĕnja bei Kopfjagden als Führer benützt. Die Gerüchte von Kopfjagden und Strafzügen, welche in Sĕrawak gegen die Kĕnja vorbereitet werden sollen, danken ihren Ursprung meistens den Punan. Wenn diese Gerüchte sich auch oft als unwahr erweisen, so lassen sich die Bewohner von Apu Kajan doch immer wieder von ihnen in Schrecken setzen.
Unsere Unterhaltung dauerte leider nicht lange, denn bald erschienen wieder Böte mit Uma-Djalān und andere mit Uma-Tokong, die mit mir handeln wollten und vertrieben den Häuptling.
Mittags hatte ich wieder mit einem Ausbruch von Angst seitens der Kajan und einiger meiner Malaien zu kämpfen, die sich einbildeten, dass hinter der Botschaft an die Häuptlinge weiter unten Verrat stecke. Ich suchte sie nach Kräften zu beruhigen, leider mit geringem Erfolg.
Nicht alle Malaien fühlten sich so wenig heimisch; von den jungen Männern hatten einige nicht nur mit den männlichen, sondern auch mit den weiblichen Gastfreunden Freundschaft geschlossen, die zu grosser Intimität führte, so dass ich sehr streng auftreten musste, um [390] sicher zu sein, dass meine Männer die Nacht zu Hause und nicht bei ihren Freundinnen verbrachten. Einige ältere Leute hatten mich auf die Gefahr eines solchen Verkehrs aufmerksam gemacht, auch hatte ich früher selbst meine Reisebegleiter stets zur Vorsicht ermahnt, um keine Rivalen, Ehemänner oder Eltern durch Liebeshändel zu kränken. Hier lagen die Verhältnisse allerdings etwas anders; die jungen Mädchen schienen von meinen jungen Reisegefährten sehr entzückt zu sein und einige Eltern, bei denen ich als Hausarzt verkehrte, zeigten sich von den Verhältnissen ihrer Töchter sehr befriedigt. So erschien ein allzu strenges Eingreifen mir nicht wünschenswert, nur machte ich die an andere Zustände gewöhnten Malaien darauf aufmerksam, dass sie nicht wie an der Küste den einen Tag bei dieser, den anderen bei jener jungen Frau verbringen durften, sondern dass ihr Freundschaftsbund während unseres ganzen Aufenthalts dauern müsse, da er anders gefährlich werden könnte. Nur als Gunst und auf besondere Bitte gestattete ich einigen, eine Nacht in der amin der Kĕnjaeltern zu verbringen, auch bat ich Bui Djalong, mir sofort zu melden, falls daraus Unfriede entstand, was jedoch nicht geschah. Von der Innigkeit der hier angeknüpffen Bande überzeugte ich mich bei der Abreise, wo der Abschied den jungen Paaren sehr schwer fiel, zahlreiche Geschenke gewechselt wurden und einer der Männer sogar zurückgeblieben wäre, wenn ich ihm das zugestanden hätte. Für einen von ihnen musste ich eine Busse bezahlen, weil seine junge Frau von ihm schwanger geworden war und er sie verliess. Die jungen Männer fühlten sich so zu Hause, dass sie mit ihrer zeitweiligen Familie bisweilen aufs Feld zogen, dort arbeiteten und abends sehr guter Dinge heimkehrten.

Schreckfigur und -Pfahl.
Am 20. Oktober kamen die jungen Männer von ihrer Sendung zurück. Sie hatten ihre Reise nur bis zu den Uma-Tow in Long Nawang fortgesetzt, weil die Dörfer weiter unten am Fluss, wie Uma Kulit, Uma Baka, Uma Tĕpai sich so sehr vor einem Einfall der Uma-Alim und Hiwan fürchteten, dass sie keine Männer zu missen und nach Tanah Putih zu senden wagten. Sie brachten die sichere Nachricht, dass von den Uma-Tĕpai nur 15 Mann beim Überfall der Uma-Alim gefallen waren, auch waren sie Bewohnern aus Uma Bom begegnet, die ihnen erzählt hatten, dass die 18 Mann, die Bang Jok uns aus Long Dĕho nachgesandt hatte, sich noch bei ihnen aufhielten, aber bald nach Tanah Putih kommen würden. [391]
Zu den Patienten, die ich lange Zeit behandelt hatte, gehörten einige sehr alte Personen, die an chronischem Lungenleiden und schlechter Herztätigkeit litten. Am 23. Oktober starb der älteste von ihnen, ein Häuptling, der ein se̥bilah, Blutsfreund, von Bo Adjang Lĕdjü in Long Dĕho gewesen war und daher mit diesem gleich alt, d.h. etwa 90 Jahre gewesen sein musste. Beim Tode dieses Mannes wurde für das ganze Dorf kein lāli festgesetzt, auch durften Fremde dieses betreten, was beim Tode eines Bahauhäuptlings streng verboten gewesen wäre. Der Sarg stand bereits seit langem fertig da, wahrscheinlich weil die hierzu nötigen dicken Stämme nur in grosser Entfernung zu finden waren. Für jüngere Menschen halten die Kĕnja keine Särge bereit.
Um zu den Begräbniskosten etwas beizutragen, was alle wohlhabenden Familien taten, schenkte ich einige Stücke weisses und farbiges Zeug. Bereits eine Stunde nach dem Abscheiden fuhren einige Leute den Fluss hinunter, um den auswärts wohnenden Blutsverwandten die Todesnachricht mitzuteilen, und ebenso schnell machte sich eine grosse Anzahl Männer auf, um ein Prunkgrab zu errichten, das innerhalb weniger Tage fertig sein sollte.
Mittags äusserte der Häuptling den Wunsch, mit mir einiges inbezug auf die bevorstehende Zusammenkunft der Häuptlinge besprechen zu wollen. Derartige Beratungen waren mir hier stets ein Vergnügen, weil ich wusste, dass hier ein aufrichtiger Wunsch zur Regelung der Angelegenheiten vorlag, und ich mich in vielen Dingen auf die Meinung und den Rat des Häuptlings verlassen durfte. Am meisten schien ihm am Herzen zu liegen, dass ich mich mit den Meinen nicht weiter flussabwärts begab, wozu ich jedoch fest entschlossen war, falls die Gefahr nicht zu gross wäre. Dem Häuptling erschien wegen der augenblicklich herrschenden Unruhen weiter unten eine Reise dorthin zu gefahrvoll, auch glaubte er der Gesinnung der dortigen Häuptlinge uns gegenüber nicht sicher zu sein. Infolge der grossen Reisnot könne er uns jetzt auch nicht mit einer genügenden Anzahl Männer begleiten, auch würde er seinen kleinen Sohn Ului nur sehr ungern allein lassen. Als ich ihm sagte, ich wolle erst den Verlauf der Besprechungen abwarten und meinen Plan danach einrichten, drang er dennoch darauf, dass ich aus genannten Gründen in keinem Fall reisen sollte. Wir behandelten ferner ausführlich die auf der Versammlung zu besprechenden Angelegenheiten. Er bat mich, den Anwesenden das Verhältnis zwischen Sĕrawak und den Niederlanden möglichst [392] deutlich auseinanderzusetzen, ebenso ihnen begreiflich zu machen, dass wir mit ihren Erbfeinden den Batang-Lupar nichts zu tun hätten; er behauptete, viele glaubten seinen Erklärungen nicht, weil sie bisher so wenig von den Niederländern als grosser Macht gehört hätten und niemand so sehr fürchteten als den Radja von Sĕrawak. Ferner sollte ich nochmals deutlich berichten, dass ich hauptsächlich gekommen sei, um den Fehden mit den Mahakambewohnern ein Ende zu machen, damit man Bui Djalong nach unserer Abreise nicht den Vorwurf machen konnte, uns in sein Gebiet Einlass gewährt zu haben. Zu meiner grossen Genugtuung sagte er, mit unserer Festsetzung im Lande wären alle Stämme sehr zufrieden, besonders weil wir sie vor den immer drohender werdenden Einfällen der Hiwan beschirmen wollten, doch bestände immerhin noch eine starke Partei, die aus Furcht vor dem Radja von Sĕrawak nicht öffentlich mit den Niederländern gemeinsame Sache machen wollte. Um mich auch dieser gegenüber so weit als möglich an der Wahrheit zu halten und später nicht den verdienten Vorwurf zu hören, ich hätte ihnen zu viel versprochen, betonte ich ausdrücklich, dass ich über eine Besetzung eines so weit abgelegenen Gebietes wie das der Kĕnja zuvor noch reiflich mit den hipui (Autoritäten) in Batavia überlegen müsste, was dem Häuptling sehr einleuchtete. Er drang jedoch sehr darauf an, dass ich die Angelegenheit soweit führen sollte.
In meine Hütte zurückgekehrt fand ich dort so viele Leute, die etwas verkaufen, fragen oder ärztlich behandelt werden wollten, dass es mir schwer wurde, Geduld zu üben, überdies war ich nach dem stattgehabten Gespräch nicht in der Stimmung, mit unbekannten Menschen über allerhand gleichgültige Dinge zu reden. Ich begab mich daher zu meinen Patienten, von denen einige mir sehr sympathisch waren und durch ihre Unterhaltung Zerstreuung verschafften. Auf der Treppe, die in eines der langen Häuser führte, begegnete ich einer Gesellschaft von etwa 50 Personen. Trotz meiner für sie sehr aussergewöhnlichen Erscheinung zogen die Fremden an mir vorbei, ohne mich näher anzusehen; einige der Gesichter schienen mir bekannt und in einem Mann, der mir zunickte, erkannte ich einen Häuptling aus Long Dĕho. Die Gesellschaft bestand aus den Long-Glat, die uns nachgereist waren und sich verirrt hatten, und den Uma-Bom, die zur Versammlung gekommen waren.
Die Kĕnjafrauen, die sich unter letzteren befanden, legten ebenso [393] wenig Neugier an den Tag als die Männer. Die grosse Anzahl der Ankömmlinge bewies, dass man in dem Dorfe für die bevorstehende Beratung Interesse zeigte, und so setzte ich guter Dinge meinen ärztlichen Rundgang fort, als Sawang Bilong, der Sohn des Verstorbenen und Häuptling eines der Häuser, mich bat, so lange die Leiche noch nicht bestattet wäre, nicht zu praktizieren oder sonst tätig zu sein, weil die adat dies verbiete. Da keiner meiner Patienten unmittelbarer Hilfe bedurfte, willigte ich gerne ein und freute mich, einer sehr ruhigen Zeit entgegenzugehen.
Kurz darauf erschien Bajow, der Anführer unserer Long-Glat, bei mir mit einem Packen Briefe und Zeitungen, die nach meiner Abreise in Long Dĕho angekommen waren. Er berichtete ausführlich über alle Leiden, die seine Gesellschaft ausgestanden, nachdem sie sich auf dem Boh verirrt hatte. Vor Hunger erschöpft hätten sie zurückkehren müssen, wenn ihnen die Punan am Boh nicht geholfen und den Weg gewiesen hätten. Dank dem Fischreichtum der Flüsse, in denen niemals gefischt wurde, hatten sie es so lange aushalten können. Bajow erzählte ferner, man habe ihn und die Seinen bei den Uma-Bom freundlich empfangen und freigebig bewirtet, auch sei man in diesem Dorfe im allgemeinen von dem Besuch der Niederländer bei den Kĕnja befriedigt, nur drücke die Furcht vor Strafe für die vielen am Mahakam begangenen Vergehen noch stark auf die Stimmung.
Anderen Tags hielten sich alle Leute in einiger Entfernung von mir, weil sie wussten, dass ich weder praktizieren noch Handel treiben durfte, auch waren viele mit den Vorbereitungen zum Begräbnis des Häuptlings beschäftigt, das nachmittags stattfinden sollte. Die Männer hatten das schöne Prunkmal wirklich an einem Tage fertiggestellt, ebenso waren viele Frauen gleichzeitig damit beschäftigt, alles für die Totenausrüstung und das Begräbnismahl Erforderliche in Ordnung zu bringen.
Nach dem Essen musste ich mich als Gast und Glied der Kĕnjagesellschaft nach Sawang Bilongs Wohnung begeben, wo alle Häuptlinge des Stammes und auch die Männer aus Uma Bom um die bereits eingesargte Leiche versammelt waren. Der grosse, schwere, aus einem Baumstamm gehauene Sarg stand vor der Wohnung des Häuptlings in der ăwă und einige Frauen in Trauer knieten vor ihm und wehklagten. Der Sarg war rotbraun, weiss und schwarz angemalt, ebenso der grosse hölzerne Hund, der sich neben ihm befand und später unter die bila gestellt werden sollte. Viele schöne Kriegsmäntel, Perlen und [394] Armbänder hingen um den Sarg und hübsche Körbe, wahrscheinlich mit kostbarem Inhalt, standen um ihn her. Nachdem ich einige Zeit an der Aussenwand der Galerie zwischen den Häuptlingen gesessen hatte, kamen auch die Abgeordneten der Niederlassungen Uma Djalān, Uma Tow, Long Nawang und Uma Bakong an, traten erst vor den Sarg zum Wehklagen und liessen sich dann an unserer Seite nieder. Es herrschte zwar eine gedrückte Stimmung, auch wurde nur leise gesprochen, doch schlossen die Neuangekommenen sogleich mit Demmeni und mir Bekanntschaft und waren sehr darauf aus, etwas Besonderes zu hören. Von den Männern verstand nur ein Teil in genügendem Masse Busang, um ein Gespräch führen zu können, weitaus die meisten sprachen lieber ihre eigene Sprache oder die der Uma-Tow. Alle diese Dialekte weichen stark vom Busang ab, nur die Uma-Lĕkĕn, die ich noch nicht sprechen gehört hatte, sollten sich des Busang bedienen.
Während wir so beieinander sassen, konnten wir beobachten, in wie freigebiger Weise die Kĕnja einander bei solchen Gelegenheiten unterstützen. Aus allen Wohnungen traten Reihen von jungen Mädchen und Frauen in schöner Kleidung und trugen Schüsseln mit Reis und anderen Esswaren in die amin der trauernden Familie; des Morgens hatten sie in gleicher Weise Brennholz herbeigetragen, um all das Essen zu kochen.
Die eigentliche Bestattung ging nachmittags gegen 4 Uhr vor sich. Nur die nächsten Angehörigen schritten hinter dem Sarge her, der von 4 Männern auf zwei festen Bambusstöcken getragen wurde. Nicht sämtliche bei der Leiche aufgestellten schönen Dinge, sondern nur Schild, Schwert, Kriegsmantel und Kriegsmütze des Verstorbenen wurden mitgetragen, um an der bila aufgehängt zu werden. Der Zug machte einen schlichten Eindruck; auf dem Wege, ausserhalb des Hauses, verstummte das Wehklagen. Da man die bila in unmittelbarer Nähe des Dorfes, bei den Gräbern von Bui Djalongs Kindern und anderen, errichtet hatte, dauerte die Beisetzung nicht lange und man kehrte bald heim.
Abends wurde meine Hütte von so vielen Personen, die ihre Häuptlinge zur bevorstehenden Versammlung begleitet hatten, belagert, dass die Häuptlinge selbst ihren Besuch bei mir auf den folgenden Morgen verschoben.
Dann waren aber auch alle Gäste versammelt, die an diesem Tage an den Beratungen teilnehmen sollten, und von früh morgens bis halb elf Uhr, wo man Demmeni und mich zur Versammlung rief, war [395] meine Wohnung ständig überfüllt. Jetzt bot sich die Gelegenheit, allen Häuptlingen, die noch kein Geschenk empfangen hatten, eines anzubieten und zugleich ihre Frauen, von denen die meisten mitgekommen waren, kennen zu lernen.
Alle hatten Esswaren mitgebracht, die von Uma-Bom sogar ein kleines Schwein. Bei der Austeilung der Geschenke musste wieder mit Überlegung zu Werke gegangen werden, um die Besucher ihrer Würde gemäss zu bedenken, ohne die Tauschartikel zu stark anzugreifen; diesmal erleichterte man mir die Aufgabe, indem man mir ganz unbefangen die verschiedenen Personen vorstellte, die für die grössten Geschenke in Betracht kamen. Unter den Gästen bemerkte ich auch Taman Dau, unseren Bekannten aus Long Dĕho. Er hatte eine sehr nette Frau mitgebracht, die augenscheinlich auch im eigenen Kreise sehr geachtet wurde; wenigstens erregte es allgemeine Befriedigung, als ich ihr ein besonders schönes Stück Seide für eine Jacke reichte.
Man brachte mir wieder eine grosse Menge Flaschen, um sie mit Arzneien zu füllen, und auch der alte Mann, der an der Mündung des Danum auf mich gewartet hatte, liess mich durch seinen Enkel, den er zu diesem Zwecke mitgesandt hatte, wieder um die Arznei bitten, die seine Hautkrankheit zum grossen Teil bereits geheilt hatte.
Der vertrauliche Umgang mit den Besuchern weckte eine gute Stimmung vor der eigentlichen Versammlung; bei alledem vergassen wir ganz unser Frühstück, das Midan bei dem grossen Zulauf ohnehin nur mit Mühe hatte zubereiten können. Zum grossen Tagesereignis, der politischen Versammlung, holten uns die vornehmsten Ältesten von Tanah Putih in die ăwă von Bui Djalong ab, wo wir uns vorläufig versammelten, um uns dann gemeinsam in das Haus und die ăwă seines ältesten Bruders Bo Anjè zu begeben. Dort fanden wir bereits eine grosse auf dem Boden kauernde Gesellschaft vor, während man uns mitten an der Vorderseite auf unseren Klappstühlen Plätze anbot. Die erste Stunde verging mit gemütlichem Plaudern, dem Essen von gekochtem Klebreis mit Schweinefleisch (man verzehrte ein ganzes, grosses Schwein bei dieser Mahlzeit) und dem Trinken von djakan, dem sehr guten Reiswein der Kĕnja. Nachdem alle befriedigt waren, merkte ich, dass sie von mir die Eröffnung der Versammlung erwarteten, auch beantwortete Bui Djalong meine Frage, ob ich den Anfang machen sollte, mit einem Kopfnicken. Um den Eindruck meiner Worte zu erhöhen, begann ich damit, der Versammlung den Unterschied [396] in den Rechten klar zu legen, die einerseits der Radja von Sĕrawak, andererseits die Niederländer auf den Grundbesitz auf Borneo zu erheben hatten, und erwähnte dabei speziell den letzten Vertrag zwischen den beiden Mächten, welcher die Wasserscheide zwischen den Flüssen der Nord- und denen der Ostküste als Reichsgrenze bestimmte. Kwing Irang hatte mir bereits im Jahre 1896 zu verstehen gegeben, dass er diesen Vertrag kannte. Ich hatte auch gemerkt, dass man keine klare Vorstellung davon hatte, dass die tuwan putih (weissen Herren), die am Long Mĕkam (Mahakammündung), am Long Kĕlai (Berouw) und Long Kĕdjin (Kajan) wohnten, alle zu unserer Nation gehörten, was ihre Überzeugung von unserer Macht sehr bestärkte. Hieran knüpfte ich an, dass wir vom Kajan aus auch auf die Uma-Alim würden Einfluss ausüben können; doch fügte ich auch jetzt ausdrücklich hinzu, derartige eingreifende Massregeln sowie eine definitive Festsetzung in ihrem Lande hingen erst von einer Besprechung mit den Autoritäten in Batavia und Europa ab. Dann kam ich auf den Hauptgegenstand der Beratung, die Fehden am Mahakam zu sprechen, besonders auf die Kopfjagden am Tawang und Medang, an denen die Uma-Bom zum grössten Teil die Schuld trugen. Die Ereignisse selbst als bekannt voraussetzend berichtete ich, dass in diesen Angelegenheiten der Sultan von Kutei für die Kĕnja am Tawang, der Assistent-Resident von Kutei für die Bewohner am Mahakam und Barito Partei ergriffen hätten und dass ich gekommen sei, um zu hören, welche Entschädigung die Uma-Tow und Uma-Djalān für den Mord am Tawang verlangten und welche Busse die Uma-Bom ihrerseits für die Kopfjagden von Taman Dau bezahlen wollten. Was die erste Angelegenheit betreffe, so sehe ich ein, dass sie für die Ermordung von Bui Djalongs Enkel von den Kĕnja am Tawang einen Sklaven fordern würden, doch könnten in diesem Fall weder der Sultan noch die Niederländer zu einer friedlichen Schlichtung der Fehde beitragen, wenn man uns nicht die absolute Sicherheit böte, dass der Mann nicht getötet werden würde. Ohne auf die von den Uma-Bom in den letzten zwei Jahren verübten Missetaten zu viel Nachdruck zu legen, ergriff ich die Gelegenheit, um nochmals deutlich auseinander zu setzen, wie wir Niederländer über derartige hinterlistige Handlungen dachten. Hatte ich mich in Long-Dĕho von der Stimmung des Augenblickes hinreissen lassen, so steuerte ich hier im Bewusstsein, dass ein offenes Wort nicht schaden würde, direkt auf mein Ziel los. Ich hatte die Kĕnja als ein Volk kennen [397] gelernt, das die Dinge beim rechten Namen zu nennen pflegte, ausserdem war ich überzeugt, dass alles, was ich sagte, den Vornehmsten unter ihnen bekannt war und meine offen geäusserte Entrüstung ihnen natürlicher erscheinen würde, als wenn ich vorsichtig um den Kern der Sache herumgegangen wäre. Ich beschrieb ihnen in grossen Zügen die Folgen ihrer Handlungsweise und wies darauf hin, dass hauptsächlich die Frauen und Kinder unter den unsicheren Zuständen im Lande litten und nicht die Übeltäter sondern unschuldige Leute ihres Stammes oder eines anderen der Rache zum Opfer fielen, worauf mir einige zustimmend zunickten. Wie früher in Long Dĕho, begann ich auch hier an dem Beispiel des Taman Dau, der dicht vor mir sass und ein böses Gesicht aufsetzte, zu beweisen, dass in unseren Augen erstens das Töten weniger wehrloser Menschen durch eine Übermacht eine unwürdige Tat sei und dass zweitens Taman Dau sich zum Schaden seines Volkes und Stammes durch schlaue Mahakam- und Tawanghäuptlinge, die bei den Malaien an der Küste in der Lehre gewesen wären, dazu habe gebrauchen lassen, deren persönliche Rachegelüste zu befriedigen. Während meiner sehr langen Rede hatte Totenstille geherrscht; mein Mahakamgeleite sass vor Schreck aschgrau und bewegungslos da, weil ich eine derartige Sprache gegen so viele mächtige Häuptlinge, die wohl 1500 Krieger aufstellen konnten, zu führen wagte. Eine Zeitlang herrschte allgemeines Geflüster, dann machte der eine oder andere eine Bemerkung in Busang, aus der ich ersah, dass man mich gut begriffen hatte. Endlich gab Bui Djalong als Vertreter aller zu verstehen, man habe zwar nicht alles, aber doch vieles von meinen Worten begriffen, nur habe man erwartet, dass ich die noch ungelösten Konflikte den Kĕnja aus dem Wege räumen würde, was ich jedoch leider nicht getan hätte. Ich merkte aber an dem vergnügten Lächeln des Häuptlings, dass mein offenes Auftreten ihm im Stillen sehr gefiel; er war übrigens früher selbst sehr energisch und kampfeslustig gewesen, wurde aber jetzt in seinem Streben, mit den Nachbarn Frieden zu stiften, besonders von den Uma-Bom gehindert, gegen die er nicht kraftvoll genug auftreten konnte.
Um den betroffenen Parteien die Sache nicht zu schwierig zu machen, gab ich in Erwägung, dass einige Kĕnja mich bei meiner Rückkehr zum Mahakam begleiten sollten, um die Tawangaffaire dort weiter zu behandeln, und wir die ferneren Angelegenheiten, besonders die der Baritostämme, dem Kontrolleur in Udju Tĕpu überlassen sollten. Hierin [398] stimmten mehrere zu, ferner wollte man abends allen, die kein Busang verstanden, meine Worte erklären. Als allerhand Nebensachen zur Sprache kamen, die für mich kein Interesse hatten, hielt ich es für das Beste, nach Hause zu gehen; es war übrigens schon halb fünf Uhr nachmittags geworden. Abends kam Lalau, um mich mit bedrücktem Gesicht namens Kwings und Bui Djalongs zu bitten, in Zukunft nicht mehr so scharf zu sprechen und besonders nicht so stark auf einen Schadenersatz seitens der Uma-Bom zu dringen.
Des anderen Morgens traten der Reihe nach zuerst die Leute von Uma-Djalān, dann die Uma-Tow von Long Nawang bei mir ein, um Geschenke zu empfangen, da am vorigen Morgen hierfür keine Zeit geblieben war. Kaum waren wir hiermit fertig, als man mich zu meinem grossen Missvergnügen zu einer neuen Versammlung rief, deren Notwendigkeit ich nach den langdauernden und ernsthaften Beratungen am Tage zuvor nicht einsah. Die ernsten Mienen der Männer machten eine Weigerung jedoch unmöglich.
Zu dieser neuen Versammlung auf Bui Djalongs ăwă hatten sich noch mehr Menschen eingefunden als zu der ersten, und bald zeigte es sich, dass die Kĕnja wichtige Angelegenheiten viel ernsthafter zu behandeln verstanden, als wir uns vorgestellt hatten. Man begann wieder damit, allgemeine Gespräche zu führen, zu essen und Reiswein zu trinken, der entsprechend der Würde der anwesenden Häuptlinge von den ältesten Mantri herumgereicht wurde. Demmeni und ich erhielten unseren Teil zuerst und zwar in sehr reinen Gläsern, die übrigen in Schalen, die sie der Reihe nach austranken. Nachdem die Anwesenden einen grossen Topf geleert hatten, nahm die Versammlung einen sehr sachlichen und feierlichen Charakter an, indem sie von Bui Djalong nach strenger Etikette geleitet wurde, wobei niemand selbständig auftreten durfte; also ganz anders als am vorigen Tage, wo jede Leitung gefehlt hatte. Zwei der ältesten Mantri fungierten als Zeremonienmeister in geradezu musterhafter Weise. Bui Djalong erklärte, man sei zusammen gekommen, um die Ansichten aller Häuptlinge über die gestern besprochenen Angelegenheiten zu vernehmen, und man erwarte, dass ich am heutigen Tage nicht selbst sprechen, sondern nur anhören sollte, was die übrigen zu sagen hätten.
Hierauf wurden die verschiedenen Wortführer der anwesenden Stämme nach dem Range aufgefordert, ihre Ansicht über die vorliegenden Fragen zu äussern. Zum Zeichen, dass jemand das Wort erteilt wurde, brachte [399] ihm ein junger Kĕnja ein Glas Reiswein, das ein Mantri gefüllt hatte; dieser wies zugleich auch die Person an, die zu sprechen hatte. Während letztere das Glas leerte, liessen alle Anwesenden einen feierlichen Ruf ertönen. Der Aufgeforderte begann dann sogleich seine Rede, die ich nicht verstand, da sie in einem der Kĕnja-Dialekte gehalten wurde. Einige Redner gaben in ruhigem Ton und mit kurzen Worten ihre Meinung zu verstehen, andere bemühten sich, Eindruck zu machen und ergingen sich in ausführlichen Betrachtungen. Zum Schluss suchten alle Redner ihren Worten dadurch ein besonderes Gewicht beizulegen, dass sie plötzlich aufsprangen, einige Mal durch Springen und Stampfen mit beiden Füssen gleichzeitig die Bretterdiele erdröhnen liessen und zugleich mit beiden gebogenen Armen in die Seiten schlugen unter dem wiederholten Ruf: “bă, bă!”
Wenn dieses Schauspiel auch sehr sonderbar wirkte, so machten doch der grosse Ernst aller Anwesenden und das strenge Zeremoniell einen grossen Eindruck, trotzdem wir das Gesprochene nicht verstanden. Dazu trug die ganze Versammlung nicht den kriegerischen Charakter wie bei den Bahau, da unter allen Anwesenden keine einzige bewaffnete Person zu sehen war.
Wie man uns später erklärte, gingen die Meinungen der Versammlung bezüglich der Frage, ob man es mit den Niederländern halten sollte, die Ordnung und Recht handhaben wollten, oder ob die alte adat mit dem Recht des Stärksten in Geltung bleiben sollte, anfangs auseinander. Die Vertreter der Niederlassungen Tanah Putih, Uma Tokong und Uma Djalān waren der ersten Ansicht, während die Uma-Bom, Uma-Bakong und die Uma-Tow von Long Nawang nicht sogleich geneigt waren, das Schwert in die Scheide zu stecken. Für die Einsicht der Versammelten sprach, dass sie nur die Hauptfrage, die Annahme oder Ablehnung der niederländischen Oberherrschaft behandelten und dass sie die Konflikte im Mahakamgebiet überhaupt nicht mehr zur Sprache brachten. Auf die Stimmung am Ende wirkte bestimmend, dass Bit, Bui Djalongs Schwiegersohn, und ein Ältester aus Tanah Putih als des Häuptlings Meinung zu erkennen gaben, dass, wenn die übrigen ihre Kampfgewohnheiten nicht ablegten, die Uma-Tow und andere in unserer Gesellschaft zum Mahakam auswandern wollten, um sich dort niederzulassen. Nachdem sich der vornehmste Häuptling so bestimmt auf unsere Seite gestellt hatte, wurden auch die Äusserungen der anderen friedliebender. [400]
Die verschiedenen Redner hatten alle der Reihe nach gesprochen und dabei zwei sehr grosse Töpfe voll djakan geleert, als Bui Djalong noch einen dritten, kleineren kommen liess, ihn selbst unter die Hut nahm und aus ihm die Gläser füllte. Während wir vorhin reichlich Zeit gehabt hatten, die Eigentümlichkeiten der Redner zu beobachten und uns im Mitsingen des Refrains, den die Versammlung bei jedem neuen Glase wiederholte, zu üben, wurde unser Interesse jetzt ganz von der Feierlichkeit der Zeremonien in Anspruch genommen.
Bevor der Häuptling den Topf öffnete, den er den Anwesenden als ein Geschenk von Kwing Irang und uns bezeichnete, hielt er an seine nächste Umgebung aus vornehmen Häuptlingen und Wortführern in gedämpftem, sehr ernstem Ton eine Ansprache, und fragte, ob sie durch einen Trunk aus diesem Gefäss sich für den neuen Stand der Dinge entscheiden wollten. Nach der zustimmenden Antwort aller öffnete er das Gefäss und stimmte darauf einen Gesang an, in dem er berichtete, dass dieser djakan von den Weissen stammte, die gekommen seien, um das Dasein der Kĕnja zu verbessern, und dass nun neue Zeiten anbrechen würden. Nachdem der Gesang, der in sehr eindrucksvollem, männlichem Ton vorgetragen wurde, beendigt war, erhielt einer der unmittelbar neben uns Sitzenden ein Glas, das er unter dem gebräuchlichen Ruf der Versammlung leerte. Erst hatte jeder von uns ein Glas trinken müssen, dann nur die ältesten, vornehmsten Häuptlinge, den jüngeren wurde überhaupt nichts angeboten. Nach Ablauf dieser Zeremonie ergriff Bui Djalong selbst das Wort in der Kĕnjasprache, von der wir wieder nichts verstanden, doch merkten wir an seiner fliessenden, deutlichen Sprache, dass er der beste Redner war. In überzeugendem Ton gab er seinen Gefühlen in einer sehr langen Rede Ausdruck. Zum Schluss sprang er dicht neben uns auf, arbeitete mit Armen und Beinen, dass der Grund erzitterte, gleichsam wie erregt von den eigenen Worten, worauf er augenscheinlich noch kurz über uns und Kwing Irang sprach, die er der Reihe nach berührte und für seine Freunde erklärte.
Nach dem Häuptling führte keiner mehr das Wort, aber ein grosses Bündel Schwerter und einige Schilde wurden hereingebracht und vor Bui Djalong niedergelegt. Zu unserem nicht geringen Erstaunen wurden sie alle unter uns verteilt, zur Besiegelung des neuen Freundschaftsbundes. Kwing Irang erhielt von Bui Djalong einen gleichen Schild mit Haaren, wie Bo Anjè ihm mir früher geschenkt hatte. Ich wurde von [401] ihm und von jedem der Anwesenden mit einem Schwert bedacht; auch Demmeni empfing 3 Schwerter. Man hatte sogar ein Schwert für Akam Igau, den Häuptling der Mendalam-Kajan, bestimmt, der früher die Kĕnja zu besuchen versucht hatte, dann aber nach dem Tawang hatte durchreisen müssen, wo er einigen Kĕnja aus Apu Kajan begegnet war.
Die ganze Zeremonie machte auf uns den Eindruck von Entschlossenheit und Kraft, wie wir ihn noch nie zuvor bei eingeborenen Stämmen empfangen hatten, und die freigebige Austeilung der Waffen, gleichfalls ein an anderen Orten unbekannter Brauch, bildete einen passenden Schluss. Gleich darauf wurde die Versammlung auch für aufgehoben erklärt. [402]
Kapitel XIV.
Aufforderung und Vorbereitung zu einem Besuch bei den flussabwärts gelegenen Niederlassungen—Ankunft in Long Nawang—Zustände im Dorf—Freundschaftlicher Verkehr mit den Bewohnern—Besuch von fremden Häuptlingen—Politische Versammlung—Besuch bei den Uma-Djalān—Rückkehr nach Tanah Putih—Vorbereitungen zur Heimreise.
Am Abend des Versammlungstages kamen die angesehensten Männer von Long Nawang zu mir, um über meinen eventuellen Besuch bei ihnen zu reden. Der vornehmste von ihnen war Pingan Sorang, der Sohn Pa Sorangs, der Bui Djalong in der Würde eines Oberhäuptlings vorangegangen war. Die Tatsache, dass Pingang Sorang seinem Vater nicht gefolgt war, machte bereits eine gewisse Eifersucht gegen Bui Djalong begreiflich und ich hatte denn auch gehört, das Verhältnis zwischen den beiden Dörfern der Uma-Tow in Tanah Putih und Long Nawang sei kein sehr freundschaftliches. Dies war auch der Grund, weshalb ich Bui Djalong nicht recht traute, als er mich von einem Besuch weiter unten abhalten wollte.
Bui Djalong hatte sich seinen Stammesgenossen gegenüber wahrscheinlich nicht öffentlich meiner Reise nach Long Nawang widersetzen wollen, denn, wie Pingan Sorang erzählte, hatte er mit ihm verabredet, wieder abwärts zu fahren und dann junge Leute mit einer genügenden Menge von Böten den Fluss hinaufzusenden, um mich und die Meinen abzuholen. Von Long Nawang aus wollte er dann die Häuptlinge der Siedelungen weiter unten am Fluss berufen, um auch mit diesen die in Tanah Putih bereits besprochenen Angelegenheiten zu behandeln. Ich versäumte nicht, meine grosse Zufriedenheit mit diesem Plan zu bezeugen, sowohl wegen des Besuches in Long Nawang als der Versammlung wegen.
Bei ihrer Heimreise am folgenden Morgen begegnete Pingan Sorangs Gesellschaft aber ein schlechtes njaho̱, das sie nach Tanah Putih zurückzukehren zwang, und bald darauf vernahm ich, dass jetzt, wo diejenigen, [403] die meinen Zug abwärts vorbereiteten, einem ungünstigen Zeichen begegnet waren, alle Dorfbewohner sich vor meiner Reise fürchteten. Das Missgeschick mit den Vorzeichen verdross mich umsomehr, als ich merkte, dass noch ganz andere Faktoren als blosse Besorgtheit um unsere Sicherheit im Spiel waren; meine Malaien hatten nämlich unter anderem erzählt, man finde in Tanah Putih, ich sei den Besuchern aus fremden Niederlassungen gegenüber zu freigebig gewesen, und fürchtete, ich würde auf einer Reise flussabwärts zu viel von meinen Artikeln wegschenken. Als auch Bui Djalong und einige Älteste mir meldeten, wie sehr die Bevölkerung jetzt gegen meine Reise sei, sagte ich ihnen, ich betrachtete Pingan Sorangs Vorzeichen nicht als das meine und wollte mir die Angelegenheit im übrigen noch überlegen. Ich nahm mir vor, mich, ohne die Häuptlinge der einen oder anderen Partei zu kränken, selbst aus der Verlegenheit zu ziehen; besonders da es sich um eine politische Versammlung in Long Nawang handelte, war es doppelt wünschenswert, der anderen grossen Partei der Kĕnja zu beweisen, dass es durchaus nicht meine Absicht sei, nur mit Bui Djalong in nähere Berührung zu kommen und mit ihm allein Rat zu pflegen. Nach reiflicher Überlegung mit Demmeni erschien es uns am besten, dass die Leute, die uns von Long Nawang aus abholen kamen, vor ihrer Abreise selbst gründlich die Vorzeichen für uns einholten, was alle Teile befriedigen und sicher zu unserem Vorteil ausschlagen musste. Darauf liess ich Bui Djalong, Pingan Sorang und einige der Vornehmsten von Uma Djalān, die meinen Besuch ebenfalls wünschten, zu einer nochmaligen Besprechung zu mir bescheiden und machte den Vorschlag, aufs neue, diesmal in meinem Interesse, Vorzeichen zu suchen. Ich betonte den fremden Häuptlingen gegenüber, wie viel mir an einem Besuch bei ihnen liege, und dass ich sie sicher begleiten würde, wenn sie günstige Vorzeichen fänden; im entgegengesetzten Falle würde ich jedoch nicht mit ihnen hinunterfahren können. Auf diese Weise unterwarf ich mich völlig ihrer adat und bot gleichzeitig den Bewohnern von Long Nawang die Möglichkeit, mich abzuholen, falls sie dies wollten, während ich denen aus Tanah Putih jede Berechtigung, sich beleidigt zu fühlen, nahm. War die Stimmung der Stämme weiter unten ungünstig, so konnten sie ein schlechtes Zeichen vorschützen, mir jedoch nicht den Vorwurf machen, nicht zu ihnen gekommen zu sein. Die Männer aus Long Nawang bezeugten auch sogleich durch Kopfnicken ihr Einverständnis mit dieser [404] Lösung der Frage, doch wurde die Gesellschaft, als sie meinen Vorschlag gemeinsam überlegten, nicht so bald einig. Zum Schluss sagte Bui Djalong, man wolle sich meinem Wunsche fügen, und die von Long Nawang sollten hinunterfahren, um mit den jungen Leuten im Dorfe zu sprechen. An diesem Tage mussten sie ihres joh wegen noch in Tanah Putih bleiben, aber am anderen Morgen kamen sie vor der Abreise noch, um Abschied zu nehmen und versprachen zum Beweis ihrer Wohlgesinntheit, mit allen weiter unten wohnenden Häuptlingen zu mir herauffahren zu wollen, falls ich sie ungünstiger Vorzeichen wegen nicht besuchen könnte.
Abends kam Bajow, der Anführer der Long-Glat aus Long Dĕho, und erzählte mir, man habe ihn gebeten, nach Hause zurückzukehren, weil sein Kommen nur Unglück im Lande verursacht habe; bei seiner Ankunft sei ein Häuptling der Uma-Bom gestorben und dann einer in Tanah Putih, der eben begrabene Vater Sawang Bilongs. Alle Leiden, die sie auf ihrer Herreise erduldet, bewiesen bereits, unter wie schlechten Vorzeichen sie ihre Reise angetreten haben, man sei also der Meinung, er solle so schnell als möglich mit den Seinen abfahren. Obgleich die Long-Glat durchaus nicht geneigt waren, die schwierige Reise sogleich von neuem anzutreten, fühlten sie sich hierzu doch verpflichtet und wollten sich daher mit Hilfe der Uma-Bom auf den Rückweg machen. Ich konnte nichts dagegen tun und gab ihnen nur einige Briefe mit, um sie als die ersten Berichte aus Apu Kajan zur Küste zu senden.
Gleichzeitig mit den Long-Glat reiste auch Kwing Irang mit den Seinen nach dem nicht weit entfernten Uma Tokong; es war dies das erste Mal, dass die Kajan auf eigene Hand andere Kĕnja zu besuchen wagten. Trotz allem Guten, das sie erfahren hatten, der grossen Gastfreiheit, dem herzlichen Umgang und der Sicherheit im Lande selbst hatten die Kajan bis jetzt ihre Angst vor den Kĕnja nicht soweit bemeistern können, dass sie ihrer Neugier, andere Dörfer kennen zu lernen, nachzugeben wagten und den zahlreichen Einladungen, die sie erhielten, Folge leisteten. Obgleich in Tanah Putih niemand bewaffnet einherging, trugen die Kajan doch stets Schwert, Schild und Speer bei sich, zur grossen Belustigung ihrer Gastherren. Dass diese sie nicht hoch schätzten, zeigte sich darin, dass Bui Djalong mit Kwing Irang keine Blutsfreundschaft schliessen wollte, wodurch eine der Hoffnungen dieses Häuptlings unerfüllt blieb. Auch in anderer Hinsicht erlebten [405] meine Mitreisenden manche Enttäuschung. Sie hatten z.B. gehofft, bei den in ihren Augen sehr urwüchsigen Kĕnja sehr vorteilhaften Handel treiben zu können, aber die Kĕnja besassen alle Artikel ebensogut wie die Bahau; auch Salz und Leinwaren hatten nicht den erwarteten grossen Wert. Infolge dieser Umstände war die Stimmung meiner Kajan durchaus nicht immer fröhlich und sie sehnten sich nach der Heimkehr. Dies war auch der Hauptgrund, weswegen die Kajan sich zu einem Besuch bei den Uma-Tokong ermannt hatten. Bui Djalong hatte ihnen nämlich zu verstehen gegeben, dass sein Stamm sie zwar ernähren könne, aber wegen Reismangels nicht imstande sei, ihnen auch für die Rückreise genügenden Proviant mitzugeben. Hierzu hatten sich jedoch die Stämme der Uma-Tokong, Uma-Bom und Uma-Djalān bereit erklärt, falls die Kajan den Reis selbst bei ihnen holen wollten. Hätte sich ihnen eine andere Möglichkeit geboten, um zu Reis zu gelangen, so hätten sie diesen Zug sicher nicht unternommen. Kwing bat mich auch für die Reise um drei Malaien zum Schutz, die ich ihm gern zugestand. Mit den Kajan zugleich zogen auch die Pnihing nach Uma-Tokong, doch schienen letztere, die ohne Tauschartikel auf Reisen gegangen waren, ihren Aufenthalt in Apu Kajan so satt zu haben, dass sie von dort einem Landweg zum Boh folgten und ohne meine Erlaubnis nach Hause zurückkehrten. Die 6 Pnihing bewiesen dadurch, dass sie mehr Mut besassen als alle Kajan zusammen.
Am 1. Oktober, zwei Tage nach ihrer Abreise, kehrte Lalau bereits aus Uma Tokong mit dem Bericht zurück, Kwing und die Seinen seien dort sehr freundlich empfangen und gefeiert worden und deshalb wohlgemut zurückgeblieben.
Mittags wurde ich durch die Ankunft von 120 Mann aus Long Nawang überrascht, die mich zu ihnen abholen wollten; augenscheinlich hatten sie nicht allzu lange nach günstigen joh gesucht oder zu suchen gebraucht. An diesem Tage war es Demmeni zum ersten Mal geglückt, eine Frau und einen kleinen Jungen zu einer photographischen Aufnahme zu bewegen; zu ihrer Beruhigung musste ich mich neben die beiden stellen, da sich besonders der Vater des Knaben sehr besorgt zeigte. Nun mussten die Negative noch ausgespült und getrocknet werden, ausserdem hatte ich noch verschiedene Massregeln für eine gute Ausrüstung zu treffen. Hauptsächlich musste ich mir die Art und Menge der mitzunehmenden Tauschartikel wohl überlegen, damit wir während unseres ohnehin kurzen Besuchs in diesen Niederlassungen [406] mit Anstand auftreten konnten. Ich nahm die Abwesenheit von Kwing und seinem Gefolge, die mich begleiten sollten, zum Vorwand, um meine Abreise um einen Tag zu verschieben.
Früh am anderen Morgen machten sich Lalau und einige vornehme Männer aus Long Nawang auf den Weg nach Uma Tokong, um Kwing mit seiner Gesellschaft abzuholen, aber erst spät abends kehrte Lalau allein zurück mit dem Bericht, sowohl Kwing als die Kĕnja würden bei den Uma-Tokong durch grosse Feste, die man ihnen zu Ehren veranstaltet hatte, aufgehalten. Auf einer eigens hierfür zusammenberufenen Versammlung hatte Kwing von uns und unserer adat erzählen müssen. Die Uma-Tokong hatten ein Schwein geschlachtet und viele anderen guten Dinge aufgetischt, welche die Kajan nicht im Stich hatten lassen können. In Tanah Putih war übrigens auch noch niemand bereit, mich zu begleiten, denn alle waren eifrig mit der Saat beschäftigt.
Des Morgens hatte sich Bui Djalong zu mir gesetzt und erzählt, einer der wichtigsten Gründe, die man gegen meine Reise abwärts gehabt habe, sei die Furcht gewesen, dass ich dort sehr unangenehme Dinge zu hören bekäme. Man sei dort noch weniger als in Tanah Putih über das Verhältnis zum Radja von Sĕrawak unterrichtet, den sie alle kannten und sehr fürchteten. Da ich alle anderen Beweggründe, vor allem die Schwierigkeit, eine genügende Menge Männer zur Fahrt vom Felde zu holen, wohl einsah, sagte ich, dass ich seine Begleitung zwar sehr schätzte, diese aber für meine Sicherheit nicht notwendig sei, dass jedoch Kwing und seine Kajan in eine Reise ohne ihn nicht einwilligen würden. Letzteres schien wenig Eindruck auf ihn zu machen, denn er erklärte, ohne die Kajan zu erwähnen, dass er nur mitgehen wolle, um mir die Siedelungen flussabwärts zu zeigen. So bat ich ihn denn, ohne die anderen Dorfbewohner, die zu beschäftigt waren, in meinem Boote mitzufahren, um dann unmittelbar nach Verlauf der grossen Versammlung (tenge̥rān ājā) zurückzukehren, damit er möglichst wenig Zeit verliere. Es war mir sehr beruhigend, dass ihn diese Anordnung zu befriedigen schien, denn wenn er sich gekränkt gefühlt hätte, weil ich die Reise gegen seinen Willen durchsetzte, so wäre mir das höchst unangenehm gewesen.
Kwing Irang, der am anderen Morgen gegen 9 Uhr mit seiner Gesellschaft erschien, war augenscheinlich bereits auf die Fahrt nach Long Nawang vorbereitet, wenigstens machte er keine Einwendungen. [407] So war unsere Karawane bald gebildet und bestand aus dem ganzen Personal, uns Europäern und den Kĕnja, zusammen etwa 120 Mann; der grösste Teil der Leute von Long Nawang war über Land bereits in sein Dorf zurückgekehrt, nachdem wir nicht sogleich hatten mit hinunterfahren können.
Wir verliessen Tanah Putih auf einem gut unterhaltenen, breiten Pfad, den ich noch nicht betreten hatte; wegen meiner vielseitigen Tätigkeit kam ich beinahe nicht aus dem Dorf. Der Pfad führte an den Gräbern und einer kubu vorbei, neben der sich zur Abwehr der bösen Geister auf einem hohen Pfahl eine Holzfigur befand. Tafel 83. Von hier gelangten wir abwärts zum Ufer des Kĕdjin, unterhalb der Reihe grosser Wasserfälle. Der an dieser Stelle nur 40 m breite Fluss wurde zu beiden Seiten von hohen, mit mächtigen Bäumen bekrönten Felswänden eingeschlossen. Die Bäume waren zur Befestigung eines schweren Rotangnetzes benützt worden, das von dem einen zum anderen Ufer derartig aufgehängt war, dass einige behauene Stämme auf dasselbe gelegt werden konnten, um als Brücke zu dienen. Seitlich stand das Netz den Stämmen entlang sehr steil in die Höhe und gewährte den Fussgängern ein Gefühl der Sicherheit, doch waren die Netzränder zu weit entfernt, um als Stütze dienen zu können. Da die Stämme sehr lose lagen, vertrauten wir uns diesem Brückenbau nicht an, sondern stiegen längs des steilen Ufers abwärts zum Landungsplatz. Die Kajan benützten grösstenteils ihre eigenen Fahrzeuge, für uns lagen aber zwei sehr lange, allerdings etwas schmale Böte bereit mit hoch vorstehenden Vorder- und Hintersteven, verziert mit schön geschnitzten Köpfen.
Nachdem unser Gepäck in den Böten untergebracht worden war, stiessen einige Männer sie vom Ufer ab und bugsierten sie in den Fluss. In einigen kleineren Böten sassen einige Frauen und boten unter all den Männern einen gemütlichen, beruhigenden Anblick. Wegen des sehr hohen Wasserstandes gelangten wir schnell über die vielen Stromschnellen, die von Bänken aus grobem Flussgestein gebildet wurden. Zwischen einigen sehr langen Schnellen verbreitete sich der Fluss bis auf 80 m. Sie liefen in starken Windungen durch eine sehr flache Landschaft, die ihrer ganzen Ausdehnung nach mit jungem Busch (talon) bedeckt war und nur hier und da einige mit Reis oder anderen Produkten bebaute Felder zeigte. An einigen Nebenflüssen zu beiden Uferseiten vorüberfahrend landeten wir zuerst bei der Niederlassung [408] der Uma-Djalān am Long Anjè, an dessen Oberlauf ein Dorf der Uma-Bakong lag. Hier stiegen einige Männer in unsere Böte, um sich mit uns zur Versammlung zu begeben, worauf die Fahrt abwärts bis gegen halb 4 Uhr fortgesetzt wurde. Dann liess man uns auf einer Geröllbank aussteigen und Toilette machen. Die meisten entkleideten sich, tauchten ein paar Mal in den Fluss, schlangen ihre Lendentücher sorgfältig um die Hüften, zogen ihre Festjacken an und strichen das Haar unter dem Kopftuch glatt. Waffen hatten die Kĕnja auch für diesen weiten Zug nicht mitgenommen, ausgenommen einige Arbeitsschwerter. Während wir uns noch verschönten, kamen auch die hinter uns gebliebenen Kajan an, worauf wir in einer Flotte von 12 Böten in guter Ordnung den Fluss weiter hinunter bis zu dem unmittelbar hinter einer Biegung gelegenen Dorf Long Nawang fuhren. Auf Wunsch der Kĕnja sollten wir bei der Landung zum Erstaunen der Menschenmenge, die uns auf dem hohen Uferwall erwartete, unsere Gewehre einige Mal abschiessen. Unsere Anfahrt musste jedoch unterbrochen werden, weil das ganze Flussbett dicht vor dem Dorfe voll grosser Schuttbänke lag, so dass einige Böte festliefen und von der Mannschaft weiter geschleppt werden mussten. Auch mein sehr schwer geladenes Boot war aufgelaufen, aber alle anderen warteten, um das meine als erstes landen zu lassen, worauf man mich auch als Erster an Land zu steigen aufforderte. Unten am Ufer empfingen uns zwei der tüchtigsten Ältesten, die uns nach Pingan Sorangs Haus führen sollten. Der eine nahm mich bei der Hand, der andere Demmeni und so stiegen wir auch den gekerbten Baumstamm hinauf, der uns auf das etwa 10 m hohe Ufer führte. Zum Glück waren die Stufen der grossen Stämme nur schwach ausgetreten, so dass wir beim Steigen mit unseren Schuhen den Menschen oben keinen allzu komischen Anblick boten. Eine grosse Anzahl kleiner, nackter Buben, die uns bei unserer Ankunft längs des Ufers jauchzend nachgelaufen waren, begleitete uns auch jetzt zu den Häusern, blieb aber draussen stehen, als wir die Treppe zum langen Hause Pingan Sorangs bestiegen, das sich dem Ufer am nächsten befand. Die Bauart glich im allgemeinen der von den anderen Dörfern und auch die Wände und Dächer der meisten Wohnungen waren ganz aus Blättern hergestellt. Nur fiel es mir sogleich auf, dass die Diele aus schönen, dicken Brettern bestand, die sich beim Gehen überhaupt nicht bewegten. Wir gelangten sehr bald in die ăwă, wo bereits viele beisammen sassen, hauptsächlich alte Häuptlinge, da die [409] jüngeren uns von oben abgeholt hatten. Pingan Sorang kam mir ein Stück entgegen und führte mich wieder an der Hand vor das Herdfeuer unter einige Reihen schwarzer Menschenköpfe, die auch hier wieder in Palmblätter gewickelt rauchgeschwärzt über dem Versammlungsplatz baumelten.
Unter den Anwesenden sassen bereits verschiedene Häuptlinge vom unteren Kajan, die erst später mit uns Bekanntschaft machten, vorläufig aber nur unser Äusseres anstaunten, während wir auf unsere Klappstühle warteten, die aus den Böten geholt werden mussten. Die neuen Ankömmlinge liessen sich hinter und zwischen den Anwesenden auf den Brettern nieder, ohne dass die grosse ăwă auch nur einigermassen gefüllt wurde. Nachdem unsere Stühle gekommen waren setzten wir uns, worauf Bui Djalong und Kwing Irang zu beiden Seiten von uns Platz nahmen. Den Leuten schien etwas auf dem Herzen zu liegen, was sie nicht zu äussern wagten; bald trat Pingan Sorang, denn auch mit der Bitte vor, der Gesellschaft den Anblick meiner Haut zu gönnen, und da ich wusste, dass ich ihr keine grössere Gefälligkeit erweisen konnte, legte ich sogleich Jacke und Hemd ab und stand auf, um mich eine Zeitlang betrachten zu lassen. Die zahlreiche Menge brach auch hier einstimmig in ein langgedehntes èh aus und starrte dann lange Zeit stumm auf die grosse weisse Erscheinung. Bald darauf brachte man zur Begrüssung einen Topf mit Reiswein von besonders gutem Geschmack, der uns nach der langen Fahrt im offenen Boot sehr erfrischte. Weniger angenehm empfanden wir die zweite Leckerei, ein Glas mit flüssigem Honig von wilden Bienen, vor dem uns nach dem langen Aufenthalt im schaukelnden Boote und bei dem Hunger, der uns quälte, etwas graute. Wir hielten uns jedoch tapfer und verdarben nicht den ersten vorteilhaften Eindruck, den wir zu machen glaubten.
Hiermit war der ernste, aber doch freundliche Empfang abgelaufen, und der Mantri, der uns herbegleitet hatte, forderte uns auf, ihm in das Haus zu folgen, das man für uns bestimmt hatte. Wir gingen rechts durch die ganze Galerie des Hauses und gelangten an ein prächtiges Holzgebäude, das ich bereits im Vorbeifahren vom Flusse aus bemerkt hatte. Die Grundfläche des Hauses betrug etwa 16 × 9 m, und wie man uns erzählte, hatten 700 Menschen 6 Tage lang an dem Bau gearbeitet. Das Haus, das auf Tafel 86 abgebildet ist, war in der Tat das hübscheste, das ich auf Borneo gesehen hatte. [410] Die Aussenwände schmückten bunte Malereien, auf den Pfählen waren allerhand Tiere, wie Eidechsen, geschnitzt und der First des Daches trug reiche Verzierungen in Form stilisierter Ungetüme und Männer mit europäischen Lanzen und Gewehren. Besonders die bang pakat und die Drachenfiguren unten an der Seite des Hauses waren fein ausgearbeitet. Die innere Ausstattung entsprach vollständig der äusseren. Sämtliche Pfähle und Bretter waren neu, doch setzte uns hauptsächlich ihre Bearbeitung, die diejenige am Mahakam weit übertraf, in Erstaunen. Die Pfähle waren alle so genau viereckig behauen, dass sie wie gehobelt aussahen und so gut ineinandergefügt, dass man die Arbeit eines europäischen Berufszimmermanns vor sich zu haben glaubte und nicht die von Laien, die nicht einmal über Sägen und Hobel zu verfügen hatten.

Kubu in Long Nawang.
Auch der Fussboden war meisterhaft gearbeitet. Die glatten Bretter trugen fast keine Meisselspuren und schlossen fest aneinander. Im Gegensatz hierzu waren die Treppen besonders schmal und schlecht, weil man keine Zeit oder keine Lust zu ihrer Herstellung übrig behalten hatte.
Auch einige Betten und einen schönen Herd aus ganz neuem Holz hatte man für uns gezimmert.
Der Raum genügte, um uns mit Kajan, Malaien und allem aufzunehmen, aber Kwing kehrte mit den Seinen bei den verschiedenen Häuptlingen ein, die ihre Gäste wieder freigebig beköstigten.
Glücklicherweise fiel uns die Menge, die uns voller Interesse von fern anstarrte, nicht lästig. Midan hatte aus Tanah Putih noch ein Huhn mitgebracht, so dass wir ohne fremde Hilfe schnell zu einer Mahlzeit gelangten. Unsere Gastgeber hatten aber auch hieran gedacht und brachten uns etwas später eine grosse Menge Reis und ein Schwein, das wir für den folgenden Tag aufsparten.
Als wir abends ruhig bei der Lampe sassen, stieg die angenehme Überzeugung in mir auf, dass wir mit der Durchsetzung unseres Besuches in Long Nawang das Richtige getroffen hatten. Der freundschaftliche Empfang, die viele Mühe, die man sich mit dem Bau dieses Prachthauses gegeben hatte, und die Anwesenheit so vieler Häuptlinge aus den tiefer gelegenen Dörfern bewiesen mir zur Genüge, dass ich einen Fehler begangen hätte, wenn ich mich von Bui Djalong und den Seinen hätte zurückhalten lassen.
Long Nawang bestand aus 17 langen Häusern mit je 20–40 Familienwohnungen, so dass die Anzahl der Bewohner mindestens 2500 [411] betragen musste. Alle diese Häuser standen auf dem flachen Ufer des Kajan an der Mündung des Nawang. Unweit des Flusses erhoben sich Hügel, auf denen aber keine Häuser standen; alle Dorfleute wohnten dicht beim Fluss, der ihnen Wasser und Badegelegenheit bot. Zwischen den verschiedenen Häusern liefen gute Wege, die hier und da noch mit behauenen Balken oder Brettern belegt waren; der dazwischen liegende Boden war teilweise von Unkraut und Gras gesäubert.
In unregelmässigen Gruppen standen zerstreut kleine Reisscheunen, die im Gegensatz zu den langen Häusern ganz aus Holz gebaut waren. Jede Familie besass meistens mehr als eine Vorratsscheune, weil der Ernteertrag bei den Kĕnja in Folge ihrer Arbeitsamkeit ein viel grösserer ist als bei den Bahau. Ob es diesem Umstand zugeschrieben werden muss, dass erstere 3 Mal täglich, letztere nur 2 Mal zu essen pflegen, wage ich nicht zu entscheiden, denn es ist auch möglich, dass das kältere Klima von Apu Kajan ein grösseres Nahrungsbedürfnis bedingt.
Die Dächer und Wände der gewöhnlichen Häuser bestanden auch hier zum grössten Teil aus Blättermatten, nur die Dächer der Häuptlingswohnungen waren mit wenigen Ausnahmen mit Holz gedeckt. Auf den Fussboden in der Galerie hatte man besondere Sorgfalt verwandt, seine Bretter waren aussergewöhnlich breit und dick. Das Alter und die Dicke der Pfähle in den Häuptlingshäusern liessen erkennen, dass sie bereits mehreren Generationen gedient hatten und stets wieder von der alten Niederlassung nach der neuen mitgewandert waren. Bei den Häusern standen nur wenige Fruchtbäume; auch kleine eingezäunte Gärtchen, wie sie sich sonst in den Dörfern der Bahau und Kĕnja fanden, fehlten hier, wodurch das Ganze ein unfreundliches Aussehen erhielt.
Anderen Tags, am 4. Oktober, wiederholte sich hier das Schauspiel von Tanah Putih. Aus dem grossen Dorfe selbst und wahrscheinlich auch aus der Nachbarschaft strömte vom frühen Morgen an eine Menge Menschen herbei, um uns zu betrachten, die in fröhlichem Gedränge über alles schwatzten, was sie sahen. Mit unseren Malaien standen sie sehr bald in bestem Einvernehmen; meine Leute folgten jetzt meinem Beispiel und waren gegen die Kĕnja viel nachsichtiger und geduldiger als früher den Bahau gegenüber. Übrigens trug die Überzeugung, dass sie sich durch Erregung des Missfallens ihrer Umgebung der grössten Gefahr [412] aussetzten, viel dazu bei, dass sie sich die neugierige Zudringlichkeit der Kĕnja gefallen liessen.
Mit Ungeduld erwartete man die Austeilung von Geschenken; da ich aber weder wusste noch sehen konnte, wer Häuptling, Freier oder Sklave war, so wäre mir diese Aufgabe auch jetzt wieder sehr schwer gefallen, wenn nicht bereits früh Morgens einige niedrigere Häuptlinge zu mir gekommen wären, um zu überlegen, wie ich am besten vorgehen sollte. Sie machten den Vorschlag, dass die Häuptlinge von allen 17 Häusern mir der Reihe nach ihre panjin vorstellen und dabei mitteilen sollten, wer auf ein grösseres und wer auf ein kleineres Geschenk Anspruch machte. So geschah es denn auch; trotzdem war es in den nächsten Tagen äusserst ermüdend, so viele Personen beschenken zu müssen, die alle um mehr baten, und den Vorrat dabei nicht aus dem Auge zu verlieren. Meine beiden vornehmsten Ratgeber standen mir treu zur Seite und zogen schliesslich die Unzufriedenheit derjenigen auf sich, die ohne sie ein grösseres Geschenk von mir erwartet hatten. Auch jetzt kamen weitaus mehr Frauen und Kinder als Männer, um ein Geschenk zu erbitten; doch fehlten auch letztere nicht, besonders die Familienväter suchten eifrig für ihre Kinder ein hübsches Stück Zeug, etwas Perlen, oder eine Tasse mit Salz zu erwischen Die Mütter steckten mir sogar die bewegungslosen Händchen ihrer Säuglinge zu, damit ich etwas Perlen für ein Armband oder ähnliches in sie hineinlegte. Aus manchen Häusern führte man mir 60–70 Personen auf ein Mal zum Beschenken zu, so dass ich täglich nur einige Häuser abmachen konnte. Da ich ausserdem noch mit den einen handeln, die anderen auf Krankheit untersuchen und mit Arzneien versehen musste, waren die Tage in Long Nawang von morgens bis abends sehr belegt. Ich war sogar nicht immer imstande, den vielen Einladungen der Häuptlinge in ihre amin Folge zu leisten, und hatte alle Mühe, meine schwerkranken Patienten in den verschiedenen Häusern zu besuchen. Da sich das Dorf mehrere Hundert Meter dem Ufer entlang ausdehnte, erforderten meine Krankenbesuche oft lange Wanderungen, bei denen ein grosses Geleite von Kĕnjakindern nie fehlte, die nicht wie die Bahau schüchtern hinter mir hergingen, sondern jauchzend durch das Gras zu beiden Seiten des Wegs hersprangen, ohne jedoch durch zu grosse Zudringlichkeit lästig zu werden. Alle Dorfbewohner waren übrigens in diesen Tagen so lebhaft und aufgeregt, dass ich meinen Hund aus Furcht vor einem Unglück anbinden musste. [413] Auch hier überliessen sie mir die Gegenstände, an denen mir lag, gern für einen entsprechenden Preis. Zwar waren ihre Forderungen bisweilen etwas hoch, besonders die mancher Häuptlinge, die an der Küste von dem grossen Interesse der Weissen für ihre Ethnographica gehört hatten, aber wie am Mahakam fasste ich auch hier einen etwas teuren Kauf als ein Geschenk für den betreffenden auf, für den ich sonst bei der grossen Anzahl Hochgestellter nur schwer etwas Grösseres übrig gehabt hätte. Auf dieselbe Weise beschenkte ich auch einige nette junge Mädchen aus einigen Häuptlingsfamilien; besonders Ping, die Enkelin Pingan Sorangs, wurde wegen ihres hübschen Äusseren und der geschmackvollen Kleidung, die sie trug, reichlich von mir bedacht. Für allerhand wertvolle Dinge, die sie von mir haben wollte, verkaufte sie mir mit Hilfe ihrer Mutter, die etwas Busang sprach, der Reihe nach ihr ganzes Kostüm, von der Mütze an bis zur Jacke und dem Rock. Sie erhielt schliesslich einen solchen Schatz an schönem Zeug und Perlen, dass kurz vor meiner Abreise ihr Vater und Grossvater mit ihr zu mir kamen, um sich für alles, was ich Ping gegeben hatte, zu bedanken. Es war dies das erste Mal, dass man mir für genossene Wohltaten nach europäischer Weise Dank sagte. Mit hübschem Zeug durfte ich übrigens freigebig sein, weil die Masse des Volkes, wie schon gesagt, dauerhaften, dicken Baumwollstoff weitaus vorzog.
Obgleich ich ganz überzeugt war, dass eine reiche Austeilung von Geschenken dazu beitragen musste, ein gutes Verhältnis mit den Eingeborenen anzuknüpfen, so war es doch nicht meine Absicht, beim Volk die Meinung zu erwecken, die Dinge besässen für mich keinen Wert; bei praktisch denkenden Eingeborenen wäre eine derartige Vorstellung sehr unerwünscht gewesen. Ich suchte daher jedes Geschenk auf das Notwendige zu beschränken, kam aber dabei oft dem Mindestmasse der Ansprüche meiner neuen Freunde bedenklich nahe und so geschah es bisweilen, dass einer eine Gabe als zu gering nicht annehmen wollte. Erst wenn ich das Geschenk durch eine kleine Zugabe vergrössert hatte, wurde es in Empfang genommen und dann oft mehr geschätzt, als wenn ich es sogleich ohne Bedenken weggegeben hätte. Im allgemeinen war ich also nicht zu freigebig. Übrigens schienen sich die Leute sehr gut in die Schwierigkeiten meiner Lage hineindenken zu können, denn einige der Ältesten Männer äusserten mehrmals ihre Bewunderung über meine Nachsicht gegenüber den Schwächen ihrer Mitbürger. Die Austeilung von Geschenken bot eine erwünschte Gelegenheit, vielen Gliedern [414] eines Stammes, mit denen ich sonst nicht in Berührung gekommen wäre, eine angenehme Erinnerung und die Überzeugung zurückzulassen, dass es ausser dem Radja von Sĕrawak, den sie als einen fernen, stets drohenden Feind hatten betrachten lernen, noch andere einflussreiche Weisse gab, die nur Gutes mit ihnen im Sinn hatten.
So hatten wir bereits am ersten Tage bei der Bevölkerung einen günstigen Eindruck hervorgerufen, bevor am zweiten die grosse Versammlung gehalten wurde. Sehr früh morgens brachten zwei Häuptlinge bereits die Bewohner ihrer Häuser zu mir, aus Furcht, dass ich sonst keine Zeit haben würde, um sie alle zu beschenken. Ich hatte nämlich sogleich bekannt gegeben, dass ich schwerlich länger als fünf Tage würde bleiben können, obgleich es mir sehr leid tue, das schöne Haus nur so kurze Zeit zu bewohnen. Man tröstete mich damit, dass das Haus doch stehen bleiben und als “kubu tuwan dokter” (Haus des Herrn Doktor) später zur Aufnahme von Gästen dienen würde.
An diesem Morgen kamen auch schon die Häuptlinge von Uma-Kulit zu mir herüber, von denen ich einige Einzelheiten über die Töpferei vernahm, welche den Haupterwerbszweig ihres Stammes bildet. Da diese Häuptlinge zu Bui Djalongs Partei gehörten und ich sie für die Versammlung günstig stimmen wollte, fragte ich sie, was sie sich zum Geschenk wünschten. Zum Glück waren sie nicht unbescheiden, nur musste ich einem von ihnen den Rest des dicken Kattuns geben, den ich ursprünglich für meine Gesteinsammlung mitgenommen hatte.
Ich hatte erwartet, wie gewöhnlich erst gegen Mittag zur Versammlung gerufen zu werden, doch geschah dies schon bald nach dem Morgenfrühstück. Bei meinem Erscheinen waren auch bereits viele in der āwā vereinigt; augenscheinlich hatte sie die Neugierde dorthin gelockt, denn von 9 bis halb 12 Uhr taten wir nichts anderes als über allerhand Gleichgültiges schwatzen und einander mit gegenseitigem Interesse betrachten. Bei der grossen Offenherzigkeit der Kĕnja erfuhr ich von ihnen wieder sehr viele Einzelheiten, vor allem über die weiter unten gelegenen Siedelungen der Uma-Kulit, Uma-Bakong, Uma-Baka, Uma-Tĕpu und Uma-Lĕkĕn. Die Vertreter dieser Dörfer fanden es sehr angenehm, von den Ihrigen erzählen zu können, und wurden hierzu noch durch gegenseitigen Wetteifer angespornt. Mit den Männern des am weitesten unten am Fluss wohnenden Stammes der Uma-Lĕkĕn unterhielt ich mich ohne Dolmetscher, da diese stets Busang [415] reden. Von den übrigen beherrschten nur wenige diese Sprache in genügendem Masse, um eine Unterhaltung mit mir zu wagen. Ich erfuhr jetzt, warum man links um unserer āwā, vor der linken Hälfte von Pingan Sorangs Haus, einen hohen Zaun errichtet hatte, hinter den unsere Gesellschaft nicht treten durfte. Zu unserem Erstaunen herrschte im Dorfe augenblicklich das lāli für die Saat, aber wegen unseres Besuches hatte man das Verbot nur für die eine Hälfte des Hauses gelten lassen, wo die Familie der dājung wohnte, die diesem lāli besonders streng unterworfen war. Die Kĕnja bewiesen hierdurch eine viel freiere Auffassung als die Bahau, die sich unter allen Umständen streng an ihre Kultusvorschriften halten.
Während wir uns so unterhielten, erfreuten wir uns an dem Anblick vieler Reihen von jungen Frauen, die aus den verschiedenen Häusern einen Beitrag zur Mahlzeit brachten, an welcher sich die Versammelten vor der eigentlichen Arbeit stärken sollten. Bescheiden vor sich hinsehend und vor den Blicken so vieler fremder Männer verlegen eilten die Kĕnjaschen Schönen etwas besser als gewöhnlich gekleidet in hastigen Schritten an uns vorüber und verschwanden hinter der hohen Türschwelle von Pingan Sorangs Wohnung. Traten sie wieder heraus, so konnten sie nicht umhin, uns und die vielen Fremden mit lachendem Gesicht aus der Ferne zu betrachten; sie blieben sogar ab und zu eine Weile stehen.
Erst gegen Mittag traten die Vornehmsten ein und wurde die Versammlung geordnet. Die Neuangekommenen setzten sich öfters in die hintersten Reihen und wurden dann von einem der Ältesten, die als Zeremonienmeister auftraten, bei der Hand genommen und an einen ihrer Würde entsprechenden Platz geführt. Die Versammlung bot zum Schluss ein übersichtliches Bild von der Würde der Anwesenden, indem die Vornehmsten um den eigentlichen Herd dicht vor uns unter den Schädeln, die jüngsten dagegen in den hintersten Reihen sassen. Im ganzen waren vielleicht 300 Mann vereinigt, als Pingan Sorang das Zeichen zum Auftragen der Mahlzeit gab.
Diese war bereits von den jungen Leuten in der amin aja unter Lachen und Scherzen zubereitet worden; nach kurzer Zeit trugen einige nett gekleidete junge Männer zuerst das Essen der vornehmsten Häuptlinge herein, dann die Päckchen mit Klebreis für die grosse Masse und gaben jedem den ihm zukommenden Anteil. Für Acht von uns hatte man neben dem Klebreis eine Schüssel mit fein gehacktem, in [416] Wasser gekochtem Schweinefleisch hingestellt, eine etwas fette, aber doch schmackhafte Suppe. Nachdem wir gegessen hatten, wurden unsere Schüsseln den Ältesten der Stämme und dann den übrigen panjin vorgesetzt. Nach der Suppe wurde Reiswein herumgereicht, auch diesmal von vortrefflicher Qualität. Das Anbieten eines Glases djakan bedeutete auch hier eine Aufforderung zum Sprechen und so wurde mir das erste Glas gereicht, damit ich durch den Trunk gestärkt das Wort ergriffe. Das tat ich denn auch, doch befolgte ich diesmal den Rat, nicht allzusehr auf die Bezahlung der Bussen zu dringen, welche die Kĕnja den Mahakambewohnern schuldeten. Ob Kwing Irang, der neben mir sass, um den ferneren Verlauf meiner Rede besorgt war, oder ob er dem Glase djakan, das auf ihn wartete, entgehen wollte, weil es ihm bei anderen Gelegenheiten schwer im Magen gelegen hatte, weiss ich nicht, aber er ergriff plötzlich ungefragt das Wort und setzte meine Rede fort. Dass man sein Busang besser verstand als das meine, bezweifle ich; die Versammlung gab jedoch ihrer Verwunderung über dieses ungewöhnliche Verfahren keinen Ausdruck, sondern hörte geduldig zu.
Nachdem Kwing geendet hatte, fragte man Bui Djalong, wer sprechen sollte; so wurde er während der ganzen Dauer der Versammlung, auch hier, in der amin seines Vorgängers Pa Sorang, als erster geehrt. Bui Djalong bestimmte als den Vornehmsten Taman Lawang Pau, den Häuptling der Uma-Tĕpu, der eine lange Rede hielt über das Unrecht, das sein Stamm durch den Überfall der Uma-Alim erfahren hatte; begreiflicherweise war er von diesem Gegenstand erfüllt, doch stand dieser mit dem Zweck unserer Versammlung in keinem Zusammenhang. Von den folgenden Reden verstand ich wieder wenig oder nichts; nur den Uma-Lĕkĕn konnte ich folgen. Nachdem die Vornehmsten alle das Wort geführt hatten, erhielt auch Bui Djalong einen Becher, den er etwas zögernd annahm. Erst sprach er mich kurz in Busang an und sagte, dass alle sich gern der niederländischen Oberherrschaft fügen wollten, dass aber viele fürchteten, dann von dem Radja von Sĕrawak leiden zu müssen. Mit den Worten: “dieses für Sie” wendete er sich von mir ab und setzte seine Rede fort in der Kĕnja-Sprache, in der er ernsthaft und fliessend zu den Versammelten sprach. Auch jetzt machte seine Redeweise den angenehmsten Eindruck. Nach ihm erhielten noch viele andere Häuptlinge das Wort, aber einige waren zum Sprechen zu verlegen, andere sagten nur einen Satz; ausnahmsweise [417] trug ein Häuptling auch einem seiner Ältesten auf, an seiner Statt seine Meinung zu äussern, was die Mahakamhäuptlinge beinahe stets taten.
Gegen 3 Uhr wurden auch hier eine Menge Schwerter als Friedenszeichen der verschiedenen Niederlassungen hereingebracht und grösstenteils mir und Kwing geschenkt, mit Hinzufügung des Ortes, von dem jedes Schwert stammte. Auch Demmeni erhielt einige Schwerter, ebenso wurden Bĕlarè, Bang Jok und den Bukat am Mahakam durch Kwing Irang je ein Schwert als Friedenszeichen zugesandt. Zum Schluss erteilte mir Bui Djalong auf meine Bitte nochmals das Wort, damit ich die Leute beruhigen und ihnen das Verhältnis zwischen der sĕrawakischen und der niederländischen Macht auseinandersetzen konnte. Bui Djalong hatte das bereits getan, aber er meinte, man würde meinen Versicherungen mehr Glauben schenken. Dass ich in der Tat Vertrauen genoss, zeigte sich darin, dass man mich bat, noch an diesem Tage dem Radja einen Brief zu schreiben, in dem ich ihm meine Gegenwart meldete und darlegte, dass die Kĕnja gegen Sĕrawak nicht Böses im Sinn hatten, jedoch um Aufschub der noch schuldigen Bussen baten. Bei der Besprechung der Streitigkeiten mit den Uma-Alim zeigten sich die Uma-Tĕpu sehr befriedigt von meinem Versprechen, dafür sorgen zu wollen, dass der Beamte an der Mündung des Kajanflusses den Uma-Alim ein Schreiben zukommen lasse, in dem er sie vor ferneren Überfällen warnte. Hierbei drückten sie allerdings ihren Zweifel darüber aus, ob es wohl sicher sei, dass die Weissen an der Mündung des Kajan (Kĕdjin) und Kĕlai (Bĕrau) auch zu meinem Volk gehörten, und es kostete mich wiederholte Versicherungen, dass es sich wirklich so verhielt, bevor man sich in diese Tatsache finden konnte.
Abends nach der Rückkehr in meine kubu musste ich noch den englischen Brief an den Radja von Sĕrawak abfassen, wobei eine zahlreiche Menge, die sich bei der feierlichen Handlung etwas ruhiger als sonst verhielt, um mich herumstand. Obgleich ich vor Müdigkeit durchaus nicht zum Schreiben aufgelegt war, musste der Brief doch beendet werden, da der Häuptling der Uma-Kulit, der der Wasserscheide am nächsten wohnte, ihn am folgenden Morgen mitnehmen und dann weiter transportieren sollte.
Eine bessere Schreibgelegenheit hätte ich übrigens auch am folgenden Tage nicht gefunden, denn des Morgens kamen erst die Bewohner [418] einiger Häuser zum se̥lābā und später die fremden Häuptlinge, um Abschied zu nehmen. Sie kehrten alle am Nachmittage in ihre Niederlassungen zurück und verbreiteten dort die Kunde von einem grossen weissen Manne, der im Besitz reicher Schätze sei.

Blick auf die Niederlassung der Kĕnja zu Long Nawang.
Darauf erschienen die Bewohner von Long Nawang selbst und brachten Reis, Eier und Früchte in grosser Menge, hauptsächlich um sie gegen grosse, schöne Perlen und Zeug auszutauschen. Auch der vierte Tag unseres Aufenthaltes ging in so regem Verkehr mit der Bevölkerung vorüber, dass ich mich energisch losreissen musste, um meine Patienten besuchen und das Dorf besichtigen zu können.
Zu gründlichen Studien von Land und Volk fehlte mir die Zeit, und da das Getriebe der Besucher von morgens bis abends kaum zu ertragen war, sehnte ich mich nach dem Augenblick, wo ich, ohne unserem Abkommen untreu zu werden, wieder flussaufwärts fahren konnte. Meine Reisegefährten dagegen unterhielten sich hier sehr gut und fanden in der grossen Niederlassung bessere Handelsgelegenheit als in dem kleineren Tanah Putih. Als Abschlagszahlung von ihrem Lohn kauften sie von mir kostbare Tauschartikel, hauptsächlich Sätze von Elfenbeinarmbändern (gadin), die sie meistens gegen alte Perlen austauschten, die am Mahakam so viel mehr wert waren. Kwing Irang war es auch geglückt, sich alte kupferne uhing oder Glöckchen zu verschaffen, die seine Frauen unten an ihren Jacken trugen und die nur noch bei den Kĕnja in grösserer Anzahl zu finden waren. Er hatte bereits lange seine gadin für sie aufgespart, aber erst jetzt glückte es ihm, sie vorteilhaft gegen die uhing auszutauschen. Diese schienen übrigens so selten zu sein, dass die panjin der Kajan ihrer nicht habhaft werden konnten. Da jeder Kauf Unterhandlungen erforderte, die oft Tage dauerten, war die Eile fortzukommen bei unseren Leuten nicht sehr gross; wenn die Kajan sich im Grunde nicht so sehr nach der Heimreise gesehnt hätten, wären sie zum Aufbruch von Long Nawang noch schwerer zu bewegen gewesen. Nach Übereinkunft mussten wir auf der Rückfahrt einige Tage bei den Uma-Djalān verbringen, was uns ebenso bewegte Tage wie in Long Nawang verhiess.
Auf den 8. Oktober war unsere Abreise festgesetzt, aber die Reiselust war sowohl bei der Mannschaft als bei den Reisenden sehr gering, und so ging ich denn gern auf Pingan Sorangs Vorschlag, noch einen Tag länger zu bleiben, ein, besonders da er bemerkte, seine Männer müssten an diesem Tage noch auf dem Lande arbeiten und könnten [419] mich daher nur schwer begleiten. Vielleicht verhinderte an diesem Tage auch ein lāli die Reise, doch hatte ich keine Zeit, mich danach zu erkundigen. Wir waren mit den Dorfbewohnern so vertraut geworden, als wenn wir uns bereits monatelang in ihrer Mitte befunden hätten; sehr angenehm berührte uns auch die Präzision, mit der für unsere Abreise gesorgt wurde, auch nachdem man nichts mehr von uns zu erwarten hatte.
Der Wasserstand blieb günstig und so konnten wir am sechsten Tage nach unserer Ankunft Anstalten zur Abreise treffen. In der Frühe kamen noch einige Häuptlinge, um mich um etwas zu bitten, hauptsächlich um alte Kleider, die hier zum Unterschied vom Kapuas und Mahakam sehr geschätzt waren; andere dagegen, wie die genannte Ping, kamen, mir ihre Kleider abzuliefern, die sie auf meine Bitte ordentlich geflickt hatten.
Man hatte, wie es sich zeigte, darauf gerechnet, dass die Uma-Djalān uns nach ihrem Dorfe abholen würden, denn es standen zwar eine genügende Menge Böte zu unserer Verfügung, aber ausser den Häuptlingen, die uns das Geleite geben sollten, keine Mannschaft. Als jedoch niemand erschien, brachte man doch eine genügende Anzahl Leute zusammen, um die Reise anzutreten. Als unser Gepäck in die Böte verteilt worden war und die Mannschaft einsteigen wollte, erschien um die Ecke eine Flotte von 30 Böten der Uma-Djalān mit etwa 100 Mann, um uns abzuholen. Mit so grosser Hilfe ging das Umladen schnell von statten und die Long-Nawang zogen ihre Böte wieder an Land, froh nicht mitzugehen zu brauchen. Von kräftigen Armen fortgerudert, verloren unsere Böte die grosse Niederlassung bald aus dem Auge. Doch dauerte die Fahrt mehrere Stunden, während welcher wir noch einmal essen mussten, da die Kĕnja ohne zwingenden Grund nicht gern auf eine ihrer drei Mahlzeiten verzichten.
Aus Furcht vor der bevorstehenden Unruhe bedauerte ich den etwas längeren Aufenthalt in der freien Natur nicht und benutzte die Gelegenheit, um mit einigen unserer neuen Gastherren Bekanntschaft zu schliessen.
Vor unserer Ankunft im Dorfe mussten wir auch jetzt viele Gewehrschüsse abfeuern; ich brauchte meine Patronen nicht mehr so sehr zu sparen und so tat ich den Kĕnja und meinem Geleite gern das Vergnügen. Taman Lĕdjü, der angesehenste der anwesenden Häuptlinge, nahm mich am Landungsplatz wieder bei der Hand und führte mich so einige Hundert Meter durch die grosse Niederlassung und [420] dann eine unbequeme kleine Treppe hinauf; augenscheinlich war dies eine besonders feierliche Art den Einzug zu halten. Die Menschen meinten es gut mit uns, hatten sehr praktisch einen Teil der ăwă des Häuptlings für uns Europäer durch eine Hecke abgeschlossen, wodurch wir die Menge fernhalten konnten, und boten uns unmittelbar nach unserer Ankunft eine Ziege und ein kleines Schwein zum Geschenk an. Unsere weisse Haut wurde wiederum von einer zahlreichen Schar bewundert, aber das war bald geschehen und dann durften wir uns hinter unsere Umzäunung und bald darauf hinter unsere Moskitogardinen zurückziehen.
Am anderen Tage, dem 10. Oktober, kamen die Leute von ihren Reisfeldern heim, betrachteten uns von allen Seiten und waren so ungezwungen, als ob wir bereits lange bei ihnen gewesen wären. Sogleich entstand ein gutes Verhältnis zwischen uns und nach wenigen Tagen fühlten wir uns unter diesen freundlichen Leuten wie zu Hause.
Taman Ulow, der uns vom Boh her kannte, und ein vornehmer Priester Bo Usat traten von Anfang an als Unterhändler zwischen uns und der Menge auf und rieten uns gemeinsam mit dem Häuptling Taman Lĕdjü, auch ihre 14 Häuser auf die gleiche Weise zu selăbă wie in Long Nawang. Da ich nur 3 Tage bleiben wollte, war diese Methode sicher die praktischste, und bereits am ersten Vormittag arbeitete ich sechs Häuser ab, obgleich sich deren Bewohner auch hier sehr gewissenhaft einstellten und alle Lebensalter von den Säuglingen bis zu den alten Männern und Frauen bedacht werden mussten. Die Arbeit war hier übrigens leichter als in Long Nawang; mit etwas Salz für die Kinder und Zeug und Perlen für die Älteren stellten sich alle zufrieden. Auch die gescheidte sympathische Frau des Häuptlings und deren hübsche Töchter waren stets behilflich, ihre Untergebenen zu bescheideneren Wünschen zu bewegen. Des Abends plauderten wir noch eine Weile mit den Häuptlingen von Uma-Djalān und Long Nawang, die noch nicht heimgekehrt waren, am Herdfeuer in der ăwă.
Die Austeilung von Geschenken und Arzneien nahm auch den ganzen folgenden Vormittag in Anspruch. Darauf kamen die vornehmsten Männer des Dorfes in die ăwă zu einer Beratung, wobei sie sich auch hier nach Rang und Stand um einen Mittelpunkt gruppierten, der wiederum durch dag Feuer und einige Reihen von Menschenschädeln darüber gebildet wurde. Zuerst reichte man uns sehr unschuldigen djakan und [421] dann Klebreis mit Schweinefleisch, die beide trefflich schmeckten. Zum Essen hatten wieder teilweise alle Häuser beigetragen, aber diesmal traten die Frauen von hinten in die amin ājā ein, so dass wir uns mit ihrer Betrachtung nicht die Zeit kürzen konnten. Des Morgens hatte die ăwă übrigens nur für die Gesellschaften, die aus den Häusern zum se̥lābā kamen, Raum geboten. Bei dieser Zusammenkunft fanden keine langen Auseinandersetzungen statt, weil die wichtigsten Männer das Notwendige bereits gehört hatten; die Feier bedeutete daher mehr eine Anerkennung unseres Besuches und eine Bewirtung. Zum Schluss wurden uns auch hier einige Schwerter überreicht, die das gegenseitige gute Verhältnis besiegeln sollten.
Hierauf fuhren die von Long Nawang wieder ab, und konnten wir uns seit vielen Tagen zum ersten Mal nachmittags wieder zur Ruhe legen. Bald kam jedoch wieder eine frage- und tauschlustige Menge angezogen, die mich bis ½ 8 Uhr abends beschäftigte und noch länger geblieben wäre, wenn ich mich nicht zu einigen Häuptlingen ans Feuer gerettet hätte.
Der 12. Oktober war wiederum erst der Austeilung von Geschenken gewidmet, mit denen sich alle zufrieden zeigten, mit Ausnahme der meisten Häuptlinge. Diese wünschten alle einen Satz Armbänder, aber ich gab nur Taman Lĕdjü und Bo Usat, den vornehmsten, ein so grosses Geschenk. Es wurde beschlossen, dass die Kajan sich mit einigen Uma-Djalān nach der Niederlassung der Uma-Bakong weiter oben am Anjè begeben sollten, wo man ihnen Reis für die Rückreise versprochen hatte. Zugleich wollte man dort, wie es sich später herausstellte, die Männer ersuchen, mich und die Meinen nach Tanah Putih zu bringen. Ich selbst hatte für mein eigenes Personal bereits Reis in Überfluss erhalten und gekauft. Da jeder Dorfbewohner am ehesten einen Beitrag an Reis liefern konnte, kam jedes Haus beim se̥lābā in der Regel mit einem grossen Korb voll Reis an, viel weniger mit Früchten und anderen Dingen, die mir auch weniger von Wert gewesen wären. Kwing und sein Gefolge zog noch am selben Nachmittage aus und kehrte am folgenden Tage mit einem Vorrat Reis zurück, sehr aufgeräumt über die ihnen gebotene gute Bewirtung, bei der man ein grosses Schwein geschlachtet hatte. Dass die Häuptlinge von Uma-Djalān über ihre Geschenke nicht allzu unzufrieden waren, erfuhr ich zu meinem Vergnügen noch am gleichen Morgen, als man mir im Namen aller ein schönes Boot schenkte, um mit ihm später den Kajan wieder aufwärts zu fahren. [422]
Kwing Irang berichtete, die Uma-Bakong hätten versprochen, zu uns herunterzufahren, um uns nach Tanah Putih zu bringen und auch noch mehr Reis für die Kajan zu sammeln.
Gewöhnt an die Unzuverlässigkeit der Bahau bei Abmachungen, begann ich am folgenden Morgen über das Ausbleiben der Uma-Bakong besorgt zu werden, doch wohnten diese ein grosses Stück weiter oben am Fluss, somit war es begreiflich, dass ihre 100 Mann erst gegen 9 Uhr ankamen. Auch die Böte der Uma-Djalān verursachten uns einiges Kopfzerbrechen wegen ihres geringen Laderaumes, aber die grosse Mannschaft hatte unser Gepäck bald in ihnen verteilt und dann ging es den Fluss wieder aufwärts. Auch jetzt nahm man sich so viel Zeit, dass immer wieder ein Boot anlegte, um Erfrischungen, hauptsächlich Zuckerrohr aber auch Früchte vom Felde zu holen, mit denen man seinen Durst löschte. Fanden die Kĕnja an den Ufern einige Böte, die besser waren als die ihrigen, so luden sie unser Gepäck in jene über und fuhren weiter, ohne die betreffenden Besitzer von ihrem Tun zu benachrichtigen. Diese eigentümliche Handlungsweise ist bei den Kĕnja ganz allgemein im Schwang; da sie sich nicht vorstellen können, dass weit entfernt wohnende Stämme anderen Rechtsbegriffen huldigen, folgen sie ihrer Sitte auch auf den Feldern der Bahau am Mahakam und anderswo und sind dort deshalb verhasst und gefürchtet. Da unterwegs auch noch gekocht wurde, erreichten wir erst um 3 Uhr unsere Abfahrtstelle oberhalb der Djĕmhāngmündung, von wo wir, froh wieder nach Hause zu kommen, nur noch ein Stück über Land zurückzulegen hatten.
In Tanah Putih fand ich, unser ganzes Hab und Gut unverletzt wieder vor. Die Bewohner sehnten sich bereits nach meiner Rückkehr, da einige Kranken meiner Hilfe dringend bedurften. Diese dienten mir als Vorwand, um einige Männer aus Long Nawang, die mich um Kleider baten, bis zum folgenden Tag zu vertrösten. Dann erwartete man mich aber bereits früh bei Bui Djalong, wo einige Männer unter Taman Lawang Pau von unten die Meldung brachten, dass ein Malaie aus Sĕrawak eingetroffen und zu den Uma-Aga gezogen sei. Dieser Mann hatte behauptet, von den Autoritäten in Sĕrawak gesandt worden zu sein, und die Kĕnja ernsthaft gewarnt, sich mit mir einzulassen. Er brachte jedoch keinen Beweis mit, dass ihn in der Tat ein englischer Beamte geschickt hatte, auch hätte ihm dieser sicher nicht erlaubt, auf niederländischem Gebiet auf derartige Weise über uns zu reden; [423] zweifellos musste sein Auftreten seiner eigenen feindlichen Gesinnung zugeschrieben werden. Die Häuptlinge wollten das auch annehmen, hielten es aber für geraten, dass ich auch nach dem Baram über das Treiben dieses Mannes schriebe, damit man auch dort erfahre, dass ich mich im Kajangebiet aufhielt.
Ich benutzte die Gelegenheit, um mit den beiden Häuptlingen über meine Rückreise zu sprechen, damit die unvermeidlichen langen Vorbereitungen möglichst zeitig begonnen Wurden und man in den Dörfern weiter unten sogleich erfuhr, dass ich in der Tat abreisen wollte. Es war nämlich beschlossen worden, dass mich die Vertreter vieler Stämme nach dem Mahakam begleiten sollten, und obgleich ich mir davon nicht viel versprach, wollte ich die Betreffenden doch von meinem Plan benachrichtigen. Die Abreise wurde auf den Beginn des folgenden Neumonds festgesetzt. Dabei betonte ich ausdrücklich, dass ich nicht gewöhnt sei, wegen schlechter Vorzeichen einen Monat zu warten, und dass die Kajan für die Rückreise keine Zeichen zu suchen brauchten. Wolle man mich begleiten, so müsse man zeitig bereit sein. Etwas später wurde ich um einige Paar Hosen, Perlen und Ringe als Lohn für ihre Begleitung die Männer der Uma-Bakong los, kaufte noch eine hübsche Matte von Bo Usat, um diesen einflussreichen Priester der Uma-Djalān noch mehr für mich zu gewinnen, und war mittags endlich einmal von allem Gedränge befreit, da beinahe ganz Tanah Putih auf die ladang gezogen war.
Um mein Reisegepäck möglichst einzuschränken, überlegte ich, was zurückbleiben durfte und was unbedingt mit musste. In Long Nawang hatte ich bereits ein paar Häuptlinge mit zweien meiner Stahlkoffer, deren Inhalt weit und breit unter den Kĕnja zerstreut war, glücklich gemacht; auch Bui Djalong wollte durchaus so einen Koffer haben, den ich ihm leicht geben konnte, da meine Tauschartikel sehr zusammen geschmolzen waren und ich nur wenige wertvolle Dinge, wie einige Elfenbeinarmbänder, wieder mitnehmen wollte. Kwing erstand im letzten Augenblick jedoch noch zwei Sätze, um für diese eine grosse guliga, die er bei den Uma-Tokong gesehen hatte, durch Anjang Njahu kaufen zu lassen, den er zu diesem Zweck dort hinschickte. Zu gleicher Zeit zog Bang Awan auch mit einigen Kajan zu den Uma-Bom, teils aus Neugier, teils um noch Reis für die Rückreise zu kaufen.
Eine angenehme Überraschung bereiteten mir in diesen Tagen einige Männer der Uma-Kulit, die nach Tanah Putih kamen, um Töpfe zu verkaufen; [424] sie erzählten nämlich, dass die Batang-Lupar, als sie den bewussten Brief von mir an den Radja sahen, gesagt hätten, dass der Radja ihnen jetzt wohl nicht länger erlauben würde, im Kajangebiet, auf niederländischem Boden, Kautschuk (lătong) zu suchen, worauf sie sich sehr bald über die Wasserscheide davon gemacht hätten. Diese Tatsache war ein schneller und schlagender Beweis für die Richtigkeit meiner Aussagen auf politischem Gebiet.
Alle überflüssigen Arzneien und Chemikalien zur Konservierung von Zoologica begannen wir jetzt zu vernichten. Einige Schwierigkeiten verursachten uns anfangs die Gifte, weil wir sie aus Furcht, dass die Kĕnja sich auch nach einer Warnung an ihnen vergreifen könnten, nicht vergraben wollten. Zuletzt versenkten wir sie an einer tiefen Flussstelle unterhalb des Dorfes. Die Flaschen fanden viele Liebhaber, es war sogar schwierig, bei der Verteilung keinen Neid zu erwecken; leider durften wir die Büchsen, in denen sich Arsenik und Ähnliches befunden hatte, nicht wegschenken, sondern mussten sie zum Ärger unserer Besucher vernichten. Unsere abgetragenen Kleider fanden reissenden Absatz; kaum merkten die Leute, dass ich nur das Notwendigste für die Reise zur Küste beiseite legte, als sie um ein altes Beinkleid oder Jacket eine förmliche Belagerung veranstalteten.
Diese Begierde nach Kleidern hätte uns beinahe noch ein ernsthaftes Unglück zugezogen; man hatte nämlich Kwing Irang in Long Nawang ohne mein Wissen seine letzte Jacke abgebettelt, wodurch der bejahrte Mann in diesem rauhen Klima schwer erkrankte. Er hatte die Bitten nicht abzuschlagen gewagt und mich auch um keine andere Jacke gebeten, bis man mich eines Morgens zu ihm rief, weil er infolge einer Erkältung an heftigem Fieber krank lag. Ich gab ihm sofort eines meiner warmen wollenen Jagdhemden, in das er sich voll Wohlbehagen einhüllte. Das half jedoch nichts gegen das immer heftiger werdende Fieber, das sich als eine durch Erkältung hervorgerufene Malaria erwies. Abgesehen von der Krankheit selbst verursachte auch der Patient mir viele Schwierigkeiten, denn wie die meisten Häuptlinge war auch er von Kind an sehr verwöhnt worden und hatte sich nicht zu überwinden gelernt. So hatte sich Kwing in der Regel nicht dazu entschliessen können, eine unangenehme Medizin einzunehmen. Allerdings war Kwing so weit von Hause fort etwas fügsamer, als er aber anfangs nach den Chininpillen leicht erbrach, liess er sich nur nach langer Überredung dazu bewegen, die Arznei aufs neue einzunehmen. [425] Es war ein Glück, dass sein Sohn Bang Awan und der Priester Bo Bawan sich bei den Uma-Bom befanden. Die Kajan glaubten nämlich sogleich an Verrat und Vergiftung seitens der Kĕnja und eine Erzürnung der Geister von Apu Kajan und wollten daher ohne Zögern mit dem kranken Kwing den Fluss hinauffahren, um im Walde zu kampieren und den Geistern zu opfern. Der Kranke, dessen Tod in diesem Augenblick einen wahren Schlag für das Resultat meiner Reise bedeutet hätte, befand sich beinahe fieberfrei, als die Seinen von den Uma-Bom zurückkehrten. Immer wieder stellte ich diesen vor, wie gefährlich für Kwing ein Transport aus der gut geschlossenen amin Bui Djalongs in den nasskalten Wald werden könne, und es schien, als ob sie die Richtigkeit meiner Worte einsähen, wenigstens blieben sie den ersten Tag in Tanah Putih. Am zweiten jedoch verschwand Kwing plötzlich mit seinem ganzen Gefolge und ging am Ufer des Kajan hausen. Tags zuvor hatten sie ihn nicht fortschaffen können, weil ein Toter noch unbeerdigt war, so dass ich noch die Möglichkeit gehabt hatte, meinen Patienten mit einer letzten Chinindosis gänzlich vom Fieber zu befreien und ihm seinen normalen Appetit wiederzugeben. Der Rückfall, den ich natürlich fürchtete, blieb jedoch aus, vielleicht dank den Arzneien, der warmen Kleidung und den Verhaltungsmassregeln, die ich ihm mit Lalau nachsandte. Kwing erklärte, sich genau an meine Vorschriften halten zu wollen. Er beabsichtigte, mit seinem Gefolge langsam nach Long Lāja vorauszufahren und mich dort zu erwarten. Die Kajan holten noch einen Teil meines Gepäcks, um mich nicht mit einer allzu grossen Menge zurückzulassen. Es erwies sich, dass die Kĕnja trotz ihrer in mancher Hinsicht viel freieren Auffassung sich doch sehr streng an die Zeichen ihrer Vögel hielten, besonders bei dieser Reise in eine ihnen feindlich gesinnte Gegend. Ich hörte, viele Niederlassungen wollten sich an der Reise beteiligen, im Ganzen etwa 500 Mann, aber jedes Dorf müsse seine eigenen Vögel suchen. Man glaubte für diesen Zug nicht weniger als 10 verschiedene gute Vorzeichen nötig zu haben; da weitaus die meisten in dieser Reihe ein böses Omen fanden, waren sie stets wieder gezwungen, nach Hause zurückzukehren.
Als ich in Tanah Putih noch nichts von einem Vorzeichensuchen merkte und Bui Djalong darüber sprach, erklärte er, dem Anführer der Männer, die mit mir gehen sollten, geraten zu haben, nicht selbst auf die Vogelschau zu gehen, sondern sich derjenigen Niederlassung [426] anzuschliessen, der es gelungen wäre, günstige Vorzeichen zu finden. Die jungen Leute wagten jedoch nicht, diesem Rat zu folgen, und begannen auch von ihrem Dorfe aus auf die Vorzeichensuche zu gehen. Sie hatten jedoch schlechten Erfolg und beschlossen daher doch nach einigen Tagen, auf Bui Djalongs Vorschlag einzugehen, weil sie sich nicht wie die anderen Niederlassungen berechtigt glaubten, bei einem schlechten Omen für immer heimzukehren. Einer über 70 Mann starken Truppe aus Long Nawang war es gelungen, unter ständig guten Zeichen über die Wasserscheide zu ziehen, und nun kehrte ein Teil zurück, um mich abzuholen, während der andere im Gebirgswald blieb, Böte baute und Guttapercha suchte, um diese später am Mahakam zu verkaufen. Bit, der Schwiegersohn Bui Djalongs und Abing Djalong und Ibau Anjè, die Anführer von 80 Mann aus Tanah Putih, wollten sich jetzt den Männern aus Long Nawang anschliessen. Da dies nur unter günstigen Vorzeichen geschehen konnte, zogen sie eines Morgens mit Sack und Pack auf die Suche aus. Anfangs ging alles nach Wunsch, aber als sich einer der Teilnehmer an einem Ruheplatz im Fluss baden wollte, begegnete er der rotköpfigen Schlange, worauf alle nach Hause zurückkehrten und für einen Tag me̥lo̱ eintrat. Als sie sich dann aufs neue aufmachten, flogen zwar der te̥lăndjăng und der hisit rechts d.h. günstig auf, aber darauf trieb die Stimme des Rehs sie ins Dorf zurück. Die Anführer hielten es jetzt nicht mehr für geraten, dass sich so viele an der Reise beteiligten, und da Bui Djalong durchaus nicht wollte, dass die von Long Nawang mich allein begleiteten, beschlossen 4 Häuptlinge, trotz aller bösen Zeichen doch mit mir zu ziehen. Die Vier versuchten nun, sich je zu zweien den vorausgereisten Männern von Long Nawang anzuschliessen, was ihnen auch gelang, ohne bösen Zeichen zu begegnen. Ihre früheren Reisegefährten wollten nur bis oberhalb des Batu Plakau mitgehen, um uns über diese schwierige Stelle zu bringen; obgleich viele von ihnen sich sehr darüber ärgerten, dass sie nicht weiter mit durften, wagte doch keiner gegen die Warnung ihrer Geister sich auf ein solches Unternehmen einzulassen.

Frau der Kĕnja Uma-Tow.
Auch in den anderen Dörfern liessen sich die Bewohner nur mit Mühe von der Reise zurückhalten. Nachdem die Männer von Uma-Djalān sich zwei Mal auf den Weg gemacht und jedes Mal wegen eines schlechten jo̱h hatten zurückkehren müssen, waren sie zu mir gekommen, um den Malaien Lalau zu holen, in der Hoffnung, dass [427] dieser imstande sein werde, ihre jo̱h günstig zu stimmen. Doch auch diese Gesellschaft hörte den kidjang und musste auch nach 9 tägiger Reise mit 110 Mann zurückbleiben. Taman Ulow und einige andere, denen es eine Freude gewesen wäre, mich auch auf der Rückreise zu begleiten, meldeten mir sehr verstimmt ihr Missgeschick und liessen sich auch durch Geschenke nur halb trösten.

Knabe der Kĕnja Uma-Tow.
Unter allen diesen Enttäuschungen trat der 3. November ein, bevor man mit dem Vorzeichensuchen so weit gefördert war, dass ich selbst an eine Abreise denken konnte. Bui Djalong, der selbst nicht viel auf Vorzeichen zu geben schien, ärgerte sich, dass die jungen Männer so viel Wesens daraus machten, und zwang daher halbwegs einen Teil der Männer, die noch mit dem Vorzeichensuchen beschäftigt waren, mich an einem bestimmten Tage abzuholen. Ich selbst schickte meine Malaien an das Ufer des Kajan voraus, um dort Hütten für uns zu bauen und einen Teil des Gepäckes mitzunehmen. Nach Übereinkunft sollte Ibau Anjè mich am anderen Tage mit den Männern seines Hauses abholen, hauptsächlich um unsere Sachen zum Fluss zu transportieren. Einige von ihren Feldern zurückkehrende Männer erzählten uns, die von Uma-Djalān ausgesandten Leute wären bereits so weit vorgerückt gewesen, dass ihr Lagerplatz sich dicht unterhalb der Brücke über den Kajan befand.
Am letzten Abend war unsere Wohnung ständig voller Freunde und Bekannten, die Abschied nehmen wollten und ihr Bedauern darüber aussprachen, dass wir schon so bald wieder abreisten. In den letzten Tagen machte sich in allen unseren Gesprächen die Abschiedstimmung bemerkbar.
Früh am anderen Morgen erschienen bereits eine Menge Häuptlinge bei uns, die sich alle verabschieden (nẹăt) und ihren Kummer (lẹwang) über unsere Abreise ausdrücken wollten. Einige blieben nur kurze Zeit, andere länger, auch waren die Kinder wie immer sehr lebhaft, so dass nur wenig Raum und Zeit übrig blieben, um an das Einpacken der Sachen die letzte Hand anzulegen. Einige Frauen tauschten noch zuletzt etwas Reis, Tabak und Eier gegen Perlen aus und erschöpften dadurch meinen Perlenvorrat beinahe gänzlich. Die meisten älteren Frauen hatten Tränen in den Augen und auch meine Scherze brachten kein Lächeln auf den Gesichtern meiner besten Freundinnen zum Vorschein. Bui Djalong und sein Bruder Bo Anjè blieben bei uns, bis wir aufbrachen, was erst um 9 Uhr geschehen konnte, weil die [428] Kĕnja noch aus ihrem Lager herunterkommen mussten. Ich begann bereits an ihrer Ankunft zu zweifeln, als sie endlich erschienen, aber in geringerer Anzahl als verabredet war, so dass viele kleineren Gepäckstücke noch unter die Anwesenden zum Tragen verteilt werden mussten. Am schnellsten waren die jungen Mädchen unter Anführung von Dow, Bui Djalongs Tochter, bei der Hand, um Tragkörbe zu holen und den Rest der Sachen in diese zu verteilen. Sie verliessen in langer Reihe die Hütte, um alles an den Fluss zu tragen. Auch unsere Malaien waren mit ihren Lasten bereits vorausgegangen, so dass wir uns mit nur wenigen Begleitern als Letzte auf den Weg machten.
Bui Djalong drückte zu wiederholten Malen sein Bedauern darüber aus, dass er wegen der Fehden mit den Uma-Alim und anderer Hindernisse sein Land eben nicht verlassen konnte, um uns zu begleiten. Ich hatte ihm und seiner Frau bereits am Tage vorher einen Abschiedsbesuch gemacht; wie er mir jetzt beim Fortgehen die Hand drückte, fragte er sehr bewegt, ob wir uns je wiedersehen würden. Er schien nur halb getröstet als ich ihm sagte, dass es wohl noch einige Jahre dauern werde, bevor ich wieder eine so grosse Reise unternehmen könne. [429]
Kapitel XV.
Abschied von Tanah Putih am 4. November—Im Lagerplatz am Kajan—Wiederholter Aufenthalt durch schlechte Vorzeichen—Zusammentreffen mit den Kajan in Long Laja—Geologische Verhältnisse im Laja—Aussichtsposten auf der Wasserscheide—Abstieg zum Mĕsĕai—Aufenthalt wegen Hochwasser—Umschlagen eines Bootes im Kiham Puging—Jagd auf Wildschweine—Ankunft am Mahakam—Besuch bei Barth in Long Iram—Abschied von Kwing Irang—Auflösung der Expedition in Samarinda—Ankunft in Batavia am letzten Dezember 1900.
Bei unserem Abzug aus der Niederlassung waren alle Bewohner auf den Galerien versammelt, um uns fortgehen zu sehen. So stiegen wir schnell zu der kubu hinauf, von der aus wir vor zwei Monaten zum ersten Mal Tanah Putih erblickt hatten und fanden dort die Malaien und jungen Trägerinnen, die auf uns warteten. Von hier aus schickten wir alle Kinder zurück, die uns vom Dorfe aus begleitet hatten. Da der Weg bis zum Kajan nicht weit war, betrachteten wir mit Musse das Panorama von Apu Kajan, bevor uns der dunkle Wald diesen Anblick ganz entzog.
Am Fluss boten uns einige alte Hütten der Kajan einen vorläufigen Schutz gegen die Sonne und dort sassen wir inmitten unserer Trägerinnen und anderer, die ihre Freunde, unsere Malaien, begleitet und zum Abschied deren Körbe hatten tragen helfen. Die fröhliche Gesellschaft bot ein sehr anziehendes Bild, das eine angenehme Erinnerung an unseren Aufenthalt bei den gutherzigen Kĕnja zurückliess. Die bedrückten Gesichter einiger unserer jungen Malaien und Bandjaresen bewiesen, wie schwer ihnen der Abschied fiel; selbst der etwas blasierte Anang, ein junger Mann, der bereits weit umhergeschweift war und viel durchgemacht und auch diese Reise nur mit Widerwillen angetreten hatte, vergoss zur Freude der Anwesenden viele Tränen bei der Trennung von seinem Mädchen. Wahrscheinlich hatten alle diese Leute in ihrem Leben noch nicht so viel aufrichtige Sympathie erfahren wie hier in Apu Kajan. Erst gegen Mittag kehrten die meisten Mädchen ins Dorf zurück und konnten wir unsere Hütten etwas einrichten lassen. [430]
Am anderen Morgen machten uns unsere kleinen Freunde und Freundinnen unter der Obhut eines alten Mannes Piat Lawei wieder einen Besuch und blieben, bis der Hunger sie um die Mittagszeit ins Dorf zurücktrieb. An diesem Morgen waren die Männer von Tanah Putih mit den beiden Häuptlingen Bit und Abing Djalong bereits vor Sonnenaufgang, also vor dem Erwachen der Vögel, aufgebrochen, um von diesen keine schlechten Vorzeichen zu erhalten. Sie liessen sich vorübergehend in unserer Nähe nieder und berieten dort mit dem erfahrenen Piat Lawei, wie sie die Hütte der Männer aus Long Nawang, ohne böse Omina zu riskieren, erreichen könnten. Bei mir waren sie vorläufig sicher, denn meine Trägerinnen hatten unterwegs für mich ein günstiges jo̱h gefunden. Als mein Hund Bruno abends fortlief, wahrscheinlich ins Dorf zurück, boten sich sogleich einige junge Malaien an, ihn zu holen, doch wollten sie erst am folgenden Morgen zurückkommen, was ich ihnen auch erlaubte.
Am 6. November gingen die Kĕnja etwas höher am Fluss hinauf, um ihre Hütte zu bauen und von dort aus ein Zeichen zu finden, das ihnen in die Hütte der Männer aus Long Nawang einzutreten erlaubte.
An diesem Abend war unser zweiter Hund Putih ebenfalls ins Dorf zurückgelaufen und wiederum baten mich viele Malaien, ihn holen und die Nacht im Hause ihrer se̥bilăh zubringen zu dürfen. Ich gab nur wenigen hierzu die Erlaubnis, um nicht mit zu kleinem Personal zurückzubleiben, und weil ich fürchtete, die Malaien könnten zum Schluss noch Unruhe in Tanah Putih stiften. Etwas später bemerkte ich jedoch, dass nicht nur der Hund, sondern fast alle jungen Malaien weggelaufen waren und diese Nacht nicht zurückkehrten.
Um grösserem Ungehorsam vorzubeugen, bestrafte ich die Schuldigen mit einer Busse von 10 Gulden pro Mann und dem besten von ihnen, Saïd, nahm ich das Gewehr ab, das er trug, und übergab es einem der älteren Malaien, um ihn so von der Schwere seines Vergehens zu überzeugen. Die Strafe war hart, aber mein Personal war nicht zuverlässig genug, um ihm in dieser Umgebung ungebundene Freiheit gewähren zu können. Die Männer konnten sich übrigens nicht über Einsamkeit beklagen, denn morgens kamen eine Menge junger Mädchen ihre Freunde im Lager aufsuchen, ausserdem stellten sich viele ältere Männer, Frauen und Kinder von den Reisfeldern aus der Umgegend ein und gingen erst abends wieder fort. Ein kleiner Junge brachte mir einen grossen Bambus voll burăk, süssen gegohrenen Reis, den ihm [431] Ungan, seine 19 jährige Schwester, die ich nach einer Hüftgelenkentzündung wieder zum Gehen gebracht hatte, für mich mitgegeben, da sie selbst den weiten Weg zu mir noch nicht zurücklegen konnte. Etwas Perlen hatte ich glücklicherweise noch gespart, so dass unser Lager den Kindern noch besonders anziehend vorkam; sie zwangen auch stets einige ältere Leute als Begleitung zum Mitgehen. Dank der Freundlichkeit der Besucher genossen wir auch noch hier in der Wildnis von den Leckerbissen, welche ein Kĕnjadorf produziert.
Der Kajan stand an diesem Tage infolge eines heftigen Ungewitters, das am Abend zuvor gewütet hatte, sehr hoch, das tröstete uns über den Aufenthalt, denn die Kĕnja hätten uns an diesem Tage, durch ihre Vogelschau aufgehalten, doch nicht weiter bringen können. Unangenehmer war es, dass wegen des Hochwassers keine Fische gefangen wurden und wir den Hauptbestandteil unserer Mahlzeiten missten.
Für den folgenden Tag war abgemacht worden, dass die Kĕnja uns in ihre Hütte abholen sollten, wo sie bereits zwei Nächte verbracht, aber doch wenigstens ein gutes Vorzeichen gefunden hatten. In Tanah Putih wusste man von unserer Abreise, aber trotzdem kam früh morgens noch ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter, mich um etwas Perlen zu bitten, und etwas später Apui, der kleine Bruder meiner Patientin Ungan, der mir zum Abschied noch einen zweiten dicken Bambus mit burăk für die Reise brachte.
Gegen 10 Uhr kamen die Kĕnja herunter, um uns hinauf zu bringen. Die Uma-Tow von Long Nawang ruderten uns aufwärts, während Bit mit den Leuten von Tanah Putih zum Dorfe weiterging, um ihren Reis für die Reise abzuholen. Sie wagten jedoch nicht, die Niederlassung zu betreten, weil ein Mann dort im Sterben lag und sie durch dessen Tod zurückgehalten zu werden fürchteten.
Da man mich nur ein Stück weit den Fluss aufwärts gebracht hatte und jetzt ein neuer Aufenthalt drohte, beschloss ich, die Malaien mit so viel Gepäck, als sie mitnehmen konnten, voraus zu senden. Sie machten sich am anderen Morgen in Gesellschaft der Kĕnja auf, die ihren Reis voraustragen wollten, doch kehrten diese zurück, nachdem sie die schlechten Prophezeiungen eines Vogels vernommen hatten. Auch am anderen Tage, dem 10 Nov., sahen sie morgens bei ihrem erneuten Versuch, mit ihrem Reis den Fluss hinaufzufahren, ein schlechtes Vorzeichen, aber ich drang darauf, dass sie wenigstens mich und mein [432] Gepäck an diesem Tage weiter hinauf brachten, ihren Reis konnten sie dann später hinaufschaffen. Glücklicherweise gingen sie hierauf ein unter Leitung von Ibau Anjè und den Männern von Long Nawang, die bereits alle ihre guten Vögel gefunden hatten. Sie brachten uns mit Hab und Gut bis oberhalb des Batu Plakau und zu meiner Verwunderung transportierten sie auch ihren Reis bis unterhalb dieser Wasserfälle, obgleich sie selbst in der Hütte weiter unten am Fluss übernachteten. Sie schleppten auch noch ein Boot hinauf, in dem Ibau Anjè und Lalau weiter fahren sollten, um Kwing mit den Seinen von unserer Ankunft zu benachrichtigen. Sie kehrten jedoch an diesem Tage nicht wieder zu uns zurück, augenscheinlich hatten sie die Kajan nicht mehr bei Long Danum gefunden, wo wir sie noch gelagert glaubten.
In der Frühe am folgenden Morgen begannen die Kĕnja ihren Reis den Wasserfällen entlang hinaufzutragen, wobei einige von ihnen 4 Mal den Weg zurücklegten. Das jo̱h war wieder ungünstig gewesen, daher waren die Häuptlinge an der Stelle, wo sie es bemerkt hatten, einige Landzungen weiter unterhalb des Landungsplatzes bei Batu Plakau, zurückgeblieben. Man beabsichtigte jedoch am anderen Tag die Böte über die Fälle zu ziehen.
Diejenigen, die bereits früher ein gutes Vorzeichen gefunden hatten, stiessen sich an diesem Tage nicht an dem Misserfolg Bits und seiner Leute, sondern zogen mit ihren Böten bis oberhalb der Wasserfälle, wo sie sich bei mir lagerten.
Unter all diesem Warten auf Vögel und Rehe hatten wir reichlich Gelegenheit, unsere Umgebung zu studieren, aber unter dem Eindruck der Heimreise nach der sehr langen Abwesenheit und des langen Zögerns der Kĕnja wurde an ernster Arbeit nicht mehr viel geleistet. Demmeni machte nur noch eine Aufnahme von dem merkwürdigen Bootsweg und ich suchte einen Einblick in die Formation des Batu Plakau zu gewinnen, von dem ich mehrere Gesteinsproben mitnahm. Abends kehrten Lalau und Ibau Anjè mit dem Bericht zurück, Kwing und sein Gefolge hätten bereits das Lager am Long Lāja bezogen, der Häuptling und die meisten seiner Leute befänden sich wohl, Bang Awan wäre nochmals bei den Uma-Bom Reis holen gegangen und die Kajan wollten mich am anderen Tage abholen, da sie mit Ungeduld auf das Heimkommen warteten.
Am 12. November kamen in der Tat zwei Böte mit den Kĕnja [433] aus Tanah Putiti zu uns herauf, aber Bit, der dabei war, sagte, er müsse noch dableiben und auf seinen Vogel warten, der vor ihm quer über den Fluss geflogen war. Später hörte ich, dass er auch einen schweigenden te̥olao̱, (kidjang) gesehen hatte, so dass er ernstlich daran dachte, nach so vielen bösen Omina endgültig heimzukehren. Ich erklärte ihm jedoch, unmöglich länger auf ihn warten zu können, weil unser Reisvorrat bereits so weit geschmolzen war, dass er für unser grosses Personal kaum noch genügte. Da auch die Kĕnja von Long Nawang aus diesem Grunde sehr ungeduldig geworden waren, äusserte ich die Absicht, mit diesen und den Kajan allein die Reise weiter fortsetzen zu wollen. Ibau Anjè war im Zwiespalt: er hatte früher unter guten Vorzeichen die Hütte der Long Nawang erreicht, aber jetzt befand sich sein Gepäck noch hinter der Stelle, wo sich das schlechte jo̱h gezeigt hatte, so dass er eigentlich umkehren musste. Mit Hilfe der Kajan, die in der Tat eingetroffen waren, brachte man mein langes Boot noch an diesem Abend über die Wasserfälle. Es befand sich jetzt eine genügende Anzahl Böte über den Fällen, um weiterfahren zu können, und als am anderen Morgen auch Bang Awan von den Uma-Bom eintraf, luden wir bis 10 Uhr morgens alles Gepäck in die Fahrzeuge und fuhren den Fluss weiter hinauf bis 3 Uhr mittags, wo wir Hütten der Kajan fanden, die nur einer Bedeckung mit Segeltuch bedurften, um uns noch vor Einbruch der Nacht ein Asyl gewähren zu können. Wir waren durch sehr flaches Land gefahren, an dessen Ufern nur hie und da stark verwittertes Gestein blosslag, das regelmässige dünne Schiefer zeigte, mit einem Fallen von 60°—90° nach Süden und einem Streichen von 225°—242°. Bei dem niedrigen Wasserstande trafen wir nur wenige schwache Stromschnellen, so dass der Fluss hier einen ganz anderen Charakter als unterhalb Batu Plakau trug, wo der Fall sehr stark war.
Bang Awan und Anjang Njahu hielten es für notwendig, nachts bei uns zu schlafen, um uns nicht allein unter den Kĕnja zu lassen, eine durchaus überflüssige Massregel. Wir bemerkten noch an diesem Abend, wie die Kĕnja die wenigen Fische, die sie gefangen hatten, uns zu unserer Abendmahlzeit gaben, während die Kajan nur von ihrem Überfluss mitzuteilen pflegten. Dass sie ihren Egoismus selbst empfanden, bewiesen sie dadurch, dass sie über die geschenkten Fische und die Kĕnja selbst gehässige Bemerkungen zu machen anfingen. Ich erfuhr erst an diesem Abend, dass bei den Kajan, während sie bei [434] Long Danum lagerten, ein Mann gestorben war. Seinen Namen wollte man mir nicht gern nennen, da ich ihnen vorhergesagt hatte, dass der Mann sterben würde, falls sie ihn mit in den Wald nähmen, als Kwing Irang aus Tanah Putih entfloh. Auch dieser Mann litt damals schwer am Fieber, das etwas abzunehmen begann, als man ihn meiner Behandlung entzog. Merkwürdigerweise wagte Anjang Njahu zuzugeben, dass ihr Landsmann durch ihre eigene Schuld gestorben war.
Der Wunsch, rasch vorwärts zu kommen, der alle beseelte, äusserte sich darin, dass unser Geleite anderen Tags bereits vor Sonnenaufgang gegessen hatte, dass wir unser Frühstück für später mit ins Boot nahmen und die Flotte sich bereits um 6 Uhr in Bewegung setzte. In ruhiger Fahrt ging es den Kajan aufwärts, bis wir gegen Mittag bei Long Lāja ankamen, wo wir im Kajanlager alles in Ordnung fanden. Man schien zu fürchten, dass ich über ihre Flucht, den Tod des Mannes und ihr eigenmächtiges Vorausfahren etwas bemerken würde, aber ich war zu froh, schon so weit gefördert zu sein und Kwing Irang gesund anzutreffen, und schwieg daher. Wie ich im Lauf des Tages merkte, hatte der Häuptling alle Mühe gehabt, seine Leute davon abzuhalten, schnurstracks zum Mahakam weiterzuziehen und nicht auf mich zu warten, unter dem Vorwande, dass ich die Kĕnja doch nicht schon nach zwei Monaten verlassen würde. Kwing hatte grösseres Vertrauen bewiesen und war nun sehr froh, dass ich mich an die Vereinbarung gehalten hatte. Abends langten Bit und Ibau Anjè in unserem Lager an; sie wollten trotz der schlechten Vorzeichen die Reise doch wagen. Auch diese beiden fürchteten, dass ich über die mannigfachen Hindernisse, die sie mir in der letzten Zeit in den Weg gelegt hatten, zürnte; so erklärte ich ihnen am anderen Morgen ausdrücklich, dass von einem Zürnen nicht die Rede sei, weil ich mich sehr gut in ihre Schwierigkeiten hineinversetzen könne. Die beiden Häuptlinge hatten nicht gewagt, auch ihre Untergebenen trotz der schlechten Vorzeichen mit auf die Reise zu nehmen, doch hatten sie diese nur mit Mühe zu einer Rückkehr nach Tanah Putih bewegen können. Sie selbst fassten jetzt den Zug als einen Kriegszug auf, bei dem sich die Kĕnja nötigenfalls nicht an die Vorzeichen zu halten brauchten.
Am 15. Nov. holten Kajan und Kĕnja alles was an Gepäck und Reis beim Batu Plakau zurückgeblieben war, in einem Tag herauf, während unsere Malaien ihre Lasten den Lāja hinauf bis auf die Wasserscheide [435] trugen. Mit Kwing und einigen anderen verbrachten wir einen ruhigen Tag im Lager, wo Bang Awan uns abends mit einem Wildschwein, das er erlegt hatte, ein gutes Mahl besorgte.
Unsere Kajan hatten augenscheinlich von den Kĕnja im gegenseitigen Hilfeleisten etwas gelernt, denn zu meinem Erstaunen halfen sie Bit und Ibau auch noch am zweiten Tag ihren Reis von unten abzuholen; vielleicht taten sie dies auch mit Rücksicht auf unseren sehr kleinen Reisvorrat. Da auch die von Long Nawang in einem Boote mitfuhren, liess die Eintracht zwischen den verschiedenen Teilen meines Personals nicht viel zu wünschen übrig. Mit dem Rest der Kajan und Kĕnja und den Malaien, die alle unser Gepäck tragen mussten, verliessen wir nun den Kajan und zogen den Lāja aufwärts. Gegen Mittag erreichten wir bereits die Wasserscheide, ngālăng hăng, auf der ich die Zeit, die während des Gepäcktransportes für uns übrig blieb, zu einer übersichtlichen Aufnahme des Landes verwenden wollte. Wir zogen daher nicht weiter, sondern liessen unsere Männer schnell ein Lager aufschlagen.
Ich hatte jetzt zur Untersuchung des im Lāja blossliegenden Gesteins mehr Musse als auf der Hinreise. Es bestand im allgemeinen aus Schiefern, doch waren diese so verwittert, dass ihre Art nicht mehr festzustellen war. Die Lagen strichen hier, wie auch im Kajan, von Ost nach West, in derselben Richtung wie die Wasserscheide. Überdies zeigten sie regelmässig einen Fall nach Süden. Mit den dünnen Schiefern wechselten bis 1 dm dicke Schichten, von mehr sandigem Aussehen, ebenfalls stark verwittert. Im allgemeinen weist die Art des Vorkommens des Gesteins in dem von uns durchzogenen Gebiet darauf, dass die Wasserscheide zwischen dem Mahakam- und Kajangebiet in diesem Teile in der gleichen Richtung verläuft, wie die Gesteinslagen und dass diese alle unter sehr grossen, aber sehr verschiedenen Winkeln nach Süden abfallen. Hiermit steht vielleicht in Zusammenhang, dass, während das wasserscheidende Gebirge sich nach Süden in zahlreichen, gleichlaufenden Rücken senkt, dies im Norden nicht der Fall ist. Vom Kajangebiet, also von Norden, sieht das Wasserscheidegebirge wie eine hohe, steil ansteigende Wand aus, und einige Teile, wie der Tĕlujön, wo der Kĕdjin entspringt, gleichen einem Hochplateau, das steil nach Norden abfällt. Die Kĕnja nennen es daher auch Lasan (Fläche).
Noch am gleichen Tage suchte ich von dem Gipfel eines benachbarten, [436] südlichen Nebenrückens aus eine Aussicht zu gewinnen oder festzustellen, wie viel ausgehauen werden musste, um diese möglich zu machen. Das Resultat war nicht ermutigend, denn wir standen auch auf dem höchsten Punkt in hohem Walde und das Gelände erwies sich als so flach, dass an ein schnelles Abholzen dieses Punktes nicht zu denken war. Der daneben liegende, mehr östliche Rücken, über den der Weg zum Mĕsĕai führte, versprach nur nach einer sehr gründlichen Abholzung eine Aussicht nach Süden, und auch dann noch blieb es fraglich, ob die vielen zum Oga hinablaufenden Rücken den Ausblick nicht zu sehr beeinträchtigen würden. Daher beschloss ich am folgenden Tage, einen Teil der Männer im Gipfel eines passenden Baumes einen Aussichtsposten bauen zu lassen, während der übrige das Gepäck weiter zum Mĕsĕai beförderte und dort blieb, um die Böte in Ordnung zu bringen und nötigenfalls unsere Hütten auszubessern. Einen Teil der Träger, vor allem die Malaien, liess ich jedoch wiederkommen, damit nicht zu viel Gepäck zurückblieb. Sie stellten sich auch abends wieder im Lager ein, aber äusserst ermüdet.
Gegen Sonnenuntergang lag eine prächtig helle Atmosphäre über der Landschaft, die mich lebhaft bedauern liess, von dieser seltenen Gelegenheit keinen Gebrauch machen zu können, weil der Beobachtungsposten noch nicht vollendet war. Der hierfür ausgesuchte Baum stand auf dem höchsten Punkt des Rückens und bot die Möglichkeit, in 16 m Höhe eine Plattform zwischen seinen Ästen zu bauen, nachdem die grössten entfernt worden waren.
Der Baum stand etwas geneigt über einem sehr tiefen Abgrund; da sein schwerer Gipfel fortgenommen war, konnte er an Stelle desselben sehr gut einige Menschen tragen, nur mussten diese das unangenehme Gefühl überwinden, hoch in der Luft über der Tiefe zu schweben. Ein geeigneterer Baum war jedoch nicht zu finden, ausserdem bot dieser noch den Vorteil, dass zwei kleine Bäumchen, die sich an seinen Stamm lehnten, sich als Seitenteile einer Leiter eigneten, an der nur einige Sprossen befestigt zu werden brauchten, um den Baum bis auf ¾ seiner Höhe besteigen zu können. Weiter oben mussten wegen einer unbequemen Drehung des Stammes einige kleine Leitern schräg über einander angebracht werden, was uns nicht akrobatisch veranlagten und ausgerüsteten Europäern die Besteigung des Aussichtspunktes etwas erschwerte.
Das Bauwerk kam mit Hilfe einiger Kĕnja und Malaien gut zustande, [437] und obgleich die Besteigung desselben einige Selbstbeherrschung verlangte, war die Aussicht doch in hohem Masse genussreich, besonders nach dem langen Aufenthalt unten im Walde, wo man sich auch in dem interessantesten Gebiet mit der nächsten Umgebung zufrieden stellen muss. Der Ausblick war nach verschiedenen Richtungen grossartig, hauptsächlich zu beiden Seiten über die Wasserscheide; nach Süden blieb der Blick jedoch, auch nachdem die wichtigsten der benachbarten Bäume gefällt worden waren, beschränkt, weil sich nicht nur im Osten ein hoher und vor allem langer Nebenrücken nach Süden hinzog, sondern auch im Westen ein noch höherer und längerer erhob. Nach Aussage der Kĕnja verläuft dieser Rücken zwischen dem Tĕmha, der östlich, und dem Oga, der westlich von ihm entspringt. Der Batu Pusing, auf dem der Oga seinen Ursprung nehmen muss, war denn auch mit seinen beiden kubusförmigen Gipfeln in nicht zu grossem Abstand im Westen zu sehen. Diese beiden Rücken verschlossen die Aussicht nach Süd-Westen und Süd-Osten und nur im Süden durften wir hoffen, abends einige Punkte anpeilen zu können. Wir sahen auch in der Tat abends den Batu Ajow und den Batu Lĕsong, aber in so grossem Abstand, dass ein Anpeilen von zwei Punkten auf ihm wertlos gewesen wäre. Unser Versuch, die Wasserscheide hier topographisch festzusetzen durch eine Aufnahme im Mahakamgebiete mittelst direkter Peilung scheiterte also. Leichter war es eine Übersicht über das Gebirge der Wasserscheide nach Osten und Westen zu gewinnen. Nach Osten traf der Blick ein 1500–1600 m hohes Bergmassiv, das sich zwar in nördlichen und südlichen Rücken fortsetzte, aber doch mehr den Eindruck eines selbständigen Hochlandes machte. Dies war der Batu Okang, auf dem nach Westen der Boh entspringt, nach Norden der kleine Kajan oder Kajan Ok und, wie die Kĕnja behaupten, der Tawang nach Süd-Osten.
In westlicher Richtung erhoben sich im Gebiet, wo der Kajan entspringt, mehrere isolierte Gipfel und hinter diesen lag der schon genannte Batu Pusing, der durch die eigentümliche Form seiner Gipfel, die zwei Kuben bilden, von allen Seiten leicht erkennbar ist. Da wir uns in relativ kleiner Höhe befanden, blieb der dahinter liegende Teil der Wasserscheide mit dem Batu Tibang unserem Auge verborgen. Wohin der Blick auch fiel, traf er einen ununterbrochenen Urwald; kein einziger Felsen trat aus der finsteren, dunkelgrünen Masse hervor, die nur durch die leicht gewölbte Oberfläche der höchsten [438] Baumgipfel und die Verschiedenheit der grünen Tinten einige Abwechslung bot. Mit angstvollem Interesse sahen die Kajan und Kĕnja aus, ob nicht irgendwo ein menschliches Zeichen zu sehen war, aber selbst kein Rauchwölkchen unterbrach die feierliche Ruhe der Umgebung.
Von hier aus gesehen erschien auch das ganze Land von Apu Kajan als ein nur mit Hochwald bedecktes Gebirge, über welches man eine gute Übersicht genoss. Hauptsächlich trat das Stromgebiet des Nawang mit dem dahinter liegenden hohen Gebirge in Form einer Pyramide mit sehr breiter Basis gut hervor; desgleichen verschiedene andere Gipfel, die wir von Tanah Putih aus gesehen hatten.
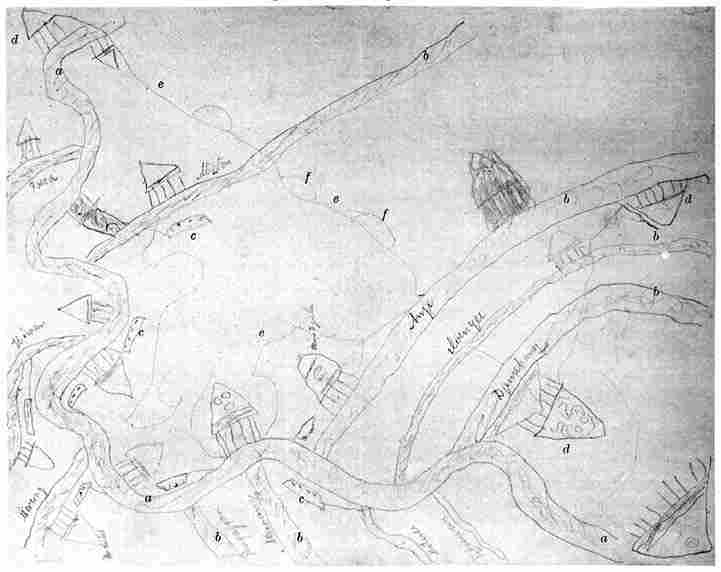
Karte des Kĕdjin, gezeichnet von einem Kĕnja.
Des Abends langten bei uns noch einige Männer aus Long Nawang an und brachten uns allerhand Neuigkeiten von den Kĕnja. Am meisten interessierte es uns, dass Ibau Anjè mit einigen Leuten unterwegs war, infolge seiner schlechten Vorzeichen aber die Mündung des Lāja noch nicht erreicht hatte. Ferner war der Häuptling der Uma-Kulit, der meinen Brief an den Radja nach Long Balaga, dem ersten Posten von Sĕrawak, gebracht hatte, von dort mit dem Bericht zurückgekehrt, der dortige Befehlshaber habe nach Empfang meines Schreibens gesagt, dass jetzt, wo der “Tuwan Dokter” in Apu Kajan sich befinde, der Radja dort nichts mehr zu schaffen haben werde, also eine zweite für die Kĕnja sehr beruhigende Nachricht. Zu den minder günstigen Berichten gehörte, dass die Punan-Lisum in einem Nebenfluss des Batang-Rèdjang die Besatzung zweier Böte der Batang-Lupar ermordet hatten und darauf mit Weibern und Kindern ins Kĕdjingebiet geflohen waren. Wohin, das wusste oder sagte man nicht.
Am 19. Nov. sassen wir des Morgens völlig in Nebel gehüllt und mussten lange warten, bis er sich verzog, auch versprachen die Peilungen sehr wenig Nutzen, so dass ich mit den neuangekommenen Uma-Tow aus Long Nawang, die auch noch tragen helfen konnten, weiter nach dem Mĕsĕai zu ziehen beschloss. Da ich den Landweg noch mit Handbussole und Uhr aufnahm, dauerte mein Abstieg zu unserem Lager am Mĕsĕai etwas länger, etwa 4 Stunden. Die Mannschaft begann sogleich die Böte in Ordnung zu bringen; die zurückgelassenen Sachen fanden wir unbeschädigt wieder und auch an unseren Böten hatte man sich nicht vergriffen, nur war ein Baum umgestürzt und hatte dabei ein Boot zerschmettert. Doris, der mit dem ersten Vortrupp sogleich bis hierher durchmarschiert war, zeigte mir triumphierend eine Bang-e̱-u, ein stahlblaues Huhn mit ganz weissem Schwanz, [439] das wir auf dieser Reise noch nicht hatten fangen können. Das Tier war von der gegenüberliegenden senkrechten Uferwand in den Fluss gestürzt und, während es durchnässt das Ufer hinaufzulaufen versuchte, von unserem Hunde Putih gepackt worden. Die leuchtende Schönheit dieses Bewohners unserer finsteren Umgebung wirkte auf alle sehr ermunternd, und selbst der gleichgültige Doris, der wie wir alle nach dem Ende der Reise schmachtete, machte sich doch mit Eifer an die Präparation des Balgs, obgleich das Trocknen sehr viele Schwierigkeiten verhiess.
Bereits bei der Mahlzeit merkten wir, dass wir uns wieder im fischreichen Mahakamgebiet befanden, denn die Kĕnja brachten uns einige schöne Exemplare. Sie hatten ihre neuen Böte beinahe ganz fertig gestellt und waren die letzten zwei Tage von den Kajan bei der Arbeit gut unterstützt worden, was ich von diesen nur auf den eigenen Vorteil bedachten Leuten kaum erwartet hatte.
Den 20. Nov. stellten sich des Morgens früh 35 Mann der Long-Nawang, die Guttapercha gesucht hatten, aus dem Walde bei uns ein und boten mir einige schöne Stücke als Willkommgruss an. Ich suchte jedoch nur ein Stück als Muster aus und gab ihnen den Rest zurück, damit sie ihn am Mahakam verkauften. Da sie uns aber durchaus eine Freude bereiten wollten, zogen sie wieder in den Wald und stellten einige Bretter als Unterlagen für unsere Matratzen her, wie ihre Häuptlinge sie zum Schlafen benützen. Abends brachte Bang Awan ein Schwein von der Jagd heim und am anderen Tage glückte es Abdul, den ich, um einige seltene Pflanzen zu sammeln, den Berg hinaufgeschickt hatte, ein zweites Schwein zu erlegen. Zu ihrer grossen Freude gab ich den Kĕnja die Vorderhälfte der Tiere und liess das übrige Fleisch als Reisevorrat für uns räuchern und das Fett als Bratspeck auskochen, weil das Kokosnussöl, das wir hier zurückliessen, ranzig geworden war.
Die Kajan fühlten sich augenscheinlich in einem Kreise, in dem man einander so freigebig aushalf, beschämt, wenigstens zog Kwing mit den Seinen nach der Mündung des Mĕsĕai voraus, um mein grosses Boot, das wir dort im Walde verborgen hatten, zu Wasser zu lassen und nötigenfalls auszubessern.
Den 22. sandte ich Dĕlahit, Lalau und einen dritten Malaien, Tagap, aus, um nachzuforschen, wo Ibau und Bit mit ihrem jo̱h geblieben waren, ob sie sich auf den Heimweg gemacht hatten oder [440] langsam herauf zogen, da die Kĕnja mit ihren Böten zur Abfahrt beinahe fertig waren. Taman Tanjit, der Häuptling der Männer von Long Nawang, bereitete sich auch darauf vor, den grossen Geist, der in diesem Gebiet zwischen Mahakam und Kajan hauste, von seinem geplanten Zug mit uns den Fluss abwärts zu benachrichtigen. Der Geist hiess pe̥laki und alle, die von Apu Kajan aus hier vorüber reisten, riefen ihn an und opferten ihm. Auch Taman Tanjit spendete ihm am folgenden Tage mit den Seinen ein Opfer, wonach er sich zur Abfahrt bereit erklärte.
Abends kam auch Dĕlahit mit einem Kĕnja zurück und meldete, dass sie Bit und Ibau auf dem Lāja begegnet wären, und dass diese uns mit 8 der ältesten Männer auf Befehl Bui Djalongs trotz ihrer schlechten jo̱h folgen mussten. Sie führten jedoch so viel Reis und anderes Gepäck mit, dass sie nur langsam über Land vorwärts kamen und daher um Hilfskräfte baten. Lalau und Tagap waren bei ihnen geblieben. Da die Kĕnja, nachdem sie bereits mit dem Geist pe̥laki gesprochen hatten, nicht mehr über die Wasserscheide zurück durften, sandte ich den Zurückgebliebenen 9 Malaien, die sich hierzu voller Eifer bereit erklärten. Sie mussten am 28. jedoch bis über die ngālăng hāng zurückgehen, bis sie der Gesellschaft begegneten, daher langten sie mit dieser erst abends bei uns an. Bit und Ibau boten uns bei ihrer Ankunft von neuem ein Geschenk an, zwei grosse Packen Reis, die uns sehr zu statten kamen, da das viele Warten auf allerlei Umstände und Menschen meinen Vorrat beinahe erschöpft hatte.
Das Wasser stand am 25. infolge vieler Regengüsse eigentlich zu hoch, doch unternahmen wir trotzdem die Talfahrt auf dem Mĕsĕai. Ich hatte die Kajan hiervon über Land benachrichtigen lassen, daher erwarteten sie uns alle oberhalb des Gesteinschaos an der Mündung, über welches die Böte nur mit vieler Mühe zu bringen waren. Zum Glück half der hohe Wasserstand, doch erforderte mein langes Boot trotzdem noch die Hilfe des ganzen Personals. Im Mĕsĕai bestand das Gestein, wie nördlich von der Wasserscheide, aus Schiefem, die nach West-Ost strichen und nach Süden fielen. Nur bei der Mündung lag dazwischen eine mehr als 50 m dicke Sandsteinschicht mit demselben Streichen und Fallen. Die Blöcke dieser Schicht versperrten den Fluss und verursachten die Wasserfälle.
Unterhalb der Mĕsĕaimündung lagen die Böte der Kajan bereits fertig gepackt, daher ging es sogleich weiter. Auch Bit und Ibau [441] zogen gleich mit, da wir sie mit den Ihren in mehrere Böte hatten verteilen können. Infolge des sehr hohen Wasserstandes im Tĕmha waren sehr viele Schnellen unsichtbar, aber das Wasser trug uns mit grosser Geschwindigkeit über sie hinweg, nur war in dem engen Fahrwasser eine besondere Aufmerksamkeit und Anstrengung des Bootsvolks erforderlich.
Um 2 Uhr gelangten wir an eine Stelle, genannt Long Sĕripa, die einzige, an der wir den Kĕnja zufolge an diesem Tage würden lagern können, und so mussten wir uns zum Aufschlagen des Lagers entschliessen. Nachts regnete es heftig und der Fluss stieg so stark, dass wir nicht weiterfahren durften und daher einen Tag liegen blieben. Gegen ½ 11 Uhr hörten wir von oben ein Geräusch und gleich darauf schossen die Böte der Männer von Long Nawang in beängstigend schneller Fahrt an uns vorüber und legten an der Flussmündung bei uns an. Die Männer waren am Tage vorher bei unserer Abreise in den Wald gegangen und hatten uns daher nicht folgen können, doch hatten sie aus Furcht, dass wir ohne sie durchfahren würden, die Fahrt trotz des Hochwassers gewagt.
Auch am 27. war der Fluss noch sehr hoch und an eine Abfahrt nicht zu denken. Die Kĕnja von Tanah Putih wollten diesen Aufenthalt zum Bau eines Bootes benützen, als sie aber zu diesem Zweck in den Wald zogen, begegneten sie einem hisit, der links von ihnen pfiff, und kehrten wieder um. Eine halbe Stunde darauf zogen sie von neuem aus und fällten einen Baum, aber bei seinem Sturz vernahmen sie wiederum ein ungünstiges Zeichen, und so liessen sie den Baum liegen und gaben den Bootsbau auf. Ich versprach ihnen zur Beruhigung meine besten Böte, mit denen sie später den Fluss wieder hinauffahren konnten.
Die Kĕnja traten hilfsbereit auch Bo Bawan und den Seinen eine grosse Menge Reis ab, da deren Vorrat erschöpft war.
Am folgenden Tag hielt der hohe Wasserstand zwar noch an, aber nicht mehr so stark als vorher und ich beschloss, die Fahrt zu riskieren, da auch Kwing dafür war. Zuerst fuhren einige Kĕnja hinunter, um einige gefährlich liegende Bäume durchzuhacken und wegzuräumen. Unterdessen hatten wir unsere Böte gepackt und fuhren unter heftigem Protest seitens Bits und Ibaus, die niedrigeres Wasser abwarten wollten, ebenfalls ab. Bald zeigte es sich, dass einiger Grund zur Besorgnis vorhanden war, denn dies war die gefährlichste Fahrt, die ich je [442] mitgemacht hatte. Das sehr heftig strömende Wasser schleuderte die Fahrzeuge bei jeder Flusswendung gegen die vorspringenden Felsblöcke, und das Boot von Taman Sulow, in das man mich gesetzt hatte, weil man es für das sicherste hielt, wurde immer wieder mit Wasser übergossen und ich bis zur Mitte des Leibs durchnässt. Des Morgens hatte niemand mich in seinem Boote haben wollen, die Kajan, weil sie das Fahrwasser nicht kannten, die Kĕnja, weil sie die Verantwortung, die der Transport meiner Person ihnen auferlegte, zu schwer fanden. Nur Taman Sulow, ein junger, forscher Kerl, hatte sich endlich bereit gezeigt, das Wagstück zu unternehmen. Nach langer Beratung wurde beschlossen, dass beim Kiham Puging, dem gefährlichsten Fall, alle Böte mit grosser Schnelligkeit auf einen bestimmten Punkt lossschiessen sollten, so dass sie sich an der Stelle, wo hohe Wellen zu beiden Seiten die niedrigen Fahrzeuge zu überschlagen drohten, nur einen Augenblick wie unter Wasserbögen befinden sollten. Mit allen Böten lief es gut ab; zwar schlug das Wasser hinein, aber infolge der grossen Geschwindigkeit der Fahrt so wenig, dass es durch Ausschöpfen entfernt werden konnte. Nur ein Kĕnjaboot, das man zur Sicherheit hinten am Steven mit einem Rotang vom Ufer aus fest hielt, verlor dadurch bei der Fahrt an Geschwindigkeit, füllte sich in einem Augenblick mit Wasser und sank. Die Mannschaft sprang sogleich ins Wasser und suchte das Boot an einer ruhigen Stelle unter Wasser gerade zu halten, damit die Ladung nicht herausfiel und verloren ging. Die vielen Böte, die hier abwarteten, wie die anderen über den Fall schiessen würden, waren sogleich zur Stelle, um zu helfen, doch glückte das Geradehalten nicht, der schwerste Teil der Ladung, Reis und Eisenwerk, glitt in den Fluss und war verloren. Die im Boot befestigten Tragkörbe mit Inhalt wurden gerettet, doch waren sie voll Wasser gelaufen. Zwei meiner Blechkoffer, die sich in diesem Boot befanden, wurden sogleich aus den Körben herausgeholt und in anderen Böten untergebracht, doch hatten auch sie stark von der Nässe gelitten.
In kurzer Zeit war das Boot von der befestigten Ladung befreit worden; die Bemannung entfernte das Wasser aus demselben durch Hin- und Herschaukeln, so dass die Ränder bald herausragten, dann wurde der Rest ausgeschöpft und das Boot war wieder fahrbar. Das nasse Gepäck wurde wieder hineingeladen und dann ging es fort in schneller Fahrt. Es war ein aufregender Anblick, wie die Böte durch [443] die hoch aufgestauten Wellen schossen, getrieben durch die beinahe verzweifelten Ruderschläge der Bemannung. Als wir selbst hindurch mussten, sah ich nur einen Augenblick zu beiden Seiten eine grosse aufbrausende Schaummasse gegen hohe schwarze Felsen schlagen und dann lag alles hinter uns und wir wandten alle Aufmerksamkeit darauf, weiter unten nicht voll Wasser zu laufen oder an den Uferfelsen zerschmettert zu werden. Etwas weiter, wo der Fluss sich durch einen Spalt zwängte, waren kurz vorher einige Bäume hineingestürzt und mussten weggeräumt werden. Diese Arbeit hielt uns etwas auf, aber um 2 Uhr legten wir doch bei unserem früheren Landungsplatz Long Krĕngo an, wo die Kĕnja ihre nassen Körbe und Doris seine Koffer mit Vogelbälgen untersuchte. Zum Glück enthielten diese Kisten keine Gesteine, sonst wären sie unfehlbar gesunken. Es waren trotz des Liegens im Wasser nur wenige Tropfen eingedrungen, weil wir alle Ritzen mit pakal, Harzpulver und Petroleum, verklebt hatten. Nur einige Papiere um die Vogelbälge mussten erneuert werden.
Obwohl es abends regnete, war das Wasser am anderen Morgen doch etwas gefallen. Die Kĕnja wollten zwar auch jetzt lieber nicht abfahren, doch entschlossen sie sich schliesslich dazu, aus Furcht, dass wir in diesem engen Flüsschen, in dem jeder Regenfall oben ein hohes Steigen des Wassers bewirkte, völlig abgeschlossen würden. Anfangs wiederholte sich die Fahrt vom vorigen Tage; ständig hohe Wellen und kleine Wasserfälle, die bei der sehr schnellen Hinabfahrt, besonders bei den zahlreichen Windungen, grosse Achtsamkeit erforderten; auch verursachten die vielen in diesen Bergspalt gestürzten Bäume immer wieder einen Aufenthalt. Beim Kiham Tandjow widersetzte ich mich anfangs, dass die Kajan ihn mit ihren Böten hinabfuhren (lawu), da ich ein ernstliches Unglück fürchtete, aber die geschulte Mannschaft sah sich die hohen, langen Stromschnellen mit einigen Wasserfällen darin erst gut an und fuhr dann unerschrocken über sie hinweg. Die Kĕnja wagten ihnen das Stück nicht nachzutun; sie bewiesen übrigens auf der ganzen Reise, dass sie den Kajan zu Wasser nicht so überlegen waren wie zu Land, was wohl damit zusammenhängt, dass ihre hoch gelegene Heimat mit den kleinen Flüssen ihnen weniger Gelegenheit bietet, sich mit dem Wasser vertraut zu machen als den Kajan, die sich beinahe ausschliesslich zu Wasser bewegen. Diese hatten denn auch allen Grund, bei der Ankunft jedes ihrer Böte, das den letzten Fall hinunterschoss, in lautes Jauchzen auszubrechen. [444]
Weiter unten wurde der Fluss etwas breiter und um 12 Uhr fuhren wir in den Oga ein, wo wir uns nach Kĕnjasitte auf einer Schuttbank bei einem Mahl von der ausgestandenen Angst und Ermüdung erholten. In diesem breiteren Tal genossen wir ungemein das grössere Stück Himmel, das zu sehen war, und dessen strahlende Sonne unsere durchnässten und steif gewordenen Männer erwärmte. Der Oga war jetzt auch viel höher als bei unserer Hinfahrt und das Wasser strömte schnell und sehr wild hinunter, aber jetzt war die Gefahr, gegen felsige Ufer oder gestützte Bäume geschleudert zu werden, nur gering. Bei der Abfahrt ging Bang Awan mit seinem Boot voraus, um Wildschweine zu schiessen, falls sich welche am Ufer zeigten. Da unsere Mannschaft die Böte mehr in der richtigen Lage zu halten als fortzubewegen hatte, machten sie nur wenig Geräusch, das überdies noch durch das Toben des Flusses gedämpft wurde. Wir hörten denn auch sehr bald in der Ferne einige Schüsse knallen und freuten uns auf den Schweinsbraten zur Abendmahlzeit, doch bekamen wir nur das enttäuschte Gesicht des Schützen zu sehen, der zwei grosse fette Schweine auf kurzen Abstand gefehlt hatte. Er bat mich denn auch, seinen Posten zu übernehmen, da wir sicher noch andere Wildschweine treffen würden, die durch diese Gegend zu ziehen schienen; die ganze Flotte blieb liegen, um mir einen Vorsprung zu lassen. Die Schweine schienen, wie bei Demmenis Aufenthalt bei den Wasserfällen im Mahakam, auch jetzt auf einer Wanderung in eine andere Gegend begriffen zu sein, denn nach kurzer Fahrt entdeckten meine scharfsichtigen Ruderer in der Ferne eine Truppe am Ufer. Wir befanden uns auf einem sehr bewegten Teil des Flusses, wo sich bei niedrigem Wasserstande eine grosse Stromschnelle bildete, aber trotzdem duckten sich die Ruderer auf den Boden des Bootes nieder, um mich ungehindert schiessen zu lassen und ich schaukelte aufrechtsitzend den Schweinen schnell entgegen. Diese hatten Unruhe gewittert oder sich zufällig vom Wasser in das Ufergebüsch zurückgezogen, nur ein sehr grosses altes Schwein hatte sich uns zugekehrt und starrte uns an. Obgleich mein 9 kalibriges Winchester Repetiergewehr zur Schweinejagd nicht besonders geeignet war, brachte ich es auf etwa 100 m doch ruhig an die Schulter, zielte auf den Kopf des Tieres, und liess das Boot bis etwa auf 60 m herantreiben. In einem ruhigen Augenblick drückte ich los, das neugierige Schwein fiel um und zappelte bereits mit den 4 Pfoten in der Luft, bevor wir es erreichten. Meine Ruderer jauchzten [445] aber noch nicht, sondern riefen: “djuwe, djuwe!” (noch ein Mal!) und so brachte ich mein Gewehr schnell wieder an die Schulter. Im Vorbeifahren bemerkte auch ich noch einige Schweine unter den Uferbäumen und feuerte wegen der grossen Schnelligkeit, mit der das Boot sich fortbewegte, einigermassen auf gut Glück einen Schuss ab. Zwei meiner Ruderer sprangen im nächsten Augenblick ins Wasser, schwammen ans Ufer und stürmten in das Gebüsch, aus dem der eine bald wieder mit einem blutigen Schwert hervorkam, mit dem er dem zweiten Opfer den Garaus gemacht hatte. Meine Kugel hatte das erste Schwein dicht über der Schnauze ins Gehirn getroffen, was den plötzlichen Tod des Tieres erklärte, während das zweite nur durch eine Kugel im Rückgrat am Weiterlaufen verhindert worden war. Die Freude unserer 140 Mann zählenden Reisegesellschaft über das köstliche Abendgericht war gross, nicht geringer war das Erstaunen und Entsetzen der Kĕnja über die Wirkung der zwei Schüsse meines kleinen Gewehrs.
Die Tiere wurden eilig in die Böte geladen und dann flog unsere Flotte wieder übers Wasser, das uns mit grosser Schnelligkeit an unseren Lagerplatz an der Ogamündung brachte. Die Kajan fanden ihren Reis dort in unverletztem Zustand wieder und begannen in Überfluss zu schweigen. In den letzten Tagen hatten die Kĕnja ihren ganzen Reisvorrat, der auch für die Rückreise hatte dienen sollen, mit uns geteilt, ohne dass von einem Verkauf die Rede war, nur auf mein Versprechen hin, dass ich sie am Mahakam mit neuem Reis versehen wollte. Die Kajan fanden die Handlungsweise der Kĕnja sehr dumm und vertrauensselig und lachten sie deswegen aus, doch liessen sie sich deren vorzüglichen Reis trotzdem trefflich munden.
Am anderen Morgen konnten wir nicht weiter, weil ein bestimmter Felsen an der Ogamündung nicht aus dem Wasser hervorragte, ein Beweis, dass das Wasser zu hoch stand, um den Boh mit seinen Wasserfällen ohne zu grosse Schwierigkeiten hinunterfahren zu können. Die Kajan und, trotz unserer Sehnsucht nach Hause, auch wir anderen fühlten ein lebhaftes Bedürfnis nach einem Ruhetag und einer körperlichen Stärkung durch Reis mit Schweinefleisch.
Das langsam sinkende Wasser ermöglichte am 1. Dezember eine ruhige Hinabfahrt. Der bewusste Felsblock ragte etwas über die Wasserfläche vor und prophezeite daher eine glückliche Reise. In der Tat boten sich keine besonderen Schwierigkeiten, nur mussten wir uns nach [446] überschwemmten Felsen und Wirbeln im Strom umschauen, doch sind diese beim fallenden Wasser viel ungefährlicher als bei steigendem von gleicher Höhe. Selbst die grossen Stromwirbel zwischen den roten Jaspisfelsen im Kiham Batu Blah (roter Stein) erschienen den Kajan jetzt nicht gefährlich; sie bugsierten ihre vollgeladenen Böte mit Geschick durch sie hindurch, gefolgt von den Kĕnja und Malaien. Sie rieten mir zwar, bis zum unteren Teil des Kiham Hulu über Land zu gehen, wagten aber selbst sogar die obere Hälfte dieser Fälle mit voller Ladung hinabzufahren, ein grossartiges Schauspiel, das wir von einigen sehr hohen Felsen herab genossen. Beim untersten, viel kürzeren Teil der Fälle mussten die Böte vollständig ausgeladen und leer hinuntergelassen werden. Da viele Männer vorhanden waren und nur wenig Gepäck, ging die Fahrt von hier an schnell von statten, und voller Hoffnung, an diesem Tage noch Long Dĕho zu erreichen, fuhren wir den jetzt sehr breiten und beinahe zu sonnigen Fluss hinunter. Die Mannschaft, die von meiner Büchse einen neuen Schweinsbraten erhoffte, liess mein Boot auch jetzt wieder an der Spitze der Flotte fahren. Die vor uns liegenden Ufer waren wegen der Breite des Flusses bereits auf grossen Abstand zu übersehen und bald bemerkten wir auch vor uns am rechten Ufer eine Schweineherde, die übers Wasser schwimmen wollte. Meine Ruderer liessen sogleich wieder das Boot treiben und duckten sich hinter den Bootsrändern nieder, während ich mich unbeweglich hielt. Die eine Hälfte der Truppe ging nicht ins Wasser, nur eine grosse Sau mit drei halb erwachsenen Jungen verliess den Uferwall; sobald sie etwa ⅓ des hier ungefähr 100 m breiten Flusses erreicht hatte, begann die Mannschaft mit aller Macht zu rudern, um ihr den Weg abzuschneiden. Die Tiere leisteten ihr Äusserstes, um vor uns das andere Ufer zu erreichen und bei der Aufgeregtheit meiner Ruderer und dem Schwanken des Fahrzeugs erschien mir ein erfolgreicher Schuss unmöglich. Als wir uns den Tieren näherten, krochen diese gerade das Ufer hinauf; da alle Ruderer aufsprangen, um zuerst an Land zu sein, musste ich mit grosser Vorsicht schiessen. Ich feuerte 2 Mal auf die Sau. Beim zweiten Schuss zuckte sie zusammen, verschwand aber doch noch mit den Jungen im Uferwald. Meine Kajan, die ihr folgten, erzählten bald darauf, die Sau sei sehr bald tot niedergefallen und einer von ihnen habe auch noch eines der Jungen mit dem Schwert getötet, so dass wir jetzt wieder reichlich mit Fleisch versehen waren. Etwas weiter unten schoss ich nochmals [447] auf ein Schwein, doch fiel es nicht sogleich nieder und wir hatten keine Zeit, es zu verfolgen. So gelangten wir bereits um 1 Uhr an unseren alten Lagerplatz bei der Bohmündung. Die Kajan wollten hier nochmals kochen, wir aber fuhren mit den Kĕnja weiter, um noch Long Dĕho zu erreichen, wo wir in der Tat um ½ 4 Uhr anlangten. Das letzte Stück hatte viel Zeit gekostet, weil die Männer wegen der Hitze die Böte von der Strömung hinabtreiben liessen statt zu rudern.
In Long Dĕho hatten sich die Bewohner inzwischen mit Eifer daran gemacht, die alte kubu, die man mir früher so oft zum Aufenthalt angewiesen hatte, durch eine neue zu ersetzen, wie sie sagten, um den Kontrolleur, falls er herauf kam, würdig aufzunehmen. Die Anlage des ganzen Hauses schien in der Tat auf einen derartigen Empfang berechnet zu sein, dafür sprachen die Grösse und die sorgfältige Ausarbeitung des halbfertigen Gebäudes. Wir konnten in ihm jedoch noch nicht übernachten, weil nur ein kleiner Teil gedielt war; unsere Malaien richteten daher in einem von Kahajan und anderen Waldproduktensuchern bewohnten Hause einen Raum für uns ein.
Der gute Erfolg unseres Zuges erfüllte manche Bewohner von Long Dĕho mit gemischten Gefühlen. Ibau Adjāng und Lawing begrüssten mich anfangs sehr herzlich, nachdem sie sich aber bei mir niedergesetzt hatten, verfinsterten sich ihre Gesichter mehr und mehr und sie sahen mit angstvollen und scheuen Blicken zu mir auf. Dass uns einige der angesehensten Kĕnjahäuptlinge begleiteten, war ihnen sehr unerwünscht, da sie diese jetzt nicht mehr als Bundesgenossen gegen die weiter unten lebenden Stämme, die unter unserem Schutze standen, ausspielen konnten. Ibau drückte überdies auch die ziemlich hohe Schuld, die er bei mir durch den Einkauf von Rotang gemacht hatte und nicht bezahlen konnte. Auch Bang Jok fühlte sich verpflichtet, mir seine Aufwartung zu machen, doch war er jetzt nicht mehr imstande, sein Missvergnügen wie bei früheren Gelegenheiten zu verbergen. Er war sehr bleich, wagte die Augen beinahe nicht aufzuschlagen und äusserte kaum ein Wort. Auch die Kĕnjahäuptlinge, die sich bei uns aufhielten, brachten ihn nicht zum Sprechen. Ich gab den Menschen Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, und traf die notwendigen Anordnungen zu unserer Abreise am anderen Morgen. Darauf vertiefte ich mich mit Demmeni in die Briefe und Zeitungen, die uns hier erwarteten. Unterdessen zogen einige Malaien zum Hause [448] der Uma-Wak, um mein grosses Boot zu holen, das sie dort vor unserer Abreise nach Apu Kajan an Land gezogen und unter der Wohnung festgebunden hatten. Das über 20 m lange Fahrzeug befand sich im besten Zustand und, nachdem sie die Bretter der Reeling (rambin), von denen kein einziges fehlte, mit Rotang angebunden hatten, war das Boot bereits abends wieder fahrtbereit.
Die Frauen im Hause des verstorbenen Adjāng Lĕdjü drückten ihre Freude über meine wohlbehaltene Rückkehr unverhohlen aus; sie wussten, dass ich es gut mit ihnen meinte, waren daher nicht bang und gaben sich nicht mit Politik ab. Von der grossen Menge Gepäck, die wir ihnen zur Aufbewahrung anvertraut hatten, fehlte nichts und war auch nichts beschädigt worden. Aus Furcht vor einem Brand hatten sie das Feuer auf dem Herde, sobald nicht mehr gekocht wurde, stets ausgelöscht, während sie es sonst sogar nachts fortglimmen lassen. Mit allerhand übrig gebliebenen Dingen machte ich der Familie noch eine Freude, nur die Regelung von Ibaus Schuld verursachte einige Schwierigkeiten. Er besass entweder wirklich nichts oder wollte nichts geben, so dass ich mich schliesslich mit einem alten Gewehr zufrieden stellen wollte, das Georg Müller gehört haben sollte. Obgleich das Gewehr ganz wertlos war, glaubte Ibau es gelegentlich doch für ein anderes, brauchbares austauschen zu können und war zur Abtretung desselben nur schwer zu bewegen. Am folgenden Morgen bei der Abfahrt brachte er es mir aber doch, denn er war zu anständig, um bei mir eine Schuld zu hinterlassen, die ich doch nie mehr hätte einlösen können. Das Gewehr übergab ich später dem Museum von Batavia.
Trotzdem die Dorfbewohner ihre unangenehmen Empfindungen bei unserer siegreichen Heimkehr nicht ganz verbergen konnten, liessen sie es im Verkehr mit uns an Freundlichkeit nicht fehlen.
Die Familie Bang Joks äusserte, wie früher bereits öfters, ihren praktischen Sinn, indem sie uns als Willkommen mit Zucker, Thee, Butter u.s.w. versah, Dingen, die wir bereits so lange entbehrt hatten.
Im Übrigen herrschte aber wieder Reisnot im Dorf und für unsere grosse Gesellschaft waren nicht genug Nahrungsmittel aufzutreiben; am anderen Morgen erregte uns daher allgemeine Freude, dass das Wasser nicht höher gestiegen war und uns daher eine bequeme Fahrt abwärts versprach. Unsere Reisegenossen hatten bereits sehr früh ihre eigenen Böte geladen und begannen sogleich auch die meinigen in [449] Ordnung zu bringen, so dass wir bereits um 7 Uhr reisebereit waren. Nachdem Demmeni und ich uns von der Häuptlingsfamilie verabschiedet hatten, verliessen wir die Hungerstätte und fuhren in einer langen Flotte erst an Batu Pala, dann an Ums Wak vorüber. Etwas weiter unten begegneten uns 4 Böte der Long-Glat von Long Tĕpai unter Njok Lea, denen der Kontrolleur Barth in Udju Tĕpu noch eine Post mit Briefen und Zeitungen für uns mitgegeben hatte. In unseren Böten sitzend vertieften wir uns mit dem grössten Eifer in die Briefschaften und die für uns neuesten Nachrichten aus der zivilisierten Welt.
Der Kiham Udang verursachte bei diesem Wasserstand nur geringen Aufenthalt, da man ihn mit den halbvoll geladenen Böten befahren konnte. Bereits um 3 Uhr erreichten wir Long Bagung, wo wir auf den ausgedehnten Schuttbänken des rechten Ufers kampierten und ich sogleich die Gelegenheit benützte, um beim Händler Raup zwei grosse Säcke Reis zu erstehen, die ich den Kĕnja als ersten Abschlag auf meine bei ihnen gemachte Schuld übergab. Ich versprach ihnen, sie in Long Iram mit einer grösseren Menge Reis für die Heimreise versehen zu wollen, was später auch geschah.
Am 3. Dezember fuhren wir Bang Awans wegen, der gern bei seiner jungen zweiten Frau bleiben wollte, nur bis Laham den Fluss hinunter, doch vereinbarten wir, am folgenden Morgen sehr früh aufzubrechen, um noch an diesem Tage Long Iram erreichen zu können. Die Kĕnja nahmen diese Abmachung etwas allzu genau, denn ein Teil von ihnen fuhr bereits um 2 Uhr nachts wieder ab und die K)njabemannung meines grossen Bootes brachte unsere Malaien dazu, so früh aufzubrechen, dass wir vor Sonnenaufgang bereits an Long Howong vorüberfuhren und ununterbrochen weiterrudernd in Gesellschaft der Kĕnjaböte abends Long Iram erreichten. Die Kajan mit Kwing trafen erst sehr spät ein, da sie sich auf dem heissen Fluss von der Strömung hatten treiben lassen, statt zu rudern.
Barth empfing uns mit Salutschüssen und hiess uns mit seiner ganzen Besatzung von Schutzsoldaten sehr herzlich willkommen. Man hatte ihm unsere Ankunft auf beinahe unbegreiflich schnelle Weise bereits morgens gemeldet.
Während wir die Treppe zum hohen Uferwall hinaufstiegen, fiel es uns auf, wie viel in diesem neu gegründeten Ort in den letzten Monaten zu Stande gekommen war. Diesen Teil des Mahakamufers hatte Barth für eine grössere Ansiedelung viel geeigneter erfunden, [450] als das Landstück, das wir das Jahr zuvor mit Bier hierfür ausgesucht hatten. Barth hatte sogleich damit angefangen, eine grosse Uferstrecke abholzen und provisorische Hütten für seine inländischen Soldaten und Sträflinge errichten zu lassen. Ferner war ein breiter Weg längs des Ufers angelegt worden, an welchem Barths provisorisches Haus aus Bambus und Palmblattmatten stand. Auch mit den eigentlichen Gebäuden dieses neuen Verwaltungszentrums war bereits ein Anfang gemacht worden, aber der Bau schritt nur langsam fort, weil alles Holz von Samarinda heraufgeführt werden musste.
Die Einsetzung der Verwaltung hatte ohne Schwierigkeiten stattgefunden und die äusserst unsicheren Zustände, die in der vorigen Jahreshälfte am Mittel-Mahakam geherrscht hatten, waren wie mit einem Zauberschlag verschwunden, nachdem der europäische Beamte sich hier mit seinen Bewaffneten niedergelassen hatte. Dabei hatte man bis jetzt noch nicht von den Waffen Gebrauch gemacht. Zwar blieb noch sehr viel zu verbessern, bevor sich die gegenwärtige sehr gemischte Bevölkerung wirklich regieren liess, aber der anfängliche Erfolg versprach viel für die Zukunft. Leider litten diese Pioniere der Kultur stark an Beri-Beri, die so häufig in neuen Siedelungen in Indien ausbricht.
Man hatte bereits Massregeln getroffen, um hier von regierungswegen ein Salzdepot einzurichten, in dem sich die Bewohner des Oberlaufs gegen festen, mässigen Preis mit diesem notwendigen Artikel versehen konnten. Um eine Aufsicht über den übrigen Handel ausüben zu können, hatte der Kontrolleur die Händler in Udju Tĕpu dazu gebracht, nach Long Iram überzusiedeln. Da diese Leute beinahe alle in schwimmenden Häusern lebten, liess sich der Handelsplatz leicht verlegen und während meines Aufenthaltes wurden die ersten Häuser heraufgezogen. Hieraus ging hervor, dass nicht nur die eingeborene Bevölkerung dieses Gebiets sich gern in den neuen Zustand fügte, sondern dass auch die buginesischen und bandjaresischen Händler, die bis jetzt ihren Vorteil in einem betrügerischen Handel mit den Dajak gesucht hatten, geordneten Zuständen unter europäischer Verwaltung den Vorzug gaben, wie sie es uns früher übrigens bereits versichert hatten.
Ihre Zufriedenheit mit den politischen Resultaten meiner Reise gaben die Händler dadurch zu kennen, dass sie allgemein beflaggten, als der Kontrolleur uns 2 Tage später mit seinen Böten zum Schiff [451] nach Udju Tĕpu geleitete, von wo uns der “Sri Mahakam” in Gesellschaft von etwa 20 Kajan und Kĕnja nach Samarinda bringen sollte.
Kwing Irang behauptete, auch jetzt nicht gern mit dem Sultan von Kutei in Berührung kommen zu wollen, weswegen er mich auch nicht zur Küste begleiten könne. Er kam jedoch mit allen seinen Kajan mit zum Schiff, ebenso diejenigen Kĕnja, die nicht mit uns fahren sollten. Ich musste hier also von Kwing Abschied nehmen. Zum Schluss hatte ich ihm doch sehr viel zu danken, wenn er auch durch die Eigentümlichkeiten seiner Rasse und seines Glaubens bei der Ausführung meiner Pläne viele Schwierigkeiten verursacht hatte. Obgleich ich nach beinahe 3 jähriger Reise mit einem Gefühl der Erlösung Abschied nahm, liess ich meine Reisegenossen doch mit Wehmut zurück und sehr leid tat es mir, als ich im folgenden Jahr hörte, dass Kwing einige Monate nach seiner Heimkehr einem neuen Malariaanfall erlegen war. Während unseres Zusammenseins hatte er sich als der achtungswerteste Häuptling gezeigt, dem ich begegnet war, und die Rolle, die er am Ende seines Lebens bei der Einsetzung einer niederländischen Verwaltung in Mittel-Borneo gespielt hatte, wird seinem Stamm und vielen anderen zum Segen gereichen, wie es auch seine Rechtschaffenheit und Friedensliebe für sie gewesen sind.
Anjang Njahu und einige andere Kajan begleiteten mich nach Samarinda, wo sie vorteilhafte Einkäufe zu machen hofften und von wo sie meine Abschiedsgeschenke an alle Zurückgebliebenen mitnehmen sollten. Kwing Irang wünschte sich einen meiner Stahlkoffer und einige Packen Kattun, die ich ihm auch zukommen liess.
Von den Kĕnja begleiteten mich verschiedene Häuptlinge, u.a. Bit und Ibau Anjè, die in Samarinda ihre Unterhandlungen mit dem Sultan unter Vermittlung des Assistent-Residenten zu einem Abschluss zu bringen hofften.
Die europäische Kolonie in Samarinda gab vielfache Beweise ihrer Teilnahme an dem Gelingen unserer Expedition und die Tage, die bis zur Ankunft des Schiffes nach Batavia verliefen, wurden in angenehmer Gesellschaft und mit dem Ordnen unseres Gepäcks zugebracht.
Auch von den Malaien musste ich hier Abschied nehmen; nur zwei von ihnen gebrauchten das auf der Reise verdiente Geld, um über Bandjarmasin in ihr Geburtsland am Barito zurückzukehren. Von den übrigen traten einige in Dienst bei der bewaffneten Polizei von Long Iram, andere wurden wieder in die von Samarinda aufgenommen, [452] während die meisten Malaien, die ich vom oberen Mahakam mitgenommen hatte, wieder dorthin zurückkehrten.
So fuhren nur Demmeni und ich mit Doris, Midan und Abdul in guter Stimmung und bester Gesundheit mit dem Schiff über Surabaja nach Batavia zurück, wo wir am letzten Tage des Jahres 1900 glücklich anlangten. [453]
Kapitel XVI.
Allgemeines über die körperliche und geistige Entwicklung der Dajak auf Borneo—Gründe für ihre geringe Bevölkerungsdichte: klimatische und hygienische Einflüsse, Krankheiten—Abhängigkeit des Gesundheitszustands von der Höhe des Landes—Einfluss mangelhafter Entwicklung und Kenntnis auf die ökonomischen Verhältnisse und auf die religiösen Vorstellungen—Geistige Fähigkeiten der Dajak—Charaktereigenschaften—Körperliche und geistige Überlegenheit der Kĕnja-Dajak über die Bahau-Dajak.
Weit mehr Schwierigkeiten als die Beschreibung der Sitten und Gewohnheiten eines Volksstamms oder selbst der Grundbegriffe seines Glaubens bietet einem Forscher, der daran gewöhnt ist, in einer hoch entwickelten Gesellschaft zu leben und zu arbeiten, die objektive Beurteilung des Charakters, der inneren Persönlichkeit von Menschen, die einen niedrigeren Bildungsstandpunkt einnehmen. Es genügt hier nicht, diese Menschen in ihrem täglichen Leben zu beobachten, sondern er muss zugleich imstande sein, die Motive zu beurteilen, die der soviel tieferstehende Naturgenosse für seine Handlungen aus seinem Glauben, seinen Lebensverhältnissen und seinem Charakter schöpft. Daher muss ein Forscher mit dem Glauben und den Lebensverhältnissen des primitiven Menschen völlig vertraut sein, bevor er aus dessen Tun und Lassen Schlüsse auf seine Persönlichkeit ziehen kann. Auch muss er es als eine natürliche Notwendigkeit einsehen gelernt haben, dass, weil den Stämmen von Mittel-Borneo z.B. von sich selbst und ihrer Umgebung ganz andere Begriffe eigen sind, als wir Europäer sie uns durch die fortschreitende Wissenschaft im Laufe vieler Jahrhunderte haben bilden können, sie auch völlig anders handeln müssen, als wir es in bestimmten Fällen tun würden. Dann wird es ihm auch ganz natürlich erscheinen, wenn die Dajak in ihrem festen Glauben, durch böse Geister oder feindlich gesinnte Menschen krank geworden zu sein, in Beschwörungen oder selbst in Racheakten gegen unschuldige Personen ihre Zuflucht suchen, was ein oberflächlicher Beobachter als Dummheit oder Rachsucht auffassen könnte. [454]
Auch bei einer guten Einsicht in die beherrschenden Motive bestimmter Handlungen wird es einem Europäer schwer, objektiv zu bleiben, sobald er selbst das Opfer dieser Motive wird, und eine grosse Selbstverleugnung wird besonders dann von ihm gefordert, wenn er in seinen wichtigsten wissenschaftlichen Untersuchungen fortwährend gehindert wird oder wenn diese ihm sogar unmöglich gemacht werden.
Die Art des Reisens, die ersten Begegnungen mit den scheuen Eingeborenen stellen an die Objektivität des Forschungsreisenden hohe Anforderungen und er wird denn auch viel mehr Zeit, als die meisten zur Verfügung haben, brauchen, um eine richtige Einsicht in die Verhältnisse und in die Persönlichkeit der Eingeborenen zu gewinnen; dies um so mehr, je weniger er sich in ihrer eigenen Sprache mit ihnen unterhalten kann.
Im folgenden soll nun gezeigt werden, wie auf Grund eingehenderer Kenntnisse und längerer Beobachtung sich das Bild der geistigen Konstitution der Dajak wesentlich anders gestaltet, als bei oberflächlicher und kürzerer Beobachtung. Man hat die Bahau und die anderen noch ursprünglichen dajakischen Stämme unter dem Eindruck ihrer kriegerischen Tracht, ihrer in der Tat hinterlistigen Art der Kriegsführung, ihrer Sitte Sklaven zu opfern und beim Tode von Häuptlingen Köpfe zu jagen, rachsüchtig, blutdürstig, hie und da sogar tapfer genannt. Hätten die Betreffenden gewusst, dass ernstliche Zwistigkeiten in einem Bahaustamme überhaupt nicht vorkommen, dass alle Vergehen von Verbrechern und Feinden, selbst Morde am liebsten mit Bussen erledigt werden und dass nur ihre innige religiöse Überzeugung und Liebe zu den Verstorbenen sie zum Töten von Menschen treibt, dann hätten sie die Dajak unentwickelt und feige, aber niemals rachsüchtig, blutgierig oder tapfer genannt.
In Ländern, die von verschiedenen Rassen bewohnt werden, wie Borneo, ist derjenige Teil der Bevölkerung, den man sich zur Untersuchung aussucht, von massgebendem Einfluss auf das Bild, das man von der Bevölkerung erhält. Lässt man sich unter dajakischen Stämmen nieder, die bereits lange unter der Herrschaft oder unter dem Einfluss der Malaien gestanden haben, so erhält man eine unrichtige Vorstellung von den ursprünglichen Eigenschaften ihrer Rasse, da solche Stämme in hohem Masse entartet sind. Nur die Dajak an den Ober- oder Mittelläufen der Flüsse, die nicht oder wenig von Malaien [455] beeinflusst worden sind, können als die wahren Vertreter dieses Volkes angesehen werden.
Für eine gerechte Beurteilung der Individualität der Stämme von Mittel-Borneo, eine Beurteilung, die nicht nur von wissenschaftlichem Wert ist, sondern von der auch die Möglichkeit eines erfolgreichen Eingreifens seitens zivilisierter Völker in das Los der Eingeborenen abhängt, genügt es nicht, deren Sitten, Gewohnheiten und Glauben an und für sich zu kennen, sondern man muss sich ausserdem ein möglichst unparteiisches Bild von ihren Lebensbedingungen und dem Einfluss, den diese auf physischem und psychischem Gebiet ausgeübt haben, zu schaffen suchen. Auf diese Weise erhält man am besten eine Vorstellung davon, welche Verhältnisse für ihr Bestehen am günstigsten wären und inwieweit die gegenwärtigen einer Verbesserung fähig sind. Für einen derartigen Gedankengang liegt das Material wohl in dem bereits früher Behandelten bereit, bevor wir jedoch in dieser Hinsicht ein Urteil fällen, wird es zweckmässig sein, die zerstreuten Notizen nochmals zu einem Gesamtbild zu vereinigen.
Eine der auffallendsten Erscheinungen ist die sehr geringe Dichte der Bevölkerung auf Borneo im allgemeinen und der von Mittel-Borneo im besonderen. Die Zahl von 2–3 Köpfen auf den qkm, die man für die ganze Insel annimmt, ist für den mittleren Teil wahrscheinlich noch zu hoch; im Vergleich zu Java, das 150 auf den qkm zählt, also sehr niedrig. Hieraus folgt bereits, dass die Bevölkerungszahl im Laufe der Zeit sicher nicht sehr gewachsen ist, viel eher abgenommen hat oder um ein sehr niedriges Mittel schwankt; jedenfalls müssen die Lebensbedingungen einer Menschenrasse sehr ungünstig sein, um zu einem derartigen Ergebnis zu führen. Doppelt bemerkenswert wird diese Erscheinung, wenn wir berücksichtigen, dass eine derartige geringe Bevölkerungsziffer im Vergleich zu der eingenommenen Bodenfläche bei allen auf niedriger Entwicklungsstufe stehenden Völkern des Festlandes oder sehr grosser Inseln vorkommt. Demnach erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass zwischen der Entwicklungsstufe und der Zahlstärke eines Volkes ein Zusammenhang besteht.
Inbezug auf Borneo hat die Frage nach der Ursache dieser geringen Bevölkerungsdichte bereits seit lange das Interesse erregt und man hat als Gründe hierfür ohne Zögern die schlechten Sitten dieser Stämme, die einander ausrotteten und ein ausschweifendes Leben führten, angegeben. Von solchen Gründen kann bei den hier beschriebenen Stämmen [456] der Bahau und Kĕnja keine Rede sein. Auch mag bemerkt werden, dass auch in Gebieten, die bereits seit vielen Jahrzehnten unter englischer oder niederländischer Verwaltung stehen und wo mithin eine gegenseitige Ausrottung unmöglich ist, die dajakischen Stämme durchaus nicht stark zunehmen.
Die Lebensbedingungen der ursprünglichen Dajak erscheinen, oberflächlich betrachtet, günstig genug. Bei einer früheren Gelegenheit ist bereits die allgemeine Gestalt der Insel Borneo mit ihrer überwältigend dichten Pflanzenbedeckung, die auf einen Überfluss an Wärme, Licht und Regen sowie auf eine grosse Fruchtbarkeit deutet, beschrieben worden (Teil I pag. 50).
In dieser Treibhausatmosphäre leben die Stämme der Dajak schon seit Jahrhunderten. Ihr Kampf ums Dasein beschränkt sich auf die Sorge für Nahrung und die relativ sehr geringen Schutzmittel gegen das Klima. Für die Beschaffung der Nahrung bietet die Üppigkeit der Vegetation und die Fruchtbarkeit des Bodens eben gefällter Walder sehr günstige Gelegenheit und der Wald liefert für eine primitive Herstellung von Wohnung und Kleidung reichliches Material. So scheint alles zusammenzuwirken, um dem Menschen die Vorbedingungen zu einem üppigen Gedeihen zu schaffen—und doch vermisst man die erste Folge von solchen Umständen, eine dichte und wohlhabende Bevölkerung.
Sowohl am Kapuas als am Mahakam lebt nur eine geringe Anzahl Menschen, deren zerstreute Wohnplätze sich auf die Flussufer beschränken und deren Dasein im allgemeinen nichts weniger als üppig ist. Infolge ihrer geringen Kenntnisse verstehen sie die günstigen Faktoren in ihrer Umgebung nicht auszunutzen und gegen die ungünstigen sich nicht zu wehren. Welche Folgen hieraus für die Existenz des Volkes hervorgehen, kann aus dem Nachstehenden ersehen werden.
Am meisten macht sich diese Unkenntnis auf dem Gebiet der Gesundheitspflege fühlbar, indem diese Menschen nicht wissen, wann und wodurch sie krank werden und keine Mittel zur Heilung ihrer Krankheiten kennen. Im Kapitel VIII des ersten Teils sind bereits die wichtigsten unter dieser Bevölkerung herrschenden Krankheiten angeführt worden. Von diesen sind inbezug auf das Bestehen des Volkes am einflussreichsten die in Borneo endemischen Krankheiten und zwar in erster Linie die Malaria, in zweiter die sehr verbreiteten venerischen Leiden. Wann sich die letzteren eingebürgert haben, ist vorläufig nicht festzustellen, aber von der Malaria kann man sicher annehmen, dass [457] sie geherrscht hat, so lange das Land von diesen Dajakstämmen bewohnt wird. Um den schädlichen Einfluss zu ermessen, den die Malaria auf das Allgemeinbefinden der Bevölkerung ausübt, muss man bedenken, dass diese dem weit und breit herrschenden Übel gegenüber völlig machtlos ist. Die meisten Individuen sind daher während einer grösseren Lebensperiode mehr oder weniger leidend, ein Umstand, der auch auf die noch ungeborene Nachkommenschaft schwächend einwirken muss (Teil I pag. 425).
Von hervorragender Bedeutung, besonders in Bezug auf die Vermehrung der Rasse, sind die venerischen Krankheiten, die, wie ein zweiter Fluch, auf den Bewohnern von Mittel-Borneo lasten. Sowohl unter den Stämmen des Kapuas als unter denen des Mahakam hat die Verbreitung von Syphilis einen entsetzlichen Umfang erlangt; am stärksten tritt sie bei den Kajan vom Blu-u auf, wo ein 11 monatlicher Aufenthalt als praktizierender Arzt mich davon überzeugte, dass keine einzige Familie von dieser Krankheit verschont geblieben war. Wie lange sie unter ihnen schon geherrscht haben muss, lässt sich daraus ersehen, dass sie unter ihnen nur in einer Form vorkommt, die von Mutter auf Kind übertragen wird (Teil I pag. 431).
Die Häufigkeit des Vorkommens von Genitalkrankheiten bei den Frauen der Mendalam-Kajan setzte mich in Erstaunen. Da ich inmitten der grossen Bevölkerung von Tandjong Karang lange Zeit allein wohnte, überwanden die Frauen ihre anfängliche Scham und suchten gegen allerhand Leiden meinen ärztlichen Beistand. In den malaiischen Wohnplätzen am oberen Kapuas hatte ich ebenfalls hinreichend Gelegenheit; mich von dem Umfange zu überzeugen, den auch hier diese Leiden erreicht haben.
Auch den venerischen Leiden gegenüber wissen die Eingeborenen nichts anderes anzuwenden als Beschwörungen. Von der Syphilis wissen sie nicht einmal, auf welchem Wege sie in der Regel entsteht.
Für die von der Küste bequem erreichbaren Gebiete, also am Unter- und Mittellauf der grossen Flüsse, tritt noch ein anderer wichtiger Faktor hinzu, der auf die Dichte der Bevölkerung einen überwiegenden Einfluss ausübt, nämlich die Infektionskrankheiten wie Cholera und Pocken, die, soweit ich habe verfolgen können, stets längs der grossen Flüsse von auswärts in die Insel eingeschleppt werden. In zivilisierten Ländern bildet die Bekämpfung dieser Krankheiten eine der grössten Segnungen, die man dem Fortschritt in der medizinischen [458] Wissenschaft zu danken hat, denn welche Rolle diese Epidemien in einer unbeschützten Bevölkerung spielen können, lehrten mich einige Beispiele unter den Stämmen Mittel-Borneos, wo diese Krankheiten gewöhnlich um so seltener vorkommen, je schwerer zugänglich die Gegenden von der Küste aus sind.
Einige Jahre vor meiner Ankunft am Mendalam war in der damals noch vereinigten grossen Niederlassung der Kajan von Tandjong Karang und Tandjong Kuda die Cholera ausgebrochen. Nicht weniger als ein Viertel der Bevölkerung muss ihr damals zum Opfer gefallen sein; die Bedingungen hierfür waren durch das Zusammenleben des ganzen Stammes in einem grossen Hause gegeben. Inbezug auf eine Pockenepidemie, die durch Uma-Lĕkĕn von der Küste nach Apu Kajan eingeschleppt worden war, teilte man mir mit, ein Drittel der Bevölkerung des infizierten Dorfes sei damals gestorben.
Es kann zahlenmässig nicht festgestellt werden, in welchem Grade diese Faktoren die Vermehrung der Bevölkerunng hemmen; aber in Anbetracht, dass alle übrigen schädigenden Einflüsse der Malaria und den Genitalleiden gegenüber verschwindend klein erscheinen, glaube ich nicht zu weit zu gehen, wenn ich die geringe Zahl und den Rückgang der Bahau hauptsächlich diesen zuschreibe.
Zu dieser Überzeugung war ich bereits auf meiner Reise 1896–97 gekommen und habe sie in meinem Werke “In Centraal Borneo (1897)” ausgesprochen. Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Überzeugung erhielt ich aber erst am Ende meiner letzten Reise, während meines Aufenthaltes unter den Kĕnjastämmen von Apu Kajan.
Seit Jahren daran gewöhnt, Malariafälle in meiner Praxis weitaus die Mehrheit bilden zu sehen, fiel es mir sehr auf, in Apu Kajan ganz andere Verhältnisse zu treffen. Eine grosse Zahl hydropischer alter Leute beanspruchte hier meine Hilfe, was in tiefer gelegenen Gegenden beinahe nie vorgekommen war, während Malariafälle sehr zurücktraten und sich während meines Besuchs auf einige akute Fälle beschränkten. Es erwies sich, dass die Veränderung im Krankheitsbilde der Bevölkerung hauptsächlich durch das vielfache Vorkommen von Bronchitis mit Emphysem und Herzfehlern hervorgerafen wurde, Erscheinungen, die durch das rauhe Klima verursacht und durch das Rauchen von sehr schlecht zubereitetem Tabak gefördert werden. Mit dem Rauchen wird bereits in frühster Jugend begonnen, da man es als Heilmittel gegen Husten betrachtet. Obgleich in Apu Kajan mit [459] dem Eintritt von rauhem, kaltem Wetter mit heftigen Regengüssen mehr akute Malariaanfälle vorkamen, war doch von einer chronischen Infektion der ganzen Bevölkerung, die sich in einer vergrösserten, harten Milz bei der grossen Mehrzahl der Kinder äusserte, (Teil I pag. 427) überhaupt nicht die Rede. Dies stimmt mit der bekannten Tatsache überein, dass in einem kälteren Klima die Malariainfektion im allgemeinen an Heftigkeit abnimmt.
Da Bronchitiden und deren Folgen erst in späterem Alter einen schwächenden Einfluss auf den Körper ausüben und hierin mit einer starken Malariainfektion nicht zu vergleichen sind, so glaube ich in dem Unterschied im Auftreten der Malaria, als eine Folge der Höhendifferenz zwischen dem Lande der Bahau und dem der Kĕnja, einen Hauptgrund gefunden zu haben für die gegenwärtige Verschiedenheit dieser beiden Stammgruppen inbezug auf ihre Dichte, ihre physische und, wie wir später sehen werden, auch ihre psychische Konstitution.
Mit dieser kräftigeren Körperkonstitution der Kĕnja steht ihr grösseres Widerstandsvermögen anderen Krankheiten gegenüber in Verbindung; so glaube ich z.B. diesem zuschreiben zu müssen, dass Syphilis bei den Kĕnja zwar in derselben eigentümlichen Form wie bei den Bahau, aber mit geringerer Heftigkeit auftritt. Während diese Krankheit unter einigen Bahaustämmen so allgemein vorkam, dass ich die Tatsache, dass sich unter ihnen nur tertiäre Formen zeigten, durch die Annahme einer ausschliesslich hereditären Ausbreitung erklären zu müssen meinte, standen die Fälle unter den Kĕnja viel zu vereinzelt da, um an Erblichkeit überhaupt denken zu können. Die von mir beobachteten Fälle schienen auf den Zustand der Kĕnja lokal und allgemein einen viel minder schädlichen Einfluss auszuüben als unter den Bahau. Es waren meistens tuberöse Syphiliden der Haut, die das Knochengerüst nicht angriffen und viele Jahre bestanden, ohne den Körper des Betreffenden ernstlich zu schwächen.
Einen schlagenden Beweis dafür, in welchem Masse Apu Kajan, das ebenso gross ist wie das Gebiet des oberen Mahakam, seiner Bevölkerung günstigere Lebensbedingungen bietet als die tiefer gelegenen Flusstäler, liefert die Tatsache, dass seit Jahrhunderten zahlreiche Stämme aus dieser 600 m hoch gelegenen Gebirgsgegend nach allen Himmelsgegenden in die benachbarten niedrigeren Flusstäler weggezogen sind und die Bevölkerung dort doch noch dichter ist als irgendwo anders in dajakischen Gebieten. Anstatt 300–800, wie am Ober-Mahakam, zählen [460] die Dörfer in Apu Kajan 1500–2500 Einwohner, trotzdem sie dort sicher nicht weiter voneinander entfernt liegen. Für mich war dies ein Beweis dafür, dass die herrschenden Krankheiten in der Tat einen überwiegenden Einfluss auf die Dichte der borneoschen Bevölkerung haben müssen.
Krankheitsverhältnisse, wie sie unter den Bahau auftreten, wirken nicht nur dezimierend auf die Anzahl der Individuen, sondern setzen auch die Lebensenergie und Arbeitskraft der Menschen so weit herab, dass diese auf ihrer niedrigen Bildungsstufe während eines grossen Teils ihres Lebens sich selbst und anderen nicht von dem Nutzen sein können, wie ihnen dies unter günstigeren Gesundheitsverhältnissen möglich wäre.
Der gleiche Mangel an Entwicklung und Kenntnissen, der den Bahau-Dajak daran verhindert, sich gegen die gesundheitsschädigenden Einflüsse seiner Umgebung zu wehren, macht seine ungünstige Wirkung auch auf anderen wichtigen Gebieten seines Lebens geltend. Betrachten wir von diesem Gesichtspunkt aus vor allem die Art und Weise, wie er sich Nahrung verschafft.
Es ist dem Dajak unbekannt, dass dasselbe Feld, auf richtige Weise bearbeitet, Jahre hintereinander Produkte liefern kann; daher die mühselige Ausrodung immer neuer Waldstrecken und die Bearbeitung des Ackers für nur 1 oder 2 Jahre. Da der Boden nicht sorgsam vorbereitet wird, ist das Wachstum der Reispflanzen gering und dieselben sind für ungünstige Lebensbedingungen, wie zu wenig oder zu viel Regen, viel empfindlicher als unter einer besseren Kultur. Ausserdem wird von dem gesäten Reis, den man nicht mit Erde bedeckt, ein Teil von den Tieren aufgefressen und, falls es nicht gleich nach der Saat regnet, leidet die Keimkraft der Körner durch zu starke Sonnenbestrahlung. Von den wachsenden Halmen fordern die Waldtiere ihren Teil, falls man diese nur vorübergehend bebauten Felder nicht in mühsamer Arbeit mit starken Hecken umgibt. Ist der Reis reif, so rauben Vögel und Affen, gegen die sich der Dajak nur schlecht zu schützen weiss, wiederum einen Teil der Ernte. Auch wird diese noch dadurch sehr verschlechtert, dass das Brennen der neuen Felder in der Trockenperiode vorgenommen werden muss, wodurch die Erntezeit in die Regenperiode fällt. Zur Erlangung einer genügenden Menge Reis muss also nicht nur stets wieder ein neues Stück Feld gerodet werden, sondern infolge des ausserordentlich geringen Ertrags muss [461] die bebaute Oberfläche auch viel grösser sein als dies bei einem rationellen Betrieb nötig wäre. Ähnliche Zustände herrschen auch bei den anderen Kulturen. Auch ihr besonders auf den Landbau so lähmend wirkendes pe̥māli-System hängt mit ihrer mangelhaften kulturellen Entwicklung zusammen.
Eine andere schädliche Folge dieser Raubwirtschaft ist, dass diese Stämme, infolge der Erschöpfung ihrer Felder in der Umgegend, nach ergiebigeren Feldern umzuziehen gezwungen sind, so dass die ganze Niederlassung nach einigen Jahren von neuem aufgebaut werden muss. Ein solcher Umzug bedeutet für eine Familie von wenig Gliedern eine Arbeit, die jahrelang alle ausserhalb des Ackerbaus zur Verfügung stehende Zeit in Anspruch nimmt, also wiederum einen bedeutenden Arbeitsverlust.
Auch die Ausübung von Jagd und Fischfang ist bei diesen niedrigentwickelten Völkern mit viel grösseren Schwierigkeiten und mit mehr Arbeitsverschwendung verbunden, als bei höher entwickelten. Für die Jagd besitzen sie weder gute Schiesswaffen noch starke, gut dressierte Hunde, während ihre Schlingen und Fallen meist sehr primitiv beschaffen sind oder viel Arbeit bei der Aufstellung erfordern.
Der Mangel an praktischen Fischmethoden hat die meisten Stämme zu einem ausgebreiteten Gebrauch des Tubagiftes gebracht, wodurch der Fischstand in vielen Flüssen vernichtet wird und für den übrigen Teil des Jahres die verfügbare Menge Fischnahrung in vielen Gegenden sehr herabgesetzt ist.
Nach der Nahrung kommt in zweiter Linie die Bedeckung zum Schutz gegen das Klima in Betracht, Kleidung und Wohnung. Zur Beschaffung derselben gebraucht der Dajak hauptsächlich die Zeit, die ihm die Sorge für die Nahrung übrig lässt. Auch hierbei zeigt es sich also, unter welchen ungünstigen Bedingungen er sein relativ geringes Kapital an Arbeitskraft ausnützen muss. Die Art und Weise, in welcher das erforderliche Material für den Hausbau in den Wäldern gesucht, dort roh bearbeitet und an Ort und Stelle geschafft wird, erfordert wegen des Fehlens guter Hilfsmittel und Wege viel mehr Anstrengung als da, wo letztere vorhanden sind. Um ein Beispiel anzuführen, die Grundbalken des Hauses müssen nach der Bearbeitung oft über weite Strecken durch die Berg und Tal bedeckenden Urwälder geschleppt werden.
Falls die Kleidung nicht von auswärts eingeführt wird, liefert die [462] Umgebung die Rohstoffe, aus denen sie zu Hause hergestellt wird. Der zur Verfügung stehende Webstuhl ist sehr primitiv; der Stoff, den man webt, besteht entweder aus selbst gebauter Baumwolle, die man mit der Hand reinigt und zu Fäden spinnt, oder aus den langen Fasern der auseinander geraffelten Lianenstämme, die aneinander geknüpft oder zu Fäden ineinander gedreht werden. Hieraus webt man grobe Stoffe, deren Herstellung viel mehr Arbeit und Zeit kostet als die viel brauchbareren Gewebe, die in Europa verfertigt werden.
Ferner erleidet eine Bevölkerung auf so niedriger Kulturstufe noch einen besonderen Nachteil durch ihre mangelhafte Arbeitsteilung. Es zeigt sich nirgends besser als in unserem modernen Gesellschaftsleben, wie geeignet dieses Mittel ist, der so geringen körperlichen und geistigen Fähigkeit des Individuums in der Beherrschung und Verwendung der Materie nachzuhelfen. Wo aber jede Familie darauf angewiesen ist, sich selbst durch Ackerbau, Jagd und Fischfang zu versorgen, wo sie ihre Kleidung selbst herstellen, ihre Wohnung selbst bauen und bisweilen alle hierfür erforderlichen Gerätschaften selbst verfertigen muss, da stehen ihre Glieder notwendigerweise infolge mangelnder Übung an Fertigkeit weit hinter denen zurück, die aus einer dieser Tätigkeiten ihren Lebensberuf machen.
Fasst man diese oben geschilderten Lebensverhältnisse ins Auge, so nimmt es nicht Wunder, dass die Bahau nicht zu den kräftigen Menschenrassen gehören; weder sie noch die meisten anderen dajakischen Stämme, denen ich begegnete, machten den Eindruck von Menschen mit grosser Lebensenergie.
Damit hängt es auch zusammen, dass ein solches Volk sich in höherem Masse als einen Spielball ausser ihm stehender Mächte fühlt, als dies bei einem entwickelteren Gemeinwesen der Fall wäre. Daher wird auch die Gedankenwelt der Dajak in viel höherem Grade von einem Gefühl der Abhängigkeit gegenüber der Umgebung beherrscht und einige ihrer gesellschaftlichen Einrichtungen sind ein unmittelbarer Ausfluss hiervon.
Bezeichnend dafür sind ihre Vorstellungen von sich selbst und der Stellung, die sie ihrer Umgebung gegenüber einnehmen. Jene kommen z.B. in ihrer Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck, nach der sie selbst gleichzeitig mit ihren Haustieren aus Baumrinde gebildet wurden; auch schreiben sie diesen Tieren und einigen anderen wie sich selbst zwei Seelen zu, und die ganze Umgebung ist von ähnlichen Seelen belebt, [463] welche auch menschliche Eigenschaften besitzen (Teil. I pag. 103).
Ferner äussert sich dieses Ohnmachtsgefühl in ihrer Überzeugung, dass mit grösserer Macht als sie selbst begabte Geister sie von allen Seiten umlagern, um sie auf Befehl ihres Hauptgottes bei einem Vergehen mit Unglück, Krankheit oder Tod zu strafen. Ihre Angst vor diesen bösen Geistern hat den lebhaften Wunsch in ihnen erweckt, diesen keinen Anlass zu einem Eingreifen in ihr Los zu bieten; hieraus ging ihr Streben hervor, Gesetze zu finden, nach denen sie in allen Lebenslagen zu handeln hätten, und so entstanden die zahllosen Bestimmungen, die als pe̥māli ihr Tun und Lassen in so hohem Masse beschränken. Die Bahau klammern sich mit um so grösserer Ängstlichkeit an diesen Glauben, als sie einen Schutz gegen die höheren Mächte nicht in sich selbst, sondern in den pe̥māli zu finden meinen. Da diese ein Ausfluss ihrer Einbildung sind und so wenig auf der richtigen Kenntnis ihrer wahren Interessen beruhen, wird ihre Freiheit, nach den Forderungen des Augenblicks zu handeln, auf sehr unpraktische Weise gebunden. Auch leitet dieser Glaube ihr Streben nach einer besseren Existenz in falsche Bahnen und verhindert eine freie Untersuchung der natürlichen Verhältnisse. In Krankheitsfällen z.B. verhindert er den Bahau, Krankheiten wie wir durch Naturprodukte oder auf der Naturkenntnis beruhende Massregeln erfolgreich bekämpfen zu lernen.
Ihrem Mangel an Selbstvertrauen, ihrer Hoffnung auf Hilfe von aussen, ihrer Unkenntnis des Begriffs Kausalität, infolge deren bei ihnen alles aus willkürlichen Taten der Geister hervorgeht, die nicht anders, sondern nur mächtiger als sie selbst sind, ist es zuzuschreiben, dass der Glaube an Vorzeichen sich unter ihnen so entwickelt hat und mit den eigentlichen pe̥māli ihrer Handlungsfreiheit ein doppeltes Hindernis in den Weg stellt. Geht aus diesem allem bereits hervor, unter welchen höchst ungünstigen Bedingungen der Bahau durch die Eigentümlichkeiten seiner Umgebung und durch seinen Mangel an Kenntnis lebt, und welch einen Hemmschuh letzterer für seine Handlungen und seine Entwicklung bildet, so ist es wissenschaftlich interessant und von kolonialem Standpunkt wichtig, nachzuforschen, wie der geistige Mensch sich in ihm unter diesen Verhältnissen ausgebildet hat.
Es hiesse die Tatsachen auf den Kopf steilen, wollte man die physische Schwäche der Bahau, die sie zu Sklaven der umgebenden Natur [464] macht, als Folge einer geringen geistigen Begabung auffassen. Aus dem folgenden werden wir vielmehr ersehen, dass bei den Bahau gute geistige Fähigkeiten vorhanden sind, dass die Verhältnisse jedoch nur einige wenige gut entwickelt haben, während die übrigen latent geblieben oder, viel wahrscheinlicher, degeneriert sind.
Es hat sich z.B. durch häufiges Reisen und vielfache Berührung mit anderen Stämmen das Sprachtalent der Bahau besonders entwickelt. Die meisten gereisten Leute sprechen mehrere Sprachen, obgleich man sich im ganzen nordöstlichen Teil von Borneo sehr gut mit dem Busang verständigen kann. Hier einige Beispiele unter vielen: Akam Igau unterhielt sich mit Punan, Taman, Pnihing und Kajan am Blu-u in deren eigenen Sprachen, dazu bediente er sich des Busang und Malaiischen täglich und kannte wahrscheinlich auch noch 1–2 Sĕrawakische Sprachen. Eine Frau der Long-Glat, Uniang Pon, sprach gut Busang, Blu-u Kajanisch, Long-Glatisch und verständlich Malaiisch. Auch die übrigen Frauen lernen Malaiisch, sobald sie mit Malaien in Berührung kommen. Obgleich die verschiedenen Sprachen der Bahau auch dem Laute nach sehr verschieden sind, scheint deren Erlernung ihnen keine Schwierigkeiten zu bieten. Dafür spricht die Tatsache, dass die kleineren Stämme, auch nachdem sie sich politisch mit den grösseren, wie den Long-Glat, verbunden haben, ihre ursprüngliche Sprache beibehalten und sich zum Verkehr mit ihren neuen Stammesgenossen einer ihnen beiden fremden Umgangssprache bedienen.
Wie leicht sich die Kajan allerhand Kenntnisse aneignen können, beobachtete ich beim Unterrichten eines Sohnes Akam Igaus, der zwar Malaiisch lesen und schreiben konnte, es aber auch mit holländischen (lateinischen) Buchstaben erlernen wollte. Obgleich dieser Unterricht einer Kritik schwerlich Stand gehalten hätte, las und schrieb mein Zögling doch schon im Verlauf eines Monats so gut, dass er sich allein weiter helfen konnte und auch imstande war, einen leserlichen Brief zusammenzustellen.
In noch einer anderen, vom Kampfe ums Dasein beinahe oder völlig unabhängigen Richtung haben sich, wie wir gesehen, die Dajak, besonders die Bahau, sehr gut entwickelt, nämlich in der Kunstfertigkeit und im Kunstsinn. Sowohl Männer als Frauen zeichnen sich hierin aus und ihre Leistungen sind für ihre Entwicklungsstufe bewunderungswürdig. Das Individuum geniesst in ihrem Gemeinwesen die vollste Freiheit zur Ausbildung seiner verschiedenen Anlagen; die allgemeine [465] Verbreitung dieser Kunstfertigkeit setzt daher den Weissen, der gewohnt ist, sie als das Vorrecht einzelner zu betrachten, in Erstaunen. Manche in anderen Gegenden entwickelten Kunstfertigkeiten gelangten unter dem Einfluss ihrer besonderen Umgebung bei ihnen nicht zur Entfaltung.
So sah ich am Mandai Kinder mit Schleudern aus langen Grasblättern spielen, mit denen sie Erdstücke so weit als möglich über den Fluss warfen. In dem mit Wäldern bedeckten Borneo können diese Schleudern jedoch nicht für ernsthafte Zwecke verwendet werden.
Die Ausleger, die den kleinen Böten an der Seeküste grosse Stabilität verleihen, gebrauchen die Bahau nur beim Hinabfahren über die Wasserfälle in Form von Bäumen, die sie an die Kähne binden.
Die Ma-Suling bauen primitive aber starke Dämme, um Fischweiher zu stauen; bei den übrigen Bahau sind sie nicht gebräuchlich, weil diese an fischreichen Strömen wohnen.
Aus der Kajansage vom Mann und dem Sagobaum (Teil II p. 124) geht hervor, dass die Bahau sehr wohl wissen, dass sie die Henne der goldenen Eier wegen schlachten, wenn sie beim Sago- oder Kautschuksammeln den ganzen Baum fällen, statt ihn nur anzuzapfen. Sie wissen aber auch, dass nur andere den Gewinn davontragen, wenn sie den Baum, der oft weit ab im Urwald steht, nur anzapfen und sich mit dem Teil des dabei ausfliessenden Saftes zufrieden geben. Sparsamkeit ist jedoch ihrer Ansicht nach unter diesen Bedingungen gar nicht angezeigt.
Auch die Fähigkeit zu zählen ist bei den Dajak auf niedriger Entwicklungsstufe stehen geblieben. Weder die Bahau noch die Kĕnja können ohne Hilfe ihrer Finger und Zehen oder kleinerer Gegenstände wie Hölzchen zählen oder rechnen. Da sie ihre Hände und Füsse stets zur Verfügung haben, werden diese beim Zählen am meisten gebraucht und zwar, für Zahlen unter zehn, die Finger, für Zahlen zwischen zehn und zwanzig auch die Zehen. Für grössere Berechnungen wiederholen sie das Zählen mit den Fingern und Zehen oder sie gebrauchen von Anfang an Hölzchen, Steinchen u.s.w. Berechnungen mit grossen Zahlen sind sie nicht imstande auszuführen, was die Malaien und Buginesen sich in ihrem Handel mit ihnen sehr zu Nutze machen. In einem vom Kontrolleur festgestellten Falle bezahlte ein Buginese den Kĕnja, von denen er 1500 Packen Rotang gekauft hatte, nur 900.
Nicht nur körperlich sondern auch geistig sind die Bahau also durch [466] ihre Lebensbedingungen hintangehalten worden. Dass auch ihr Charakter hiervon das Gepräge trägt, davon überzeugten wir uns bereits bei der Betrachtung ihrer religiösen Überzeugungen und Gebräuche. In den Charaktereigenschaften der Bahau macht sich hauptsächlich ein durch die Verhältnisse hervorgerufener Mangel an Energie geltend, wovon wir uns im folgenden bei einer Vergleichung mit den Charaktereigenschalten der Kĕnja überzeugen werden.
Natürlich darf hierbei nicht übersehen werden, dass unter den vielen Individuen eines Stammes grosse Unterschiede vorkommen, die allerdings nicht so gross sind wie in einem höher entwickelten Gemeinwesen, das seinen Gliedern verschiedenere Verhältnisse zum Leben und zur Entwicklung bietet; doch treten auch bei den gleichförmigeren Existenzbedingungen der Bahaugesellschaft einzelne Persönlichkeiten stark vor der Umgebung hervor.
Der Bahau ist im allgemeinen nicht tapfer; nie bin ich jemand begegnet, der sich für irgend etwas aufgeopfert hätte, und sobald mit einer Sache grosse Gefahr einer Verwundung oder gar Lebensgefahr verbunden ist, zieht er sich zurück. Charakteristisch ist sein Ausdruck für einen Mut, der keine Gefahren kennt, nämlich “lakin ujow (dummer oder verrückter Mut).” Am besten lässt sich der Mut der Bahau an dem ermessen, was er selbst für besonders mutig und männlich hält. Vor allem das Unternehmen einer Kopfjagd gegen feindliche Stämme, wobei unter grossen Entbehrungen durch das versteckte Leben im Walde und mit Aufopferung von viel Zeit mit einer Übermacht einzelne Individuen, bisweilen Frauen und Kinder, überfallen werden und der Angreifer selbst ein Minimum an Gefahren riskiert.
Das Unternehmen einer Kopfjagd an und für sich könnte schon als eine mutige Tat angesehen werden, wenn man nicht wüsste, dass diese Stämme hierzu durch ihren Glauben und ihre Liebe zu verstorbenen Häuptlingen, denen sie einen Schädel ins Grab geben müssen, gezwungen würden. Schon die Berührung eines solchen Schädels ist ein Beweis von grossem Mut, den nur wenige zu erbringen wagen (178 u. 180). Das Unternehmen einer solchen Kopfjagd ist einigermassen mit der freiwilligen Verbrennung der Witwen der Hindufürsten auf Bali vergleichbar, aus der ersichtlich ist, wie weit der Glaubensfanatismus führen kann. Der Abscheu vor Blutvergiessen ist bei den Dajak im Grunde so gross, dass selbst ein auf die feigste Weise ausgeführter Mord noch als eine besonders mutvolle Tat betrachtet wird. [467]
Für Häuptlingssöhne am oberen Mahakam ist es bei ihrem Eintritt ins Mannesalter wünschenswert aber nicht absolut notwendig, einen Menschen getötet zu haben; deshalb werden häufig alte Sklavinnen am oberen Murung gekauft und dann unversehens niedergemacht. (Lasa Tĕkwan Tl. 1 pag. 399 und Ibau Li pag. 82). Sehr bezeichnend ist auch die Tatsache, dass bei Gefechten, die zwischen diesen Stämmen geliefert werden, der Tod oder die ernsthafte Verwundung nur eines Mannes den ganzen Stamm in die Flucht treiben kann. Dies wird allerdings auch als ein Zeichen von Zorn seitens der Geister aufgefasst, doch beweist es nicht minder den starken Eindruck, den ein derartiger Vorfall auf den ganzen Stamm ausübt.
Einigermassen im Widerspruch hiermit steht, dass relativ häufig Fremde von Bahau ermordet werden, wenn auch auf verräterische Weise. Bei näherer Betrachtung erweist es sich aber, dass die Eingeborenen dann durch ihr Schlachtopfer oder dessen Stammesverwandte aufs äusserste gereizt worden waren und die geübte Rache, von ihrem Standpunkt aus, durchaus nicht übertrieben ist (Fall in Long T/epai).
Diesem furchtsamen Charakter und Mangel an Selbstvertrauen ist es denn auch zuzuschreiben, dass man unter den Bahau so wenig Wahrheitsliebe antrifft. Zwar ist auch hierin die individuelle Verschiedenheit gross und ein Kind und ein Sklave flunkert z.B. viel leichter als ein Erwachsener und Höherstehender, aber weitaus die meisten Personen können der Versuchung nicht widerstehen, eine Lüge vorzubringen, falls sie sich hierdurch leicht aus einer Verlegenheit retten zu können glauben. Hierdurch wird natürlich der Umgang mit ihnen sehr erschwert und beim Einholen von Nachrichten muss man hierin stets auf der Hut sein und besonders die Person, an die man sich richtet, in Rechnung ziehen.
In Übereinstimmung mit ihrer Abneigung gegen Gewaltsakte steht auch die Tatsache, dass, obgleich das gegenseitige Verhältnis zwischen den Stämmen z.B. am Ober-Mahakam nichts weniger als harmonisch ist, dennoch ein Kampf zwischen ihnen zu Lebzeiten der gegenwärtigen Bewohner nicht mehr vorgekommen ist. Überdies sei hier daran erinnert, dass in einem Stamm selbst ein Zank oder gar ein ernsthafter Zwist unter normalen Verhältnissen nicht vorkommt. Anfälle von Heftigkeit oder Wut sind bei den Bahau nur als Äusserungen Geisteskranker bekannt; daher ihre Angst vor Europäern, die leichter heftig werden. [468]
Roh und rachsüchtig sind sie ebenfalls nicht, sie verraten vielmehr ein zart entwickeltes Gefühl, was man von Kopfjägern wohl nicht erwartet hätte. Ihr Abscheu vor Gewalttätigkeit, der sich schon in dem Verhältnis der Stämme untereinander zeigt, tritt noch viel stärker hervor im Betragen der Familienmitglieder untereinander. Hier äussern sie ein grosses Mass von Selbstbeherrschung und Mitgefühl für ihre nächste Umgebung im Gegensatz zu den nicht durch Verwandtschaft mit ihnen verbundenen Menschen. Besonders massgebend für ihre Haltung ist der Verwandschaftsgrad, in dem der Bahau zu jemand steht, und der Umstand, ob dieser ein völlig Fremder ist oder nicht.
Am innigsten ist das Band zwischen Eltern und Kindern; Roheiten kommen zwischen diesen nie vor. Schon die jahrelange Versorgung des kleinen Kindes durch die Mutter mit Aufopferung beinahe aller ihrer Arbeit auf dem Felde oder im Walde zeugt von liebevoller Fürsorge. Obgleich die Kinder bei allzugrossen Unarten ab und zu wohl einen Schlag erhalten, so ist doch von Strenge, übrigens auch von ernster Erziehung nicht die Rede. Die Eltern sind bisweilen aus übertriebener Zärtlichkeit so schwach, dass sie schliesslich von den Kindern tyrannisiert werden. Das beste Beispiel eines solchen verzogenen Kindes war der elternlose Enkel der Priesterin Usun, der seine Grossmutter entsetzlich plagte und ihr die Sorgen, die er ihr bereitete, schlecht vergalt. Da er ständig krank war, genoss ich täglich das Vergnügen ihn zu behandeln, und wenige zeigten sich so ungeduldig wie die Alte, bis dem Bengel geholfen wurde.
Es scheint, dass eine derartige milde oder schwache Erziehung vollkommen ausreicht, um einen Kajan für die Erfülhing der Forderungen, die das Zusammensein an ihn stellt, vorzubereiten; denn unter den Erwachsenen findet man wenige, die in ihrer Umgebung ernstlich Anstoss erregen.
Über die Innigkeit der Gefühle, welche Eltern ihren Kindern entgegenbringen, überzeugte ich mich am leichtesten während meiner ärztlichen Praxis. Bei so ergreifenden Momenten wie Krankheit und Tod zeigten auch so zurückhaltende Charaktere wie die Kajan ihre wahre Natur. Ich kannte Eltern, welche ihre kranken Kinder mit unermüdlicher Hingabe Tag und Nacht verpflegten. Obgleich bei ihnen selbst gute Heilmittel unbekannt sind, griffen sie doch nach allem, was nach ihrer Meinung den Leidenden Linderung verschaffen konnte. Ich erinnere mich eines Falles in Tandjong Karang, wo meine ärztliche [469] Hilfe nicht ausreichte und wenige Tage nach meiner Ankunft ein Kind nach monatelangen Leiden starb. Das verzweifelte Jammern der Frau blieb mir noch lange in den Ohren, und ich sah die Eltern, die sich aus Kummer über den Verlust ihres einzigen Söhnchens nur sehr selten zeigten, einen Monat lang nicht wieder. Als die Mutter eines Abends wieder zu mir kam, erzählte sie mir mit tränenden Augen von ihrem Kleinen. Ich hatte sie früher als lebhafte, fröhliche Frau gekannt, jetzt stand sie als ein Bild des Jammers vor mir, mit eingefallenen bleichen Wangen und tonloser Stimme. Sie berichtete, dass ihr Mann das Haus noch nicht verlassen wolle, weil der Anblick von Kindern im gleichen Lebensalter wie das seine ihn zu sehr angreife.
Diesem sehr entwickelten menschlichen Empfinden sind wohl auch zum Teil die strengen Vorschriften für die Trauer und die Sorge, dem Toten durch eine gute Ausrüstung den Weg nach Apu Kĕsio und seinen dortigen Aufenthalt so angenehm als möglich zu gestalten, zuzuschreiben.
Von einer Angst vor den Seelen ihrer Verstorbenen habe ich bei diesen Stämmen nie etwas gemerkt. Als die Leiche des alten Bo Adjāng Lĕdjü wochenlang über der Erde in der Wohnung stand, wurde sie dreimal täglich liebevoll mit Speise versorgt, seine Frauen schliefen nachts ohne Furcht neben dem schön verzierten, gut geschlossenen Sarg, junge Männer wurden gebeten, dem alten Manne auf der kle̥di vorzuspielen, und zogen Fremde vorüber, die sich im Rezitieren alter Überlieferungen auszeichneten, so wurden sie hierzu aufgefordert. Das tägliche Leben ging in dieser Zeit seinen gewöhnlichen Lauf.
Wenn die Frauen der Kajan am oberen Mahakam hinter dem Sarge eines Verstorbenen, der zu Grabe getragen wird, einhergehen und den Geist der früher verschiedenen Mutter zu Hilfe rufen: Ino̤̱ ālo̤̱ ko̤̱. (Mutter, hole mich!), so zeugt auch dieser Zug von Furchtlosigkeit gegenüber der Seele der Verstorbenen.
Die guten Geister von Apu Lagan werden als die Vorfahren aus längst vergangener Zeit aufgefasst und stets wieder um Hilfe angerufen (Teil I pag. 99). Von einem Ahnenkultus, der nur auf Angst beruht, ist bei diesen Stämmen nichts zu merken. Sie fürchten sich zwar vor Begräbnisplätzen und vor den Leichen derjenigen, deren plötzlicher Tod sie erschreckt hat, wie Selbstmörder, Verunglückte, Erschlagene, Wöchnerinnen und erklären dies als Strafe der Geister für die Schuld der Verstorbenen, aber hierauf beruht bei ihnen kein [470] anderer Kultus als das diesen Leichen eigentümliche Begräbnis selbst.
Von ihrem Mitgefühl für das Leiden eines Familiengliedes lassen sich alle Angehörigen so weit fortreissen, dass bei einem einigermassen ernsten Krankheitsfall alle Arbeiten vernachlässigt, die Felder schlecht bebaut werden und für das Essen kaum gesorgt wird; daher bedeutet die Krankheit eines Gliedes ein Unglück für die ganze Familie. Öfters kommt es vor, dass diese sich durch den Kauf von allerlei schlechten dajakischen, malaiischen und chinesischen Heilmitteln zu Grunde richtet; es war daher sehr begreiflich, dass ich mir durch die Behandlung ihrer Kranken ihr Vertrauen in einem Mass erwarb, wie ich es durch kein anderes Mittel erreicht hätte.
Handelt es sich jedoch um Personen, die nicht zur Familie gehören oder sogar von einem anderen Stamme sind, dann tritt ein kleinlicher Charakter und gänzlich Fremden gegenüber grosses Misstrauen und selbst Feindschaft bei den Bahau zum Vorschein. Bei der Beurteilung dieser Eigenschaft darf nicht vergessen werden, dass die Gesellschaft, in der diese Stämme leben, zu einem solchen Misstrauen gegen Fremde viel Anlass gibt. Bei Fremden der eigenen Rasse müssen sie sich meistens vor Verrat in Acht nehmen, bei fremden Malaien sind sie am stärksten Schwindel, Diebstahl und Grabschänderei ausgesetzt, so dass ihre Zurückhaltung Fremden gegenüber bereits hieraus erklärlich ist. Ausserdem ist ihre Furcht vor Krankheiten, welche die Fremden als böse Geister begleiten, einem sympathischen Empfang bei ihnen auch nicht förderlich.
Um den Charakter der Bahau anderen gegenüber zu studieren, bot mir der Einkauf von Ethnographica gute Gelegenheit. Eigentümlich war z.B. die Beobachtung bei den Mendalam Kajan in Tandjong Karang, dass kleinlicher Neid und Eifersucht sich geltend machten, sobald es sich um Konkurrenten aus dem eigenen Dorf handelte, dass sich die Leute meines Wohnplatzes jedoch denen von Tandjong Kuda gegenüber solidarisch verhielten.
Wenn die Jüngeren nicht durch Verfolgung gleicher Interessen auseinander gehalten wurden, waren sie untereinander solidarisch, um einer Freundin zu helfen, mich etwas so teuer als möglich bezahlen zu lassen, und dann war die Bande mit berechtigten und unberechtigten Anpreisungen auch nicht sparsam. Besonders machte die Verlegenheit junger Mädchen solche Hilfe der Freunde und Freundinnen wünschenswert. [471]
Sobald ein Vorübergehender merkte, dass jemand aus einer anderen Ursache als um zu schwatzen oder seine Neugier zu befriedigen in meiner Hütte stand, trat er ein, ohne dass die beinahe jeden Kauf begleitenden Auseinandersetzungen durch das Hinzutreten interessierter Zeugen irgendwie gestört worden wären. Wenn die Neuangekommenen auch in der Lage waren, selbst Gleiches oder Ähnliches zu liefern, so bewahrten sie doch tiefes Schweigen, und erst wenn die Besprechungen ohne Ergebnis endigten, versuchten sie, nach Fortgang des Verkäufers, dieselben Gegenstände anzubieten oder erklärten sich bereit, sie für mich herzustellen. Hierbei gewährte ihnen die Geheimhaltung des Auftrages, vor allem aber des Preises, eine grosse Genugtuung und spornte sie an, das Beste zu leisten. Den Preis jedoch lernte ich bald, erst nach Empfang des Kaufgegenstands zu bestimmen; denn die Kajan zeigten eine starke Neigung, sich ihrer Verpflichtungen auf möglichst bequeme Weise zu entledigen. Eigentlich lag in ihrer Geheimtuerei viel Naivität; denn ihre Umgebung, in der jeder von seinem Nächsten alles sehen und hören kann, ist dazu nichts weniger als geeignet. So lange jedoch der vereinbarte Preis noch nicht allgemein bekannt war, machte es den Kajan besonderen Spass, durch Angabe eines höheren Betrages beim Hausgenossen Neid zu erwecken, vor allem aber, als grosser Geschäftsmann oder als besonders in meiner Gunst stehend zu gelten.
Denen, die mit besonderen Talenten begabt waren, stellte ich auch besondere Aufgaben und dabei war es auffallend, wie selten ein schön gearbeitetes Stück bei den anderen Beifall oder Lob erntete. Viele schwiegen, doch manche fanden bald einen Tadel heraus und der Preis erschien ihnen stets zu hoch, Die gegenseitigen Beziehungen der Beteiligten spielten dabei eine grosse Rolle, und man musste über sie genau unterrichtet sein, um den Wert ihres Urteils über Personen oder Sachen richtig einzuschätzen.
Galt es Personen, die in meiner Gunst standen und hieraus ihren Vorteil zogen, so geschah es nicht selten, dass der eine oder andere nach harmloser Einleitung darauf hinaus zielte, meine Aufmerksamkeit auf deren nachteilige Seiten zu richten, und einige unter ihnen verstanden dabei sehr geschickt von ihrer Kenntnis europäischer Auffassung gewisser Dinge Gebrauch zu machen. So suchte einst ein bereits betagter Mann ein paar junge Mädchen, die ich gerade gut leiden mochte, dadurch in meinen Augen herabzusetzen, dass er mich auf [472] ihren intimen Verkehr mit diesem oder jenem jungen Manne aufmerksam machte.
Ein anderes Mal versuchte mich ein Kajan am Mahakam während der weitläufigen Vorbereitungen, die meinem Zuge vom Blu-u nach der Küste vorangingen, zu überreden, mit ihm und den Seinen statt mit Kwing Irang und den Männern des ganzen Stammes die Fahrt zu unternehmen. Als bei einer Beratschlagung die Geschichte ans Licht kam, entstand eine allgemeine Entrüstung. Im übrigen zeigten sich die Kajan beim Leisten von Kulidiensten stets solidarisch, was bei den malaiischen Kuli nie der Fall ist.
Sogar vornehme Häuptlinge wie Akam Igau und Kwing Irang waren über einen derartigen kleinlichen Wetteifer anderen Häuptlingen gegenüber durchaus nicht erhaben, ja nicht einmal gegenüber ihren Stammgenossen. Bei anderer Gelegenheit habe ich bereits darauf hingewiesen, wie sehr ich mit dieser Eigenschaft bei den Reisezurüstungen rechnen musste (Teil I pag. 41).
Am Mendalam gewann ich das Herz Akam Igaus, indem ich bemerkte, dass sein Haus im Vergleich zu allen bisher besuchten stark und hübsch gebaut sei. Höchst wahrscheinlich in Folge dieser Bemerkung, begann Tigang, der Häuptling von Tandjong Kuda, einen Monat später seine ganze Wohnung mit farbigen Bildern zu schmücken, was in der Tat sehr hübsch aussah. Unglücklicherweise jedoch baute er in dieser Wohnung, in der eine gute Lüftung unbedingt notwendig war, nette aber geschlossene Kammern, wie er sie in Pontianak gesehen hatte. Um nicht allzu sehr hinter ihm zurück zu bleiben, liess nun Akam Igau wieder durch seine Hauskünstler eine prachtvolle Tür für seine Wohnung schnitzen (Teil I Taf. 3). An Anlässen, einander zu überbieten, fehlt es somit den Kajan nicht.
Für einen intimeren Verkehr mit den Dorfbewohnern schien mir ein längerer Aufenthalt am gleichen Orte sehr wünschenswert, daher liess ich mich unter den Mendalam Kajan nur in Tandjong Karang nieder. Die Dajak sehen jedoch das Schlafen unter ihrem Dache als ein Zeichen von Wohlgeneigtheit an, daher wurde Tigang neidisch und bemühte sich, mich durch allerhand schöne Versprechungen zu bewegen, für länger als die eine Nacht, die ich bei ihm verbrachte, zu ihm nach Tandjong Kuda zu ziehen. Da ich seinen Lockungen widerstand, suchte er mich später an der Ausführung des Zuges nach dem Mahakam, von dem ich ihn und die Seinen wegen seiner Feindseligkeiten [473] mit Tandjong Karang hatte ausschliessen müssen, zu verhindern, indem er meine Leute aufwiegelte und sie zu hohen Forderungen veranlasste. Äusserlich liess sein Benehmen jedoch nichts zu wünschen übrig. Er suchte beim Verkauf verschiedener Proben der grossen Kunstfertigkeit seines tauben Bruders Adjāng so viel als möglich von mir zu profitieren; dabei beging er die dumme Flunkerei, die Gegenstände als seine eigene Arbeit auszugeben.
Einen auch bei den Weissen nur zu gut bekannten Charakterzug fand ich auch bei den Bahau wieder. Wenn sie nämlich auf alle erdenkliche Weise die schlechten Eigenschaften ihrer Nebenmenschen mir gegenüber hervorgehoben hatten, endeten sie mit der Erklärung: “aber ich bin nicht so”; dabei diente ihnen diese Erklärung oft als Einleitung für irgend eine Unterhandlung, bei der ich mich vor einem Betrug ihrerseits hüten musste. Bei einer der seltenen Gelegenheiten, wo ich mit Akam Igau allein war, musste ich sogar von ihm diese mit grossem Ernst gegebene Erklärung hören.
Solche kleinliche Reizbarkeit tat aber dem Frieden keinen Eintrag, da sie durch eine andere Eigenschaft im Schach gehalten wurde. Diese beruht eigentlich auf ihrem schwach entwickelten Selbstgefühl und besteht in ihrer grossen Empfindlichkeit gegenüber der Meinung anderer, hauptsächlich ihrer Angehörigen und Dorfgenossen, über ihre Person. Diese Eigenschaft verhindert die Bahau in viel höherem Masse etwas zu tun, was ihre Stammesgenossen nicht billigen würden, als ihre adat, welche dem Häuptling das Recht gibt, Vergehungen mit Bussen zu strafen. Sie fürchten sich sehr davor haè, beschämt, zu sein vor ihrer Umgebung, und auch sobald sie mit einem angesehenen Fremden, z.B. einem Europäer, verkehren, ist dieses Gefühl eines der unangenehmsten, das sie empfinden können. So erzählte man mir später am Mahakam, bei meiner Ankunft habe für sie eine der grössten Schwierigkeiten darin bestanden, nicht zu wissen, wie sie mit mir umzugehen hätten. Es fiel ihnen denn auch ein Stein vom Herzen, als ich ihnen durch meine ungezwungene Art des Umgangs zeigte, dass ich mit ihrem Benehmen zufrieden sei, und sie trotz ihres Mangels an europäischen Manieren nicht haè vor mir zu sein brauchten. Noch in späteren Jahren verwunderte ich mich darüber, wie viel Gewicht sie auf meine Erklärung legten, dass mir an meinem Zuge nach Apu Kajan so sehr viel gelegen sei, um mich vor meinen Landsleuten später nicht haè fühlen zu müssen, falls ich unverrichteter Sache zurückkehrte. [474] Diese Erklärung übte bei vielen Unterhandlungen eine stärkere Wirkung als eine Auseinandersetzung der für sie damit verbundenen Vorteile.
Bezeichnend hierfür war auch der Kummer eines armen Tropfs, der an einer Hautkrankheit leidend sich mit einer schwarzen sirupartigen Flüssigkeit behandelte und nach ihrer Gewohnheit mit einem Lendentuch von etwas zu kleinen Dimensionen herumlief. In diesem Kostüm hatte er sich einem weissen Beamten aus Putus Sibau, der ihr Dort besuchte, präsentiert und dafür einen Verweis erhalten. Bei meiner Ankunft am folgenden Tage hatte er das noch nicht vergessen und gab mir seine Befriedigung darüber zu erkennen, dass ich mich durch seine Erscheinung in meiner Würde nicht gekränkt fühlte.
In ihren Vorstellungen von Schicklichkeit spielt dies stark entwikkelte Gefühl der Scham eine grosse Rolle, und es war merkwürdig zu sehen, wie die Auffassung sich auch unter diesem Volk bei verschiedenen Individuen und unter wechselnden Umständen änderte. Glücklicherweise erfuhren diese Begriffe der ärztlichen Praxis gegenüber eine gewisse Milderung, sonst wäre ich bei der Behandlung dieser beinahe nackten Gestalten auf den gleichen Widerstand gestossen wie bei den stark bekleideten zivilisierter Länder.
Bitten um Heilmittel gegen venerische Krankheiten wurden mir, besonders von den Frauen, nur dann vorgetragen, wenn sich niemand in der Nähe befand, und auch dann so geheimnisvoll, wie in einem europäischen Sprechzimmer. Die Malaien von Mittel-Borneo behandeln ähnliche Angelegenheiten dagegen öffentlich und fast ohne Scham.
Obgleich die Frauen ihre in unseren Augen sehr primitive Kleidung beim Baden völlig ablegen, stösst die Besichtigung der für gewöhnlich bedeckten Teile doch auf heftigen Widerspruch. Wenn sie in meiner Hütte am Boden hockten, zogen sie anfangs die Röcke ängstlich über die schön tätowierten Beine, später, als sie sich heimischer fühlten, durfte hie und da wohl auch ein Knie zum Vorschein kommen, zuletzt kam es ihnen, wie in ihrer Wohnung, nicht mehr darauf an, wie die Rockfalten fielen. Anders verhielt es sich, wenn ich ihre Tätowierung näher besichtigen wollte; ich musste die Frau gut kennen, um sie zur Entblössung eines Beines zu bewegen, bemerkte aber, dass ihr dann ein bewunderndes Wort über das schöne Muster oder die gute Ausführung sehr angenehm war.
Eine eigenartige Szene erlebte ich bei der Behandlung eines jungen [475] Mädchens, das an einer Schenkelverletzung litt. Sie musste mich in meiner offenen Hütte besuchen, die unter anderem auch als Sprechzimmer diente. Meist kam sie, wenn sie mich allein wusste, aber einmal erschien sie in Begleitung einer kleinen Freundin, als die Hütte mit schwatzenden jungen Leuten gefüllt war. Nachdem sie eine Weile im Hintergrunde gewartet, gab sie mir einen Wink, und ich sah an ihren sprechenden Gebärden, dass sie sich vor den vielen Zuschauern verlegen fühlte. Ich musste die fröhliche Schar erst entfernen, bevor sie sich behandeln liess. Vor dem Arzte aber zeigte sie kein falsches Schamgefühl.
Wie verschieden dieses Gefühl haè zu werden unter den verschiedenen Klassen der Gesellschaft entwickelt ist, kann man am besten in den Fällen beobachten, wo ihr Egoismus stark gereizt wird. Dieses zeigt sich z.B. bei der Bettelei, deren sich ein jeder im Stamme, vom Häuptling bis zur niederen Sklavin, schuldig macht: die Männer sind im allgemeinen sowohl in ihrer Art zu bitten als in ihren Ansprüchen bescheidener als die Frauen. Unter diesen wussten nur die aus der Häuptlingsfamilie sich zu mässigen; das Betteln der Sklavinnen und Kinder dagegen war fast unerträglich.
Um alles, was ihnen schön und wohlschmeckend erscheint, betteln sie alle und, obgleich sie oft mit einer Kleinigkeit zufrieden sind, können sie dem Reisenden durch ihr beständiges Betteln vom frühen Morgen bis zum späten Abend den Aufenthalt völlig verleiden. Am praktischsten ist es, sich für diese Gelegenheit mit billigem Tand und leicht teilbaren Leckereien zu versehen. Ab und zu bietet es übrigens einen angenehmen Zeitvertreib, so viele Menschen glücklich zu machen; man erschliesst sich dabei viele Herzen und veranlasst manche interessanten Gespräche. Wenn mir die endlose Bettelei bisweilen ganz unerträglich wurde, stellte ich mir vor, was in einem zivilisierten Staate aus einem Menschen werden würde, der so gut wie schutzlos in einer offenen Hütte mit grossen Reichtümern leben wollte, und dann söhnte ich mich mit der Bettelsucht meiner Gastherren wieder aus. Denn wenn auch neben dieser Bettelei eine ungezügelte Neugier zu den charakteristischen Eigenschaften der Bahau gehört, so ist es für alle, die mit den Bahau zu tun haben, noch ein Glück, dass dieses Interesse für alles, was ihr Auge Neues erblickt, nicht wie bei anderen Stämmen in Diebereien ausartet, wodurch der Aufenthalt gefährlich wird. Im Gegensatz zu den Europäern sind die Bahau frei von dieser [476] Untugend, das spricht schon aus der Tatsache, dass ich in Tandjong Karang beinahe 11 Monate in einer völlig offenen, beinahe wandlosen Hütte wohnte, in der Schätze nur so zum Greifen bereit lagen, und dass während der Zeit nur ein einziges Mal ein kleines Kind einen blinkenden Löffel fortnahm, der mir gleich darauf wieder zurückgebracht wurde.
Unter ihnen selbst nimmt einer Früchte und Sirihblätter vom andern; jetzt wird das fast wie ein kleiner Diebstahl aufgefasst, wenn man aber bedenkt, dass diese Sitte zu den ganz erlaubten Gewohnheiten der Kĕnja gehört und auch unter den Bahau vor hundert Jahren noch herrschte, so kann man es schwer als Diebstahl betrachten. Ein Aufbewahren wertvoller Gegenstände hinter Schloss und Riegel ist nicht notwendig. Viele bergen einen Teil ihres Besitzes gegen Brand in kleinen Scheunen, ähnlich den Reisscheunen vor ihren Häusern, und einem geschickten Diebe würde es nicht die geringste Mühe kosten, alle diese Lagerplätze zu plündern; aber diese Sitte selbst spricht für die Seltenheit eines solchen Missbrauches.
Obgleich sich die Bahau im allgemeinen kein Gewissen daraus machten, von mir und meinem Besitz nach Möglichkeit Nutzen zu ziehen, zeigten doch einige ihrer Männer öffentlich, dass ihnen das Treiben der Frauen und Kinder oft zu arg schien. Ein älterer Mann tröstete mich einst damit, dass ich mir auf diese Weise lauter Freunde gewinne und dass es viel schlimmer wäre, wenn die Leute auf Stehlen statt auf Betteln ausgingen. Sie sehen nämlich aus nächster Nähe, wie die Malaien stehlen und häufig sogar vor brutaler Grabschändung nicht zurückschrecken.
Als bei meinem zweiten Aufenthalt in Tandjong Karang mein Zug nach dem Mahakam beschlossen war, hielt es Akam Igau für seine Pflicht, mich vor allzu reicher Beschenkung seiner Stammesgenossen zu warnen aus Furcht, dass für die später Kommenden nicht genug übrig bleiben möchte. Selbst als die eigenen Töchter den Versuch machten, jede noch ein schönes Stück Zeug zu kaufen, liess er seine warnende Stimme hören und ich machte ihm, wie später noch öfters, das Vergnügen, seinem Rate zu folgen.
In ihrer eigenen Gesellschaft wird ein solches Gerechtigkeits- und Ehrgefühl hoch geschätzt; bei den Häuptlingen schätzt man es höher als Tapferkeit oder Reichtum. Unter den Mahakam Kajan am Blu-u hatte einer der Mantri, Kwaï genannt, den Ruf ein “lake̱ marong” (rechtschaffener [477] Mann) zu sein. Zwar kam ich wegen der grossen Entfernung seines Wohnplatzes nur sehr wenig mit ihm in Berührung, aber ich hatte doch einige Male Gelegenheit zu bemerken, wie gut er sich den Ansprüchen der Seinen gegenüber in meine Verhältnisse zu versetzen und zwischen beiden Parteien einen Vergleich zustande zu bringen wusste. Er war es auch, mit dem ich wegen des Lohnes der Kajan für die Fahrt den Mahakam hinunter verhandelte. Er fand bei dieser Gelegenheit, dass es von mir zu viel verlangt heisse, ihnen ausser allem, was sie von mir erhalten hatten, auch noch das grosse Boot zu geben, um welches Kwing Irang mich gebeten hatte. Als man mir einmal über die Kĕnja zu viel auf binden wollte, erklärte er, dass man wenig anderes von ihnen wisse, als dass sie Menschen seien wie sie selbst.
Die Ehrfurcht vor dem Alter und die Stellung, welche die Frau im Bahau-Staate einnimmt, scheinen mir Äusserungen des sanften Charakters dieser Menschen zu sein. Obgleich die Jugend auch bei ihnen gern das grosse Wort führt, so schweigt sie doch in Gegenwart älterer Leute. Bei öffentlichen Versammlungen des Stammes ergreifen junge Männer daher nur ausnahmsweise das Wort, gewöhnlich sagen sie Ja und Amen zu allem, was die Alten verlangen.
Die Frau spielt in der Kajan-Gesellschaft eine wichtige Rolle. Während bei andern Völkern die Frau oft die Beute des Stärksten wird und in die Verhältnisse ihres Gemeinwesens nicht genug Einsicht besitzt, um sich nicht durch die eine oder andere glänzende Eigenschaft eines Mannes blenden zu lassen, steht die Frau im Staate der Kajan am Mendalam z.B. ebenso selbständig da wie der Mann, bestimmt mit derselben Einsicht wie dieser ihr Tun und Lassen und bietet ihren Neigungen dadurch einen festeren Halt. Die besonders bevorzugte Stellung der Frau unter den Mendalam-Kajan muss aber wohl dem Nebenumstande zugeschrieben werden, dass die Männer dieses Stammes besonders langdauernde Handelsreisen unternehmen, wodurch die Frauen zu Hause mehr Einfluss bekamen als die der Stämme am Mahakam.
Auch am Mendalam hat das stärkere Geschlecht die Neigung, das schwächere auf den zweiten Platz zu drängen. Bald nach meiner Ankunft sprach Akam Igau in einem Gespräche unter vier Augen sein Bedauern darüber aus, dass die Frauen seines Stammes sich so viel Geltung verschafft hätten. Der alte Herr war in seinem Leben viel [478] gereist und sah die Zustände seines Stammes mit anderen Augen an als die meisten; die bevorrechtete Stellung, welche die Männer bei den Malaien einnehmen, gefiel ihm weit besser.
Bemerkenswerter Weise scheint diese Gleichstellung der Geschlechter mit einer beinahe vollständigen Abwesenheit geschlechtlicher Entartungen, wie man sie in den Stämmen vom Barito beobachtete, zusammenzufallen.
Auch wenn die heftigsten menschlichen Leidenschaften, wie die Liebe, im Spiele sind, kommt es in der Bahaugesellschaft nicht zu Händeln. Man erzählte mir, dass die Kajanfrauen, wenn sich ihre Neigungen kreuzen, bisweilen mit einander in heftigen Konflikt geraten; während meines Aufenthaltes bemerkte ich aber nichts davon.
Es wäre jedoch falsch, diesen Mangel heftiger Äusserungen einer gegenseitigen Gleichgültigkeit der Geschlechter zuzuschreiben. Ich hatte im Gegenteil öfters Gelegenheit zu beobachten, dass sowohl Männer als Frauen in ihren Neigungen eine grosse Standhaftigkeit zeigen und imstande sind, ihnen viele und langdauernde Opfer zu bringen.
So gab mir einst ein junger Häuptling seine Entrüstung darüber zu erkennen, dass sein Mädchen sich während seiner Abwesenheit zu viel mit einem andern abgegeben hatte; für ihn war dies Grund genug, mit ihr zu brechen.
Als Akam Igau einst das Bedürfnis fühlte, sein bedrücktes Gemüt von einem Teil seiner Sorgen zu entlasten, erzählte er mir die rührende Liebesgeschichte seiner zweiten Tochter Paja. Diese, ein auffallend schönes, ungefähr 18 jähriges Mädchen, liebte seit 4 Jahren einen jungen Häuptling, Tĕkwan, dessen Haus sich in der Nähe der Ma-Suling am Oberlauf des Mendalam befand. Es war mir schon auf unserem Zuge nach dem Mahakam aufgefallen, wie sehr sich der junge Mann bemühte, dem alten Igau bei jeder Gelegenheit behilflich zu sein. Leider standen der Vereinigung der jungen Leute grosse Hindernisse im Wege. Tĕkwans Vater gehörte bedauerlicher Weise nicht zu den Gescheidten seines Stammes; und so wollte seine Mutter Ping nicht zugeben, dass er, die wichtigste Stütze des Haushalts, die elterliche Wohnung verlasse, um bei seiner jungen Frau Einzug zu halten. Nach ihrer Beredsamkeit zu urteilen, war sie übrigens sehr wohl imstande, ihre ganze Umgebung allein zu beherrschen; wenigstens wohnte ich einer Unterhandlung zwischen ihr und Akam Igau über diesen Gegenstand bei, die 3 Stunden dauerte und für die meine Hütte, als [479] neutrales Gebiet, zum Zusammenkunftsort gewählt wurde. Aber Igau sah sich als Häuptling noch besonders verpflichtet, die alten Gebräuche hoch zu halten, und duldete daher nicht, dass Paja gegen alle gute Sitte sogleich ihrem Manne in sein Haus folgte. Tĕkwan wiederum war zu arm, um die Busse für die Übertretung der adat zu bezahlen.
Die Familien beider Parteien hatten bereits die Geduld verloren, aber Paja und ihr Liebhaber liessen nicht von einander und widerstanden allen Verlockungen von anderer Seite.
Adat und Liebestreue gewannen aber zum Schluss doch den Sieg; denn Tĕkwan zog in Akam Igaus Wohnung und bei meinem 2. Besuche fand ich das Paar vereint in Tandjong Karang; kurz vor meiner Abreise wurde Tĕkwan glücklicher, aber etwas unbeholfener Vater eines kräftigen Sohnes.
An starkem und tiefem Liebesempfinden fehlt es den Kajan also nicht. Wenn die Leidenschaft sie nicht zu ernsten Konflikten mit ihren Nächsten hinreisst, so ist der Grund dafür in ihrem Charakter zu suchen, der wenig zu heftigen Ausbrüchen geneigt ist.
Mit den Äusserungen der Dankbarkeit den vielen Wohltaten gegenüber, welche sie von mir genossen, hatte es unter diesen Stämmen eine besondere Bewandtnis.
Die Erklärungen, die die Bahau über Zweck und Ziel meiner Reisen und meines Lebens in ihrer Mitte gaben, waren für ihre Denkweise sehr charakteristisch. Den wissenschaftlichen Zweck meiner Reisen und das Sammeln ihres Hausgerätes und anderer Artikel konnte ich ihnen absolut nicht begreiflich machen. Trotz meiner Gegenversicherungen blieben sie bei dem Glauben, dass ich auf einem Handelszuge begriffen sei und dass mir die Sammlungen bei meiner Rückkehr grossen pekuniären Gewinn bringen würden. Mit der Zeit merkten sie jedoch, dass ich mich anders als die malaiischen Kaufleute betrug, und da fügten sie dem ersten Reisemotiv noch ein zweites, spezifisch Bahauisches hinzu, dass mir daran gelegen sei, bei meiner Heimkehr als grosser Reisender gefeiert zu werden. Dass jemand auf die Idee kommen konnte, sich Menschen und Natur aus Interesse an sich anzusehen, ging über ihren Horizont.
Logischer Weise heuchelten sie auch keine Dankbarkeit dem Fremden gegenüber, der nach ihrer Überzeugung aus den ihnen erwiesenen Wohltaten später genügend Vorteil ziehen würde. Sie boten mir auch auffallend wenig materielle Zeichen ihrer Anerkennung. Das ungewöhnliche [480] Vertrauen, das mir besonders von Frauen und Kindern entgegengebracht wurde und das Malaien und Chinesen nie genossen, musste mich für alles andere entschädigen.
Die Kajan machten in ihrem Betragen meinem Bedienten und mir gegenüber einen grossen Unterschied. Midan stand mit ihnen zwar auch auf freundlichem Fusse, aber sie zogen von ihm lange nicht so viel Vorteil, als von mir, und doch sah ich anfangs mit Verdruss, dass sie freiwillig alles für ihn taten und ihm sogar Sirih und selbstgebauten Tabak schenkten, wofür sie von mir so viel als möglich zu erpressen suchten.
Das Wohlwollen einzelner Männer erkannte ich daraus, dass sie ihr Äusserstes taten, um etwas Schönes für mich herzustellen. Sie liessen sich aber später eine gute Summe dafür bezahlen, selbst dann, wenn ich ihren Familien meine ärztliche Hülfe, wie immer, umsonst zu teil werden liess.
Ganz gleich betrug sich die Bevölkerung am Mahakam. Nur brachte diese von Anfang an kleine Geschenke als Gegenleistung für meine medizinische Behandlung mit. Hier machte aber Kwing Irang dadurch alles gut, dass er allein mir im Gegensatz zu meinen Reisegefährten beim Abschied Waffen zum Geschenk brachte, was am Mendalam nicht geschah. Es ist jedoch möglich, dass Akam Igau mir Dankbarkeit genug zu erzeigen glaubte, indem er mich für 100 Dollar zum Mahakam begleitete; es wäre dies der Auffassung der Bahau gemäss, die zwar nie als Kuli auf Reisen gehen, aber den Fremden und seine Sachen doch gegen eine Entschädigung weiter führen. In gewissem Grade fühlen sie sich dann auch für seine Sicherheit verantwortlich.
Im Gegensatz zu den Männern, von denen keiner sich überwinden konnte, mir seine Dankbarkeit durch ein materielles Opfer zu bezeigen, suchten einige junge Frauen, so wenig Gunstbezeigungen sie von mir auch erhalten hatten, mir alles zu verschaffen, wovon sie glaubten, dass es mir Freude bereiten könnte. Eine ältere Frau brachte mir öfters Naschwerk und freute sich, wenn es meinen Beifall hatte; später trotzte sie dem Unwillen ihrer fanatischen und unliebenswürdigen Schwester, indem sie mir religiöse Gegenstände verfertigte, die ich noch nicht besass. Die Bestimmung des Preises überliess sie dabei vollständig meinem Gutdünken. Die zweite war zu jung, um sich durch Herstellung von Leckereien und Arbeiten verdient zu machen, aber sie verkaufte mir einige alte Sachen, ohne auf den Preis zu sehen. [481]
Ulo Embang war in Tandjong Karang auch die einzige Frau, die mir am Abend vor der Abreise als Zeichen ihrer Zuneigung ein Huhn brachte. Ganz gegen ihre Gewohnheit, abends das Haus zu verlassen und unbegleitet zu mir zu kommen, erschien sie, als die Nacht bereits eingebrochen, mit ihrem Huhn in meinem Zelte und stand dabei so sehr unter dem Eindruck des bevorstehenden Abschieds, dass sie kaum ein Wort hervorbringen konnte. Ich versuchte, sie zu zerstreuen und zu trösten, und wurde dabei später durch ihre Tante, nach Usun die älteste und oberste Priesterin von Tandjong Karang, unterstützt. Auch sie hatte mir viele Beweise ihrer Erkenntlichkeit gegeben, aber schon ihr Äusseres verriet die ernste Matrone, die sich z.B. über ihre spezielle Wissenschaft nie geäussert hätte. Bemerkenswert war der Takt, mit dem sie ihre Nichte dazu brachte, sich unserem peinlichen Zusammensein zu entziehen. Sie sprach zuerst über das Zeichen der Zuneigung, das mir Ulo gegeben, dann über meine eventuelle Rückkehr und die Schwierigkeiten der Mahakamreise; dabei legte sie voll Mitgefühl die Hand auf Ulos Arm und geleitete sie so nach Hause.
Aus Furcht, in meiner Achtung zu sinken, hatte mir Ulo bis zuletzt ein Leiden verschwiegen, das ich bei anderen Frauen ihres Stammes mit Erfolg kuriert hatte.
Die übrigen Kajanfrauen gaben mir bei der Abreise ihre Wertschätzung auf sehr eigentümliche Weise zu erkennen. Sie fürchteten, dass die Seelen ihrer Kinder ihrem Wohltäter folgen könnten, und hielten mir daher beim Abschied die hăwăt hin, um die Seelen der Kinder durch Gebetssprüche zu bewegen, von mir wieder auf die Tragbretter zurückzukehren. An jede hăwăt hatten sie eine Schnur befestigt, um die Seele bei ihrer Rückkehr mittelst eines Knotens zu binden. In den Knoten steckten sie darauf ein Fingerchen der Kleinen, damit die Seele endlich in ihren richtigen Wohnplatz zurückgeleitet werde.
Hauptsächlich die einflussreichen alten Männer bezitzen ein stark entwickeltes Ehrgefühl, das sie bisweilen einen eigenen Vorteil übersehen lässt, nur um sich nicht haè zu fühlen. So bot mir einst einer der vornehmeren Männer einen durch sein Alter wertvollen Hammer zum Kaufe an. Gewöhnt übervorteilt zu werden und den wahren Wert des Stückes nicht kennend bot ich viel zu wenig. Der Mann hielt aber das Feilschen für unter seiner Würde und liess mir den Hammer für den gebotenen Preis. Erst viel später erfuhr ich, dass er [482] der Mann mir den Hammer für ⅓ des wahren Preises überlassen hatte, und beeilte mich, ihm den Rest zukommen zu lassen.
Ein anderer nahm ohne Widerrede das Geld an, das ich ihm für einen eigenartigen Schwertgriff bot; auch er hatte, wie ich später hörte, viel zu wenig erhalten.
Viele Kajan hielten es auch für unter ihrer Würde, in einem Buche abgebildet zu werden, wovon sie wahrscheinlich durch die Malaien gehört hatten; für die Aufnahme von Photographieen war dies mit ein erschwerender Umstand.
Hieraus geht hervor, dass die Bahau sowohl am Kapuas als am Mahakam für meinen Aufenthalt unter ihnen dankbar waren, in der Äusserung einer Anerkennung jedoch so sparsam zu Werke gingen, dass ich sie leicht für undankbar hätte halten können. Bei meinem späteren Besuch bei den Kĕnja merkte ich, dass die Bahau auch im Äussern von Dankesbezeugungen weit hinter diesen zurückstanden.
Aus dieser Skizze ihrer Persönlichkeit geht hervor, dass die Bahau psychisch keine kräftigen, vielmehr furchtsame, reizbare Naturen sind. Einzelne gute Eigenschaften der Menschen kommen bei ihnen nur ihren Familiengliedern gegenüber zum Vorschein; anderen Stammesgenossen und besonders Fremden gegenüber beherrscht der kleinliche Egoismus ihrer schwachen furchtsamen Persönlichkeit alle ihre Handlungen. In dieser Hinsicht steht ihr geistiges Wesen völlig in Übereinstimmung mit dem leiblichen und wir können hieraus den Schluss ziehen, dass die höchst ungünstigen Lebensbedingungen, unter denen die Bahau leben, auf ihre psychischen Anlagen ebenso nachteilig gewirkt haben wie auf die physischen.
Einen Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme finden wir in dem Bilde, das wir von den Kĕnjastämmen erhielten, die unter so viel günstigeren klimatischen Einflüssen leben und daher nicht nur körperlich, sondern auch geistig viel kräftiger als die Bahaustämme gediehen sind.
Die Bahau müssen in früherer Zeit, als sie unter dem degenerierenden Einfluss des Talklimas noch nicht gelitten hatten, körperlich und geistig ebenso kräftig gewesen sein wie ihre Stammverwandten, die Kĕnja. Nach ihrer Geschichte waren sie am Anfang des 19. Jahrhunderts sowohl durch ihre Kopfjagden als durch ihre grossen Kriegszüge bis weit in das Stromgebiet des Kapuas, Barito und Mahakam bekannt geworden und kein Stamm konnte [483] ihnen widerstehen; gegenwärtig sind, wie wir gesehen haben, solche Unternehmungslust und Tapferkeit unbekannte Eigenschaften bei ihnen geworden.
Für einen europäischen Reisenden, der auch nach langdauerndem Verkehr fortwährend mit Kleinlichkeit, Ängstlichkeit und Misstrauen bei den Bahau zu kämpfen gehabt hat und der in seinen Unternehmungen ständig durch die eigentümlichen religiösen und anderen Überzeugungen dieser Umgebung gehindert worden ist, erscheint der Unterschied gegenüber den Kĕnja natürlich sehr auffallend.
Bereits bei meiner Ankunft in Apu Kajan bemerkte ich, dass die 150 Kĕnja, die mir unter ihren vornehmsten Häuptlingen zu Hilfe gekommen waren, in ihrem Auftreten viel freier und lauter waren als mein Bahaugeleite, dass ihre Häuptlinge viel energischer ihre Befehle erteilten und man ihnen auch besser gehorchte. Bei meinem Aufenthalt in ihren Dörfern wurde dieser Eindruck auch durch das freimütige Auftreten der Frauen und Kinder sehr verstärkt. Schon die jungen Kĕnja zeigten einen auffallenden Unterschied gegenüber den jungen Bahau.
Bemerkenswert ist die grössere Ausdauer der Kĕnja bei der Arbeit; sie fiel mir hauptsächlich bei unseren langen Fahrten in den Böten bei der für sie ungewöhnlichen Hitze des Mahakam auf. Obgleich sie in ihrer Gebirgsheimat mehr an das Gehen als an das Rudern gewöhnt waren, ruderten sie doch Tage lang viel besser als die Bahau und kamen auch stets viel früher an als diese.
Für unangenehme Gerüche waren die Kĕnja viel weniger empfindlich als die Bahau, die lieber einen grossen Umweg machen, als dass sie an einem Kadaver vorübergehen, und durch Gebärden und Spucken heftig auf schlechte Luft reagieren.
Während ich bei der Erzählung von den Merkwürdigkeiten unserer europäischen Gesellschaft bei den Bahau auf ein absolutes Unvermögen der Vorstellung stiess, was Unglauben verursachte und sie dazu veranlasste, zu versuchen, mich oft erst viel später auf einer Unwahrheit zu ertappen, bemerkte ich sehr bald an den Fragen der Kĕnja, dass sie sich doch wenigstens bemühten, sich Eisenbahnen und Ähnliches vorzustellen, und dass sie manche Dinge auch wirklich begriffen. Hauptsächlich lieferte die Erklärung der Bewegung der Sonne und der Sterne und der Entstehung von Tag und Nacht, sowie eine Sonnen- und Mondfinsternis ein gutes Kriterium. Natürlich glaubten auch die Kĕnja [484] nicht sogleich, dass die Erde rund ist und sich bewegt, ebensowenig, dass nicht ein Ungetüm bei der Finsternis Sonne oder Mond verschlingt, aber sie begriffen doch wenigstens meine Erklärung.
Praktisch sehr wertvoll für uns waren das grössere Interesse, das die Kĕnja ihrer Umgebung entgegenbrachten, und die besseren Kenntnisse, die sie von ihr besassen. Während wir von den Bahau bei der topographischen Aufnahme des Mahakam nicht einmal die Namen der wichtigsten Berge und Flüsse in der Umgegend erfahren konnten, führte mich der Kĕnjafürst Bui Djalong auf den Gipfel eines Berges und nannte mir bis zum Horizont zu alle Namen der Berge, auch derer im Mahakamgebiet, die wir unterscheiden konnten; er gab die zu den verschiedenen angrenzenden Gebieten führenden Wege an, ebensogut als dies ein Europäer getan haben würde.
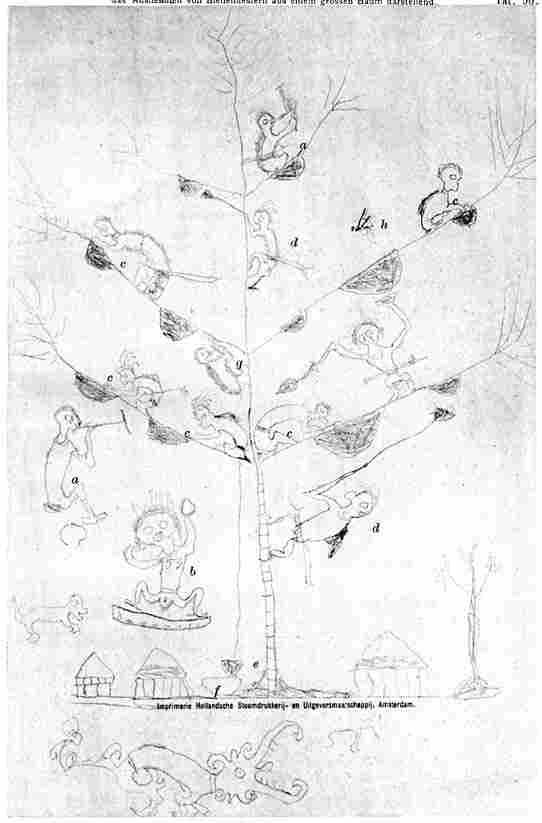
Zeichnung eines Kĕnja Uma-Tow.
Bei niedrigstehenden Völkern ohne Schrift geht die Erinnerung an frühere Ereignisse gewöhnlich schnell verloren, so wussten die Bahau kaum noch etwas über ihre Vorfahren, die Kĕnja dagegen kannten sogar noch die Überlieferungen der Bahau aus der Zeit, wo auch sie noch in Apu Kajan wohnten.
Mit ihrer stärker entwickelten Psyche stehen bei den Kĕnja auch Erscheinungen in Verbindung, die auf eine kräftigere Behauptung der Persönlichkeit ihrer Umgebung gegenüber schliessen lassen. So sind sie mutiger als die Bahau und üben daher nicht deren hinterlistige, feige Art der Kriegsführung. Sie kämpfen, wie bereits gesagt, in Banden, Mann gegen Mann, wobei hauptsächlich das Schwert gebraucht wird und erst der Tod vieler Kämpfer die Schlacht beendet. Obgleich auch bei ihnen Kopfjagden üblich sind, so treten sie doch mehr in den Hintergrund und zeugen auch mehr von persönlichem Mut. Ich erinnere hier an den Fall, wo ein junger Kĕnjahäuptling bei einem Besuche am Mahakam während eines Kriegstanzes einem der zahlreichen Zuschauer plötzlich den Kopf abschlug und mit diesem die Flucht ergriff. Verräterisch war diese Tat sicher, aber es gehörte doch Mut dazu, um sie auf einer grossen Galerie unter vielen Menschen auszuführen.
Wohnt man unter den Bahau, so ist es einem ärgerlich mit anzusehen, wie sie sich von den Malaien ausbeuten lassen, die auf ihre Kosten von Betrug, Diebstahl und Grabschändung leben. Die Kĕnja sind weniger langmütig; wenn die Malaien es zu arg bei ihnen treiben, werden sie einfach niedergemacht. Infolge ihres grossen Misstrauens gegen uns und die eigenen Stammesgenossen [485] brachten wir die Bahau nur ab und zu einmal unter 4 Augen zu einer freien Äusserung ihrer Gedanken; einen unvergesslichen Eindruck auf uns Europäer machte dagegen das offene Auftreten der Kĕnja bei ihren politischen Versammlungen, wo so wichtige Angelegenheiten wie das Zusammengehen mit dem Radja von Sĕrawak oder der niederländischen Regierung öffentlich behandelt wurden.
Eigentümlich ist es zu verfolgen, welchen Einfluss das lebhaftere, mutigere, rohere und weniger empfindliche Wesen der Kĕnja auf deren Zusammenleben geübt hat. Während die Bahau am Mahakam eine ganz unzusammenhängende Gruppe von Stämmen bilden, in welchen jedes Individuum sich frei und berechtigt fühlt, den eigenen Vorteil als das Höchste zu betrachten, wodurch die Häuptlinge machtlos sind und auf die gemeinsamen Stammesinteressen keinen Einfluss ausüben können, bilden die Kĕnjastämme ein zusammenhängendes Ganzes unter der anerkannten Oberherrschaft eines Stammes und eines Oberhäuptlings und jedes Glied fühlt sich abhängig und verantwortlich für die Interessen der anderen.
In der geordneteren Gesellschaft der Kĕnja machte sich auch deren höhere Moral mehr geltend. Ihre Häuptlinge waren selbstloser, besassen mehr sittlichen Mut und genossen mehr Vertrauen seitens ihrer Untertanen. Wagten die Bahauhäuptlinge z.B. nicht, bei einer Löhnung ihrer Stammesgenossen in Form von verschiedenen Artikeln die Austeilung vorzunehmen, so rechneten die Kĕnjahäuptlinge ohne Furcht vor Unzufriedenheit und Streitigkeiten selbst aus, wieviel jedem zukam, und führten dann die Verteilung im eigenen Hause aus.
Als sich bei meiner Rückkehr zum Mahakam Hunderte von Kĕnja zu meiner Begleitung vorbereiteten, mussten die meisten von ihnen wegen schlechter Vorzeichen zurückkehren; auch die Häuptlinge hätten dies tun müssen, doch schickten sie nur ihre Untertanen zurück und gingen selbst mit wegen der Wichtigkeit einer Fortführung der Unterhandlungen. Bei den Bahau hätte kaum je ein Häuptling sich verpflichtet gefühlt, die allgemeinen Interessen zu vertreten, vollends bei ungünstigen Vorzeichen.
Auch das Betragen ihrer Untertanen unterwegs war ganz anders als bei den Bahau. Die 80 Kĕnja, denen es doch noch gelang, alle guten Zeichen zu finden und mitzufahren, bildeten, obgleich sie aus verschiedenen Dörfern stammten, auf der Reise eine Gemeinschaft, die ihre Lebensmittel gemeinsam verbrauchte und sogar mit uns und [486] unseren Bahau teilte, als unser Vorrat erschöpft war; auch vertrauten sie meiner Versicherung, ihnen am Mahakam neue Lebensmittel kaufen zu wollen. Die zahlreichen Gruppen meines Bahaugeleites dagegen teilten niemals freiwillig ihren Reis und, als meine Malaien auf der Hinreise in grosse Reisnot gerieten, suchten sie aus dieser kritischen Lage ihren Profit zu ziehen.
Trotz der sehr grossen Vorteile, die die Bahau aus unserem Aufenthalt bei ihnen zogen, gaben sie mir, wie schon gesagt, höchst selten ein Zeichen von Dankbarkeit, nur schenkten sie mir ein grösseres Vertrauen als anderen Fremden. Als ich dagegen einen Kĕnjastamm nach sechstägigem Besuch verliess, kam die Familie des Häuptlings, um sich bei mir für alles zu bedanken, was ich ihrem Stamm an Tauschartikeln, Geschenken und Arzneien gegeben hatte.
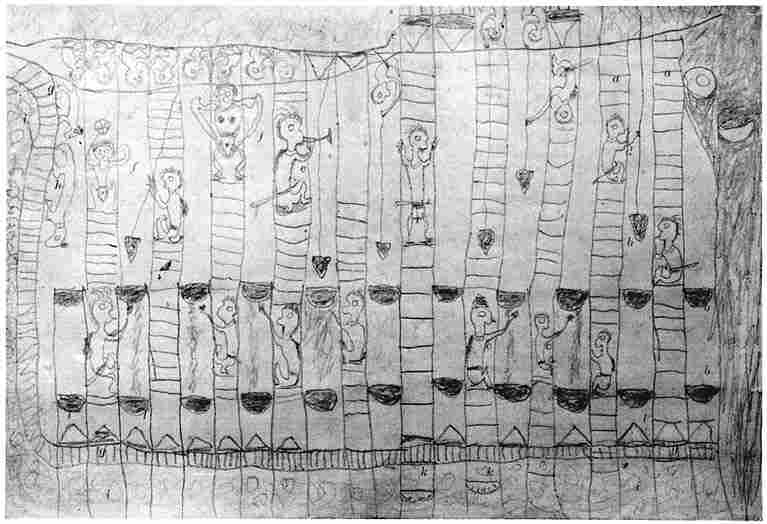
Zeichnung eines Kĕnja Uma-Tow.
Die kräftigere Persönlichkeit der Kĕnja äussert sich auch noch in dem Grade, in welchem ihre religiösen Begriffe auf ihr Leben einwirken. Wie auch nicht anders zu erwarten ist, lassen sich diese körperlich und geistig kräftigeren Stämme um ihres Glaubens willen die auf ihr Bestehen drückenden Bande der pe̥māli und Vorzeichen nicht so geduldig gefallen, wie die körperlich und geistig schwächeren und daher ängstlicheren Stämme. Der Unterschied zwischen Bahau und Kĕnja ist hierin am bemerkenswertesten. Beide Stammgruppen haben ja den gleichen Gottesdienst und ihre pe̥māli und Vorzeichen sind im Grunde dieselben, nur sind diese bei den Bahau mehr bis in Kleinigkeiten entwickelt als bei den Kĕnja. Unter ersteren sind alle Erwachsenen verpflichtet, den pe̥māli streng nachzuleben, unter letzteren ist dies mehr den Priestern aufgetragen, so dass die Masse der Bevölkerung sich freier bewegen kann. Bei den Bahau z.B. darf niemand Hirschfleisch essen, bei den Kĕnja ist dieses nur den Priestern verboten. Während die Bahau sich bei ihrem Reisbau nur wenig nach Trockenheit und Regen oder nach dem Zustand ihrer Felder richten, sondern alle Stammesglieder sich dem Häuptlinge fügen, der die erforderlichen Zeremonien für bestimmte Feldarbeiten verrichten lässt, beachten die Kĕnja diese sehr hinderlichen und nachteiligen Vorschriften nur in viel geringerem Masse. Zwar lässt auch bei diesen der Häuptling die nötigen Zeremonien ausführen, doch ist dann jeder frei, mit seinem Felde vorzunehmen, was ihm gutdünkt, wodurch die Ernteaussichten wesentlich gebessert werden. Die Bahau klammern sich ganz allgemein viel ängstlicher an ihre pe̥māli als die Kĕnja. [487] Trotz eines jahrelangen Zusammenwohnens mit jenen fühlte ich mich doch verpflichtet, mich ebenso streng an ihre Auffassungen zu halten wie sie selbst. Nur in sehr dringenden Fällen wagte ich, in ihrer Verbotszeit auf Reisen zu gehen oder einen Kranken zu empfangen und war daher ebenso wie sie von der Aussenwelt abgeschlossen. Ihre eigenen Dorfgenossen liessen sie einst nach einem 8 monatlichen Zuge bei der Rückkehr lieber im Walde bleiben und hungern, als dass sie das lāli im Dorf geschändet hätten, indem sie die Heimkehrenden einliessen oder ihnen Essen brachten. Als ich dagegen, wie in der Reiseerzählung berichtet, mit meinen Begleitern bei den Kĕnja ankam, und im Hause des vornehmsten Häuptlings ebenfalls lāli herrschte, liess er für die priesterliche Familie, die sich in seinem Hause befand und die Hauptträgerin der pe̥măli bildete, schnell ein neues Haus bauen, wonach er uns bei sich aufnehmen durfte. Ähnliche Beispiele sind an anderer Stelle bereits erwähnt worden.
Die Kĕnja suchen vor jeder Unternehmung ebenso gewissenhaft wie die Bahau nach guten Vorzeichen, aber sobald diese mit den Forderungen des Augenblicks in Konflikt geraten, wagt man sie zu vernachlässigen. Droht eine Gefahr, liegt z.B. der Feind in der Nähe versteckt, so achten die Kĕnja überhaupt nicht auf die Omina. Wir sehen also, dass bei den Bahau die strengere Befolgung eines entwickelteren Systems religiöser Gebräuche gleichen Schritt hält mit ihrem Rückgang in vielen physischen und psychischen Eigenschaften.
Auf Grund der vorhergehenden Ausführungen glaube ich für die Dajak von Mittel-Borneo bewiesen zu haben, dass ihre geringe Volksdichte hauptsächlich von den ungünstigen hygienischen Verhältnissen, unter denen sie leben, und ihrem niedrigen Entwicklungsstandpunkt abhängig ist, ferner, dass diese Umstände nicht nur in körperlicher sondern auch in geistiger Hinsicht höchst nachteilige Folgen für sie gehabt haben. Eine kräftige Stütze für diese Behauptung fanden wir in den Kĕnja, die, was die Bevölkerungszahl und geistige Entwicklung betrifft, so viel günstigere Verhältnisse aufweisen, was schwerlich, einem anderen Umstand zugeschrieben werden kann, als der höheren Lage ihres Wohnplatzes, wo vor allem die Malaria so viel weniger heftig auftritt. [488]
Kapitel XVII.
Verhältnis zwischen der dajakischen, malaiischen und europäischen Rasse auf Borneo—Malaiische Regierungsprinzipien—Einfluss der Malaien auf ökonomischem und religiösem Gebiet—Unterdrückung und Ausbeutung der dajakischen Stämme durch die malaiischen Fürstenfamilien—Degeneration der ursprünglichen Bevölkerung—Furcht der Dajak vor den sĕrawakischen Stämmen—Segensreicher Einfluss einer europäischen Verwaltung—Gründung des Fürstentums Sĕrawak unter James Brooke und die günstigen Resultate von dessen Wirksamkeit.
Die an den West-, Süd- und Ostküsten von Borneo wohnenden Stämme gehören der malaiischen Rasse an. Obgleich sie in manchen Gegenden sich stark mit fremden Elementen vermengt haben, wie mit Javanern (Südküste), Buginesen und Arabern (Westküste), Buginesen und Toradjas (Ostküste), treten bei den Bewohnern der an den Küsten gelegenen Fürstentümer in Sprache, Sitten und Gebräuchen die malaiischen Eigentümlichkeiten noch stark hervor. Anders verhält es sich an den grossen Strömen, längs welchen sich die Malaien, die vorzugsweise Händler sind, bis tief ins Innere niedergelassen haben. An diesen Handelswegen gründeten sie an der Mündung grösserer Nebenflüsse Niederlassungen, so entstanden am Kapuas Tajan, Sanggau, Sekadau, Sintang, Binut und zahlreiche andere.
Die kleinen, durch ständige Fehden unter einander entzweiten dajakischen Stämme waren den energischeren Malaien, unter denen die Einheit der Sprache und des Gottesdienstes ein festeres Band bildete, nicht gewachsen, und die Lage ihrer Niederlassungen ermöglichte es den Malaien, bei der Abwesenheit von Landwegen, den Handelsverkehr mit den flussaufwärts wohnenden Dajak vollständig zu beherrschen. Die malaiischen Fürsten erhoben auf die ein- und ausgeführten Handelswaren hohe Steuern, auch unterwarfen sie sich die benachbarten Dajakstämme, so weit als dies ohne grosse Kosten geschehen konnte. Da die malaiischen Fürsten sich ausschliesslich zum pekuniären Vorteil mit dem eigenen Volk und den unterworfenen Stämmen befassen, [489] reicht die Unterwerfung der dajakischen Stämme in der Regel nicht hoch an die Nebenflüsse hinauf; kostet es keine Opfer, so werden die Dörfer der Eingeborenen oft genug gebrandschatzt, obgleich sich die Dajak bereits auf möglichst grosse Entfernung von den Malaien zurückgezogen haben.
Von Interesse ist, dass sich die Malaien die Ausbreitung des Islams unter den Dajakstämmen sehr wenig angelegen sein lassen; den Fürsten wäre sie sogar sehr unerwünscht, da sie aus heidnischen Untertanen ein viel grösseres Einkommen ziehen können als aus ihren eigenen Glaubensgenossen. Doch trägt die Anwesenheit der Malaien trotzdem viel zur Verbreitung des Islams bei, weil sie sich oft mit dajakischen Frauen verheiraten, die zu diesem Zweck Mohammedanerinnen werden müssen; ferner denken die Dajak, dass auch die Religion von Menschen, denen eine grössere Weltkenntnis eigen ist und die im Besitze der Produkte höherer Kulturvölker sind, mehr wert sein müsse als die ihrige; das hochmütige Benehmen der Malaien gegenüber den Helden bestärkt diese noch in dieser Meinung. So kommt es, dass die Dajak ziemlich leicht zum Islam übergehen, was für sie auch sehr einfach ist, da von einer inneren Überzeugung von den höheren Vorstellungen, welche drem Islam zu Grunde liegen, nicht die Rede zu sein braucht und sie beim Übertritt eigentlich nur auf den Genuss von Schweinefleisch verzichten und die Glaubensformel nachsprechen müssen. Dem gegenüber geniesst der Dajak den Vorteil, nicht nur Mohammedaner, sondern nach der Volksauffassung zugleich Malaie geworden zu sein. Der Name Malaie erhält hierdurch für die borneoschen Binnenlande eine besondere Bedeutung, insofern als in der dortigen Bevölkerung alle Blutmischungen von rein malaiischer bis zu rein dajakischer Rasse vertreten sind. Natürlich verhält es sich ebenso mit den Sitten und Gewohnheiten und dem Glauben.
Die Ausbreitung der malaiischen Fürstentümer ist an den verschiedenen Küsten nicht gleich weit in die Binnenlande vorgedrungen. Am weitesten ist dies an der Westküste geschehen, wo die Malaien sich so hoch den Kapuas hinauf niederliessen, als der Fluss das ganze Jahr über für Handelsfahrzeuge schiffbar ist. Im Süden nehmen sie nur das Mündungsgebiet der Flüsse ein, ausser am Barito, wo das einst mächtige Reich der Sultane von Bandjarmasin sich sehr weit am Unterlauf ausstreckte und wo die in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von den Niederländern gegen diese Fürstenfamilie geführten [490] Kriege diese und ihren Anhang immer höher den Fluss hinauf trieben bis in das noch unerforschte Quellgebiet des Murung. Die malaiischen Reiche im Osten der Insel sind auf die Küstenstreifen beschränkt, mit Ausnahme des mächtigen Sultanats von Kutei, das sich bis zum Mujub hinauf ausdehnt.
Was die Unterwerfung von Stämmen und die hieraus erwachsenden Herrscherrechte betrifft, so huldigen die Malaien der höchst eigentümlichen Auffassung, die übrigens nicht auf Borneo beschränkt ist, dass jedem malaiischen Fürsten, der im stande ist, sich an einer Flussmündung zu halten und dort den Handelsmarkt zu beherrschen, das ganze Gebiet des betreffenden Stromes zugehört und dass alle Stämme, die an diesem wohnen, ihm tributpflichtig sind. Diese Auffassung ist insofern praktisch sehr wichtig, als die Fürsten beim Abschluss eines politischen Kontrakts diese Ansprüche stets den Europäern gegenüber geltend gemacht haben, und da diesen öfters die wahren Verhältnisse an den Flussoberläufen gänzlich unbekannt waren und sie die Macht der Malaien sehr überschätzten, sind hierdurch Kontrakte geschlossen worden, die überhaupt nicht auf einen tatsächlich bestehenden Zustand gegründet sind.
Von grosser Bedeutung für den Einfluss, den die Malaien auf die ursprünglichen Dajak ausgeübt haben, ist der Umstand, dass infolge der starken europäischen Nachfrage nach Waldprodukten die Malaien tiefer und tiefer ins Innere gedrungen und gegenwärtig beinahe überallhin gelangt sind, wenn man auch in Mittel-Borneo nur mit malaiischen Individuen und nicht mit malaiischen Reichen zu rechnen hat.
Untersuchen wir im folgenden, ob dem malaiischen Volkswesen, das so viele Jahrhunderte mit Kulturvölkern in Berührung gewesen ist, wie man erwarten sollte, in der Tat ein so viel höherer Grad der Entwicklung eigen ist als dem dajakischen und in wie weit es auf letzteres fördernd hat wirken können.
An der Westküste, wo die Sultanate von Sambas und Matan sich fast selbständig haben entwickeln können, finden wir eine malaiische Bevölkerung, die am liebsten von Handel und Fischfang (früher auch von Seeräuberei) lebt, die sich nur im Notfall mit Ackerbau beschäftigt und auf industriellem Gebiet wenig produziert. Obgleich die Malaien auf ihren Handelsreisen ständig mit höher entwickelten Völkern in Berührung kamen, steht in Sambas der Ackerbau doch noch auf [491] der gleichen niedrigen Stufe wie bei den im tiefsten Innern wohnenden Dajak. Hier lernte ich zum ersten Mal das Fällen und Verbrennen von Wald und Busch und das Pflanzen von Reis, Mais, Bataten und Zuckerrohr in den mit Asche bedeckten Boden kennen. Der Acker erfährt hierbei keine andere Behandlung, als dass mit einem zugespitzten Holzstock Löcher in den Boden gestossen werden, in weiche später die Saat gelegt wird; beim Pflanzen von Zuckerrohr werden kleine Erdhaufen aufgeworfen. Jährlich oder alle 2 Jahre werden auch bei den Malaien die Felder verlegt; sie entschliessen sich jedoch nur schwer, zur Anlage eines neuen Ackers Urwald zu fällen, und begnügen sich mit einem Boden, der mit höchstens 5–6 Jahre altem Strauchwerk bewachsen ist. Was das Gewerbe in Sambas betrifft, so wird fast alles Eisenwerk und Kattun eingeführt; an Gegenständen, deren Verfertigung Geschicklichkeit und Geschmack erfordert, findet man nur einige Webereiartikel in Kattun und Seide, verziert mit Goldstickerei, und einige Kupferarbeiten. In einigen Dörfern waren die Häuser allerdings aus festem Holz gebaut, aber von einer behaglichen Einrichtung und schön verziertem Hausgerät war nichts zu erblicken. Beim Eintritt ins Haus fallen nur geschmacklose, aus europäischen Stoffen verfertigte Moskito-Gardinen, einige Koffer und etwas Kupfergerät ins Auge. Herrscht an grösseren Orten bei einigen Familien eine gewisse Wohlhabenheit, so hat man es stets mit Arabern oder Bandjaresen, die Grosshandel treiben oder getrieben haben, zu tun.
Hätten die Malaien Anlage und Lust, sich mit Kunst und Geschmack eine behagliche Umgebung zu schaffen, so würde man hiervon am ehesten in den Sultansfamilien, die aus dem Lande der Dajak so grosse Apanagen beziehen, etwas merken. Aber auch in diesen Häusern findet man, ausgenommen den mit europäischen Möbeln ausgestatteten Empfangssaal des Palastes, nur weisse, gewöhnlich nur mit Kalk bestrichene Wände und das notwendigste, oft schlecht unterhaltene Hausgerät.
Arbeitsscheu und Spielsucht sind die Haupthindernisse für die Wohlfahrt der Malaien. Sie sind zwar imstande, durch Not gezwungen eine Zeitlang angestrengt zu arbeiten, aber sobald der Antrieb aufhört, ziehen Spiel und Nichtstun sie mit doppelter Macht wieder an. Der starke Hang der Männer zum Umherschweifen und die niedrige Stellung, welche die Frau bei ihnen einnimmt, hat ausserdem zur Folge, dass die Arbeitslast bisweilen ganz auf den Schultern der Frau ruht. [492]
Die Bevölkerung von Sambas steht indessen, wahrscheinlich weil sie zur Zeit der Seeräuberei stark mit Bandjaresen und anderen Elementen vermischt worden ist, noch auf einer höheren Entwicklungsstufe als diejenige am Kapuas, deren baufällige, schmutzige Häuser sofort ins Auge fallen. Noch schlimmer steht es bei den malaiischen Bewohnern in Kutei mit den Wohnungsverhältnissen.
Somit scheint der Malaie, wo er nicht mit anderen Rassen sich vermischt hat, wenig entwicklungsfähig; in Gegenden dagegen, wie die “Zuider-Afdeeling“ von Borneo, wo in früheren Jahrhunderten eine grosse Anzahl Javaner in der malaiischen Bevölkerung aufging, ist diese durch fleissigen Betrieb von Ackerbau und Industrie wohlhabend und dicht geworden. Die tüchtigsten Elemente findet man auf Borneo stets da, wo Bandjaresen sich niedergelassen haben.
Hat es sich im Vorhergehenden gezeigt, dass die Malaien auf Borneo an Bildung und Wohlstand nicht besser daran sind als die ursprüngliche Bevölkerung, so stehen wir jetzt vor der Frage, in wie weit jene als Moslemin einem höheren Glauben huldigen, als die Dajak, da es für diese von grosser Bedeutung wäre, wenn sie durch die Berührung mit den Malaien wenigstens zum Teil von ihrem äusserst nachteiligen Glauben an Geister, pe̥māli u.s.w. befreit würden.
Selbst unter den höchstentwickelten Völkern des indischen Archipels, z.B. den Javanern, hat die Einführung des Islams auf die Wohlfahrt der grossen Masse nur einen geringen Einfluss ausgeübt, weil diese selbst dort noch in ihrem Tun und Lassen stark von animistischen Vorstellungen über sich selbst und ihre Umgebung beherrscht wird, die aus der malaio-polynesischen Periode vor der Ausbreitung des Hinduismus und später des Islams herstammen. Nur sind dort gegenwärtig beim Gottesdienst Hindu- und mohammedanische Namen und Zeremonien gebräuchlich, während man in heidnischen Gegenden mehr malaio-polynesische antrifft. Hierdurch ist es möglich, dass die grosse Masse der Bevölkerung, die den wahren Islam nicht kennt, sich nichtsdestoweniger als seine treuen Bekenner betrachtet. Diejenigen, die sich in einem hochstehenden indischen Gemeinwesen, wie das der Javaner, mehr oder weniger mit dem Studium mohammedanischer Schriften befasst haben, besitzen hierüber richtigere Vorstellungen, aber die Überzeugung dieser wenigen übt auf die Auffassung des geringeren Mannes und auf seine Handlungen nur einen unbedeutenden Einfluss aus. [493]
Unter den Malaien auf Borneo hat der Hinduismus lange nicht so stark geherrscht als auf Java, obgleich sie sich als echte Moslemin betrachten, entbehren die Malaien sogar in den Küstenstaaten der Wohlhabenheit, um einen gelehrten Stand aufkommen zu lassen, und der entwickelnde Einfluss, den die Religion der Hindu und Mohammedaner hätte ausüben können, fehlt hier in noch höherem Masse als auf Java. Berücksichtigt man ferner das oben über die Blutmischung der Borneo-Malaien Gesagte, so erregt es keine Verwunderung, dass die Mohammedaner, wenigstens die im Innern Borneos, auch durch ihren Gottesdienst keinen zivilisierenden Einfluss auf die Dajak ausüben können und in der Tat auch nicht ausgeübt haben. Der zum Islam übergetretene Dajak wird im Gegenteil sehr bald wie die übrigen Mohammedaner und verachtet seine noch Schweinefleisch essenden Stammesgenossen, glaubt sich berechtigt, diese auf die gewissenloseste Weise zu betrügen, und folgt seinen neuen Glaubensbrüdern bald in der Leidenschaft für Spiel, Hahnenkämpfe und dergleichen.
Für das Verhältnis, in welchem die unterworfenen dajakischen Stämme zu den malaiischen stehen, ist die Regierungsform der letzteren von besonderem Gewicht. Jedes malaiische Reich auf Borneo, auch wenn es, wie am Mittel-Kapuas, nicht viel mehr Niederlassungen umfasst als ein oder mehrere Dörfer, wird von einem Fürstenhaus regiert. Die Fürsten tragen verschiedene Namen wie Sultan, Panembahan, Pangeran u.s.w., doch leiten diese sowie ihre Familienglieder aus ihrer Würde alle das Vorrecht ab, dass sie auf Kosten der Masse des Volks so faul und üppig leben dürfen, als die Umstände es einigermassen zulassen. In diesen Reichen hat sich der Begriff einer Verantwortung von Fürst oder Regierung dem Volk gegenüber noch nicht herausgebildet, von einem Regieren in dem Sinn von Verwalten, von einer Leitung der Volksentwicklung ist denn auch nicht die Rede und als Richtschnur in allen Regierungsangelegenheiten gilt nur die Erpressung eines möglichst grossen Einkommens aus der Bevölkerung.
Trotz der in der Regel grenzenlosen Verschwendung und dem ungezügelten Leben der Fürstenfamilien hätte deren Regierung nicht den höchst verderblichen Einfluss auf jeden Fortschritt ausüben können, wie es in Wirklichkeit der Fall ist, wenn nicht in Folge der mohammedanischen Vielweiberei die Nachkommenschaft der Fürsten so zahlreich geworden wäre, die auch, wenn sie bereits den untersten Gesellschaftsschichten angehört, ihrer Verwandtschaft noch Rechte [494] zu entlehnen wagt. Hierdurch sind auch rechtschaffene malaiische Fürsten, die eine höhere Vorstellung von den Pflichten eines Regenten besitzen und die den Vorteil einer Entwicklung ihres Reiches einsehen, gezwungen, bei der Regierung stets das Hauptaugenmerk auf das Einkommen ihrer Familie zu richten; auch dann noch müssen sie aus Mangel an Mitteln ihre entferntesten Blutsverwandten häufig sich selbst überlassen. Diese trachten dann, auf ihre hohe Verwandtschaft gestützt, auf alle Weise, nur nicht durch Arbeit, ihren Unterhalt zu gewinnen, und den meisten Malaien und Dajak fehlt der Mut, sich ernsthaft gegen ihre Erpressungen aufzulehnen. Da es den Fürsten selbst an den nötigen Mitteln zu einem kraftvollen Auftreten gegenüber diesen schlechten Elementen mangelt, müssen sie dieses auch für sie selbst nachteilige Treiben stillschweigend mit ansehen; die näheren Blutsverwandten des Fürsten erhalten öfters Teile des Reiches als Apanage und leben dann mit ihren Familien von dem Einkommen, das sie durch feste Steuern oder die noch viel drückenderen willkürlichen aus der Bevölkerung zu erpressen suchen.
Unter diesen aus der malaiischen Herrschaft entstehenden Zuständen leiden am schwersten die direkt unterworfenen dajakischen Stämme. Von dem Los, das diesen in den grossen malaiischen Reichen zu Teil wird, können wir uns nach den Verhältnissen, die z.B. an den Westküsten in Sambas und Matan herrschen, eine Vorstellung machen. Auch im Sultanat von Sambas ist alles Land grösstenteils als Apanage an die Sultanssprösslinge verteilt. Die Dajak müssen hier eine nicht sehr hohe Steuer in Gestalt von Naturalien aufbringen, doch wird diese Summe dadurch bedeutend erhöht, dass der von ihnen gelieferte Reis z.B. in viel zu grossem Mass in Empfang genommen wird, während das Salz, der Tabak und bei Hungersnot auch der Reis, die sie von ihren Herren zu kaufen verpflichtet sind, mit viel kleinerem Mass gemessen werden. Am schwersten drücken die Dajak jedoch, wie gesagt, die ihnen willkürlich auferlegten Steuern, wie Lieferungen von Baumaterial, Böten, Lebensmitteln und persönliche Dienste, welche die Malaien so weit schrauben, als es möglich ist, ohne dass ihre Sklaven dabei völlig zu Grunde gehen.
Ausserdem unterlassen es die Steuereinnehmer und anderen Trabanten der malaiischen Herrscher nicht, die Dajak auch noch in ihrem eigenen Interesse zu bestehlen. Wie weit die Anmassung dieser Leute gehen kann, davon überzeugte ich mich einst selbst auf einer [495] Inspektionsreise in Sambas, für welche mir der Sultan seinen Aufseher mitgegeben hatte. Als wir in einem trockenen Flussbett eine lagernde Dajakgesellschaft antrafen, unter welcher sich eine Frau befand mit einer schön gestickten Mütze auf dem Kopf und einer ebenso schönen Jacke im Tragkorbe, riss der Aufseher der Frau einfach die Mütze vom Kopf und nahm ihr die Jacke aus dem Korbe, ohne dass einer der Dajak etwas einzuwenden wagte. Der Mann fand sein Betragen so natürlich, dass ich ihn nur mit Mühe dazu brachte, die Sachen zurückzuerstatten. Dies geschah, trotzdem sich der Assistenz-Resident und der Sultan in derselben Gegend aufhielten.
In Matan, einem im südlichsten Teile der Wester-Afdeeling gelegenen Staate, fand ein Kontrolleur einst auf einer Reise ins Innere in einer inländischen Herberge einen Erlass des Sultans angeschlagen, in dem geschrieben stand, dass es den Malaien verboten sei, Dajak zu töten oder deren Hab und Gut zu vernichten.
Was von den ursprünglichen Dajak bei dieser Jahrhunderte dauernden Knechtschaft übrig geblieben ist, kann man sich leicht vorstellen: sehr arme, schwache Stämme, die für Wohnung und Kleidung das schlechteste Material gebrauchen und die körperlich und geistig weit hinter ihren Blutsverwandten tiefer im Binnenlande zurückstehen. Da, wo die Malaien ihre Macht über die Dajak nur der Lage ihrer Niederlassungen an den Flussmündungen verdanken, von wo aus sie die einzigen Handelswege beherrschen, sind nur die unmittelbar benachbarten Stämme mehr oder weniger steuerpflichtig, die höher hinauf wohnenden tatsächlich unabhängig. Doch werden auch sie durch Banden betrügerischer Händler ausgebeutet. Ab und zu treiben es die Malaien so arg, dass auch die Dajak die Geduld verlieren und einige Vertreter dieser gehassten Rasse niedermachen. Ein derartiger Vorfall bildet für die mit Gewehren bewaffneten Malaien, die ausserdem noch die ihnen kontraktlich zugesagte Hilfe des niederländischen Gouvernements beanspruchen, einen erwünschten Anlass, um durch Plünderung und Busse aus den Dajak noch eine Extraeinnahme zu erpressen.
Es ist klar, dass ein Staat, der seine Untertanen derartig behandelt, auf die im ganzen Stromgebiet wohnenden Stämme keinen Anspruch zu erheben hat. Trotzdem glaubt z.B. der Panembahan von Sintang der gesetzliche Herrscher des ausgedehnten Stromgebietes des Mĕlawie zu sein, obgleich auch er keinerlei Verwaltung über die dort ansässigen [496] Stämme ausübt und sich nur soweit um das Land bekümmert, als er und seine zahlreichen Familienglieder, je nach den zufällig herrschenden Zuständen, mehr oder weniger Profit aus ihnen ziehen.
Den Hass der dort lebenden noch kräftigen und wohlhabenden Dajak gegen die Malaien benützte ein energischer Dajakhäuptling aus Nanga Sĕrawai am Mĕlawie, namens Raden Paku, 1895, um die dajakische Bevölkerung gegen die sintangsche Herrschaft aufzuhetzen. Er hatte wegen früherer ähnlicher Versuche in Pontianak gefangen gesessen und war dann nach Sintang entflohen. Seinen Landsleuten erzählte er, dass die niederländisch-indische Regierung ihn als ihren Repräsentanten unter ihnen angestellt habe; als Beweis wies er ein Dokument vor in Gestalt einer mit vielen Medaillen bedruckten Rechnung für Photographien auf den Namen des damals in Nanga Pinau am Mĕlawie wohnhaften Kontrolleurs. Der lebhafte Wunsch der Dajak, unter eine gesetzmässige, gerechte niederländische Verwaltung zu kommen und Raden Pakus Einfluss brachten einen zeitweiligen Bund der Stämme am oberen Mĕlawie zustande, und das erste, was sie taten, war, dass sie einige malaiische Niederlassungen am Hauptstrom belagerten und die sintangschen Beamten vertrieben. Der Panembahan selbst war völlig machtlos und wandte sich an den Residenten der “Wester-Afdeeling” um Hülfe. Dieser war der Ansicht, dass eine Befestigung der malaiischen Herrschaft unter den Dajak die Ruhe in diesen Gegenden am besten sichern würde, und rüstete und begleitete daher selbst Ende 1895 und Anfang 1896 eine militärische Expedition an den oberen Mĕlawie. Mit Hülfe der Tĕbida-Dajak vom unteren Mĕlawie unter Anführung einiger Kontrolleure wurde der Aufstand unterdrückt und Raden Paku gefangen genommen, wodurch die Macht des Panembahan von Sintang grösser als je zuvor wurde. Statt nun einen Versuch zu einer tatsächlichen Verwaltung des Landes zu machen, wie man es von ihm erwartete, waren er und seine Familienglieder ausschliesslich darauf aus, noch drückendere Steuern als vorher zu erheben. Auch hatte er noch die Dreistigkeit zu bitten, dass der europäische Beamte für ihn die Steuern erheben möchte, weil es ihm zu gefährlich und kostspielig schien, es auf die Dauer selbst zu tun. Hierauf liess sich denn doch die Regierung nicht ein.
Auch im östlichen Teil der Insel wird die Selbständigkeitszeit und Kultur der Dajak durch malaiischen Einfluss immer mehr untergraben. [497] Lange Zeit musste sich das Sultanat von Kutei hinsichtlich der Bahau, deren Niederlassungen erst weiter oben beginnen, mit der Rolle begnügen, welche die kleinen malaiischen Fürsten an der Mündung der Kapuasnebenflüsse spielten.
Da es für die Sultane nicht vorteilhaft war, sich mit den noch kräftigen Bahau in einen Kampf einzulassen, gaben sie sich damit zufrieden, das ganze Stromgebiet des Mahakam in der Theorie als ihr Eigentum zu betrachten, und gingen selbst so weit, auch das Land oberhalb der Wasserfälle als ihnen zugehörig anzusehen mit demselben Recht, wie der Verstorbene Resident Tromp sich ausdrückte, als wenn die Niederländer auf die Schweiz Anspruch erheben wollten.
Nachdem jedoch der Vorrat an Waldprodukten im eigenen Reich erschöpft war, liess der 1899 verstorbene Sultan es sich angelegen sein, auch über die weiter oben wohnenden Bahau und ihre noch ungeplünderten Wälder seine Macht auszubreiten.
Die zwischen Long Bagung und Long Tĕpai gelegenen beiden Reihen grosser Wasserfälle und Stromschnellen, die nur unter günstigen Umständen passierbar sind, schützten die oberhalb derselben wohnenden Dajak vorläufig vor der Herrschsucht des Sultans, dagegen konnte sich die unterhalb der Wasserfälle lebende Bevölkerung dem kuteischen Treiben nicht völlig entziehen. Seitdem sich diese Stämme vor 2 Jahrhunderten hier niederliessen, sind sie an Zahl und Stärke sehr zurückgegangen.
Sie waren hier viel mehr den ansteckenden Krankheiten, wie Cholera und Pocken, die sich von der Küste aus bei ihnen verbreiteten, ausgesetzt. Solange sich ihre Häuptlinge jedoch ernstlich den Malaien widersetzten, wagten sich nur wenige Kaufleute aus Kutei ins Land der Bahau. Es glückte jedoch dem Sultan, die wichtigsten Häuptlinge der Bahau mit ihrem Gefolge zu einer Beratung über einen Palastbau nach Tengaron zu locken. Als diese arglos und nach ihrer Sitte mit Frauen und Kindern dort angelangt waren, verwendete sie der Sultan zum Palastbau und hielt sie unter allerhand Vorwänden und auch mit Gewalt so lange in Tengaron zurück, bis sie alle an Cholera und anderen Krankheiten starben oder sterbend in ihr Land zurückkehrten. 10 Jahre später, 1897, starb Si Ding Lĕdjü, der letzte Bahauhäuptling von Ana, der auf die Stämme unterhalb der Wasserfälle noch den grössten Einfluss besass und bis zu seinem Tod dem Sultan von Kutei Widerstand geleistet hatte. In den letzten Jahren [498] seiner Oberherrschaft hatte sich eine Kolonie Buschproduktensucher unter einigen Fürstenabkömmlingen aus Kutei an der Mündung des Pari, eines Nebenflusses des Mahakam, im Lande der Bahau niedergelassen, um dieses auszubeuten. Zu gleicher Zeit und zum gleichen Zweck trafen auch Banden aus den Baritolanden, unter denen sich auch viele halb mohammedanische Dajak befanden, am Mahakam ein. Wie ich Anfang 1897 zu beobachten Gelegenheit hatte, wurden die Vergehen, deren sich diese Banden schuldig machten, durch Si Ding Lĕdjüs noch einigermassen in Schranken gehalten; doch klagten die älteren Leute bereits damals über den schlechten Einfluss, den das Treiben dieser Leute auf das Leben der Bahau ausübte. Seit dem Tode Si Ding Lĕdjüs verbreitete sich jedoch eine immer grössere Zahl von Glücksrittern aus Kutei über das Land, und 1899, bei meiner zweiten Reise flussabwärts, fiel es mir auf, wie schnell die ursprüngliche Bevölkerung unter dem schlechten Einfluss der fremden Eindringlinge ihre alten Gewohnheiten und Sitten verändert hatte.
Das wichtigste Zentrum für die Buschausbeutung befand sich damals in Uma Mĕhak, an der Mündung des Mĕdang, eines Nebenflusses des Mahakam. Das ganze Flussgebiet hatte der Sohn des vorigen Sultans, Raden Gondol, der sich in Tengaron unmöglich gemacht hatte, mittelst eines Briefes seines Vaters, also quasi auf dessen Befehl, von Edoh Lalau, der Tochter eines in Tengaron verstorbenen Häuptlings Lalau, gegen eine geringe und nur halb bezahlte Vergütung erworben. Der erwähnte Sultansbrief hatte in Wirklichkeit jedoch einen ganz anderen Inhalt und nichts mit Buschausbeutung zu tun. Dieses fälschliche Recht auf die Ausbeutung des Waldes verkaufte Raden Gondol stückweise an Banden aus Kutei und dem Barito und blieb selbst in Uma Mĕhak wohnen, wo er für seine Untergebenen eine Spielbank errichtete. Durch ihn und seine ebenso energische als hübsche Frau Mariam wurden nicht nur die Dorfbewohner, sondern auch die flussauf- und abwärts reisenden Händler, welche in Uma Mĕhak Halt machten, gezwungen, ihr Glück im Spiel zu versuchen. Auch hielt er zahlreiche Kampfhähne, bezahlte jedoch den Einsatz nicht, wenn er verlor. Hier wurden auch die Bahau und Kĕnja, die mit Rhinozeroshorn, Bezoarsteinen und anderen Kostbarkeiten ihre Gebrauchsartikel einkaufen kamen, von dem Sultanssprössling in einer Weise ausgebeutet, die nur in der Schüchternheit dieser Leute gegenüber dem Sohne des Fürsten ihre Erklärung fand. [499]
Durch sein Gefolge, das aus kuteischen Übeltätern bestand, die sich in den Palast seines Vaters geflüchtet und dadurch vor Strafe geschützt hatten, liess er bei seinen Gastherren in Uma Mĕhak Haussuchungen nach kostbaren Perlen und dergleichen vornehmen, die er in seiner Kasse verschwinden liess. Noch schlimmer war, dass er, wie mir aus zwei verschiedenen malaiischen Quellen mitgeteilt wurde, dreimal Schuldsklaven im Geheimen an Siang-Dajak aus dem oberen Barito verkauft hatte, wo sie auf den Gräbern von Häuptlingen zu Tode gemartert werden sollten.
Dergleichen gut bewaffneten, gewissenlosen Schurken gegenüber sind die Bahau machtlos. Sie lassen sich sogar von ihnen zu allem Schlechten verleiten, denn die energischen Fremden, welche die durch Buschprodukte verdienten Geldsummen bei Spiel und Hahnenkämpfen wieder verschleudern, machen besonders auf die jungen Bahau grossen Eindruck. Obgleich diese keine Alkoholika gebrauchen, vergeuden sie doch ihre Kraft und Zeit mit Spiel, zu hohen Einsätzen und vernachlässigen immer mehr den Ackerbau, was eine ständige Hungersnot im Dorfe zur Folge hat.
Die Einfuhr von hoch besteuertem Reis aus Kutei, der durch die Anwesenheit der vielen Fremden in Uma Mĕhak noch teurer geworden ist, kann der bereits verarmten Bevölkerung keine Abhilfe bringen.
Auch die Frauen bleiben diesen in Genuss dahinlebenden Fremden gegenüber, die mit Geld und Gut freigebig umgehen und sich auch die Spielschulden ihrer Männer mit ihrer Gunst bezahlen lassen wollen, nicht gleichgültig.
Die bereits früher hier vorgekommenen Diebstähle und Morde nahmen unter diesen Verhältnissen stark zu, und die ohnehin zu hinterlistigem Mord geneigten Bahau beteiligten sich häufig an diesen Missetaten. Von Juni 1899 bis März 1900 kamen unterhalb der Wasserfälle 10 Raub- und Rachemorde mit 25 Opfern vor. Seitdem Barth dort im Juni 1900 als Kontrolleur eingesetzt worden ist, fanden keine Morde oder schwereren Diebstähle mehr statt.
Die Bahaustämme oberhalb der Wasserfälle lebten ihrer isolierten Lage wegen unter günstigeren Verhältnissen; trotzdem beunruhigten sich ihre Häuptlinge und Ältesten über die Zustände bei ihren Stammesverwandten weiter unten, besonders weil einzelne Banden von Waldproduktensammlern auch in ihrer Mitte bereits ihren nachteiligen Einfluss zu verbreiten begannen. [500]
Berücksichtigt man, dass bis vor wenigen Jahren weitaus die meisten Forschungen unter den dajakischen Stämmen entweder flüchtig, auf der Durchreise, oder, wenn sie eine längerer Zeit umfassten, unter Stämmen vorgenommen wurden, welche bereits lange unter dem malaiischen Joch gelitten und deswegen von ihrer früheren Kultur nur wenig mehr übrig behalten hatten, dann wundert es einen nicht, dass die bei ihnen gewonnenen Resultate wenig Übereinstimmung mit denjenigen zeigen, welche man nach längerem Verkehr mit den ursprünglichen Dajak erhält.
Nach dem Vorhergehenden erscheint es Unzweifelhaft, dass der Verkehr der malaiischen und der dajakischen Rasse für das Lebensglück der letzteren verhängnisvoll geworden ist. Da diese Verhältnisse nicht nur für Borneo charakteristich sind, sondern im ganzen Archipel wiederkehren, gewinnt das Auftreten der Europäer unter diesen Völkern eine besondere Bedeutung. Um ihr Ansehen im indischen Archipel dauernd behaupten zu können, ist eine europäische Nation schon in ihrem eigenen Interesse verpflichtet, der fortwährenden Unruhe, welche durch die Erpressungen seitens der malaiischen Fürstensprösslinge und durch die ständig drohenden feindlichen Überfälle unter den ursprünglichen Stämmen hervorgerufen wird, ein Ende zu machen. Dass dies einer europäischen Regierung sehr wohl möglich ist, beweist die plötzliche Veränderung, die in den höchst nachteiligen Zuständen am Mittel-Makaham durch die Einsetzung eines Kontrolleurs zu Stande gekommen ist. Wir erkennen hier den grossen Einfluss, den auch ein mit wenig Mitteln ausgerüsteter Europäer durch verständiges, taktvolles Auftreten ausüben kann. In einem derartigen Falle erscheint ein Eingriff eines europäischen Volkes in das Lebenslos eines niedriger entwickelten durchaus gerechtfertigt; beruht dagegen die Ausbreitung der europäischen Macht auf Gewalt und mangelhafter Einsicht in die herrschenden Überzeugungen und die Verhältnisse der Bevölkerung und tritt noch Mangel an Takt seitens der zuerst auftretenden Europäer hinzu, so erwachsen hieraus für beide Teile verhängnisvolle Folgen.
Auf Borneo spürt man sowohl im englischen als im niederländischen Teil den segensreichen Einfluss, den seine Bevölkerung durch die Berührung mit einer europäischen Nation erfahren kann; die Beispiele sind dort treffender als in den noch halb unabhängigen malaiischen Nachbarreichen, wo die alten verrotteten Zustände noch fortdauern. Auf [501] Grund ihres Vertrauens in die niederländische Regierung fügten sich vor einigen Jahrzehnten alle Stämme des Kapuasgebiets oberhalb Bunut unter ihre Herrschaft, sobald sich nur einige Male ein Staatsbeamter aus dem sehr entlegenen Sintang bei ihnen zeigte; Kontrakte wurden hierbei nicht geschlossen, doch wurden die Verordnungen treu befolgt und später eine mässige Abgabe bezahlt; Widerstand kam in diesen Gebieten bis jetzt überhaupt nicht vor. Sobald die Stämme am Mahakam ihre Angst vor den Niederländern, welche hauptsächlich durch die zu ihnen geflüchteten malaiischen Missetäter geweckt worden war, verloren hatten, wagten auch die Bewohner am Ober- und Mittellauf die beschirmende Hand der niederländischen Verwaltung anzurufen. Wie gern auch die Stämme im Quellgebiet des Mĕlawie die malaiische Herrschaft gegen die niederländische vertauschen möchten, sahen wir bereits oben. Das Stromgebiet des Pinau, des südlichen Nebenflusses des Mĕlawie, bietet hierfür ein weiteres Beispiel; es bildete bereits seit langem einen Zankapfel zwischen den Fürsten von Sintang und Kotawaringin an der Südküste und demzufolge herrschten dort unter der Bevölkerung von Malaien und Dajak höchst ernste Missstände. Nach Übereinkunft der indischen Regierung mit den betreffenden Fürsten, wobei beide ihre vermeintlichen Rechte abtraten, genügte die Ankunft des Kontrolleurs Barth und einiger bewaffneter Schutzsoldaten, um die Fehden zwischen den Malaien und Dajak dort zu schlichten und die Zustände mehr nach europäischen Begriffen zu regeln. Dies entsprach so sehr dem Wunsche der Bevölkerung, dass bei der Kunde von der grossen Reise, welche Barth in meiner Gesellschaft 1898 antreten sollte, ein vornehmer Häuptling von dort, Raden Inu, und zwei seiner Verwandten uns baten, unseren Zug mitmachen zu dürfen.
Der Eindruck, den unsere friedsame Besetzung des Mahakamgebiets auf diese Malaien machte, äusserte sich nachher auf eigentümliche Weise: als ihnen nach ihrer Heimkehr 1899 anlässlich ihrer uns bewiesenen Dienste von der niederländischen Regierung das vorteilhafte Anerbieten gemacht wurde, sich an einem Feldzuge gegen die Sonkong Dajak am oberen Sĕkajam zu beteiligen, schlug Raden Inu diese Ehre ab mit der Begründung, er wisse nun aus eigener Erfahrung, dass ein gewalttätiges Auftreten gegen die dajakischen Stämme nicht die richtige Methode sei, um einen heilsamen Einfluss auf sie auszuüben. Für eine friedliche Regelung der Zustände, wie sie Barth am Mahakam aufgetragen wurde, empfand er grössere Sympathie und so [502] liess er seinen jungen Neffen und einen Verwandten Persat, der ebenfalls unsere Reise mitgemacht hatte, mit dem Kontrolleur an den Mahakam ziehen.
Vergleicht man die Zustände, wie sie unter den Bahaustämmen vor und nach der Festsetzung der Niederländer geherrscht haben, so zeigt es sich, welch eine richtige Einsicht die Häuptlinge dieser Stämme in ihre Lebensinteressen bewiesen, indem sie eine niederländische Einmischung selbst anriefen. In früherer Zeit hatten die Kaufleute am Unterlauf des Mahakam die Bahau durch ihren betrügerischen Handel dazu gebracht, die sehr viel mühevolleren Handelszüge nach Sĕrawak zu unternehmen, wobei sie das nur unter grossen Schwierigkeiten schiffbare Quellgebiet des Mahakam passieren, das 1200 m hohe Grenzgebirge überschreiten und den Njangeian bis Fort Kapit hinabfahren, dann wieder in umgekehrter Richtung zurückreisen mussten. Obgleich die Reise je nach dem Wasserstande bisweilen Monate erforderte, schätzten die ökonomisch schlecht gestellten Bahau den Schutz, den sie von den sĕrawakischen Beamten im Handel gegen Chinesen und Malaien genossen, so hoch, dass die mehr westlich wohnenden Stämme am oberen Mahakam ihre wichtigsten Lebensartikel lieber aus Sĕrawak als vom unteren Mahakam bezogen. Die Reise ins englische Gebiet unternahmen die Kajan zum ersten Mal vor etwa 30 Jahren unter Kwing Irang. Sie gerieten jedoch bereits bei ihren ersten Zügen mit den dort ansässigen Stämmen, die sie unter dem Namen Hiwan zusammenfassen, in Streit. Schuld hieran trug ihre verhängnisvolle Gewohnheit, auf Handelsreisen bei günstiger Gelegenheit Köpfe zu jagen. Die Unfähigkeit ihrer Häuptlinge, beim eigenen Stamm oder bei Verwandten dergleichen Ausschreitungen zu unterdrücken, verschärfte noch die Feindschaft mit den sĕrawakischen Stämmen; auch die Unterhandlungen zwischen den englischen Autoritäten und den vornehmsten Häuplingen Kwing Irang und Bĕlarè brachten wenig Verbesserungen zuwege, weil diese eben nicht im Stande waren, ihre Stammesgenossen im Zaum zu halten. Um der Unruhe ein Ende zu machen, vereinigte die Regierung von Sĕrawak 1885 zahlreiche Banden ihrer Batang-Lupar-Dajak, versah sie mit Gewehren und liess sie plötzlich einen Einfall in das Gebiet des Mahakam vornehmen, hauptsächlich zu den Pnihing, die der Grenze am nächsten wohnten.
Die aus Tausenden von Personen bestehende Kriegsmacht musste zuerst den Njangeian hinauffahren, dann das Gebirge überschreiten und [503] an den Quellflüssen des Mahakam von neuem Böte bauen; wenn die Bahaustämme trotzdem völlig unvorbereitet überfallen wurden, so geschah dies wegen der ungeheuren Ausdehnung der Wälder, in denen monatelange Vorbereitungen unbemerkt vor sich gehen können, und wegen der grosse Sorge, mit der man von sĕrawakischer Seite den Zug vor den weiter unten am Fluss wohnenden Stämmen geheim gehalten hatte. Trotzdem über 100 Böte hergestellt wurden, hatten die Bahau keine Späne den Fluss hinuntertreiben gesehen, woran für gewöhnlich die Gegenwart Fremder am Oberlauf erkannt wird.
Die Pnihingniederlassungen, auf die der Zug gemünzt war, wurden geplündert und verbrannt und allein in Bĕlarès Stamm 237 Personen getötet oder in Sklaverei geführt. Mangels einer europäischen Aufsicht fuhren die Plünderer den Mahakam noch weiter hinunter, als ihnen aufgetragen war, und verwüsteten auch die Dörfer anderer Pnihing und der Kajan. Seit der Zeit erdreisteten sich die Batang Lupar, auch in unmittelbarer Nähe der Bahau-Niederlassungen Waldprodukte zu rauben, so dass der früher verbreitete Schrecken fortwährend lebendig erhalten wurde. Erst nach Jahren wagten die an die Nebenflüsse geflohenen Stämme, sich wieder am Hauptstrom niederzulassen.
Dessenungeachtet hatten einige junge Bahau-Männer doch noch den Mut, mehrmals Batang-Lupar zu töten, in der Regel, um den früheren Mord ihrer Familienangehörigen zu rächen; die Häuptlinge waren trotz ihrer Besorgnis zu schwach, um diese Gewalttaten zu verhindern. So leben diese Stämme in ständiger Angst vor neuen Rachezügen aus Sĕrawak. Während unseres Aufenthaltes am Mahakam im Jahre 1897 erschienen, einige Monate nachdem 2 Batang-Lupar von einigen Pnihing getötet worden waren, 2 Bukat-Männer vom Grenzgebirge als Vermittler aus Sĕrawak, um mit Bĕlarè über ein Sühngeld zu unterhandeln. Sobald die Kajan von dieser Gesandtschaft hörten, schenkten sie sogleich dem Gerücht Glauben, dass zahlreiche Banden am oberen Mahakam bereit ständen, um diesen Mord zu rächen. Sogleich flohen viele Bewohner mit ihrer kostbarsten Habe, falls sie diese nicht bereits in Felshöhlen versteckt hatten, in den Wald. In der kleinen Niederlassung um das Häuptlingshaus der Kajan schlief in dieser Nacht niemand und trotz unserer beruhigenden Gegenwart war jeder auf das erste Alarmzeichen zur Flucht bereit. Auf einer Fahrt den Pnihingdörfern entlang fanden wir diese von, Frauen und [504] Kindern verlassen. Es lässt sich begreifen, dass die fortschrittlicheren Häuptlinge nach einer Macht aussahen, welche ihre Untertanen von der drückenden Angst, in der sie lebten, befreite. Hätte in Sĕrawak nicht die Sitte geherrscht, sich in weit entlegenen Gebieten durch plündernde Batang-Lupar-Banden Gehorsam zu erzwingen, so hätten sich viele Mahakam-Stämme gern dem Radja unterworfen. Von einer niederländischen Herrschaft versprachen sie sich nicht viel Gutes, denn in Kutei an der Ostküste übte der Assistent-Resident tatsächlich nur eine sehr geringe Macht aus und vom Kapuas aus hatte man von den Niederländern nicht viel mehr gemerkt als schwere Bussen, welche den Bahau für die an Malaien verübten Morde auferlegt wurden, durch welche sie sich der lästigen Ausbeuter zu entledigen getrachtet hatten. Die durch die Malaien verbreiteten Vorstellungen von der Unnahbarkeit, Anmassung und Roheit unserer Beamten fanden bei diesen Stämmen leicht Glauben, und Versuche, die in späteren Jahren von der Wester-Afdeeling aus ins Werk gesetzt wurden, um mit ihnen in Berührung zu kommen, scheiterten.
Aus dem Vorhergehenden zeigt es sich, dass die Bahau am Mahakam aus reinem Selbstinteresse den Schutz der Niederländer 1897 anriefen, nachdem die Gegenwart von uns Europäern ihnen die Furcht genommen hatte. Dass ihr Blick sie nicht betrog, beweisen die Vorteile, welche diese Stämme z.B. oberhalb der Wasserfälle aus der europäischen Verwaltung ziehen.
Zunächst rief der Radja von Sĕrawak seine Dajak mit grösserem Nachdruck als vorher aus dem Mahakamgebiet zurück, so dass bei unserer Reise ins Quellgebiet keine Spuren eines neueren Aufenthaltes mehr zu finden waren. Welch eine Beruhigung diese Tatsache und ausserdem die Einsetzung eines Postens mit bewaffneten Schutzsoldaten oberhalb der Wasserfälle bewirkte, kann man sich nach dem oben Gesagt en leicht vorstellen. Die Gegenwart des Kontrolleurs in Long Iram befreite sie überdies von ihrer Angst vor dem zunehmenden Einfluss der Sultansfamilie in Kutei.
Durch Rachedrohungen und Hinweise auf die Machtlosigkeit des niederländisch-indischen Gouvernements, das ohne den Sultan nichts tun dürfe, suchte dieser die Einsetzung eines Staatsbeamten unter den Bahau zu verhindern, auch beunruhigte er während unseres Aufenthalts die Stämme beständig. Die Anwesenheit einer europäischen Verwaltung übte auch auf das materielle Leben der Familien einen günstigen [505] Einfluss. Während sie ihre Gebrauchsartikel früher entweder von buginesischen Händlern aus Kutei kaufen mussten, die sie auf die gröbste Weise betrogen, oder in Sĕrawak, nach langer Reise durch feindliches Gebiet, besorgen sie sich jetzt alles Nötige nach relativ kurzer, sicherer Reise auf den Märkten am Mittel-Mahakam, wo die jetzt freie Konkurrenz der Kaufleute die Preise bedeutend herabgedrückt hat und allzu grober Betrug bestraft wird. Die Eröffnung eines Salzlagerhauses in Long Iram hat den Preis für Salz jetzt um ein Drittel oder die Hälfte erniedrigt.
Obgleich die grosse Ausdehnung des Landes und die geringe Dichte seiner Bewohner eine ärztliche Behandlung sehr erschwert, sind die Bahau jetzt, wo ihnen umsonst Arzneien ausgeteilt werden und ein inländischer Arzt (dokter djawa) und ein inländischer Impfarzt unter ihnen eingesetzt sind, weit besser daran als früher, wo sie bei Krankheit auf die vielen Fremden angewiesen waren, die sich alle als Medizinmänner bei ihnen aufspielten und manche Familie durch ihre hohen Forderungen und schädlichen Mittel zu Grunde richteten. Auch bei den so viel mächtigeren Kĕnja herrschen die gleichen Zustände und der gleiche Wunsch nach Verbesserung durch Einführung einer niederländischen Verwaltung.
Was europäische Regierungsprinzipien und europäische Energie ohne viel Hilfe von aussen in einem inländischen Gemeinwesen zu Stande bringen können, dafür bietet uns auf Borneo das Fürstentum Sĕrawak ein interessantes Beispiel. Dieses Reich, das den westlichen Teil der Nordküste einnimmt, wird von der englischen Familie Brooke regiert. Bei der Gründung dieses Reichs ist von einer Überwältigung der Eingeborenen durch eine europäische Kriegsmacht keine Rede gewesen, sondern wir haben es hier mit einem typischen Fall friedlicher Entwicklung der einheimischen Bevölkerung unter europäischer Führung zu tun. Die Geschichte dieses Reichs ist so eigenartig, dass sie hier wenigstens kurz erwähnt zu werden verdient.
Im Jahre 1841 landete ein englischer Schiffskapitän, namens James Brooke, an der Nordküste von Borneo, nachdem er vorher vergeblich versucht hatte, sich in Ost-Celebes niederzulassen. Im Gebiet des jetzigen Sĕrawak lernte Brooke damals das äusserst schlechte Verhältnis der verschiedenen Völkerschaften zu einander kennen. Der vom Sultan in Brunei abhängige Radja des Landes, Muda Hassein, war trotz seines guten Willens nicht im Stande, seine dajakischen und [506] malaiischen Untertanen zufrieden zu stellen, so dass beide aufständig gegen ihn wurden. Brooke, der den Grund hierfür sofort in der brutalen Unterdrückung der Dajak durch die Malaien erkannte, wurde vom Radja beauftragt, den Frieden wieder herzustellen, was ihm auch gelang. Als Belohnung für seine Dienste erhielt er vom Radja ein Stück Land zur Verwaltung. Gleich anfangs gab er sich die grösste Mühe, wenigstens in seinem Gebiet die Dajak vor der Ausbeutung durch die Malaien und Chinesen zu schützen, und gewann dadurch in so hohem Masse die Gunst der ersteren, dass sie ihm später, als die Malaien ihm seine Herrschaft gewaltsam zu entreissen versuchten, kräftig bei der Unterdrückung der Aufständischen behilflich waren.
Später, als auch die zahlreichen Chinesen versuchten, James Brooke an der Verwirklichung seiner humanen Regierungsprinzipien, die ihre egoistischen Pläne kreuzten, zu verhindern, brachte er wiederum mit Hilfe der Dajak die Aufrührerischen zur Botmässigkeit. So gelang es ihm, den Dajak neben Malaien und Chinesen ein erträgliches Dasein zu verschaffen. Sehr viele Schwierigkeiten bereiteten ihm später die östlicher wohnenden, sehr kriegerischen Stämme, die unter den Namen See-Dajak und Batang-Lupar zusammengefasst werden; diese beteiligten sich unter Leitung der Malaien an der Seeräuberei, die Anfang und Mitte des vorigen Jahrhunderts alle Küsten Borneos unsicher machte. Aus Handelsinteressen rüstete die englische Regierung 2 Expeditionen aus, die dem Seeräuberwesen einen schweren Schlag versetzten. Später glückte es James Brooke und seinem Nachfolger Charles Brooke, auch der Kopfjägerei ein Ende zu machen und die Batang-Lupar zu unterwerfen. Seit der Zeit gebraucht Sĕrawak, wie wir sahen, diese kampfeslustigen Stämme, um die Bewohner des Inneren im Zaum zu halten. Vom europäischen Standpunkte aus ist es zu bedauern, dass derartige Züchtigungen mit so grossem Verlust an Menschenleben und soviel Plünderung verbunden sind, aber die Mittel, welche der Familie Brooke zur Verfügung stehen, genügen nicht zur Unterhaltung ständiger Truppen.
Von welchem Segen die Regierung Radja Brookes für sein Land geworden ist, ersieht man daraus, dass in Sĕrawak jetzt bis weit flussaufwärts ruhig Handel getrieben werden kann und Artikel wie Salz und Leinwaren jetzt auch bei den entlegensten Stämmen eingeführt werden.
Ausserdem bringen die Eingeborenen ihre Waldprodukte jetzt an [507] Orten zu Markte, wo sĕrawakische Beamte dafür sorgen, dass sie durch malaiische und chinesische Händler nicht zu stark betrogen werden. Es erscheint daher begreiflich, dass die im Binnenlande von Sĕrawak wohnenden Stämme das viele Gute, das ihnen durch die Europäer zu Teil wird, sehr hoch schätzen und ihrerseits gern bereit sind, einen Teil ihrer alten Gewohnheiten aufzugeben und eine kleine Steuer zu entrichten. [508]
Kapitel XVIII.
Ergebnisse meiner Reisen auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, Medizin und Topographie—Praktische Bedeutung ethnologischer Studien für eine friedsame Kolonisation—Politische Ereignisse in Mittel-Borneo nach meiner Rückkehr—Schlussbemerkung.
Dank ihrer zweckmässigen Ausrüstung und langen Dauer haben die in diesem Werk besprochenen Reisen auf sehr verschiedenartigen Gebieten wertvolle Resultate liefern können. Die beiden ersten Reisen der Jahre 1893–94 und 1896–97 waren, wie eingangs erwähnt worden ist, zu rein wissenschaftlichen Zwecken bestimmt gewesen; nachdem sich jedoch auf denselben die dringende Notwendigkeit einer Ausbreitung der niederländischen Macht in Mittel-Borneo und ein friedlicher Weg diese zu erreichen gezeigt hatte, wurde die dritte, von Mai 1898 bis Dezember 1900 dauernde Reise von der indischen Regierung zu politischen Zwecken ausgerüstet: Da es die beiden ersten Male vollständig geglückt war, die Angst der Eingeborenen vor den Europäern zu beseitigen und eine gründliche Kenntnis von Land und Volk zu gewinnen, womit die Grundbedingungen zu einer friedsamen Kolonisierung erfüllt waren, wurde in der Ausrüstung und Ausführung der politischen Expedition keine Veränderung vorgenommen, so dass sie auch andere, wissenschaftliche Arbeit zu leisten vermochte.
Im folgenden sind die Ergebnisse der 3 Reisen in einer kurzen Übersicht zusammengefasst.
Die ethnologischen Resultate betreffs des Charakters der Bahau und Kĕnjabevölkerung haben für die Beurteilung und Behandlung dieser auf niedriger Kulturstufe stehenden Völker neue Gesichtspunkte eröffnet. Diese sind im Lauf des Werkes bereits ausführlich erörtert worden und kommen weiter unten in Verbindung mit den politischen Resultaten nochmals zur Sprache.
Von den ethnographischen Sammlungen, welche sich alle auf die Stämme Mittel-Borneos beziehen, wurden etwa 800 Gegenstände der [509] letzten Reisen dem Reichs-Museum für Ethnographie in Leiden übergeben und etwa 300, welche auch die von den Kĕnja herstammenden umfassen, im Museum der Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft zu Batavia deponiert. Von den Leidener Ethnographica wurde in diesem Werk häufig Gebrauch gemacht; alle Gegenstände werden in dem beschreibenden Katalog, den das Museum nächstens über die Abteilung Borneo herausgibt, behandelt werden. Da an den beiden letzten Reisen keine Fachgelehrten auf dem Gebiete der Zoologie, Botanik und Geologie teilnahmen, musste ich mich darauf beschränken, die Sammlungen derart anzulegen, dass sie später von berufener Hand mit Erfolg bearbeitet werden konnten.
Die zoologische Sammlung, von der besonders die Fische und Vögel bemerkenswert waren, ist grossenteils dem Museum für Zoologie in Leiden zugewiesen worden; ein kleiner Teil wurde demjenigen auf Buitenzorg abgetreten. In mehreren Sendungen wurden dem Leidener Museum ungefähr 1500 Vogelbälge von 209 verschiedenen Arten, unter denen eine neue, einverleibt. Zu meiner Genugtuung unterzog sich der frühere Konservator der Vogelabteilung Dr. O. Finsch trotz vieler anderer Beschäftigung der Bearbeitung dieser Sammlung und führte sie in vorzüglicher Weise zu Ende. Die Arbeit ist in den “Notes for the Leyden Museum” Vol. XXVI publiziert worden.
Auch die 659 Exemplare zählenden Fischsammlungen, die auf den beiden letzten Reisen zu einer Anzahl von 117 Arten anwuchsen und 1 neue Familie, 6 neue Gattungen und 54 neue Arten ergaben, fanden, bearbeitet in Professor Dr. L. Vaillant in Paris, der mit den Fischen von der Expedition 1893–94 auch einen Teil der in den Jahren 1896–97 gesammelten untersuchte und in Dr. C.M.L. Popta in Leiden, die sich mit grossem Eifer und Erfolg der mühevollen Bearbeitung und Beschreibung der grossen Anzahl auf den beiden letzten Reisen gesammelten Fische widmeten. Vol. XXVII der “Notes from the Leyden Museum” wird von der letzten Arbeit völlig eingenommen.
Sowohl die lebenden Pflanzen als die getrockneten wurden dem botanischen Garten in Buitenzorg übergeben. Von ersteren überstanden viele die Reise und wurden in den von diesem Institut herausgegebenen Werken beschrieben. Auch einige Familien des Herbariums, das im ganzen über 2000 Nummern umfasste, fanden Bearbeiter; den Farnen widmete sich Dr. H. Christ in Basel, den Moosen Dr. M. Fleischer in [510] Berlin; diese Arbeiten wurden vom Institut in Buitenzorg veröffentlicht.
Die geologischen Sammlungen, die aus den bis dahin gänzlich unbekannten Flussgebieten des Mahakam und Kajan (Kedjin, Bulungan) stammten, wurden dem geologischen Museum der Universität Utrecht übermittelt, weil sie dort zur Ergänzung der von Prof. Dr. G.A.F. Molengraaff im Jahre 1894 gesammelten Gesteine aus dem Kapuas- und Baritogebiet dienen konnten.
Die Resultate einiger Untersuchungen auf anthropologischem und medizinischem Gebiet, die gesondert veröffentlicht worden sind, finden wir in diesem Werke bereits erwähnt. Die anthropologischen Messungen sind durch Dr. J.H.F. Kohlbrugge bearbeitet und unter No. 5 der 2. Serie der “Mitteilungen aus dem niederländischen Museum für Völkerkunde” herausgegeben worden.
Wegen der Bedeutung, welche die sehr verbreitete Hautkrankheit Tinea albigena für die indischen Truppen des niederländisch-indischen Heeres und die inländische Bevölkerung im allgemeinen besitzt, veröffentlichte ich im Jahre 1904 eine Abhandlung über das bisher noch nicht beschriebene Krankheitsbild dieses Hautparasiten. (Deel 49 afl. 5 van het Geneeskundig Tijdschrift voor Ned.-Indië).
Wenden wir uns jetzt den Arbeiten auf topographischem Gebiet zu.
Eine sorgfältige Aufnahme des durchzogenen Gebiets gehörte besonders auf der letzten Reise zu unseren Hauptaufgaben, weil sie zur Erlangung einer gründlichen Einsicht in die geographischen Verhältnisse Mittel-Borneos und zur Festsetzung der Grenzen gegen Sĕrawak dringend notwendig war. Nur der langen Dauer dieser Reise war es zu danken, dass wir mit den sehr bescheidenen Mitteln, die uns in dieser Beziehung zur Verfügung standen, die nachfolgenden Resultate erzielten. Von jeder Gelegenheit Gebrauch machend gelang es mir, den Sergeant Topographen Bina in den Stand zu setzen, nicht nur mit Tranche-Montagne und Messstab den von uns zurückgelegten Weg zu messen, sondern diese Messung zugleich als Basis für die Aufnahme zahlreicher Nebenflüsse zu benutzen; ebenso wurde von dieser aus 3 Mal die Wasserscheide gegen das Baritogebiet erstiegen, um letztere festzusetzen. Ferner wurden zur Gewinnung von Beobachtungspunkten für die Aufnahme des Gebirgsterrains eine grössere Anzahl Berge bestiegen. Im Interesse dieser Arbeit wurde auch der Mahakam bis zu stillen Quellen hinaufbefahren und bei dieser Gelegenheit die Grenze gegen Sĕrawak bestimmt. [511]
So wurde zum Schluss nicht nur der Mahakam mit seinen wichtigsten Nebenflüssen oberhalb der Wasserfälle mit dem dazwischenliegenden Gelände auf die Karte gebracht, sondern dadurch, dass die Aufnahme an 2 Stellen mit der des Kapuasgebiets in Verbindung gebracht und der Mahakam selbst bis zu dem astronomisch bestimmten Punkt Ana sorgfältig gemessen wurde, kam eine Messung von West nach Ost quer durch die ganze Insel zu Stande.
Sowohl wegen der allgemein herrschenden Auffassung, es sei die Ausbreitung einer europäischen Macht unter niedrig stehenden Völkern mit dem Gebrauch von Waffengewalt untrennbar verbunden, als wegen der irrtümlichen, oft zu unnützem Blutvergiessen führenden Vorstellung über das Wesen unkultivierter Völker, diejenigen des indischen Archipels, besonders die Dajak, nicht ausgenommen, erscheinen mir die Ergebnisse meiner Reisen auf kolonialpolitischem Gebiet und dem der psychologischen Völkerkunde am wertvollsten. Da nur auf einen richtigen Begriff von den bestehenden Zuständen eine rationelle Kolonialverwaltung begründet werden kann, sind die in den Kapiteln XVI und XVII gegebenen Ausführungen über den Charakter der dajakischen Stämme und ihrer Gemeinwesen direkt von praktischem Wert. Die bei der Ausrüstung und Ausführung meiner Reisen als Leitschnur dienende Anschauung, dass man es auch bei den Dajak im Grunde mit friedliebenden Ackerbauern zu tun hat, die einem eher durch Angst und Misstrauen als durch ein böswilliges Auftreten gefährlich werden, falls man ihnen nicht selbst hierzu Veranlassung bietet, haben die Ergebnisse meiner Reisen als durchaus richtig erwiesen. Die Reise 1893–94 wurde allerdings unter dem Schutz bewaffneter Malaien angetreten, jedoch ohne denselben beendet, nachdem er sich als überflüssig erwiesen hatte. Auf Grund der gesammelten Erfahrungen führte ich die erste Reise quer durch die Insel (1896–97) mit Hilfe der Bahau selbst aus, in Gesellschaft von 2 Europäern und 3 Inländern, von denen nur erstere ein Gewehr zu handhaben verstanden. Auch die letzte Expedition trug völlig den Charakter einer Reise unter einer friedfertigen Landbevölkerung; allerdings war, hauptsächlich im ersten Jahr, auch an eine Verteidigung gegen Überfälle einzelner Individuen gedacht worden; im übrigen war diese Expedition aber ganz auf die Hilfe der Eingeborenen selbst angewiesen gewesen. Mit welcher Gewissenhaftigkeit diese geleistet [512] wurde, geht daraus hervor, dass trotz der jahrelangen Dauer der Reisen in den für Europäer und Javaner so unwirtsamen Wäldern keiner der Reisegenossen einem Unglücksfall erlegen ist und alle in guter Gesundheit heimgekehrt sind. Von nicht geringerer Bedeutung ist ferner, dass dieser friedsame Verkehr mit der Bevölkerung auch zu einer friedsamen Besetzung des bis dahin gänzlich unbekannten östlichen Teils von Mittel-Borneo geführt hat.
Anderen Ortes ist bereits angeführt worden, dass die Einsetzung eines niederländischen Beamten am mittleren Mahakam ohne Schwierigkeiten stattfand; die Notwendigkeit dieser Massregel bewiesen die Ordnung und der Frieden, die nach seiner Ankunft in den sehr verwirrten Zuständen am Mahakam eintraten. Seitdem haben die Ereignisse am Mahakam selbst und im Baritogebiet gezeigt, dass diese auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Mahakambevölkerung begründete Verwaltung ohne die Stütze besonderer Personen oder einer bewaffneten Macht vor sich geht. Die ursprüngliche Anzahl malaiischer Schutzsoldaten in Long Iram wurde in den folgenden Jahren nur unwesentlich erhöht und nur an der Mündung des Blu-u wurde ein aus einer kleinen Anzahl bewaffneter Malaien bestehender Posten eingesetzt, über den unser Reisegenosse Suka den Oberbefehl erhielt.
Kurz nach meiner Abreise bestand die neue Verwaltung eine schwere Prüfung durch den noch im Jahre 1901 erfolgten Tod Kwing Irangs; man fürchtete anfangs, dass dieses Ereignis die Gesinnung der Häuptlinge oberhalb der Wasserfälle verändern könnte. Diese Furcht war jedoch unbegründet; während des heftigen Kampfes, der in den Jahren 1902–03 das benachbarte Baritogebiet in Aufruhr brachte, verhielt sich das Mahakamgebiet durchaus ruhig und war auch kein militärisches Einschreiten notwendig.
Das neue Verwaltungszentrum in Long Iram erhält nicht nur einen erträglichen Zustand bei den Stämmen längs der sĕrawakischen Grenze aufrecht, sondern ist auch für eine friedliche Entwicklung des tiefer gelegenen Mahakamgebiets von hoher Bedeutung. Die grösste Schwierigkeit bei einer Kriegsführung mit dem meistens viel schwächeren inländischen Feinde, wie den malaiischen Fürsten, besteht in seiner Gewohnheit, stets tiefer in das für Europäer schwer zugängliche Binnenland zu entweichen und bei den dort wohnenden Stämmen, die mit unseren Warfen noch nicht in Berührung gekommen sind, Hilfe zu suchen. Durch dieses ständige Zurückweichen hat z.B. die Sultansfamilie [513] im Baritogebiet beinahe 50 Jahre den Niederländern Stand halten können. Da die Verwaltung des Mahakamgebiets sich auf die Bahau stützt, ist den Malaien jetzt das Zurückweichen unmöglich gemacht worden.
Dass das neu eingenommene Gebiet in Zukunft nicht nur tatsächlich, sondern auch formell dem Einfluss des kuteischen Sultanshauses entzogen werden wird, indem dem Fürsten eine bestimmte Summe für seine Ansprüche bezahlt werden soll, ist eine vorzügliche Massregel, die nicht verfehlen wird, einige noch widerstrebende Bahaufürsten, wie Bang Jok, der sich auf seinen dem Sultan abgelegten Eid beruft, zum Einlenken zu bringen.
Auch die unter den Kĕnja erreichte Ausbreitung der niederländischen Macht erwies sich später als dauerhaft. Im Jahre 1902 wurde dem Kontrolleur vom Berau E.W.F. van Walchren aufgetragen, von dort aus einen Zug nach Apu Kajan zu unternehmen. Eine Gesellschaft der Kĕnja Uma-Tow, die sich gerade am unteren Berau befand, geleitete ihn diesen Fluss aufwärts und brachte ihn über einen hohen Bergrücken an die Mündung des Kajan Ok in den Kajan, von wo sie nach einigen Tagen die Niederlassung der Uma-Lĕkĕn erreichten. Während seines 6 monatlichen Aufenthahs unter den Kĕnja befestigte Herr Van Walchren die von uns früher bereits angeknüpften Beziehungen und kehrte in Begleitung der Uma-Tow längs des Boh und Mahakam an die Ostküste zurück. Auch damals zeigte es sich, dass das Verhältnis zu den weiter unten am Kajanfluss wohnenden Kĕnja und Bahaustämmen viel zu wünschen übrig liess. Aus diesem Grunde wurde im Jahre 1905 Herr Van Walchren nochmals beauftragt, den Kajan von Tandjong Seilor aus hinaufzufahren, um zwischen den Kĕnja oberhalb der Baröm (Wasserfälle) und den Uma-Alim am Pĕdjungan eine Versöhnung zu Stande zu bringen. Die Niederlassungen der letzteren wurden zwar erreicht, jedoch verhinderten Krankheit und schlechte Vorzeichen die Erfüllung des Auftrags, so dass der Kontrolleur unverrichteter Sache wieder zurückkehren musste.
Eine anziehende und für den Verfasser charakteristische Beschreibung der Reise des Herrn Van Walchren zu den Kĕnja hat einer der Teilnehmer an der Expedition, der inländische Arzt J.E. Tehupeiory veröffentlicht. Das in holländischer Sprache verfasste Werk erschien unter dem Titel: “Onder de Dajaks van Centraal-Borneo” bei der Firma G. Kolff & Co. in Batavia, 1906. [514]
Es wird manchen Leser vielleicht interessieren, etwas über die Kosten derartiger langdauernder Expeditionen zu erfahren. Für meine letzte 2 Jahre und 8 Monate währende Reise bewilligte mir die indische Regierung einen Kredit von 53.000 Gulden, von denen ich 50.000 gebrauchte. Die Summe ist hoch, aber die wissenschaftlichen Expeditionen, welche in den letzten Jahren nach Niederländisch-Indien ausgerüstet wurden, kosteten, besonders mit Rücksicht auf ihre viel kürzere Dauer, erheblich mehr, dasselbe gilt für die militärischen Expeditionen, welche lange Zeit unterhalten werden müssen, um in einem so grossen Gebiet eine politische Machtentfaltung zu bewirken. Das in diesem Fall erhaltene Resultat ist oft eine zwar unterworfene, aber verbitterte Bevölkerung, deren Sitten und Gewohnheiten nur äusserst oberflächlich bekannt geworden sind und die in der ersten Zeit nur durch eine kostspielige militärische Besatzung in Schranken zu halten ist.
Ein weites Arbeitsfeld steht einer friedlichen Kolonisation auf Borneo noch offen. Im grossen Gebiet des Kajanflusses müssen noch eingehende Forschungen durch sachkundige Personen vorgenommen werden, bevor man die dort lebende Bevölkerung genügend kennen wird, um auch ihr Land auf einfache Weise und ohne Blutvergiessen regieren zu können. Eine gerechte, über den Stämmen stehende Verwaltung würde diesen selbst zum Segen gereichen und wäre auch mit Rücksicht auf die internationalen Beziehungen zum englischen Fürstentum Sĕrawak, welche eine Kriegführung zwischen den Grenzstämmen verbieten, sehr notwendig. Überdies ist es in einem derartigen Fall Pflicht einer kolonialen Macht, den ärgsten Missständen, wie den verhängnisvollen Kopfjagden unter den dajakischen Stämmen, ein Ende zu machen, besonders da dies mit einfachen, unblutigen Mitteln erreicht werden kann.
Ende.

