.

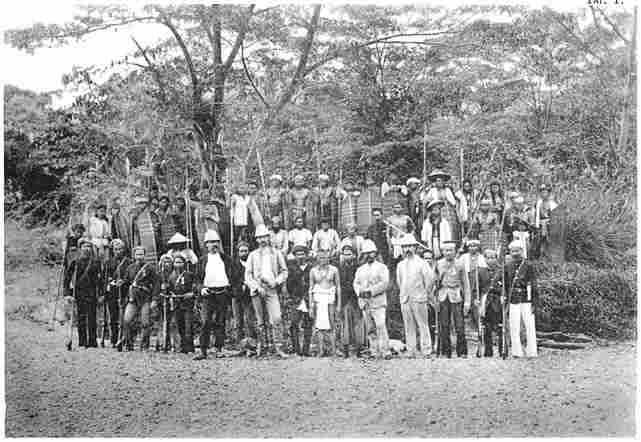
Die Expedition in Long Bagung (Mai 1899).
Schutzsoldaten. Bier. Dr. Nieuwenhuis. Barth. Demmeni. Raden Inu und Geleite. Kwing Irang.
Quer durch Borneo
Ergebnisse seiner Reisen
In den Jahren 1894, 1896–97 und 1898–1900
Von
Dr. A.W. Nieuwenhuis
Unter Mitarbeit
Von Dr. M. Nieuwenhuis-von Üxküll-Güldenbandt
Erster Teil
Mit 97 Tafeln in Lichtdruck und zwei Karten
Buchhandlung und Druckerei
Vormals
E.J. Brill
Leiden—1904
[V]
Vorwort.
Bevor noch die Ergebnisse meiner ersten Durchquerung der Insel Borneo unter dem Titel “In Centraal Borneo” veröffentlicht waren, trat ich eine neue Reise an, die zwei Jahre und acht Monate dauerte und mir Gelegenheit bot, die bereits erlangte Kenntnis von den Bewohnern dieser bisher völlig unbekannten Gegenden wesentlich zu bereichern. Da die Forschungen, die ich über den Charakter der Dajak und die Verhältnisse, unter denen sie leben, anstellte, eine weitere Ausbreitung des niederländischen Einflusses im Herzen Borneos zur Folge hatte, erschien mir eine Vereinigung der früher erworbenen Resultate mit den neuen und deren Veröffentlichung in umgearbeiteter Form nicht nur aus wissenschaftlichem, sondern auch aus praktischem Interesse wünschenswert.
Das Werk besteht aus zwei Teilen. Der erste behandelt die Reise von Pontianak nach Samarinda, quer durch Borneo, und enthält eine Schilderung von den Zuständen unter den Bahau am Kapuas und Mahakam, der zweite beschreibt die Expedition zu den Kĕnja im Stammland der Bahau, ferner die Industrie, den Handel, den Häuserbau und die Kunst bei diesen Stämmen.
Wie in meinem vorigen Werke habe ich mich auch in diesem darauf beschränkt, fast ausschliesslich eigene Beobachtungen zu geben, und die anderer Autoren nicht zur Vergleichung herbeigezogen. Abgesehen davon, dass das Werk sonst zu umfangreich geworden wäre, ist es auch sehr schwierig, in allem, was die Reisenden bis jetzt über Borneo geschrieben haben, sorgfältige Beobachtungen von flüchtigen Eindrücken zu unterscheiden. Überdies bin ich der Ansicht, dass eine einfache Wiedergabe eigener Beobachtungen, von deren Richtigkeit man sich [VI] im Laufe vieler Jahre hat überzeugen können, für die Ethnographen besonders wertvoll ist.
In dieses neue Werk habe ich, soweit sie nicht in Fachzeitschriften gehören, alle Resultate meiner Reisen in Mittel-Borneo aufgenommen; desgleichen haben diejenigen Photographien der vorigen Reisen, die ich für wissenschaftlich interessant hielt, auch ins neue Buch Aufnahme gefunden. In die Reiseerzählung, die das Werk auch für Laien geniessbar machen soll, sind noch Beobachtungen allerlei Art, die anderswo keinen Platz fanden, und einige charakteristische Erlebnisse meiner vorigen Reisen verflochten worden.
Zur Verzierung des Einbands wurden ausschliesslich dajakische Muster verwendet. Die vordere Seite des Einbands ist mit den Randfiguren eines Frauenrockes geschmückt, die hintere Seite und der Rücken tragen Tätowiermuster.
Die Herausgabe des vorliegenden Werkes konnte in dieser Form nur dank einer bedeutenden Subvention seitens des Kolonialministeriums stattfinden. Diese Subvention ermöglichte auch eine Reproduktion der Tafeln in Licht- und Farbendruck, durch welche erst die vom ethnographischen Standpunkt wichtigen Einzelheiten der photographischen Aufnahmen zur vollen Geltung gelangten.
Während meiner Arbeit habe ich von verschiedener Seite Unterstützung genossen. In erster Linie fühle ich mich der “Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën”, die meine ersten Reisen veranlasste und mir gestattete, die von ihr herausgegebene Karte von Borneo für dieses Werk zu reproduzieren, zu Dank verpflichtet. Ferner spreche ich den Herren Professoren Dr. A.E.J. Holwerda und Dr. K. Martin und Herrn Dr. J.D.E. Schmeltz, die sich stets hilfsbereit gezeigt haben, besonders aber Herrn Professor Dr. F. Schwend in Stuttgart, der mir durch seine Hilfe bei der Korrektur einen grossen Dienst geleistet hat, meinen herzlichsten Dank aus.
Leiden,
Dezember 1903.
Dr. A.W. Nieuwenhuis. [VII]
Inhalt.
Kapitel I. 1–22
Erste wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo (1893–1894)—Pläne zu einem zweiten Versuch einer Durchquerung Borneos von West nach Ost—Zweite Reise (Februar 1896–Juni 1897) und deren Ergebnisse—Anlass zur Unternehmung der dritten Reise (Mai 1898–Dezember 1900)—Ausrüstung—Dampfschiffahrt nach Pontianak—Fahrt auf dem Kapuas bis Putus Sibau—Zustände in Putus Sibau.
Kapitel II. 23–42
Aufenthalt in Putus Sibau—Aussichten für die Mahakamreise—Besuch der Batang-Lupar—Aufbruch nach Tandjong Karang Einrichtung des Kajan Hauses—Ärztliche Praxis unter der Bevölkerung—Vorbereitungen für den Zug nach dem Mahakam Rückkehr nach Putus Sibau—Einkauf von Ethnographica und Krankenbehandlung—Verwundung eines Sibau Dajak Zurücksendung eines Jägers—Besuche der Kajan—Usun in Putus Sibau—Befragen der Vögel—Aufbruch nach dem Mahakam.
Kapitel III. 43–68
Allgemeines über die Insel Borneo—Die Gebirge von Mittel-Borneo—Die Wasserscheiden zwischen dem Mahakam und dem Batang-Rèdjang, Kajan und Barito—Geologie des oberen Mahakamgebietes—Salzquellen—Geologischer Charakter des Apu Kajan Äussere Gestaltung Mittel-Borneos—Buschvegetation—Meteorologische Verhältnisse—Bewohner der Insel—Malaien und Dajak Sesshafte Stämme: Bahau und Kĕnja—Nomadenstämme: Punan, Bukat und Bĕkĕtan—Herkunft der Bahau und Kĕnja Legende vom Wasser und Feuer—Auswanderungen und Vermischungen der Stämme—Organisation eines Bahau- bezw. eines Kajan-Stammes—Geschichte der Mendalam Kajan—Glieder eines Stammes: Häuptlinge, Freie und Sklaven—Gegenseitige Verpflichtungen der Stammesglieder—Abstammung des Häuptlings Akam Igau.
Kapitel IV. 69–95
Lebenslauf eines Bahau bzw. eines Kajan—Geburt—Behandlung des Neugeborenen—Kindertragbrett (hăwaăt)—Verpflegung des Kindes—Erste Namengebung—Zweite Namengebung—Namenänderungen—Das Kind bis zur Pubertät—Junge Männer und Mädchen—Tätowierung—utang—Künstliche Verunstaltungen—Beschäftigungen und Verkehr der jungen Leute—Mahlzeiten Heirat—Stellung von Mann und Frau—Erbschaft—Tod—Trauer—Kopfjagden. [VIII]
Kapitel V. 96–115
Religiöse Vorstellungen der Bahau—Wichtigste Götter—Einteilung des Weltalls—Gute und böse Geister—Seelen der Bahau—Charakter und Schicksal der bruwa und to̱n luwa—Seelen der Tiere, Pflanzen und Gesteine—Vorzeichen—Erklärung der pemāli—Priester und Priesterinnen—Beseelung der dājung—Pflichten der dājung—Erklärung der melă—Das Ei als Opfergabe.
Kapitel VI. 116–132
Opfergaben der Ballon: kawit—Die pemāli: bei der melă, beim Erntefest, in den Reisscheunen, auf dem Reisfelde, beim Säen, beim Neujahrsfest, bei der melă der Namengebung, bei der melă gegen Krankheit, bei der Rückkehr von grossen Reisen—Das legén—Schwierigkeiten bei den Nachforschungen auf religiösem Gebiet—Usun, die Oberpriesterin—Schöpfungsgeschichte der Mendalam Kajan.
Kapitel VII. 133–155
Auffassung der Kleidung seitens der Eingeborenen—Zweck der Kleidung—Einfluss der Malaien auf die Kleidung—Alltags-, Fest- und Kriegskostüm der Männer am Mendalam—Kopfbedeckungen—Schmuck—Tätowierung—Ausrecken der Ohrläppchen—Umformung der Zähne—Haartracht—Alltags- und Festkleidung der Frauen—Schmuck—Trauerkleidung—Ausrüstung der Toten—Waffen der Kajan: Schwerter, Speere, Blasrohre—Herstellung der Blasrohre—Pfeile und Pfeilgifte—Schilde.
Kapitel VIII. 156–185
Rolle des Ackerbaus bei der Bahau und Kĕnja—Religiöse Vorstellungen beim Ackerbau—Legende von der Entstehung der Ackerbauprodukte—Art der Feldbewirtschaftung—Vorzeichensuchen bei der Wahl der Felder—Bestimmung der Saatzeit—Perioden des Reisbaus—Bedeutung der Ackerbaufeste—Saatfest: religiöse Zeremonien; Masken- und Kreiselspiel—Neujahrsfest—Festgebräuche—Zweite Namengebung der Kinder—Darbietung der Opfer—Tänze der Priesterinnen—Ringkampf—aro̱n uting = Festtag des Schweinefleischessens—aro̱n kertap = Festtag des Klebreisessens—nangeian = Rundtanz der Priesterinnen und Laien—Schlusszeremonien beim Neujahrsfest.
Kapitel IX. 186–199
Fischreichtum des Kapuasgebietes—Fischereigerätschaften—Fang des tapa—Fang mit tuba-Gift—Jagd—Hunde der Bahau—Erträgnisse der Jagd—Vogelfang—Haustiere.
Kapitel X. 200–219
Von Putus Sibau nach Siut—Besuch bei den Taman Dajak-Verlust eines Hundes durch ein Krokodil—Nachtlager auf der Geröllbank Liu Tangkilu—Kampf gegen die Strömung—Aufenthalt wegen des tĕlaradjang—Umschlagen eines malaiischen Handelsbootes—Ausflug auf einen Berg—Eigentümliche Lianen—Fortsetzung der Fahrt bis zur Gung-Mündung—Aufenthalt wegen schlechter Vorzeichen—Passieren der “Gurung Dĕlapan”—Nachtlager an der Bungan-Mündung—Bier und Obet Lata fallen in den Fluss—Begegnung mit unserer ersten Gesandtschaft—Ankunft an der Bulit-Mündung—Aufschlagen der Lagers—Nächtlicher Überfall durch Hochwasser—Akam Igaus Reiseplan—Begegnung mit Bungan Dajak—Aufbruch zum pangkalan Howong—Kalkberge am Bulit.
Kapitel XI. 220–243
Ankunft am pangkalan Howong—Unterhaltung im Lager—Akam Igau zieht zum Mahakam voraus—Aufbruch eines Teils der Kuli zur Wasscherscheide—Erscheinen von Bungan Dajak—Besuch im Lagerplatz, der Bungan—Rückkehr der Träger—Verschwinden des Reises—Landzug in Eilmärschen—Passieren des Bungan—Nahrungsnot—Lager unterhalb der Wasserscheide. [IX]
Kapitel XII. 244–268
Auf der Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam—Opfer der Kajan—Längs des Howong zu den Pnihing—Amun Lirung—Nahrungsmangel und Schwierigkeiten mit dem Transport des Gepäckes—Kwing Irang—Löhnung der Träger—Besuch bei den Bukat—Reise zu Bĕlarè—Einkauf von Böten am Tjĕhan—Fahrt zu Kwing Rang am Blu-u.
Kapitel XIII. 269–294
Der Mahakam in seinem Ober- Mittel- und Unterlauf—Bewohner des Mahakamgebietes—Vorgeschichte der Stämme—Stellung und Einfluss der Fremden—Ursprüngliche Bewohner am oberen Mahakam—Vorherrschaft der Long-Glat—Kwing Irang und dessen Stellung unter den übrigen Häuptlingen—Verkehr und Handel unter den Stämmen—Selbständigkeit der Stämme—Verteilung der Ländergebiete—Bestimmungen in bezug auf Feld- und Waldfrüchte, Buschprodukte, Jagd- und Fischfang—Industrie—Verkehr mit den Nachbarländern—Handel und Handelswege.
Kapitel XIV. 295–315
Verkehr mit den Eingeborenen—Einkauf von Ethnographica—Sammeln und Konservieren von Tieren und Pflanzen—Sammlungen und Untersuchungen auf geologischem Gebiet—Topographische Aufnahmen—Photographie.
Kapitel XV. 316–350
Verhältnisse bei den Mahakam Kajan—Zeitrechnung-Beschäftigungen während der Verbotszeit—Besteigung des Batu Mili—Saatfest—Maskenspiel—Kreiselspiel—Abschied von Akam Igau und Jung—Fahrt zum Mĕrasè—Tod des Häuptlings Bo Li—Begegnung mit malaiischen Rebellen—Beginn mit der Mahakamaufnahme—Zweite Besteigung des Batu Mili—Sage vom Batu Mili—Hahnenkämpfe.
Kapitel XVI. 351–385
Besuch bei den Ma-Suling am Mĕrasè—In Batu Sala, Napo Liu und Lulu Sirāng—Behandlung von Kranken, Einkauf von Böten und Ethnographica—Besteigung des Batu Situn—Beobachtungsposten auf einem Baumgipfel—Rückkehr nach Lulu Sirāng—Symbolische Heiratserklärung—Hochzeitsgebräuche—Ehegesetze—Heimkehr nach dem Blu-u—Besuch bei den Pnihing am Tjĕhan—In Long ’Kup—Besteigung des Liang Karing—Bei den Pnihing am Pakatè—Begräbnisstätte der Pnihing—Hadji Umar—Zurücksendung einer Batang-Lupar Gesellschaft—Beratung wegen des Hausbaus—Besuch von Hinan Lirung.
Kapitel XVII. 386–417
Bau des Häuptlingshauses—Besteigung des Batu Lĕsong—Ermordung einer Sklavin—Schutzleistung gegen Batang-Lupar Banden—Anwerbung neuer Leute—Krankenbesuch am Mĕrasè—Reisevorbereitungen—Bang Joks politische Stellung—Kwing Irangs Einzug ins neue Haus—Allerhand Schwierigkeiten—Wiederholtes Vorzeichensuchen—Tod eines kleinen Mädchens—Ankunft Akam Igaus—Neue Reisehindernisse.
Kapitel XVIII. 418–449
Äusseres der Bahau—Körperbau—Sinnesorgane—Charakter—Eigentümlichkeiten ihrer Konstitution—Krankheiten der Bahau: Malaria, venerische Krankheiten, Intestinalkrankheiten, Rheumatismus; Kropf; Infektionskrankheiten verschiedener Art, Augenkrankheiten, parasitäre Hautkrankheiten—Wert einer ärztlichen Praxis unter den Eingeborenen—Vorstellungen der Bahau von ihrem Körper, ihrem Geist; dem Schlaf und den Krankheiten—Heilmethoden der Priester—Diätetische Mittel-Befolgung ärztlicher Vorschriften—Arzneien der Eingeborenen—Massage, Dampfbäder. [X]
Kapitel XIX. 450–468
Allgemeines über Tätowierung—Unterscheidung dreier Gruppen—Vorschriften für Tätowierkünstlerinnen und Patienten—Tätowiergerätschaften—Ausführung und Folgen der Operation—Methoden der Tätowierung bei den verschiedenen Stämmen und Ständen—Seeentätowierung—Tätowierung der Kajan am Mendalam—Tätowiermuster—Tätowierung bei den Mahakamstämmen und den Kĕnja.
Kapitel XX. 469–493
Reise zur Küste: von Long Blu-u nach Long Tĕpai—Passieren der westlichen Wasserfälle—Flössen des Rotang—In Long Dĕho bei Bo Adjāng—Aufenthalt wegen Hochwassers—Ertrinken zweier Long-Glat—Ankunft Kwing Irangs—Weiterreise mit den Kajan—Passieren des Kiham Udang—Wiedersehen mit dem Kontrolleur in Long Bagung—Begegnung mit Kĕnja—Über Uma Mĕhak, Udju Halang, Ana und Tengaron nach Samarinda. [XI]
Bemerkungen über die Aussprache.
Alle einheimischen Wörter, die keine geographischen Namen oder Personennamen bedeuten, liess ich kursiv drucken. Während die Zeichen auf den gerade gedruckten Wörtern keiner weiteren Erklärung bedürfen, gelten in Bezug auf die Aussprache der Vokale in den kursiv gedruckten Wörtern die folgenden Regeln des allgemeinen linguistischen Alphabets1.
| a | in dem Deutschen | Tat, hat. |
| e̱ | in dem Deutschen | Bär, fett; |
| ẹ | in dem Deutschen | Weh; |
| i | in dem Deutschen | wir, mit; |
| ọ | in dem Deutschen | Mond; |
| o̱ | in dem Deutschen | Sonne; |
| o̤̱ | in dem Deutschen | Hörner; |
| o̤̣ | in dem Deutschen | König; |
| u | in dem Deutschen | Mut; |
| ṳ | in dem Deutschen | Tür; |
| ai | in dem Deutschen | Kaiser. |
| au | in dem Deutschen | Haut. |
| aṳ | in dem Deutschen | Häute. |
| e̥ | bezeichnet den dumpfen Vokal der deutschen Vor- und besonders Endsilben, z.B. be̥grabe̥n. | |
In den Inhaltsangaben und in den Überschriften der Seiten sind obige Zeichen bei den kursiv gedruckten Wörtern fortgelassen worden.
Um die Länge und die Kürze der Vokale und die Betonung anzugeben, sind die üblichen Zeichen ¯; ˘; und ´ verwendet worden. [XIII]
1 H. Steinthal in: Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen von Dr. G. Neumayer.
Liste der Karten und Tafeln.
Kapitel I.
Erste wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo (1893–1894)—Pläne zu einem zweiten Versuch einer Durchquerung Borneos von West nach Ost—Zweite Reise (Februar 1896–Juni 1897) und deren Ergebnisse—Anlass zur Unternehmung der dritten Reise (Mai 1898–December 1900)—Ausrüstung—Dampfschiffahrt nach Pontianak—Fahrt auf dein Kapuas bis Putus Sibau—Zustände in Putus Sibau.
In den Jahren 1893 und 1894 rüstete die “Maatschappij tot bevordering van het natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën” (Gesellschaft zur Beförderung der naturwissenschaftlichen Forschung in den niederländischen Kolonieen) ihre erste grosse wissenschaftliche Expedition nach Mittel-Borneo aus; wesentlich unterstützt wurde sie dabei durch den damaligen Residenten S.W. Tromp1 der “Wester-Afdeeling” von Borneo, der sehr wohl begriff, dass eine Erweiterung der Kenntnis von Land und Volk auch in politischer Hinsicht von grosser Bedeutung sein musste.
Den Teilnehmern an der Expedition war zur Aufgabe gestellt worden, von der Westküste durch die bisher ganz unbekannten Gebiete des oberen Kapuas und oberen Mahakam bis zur Ostküste vorzudringen und während der Reise, so weit als möglich, naturwissenschaftliches Material zu sammeln und die Bevölkerung zu studieren.
In Kutei erhoben sich aber bald warnende Stimmen, welche auf die grossen Gefahren einer derartigen Unternehmung aufmerksam machten; daher nahm man von dem anfänglichen Plan Abstand und beschränkte sich auf die Erforschung des Flussgebietes des oberen Kapuas, in welchem vom November 1893 bis zum Oktober 1894 reiche Sammlungen auf botanischem, zoologischem, geologischem und ethnologischem Gebiete angelegt wurden. Dank der Unterstützung der Regierung durch Schutz- und Transportmittel konnten die Forscher, jeder in seinem Fache, gesondert tätig sein; während der Zoologe Dr. J. [2] Büttikofer und der Botaniker Dr. H. Hallier sich im Urwalde niederliessen, durchzog der Geologe Prof. G.A.F. Molengraaff ausgedehnte Landstrecken, um deren Formation kennen zu lernen und beendete seine Reise durch einen gelungenen Zug von Bunut südlich nach Bandjarmasin. Indessen jeder auf diese Weise die nötige Forschungsfreiheit genoss, lag mir, als dem Expeditionsarzte, die Verwaltung des Ganzen ob. Da meine ärztliche Hilfe von den Teilnehmern der Expedition selten beansprucht wurde, konnte ich in den Dörfern der Eingeborenen wohnen bleiben und von dort aus für die Zufuhr neuer Vorräte und die Anwerbung von Kuli Sorge tragen.
Teils aus Neugier, teils um ärztlichen Beistand zu erbitten, kamen bald ununterbrochen Eingeborene in meine Nähe, so dass ich Gelegenheit hatte, die Bevölkerung eingehend zu studieren und Ethnographica zu sammeln.
Nach zweimonatlichem Aufenthalt am Mandai, südlich vom oberen Kapuas, machten der Geologe, Prof. Molengraaff, und ich den Versuch, in das Gebiet des oberen Mahakam vorzudringen; wir mussten jedoch, obgleich wir bereits die Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam überschritten hatten, auf Grund von Gerüchten, die der uns begleitende Kontrolleur über ernstliche feindliche Rüstungen seitens der Eingeborenen vernommen hatte, den Rückzug antreten. Auf dieser letzten sechswöchentlichen Expedition hatten die am Mendalam wohnenden Kajan, ein bis dahin so gut wie unbekannter Stamm, die Träger und Ruderer geliefert. Die Kajan am Mendalam sind nämlich mit denen am Mahakam verwandt und in ständigem Verkehr, daher sind sie auch die besten Kenner dieser dunklen Gebiete von Mittel-Borneo.
Ich war somit, um zuverlässige Auskunft über die Verhältnisse am oberen Mahakam zu gewinnen, hauptsächlich auf diesen Stamm der Kajan angewiesen. Zwar hatte schon im Jahre 1825 ein Europäer, Georg Müller, von der Ostküste aus den oberen Mahakam erreicht, aber sein Geleite von Pnihing und Kajan ermordete ihn nach dem Überschreiten der Wasserscheide im Flussbett des Bungan; mit dem kühnen Forscher gingen auch seine Aufzeichnungen zu Grunde, und die innersten Gebiete Borneos blieben unbekannt wie zuvor.
Während Prof. Molengraaff seine Reise nach Bandjarmasin antrat, liess ich mich also für zwei Monate bei diesem Stamm der Kajan am Mendalam in Tandjong Karang nieder und zwar mit demselben Resultat, wie sonst überall, dass ärztliche Hülfe, das Einkaufen von Ethnographica [3] und viel Geduld mit ihrer Eigenart mir alles Vertrauen gewanden, das eingeborene Stämme einem Fremden überhaupt schenken können. Als wichtigsten Vertrauensbeweis betrachtete ich ihre Erklärung, mich in das Gebiet des oberen Mahakam begleiten zu wollen, falls ich auf ihre Bedingungen zur Unternehmung der Reise eingehen wollte. Eine der für beide Teile wichtigsten war, dass ich, um nicht das Misstrauen ihrer Verwandten am Mahakam zu erregen, ohne bewaffnetes Geleite gehen sollte, was für mich so viel bedeutete, als dass ich mich ihnen vollständig ausliefern sollte. Ich fand eine teilweise Erklärung für diese Bedingung in dem Gefühl, das alle Eingeborenen in Mittel-Borneo bei der Begegnung mit etwas Neuem und Fremdem beherrscht, nämlich: der Angst. Da ich ausserdem wusste, dass es im eigenen Interesse der Dajak lag, der niederländisch-indischen Regierung keinen Anlass zur Unzufriedenheit zu geben, indem sie mir ein Leid zufügten, so beunruhigte mich diese Bedingung durchaus nicht.
Unter den interessanten Beobachtungen, die ich in dieser Zeit über den Charakter der Stämme von Mittel-Borneo machte, ist diejenige sicher die bedeutendste, dass die blutgierigen, wilden, Köpfe jagenden Dajak im Grunde zu den sanftesten, friedliebendsten und ängstlichsten Bewohnern dieser Erde gehören. Meine Erfahrungen stehen in dieser Hinsicht nicht nur in schroffem Gegensatz zu der allgemein verbreiteten Auffassung über die Dajak seitens der Europäer an den Küsten Borneos, sondern seltsamer Weise auch aller Reisenden, die bis jetzt Gelegenheit hatten, mit den mehr im Innern der Insel wohnenden Stämmen in Berührung zu kommen.
Da meine neuen Kajanfreunde mir allmählich auch zu verstehen gaben, dass es mit der feindlichen Gesinnung der Mahakambewohner nicht so schlimm bestellt sei, fasste ich auf meiner Rückreise nach Batavia den Plan, wenn irgend möglich, aufs neue den Versuch zu wagen, in das Gebiet des oberen Mahakam einzudringen und den Fluss bis zur Ostküste hinabzufahren.
In Batavia angelangt wurde ich jedoch sogleich als Arzt nach Lombok abkommandiert, wo die Bestürmung von Tjakra Negara (1894) und alle traurigen Folgen dieses entsetzlichen Kriegszuges uns Ärzte bald alle eigenen Pläne vergessen liessen.
Auch im Anfang des folgenden Jahres fanden wir selten Zeit, an etwas anderes, als an unsere Kranken zu denken, bis endlich der Westmonsun [4] uns weniger Patienten und mehr Kollegen brachte und es mir glückte, eine Versetzung nach Batavia zu erlangen.
Dankbar für die mir erhaltene Gesundheit und alles, was ich auf der prachtvollen Insel Lombok gesehen hatte, bestieg ich im Juli ein Schiff der “Paketfahrtgesellschaft”, welches mich nach Java brachte, und sechs Tage darauf führte mich die Bahn von Surabaja an den Ort meiner Bestimmung. Vier im idyllischen Garut verbrachte Tage verwischten den Eindruck aller Lomboker Schrecknisse, und bei meiner Ankunft in Batavia traten meine Borneopläne mir deutlicher als je vor den Geist.
Nach einigen Unterhandlungen mit dem Ausschuss der oben genannten niederländischen Gesellschaft in Batavia, zeigte sich diese bereit, meine Pläne zu unterstützen, und als dann auch der finanzielle Teil erledigt und die Zustimmung der Regierung erlangt war, konnte ich mit der Ausrüstung beginnen und im Februar des Jahres 1896 von Batavia über Pontianak mit der Expedition aufbrechen.
Überzeugt, dass die Unterhandlungen mit den Kajan Monate dauern würden, liess ich zwei Europäer: Demmeni und von Berchtold, von denen sich jener mit dem Photographieren, dieser mit der Erwerbung einer zoologischen Sammlung beschäftigen sollte, vorläufig in Batavia zurück; sie trafen mit mir erst im Mai am oberen Kapuas zusammen. Hier war es mir nach monatelangem Zusammenleben mit den Kajan am Mendalam endlich geglückt, diese ihrem Versprechen gemäss zur Teilnahme am Zuge nach dem Mahakam zu bewegen und die vorläufigen Vorbereitungen, wie das Einkaufen von Böten und grossen Quantitäten Reis, zu beenden; jedoch dauerte es noch bis zum 3. Juli, bis wir von Putus Sibau, dem wichtigsten Handelsplatz am oberen Kapuas, aufbrechen konnten. Im Laufe von zwei Monaten fuhren wir den Kapuas und darnach seine beiden Nebenflüsse Bungan und Bulit hinauf, zogen auf 800 m Höhe über die Wasserscheide und stiegen dann zum Penaneh, einem Nebenfluss des Mahakam, hinunter.
Der erste Empfang bei den dort ansässigen Pnihing liess nichts zu wünschen übrig, und auch während unseres achtmonatlichen Aufenthaltes bis zum April 1897 bei den anderen Stämmen am oberen Mahakam fiel nichts vor, was unser freundschaftliches Verhältnis gestört hätte. Es war anfangs mein Plan gewesen, nur zwei Monate bei ihnen zu bleiben, aber die herrschende Hungersnot liess uns nur die Wahl, uns ohne Unterbrechung von einem Stamme zum anderen führen [5] zu lassen, oder die Hungersnot am oberen Mahakam bis zum Eintritt der neuen Ernte mitzumachen. Wir wählten letzteres, da nur ein längerer Aufenthalt bei den Stämmen ein Ergebnis der Reise versprach, und es gelang uns, mit den Tauschartikeln bis zum letzten Augenblick hauszuhalten. Im April brachen wir mit Kwing Irang, dem obersten Häuptling der Mahakam-Kajan, bei dem wir uns niedergelassen hatten, nach dem unteren Mahakam auf, passierten die grossen Wasserfälle, die den Ober- und Mittellauf des Mahakam scheiden, und wurden vom Häuptling dem Sultan von Kutei übergeben, der uns mit dem Assistent-Residenten van Assen entgegengereist war.
Der langdauernde Aufenthalt im Herzen vom Borneo hatte uns in Stand gesetzt, unsere Umgebung eingehend zu studieren und so brachte ich, ausser bedeutenden Sammlungen auf naturwissenschaftlichem Gebiet, eine gründliche Kenntnis der Zustände, Sitten und Sprachen der Stämme am Mahakam mit nach Java.
Statt in einem Dorado der Wilden, wie es sich die Europäer gewöhnlich vorstellen, hatten wir unter Zuständen gelebt, von denen man sich in Europa schwer einen Begriff machen kann. Ausser den ungünstigen hygienischen Verhältnissen, welche eine Zunahme der Bevölkerung verhindern, hatten mich die Angst und Unruhe, in der diese Menschen ihr Dasein führen, betroffen. Jene sind, als Folgen des Klimas und der Eigenart der Bevölkerung, schwer zu bekämpfen, diese, hauptsächlich durch die Fehden der Stämme untereinander verursacht, sind sehr leicht zu beseitigen, sobald sich eine über diesen Stämmen stehende Macht mit der Schlichtung ihrer Zwistigkeiten befasst und Selbstwehr verhindert. Die Bahau fühlten, dass ihnen (lies vor allem fehlte; denn Kwing Irang wandte sich durch meine Vermittelung im Namen aller Stämme am oberen Mahakam an die niederländisch-indische Regierung mit der Bitte um Beschirmung.
Hierdurch wurde die indische Regierung veranlasst, eine neue Expedition auszurüsten, um festzustellen, auf welche Weise in den Gebieten des oberen Mahakam Ruhe und Sicherheit am besten herzustellen seien. Als Leiter dieser Expedition wurde ich gewählt, ferner der Kontrolleur 1. Kl. J.P.J. Barth und einige europäische und malaiische Gehilfen.
Obgleich politische Interessen bei diesem neuen Zuge das Leitmotiv bildeten, war es mir doch klar, dass seine Organisation aus verschiedenen Gründen die gleiche wie bei der früheren, so wohl gelungenen [6] Expedition von Pontianak nach Samarinda sein musste. Es handelte sich im wesentlichen darum, die Stimmung der Bevölkerung in bezug auf die Einsetzung einer festen Verwaltung auszukundschaften und auf die Schlichtung ihrer Zwistigkeiten mit benachbarten Stämmen Einfluss zu gewinnen. Hierzu war es, wie auch auf der vorigen Reise, notwendig, das Vertrauen der ängstlichen Bahau zu erwerben und sie durch ein monatelanges Leben und Arbeiten in ihrer Mitte an die Gegenwart von Weissen zu gewöhnen.
Da wir möglicherweise mit feindlich gesinnten Stämmen von Sĕrawak in Berührung kommen konnten, musste das gut bewaffnete Geleite so zahlreich sein, dass es im Notfall kräftigen Widerstand leisten konnte. Um zu verhindern, dass dieses, hauptsächlich aus Malaien bestehende Geleite während eines längeren Aufenthaltes in einem Stamme Anstoss errege und um es stets bei guter Stimmung zu erhalten, musste für seine ständige Beschäftigung gesorgt werden; das Gleiche galt auch für die Europäer. Ich wählte die Malaien daher derart, dass sie, ausser als Schutzsoldaten, auch auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiet von Nutzen sein konnten, als Pflanzensammler, Jäger, Präparatoren, Ruderer u.s.w.
Eine grosse Menge Tauschartikel zu unserem täglichen Unterhalt, zum Einkauf von Ethnographica und zur Bezahlung der Kuli wurde wiederum mitgenommen. Wir mussten nämlich nicht nur trachten, unsere dajakischen Gastherren nicht zu verletzen, sondern auch, durch Einkaufen von allerhand Dingen, vielen im Stamme einen Vorteil und uns ihre Gunst zu verschaffen. Zur Erreichung dieses Ziels war auch, wie wir auf der letzten Reise erfahren hatten, ein gründlicher ärztlicher Beistand von grosser Bedeutung; daher gehörte ein reichlicher Vorrat an Arzneimitteln zu unseren wichtigsten Reiseartikeln.
Mit Rücksicht auf die oben erwähnten Verhältnisse setzte sich meine Reisegesellschaft aus folgenden Gliedern zusammen: dem Kontrolleur J.P.J. Barth, der sich hauptsächlich mit dem Studium der allgemeinen Umgangssprache der Bahau, dem Busang, befasste; dem Photographen der vorigen Expedition, J. Demmeni; dem Topographen H.W. Bier; zwei Javanen aus dem botanischen Garten in Buitenzorg (Java) für die botanischen Sammlungen; dem Jäger und Präparator Doris für das Präparieren von Vögeln und Säugetieren und sechs anderen Javanen, die bereits Naturforscher auf Reisen begleitet hatten und im stande waren, als Mechaniker, Jäger, Fischer u.s.w. die verschiedensten [7] Dienste zu leisten. Zu meiner persönlichen Bedienung nahm ich Midan, meinen javanischen Diener der vorigen Reise, mit. An Vierfüsslern begleiteten uns zwei Jagdhunde; in Pontianak kaufte ich später noch zwei Wachthunde hinzu.
Überzeugt, dass uns die Küstenmalaien in Kutei Schwierigkeiten verursachen würden, falls wir auf dem eigentlichen Wege, den unteren Mahakam hinauf, zum oberen gelangen wollten—den Malaien ist nämlich selbst viel daran gelegen, ihren eigenen Einfluss im Hinterlande auszubreiten und den der Niederländer zurückzudrängen—mussten wir unsere Reise wiederum von Pontianak, an der Westküste, beginnen und uns von den Kajan wieder durch das unbewohnte Quellgebiet der grossen Flüsse zum oberen Mahakam geleiten lassen.
Auf der Reise im Jahre 1896 hatte, um den Landtransport mit einer kleinen Anzahl Leute möglich zu machen, die Ausrüstung so viel als möglich eingeschränkt werden müssen. Jetzt war die Besorgnis, durch ein grosses Geleite bei den Mahakamstämmen Misstrauen zu erwecken, zwar geringer, aber, in Anbetracht des Umstandes, dass die Verpflegung so vieler Menschen unterwegs an und für sich schon schwierig genug war, musste das mitzunehmende Gepäck auch diesmal auf ein Minimum reduziert werden.
Was die Kleidung betraf, so galt es, sie so zu wählen, dass sie sowohl dem Klima als den Strapazen standhalten konnte. Eine gute wollene Unterkleidung und eine warme Bedeckung nachts sind die besten Schutzmittel gegen Moskitos und Erkältungen; die Hauptursachen für das Entstehen der Malaria. Auch musste dafür gesorgt werden, dass die verpackten Kleidungsstücke und dass Bettzeug so wenig als möglich Gefahr liefen, nass zu werden.
Als Packkisten sind die bekannten Stahlköfferchen die geeignetsten. Sie halten, ausser unter Wasser, die Feuchtigkeit fern, zerbrechen nicht beim Fall auf Felsen und werden durch die Termiten nicht angetastet; sie dürfen jedoch sammt Inhalt nicht mehr als 20–25 kg wiegen.
Für die Nacht besassen wir starke Reiseklambu (Moskitonetze) aus fester Java-Gaze 1: 1: 2 m gross und so eingerichtet, dass sie mittelst Seilen in jedem beliebigen Raum ausgespannt werden konnten. Der untere Rand der Gaze war, ausgenommen an der Eingangsöffnung, wo das Zeug 1 m über einander schlug, an ein Stück double waterproof sheeting festgenäht. Sorgte man dafür, dass die Gazeenden am [8] Eingang dicht auf einander lagen, so war die Möglichkeit eines nächtlichen Besuchs von Ameisen, Schlangen, Skorpionen und Blutegeln so gut wie ausgeschlossen, und ich bin auch wirklich auf der ganzen Reise durch dergleichen Gäste nicht gestört worden. Die grosse Dichte der Gaze hielt auch die Moskitos und sehr kleinen aga oder murutu fern, welch letztere sehr empfindlich stechen, obgleich sie nicht grösser sind als eine Nadelspitze.
Die undurchlässige Unterlage schützte nachts vor Bodenfeuchtigkeit und bildete tagüber eine wasserdichte Umhüllung für das Klambu, ein kleines Kopfkissen und zwei Decken, die in sie eingepackt und mit Riemen festgeschnürt wurden.
Zur Bettausrüstung gehörte ferner noch eine dünne, mit Lederimitation überzogene Matratze, aus drei Teilen bestehend und daher leicht transportierbar.
Als Oberkleidung sind ein Anzug aus Khaki, Schuhwerk aus Leinwand und ein Korkhelm sehr geeignet. Zum Schutz gegen Blutegel, die lästigste Plage der feuchten Tropenwälder, ist es geraten, die Kleidung fest am Körper anschliessen zu lassen und die Beinkleider an den Knöcheln festzubinden oder zu knöpfen.
Eine besondere Sorgfalt muss auf die Wahl des Schuhwerkes verwendet werden; das Gehen mit blossen Füssen ist sehr unzweckmässig. Für schwieriges und unebenes Gelände sind, als Stütze für die Knöchel, hohe Schnürstiefel sehr empfehlenswert und zwar müssen sie, um das Wasser nach dem Durchwaten von Morästen und Lachen schnell abfliessen zu lassen, aus Leinwand hergestellt sein. Dünne, starke, nicht zu schwer beschlagene Sohlen verhindern am besten ein Gleiten auf Felsen und umgefallenen Baumstämmen. Lederne Gamaschen bewähren sich gut auf Märschen; hohe Wasserstiefel dagegen sind zu schwer.
Auch als Dachbedeckung eignet sich double waterproof sheeting seht gut, nur darf man es nicht lange der Sonne aussetzen, oder man muss es in diesem Falle mit Matten bedecken. Zur Aufrichtung eines Zeltes lehrte mich die Erfahrung, nichts anderes mitzunehmen als Stücke dieses Zeuges, die genügten, eine Fläche von 4 × 6 m zu überdecken. Der Tropenwald liefert stets viel dünnes Holz für Pfähle und Fussboden, so dass das Gerüst zu einer Hütte von den Dajak innerhalb einer Stunde im Walde gefällt und aneinander gebunden werden kann. Soll das Zelt nur einige wenige Nächte gebraucht werden, so sind Wände nicht erforderlich, da der Regen im Urwalde selten schräg niederfällt. [9]
Wegen der Unmöglichkeit, grössere Mengen von Lebensmitteln über Land mitzuführen, mussten auch die Europäer am Mahakam von dem leben, was die Bahauumgebung lieferte; nur für die Kranken wurden Konserven mitgenommen. Das Hauptnahrungsmittel bildete für alle der Reis-. für die Eingeborenen kamen am Kapuas noch getrocknete und später frische, im Fluss gefangene Fische hinzu; daher wurden auch einige Wurfnetze mitgenommen. Was die mitzuführenden Tauschartikel betraf, so hatte ich mich bereits früher davon überzeugt, welche Arten von Glasperlen und Zeug bei den einzelnen Stämmen besonders beliebt waren. Auch viele Kleinigkeiten wie: Fingerringe, Nadeln, Spiegeldöschen u.a. nahm ich mit, um sie zu gelegentlichen kleinen Geschenken zu verwenden.
Die Kisten, welche im Laufe der Reise geleert wurden, waren zur Aufnahme von Ethnographica und trockenen naturwissenschaftlichen Gegenständen bestimmt, während die zahlreichen Arzneiflaschen später zum Aufbewahren der Spirituspräparate verwendet wurden. Obgleich Formol als Konservierungsmittel einige Nachteile aufweist, war es doch zum Mitführen deshalb am geeignetsten, weil man es beim Gebrauch mit Wasser stark verdünnen kann; daher wurde nur wenig Alkohol mitgenommen. Für das Konservieren kleiner Tiere leisteten uns kleine Kisten voll zylinderförmiger Gläser mit abschraubbaren metallenen Deckeln gute Dienste.
Es konnte beinahe die ganze Ausrüstung in Batavia angeschafft werden, mit Ausnahme einiger Apparate für Höhenmessungen und Photographie, welche in Europa bestellt werden mussten, und einiger Tauschartikel, die nur in Singapore, von wo aus europäische Produkte hauptsächlich in Borneo eingeführt werden, zu erhalten waren. In allen Teilen des indischen Archipels besitzen die Eingeborenen in bezug auf Tauschartikel ihre besonderen Liebhabereien, so dass nur solche unter ihnen gangbar sind, welche an dem Ort gekauft wurden, von dem aus sie für gewöhnlich eingeführt werden. Bei den Stämmen von Borneo finden hauptsächlich bestimmte Arten von Glasperlen Beifall, die in Java nicht beliebt und daher auch nicht käuflich sind, obgleich sämmtliche Glasperlen in Europa verfertigt werden. Da sowohl diese Perlen als auch bestimmte Elfenbeinarmbänder, die von den Chinesen speziell für die Bahau- und Kĕnjastämme von Nord-Ost-Borneo gearbeitet werden, nur in Singapore zu haben waren, musste ich, zur Vervollständigung unserer Ausrüstung, erst noch eine Reise nach dieser Stadt unternehmen. [10]
Einen Teil des Proviantes und der Tauschartikel sandte ich von Batavia aus direkt an die Ostküste von Borneo an den Residenten von Samarinda zur Aufbewahrung; ich hatte mir nämlich vorgenommen, wenn unser Zug von West nach Ost glücklich beendet sein würde, nochmals ins Innere der Insel zurückzukehren, um in das nordöstlich gelegene gänzlich unbekannte Stammland aller Bahau und Kĕnja, das Quellgebiet des Bulungan, vorzudringen.
Zu meinem Verdruss musste ich, wegen der zu langen Dauer der Reisevorbereitungen, die beste Reisezeit verstreichen lassen. Die kleinen Quellflüsse des Kapuas sind nämlich nur in der Trockenzeit, der Zeit nach der Ernte, befahrbar und so kann man die Kajan auch nur zwischen Juni und September zur Teilnahme an einer Expedition bewegen.
Endlich, am 18. Mai, schiffte ich mich in einem kleinen Dampfer der “Paketfahrtgesellschaft” in Batavia nach Pontianak ein.
Am folgenden Tage fand meine Reiseungeduld einige Ablenkung durch den Aufenthalt unseres Dampfers in Billiton; das Aus- und Einladen von Gütern mit Hilfe von Fähren der sehr eigenartigen Seka (schwärmende Fischerbevölkerung) bot manches interessante Bild. Von ihren schwimmenden und lebhaft bewegten Wohnungen aus tauchten die Seka ins kristallklare Wasser nach Geldstücken, die wir hineinwarfen, und schienen sich in der blau-grünen Tiefe ebenso sicher zu fühlen, wie andere auf dem Festlande. Jedoch, trotz allem Schönen, was ich sah, und allem Interessanten, was mir der Steuermann über das Leben dieser Fischerbevölkerung erzählte, war es für mich doch eine Erlösung, als Borneo beim Erwachen am anderen Morgen in Sicht war und das Schiff bereits kehrte, um sich zwischen dem für Uneingeweihte unentwirrbaren Labyrinth von Grün, das in Form von Inseln und weit ins Meer hineinragenden Landzungen buchstäblich aus dem Wasser hervorstieg, hindurchzuwinden. Auch zur Ebbezeit ist hier kein festes Land zu sehen; die hie und da braune Farbe des Wassers deutet nur auf ausgedehnte Moderbänke. Der höchsten Erhebungen dieser Bänke hat sich eine eigentümliche Vegetation bemächtigt, die, mit Hilfe eines mächtigen Gerüstes von zahllosen Luft- und Stützwurzeln, nicht wenig dazu beiträgt, die vorhandenen Untiefen zu befestigen und weitere Anschwemmungen zu befördern.
Nur sehr langsam näherten wir uns diesen trügerischen grünen Streifen, die mit zweifelhaftem Recht den Namen Küste führten; als Verkünder des weit in der Ferne in einzelnen undeutlichen Bergspitzen sichtbaren [11] Festlandes begrüssten wir sie aber doch mit Freuden. Still glitt unser Fahrzeug über die spiegelglatte dunkle Wasserfläche, während die strahlende, aber noch nicht lästig warme Sonne mit ihrem leuchtenden Glanz das ernste Bild in eintönig grüner Umrahmung zu beleben trachtete. Weder Mensch noch hier waren anwesend, um den ersten überwältigenden Eindruck dieses grossen aequatorialen Landes in seiner beklemmenden Majestät zu brechen.
Zwischen den vielen, aus dem Wasser emporsteigenden Wäldchen steuerte der Kapitän sein Schiff, nach einigen nur ihm bekannten Kennzeichen, in der Richtung der Kubu, der südlichsten und schiffbarsten Mündung des Kapuas. Auch diese Einfahrt liess viel zu wünschen übrig; denn wir mussten einige Zeit warten, bis die Flut so hoch gestiegen war, dass sie uns über die Moderbank in die noch immer durch eine grüne Mauer verborgene Flussmündung tragen konnte. Mehr die Zeit, als die Tiefe des Wassers, gaben endlich das Zeichen zum Weiterdampfen; als wir uns nach einer scharfen Biegung vor der ungefähr 40 m breiten Öffnung in der grünen Mauer befanden, sah das aufgewühlte Wasser verdächtig moderfarbig aus. Da es sich aber darum handelte, ob wir hier noch zwölf Stunden warten sollten, oder nicht, wollten wir doch lieber probieren, ob unser Dampfer nicht ebenso gut durch den Moder als durch das Wasser dringen konnte. Mit vollem Dampf wurde die Schraube durch das braune Wasser getrieben, aber gleich darauf fühlten wir den Kiel durch eine teigige Masse gleiten, die Schnelligkeit verminderte sich, und plötzlich befand sich der ganze Vorderteil des Dampfers in einem Wald von Nipapalmen.
Zum Glück war dieser unbeabsichtigte Abstecher nicht verhängnisvoll, denn von einem festen Ufer war auch hier keine Rede, so dass das völlig auf die Moderbank geschobene Schiff. nach eigenen Drehungen der Schraube in umgekehrter Richtung, bald wieder mitten in der Kubu schwamm und seine Fahrt wieder aufnehmen konnte. Bald begann sich zu beiden Uferseiten der Reichtum der tropischen Vegetation zu entfalten; die federförmigen Blätter der Nipapalmen (Nipa fruticans Thb.) bildeten dabei stets einen lichtgrünen Saum um den dunkleren Urwald.
Das Fahrwasser machte viele Krümmungen und wurde hie und da so eng, dass es nur für einen kleinen Dampfer mit kräftigem Steuerruder passierbar war. Bisweilen fuhren wir, um besser wenden zu können, so dicht unter den Bäumen hindurch, dass wir vor ihren über [12] das Verdeck streichenden Ästen flüchten mussten. In einigen Stunden befanden wir uns endlich in einer breiten Flussverzweigung, an deren Ufern festes Land und Spuren von Kultur sichtbar waren. Kokospalmen erhoben ihre hohen Federkronen über die niederen Uferbäume, und für Eingeweihte wurde ein Fusspfad zu den malaiischen Wohnungen, die nach alter Gewohnheit sorgfältig hinter dem schützenden Wall von Uferbäumen verborgen lagen, sichtbar. Erst später erschienen auch einige Malaien in langen, schmalen, kaum über die Wasserfläche hervorragenden Böten; sie ruderten, um die Strömung zu vermeiden, unter dem Ufergebüsch.
Je weiter wir fuhren, desto zahlreicher wurden die den Reichtum dieser Gegenden bildenden Kokosnusspflanzungen. Die Eingeborenen waren hier weniger scheu; die Kinderschar geriet sogar beim Erblicken des Dampfbootes in fröhliche Erregung.
In wenigen Augenblicken waren alle Nachen mit kleinen Ruderern in Paradieseskostüm besetzt, die mit Rudern, Stöcken und Händen so schnell als möglich in die Mitte des Stromes zu gelangen suchten, wo ihre äusserst ranken Fahrzeuge von den Wellen unseres Dampfers so lange umhergeschleudert wurden, bis sie Wasser fassten und umschlugen. Dann plätscherte die braune Bemannung unter fröhlichem Gelichter im Flusse herum, kehrte das Boot wieder um, entfernte mit einigen geschickten Bewegungen das Wasser und schwang sich wieder in den Nachen.
Als wir uns gegen Mittag dem Hauptstrome näherten, erlangte die Wasserfläche eine Breite, wie sie im indischen Archipel nur die stolzen Ströme von Borneo aufweisen.
Auf der spiegelblanken Fläche war, bis wir Pontianak, den Hauptort an Borneos Westküste, erreichten, kein lebendes Wesen zu sehen. Jetzt belebten sich aber die Ufer. Die Häuser standen dicht bei einander und vereinigten sich, besonders am linken Ufer, zu einem langen malaiischen kampong (Dorf). Nach ihrer Bauart zu urteilen, hatten die Malaien auch hier den Begriff des Festlandes noch nicht zu fassen vermocht; denn vom erkennbaren Ufer aus erstreckten sich ihre Pfahlbauten bis weit in den Fluss hinein, wo noch einzelne, auf grossen treibenden Baumstämmen gebaute Häuser den Übergang von festen Wohnhäusern zu Fahrzeugen vervollständigten. Aus der Ferne war der Anblick der unregelmässig bei einander liegenden Gebäude mit der grau-braunen atap (Dachbedeckung von Palmblättern) und den [13] schwarzen Holzdächern recht hübsch, und die vielen, den Verkehr vermittelnden Ruderbötchen gaben dem Ganzen ein besonders lebhaftes Gepräge. In der Nähe jedoch machten sich die unschönen Farben der schlecht unterhaltenen Wände und Dächer zu sehr geltend; das Gleiche war auch beim Palast (dalam) des malaiischen Sultans der Fall, von dem ein Europäer etwas anderes als ein Durcheinander grosser, unansehnlicher Hütten erwartete.
Wir fuhren jetzt am anderen Ufer einer Reihe buginesischer Behausungen entlang, hinter welchen die hässlichen Hinterhäuser des sehr grossen chinesischen pasar (Markt) zum Vorschein kamen. Keines dieser Gebäude war auf den Grund gebaut; alle standen auf Pfählen im Morast; selbst die bis 10 m breiten Strassen bestanden aus Planken, die auf Pfählen ruhten.
Einen freundlicheren Eindruck machte der europäische Teil der Ortschaft; er dehnte sich mit seinen netten weissen Häusern und grossen Gärten zwischen dem üppigen Grün des Ufers aus.
Verglichen mit Batavia ist Pontianak ein kleiner Ort; als wir uns dem Anlegeplatz näherten, erinnerte ich mich aber, wie einst, nach dreijährigem Aufenthalt auf meinem nördlicher gelegenen Posten Sambas, dieser Anblick einen ganz anderen Eindruck auf mich machte. Damals, an kleine, graue, malaiische oder schmutzige, dunkle, chinesische Häuser gewöhnt, dachte ich unwillkürlich: “wie ist Pontianak doch gross und schön!” Die Bewunderung schwand aber, bei näherer Überlegung, auch damals schnell, und ich musste über die Veränderung lachen, die der Mensch unter dem Einfluss seiner Umgebung unmerklich erleidet.
Erklärlicher ist die Stimmung eines Offiziers, der mir erzählte, dass ihm Tränen in die Augen traten beim Gedanken, dass er hier einige Jahre verbringen sollte. Und doch—hat man hier längere Zeit gelebt—so nehmen die meisten mit Wehmut Abschied. Der “erste Posten” wird stets besonders lange in treuer Erinnerung bewahrt. Ist man an die Unstätigkeit einer indischen Laufbahn einmal gewöhnt, so fällt es einem leichter, angeknüpfte Bande wieder zu lösen, aber die beim Abschied vom ersten Posten vergossenen Tränen sind wahr, und die herzlichen Abschiedsworte, die man den das Geleite gebenden Bekannten zuruft, sind im. Augenblicke wirklich empfunden.
Bei Ankunft unseres Postdampfers stand, obgleich niemand erwartet wurde, “ganz Pontianak” in der Mittagsglut auf dem Stege, umgeben von zahlreichen Eingeborenen mit und ohne Uniform. [14]
Was das Hotel in Pontianak betraf, so hatte es seit meinem letzten Aufenthalt ebenfalls den Wechsel alles Irdischen erfahren, zum Glück aber nicht dabei verloren, Der frühere Besitzer, der, obwohl etwas braun, doch bei jedermann unter dem echt holländischen Namen Piet bekannt war, hatte sich mehr für seinen vorteilhaften Handel in Orang-Utanen und Orchideen als für den Gang seines Hotels interessiert, so dass dieses, nach dem Urteil von Kennern indischer Gasthäuser, unter seinem Interesse und Wirken auf zoologischem und botanischem Gebiet etwas zu leiden hatte.
Ob ihm nun seine vermittelnde Rolle zwischen europäischen Wissenschaftlern und Liebhabern und den Dajak des Inneren auf die Dauer nicht mehr gefiel, oder ob ein Wink des Residenten, der durch Erteilung einer Regierungsunterstützung auf die Führung des Gasthauses Einfluss hatte, das Seine dazu beigetragen, konnte ich aus der Ortschronik nicht sicher feststellen; so viel aber war gewiss, dass Piet jetzt am jenseitigen Flussufer in einer neu errichteten Ölfabrik tätig war und dass wir bei dem neuen Wirt auf reinerem Tisch und besser speisten, als es früher der Fall gewesen.
Der Einfluss der sich immer mehr ausbreitenden europäischen Industrie, der auch Pontianak aus dem Schlaf zu wecken drohte, hatte leider noch nicht zu eingreifenden und sehr notwendigen Verbesserungen seines Hotelgebäudes geführt. Das auf Pfählen in einer Schlammgrube errichtete Holzgebäude schien nämlich mit einem grossen Teil der Ortschaft im Einsinken begriffen zu sein. Bei dieser ständigen Abwärtsbewegung hatte der vor den Häusern dem Ufer entlang laufende Griessweg immer den Vorsprung; denn, nach dem was die Leute erzählten, musste er jedes Jahr mindestens um einen halben Meter erhöht werden, damit er nicht mehrere Male im Jahre unter den braunen Wassern des Kapuas verschwinde und ein Jagdgebiet der Krokodile werde, denen bereits etliche Menschen und Hunde zum Opfer gefallen waren.
Um meinen Aufenthalt nach Möglichkeit abzukürzen, hatte ich schon von Batavia aus an den Residenten von Pontianak die Bitte gerichtet, grössere Mengen gesalzener Eier, gedörrter Fische, Tabak u. dergl. für mich einkaufen zu lassen. Zu meiner angenehmen Überraschung hatte der Resident auch bereits das Salz, welches wir für den Selbstgebrauch vor allem aber als kostbaren Tauschartikel für die Bahau in grossen Mengen nötig hatten, luftdicht in verlötete Blechkisten zu je 20 kg Gewicht verpacken lassen. [15]
Wir nahmen 40 dieser Kisten mit und gebrauchten deren 30 am Mahakam.
An anderen notwendigen Artikeln entdeckte ich auf dem chinesischen Markt nicht viel Brauchbares; nur selten fand ich eine Partie Glasperlen, Tücher oder schwarzen Kattuns in der erforderlichen Verpackung. Die erleichterte Dampferverbindung mit den höher am Kapuas gelegenen Ortschaften hatte auch hier zur Folge gehabt, dass die Zwischenhändler verschwanden und die kleinen Händler von oben ihre Bestellungen direkt nach Singapore richteten.
Weit besser bediente man uns mit kadjang (Palmblattmatten) und allem, was mein Küchenjunge Midan, um mir in einer Gegend ohne toko (Läden) und pasar (Markt) eine gute Mahlzeit bereiten zu können, für nötig hielt. Da er hierin am meisten Sachkenntnis besass, konnte ich ihm die Küchensorgen getrost überlassen.
Der Resident hatte uns, gleich nach meiner Ankunft, seine Jacht “Karimata” zur Verfügung gestellt, so dass wir schon am 24. Mai nach Putus Sibau, unserem nächsten Halteplatz, weiterreisen konnten.
Dank der Zuvorkommenheit des Residenten durften wir die mitzunehmenden Leute unter den bewaffneten eingeborenen Schutzmannschaften selbst wählen; wir suchten diejenigen zu gewinnen, welche bereits bei der topographischen Aufnahme des Kapuasgebietes und bei den militärischen und wissenschaftlichen Expeditionen der letzen 10 Jahre als Geleite gedient hatten und an das Leben in der Wildnis, fern von ihrer Familie und der vertrauten Umgebung, gewöhnt waren. Zur Anwerbung dieser Soldaten begab sich Barth später von Sintang nach seinem früheren Wohnplatz am Melawie, Nanga Pinoh, und holte uns nachher am oberen Kapuas wieder ein.
Ich nahm also von Pontianak Abschied und zwar mit dem stillen Wunsch, dass mich die Westküste vor der Hand nicht wiedersehen sollte. Auf dem Flusse zeigte sich die gleiche Aussicht, wie einige Tage zuvor, nur wurden die Ufer eintöniger, weil die Nipa nur so weit wächst, als das Brackwasser reicht, also etwas über Pontianak hinaus.
Die breiten stillen Ströme bieten nur wenig Abwechslung; das Dampfschiff vertreibt Krokodile und Affen, die sich sonst zu zeigen pflegen, und der Waldrand ist zu weit entfernt, als dass man seine Schönheit wirklich geniessen könnte. Jetzt war er nur als schmaler Saum längs der Wasserfläche bemerkbar; auf der vorigen Reise hatte ich aber [16] einen unvergesslichen Eindruck von ihm erhalten. Damals machte ich die Fahrt mit einem ausgedienten Regierungsdampfer; infolge der starken Anspannung brach eine Maschinenstange, so dass wir lange liegen bleiben und mit einer kleinen, an Bord befindlichen Schmiede den Bruch zu heilen suchen mussten. Als die Schmiede an Land gebracht wurde, bekam ich, durch den Vergleich mit den am Ufer arbeitenden Menschen, einen Begriff von den riesenhaften Dimensionen der Urwaldbäume. Für gewöhnlich verliert man in der Beurteilung der Tropennatur gar bald jeden Massstab.
Die Landschaftsbilder, die sich auf der weiteren Fahrt vor uns entrollten, hatten viel Europäisches an sich; mit der Nipa waren nämlich die charakteristischsten Repräsentanten des Pflanzenreichs im indischen Archipel, die Palmen, verschwunden; sie zeigen sich in den aequatorialen Wäldern Borneos, mit wenigen Ausnahmen, nur da, wo der Mensch sie hinpflanzte. Gewöhnlich geben ihre Federkronen den Ort an, an dem Menschen wohnen oder gewohnt haben. Erblickt man daher einen Tropenwald aus der Ferne, von oben oder von der Seite, so sieht man nur Laubbäume; aus der Nähe betrachtet verschwindet jedoch dieses europäische Äussere; das einfarbige Bild löst sich nach der grossen Verschiedenheit der tropischen Baumarten, die hier neben, über und durch einander wachsen, in eine unendliche Mannigfaltigkeit grüner Schattierungen auf.
Während der beinahe zwei mal 24 Stunden dauernden Fahrt nach Sintang verändert sich die Gegend nur wenig; der Strom wird breiter und breiter, bis bei Tajan, dem Wohnplatz eines Kontrolleurs, die Ufer 1500 m von einander entfernt sind, so weit, dass man die Bäume der gegenüberliegenden Seite schwer unterscheiden kann. Der Dampfer hielt nicht an, um dem Beamten Nachrichten von der Aussenwelt zukommen zu lassen, die ihm in seinem Einsiedlerleben, als einzigem europäischen Repräsentanten der Regierung, einige Abwechslung gebracht hätten. Der Kontrolleur verwaltet ein Gebiet von der Grösse einer Provinz seines Vaterlandes, auf dem sich jedoch nur hie und da eine Niederlassung von Dajak oder Malaien unter dem panembahan (Fürst) von Meliau befindet.
Endlich brachten einige Hügelreihen mit unregelmässigen Formen etwas Abwechslung in das Bild; sie waren aber nicht hoch genug, um die majestätische Wasserfläche zu beherrschen. In der ersten Nacht passierten wir Sanggau, an dem wir vorbei dampften, um so schnell [17] als möglich Sintang zu erreichen. Am 26. Mai erwachten wir dort; um unsere Nachtruhe nicht zu stören, hatte der Kapitän kein Signal mit der Dampfpfeife ertönen lassen.
An der Mündung der Mĕlawie erbaut, hat Sintang, wie alle grossen malaiischen Wohnplätze, eine vorzügliche Lage, um auf den Handel der im Gebiet der Mĕlawie wohnenden Dajak einen beherrschenden Einfluss auszuüben, d.h., nach malaiischer Auffassung, so viel Steuern als möglich zu erpressen. Diesem erhebenden Streben der malaiischen Fürsten ist nun durch die indische Regierung Zaum und Zügel angelegt worden; aber sie haben doch stets eine starke Festung mit 150 Mann Besatzung vor Augen nötig, um sich in ihre Beschränkung zu fügen.
Zu meiner Freude konnte ich in Sintang verschiedene alte Bekannte begrüssen; im übrigen hatte ich aber keinen Grund, mich hier lange aufzuhalten, denn auf dem Markt fand ich nur einen einzigen für den oberen Kapuas brauchbaren Artikel. Ich setzte jetzt alle Hoffnung auf den Markt von Bunut und auf die Chinesen, die von dort aus in grossen, verdeckten Magazinböten ihre Handelsartikel nach Putus Sibau hinaufrudern.
Nachdem wir in Sĕmitau, einer Station auf unserer ersten Expedition im Jahre 1894, den Kontrolleur besucht hatten, ging es schnell den Fluss aufwärts bis nach Bunut, das wir am 28. Mai abends erreichten. Weiter aufwärts wurde die Fahrt nachts gefährlich wegen der grossen abwärts treibenden Baumstämme und der im Fluss versunkenen Stämme (einige Eisenholzarten haben ein sp. Gewicht von etwa 1.2), die bei Hochwasser durch den starken Strom immer weiter verschoben werden.
Oberhalb Semitau trugen die Ufer des Kapuas einen anderen Charakter; die ununterbrochene Buschvegetation war verschwunden, man sah nur niedriges Strauchwerk, das auf den von Malaien und Dajak verlassenen ladang (trockenen Reisfeldern) aufgeschossen war.
Der chinesische Markt in Bunut enttäuschte mich, was seinen Vorrat an Perlen und seidenen Tüchern betraf, zum Glück nicht; wir waren aber doch schon um 8 Uhr morgens mit unseren Einkäufen fertig und konnten sogleich weiter nach Putus Sibau hinauf fahren.
Unterwegs hatte ich aufs neue Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, mit welcher enormen Schnelligkeit sich das Pflanzenreich eines verlassenen Kulturbodens wieder bemächtigt. Vor zwei Jahren hatte ich mich über die grosse Zahl der am linken Ufer angelegten Reisfelder [18] gewundert, jetzt war von diesen wenig mehr übrig; das Ufer war überall gleichmässig von derselben Strauchvegetation von 10–15 m Höhe bedeckt.
Dank dem hohen Wasserstande, konnten wir unsere Fahrt über Untiefen und versunkene Baumstämme ungehindert fortsetzen, bei den letzten Strahlen der untergehenden Sonne Putus Sibau erreichen und bei der mir wohlbekannten kubu (Blockhaus) auf dem Floss anlegen. Diese kubu, deren es am oberen Kapuas zahlreiche giebt, sind viereckige, ungefähr 2 m über dem Boden errichtete und rund herum mit Palisaden umgebene Gebäude, die etwa 10–20 mit Beaumontgewehren bewaffneten Eingeborenen als Wohnhaus dienen. Unter Aufsicht des Kontrolleurs stehend haben diese Soldaten für die Aufrechterhaltung der Ruhe zu sorgen, zugleich müssen sie dem Beamten auf seinen Reisen, die hier stets zu Wasser ausgeführt werden, als Ruderer dienen.
Putus Sibau liegt am Kapuas vor der Mündung seines rechten Nebenflusses Sibau und ist der höchste Punkt, den Dampfer bei hohem Wasserstande noch erreichen können. Weiter oberhalb engen grosse Geröllbänke das Flussbett in Trockenzeiten stark ein und verursachen in Regenzeiten wiederum so heftige Stromschnellen, dass auch kleine Dampfbarkassen nur in den günstigsten Fällen weiter hinauffahren können. Lange bevor man in Putus Sibau an eine Dampferverbindung dachte, hatten die Malaien die grosse Bedeutung dieses Ortes bereits begriffen und hier ihre letzte Niederlassung im Binnenlande gebaut. Bis vor kurzem waren sie hier Alleinherrscher; ihren Hauptunterhalt bildete der Handel mit den wichtigsten der benachbarten Dajak Stämme: den Kajan-, Taman-, Kantu- und Sibau-Dajak; einen Nebenerwerb bildete das Sammeln von Buschprodukten.
Als nach Einsetzung der niederländischen Verwaltung den ständigen Fehden der Stämme untereinander und besonders den Einfällen der Batang-Lupar aus Sĕrawak ein Ende gemacht wurde, wagten sich sehr bald auch die Chinesen bis Putus Sibau hinauf. In langen Ruderröten fuhren sie in 3–4 Tagen den Kapuas von Bunut aufwärts, um ihre Waren vom Markt in Bunut hier an den Mann zu bringen. Die niederländische Regierung verweigerte ihnen aber das Niederlassungsrecht, das sie sich wohl auch nicht sonderlich wünschten, da der Kontrolleur weit ab, in Sĕmitau, wohnte und die Malaien ihre Konkurrenten, durch deren Gegenwart ihrem Monopol auf den betrügerischen Handel mit [19] den Dajak ein Ende gemacht wurde, mit scheelen Augen ansahen. Das Wohnen in Böten bietet den Chinesen ausserdem den grossen Vorteil, dass sie sich bei drohender Gefahr schnell aus dem Staube machen können, was in dieser Gegend, wie es sich in den letzten Jahren erwiesen, oft sehr wünschenswert war.
Wenige Jahre vor unserer ersten Expedition 1894 waren, auf das Gerücht eines grossen Einfalls der Dajak aus Sĕrawak hin, alle Händler aus Putus Sibau nach Bunut geflüchtet; die Bevölkerung selbst lebte seit dem grossen Plünderungszug der Batang-Lupar am oberen Mahakam 1885 in ständiger Angst.
Bei meiner Ankunft jedoch waren alle schreckenerweckenden Gerüchte längst vergessen und seit meinem ersten Besuch in Putus Sibau hatten viele Veränderungen stattgefunden. Der Resident hatte es nach der ersten wissenschaftlichen Expedition für ratsam gehalten, den malaiischen Distriktsaufseher von Putus Sibau durch einen Kontrolleur, den Herrn Westenenk, zu ersetzen und dieser hatte dafür gesorgt, dass das Äussere des malaiischen Dorfes, das, wie überall am Kapuas, aus einer Reihe niedriger Häuser am Flussufer bestand, wesentlich verbessert worden war; ausserdem hatte er den chinesischen Händlern das Niederlassungsrecht gewährt.
Auf dem rechten Ufer, das hoch gelegen war, und nicht, wie das steile linke, bei jedem Hochwasser ein Stück Boden durch Absturz verlor, waren eine Reihe chinesischer Häuser im Bau begriffen; sie schlossen sich dicht an einander und waren durch eine lange Galerie unter ihrem gemeinsamen Dache verbunden.
Hier war also der Grund zu einem neuen festen Handelsplatze mit ansässiger. Bevölkerung gelegt, für die umliegenden Gebiete ein Ereignis von grösster Bedeutung, da die Aufsicht eines europäischen Beamten den allzueifrigen Bemühungen der Händler, sich auf Kosten der harmlosen Eingeborenen zu bereichern, eine Grenze setzte. Eine weitere wichtige Folge der Gewährung des Niederlassungsrechtes war, dass die chinesischen Handelsdampfer jetzt nicht mehr in Bunut Halt machten, sondern direkt bis Putus Sibau hinauffuhren, wodurch die Preise der eingeführten Waren sanken und die der Buschprodukte stiegen.
So konnte auch ich meine Einkäufe jetzt ebensogut in Putus Sibau als in Bunut machen, was mir, besonders später beim Zuge an den Mahakam, sehr zu statten kam. [20]
Ein Teil der kleineren malaiischen und chinesischen Händler hatte jetzt gerade schwere Zeiten zu bestehen, da einige andere, reiche, von weit unten heraufgekommene Konkurrenten sich besonders des Handels mit Buschprodukten zu bemächtigen suchten.
Eine wichtige Rolle bei dieser Art von Handel spielt das Vorschusswesen: ein Malaie oder Dajak, der in den Urwald zieht, um Buschprodukte zu suchen, erhält von einem anderen Malaien oder Chinesen auf Kredit eine Ausrüstung an Kleidern, Werkzeugen und besonders an Reis unter der Bedingung, dass er später mit dem, was die Expedition an Rotang, Guttapercha und Kautschuk liefern wird, das Geliehene reichlich zurückbezahlt. Sind die Buschproduktensucher einmal fort, so ist eine Überwachung ihrer Arbeit oder eine Bestimmung des Termins ihrer Rückkehr fast unmöglich, da sie wochenlang in unbewohntem Lande die Flüsse hinauffahren und man sie in den Bergen des Urwaldes schwer erreichen kann.
Meistens sind es Malaien, die sich ganz dem Sammeln von Buschprodukten widmen; ihr angeborener Hang zum Nomadenleben und die eingebildete Freiheit, die sie im Urwalde geniessen, treibt viele dazu, ihre Dörfer am unteren und mittleren Kapuas für Jahre zu verlassen; ihnen schliessen sich auch manche, von bösem Gewissen geplagte Leute an, um dem Gefängnis zu entgehen.
In Gegenden, die reich an Rotang und Guttapercha sind, trifft man daher eine sehr zweifelhafte Gesellschaft malaiischer Abenteurer an; sie wissen sich jedoch auch das Leben im Urwalde gemütlich zu machen. So bildete 1896 der Oberlauf des Kréhau, des linken Quellflusses des Kapuas, das Zentrum des Buschverkehres; man baute dort, in nächster Nähe der Buschprodukte, Wohnungen. Händler brachten die nötigen Waren, die wegen des schwierigen Transportes sehr teuer wurden; aber die Möglichkeit, die man dort genoss, der Leidenschaft für Kartenspiel und Hahnengefechte ungestraft fröhnen zu können, wog manche Nachteile auf. Aus Mangel an Frauen vergriffen sich die Malaien an denjenigen der in der Nachbarschaft schwärmenden Punan und Bukatstämme; das kostete ab und zu allerdings einen Kopf—aber was riskiert man nicht alles der goldenen Freiheit wegen!
Unternehmendere Malaien dingen bisweilen für einige Monate zu einem bestimmten Lohn Kajan- oder Taman-Männer und ziehen mit ihnen in den Wald. Wird eifrig gesammelt, so bildet das Buschproduktesuchen eine lohnende Beschäftigung, der am Kapuas viele [21] einen gewissen Wohlstand zu danken haben. Die Malaien sind aber im Busch wie zu Hause einer regelmässigen Arbeit abgeneigt.
Haben sie eine so grosse Menge Guttapercha und Rotang beisammen, dass sie von ihrem Ertrag einige Zeit leben und geniessen können, so tritt ihre Sucht zum Faulenzen und ihre Leidenschaft für Würfelspiel und Frauen so sehr in den Vordergrund, dass die Arbeit im Stich gelassen wird, bis die Not sie wieder zu ihr treibt. Unter diesen Umständen regt auch der Gedanke an die fernen Gläubiger nicht zur Arbeit an. Auf viele wirken diese Verhältnisse geradezu lähmend; denn sie machen stets neue Schulden, deren Tilgung immer schwieriger wird.
Begreiflicher Weise ist unter derartigen Verhältnissen das Ausleihen auf Kredit für die Händler mit grossem Risiko verbunden und bietet nur denjenigen Vorteil, die im Stande sind, mit auf den Arbeitsplatz zu ziehen und ihre Schuldner zu beaufsichtigen. In dieser Beziehung sind die kleinen Händler den grossen gegenüber im Vorteil.
Geld spielt bei diesen Handelskontrakten selten eine Rolle. Sowohl Malaien als Dajak lassen sich ihre Produkte mit Kattun, javanischem Tabak, Salz und allerhand Nahrungsmitteln bezahlen. Auch die Dajak kaufen gern auf Schulden und bezahlen diese bei der folgenden Reisernte. Von einer Zinszahlung in unserem Sinne ist hier keine Rede; aber die Händler entschädigen sich, indem sie die Quantität des zu empfangenden Reises erhöhen. Auch hierin bringen geregeltere Zustände Veränderungen hervor; so erzählte mir der Kajanhäuptling Akam Igau, der in seinem Leben viele Handelszüge unternommen hatte, dass er seine ersparten Dollars in Bunut nach malaiischer Weise gegen 3% monatlichen Zinses unterzubringen beabsichtige.
In auffallendem Gegensatz hierzu werden europäische Industrieprodukte, die aus den Fabriken direkt nach Singapore und von dort durch Chinesen nach Putus Sibau eingeführt werden, zu kaum höheren Preisen als in Europa verkauft. Wir wunderten uns nicht wenig, hier für fl 1.37 europäische Regenschirme kaufen zu können, die wegen ihres dünnen Überzuges zwar besser gegen Sonne als gegen Regen schützten, im übrigen aber hübsch gearbeitet waren. Einfache Schmucksachen, wie vergoldete Armbänder, waren zu Bazarpreisen käuflich und nette Glasdöschen mit einem Dutzend Fingerringe mit bunten Steinen zu fl. 1 lieferten den traurigen Beweis, dass in Europa viel Arbeit gegen geringe Belohnung geleistet werden muss.
Da die Bedürfnisse und das Kaufvermögen der Dajak sehr gering [22] sind, kann ein Handel mit ihnen auch nur wenige unterhalten und die vielen Malaien, die langsam flussaufwärts gezogen sind, sehen sich genötigt, hauptsächlich vom Ertrag der Buschprodukte zu leben. Jedoch auch die Buschprodukte müssen schon seit Jahren aus sehr entfernten Gegenden geholt werden und der Vorrat ist so beschränkt, dass er nicht mehr allen einen Verdienst liefern kann. Um der dringenden Not abzuhelfen, wurde, bei meinem früheren Aufenthalt am Mendalam, der Kapuas freigegeben, um aus dein Flussand Gold zu waschen. Die Goldwäscherei ist hier zwar nicht sehr lohnend, reicht jedoch zum Unterhalt einer Familie aus, da auch Frauen und Kinder sich an der Arbeit beteiligen. In Anbetracht des Umstandes, dass sich die benachbarten Dajakstämme dadurch in ihren Rechten verkürzt glaubten, verlangte diese Massregel viel Umsicht und Geschicklichkeit seitens des Kontrolleurs, und die Goldwäscherei wurde auch nicht weiter als bis zur Mündung des Kréhau gestattet.
Dergleichen Rechte der Dajak auf die Erzeugnisse des Landes werden übrigens auch beim Sammeln von Buschprodukten berücksichtigt und die Sitte verlangt, dass dem betreffenden Dajakhäuptling 10% des Ertrages abgeliefert werden. Am oberen Kapuas sind durch das Hin- und Herziehen der Stämme die Ansprüche auf Ländergebiete so kompliziert geworden, dass die holländische Verwaltung sich in diesem Stromgebiet mit der Einnahme und Verteilung der Steuern unter den Häuptlingen hat befassen müssen. Auch die ausserhalb wohnenden Pnihinghäuptlinge vom Mahakam kommen hierbei in Betracht, da auch sie früher am Kapuas lebten. [23]
1 Den Titel “Resident” führt in niederländisch Borneo der höchste Regierungsbeamte; auf ihn folgt der Assistent-Resident und in dritter Rangstufe der Kontrolleur.
Kapitel II.
Aufenthalt in Patus Sibau—Aussichten für die Mahakamreise—Besuch der Batang-Lupar Aufbruch nach Tandjong Karang—Einrichtung des Kajan Hauses—Ärztliche Praxis unter der Bevölkerung—Vorbereitungen für den Zug nach dein Mahakam—Rückkehr nach Putus Sibau Einkauf von Ethnographica und Krankenbehandlung—Verwundung eines Sibau Dajak.—Zurücksendung eines Jägers—Besuche der Kajan—Usun in Putus Sibau—Befragen der Vögel—Aufbruch nach dem Mahakam.
Der Kontrolleur von Putus Sibau, dein schon von Batavia aus die Bestellung von Böten aufgetragen worden war, hatte uns bereits erwartet und die Kaserne seiner Schutzsoldaten zur Aufnahme unserer Mannschaften und Güter vorbereitet. Nachdem wir uns in der alten Umgebung wieder eingerichtet hatten, erkundigten wir uns, wie es mit der Aussicht auf eine Expedition zum Mahakam stehe. Vorläufig waren die Aussichten noch nicht glänzend; die Kajan am Mendalam waren noch mit der Ernte beschäftigt; ihr Häuptling Akam Igau, der mich bereits auf der vorigen Reise begleitet hatte, befand sich eben am Embálau, um mit den Erbfeinden der Kajan, den Batang-Lupar (auch Hiwan genannt) aus Sĕrawak, zu beraten; endlich lauteten auch die Berichte vom Mahakam beunruhigend. Wie bei allen bösen Gerüchten aus diesen Gegenden, standen auch jetzt wieder begangene Mordtaten im Vordergrund: die Bungan Dajak sollten einen Malaien Adam, der 1896 meinen Zug zum Mahakam zu verhindern gesucht hatte, getötet haben und am Boh sollten fünf Batang-Rĕdjang, welche am Flussufer nach Buschprodukten suchten, ermordet worden sein.
Bald stellte sich auch heraus, dass die Kajan die bestellten Böte noch nicht fertig hatten, so dass die wenigen Monate günstiger Reisezeit, die uns noch übrig blieben, sicher mit Vorbereitungen verstreichen mussten.
Sobald Akam Igau, den der Kontrolleur mit dem kleinen Dampfer “de Punan” vom Embälau zurückholen liess, unsere Pläne gehört und [24] sich überlegt hatte, erklärte er sich bereit, uns zu begleiten. Seine Zusage war für uns eine grosse Beruhigung; wir ersahen aus ihr, dass er, der die Denkweise seiner Verwandten am Mahakam besser als irgend jemand kannte, die Aussicht auf Erfolg für genügend gross hielt, um mit uns die Reise zu wagen. Seine Zusage bezog sich jedoch nur auf ihn und einige seiner Leibeigenen; um aber eine rationelle und ausgiebige Unterstützung zu erlangen, musste ich selbst mit den verschiedenen Niederlassungen der Kajan am Mendalam Unterhandlungen anknüpfen.
Auf meiner letzten Reise hatte ich einen jungen, Akam Igau feindlich gesinnten Häuptling, namens Tigang Aging, vorn Zuge ausschliessen müssen, weil ich Zwistigkeiten zwischen beiden fürchtete; jetzt aber hatte ich so viel mehr Personal bei mir, dass auch mehr Träger und Ruderer erforderlich waren, als eine einzige Niederlassung liefern konnte; es war mir daher sehr willkommen, dass auch Tigang zum Mitgehen bereit war.
Die Unterhandlungen begannen wiederum mit einer Diskussion über die Zeit des Aufbruchs.
Obgleich die Ernte noch nicht beendet und das grosse Neujahrsfest noch nicht gefeiert worden, zu den Reisevorbereitungen also noch ein Überfluss an Zeit vorhanden war, lautete der Vorschlag seitens der Kajan doch, dass nicht vor der folgenden Saatzeit aufgebrochen werden sollte, was einen Aufschub von fünf Monaten und ein Reisen zu ungünstiger Jahreszeit bedeutete. Ich appellierte jedoch an ihren gesunden Verstand und suchte ihnen begreiflich zu machen, warum dieser Vorschlag unausführbar war; im übrigen überliess ich diese wichtige Frage jedoch der Zukunft, da ein erwarteter Versöhnungsbesuch der Batang-Lupar, die sich noch am Embálau aufhielten, die Gemüter sehr erregte und für andere Interessen unzugänglich machte.
Diese Batang-Lupar kamen nämlich, etwa 100 Mann stark, aus dem Gebiete von Sĕrawak und standen unter Führung von zweien der grössten Häuptlinge am mittleren Batang-Rĕdjang, Kanjan und Rawing. Beide hatten sich als Anführer des grossen Feldzuges der Batang-Lupar gegen die Kĕnjastämme im Quellgebiet des Balui oder oberen Batang-Rĕdjang einen grossen Ruf erworben. Schon seit alter Zeit lebten die Batang-Lupar mit den Taman und Kajan am Mendalam auf dem Kriegsfuss, jetzt kamen ihre Häuptlinge, wie sie sagten, um Frieden zu schliessen. [25]
Nach ihrer Art und Weise zu reisen waren diese Batang-Lupar schon seit sechs Monaten unterwegs; ihre wahrsagenden Vögel hatten sie stets wieder gezwungen Halt zu machen und sie selbst hatten jede Gelegenheit benutzt, um im Gebirge Buschprodukte zu sammeln. Auch hatte ihnen im Urwald die Herstellung von Böten zum Befahren des Embálau viel Zeit gekostet.
In Borneo ist jeder Fremdenbesuch verdächtig, da nach Landessitte eine gute Gelegenheit Köpfe zu jagen auch auf Gäste sehr verlockend wirkt. Bedenkt man, dass der Kontrolleur in Putus Sibau mit seinen 8 Schutzsoldaten keine starke Festung zur Verfügung hatte, so nimmt es nicht Wunder, dass man auch dort sehr auf der Hut war.
Sicherheitshalber hatte der Kontrolleur Kanjan und Rawing nur mit 30 Mann Gefolge nach Putus Sibau zu kommen gestattet, auch sollten die beiden Häuptlinge nur eine Nacht in jeder Kajan Niederlassung verbringen und zwar ohne ihr Geleite. Um ihnen diesen Beschluss mitzuteilen, war Akam Igau, der als weitgereister Mann auch diese Stämme kannte, zum Embálau gesandt worden.
Ich erlebte noch die Ankunft der Batang-Lupar in Putus Sibau und hörte ihre indirekten Berichte vom Mahakam. Da empfing ich von den Mendalam Kajan aus Tandjong Karang die Nachricht, dass sie mich, ihrer vielen Kranken wegen, mit Ungeduld erwarteten. Obgleich die Friedensfeier sehr interessant zu werden versprach, beschloss ich doch, der Bitte meiner Kajanfreunde bald Folge zu leisten.
An Vorräten und Tauschartikeln nahm ich nur das Notwendigste mit, alles übrige liess ich unter der Obhut des Kontrolleurs in Putus Sibau zurück.
Demmeni und Bier sollten während meines Aufenthaltes bei den Kajan ihre Zeit dazu verwenden, ihre Ausrüstung in Ordnung zu bringen. Ersterer sollte ausserdem die Aufsicht über einige Leute aus Buitenzorg führen, die Kisten und Blechsachen zu reparieren oder herzustellen hatten.
Doris der Präparator begann sogleich seine Tätigkeit auf zoologischem Gebiet, während die beiden Javanen, Sĕkarang und Hamja, hier gute Gelegenheit hatten, sich im Sammeln und Lebendkonservieren von Urwaldpflanzen zu üben. Obgleich beide nur im botanischen Garten von Buitenzorg gearbeitet hatten, zeigten sie sich doch bald, in noch höherem Grade als ihre Kollegen im Jahre 1896, zur Erfüllung ihrer Aufgabe befähigt. [26]
Wegen der Schwierigkeit, die Kajan auch nur für einen Tag zur Unterbrechung ihrer Arbeit zu bewegen, um mich und mein Gepäck nach Tandjong Karang abholen zu lassen, mietete ich einige Malaien, die sich nie durch anderweitige Pflichten daran verhindert sehen, einen Extralohn zu verdienen.
Böte lieh mir der Kontrolleur und so konnte ich bereits am 7. Juni zum Mendalam aufbrechen.
Als wir, nach fünfstündiger Fahrt, um die letzte Flussbiegung fuhren, trat mir das wohlbekannte Tandjong Karang wieder vor Augen: hinter einem Vordergrunde von dunkelgrünen Fruchtbäumen und zahlreichen kleinen, zerstreuten Reisscheunen kam das hohe, gerade Dach der langen Kajanwohnung zum Vorschein. Das Haus dehnte sich parallel dem Ufer über eine 250 m lange Strecke aus; sein 15 m hoher First, der sich gegen den hellen Himmel besonders scharf und geradlinig abhob, war nur in der Mitte, über der Wohnung des Häuptlings, um einige Fuss erhöht.

Tandjong Karang.
Mit Stangen das Boot längs dem Ufer vorwärtstreibend, erreichten wir bald die Steinbank vor dem Hause und ich verliess mein Fahrzeug, umringt von Kindern, von denen mich einige mit dem Finger im Munde verlegen anstarrten; durch meinen vorigen Besuch waren sie jedoch schon zu sehr an mich gewöhnt, um fortzulaufen. Ein vielbetretener Pfad führte mich das hohe Ufer hinauf; weiter diente ein langer Baumstamm als Brücke über einen 5 m tiefen Graben, den der Strom seit meinem letzten Aufenthalt hatte entstehen lassen. Hieran schloss sich ein aus 1 m breiten Brettern bestehender Steg, der in 1½ m Höhe über dem Erdboden auf Eisenholzquerbalken ruhte, die wiederum in die Öffnungen senkrecht stehender Pfähle eingefügt waren. Dergleichen Pfähle werden gewöhnlich mit grotesken Menschenfiguren verziert, hier war man aber noch nicht so weit. Dieser 40 m lange Steg führte zu einer kleinen Plattform am Fuss der Haustreppe. Wir hatten bei diesem Gang den mit Fruchtbäumen und Reisscheunen besetzten Vorderplatz passiert, der ausserdem viele kleine mit Sirih (Piper betle) und Gemüse bepflanzte Gärtchen enthielt, welche gegen die vielen frei herumlaufenden Schweine und Hühner mit festen flecken umgeben waren.
Am Fuss der Treppe stand Akam Igau; er empfing mich sehr erfreut und forderte mich auf, ins Haus einzutreten. Auf der Galerie des 5 m über dem Erdboden auf einem Wald von Pfählen ruhenden Hauses hatte sich bei meiner Ankunft eine Menge brauner Gestalten [27] aus den verschiedenen Wohngemächern versammelt, vor allem Frauen und Kinder, die ihre Neugier am wenigsten zu beherrschen schienen. Die gute Kajansitte forderte jedoch, dass sich keiner unsere frühere Bekanntschaft merken liess, bevor ich ihn mit einem Kopfnicken begrüsst hatte, d.h. auch das Kopfnicken entsprach eigentlich nicht der Sitte; denn unter einander begrüssen sich die Kajan überhaupt nicht. Besuchen sie einander, so machen sie es sich erst bei ihren Gastherren gemütlich, bevor sie für diese zu sprechen sind.
Die Frauen trugen offenes Haar, blossen Oberkörper und verschiedene Halsketten; von unterhalb der Hüften bis zu den Füssen bekleidete sie ein Röckchen, das mittelst zweier Perlenschnüre am Körper festgebunden war. Von den Kindern liefen nur die kleinsten nackt umher, die ungefähr zweijährigen trugen bereits ein Röckchen oder Lendentuch. Die Kleidung der Männer bestand bei den meisten nur in einem Lendentuch, einige erfreuten sich auch des Besitzes einer bunten malaiischen Hose.
Nachdem sich die Menge etwas verlaufen hatte, liess sich die mächtige Galerie des Hauses in ihrer ganzen Ausdehnung überblicken.
Bei allen Dajak herrscht die Sitte, dass der ganze Stamm in einem einzigen langen Hause (umā) wohnt; sie tun dies der Sicherheit wegen. Aus dem gleichen Grunde bauen sie ihre Häuser auch auf Pfählen, mehrere Meter über dem Erdboden; jedes Haus dient bei Überfällen zugleich auch als Festung gegen den Feind. Von der Galerie (ăwă) führen an der durchlaufenden, mittleren Hauswand (liding) in Abständen von 4–6 m Türen mit ½ m hohen Schwellen in die dahinter gelegenen Wohngemächer (āmin) der einzelnen Kajanfamilien. Vor der Häuptlingswohnung (āmin aja), wo das Dach etwas erhöht war, erreichte auch die Galerie eine grössere Breite und ragte mit erhöhtem 2 m breitem Fussboden nach aussen vor. Dieser Ausbau, auf dem ein Herdplatz angebracht war, diente als Gastgemach und war auch mir als solches angewiesen. Bau, Ausführung und Reinheit der Galerie fielen angenehm auf; der Fussboden bestand aus gut bearbeiteten aneinanderschliessenden Planken, auf denen man auch abends, ohne seine Gliedmassen zu riskieren, ruhig umhergehen konnte.
Vor jeder Wohnung bzw. jedem Wohngemache stand neben der Tür ein zum Reisstampfen bestimmter Block, (le̥song).
An der Aussenseite, wo das schräge Schindeldach nur t m über dem Fussboden hing, war die Galerie durch eine Reihe horizontaler Latten abgeschlossen. [28]
Während meine Leute das Gepäck nach oben ins Gastzimmer brachten, lud mich Akam Igau zur Begrüssung seiner Familie in seine Wohnung ein.

Geschnitzte Haustür des Häuptlings Akam Igau.

Inneres von Akam Igaus Wohnung A.

Inneres von Akam Igaus Wohnung B.
In gebückter Haltung über die Türschwelle steigend gelangte ich in einen schmalen langen Gang, der mitten in ein 8 × 12 m grosses Gemach führte. Männer, Frauen, Kinder und Hunde bewegten sich in dem rauchgeschwärzten Raume durcheinander.
Beim Lichtschein, der spärlich durch das grosse, mittelst einer Palmblattklappe geschlossene Dachfenster (huwábw) hereindrang, bemerkte ich längs den Wänden verschiedene gesonderte Räumlichkeiten, welche den verheirateten Familiengliedern, die im übrigen alle zusammenlebten, als Nachtquartier dienten. Längs der Galeriewand erhob sich ein 5 m breiter Herd auf dem etliche eiserne Töpfe (tāring) auf Dreifüssen zum Kochen gestellt waren. Auf Wandgestellen über dein Feuer befanden sich, durch den Rauch vor Feuchtigkeit und Insekten geschützt, die Küchenvorräte: das sehr kostbare Salz, Bataten, Mais und trockene Zuspeisen für den Reis.
Die Kochgerätschaften bestanden ausschliesslich aus flachen Eisenpfannen verschiedener Grösse, während zum Wasserholen grosse Bambusgefässe und Kalabasse dienten.
Über den Gestellen mit Esswaren befanden sich andere mit sorgfältig gestapeltem Brennholz, das hier zum Trocknen ausgebreitet war.
Während ich die Umgebung musterte, hatten die Hausbewohner Zeit gehabt, sich von der Erregung, welche meine Ankunft verursacht hatte., zu erholen, und ich begann die Hauptpersonen der Gesellschaft zu begrüssen. Die Töchter des Häuptlings und deren Ehemänner kamen zuerst an die Reihe, die jüngeren Söhne waren zum Glück nicht allzu schüchtern.
Auch verschiedene Sklavenfamilien, die bei der Hausarbeit behilflich sein mussten, hausten in diesem Gemache.
An der Aussenwand gegenüber der Tür (be̥tamen), wo der Zimmerboden etwas erhöht war, standen in langer Reihe grosse Gonge und Tempajan (chinesische Töpfe); die älteren und kostbareren waren mit den übrigen Familienstücken wie: alte Schwerter, Speere und Perlen, in den gesonderten Räumlichkeiten geborgen.
Um die Anwesenden baldmöglichst von meiner beängstigenden Gegenwart zu befreien, ging ich wieder auf die Galerie hinaus und sorgte dort, dass mein Gepäck geschickt gestapelt wurde, damit für mein [29] Klambu (Moskitonetz) noch Platz übrig blieb. Mittelst einiger Matten wurde der Raum schnell in ein Zimmer verwandelt, das mir nach der langen Reise sehr willkommen war. Sobald konnte jedoch von Ruhe keine Rede sein, denn die Malaien aus Putus Sibau mussten ihren Lohn erhalten, um noch am selben Tage zurückzukehren, und bald strömten auch besorgte Eltern mit kranken Kindern und besorgte Kinder mit kranken Eltern herbei, die alle von meinen allmächtigen Arzneien Hilfe erwarteten.
Nachdem ich etwas geruht und von dem genossen hatte, was mein Diener auf dajakischem Herde für mich bereitet hatte, reichte das Tageslicht noch gerade zu einem Spaziergang in der Galerie; absichtlich beschäftigte ich mich mehr mit den leblosen als mit den allzu schreckhaften lebenden Wesen meiner Umgebung.
Das lange Haus enthielt ungefähr 50 verschiedene Räume, jeder von einer mehr oder minder zahlreichen Familie bewohnt und von nahezu gleicher Grösse; nur die Einrichtung der Zimmer war, je nach der Wohlhabenheit ihrer Bewohner, verschieden.
Über jeder Haustür standen auf horizontalen Balken der Vorwand grosse Körbe mit Rotang und Fischerei- und Ackerbaugerätschaften.
Auch in diesen kleineren Wohnräumen der gewöhnlichen Leute herrschte wie bei der Häuptlingsfamilie das Prinzip der gesonderten Schlafkammern für Verheiratete und junge Mädchen. Die jungen, unverheirateten Männer schlafen vom achten Jahre an in der Galerie.
Am folgenden Tage setzten mit Hilfe des Häuptlings einige Männer das Gerüst für eine Hütte von 4 × 6 m Bodenfläche zusammen; mit den mitgeführten Palmblattmatten wurden die Wände belegt und mit Segeltuch das Dach gedeckt, so dass ich bereits abends mein Klambu im neuen Palast aufstellen konnte; hier belästigte ich die Bewohner des langen Hauses nicht und war auch selbst in ruhigerer Umgebung.
In den ersten Tagen erneuerte ich die Bekanntschaft mit einstigen Freunden und Freundinnen; bei allen hatte ich anfangs eine gewisse Zurückhaltung zu überwinden, die aber nur ihrer Sitte entsprang; denn sie schwand bei einem freundlichen Blick oder Wort oder kleinen Geschenk. Obgleich ich fast alle bekannten Gesichter wiederfand, war es doch Zeit, dass ich mit meinen Arzneien den Kampf gegen die bösen Geister, die Urheber aller Krankheiten, wieder aufnahm. Einen kleinen Jungen, der, durch Syphilis erschöpft, seinen Eltern schon monatelang [30] Angst und Sorgen bereitet hatte, konnte ich nicht mehr retten, er starb drei Tage nach meiner Ankunft; das verzweifelte Jammern seiner Mutter tönte mir noch lange Zeit in den Ohren. Kleine, infolge leichter Malariaanfälle anämisch aussehende Patienten wurden mir in grosser Zahl gebracht; in den ersten 14 Tagen kamen sie regelmässig zu bestimmter Zeit, um ihre Chinindosis einzunehmen.
Obgleich die Rosen, die auf ihre Wangen zurückkehrten, einen etwas bräunlichen Ton hatten, so war doch das Schwinden der graugelben Hautfarbe, die wiederkehrende Fröhlichkeit und das gesündere Aussehen erfreulich zu beobachten.
Bei meinem ersten Besuch in Tandjong Karang hatte ich die Leute nur mit Mühe dazu bringen können, mir irgendwelche Gegenstände für meine ethnographische Sammlung abzutreten; jetzt brachte man mir bereits von selbst allerhand Sachen. Ich suchte aber nur einige besonders schöne Schnitzereien in Horn und Holz zu erlangen, da es mir nur darum zu tun war, meine beiden früheren Sammlungen zu vervollständigen.
Mein Hauptinteresse galt aber der Vorbereitung für die Expedition, d.h. dem Einkauf von Böten und Reis. Zwar waren, wie erwähnt, bereits vor langer Zeit 25 Böte bestellt worden, aber aus Ungewissheit und Sorglosigkeit hatten die Kajan die Arbeit noch nichtbeendet, obgleich sie dieses Mal zum Glück mehr zu Stande gebracht hatten, als vor meiner früheren Reise. Um den Leuten zu zeigen, dass es mir Ernst war, suchte ich auch nach alten brauchbaren Böten und zwar mit gutem Erfolge. Sobald der eine Kajan sah, dass sein Nachbar an seinem Boote arbeitete, machte auch er sich, um nicht im Rückstande zu bleiben, ans Werk; so half die Konkurrenz mehr als alle Worte. Der Konkurrenz verdankte ich es auch, dass ich die Böte zu den gleichen Preisen wie früher erhielt. Da ich für meine Vogel- oder mexikanischen Dollars, die in West-Borneo noch stets neben dem holländischen Gelde zirkulieren, in Singapore nur fl. 1.10 bezahlt hatte und die Chinesen sie den Dajak immer noch zu fl. 1.50 berechnen, kaufte ich sehr vorteilhaft ein.
Noch mehr Schwierigkeiten als das Herbeischaffen von Böten bereitete der Einkauf von Reis; ich hatte ihn in grosser Menge nötig und der Reisvorrat der Kajan war beinahe erschöpft.
Es lag mir daran, von dem Gelde, das für Reis ausgegeben werden musste, besonders viel den Kajan selbst zukommen zu lassen, daher [31] verabredete ich mit Akam Igau, dass er unter den Familien von Tandjong Karang 100 Dollar verteilen sollte, für die sie mir nach der Ernte Reis zu liefern hatten. Akam Igau behielt jedoch einen guten Teil des Geldes für sich und seine Leibeigenen und folgte bei der Verteilung so sehr seinen Sympathieen, dass einige, die auch etwas beitragen wollten, aber nicht in seiner Gunst standen, leer ausgingen. Als man mit Klagen zu mir kam, konnte ich mich durch einige Dollars Vorschuss einer weiteren Quantität Reis versichern. Leider war dieses Verfahren nicht auch in den höher gelegenen Niederlassungen anwendbar; die Ernteaussichten waren dort sehr schwach, und viele Männer beteiligten sich nur deshalb an der Expedition, um später mit dem verdienten Lohn für sich selbst Reis einkaufen zu können.
Kaum hatten die Chinesen und Malaien in Putus Sibau gemerkt, dass es etwas zu verdienen gab, als auch sie mir anboten, nach der Ernte, sobald die benachbarten Dajakstämme ihnen ihre Schuld in Reis bezahlt haben würden, einige Tausende von Kilo zu liefern.
Inzwischen kam auch wieder die Frage nach dem Termin des Aufbruchs zur Sprache. Bald nach der Abreise der Batang-Lupar kam Tigang nochmals zu mir und erklärte, dass seine Leute nicht vor der nächsten Reissaat aufbrechen wollten. Glücklicher Weise sind die Kajan Beweisgründen zugänglich, so dass mir Tigang auf meine Bemerkung, dass nach dem langen Warten eine ungünstige Reisezeit angebrochen sein würde, nichts anderes erwidern konnte, als dass die Beteiligung an der Expedition den Kajan viele Opfer kostete.
Nach langem Hin- und Herreden wurde beschlossen, dass die Männer nach dem Erntefest einige neue Grundstücke für die Anlage der Reisfelder suchen sollten und dass wir, wenn auch das Fällen des Waldes beendet sein werde, die Reise antreten sollten.
Akam Igau war zwar bei dieser Verhandlung nicht gegenwärtig gewesen, ich wusste aber doch, dass auch er für einen beschleunigten Aufbruch war und fragte ihn daher nicht um seine Meinung. Wir hatten zugleich überlegt, dass es unmöglich sein würde, für die 140 Mann, die sich am Zuge beteiligen sollten, auch den Proviant in den Böten gleich mitzuführen; es sollte daher ein Vorrat Reis und Salz so schnell und so weit als möglich den Kapuas aufwärts transportiert und dort bewacht werden, bis wir nachkamen und ihn über Land Weiterschaffen konnten.
Als die Zeit des Aufbruchs ungefähr bestimmt war, erkundigten [32] sich die verschiedenen Häuptlinge nach der Zahl der Dorfgenossen, die mitgehen konnten. Bald trat die alte Eifersucht zwischen Akam Igau und Tigang wieder zu Tage; letzterer erzählte triumphierend, dass er in Tandjong Kuda, seinem Dorf, 50 Mann aufstellen konnte, Tandjong Karang dagegen nur 30, Pagong nur 10 und die Ma Suling ebenfalls nur 10 Mann. Da Tigang der Schwiegersohn von Akam Lasa, dem Ma Suling Häuptling, war, der selbst nicht mitziehen konnte, so fügte sich der Anführer der Ma Suling mehr Tigang als Akam Igau.
Dieser wusste jedoch, dass ich ihn, den erprobten Führer, doch als Leiter des Ganzen behandeln würde und nahm sich die geringere Anzahl seiner Männer nicht zu Herzen.
Inzwischen war die Ernte vorüber und das Erntefest mit gewohnter Freude und Feierlichkeit begangen worden; ich hatte mich wiederum davon überzeugen können, in wie hohem Masse die ganze Bevölkerung von den für Europäer so unbegreiflichen und unsinnigen religiösen Zeremonien ergriffen wurde. So verging der ganze Monat Juni; da er sehr trocken, also zum Reisen äusserst geeignet gewesen und ich ausserdem überzeugt war, dass es noch lange dauern würde, bevor wir uns in Bewegung setzen konnten, machte mich das Warten sehr ungeduldig. Es war mir noch ein Trost, dass ich, nachdem ich erst 12 Böte mit einer grossen Menge Reis nach Putus Sibau hatte bringen lassen, einige Tage darauf eine zweite Truppe Kajan aus Tandjong Karang mit 2000 kg Reis und 14 Blechgefässen Salz den Kapuas aufwärts schicken konnte. Sie sollte versuchen, den Kapuas, Bungan und Bulit bis zu dem Ort hinaufzufahren, von wo aus der Landweg beginnen sollte; zwei bewaffnete Schutzsoldaten, von denen der eine, Korporal Suka, bereits auf einer Expedition am oberen Mĕlawie sich ausgezeichnet hatte, und ein Kajan, der die Punansprache kannte, wurden als genügende Bewachung im unbewohnten Berglande angesehen.
In Putus Sibau war es dem Kontrolleur inzwischen gelungen, die tüchtigsten der bewaffneten malaiischen Schutzsoldaten dazu zu bringen, uns zum Mahakam zu begleiten.
Zu unserem Erstaunen war auch ein malaiischer Häuptling, Raden Inu, sein Bruder, Abang Ganda, und ein Untergebener, Persat, aus dem Pinaugebiet am Mĕlawie nach Putus Sibau gekommen; diese hatten zufälliger Weise gehört, dass der Kontrolleur, den sie von früher her kannten, eine grosse Reise antreten sollte, und wollten sich [33] nun aus alter Anhänglichkeit an derselben beteiligen. Ein Zuwachs der Gesellschaft erschien uns anfangs zwar nicht sehr erwünscht, weil die Leute aber so viel Eifer an den Tag legten, beschlossen wir doch, sie mitzunehmen, und haben es später auf der Reise nicht zu bereuen gehabt.
Mein Aufenthalt am Mendalam war nun nicht mehr unbedingt notwendig und auch Akam Igau drang darauf, man solle sich zur Reise vorbereiten, damit man nach der Rückkehr der Gesandtschaften gleich aufbrechen könne; ich nahm daher zum Leidwesen meiner vielen Freunde und Bekannten von Tandjong Karang Abschied und kehrte nach Putus Sibau zurück.
Hier waren unterdessen aus Pontianak nachbestellte Güter angekommen, auch allerhand nützliche Dinge, wie Kisten für Lampen und andere tägliche Gebrauchsartikel, verfertigt und ein Vorrat Segeltuchs zugeschnitten, besäumt und mit Seilen versehen worden. Ferner hatte Demmeni auf seine photographische Ausrüstung viel Arbeit verwandt; ebenso Bier für eine topographische Aufnahme des Mahakamgebietes alles vorbereitet.
Um alles hatte sich der Kontrolleur Barth bekümmert, und ich sah zu meiner Befriedigung, dass er auch mit den Eingeborenen sehr gut umzugehen verstand. Da die allgemeine Verkehrssprache der Bahau, das Busang, ihm noch unbekannt war, hatte er sich alle Mühe gegeben, sie vor dem Beginn des Zuges zu erlernen.
Ich hatte bereits 1894 dem ältesten Sohne Akam Igaus, namens Ju, das Lesen und Schreiben mit lateinischen Buchstaben beigebracht; nun hatte er den Kontrolleur gebeten, auch seinen jüngeren Sohn, Adjang, im Lesen und Schreiben des Malaiischen, das er nur notdürftig sprach, zu unterrichten. Adjang war studienhalber nicht nur monatelang beim Kontrolleur in Putus Sibau geblieben, sondern zog auch mit uns zum Mahakam. Während unserer Reise durch den Urwald lernte er abends im Lager seine Lektionen ebenso eifrig wie in Putus Sibau, und am Mahakam angekommen las und schrieb er bereits befriedigend.
Da an der Ausrüstung nichts mehr zu tun übrig blieb und das für die Reise so günstige trockene Wetter anhielt, hätte mich die Ungeduld, endlich fortzukommen, sehr gequält, wenn die Bewohner der Niederlassungen ober- und unterhalb von Putus Sibau meine ärztliche Hilfe nicht ständig in Anspruch genommen und mich gezwungen hätten, mich um ihre Interessen zu bekümmern. [34]
Unterhalb Putus Sibau waren in den letzten Jahren Niederlassungen der Kantu Dajak entstanden. Dieser mit den Batang-Lupar verwandte Stamm aus dem Seengebiet war von diesen aus seinem alten Wohnplatz nach Südwesten vertrieben worden. Seit der Zeit hatten sich die Kantu bald hier bald da in sehr kleinen Niederlassungen weiter oben am Kapuas verteilt. Sie waren viel zugänglicher als die Kajan und interessierten mich auch durch ihre Kunstfertigkeit in der Herstellung von Webereien und Perlenarbeiten, so dass ich es lebhaft bedauerte, mich mit ihnen aus Zeitmangel nicht mehr abgeben zu können. Da sie mehr als die anderen Stämme geneigt waren, ihre seltenen Produkte um hohen Preis loszuschlagen, gelang es mir, in kurzer Zeit allerlei anzuschaffen, was mir von ihrer sehr hoch stehenden Webe- und Färbeindustrie eine Vorstellung geben konnte.
Auch mit den weiter oben wohnenden Taman Dajak kam ich dadurch in Berührung, dass sie mir ihre Kranken brachten und durch vorteilhaften Verkauf ihrer eigenartigen Kleidungsstücke von mir zu profitieren trachteten. Verschiedene Personen boten mir auch ihre aus bunten Perlen und Muscheln (Nassa callosa) verfertigten Jäckchen und Röckchen an, die sie früher bei ihren religiösen Festen trugen, jetzt aber, wegen der Ausbreitung des Islam in ihrem Stamm, nur selten mehr gebrauchten. Diese in schönen farbigen Mustern ausgeführten Kleidungsstücke sind in jeder Familie altes Erbgut, dessen Herstellung viel Zeit und Geld gekostet hat; unter gewöhnlichen Umständen sind sie auch beinahe nicht zu erlangen. In dieser Erwägung kaufte ich die schönsten dieser Kleidungsstücke und rettete sie so vor dem Untergang.
Die meisten kosteten 20 bis 26 Dollar; für ein besonders schönes Röckchen musste ich sogar 35 Dollar bezahlen. Die Besitzerin dieses Kleinods, eine Taman Frau am Mendalam namens Litong, war anfangs durchaus nicht geneigt, mir diesen ihren schönsten Schmuck abzutreten und ich hatte bereits alle Versuche, sie zu erweichen, aufgegeben, als ihr Vater, von einem Handelszuge aus Bunut zurückkehrend, den hohen Preis erfuhr, den ich geboten. So kam er eines schönen Tages nach Putus Sibau und übergab mir sehr erfreut für die 35 Dollar das Röckchen. Hätte ich geahnt, dass er ganz gegen den Wunsch seiner Tochter handelte und dass diese, wie ich später durch Kajan erfuhr, vor Kummer heisse Tränen vergossen, so hätte ich meine Sammellust vielleicht bezwungen. [35]
Auch die Taman Dajak, die am Sibau wohnten, der neben unserer Wohnung in den Kapuas strömte, trugen dazu bei, uns die erzwungene Ruhe nicht allzu fühlbar werden zu lassen. Wenige Tage nach meiner Rückkehr nach Putus Sibau holten vier dieser Sibau Dajak mich in einem Boot in ihre Niederlassung ab, wo einer der Ihren, der sich beim Holzhacken mit dem Schwerte das Bein verletzt hatte, heftig blutend darniederlag. Den Verwundeten nach Putus Sibau zu bringen schien unmöglich; so blieb mir nichts anderes übrig, als mit den nötigsten Hilfsmitteln und einem unserer Malaien zum Kranken zu reisen. Nach dreistündiger Fahrt in schwankendem Nachen erreichten wir das lange Haus, auf dessen grosser Galerie vor der Häuptlingswohnung eine Menge Männer, Frauen und Kinder um eine Gruppe herumhockte, die sich mit der Pflege des Kranken beschäftigte. Dieser schien ein kräftiger junger Mann zu sein; auf dem Rücken zwischen seinen jammernden Angehörigen liegend zeigte er bereits eine verräterische graubraune Leichenfarbe, auch hatte er schon das Bewusstsein verloren und sein Puls war nicht mehr fühlbar. Sein rechter Fuss war an der Innenseite, unterhalb des Knöchels, verwundet und mit alten Lappen voll geronnenen Blutes verbunden. Fortwährend tröpfelte noch Blut aus dem Verbande, was hauptsächlich wohl einem zweiten Verbande zugeschrieben werden musste, den man um die Wade angebracht hatte und der, gleichwie auch die horizontale Lage des Beines, einen Abfluss des venösen Blutes verhinderte. Während ich den zweiten Verband abnehmen und das Bein hoch halten liess, erzählte man mir, wie sich der junge Mann die Wunde beigebracht hatte. Die Abwesenheit des Pulsschlags bewies, dass die Blutung auch während des Transportes nach Hause sehr heftig gewesen sein musste. Man hatte, um die Blutung zu stillen, das gebräuchliche Mittel, gekaute Sirihblätter mit Kalk, auf die Wunde gelegt, welch letzterer adstringierend wirkt und durch das starke Anpressen mittelst der Blätter zugleich als Tampon dient. Da der Patient augenscheinlich nicht mehr viel Blut zu verlieren hatte und seine Herztätigkeit sehr schwach war, musste ich einen neuen Bluterguss bei der Untersuchung zu vermeiden trachten und hielt daher den Kautschukschlauch am Schenkel bereit. Zum grossen Erstaunen der Taman kam, da ich das Bein hoch halten liess, beim Wegnehmen der schmutzigen Lappen und Sirihballen kein Tropfen Blut mehr aus der Wunde; doch war die bis tief hinter den maleolus internus reichende Wunde durch die falsche Behandlung bereits so [36] infiziert, dass an einen aseptischen Heilverlauf nicht zu denken war.
Vor allem musste der Patient wieder zu Kräften kommen, dann konnte man ihn, zwecks einer rationellen Behandlung, nach Putus Sibau bringen lassen. Ich desinfizierte daher die Wunde so weit als möglich, bestreute sie mit Jodoform, tamponierte sie gründlich und empfahl den Taman, das Bein ständig hoch liegen zu lassen und gut für den Patienten zu sorgen.
Dank seiner kräftigen Konstitution war der Mann nach zwei Tagen bereits so weit, dass seine Familie ihn mir zur weiteren Behandlung nach Putus Sibau bringen konnte. Nachdem ich schon gehofft, dass keine Nachblutung den Heilprozess stören würde, rief man mich doch sechs Tage darauf nachts, weil der Verband ganz mit Blut durchtränkt war. Es blieb nun nichts anderes übrig, als die Galerie unserer Kaserne zum Operationszimmer zu machen und den gewandtesten meiner Gehilfen zum Assistenten zu promovieren. Zum Glück gelang es mir bald, die Blutungsquelle zu entdecken. Ich hatte bereits vorher versucht, die Wunde von dem nekrotischen Gewebe zu reinigen, aber die Infektion hatte sich bereits zu sehr verbreitet. Sobald die Schlinge um den Schenkel etwas gelockert wurde, quoll in rhythmischen Stössen eine Blutmenge, augenscheinlich aus der arteria tibialis postica, hervor. Beim Schein einiger Lampen entfernte ich so lange nekrotisches Gewebe, bis die Arterie bloss lag; es zeigte sich, dass diese auf die ungünstigste Weise beschädigt war, nämlich halb durchgeschnitten, so dass die Enden sich nicht zurückziehen konnten und wegen der Retraktion der Ränder ständig offen gehalten wurden. Mit einigen Bedenken, wegen der stark entzündeten und infizierten Umgebung, entschloss ich mich doch, das Gefäss zu durchschneiden und die beiden Enden zu unterbinden. Glücklicher Weise schlossen sich die Gefässe und eine Blutung trat nicht mehr ein, trotzdem sich die Entzündung über den ganzen Unterschenkel verbreitete. Einige Einschnitte bis in das subkutane Gewebe, zur Entfernung des Eiters, und eine Ausspülung mit Borwasser übten eine gute Wirkung. Infolge unserer sorgsamen Pflege kam der Taman bald wieder zu Kräften, und nachdem der Kontrolleur von Putus Sibau nach unserer Abreise noch einige Zeit für ihn gesorgt hatte, konnte er wieder nach Hause gebracht werden, wo er bald völlig genas.
Der langdauernde Aufenthalt in Putus Sibau hatte noch den grossen Vorteil, dass wir uns über die aus Java mitgenommenen und uns [37] grösstenteils fremden Leute ein Urteil bilden konnten. Bereits als ich sie in Dienst nahm, hatte ich dafür gesorgt, dass jeder von ihnen einen Kameraden oder Verwandten bei sich hatte, damit er sich nicht einsam fühlen sollte. Da eine gute Stimmung unter den Teilnehmern einer Expedition deren guten Erfolg wesentlich beeinflusst, freute es mich sehr, zu bemerken, dass Zwistigkeiten unter unseren Leuten wenig vorkamen. Nur der zweite Jäger, Djumat, erregte zu meiner Verwunderung bei seinen mohammedanischen Glaubensgenossen durch seine ständigen religiösen Übungen Anstoss. Wie ich bei meiner Rückkehr von den Kajan hörte, war er, ein europäisches Halbblut, zum Islam übergetreten. Obgleich beinahe mein ganzes Geleite mohammedanisch war, hatte ich doch von Beten und von anderen religiösen Verrichtungen nie etwas gemerkt; nur Djumat war hierin sehr eifrig und ärgerte dadurch die anderen so sehr, dass einer der Schutzsoldaten zuletzt auf seiner Violine zu spielen begann, sobald Djumat seine Gebete anfing. Wahrscheinlich geschah dies nicht wegen der Andachtsübungen selbst, dazu waren meine Javaner und Malaien zu friedliebend, sondern weil sie ihn besser kannten als ich. Bald hörte ich auch einige Bemerkungen über Djumat, der sich viel mit den Chinesen auf dem Markte abgab, und eines Morgens fand ich auf der Galerie einen zusammengefalteten chinesischen Brief, den ich aber nicht lesen konnte. Etwas Besonderes vermutend, wollte ich meine farbigen Begleiter doch nicht in die Angelegenheit einweihen, und da auch unsere Europäer das Schreiben nicht lesen konnten, liess ich es unbeachtet. Der Schreiber schien aber die Sache ernst zu nehmen; denn zwei Tage darauf erhielt ich ein anderes Briefchen, diesmal malaiisch geschrieben. Der Inhalt des Briefes war der, dass Djumat den chinesischen Frauen auf dem pasar auf brutale Weise nachstellte und dass ein derartiges Betragen meines Personals mir am Mahakam gefährlich werden konnte. Für mich war diese Tatsache zu wichtig, um ihr nicht Rechnung zu tragen.
Mit dem Kontrolleur Barth und dessen Kollegen von Putus Sibau kam ich überein, dass wir gleich die Ankunft des kleinen Dampfers “de Punan”, der uns die letzte Post und noch einige Güter bringen sollte, benützen mussten, um uns dieses lästigen Reisegenossen zu entledigen. Sobald denn auch der Dampfer angekommen war, erhielt Djumat zu seiner Verwunderung den Befehl, sich bereit zu halten, um sich zwei Stunden später nach Java einzuschiffen. Diese plötzliche Entlassung musste ihn umsomehr in Erstaunen versetzen als er, [38] wie auch seine Kameraden, bereits in Java 75 fl. Vorschuss von seinem Lohn erhalten hatte. Sein Betragen, das in seiner javanischen Umgebung nicht viel Anstoss erregte, war jedoch in unserer künftigen Lage, mitten unter den eingeborenen Stämmen, viel zu gefährlich, als dass ich die übrigen Männer nicht auf den Ernst eines solchen Vergehens hätte aufmerksam machen müssen. Bereits seit langem wusste ich, dass eine grosser Teil der Morde und Unglücksfälle von Malaien unter den Dajak hauptsächlich daher kam, dass die malaiischen Männer darauf ausgingen, die dajakischen Frauen zu verführen. Obgleich es nämlich bei den Bahau, nach längerem Aufenthalt in ihrer Mitte, wohl gestattet ist, mit einem der jungen Mädchen, die in ihrem Tun und Lassen fast gänzlich unabhängig sind, ein Verhältnis anzuknüpfen, geschieht es doch häufig, dass die Malaien, mit Hilfe von Geschenken und anderen Mitteln, mit der ersten besten Frau, die sich hierfür empfänglich zeigt, einen intimen Verkehr anzubahnen versuchen. Da aber die eheliche Treue bei diesen Stämmen sehr streng gehalten wird, laden sich die Malaien durch ihr leichtsinniges Betragen die Rache des beleidigten Gatten auf den Hals. Ich suchte daher, wenn wir irgendwo bei den Bahau längere Zeit bleiben mussten, tun ihr Vertrauen zu gewinnen, alles daranzusetzen, um ein derartiges Betragen zu verhindern. So hatte ich von Anfang an getrachtet, etwas ältere Männer für unseren Zug anzuwerben und habe auch später durch leichtsinniges Betragen meiner Leute nicht viel Unannehmlichkeiten gehabt.
Nach meiner Abreise von Tandjong Karang nahmen die Kajan noch öfters jede Gelegenheit wahr, um uns in Putus Sibau zu besuchen, teils aus persönlicher Anhänglichkeit, teils um noch einiges vorteilhaft zu verkaufen, teils um noch allerhand Neues und Schönes von unserer Ausrüstung zu sehen.
Selten vergingen einige Tage, ohne dass ich Besuch bekam, und jetzt waren es nicht nur, wie in früherer Zeit, erwachsene Männer und einzelne Frauen, die sich aus dem Mendalamgebiet herauswagten, sondern es kamen auch viele Knaben und Mädchen und sahen sich zum ersten Mal in ihrem Leben Putus Sibau mit seinen vielen Malaien, Chinesen und seinem Markt an. Auch viele 18–20 jährige Frauen erklärten, noch nie hier gewesen zu sein; zum Übernachten konnten sie sich aber nicht entschliessen, sie sorgten vielmehr alle, vor Einbruch der Nacht aus dieser fremden Umgebung wieder fortzukommen. [39]
Besonders meine Freundin Usun, die älteste und oberste Priesterin von Tandjong Karang, benützte jede Gelegenheit, um nach Putus Sibau zu kommen, und es zeigte sich, dass aufrichtiges Interesse sie dazu trieb. Bereits bei meinen Besuchen 1894 und 1896 hatte sie mir allerhand, nach ihren Begriffen schöne Geschenke gemacht, auch war sie die einzige Frau ihres Stammes gewesen, die es gewagt hatte, sich photographieren zu lassen. Auch jetzt wieder gab sie uns einen starken Beweis ihres Vertrauens, indem sie einmal mit einer Gesellschaft vom Mendalam ankam, mehrere Tage allein bei uns blieb und erst mit einer zweiten Gesellschaft nach Hause zurückkehrte. Usun äusserte oft ihre Besorgnis aller Gefahren wegen, die uns auf den weiten Reisen bedrohten, besonders beunruhigte sie mein Plan, in das ferne Gebiet des Apu Kajan, das Stammland ihrer Vorfahren, einzudringen, ein Land, das in ihrer priesterlichen Wissenschaft einen mythischen Charakter angenommen hatte und von dem sie wusste, dass es von den so gefürchteten Kĕnjastämmen bewohnt wurde.
Wenige Tage vor unserer Abreise kam Usun mit einigen Männern und Frauen von Tandjong Karang zu uns herunter und bat um die Erlaubnis, bis zu unserer Abfahrt bei uns bleiben zu dürfen. Zugleich gab sie zu verstehen, dass sie, da es nun doch zum Scheiden kam, beschlossen hatte, ihren kostbarsten, oder besser gesagt, ihren heiligsten Besitz zwischen ihrem Enkel und mir zu teilen, damit diese geweihten Gegenstände mich vor allen Gefahren, denen ich entgegen ging, beschützten. Sie übergab mir ein sehr altes Schwert, das, nach der Aussage meiner 70 jährigen Freundin, bereits in ihrer Jugend sehr alt gewesen war, ferner Kieselsteine von aussergewöhnlicher Form in einem kleinen Säckchen und ein steinernes Fläschchen mit etwas Kokosnussöl. In diesen ernsten Abschiedstagen wurde Usun gestattet, ihre Schlafmatte in der kleinen Kammer auszubreiten, in welcher der Kontrolleur Barth auf einer Seite und ich auf der anderen unsere Moskitonetze aufgehängt hatten. Beim Erwachen am anderen Morgen sah ich, dass Usun bereits alle ihre Vorbereitungen getroffen hatte

Usun, Oberpriesterin in Tandjong Karang.
an der Stelle, wo sie geschlafen hatte, lagen auf einer kleinen Matte neben einander die für mich bestimmten Schätze, ausserdem das Geldstück und die Perlen, die ich ihr als usút gegeben hatte, d.h. damit diese Dinge in gleicher Weise in ihre Hände übergehen könnten, wie ihre Talismane in die meinen und der Geist, der in letzteren steckte, nicht erzürnt würde. Darauf sprach sie, vor der Matte hockend, die [40] Geister an, die in den Gegenständen hausten und trug ihnen auf, mich gegen alle Angriffe böser Geister zu schützen, mich vor Anstrengungen sowie vor einem Fall in den Bergen oder Tälern zu behüten und zu verhindern, dass meine Seele sich von mir entfernte. Weiter berichtete sie den Geistern der geweihten Gegenstände, dass ich die Absicht habe, sie zum Mahakam und weiter bis zum Apu Kajan zu bringen. Auch erzählte sie ihnen, dass ich ihr das Geldstück und die Perlen gegeben, damit sie an Stelle der alten Gegenstände in ihren Händen zurückblieben.
Ich schenkte Usun zuletzt noch, da meine Vorräte es zu erlauben schienen, einen Satz schöner Armbänder aus Elfenbein. Bis zum letzten Augenblick blieb Usun bei uns und, während ich des Morgens mit dem Verteilen von Menschen und Gütern in die Böte viel zu tun hatte, strengte sie sich an, mir mit ihren alten Beinen wie mein Schatten zu folgen und hörte nicht auf, mir unter heissen Tränen Segenswünsche auf die Reise mitzugeben.
Mit Akam Igau hatte ich abgemacht, dass er seine Leute dazu bringen sollte, gleich nach der Rückkehr der vorausgeschickten Gesandtschaften die wahrsagenden Vögel zu befragen. Am 24. Juli kehrten die Gesandtschaften endlich gemeinsam zurück; ihre Reisen waren ohne Unfall verlaufen, nur hatten sie, wegen des sehr hohen Wasserstandes, lange gedauert; auch war es ihnen nicht geglückt, den Bulit aufwärts bis zum Landweg zu gelangen; sie hatten aber den Reis an der Mündung des Bulit unter dem Schutze von Korporal Suka und zwei anderen zurückgelassen.
Den folgenden Tag kam Tigang Aging aus Tandjong Kuda mit dem Bericht, dass in seinem Dorf für sechs Tage “me̥lo njaho” ein “Stillsitzen wegen der Vorzeichen” angesagt war, weil man ein Reh über ein eben bearbeitetes Feld hatte laufen sehen (ein böses Omen) und dass man erst nach dieser Ruhezeit, unter Anführung des Ma-Suling namens Obet Lata, zur Beobachtung der Vorzeichen aufbrechen würde.
Nach Ablauf dieser sechs Tage kam Tigang Aging abermals nach Putus Sibau, diesmal mit dem Vorschlag, wiederum einen Teil unseres Gepäckes unter Aufsicht der zwei alten Häuptlinge Sĕniang und Akam Lasa, je mit zehn Mann; vorauszuschicken. Diese Leute waren nämlich nicht im stande, den Zug mitzumachen, wollten aber, wie es schien, auch noch etwas verdienen. Nachdem ich diesem Vorschlage in der [41] Überlegung zugestimmt hatte, dass wir dadurch später um so schneller flussaufwärts fahren konnten und ich, um nur endlich fortzukommen, möglichst viel Freunde gewinnen musste, verpflichtete sich wiederum Tigang, den Obet Lata bereits am folgenden Tage auf die Vogelschau auszusenden. Auf diese Weise suchte sich Tigang als Herrn der Mendalambewohner aufzuspielen, obwohl er sehr gut wusste, dass Akam Igau von mir als Führer angesehen wurde. Mein Hauptziel war jedoch die Abreise, der ich mit Ungeduld entgegensah, da die Trockenzeit bereits zwei Monate gedauert hatte und jeder Tag uns Regen und ungünstig hohen Wasserstand bringen konnte; daher fand ich alles gut, was uns einen Schritt weiter brachte. Es verging aber ein Tag nach dem andern, ohne dass wir etwas anderes hörten, als dass die Vögel noch immer nicht alle erforderlichen Zeichen gegeben hatten, bis endlich am 16. August Akam Igau seinen Sohn Adjang abholte, um gemeinschaftlich mit den übrigen Teilnehmern an der Expedition ein me̥lo njaho zu feiern, da die Vögel jetzt genügende Auskunft gegeben hatten. Zwei Tage darauf sollte die ganze Gesellschaft bei uns eintreffen.
Um Akam Igaus Oberherrschaft wieder einzuschränken, kam auch Obet Lata im Auftrage Tigangs am folgenden Tage und meldete, dass man aus Tandjong Kuda aufbrechen werde, dass man sich aber, wie auch auf der vorigen Reise, noch einen Tag an der Mündung des Mendalam aufhalten wolle, um noch einen besonderen Vogel zu befragen.
Am 18. August schlug endlich unsere Befreiungsstunde; denn bereits des Morgens kam ein bemanntes Boot nach dem anderen hinter der Flussbiegung zum Vorschein. Auch Sĕniang und Akam Lasa brachten ihre eigenen Böte und Leute mit; gegen ihren Vorschlag, bereits am selben Tage weiterzufahren, hatte ich nichts einzuwenden. Ich gab ihnen eine gute Ladung Reis und Salz mit und so fuhren sie bereits mittags den Kapuas aufwärts.
Die Leute, welche die Mahakamreise selbst mitmachen sollten, übernachteten, der Übereinkunft gemäss, unter Akam Igaus und Tigangs Aufsicht an der Mendalam Mündung, trafen aber schon früh am folgenden Morgen vor unserer Wohnung ein.
Im Ganzen erschienen aus den verschiedenen Niederlassungen am Mendalam ungefähr 110 Mann, die sich in so viel Gruppen verteilten, als die Zahl der Dörfer und Stämme, denen sie angehörten, betrug. [42] Die Kajan aus Tandjong Karang und Tandjong Kuda waren die zahlreichsten, ihnen folgten die Ma-Suling und Uma-Pagong, und schliesslich noch Glieder der Bukat und Punan, der meist nur zeitweise am Mendalam lebenden Nomadenstämme. Jede Gruppe hatte einen eigenen Häuptling oder angesehenen Mann zum Anführer; ich betrachtete aber, wie bereits gesagt, Akam Igau aus Tandjong Karang als Oberhaupt aller, da er als alter weitgereister Mann am meisten Einfluss besass, während sein viel jüngerer Nebenbuhler Tigang Aging aus Tandjong Kuda nur durch seine hohe Geburt sich Ansehen zu verschaffen trachtete. Ihm völlig ergeben war nur Obet Lata, der Anführer der Ma-Suling, ein alter unbedeutender Mann, der Tigang als den Schwiegersohn des Ma-Sulinghäuptlings Akam Lasa fürchtete.
Die Männer von Uma-Pagong standen, wie auch auf der vorigen Reise, unter Anführung von Jung, einem Adoptivsohn des weiblichen Häuptlings Bulan. Es war dies eine junge energische Persönlichkeit, die uns auf der Reise viele Dienste erwies.
Die Gruppe der Punan und Bukat bestand aus 12 Männern sehr verschiedener Abkunft, auch befanden sich unter ihnen einige Leute eines anderen Jägerstammes, der Bĕkĕtan. Ludang, der Punanhäuptling, konnte an der Expedition nicht teilnehmen, liess sich aber durch seinen jungen Sohn Kwing vertreten, dem ein schwächlicher, aber intelligenter Mann namens Tĕtuhè zur Seite stand.
Um keine Zeit zu verlieren, hatten wir bereits am Tage zuvor alles Gepäck so geordnet, dass die Ladung auf die schnellste Weise von statten gehen konnte. Nun galt es, Menschen und Güter auf die praktischste Weise in die 25 Böte zu verteilen, was insofern seine Schwierigkeit hatte, als die Leute sich bereits in Gruppen verteilt und in den Böten da Platz genommen hatten, wo es ihnen gerade am besten gefiel; dadurch war das eine Boot überladen, das andere beinahe leer; ausserdem nahm jedes Boot so wenig als möglich Gepäck mit, so dass ich das Einladen genau regeln und überwachen musste. Das, erforderte alles viel Hin- und Herreden, Ermahnungen und bisweilen ernstes Auftreten und dauerte bis 10 Uhr morgens. Die ganze Zeit über hatte ich die alte Usun an meinen Fersen. Endlich war alles geregelt, jeder Mann an seinem Platze und wir nahmen vom Kontrolleur Abschied, der uns mit seinen zwei kleinen Kanonen noch eine gute Reise nachdonnerte. [43]
Kapitel III.
Allgemeines über die Insel Borneo—Die Gebirge von Mittel-Borneo—Die Wasserscheiden zwischen dem Mahakam und dem Batang-Rèdjang, Kajan und Barito—Geologie des oberen Mahakamgebietes—Salzquellen—Geologischer Charakter des Apu Kajan—Äussere Gestaltung Mittel-Borneos—Buschvegetation—Meteorologische Verhältnisse.—Bewohner der Insel—Malaien und Dajak—Sesshafte Stämme: Bahau und Kĕnja—Nomadenstämme: Punan, Bukat und Bĕkĕtan—Herkunft der Bahau und Kĕnja—Legende vom Wasser und Feuer-Auswanderungen und Vermischungen der Stämme.—Organisation eines Bahau- bezw. eines Kajan-Stammes—Geschichte der Mendalam Kajan—Glieder eines Stammes: Häuptlinge, Freie und Sklaven-Gegenseitige Verpflichtungen der Stammesglieder—Abstammung des Häuptlings Akam Igau.
Die Insel Borneo ist mit ihrer Oberfläche von 734.000 □ km nach Neu-Guinea die grösste der Welt; sie ist mehr als zweieinhalb Mal so gross als England, Schottland und Irland zusammen. Betrachtet man eine in grossem Massstab gehaltene Karte von Borneo, so bemerkt man, dass vom Zentrum der Insel aus mächtige Ströme nach allen Richtungen hin den Küsten zuströmen; sie durchziehen in ihrem Unterlauf weite Ebenen, die sie mit der Zeit selbst gebildet haben. Die Entstehung so grosser Flüsse und Ebenen ist nur da möglich, wo starke Regenfälle herrschen. Die durchschnittliche jährliche Regenmenge in Borneo ist in der Tat eine sehr bedeutende, sie kann bis über 5 m betragen, doch machen sich auf dem ausgedehnten Gebiet grosse lokale Abweichungen bemerkbar. Wegen ihrer aequatorialen Lage bestreichen die Passatwinde die Insel Borneo lange nicht so regelmässig wie Java, daher ist der Regenfall dort gleichmässiger auf das ganze Jahr verteilt.
In scharfem Gegensatz zu den Nachbarinseln hat man auf Borneo bis jetzt keine tätigen Vulkane gefunden. Zwar entdeckte Prof. Molengraaff im Jahre 1894 südlich vom oberen Kapuas ein ausgedehntes vulkanisches Gebiet, das hauptsächlich aus riesigen Tufflagern besteht, Spuren einer Eruption jüngeren Datums fand er jedoch nicht. Die südlichen Nebenflüsse des oberen Kapuas haben daher auch Zeit [44] gehabt, diese Tufflager durch Erosion in ein höchst eigenartiges Bergland umzuformen, dessen eigentümliche terrassenförmige Erhebungen bisweilen mehr als 1000 m Höhe erreichen. Dem 1825 verunglückten Forschungsreisenden Georg Müller zu Ehren nannte Prof. Molengraaff dieses Gebirge: Müller-Gebirge. Die zahlreichen Petrefakten, welche diese Tufflager enthalten, deuten darauf hin, dass das Müller-Gebirge hauptsächlich in der Tertiärzeit gebildet sein muss.
An der Ostküste, gegenüber der Insel Miang und auf dieser selbst, liegen 100 m hohe Hügel, die in späteren geologischen Perioden durch negative Strandverschiebung entstanden sein müssen; denn man findet auf ihnen die Riesenmuschel (Tridacna). Das ganze flache Gebiet von Kutei wird durch diese auf die Ostküste beschränkte Hügelreihe gegen das Meer hin abgegrenzt. Die vielen Seeen, welche die grosse eingeschlossene Ebene aufweist, lassen vermuten, dass sie früher ein Becken gewesen, das durch den Mahakam und seine Nebenflüsse allmählich angefüllt worden ist. Bereits seit langer Zeit werden in den Hügeln an der Mahakammündung Steinkohlenlager ausgebeutet; vor einigen Jahren sind dort auch reiche Petroleumquellen angebohrt worden.
Das Kettengebirge, welches sich von dem an der Westküste gelegenen Tandjong Dato an quer durch die Insel nach Osten, wahrscheinlich bis zum Kap Mangkalihat, erstreckt und die Wasserscheide zwischen zahlreichen Flüssen bildet, besteht grösstenteils aus stark gefalteten Schieferschichten.
Nach den Untersuchungen von Prof. Molengraaff ist dieses Gebirge, nördlich von dem grossen Seeengebiet der Batang-Lupar, aus stark abgetragenen Schiefern zusammengesetzt und erhebt es sich nur ungefähr 200 m über den Meeresspiegel. An der Südseite traf er zum ersten Mal die für Mittel-Borneo charakteristische Danau-Formation1, deren obere, aus Kieselschiefer, Jaspis und Hornstein bestehende Schichten Radiolarien enthalten und daher Tiefseeablagerungen sein müssen.
Nördlich vom oberen Kapuas und Mahakam, nach Osten zu, steigt dieses Gebirge immer mehr an, behält jedoch stets denselben Charakter bei. Vom Bukit Tjondong aus konnte Molengraaff das Gebirge, das er Ober-Kapuri-Kettengebirge nannte, übersehen; es erwies sich auch später, vom Liang Tibab aus gesehen, als typisches Kettengebirge, [45] das ganz aus zahlreichen, scharfen, in gleichen Entfernungen neben einander sich erhebenden Rücken zu bestehen schien. Wie gesagt, steigt das Gebirge in östlicher Richtung an: der Lawit ist bereits 1767 m hoch, die höchsten Gipfel bei den Kapuas-Quellen erreichen 1900 m und diese Höhe bleibt ungefähr konstant bis zum oberen Mahakam, wo das Kettengebirge vom Batu Tibang durchbrochen wird. Dem Geröll seiner Flüsse nach zu urteilen, scheint dieser letztere Teil des Gebirges eruptiven Ursprungs zu sein.
Östlich vom Batu Tibang setzt sich das Kettengebirge, das jetzt den Namen Bawui Gebirge trägt, weiter fort; in westlicher Richtung, bis zum Batu Okang, dem grossen Bergmassiv, auf dem der Boh entspringt, verschmälert es sich und bildet dort die Wasserscheide zwischen Kajan und Mahakam. Östlich vom Batu Okang ist das Kettengebirge noch unerforscht; künftige Untersuchungen werden aber voraussichtlich ergeben, dass es sich ununterbrochen bis zum Kap Mangkalihat fortsetzt.
Im Flussbett des Sĕlirong und Sĕliku, der beiden Quellflüsse des Mahakam, beobachtete ich im Hangenden der fast senkrecht aufgerichteten, alten Schiefer beinahe horizontal gelagerte Sandsteinschichten, die im übrigen Teil des Gebirges bereits weggespült sein müssen. Auch dieser mittlere Teil des Kettengebirges ist also nach seinem Entstehen untergetaucht gewesen. Am oberen Sĕliku befanden sich diese Sandsteinschichten am Fuss des Lasan Tujan in 720 in Höhe, am Sĕlirong, etwas oberhalb des Landweges nach Sĕrawak, in 650 m Höhe. Der Sandstein, aus dem die 5–10 cm dicken Schichten bestanden, war an beiden Orten grobkörnig. Die Schichten fallen unter 26º nach Norden ein und das Streichen ist 236º.
Die Danauformation, die Molengraaff im Seeengebiet der Batang-Lupar, im Bungan und Bulit, an der Südseite des Kettengebirges antraf, stellte ich auch am oberen Mahakam, unterhalb der Mündung des Sikè und im Boh in der Nähe der Ogamündung fest.
Weitere Hornsteinschichten beobachtete ich im Mahakam und zwar in seiner westlichen Reihe von Wasserfällen bei Long Tĕpai, wo beim Fall des Lobang Kubang die Lagen eine Dicke von 3 dm bis 1 m erreichen. Der hier weisse Hornstein wird von den Sandsteinschichten des grossen Gebirgszuges überlagert, der die Wasserscheide zwischen dem oberen Mahakam und oberen Barito bildet. In seinem von West nach Ost sich erstreckenden Teil heisst dieser Gebirgszug Batu Lĕsong, seine südliche Fortsetzung heisst bis zur Quelle des Rata: Batu Ajo. [46]
Dieses ganze Gebirge erscheint als ein schmaler, sehr steiler, oben abgeflachter Rücken. Seine grobkörnigen Sandsteinschichten erreichen eine Mächtigkeit von 5–50 m und haben eine Neigung von 8º nach Süden.

Die Salzquelle Sĕpan Dingei mit Brunnenvorrichtung.
Der 1800 m hohe Batu Lĕsong wird seiner regelmässigen Form wegen von den Eingeborenen mit einem Reisblock, le̥song, verglichen. Bei einer Besteigung des Batu Lĕsong im Quellgebiet des Blúu konstatierte ich, dass er sich mit senkrechten 4–500 m hohen Wänden aus den Flussbetten, welche das Wasser nach Norden in den Mahakam, nach Süden in den Busan und Bĕlatung wegführen, erhebt. Der Hauptrücken ist nur 1–2 km breit und sendet nach Norden eine Reihe von Querrücken, welche die Täler der Nebenflüsse des Mahakam von einander scheiden. Zum Mahakam hin fallen diese Querrücken oft sehr steil ab, zwischen dem Blúu und Danum Parei mit einer Höhe von 1000 m; dazu sind sie oft so schmal, dass sie kaum für einen Pfad Platz lassen. Eine starke Abtragung wird durch die üppige Vegetation verhindert. Nach Osten hin nimmt die Höhe des Batu Lĕsong immer mehr ab; seine Fortsetzung, Batu Ajo, ist nur noch 1000–1200 m hoch. Das Gebirge, welches den gleichen Charakter stets beibehält, kehrt sich mit einer scharfen Wendung nach Süden; es scheint das vulkanische Müller-Gebirge nach Osten zu begrenzen.
Die nördlichen, zwischen dem Sumwé und Mĕrásè gelegenen Nebenflüsse des Mahakam, sowie der betreffende Teil des Hauptstromes selbst, haben sich ebenfalls ihre Betten aus beinahe horizontalen Sandsteinlagern erodieren müssen. Diese gehören dem ursprünglich augenscheinlich mit dem Batu Lĕsong zusammenhängenden Ong Dia (ong = Gebirge) der Bahau an. Der Ong Dia ist nicht über 900 m hoch, läuft in Form eines schmalen Rückens dem Batu Lĕsong parallel, fällt dem Mahakam zu steil ab und dehnt sich in nördlicher Richtung bis zu dem hoch aufragenden Kalksteingebirge Batu Matjan aus. An die steilen Wände des Ong Dia lehnen sich auf der Mahakam Seite eine Reihe von Hügeln in Gestalt von 200–500 m hohen steilen Kalkbergen, welche die Erosion des Sandsteins aufzuhalten scheinen.
Das eben erwähnte nördliche Kalksteingebirge liegt zwischen dem Sĕrata und oberen Tĕpai und erhebt sich mit seinen eigentümlichen Formen bis zu einer Höhe von 1900 m; es giebt dem Serata, Sumwe, Mĕrásè, Tĕpai, Glat und anderen Flüssen den Ursprung, während südlich von ihm der obere Mahakam einen mächtigen Bogen nach [47] Westen macht, bevor er den Weg nach Süden einschlägt. Die höchsten Berge dieser Kalkformation heissen: Batu Matjan, Batu Brok und Batu Ulu.
Diesem grossen Kalkgebirge schliesst sich eine Reihe schmaler, sehr steiler, freier Kalkberge von 300–900 m Höhe an, welche ich längs den Ufern des Tjehan unterhalb des Pakatè und weiter östlich längs dem Mahakam bis an den Blúu entdeckte. Der Kalk hat eine dichte Struktur und findet sich teils massig, teils in Schichten bis zu 40 m Mächtigkeit. Diese fallen am Mahakam sowohl als am Tjĕhan ungefähr gleich unter 44° nach Süden und das Streichen ist 242°, also im wesentlichen gleich dem der oben erwähnten Sandsteinschichten.
Zu den höchsten Erhebungen dieser Kalkberge gehört der Liang Karing an der Mündung des Tjĕhan, der Liang Nanja im Flusstal selbst und der Batu Baung am Mahakam.
In den zahlreichen Höhlen dieser Berge bewahren die Eingeborenen ihre Kostbarkeiten auf und setzen sie ihre Toten bei. Ähnliche grosse Felsenhöhlen sollen auch im grossen Kalksteingebirge z.B. im Batu Matjan, Batu Brok u.a. vorkommen.
Ausser den eben besprochenen beiden Gebirgsgliedern kommt im Gebiet des oberen Mahakam noch eine Reihe vulkanischer Andesitkegel vor, die sich im Tal des Blúu von Süden nach Norden hinzieht. Der nördlichste dieser Kegel ist der Batu Mili 840 m, ihm gegenüber an der Mündung des Blúu liegt der Batu Kasian 650 m, weiter südlich der Moang 900 m. Am Fuss dieser Hügel kommen Quellen vor, die gleichzeitig Salz und Kohlensäure liefern; die Bevölkerung benutzt sie zur Salzgewinnung. Bei einer dieser Quellen, der Span Dingei am Fuss des Moang, glückte es mir im Jahre 1896 mit Kwing Irang, dem Häuptling der Mahakam Kajan, eine alte Vorrichtung zur Salzgewinnung auszugraben. Als auf Anweisung von Kwing Irang neben einer Reihe Felsen von glasigem Eruptivgestein die Erde fortgeschafft wurde, kam der Rand eines ausgehöhlten Baumstammes von 6 dm Durchmesser zum Vorschein, der senkrecht in den Boden gerammt war. Etwas tiefer bemerkten wir einen zweiten hohlen Baumstamm, der in den ersten hineingesteckt war und aus dem das Wasser kräftig hervorsprudelte. Die Baumstämme dienten dazu, das Wasser vor Verunreinigung durch hineinfallende Erde zu schützen. Gegenwärtig wird die Quelle ihres geringen Salzgehaltes wegen nicht mehr ausgebeutet, in früherer Zeit jedoch [48] wurde das Salzwasser aufgefangen und in grossen Töpfen verdampft.

Landschaft von Mittel-Borneo (oberer Mahakam).
Trotz der Einfuhr von Salz von der Küste her benutzten die Ma-Suling am Mĕrásè noch bis vor kurzem eine andere, salzhaltigere Quelle, Sĕpan Daja, am Fuss des Ong Dia zur Salzgewinnung. Eine Analyse des mitgenommenen Wassers ergab folgende Bestandteile
per Liter Wasser (neutral).
| Kieselsäure | (Si O2) | 0.068 g |
| Chlor | (Cl) | 3.592 g |
| Kalk. | (Ca O) | 0.202 g |
| Magnesia. | (Mg O) | 0.098 g |
| Kali | (K2 O) | 0.095 g |
| Natron | (Na2 O) | 3.260 g |
Was das Gestein am Grunde des Mahakambettes betrifft, so sah ich unterhalb der Mündung des Kaso, bis oberhalb der westlichen Wasserfälle, jüngere Schiefer in dünnen Schichten mit 1–10 cm dicken sandsteinartigen Schichten abwechseln. Alle diese Schichten streichen von West nach Ost, im Grossen und Ganzen mit der Richtung des Flusslaufes übereinstimmend.
Von der Vereinigung des Sĕlíku und Sĕlírong an bis zur Mündung des Blúu fällt der Mahakam von 550 auf 200 in Höhe; bei der Fahrt den Boh, Oga, Tĕmha und Mĕsĕai aufwärts steigt man von 150 bis 600 m Höhe, wo der Landweg zum oberen Kajan beginnt.
Von hier aus kann man die Wasserscheide längs einem ins Tal des Laja, eines Duellflüsschens des Kajan, hinabführenden Querrücken in einem Tage überschreiten. Der Kajan entspringt in der Nähe auf dem Batu Tĕlunjôn und strömt in nördlicher Richtung, in 600 m Höhe, durch ein ausgedehntes Hügelland, das die Bahau Apu Kajan nennen.
Die Erhebungen bestehen hier hauptsächlich aus Rücken, die sich von der Wasserscheide aus nach Norden erstrecken; sie sind, wie die Wasserscheide selbst, aus altem Schiefergestein gebildet, das unter der allgemeinen Büschbedeckung verborgen, fast nur in den Flussbetten zum Vorschein kommt. Diese Schiefer sind schwach gefaltet und fallen im allgemeinen unter 45°–70° nach Süden; das Streichen ist 245°–275°. An einigen Stellen werden die Schiefer von Sandsteinschichten bedeckt. Diese sind 1–6 dm dick und liegen horizontal den älteren, geneigten Schieferschichten auf. Die Schiefer werden von Basaltgängen durchbrochen. [49]
Nach Auffassung der Bevölkerung dehnt sich das Gebiet des Apu Kajan bis zu der Stelle aus, wo der Kajan eine lange Reihe unüberwindlicher Wasserfälle, Baröm, bildet. Der Beschreibung zufolge muss der Fluss dort über eine grosse Strecke hin von sehr hohen Bergen eingeschlossen sein.
Etwas Näheres wissen auch die Eingeborenen nicht über dieses ihnen selbst unbekannte und mystische Gebiet; künftige Forschungsreisen werden hoffentlich auch dorthin Licht bringen.
Nach diesem kurzen geologischen Überblick über Mittel-Borneo betrachten wir uns im folgenden das Land, wie es sich dem Beschauer in seiner äusseren Gestalt darbietet.
Man kann sich Mittel-Borneo am besten als ein mit Urwald bedecktes Gebirgsland vorstellen, dessen bedeutendste Flussläufe unter 200 m Höhe liegen und dessen höchste Bergspitzen 2000 m nicht überragen. So grosse Erhebungen kommen jedoch in der Nähe menschlicher Wohnungen nicht vor; Niederlassungen finden sich stets nur an den Flüssen und höher als 250 m liegen sie in Mittel-Borneo überhaupt nicht.
Das ganze Land ist mit ununterbrochenen, Jahrhunderte alten Wäldern bedeckt, die, je nach der Höhe ihrer Lage, von einander verschieden sind. Diejenigen Wälder, mit denen der Mensch in Berührung kommt, zeigen eine äusserst üppige Vegetation, die zwischen einem Gerüst von Riesenstämmen mit alles überdeckendem Blätterdache eine Menge kleinerer Bäume, Sträucher und Kräuter gebildet hat, so dicht, wie sie hohe Temperatur und ständige Feuchtigkeit auf humusreichem Boden allein zu schaffen vermögen. Auf dieses alles überwuchernde Pflanzenkleid übt die menschliche Tätigkeit wenig Einfluss aus. Für seine relativ geringen Bedürfnisse fällt der Mensch stellenweise den Wald, dessen Boden für 1–2 Jahre als ladang (trockenes Reisfeld) gebraucht wird; aber unmittelbar darauf wird diese kleine Lücke in der Buschbedeckung von der alles beherrschenden Vegetation wieder ausgeglichen, so dass binnen weniger Jahre nur der Eingeweihte die Spuren früherer menschlicher Arbeit erkennen kann. So wurde in früherer Zeit ein grosser Teil der tiefer gelegenen Wälder durch seine Bewohner gefällt, aber, wenn nicht hie und da steinerne Gerätschaften zurückgeblieben wären, käme man schwerlich auf die Vermutung, dass an Stelle dieser sogenannten Urwälder einst Reisfelder gestanden.
Die ungestörte Ruhe, welche die verlassenen Reisfelder geniessen, gestattet dem Gestrüpp und Busch, sogleich wieder ihr Reich einzunehmen, [50] und noch keine einzige Grasart, nicht einmal das im übrigen Indien so häufige und verbreitete alang-alang hat sich im Gebirgslande von Mittel-Borneo entwickeln können. Erst seit ungefähr dreissig Jahren ist am oberen Mahakam Gras aufgetreten, zum grossen Verdruss der Bewohner, die es nun aus ihren Reisfeldern jäten müssen.
Die Buschvegetation findet in der aequatorialen Lage des Landes eine mächtige Stütze, da der Einfluss der Passatwinde, der in höheren Breiten den Wechsel von Regen- und Trockenzeit hervorruft, sich hier nur in geringem Masse geltend macht. Daher erleidet die Vegetation von Mittel-Borneo niemals die Nachteile einer langdauernden Dürre, die den Graswuchs öfters begünstigt; auch schafft die grosse Ausdehnung der Wälder selbst, ausser der Zufuhr von Wasserdampf aus dem Meere, einen Überschuss an Feuchtigkeit in der Luft, während in den kühlen Räumen unter dem Blätterdache und im Boden beständig ein grosser Feuchtigkeitsvorrat angehäuft bleibt.
Durch diese das ganze Jahr anhaltende Feuchtigkeit und den übermässigen Regen ist die Temperatur dieser Gegenden niemals besonders hoch und nur da, wo die Bevölkerung zum Bau der Wohnungen einen kleinen Teil des schützenden Pflanzenkleides zerstört hat, steigt um die Mittagszeit die Temperatur unter einem kadjang- (Palmblatt-) Dache auf 30°–31° C, sinkt aber auch nachts selten unter 20° C.
In unmittelbarer Nähe der Berge, mehr am Mandai und Mahakam als im Tale des Mendalam, ist der Himmel oft bewölkt, und nachts bedecken tief hängende Wolken und Nebel den Wald. In der Regel beginnt die Bewölkung gleich nach Sonnenuntergang und verschwindet bei Sonnenaufgang; daher gehört ein klarer Sternhimmel in vielen Gegenden zu den Seltenheiten. Die Gipfel der Berge bleiben oft auch an heiteren Tagen bis zum Abend mit Wolken bedeckt. Das Gleiche gilt, mit geringen Ausnahmen, auch für die Küstengebiete, nur bewirken hier die Seewinde bisweilen kühlere Nächte.
In höheren Regionen verändert sich der Charakter der Vegetation unter dem Einfluss häufiger und regelmässiger Regen auffallend schnell. Gegen die Berge aufsteigend, lassen die mit Wasserdampf stark geschwängerten Luftströme ihre Wassermassen in Form von Regen anhaltend niederfallen und ihre Wolken widerstehen der Sonnenwärme; dadurch kühlen die höheren Stellen so stark ab, dass man auf einer Höhe von 1000 m an, abgesehen von wenigen kleinen Bäumen und niedrigem Gestrüpp, eine dicke, alles überdeckende Moosvegetation antrifft, [51] der man in Java nur auf einer Höhe von 2500–3000 m begegnet.
Die Bewohner Borneos wurden bisher in Dajak (die ursprünglichen Inselbewohner) und Malaien (die eingewanderte Bevölkerung) eingeteilt; jene, sagte man, bewohnen das Binnenland, diese die Küsten. Im allgemeinen ist diese Einteilung richtig, aber hie und da, z.B. in Sĕrawak, bewohnt die heidnische Bevölkerung das Land bis zur Küste, andrerseits leben Stämme, die sich auch Malaien nennen, bis tief ins Innere an den grossen Flüssen. Diese zwei Hauptgruppen sind ausserdem nirgends scharf geschieden, sondern haben sich stark vermischt, was zur Folge gehabt hat, dass sich die Bewohner vieler Orte zwar Malaien und Mohammedaner nennen, in Wirklichkeit aber beinahe oder ganz rein dajakischer Abstammung sind und sich zu einer Religion bekennen, die dem heidnischen Dajaktum viel mehr ähnelt als dem Mohammedanismus. Auch findet man, allerdings weniger häufig, Dajak, in deren Adern malaiisches Blut fliesst. Diese Vermengung wird durch die grossen Flüsse, die für Fahrzeuge der Eingeborenen bis tief ins Innere des Landes zugänglich sind, stark befördert. Die vorzugsweise seefahrenden Malaien konnten sich längs diesen Strömen leicht verbreiten. Wie sehr sich die Malaien an einen Verkehr zu Wasser gebunden fühlen, erkennt man überall daran, dass sie sich hauptsächlich an den grossen Strömen niederlassen und die Dajak in das Bergland an die Nebenflüsse zurückdrängen.
Auch die allgemeine Bezeichnung der eingeborenen Bevölkerung Mittel-Borneos als Dajak ist nicht ganz zutreffend, da diese aus verschiedenen, ethnologisch scharf von einander geschiedenen Gruppen zu bestehen scheinen. Nach meinen im Jahre 1894 an 135 Dajak im Gebiete des oberen Kapuas ausgeführten anthropologischen Messungen scheinen sich diese Gruppen auch körperlich sehr verschieden zu verhalten. Dr. Kohlbrügge, der die Freundlichkeit hatte, meine Messungen zu bearbeiten, kam, ohne von den ethnologischen Verschiedenheiten der Stämme etwas zu wissen, auf Grund der Ergebnisse der Schädelmessungen und anderer Körpermerkmale zu der Vermutung, dass Mittel-Borneo von zwei Völkergruppen bewohnt wird, von denen die eine brachyzephal, die andere dolichozephal ist; diese kann zu den Indonesiern gerechnet werden2. Zu den Brachyzephalen [52] gehören die Kajan; zu den Dolichozephalen die Ulu-Ajar Dajak am Mandai. Auch vom ethnographischen Gesichtspunkte aus sind diese zwei Gruppen durch ihre sehr verschiedenen Sitten und Gewohnheiten geschieden. Ausserdem sind sie geschichtlich getrennt, denn die Kajan gehören zur grossen Gruppe der Bahau- und Kĕnjastämme von Ost-Borneo, während die Ulu-Ajar zu den Stämmen gerechnet werden müssen, die als Ot-Danum und Siang am oberen Melawi, oberen Kahájan und oberen Barito wohnen. Dass Dr. Kohlbrügge die Kajan auf Grund der Messungen für ein Mischvolk ansieht, ist sehr richtig, denn dieser Stamm ist seit 150 Jahren von seinem Stammland Apu Kajan am weitesten, bis in das Kapuasgebiet, fortgezogen, wo viele Sklaven, Abkömmlinge von Kriegsgefangenen verschiedenen Ursprungs und Individuen benachbarter Stämme durch Heirat in den Stamm aufgenommen wurden.

Greis der Kajan vom Mahakam.
Neben diesen zwei grossen Gruppen, welche die ackerbautreibenden Stämme umfassen, giebt es in Mittel-Borneo, in geringerer Zahl, auch Jägerstämme, die unter den Namen von Punan, Bukat und Bĕkĕtan in den hohen Gebirgen, den Quellgebieten der grossen Ströme, ein Nomadenleben führen. Diese Stämme betreiben wenig oder gar keinen Landbau, sondern leben von Jagd, Fischfang oder Waldfrüchten. Sie scheinen älter als die beiden anderen Gruppen zu sein und gehören vielleicht zu den ältesten Bewohnern Borneos.

Kajan vom Mahakam.
Sowohl die Bahau- als die Kĕnjastämme haben zum gemeinsamen Stammland das Quellgebiet des Kajan bzw. Bulunganflusses, welches Apu Kajan oder Po Kĕdjin genannt wird. Früher wurden alle Stämme der Bahau und Kĕnja unter den Namen Paristämme zusammen gefasst.
Augenblicklich bewohnen diese Stämme die Stromgebiete des ganzen Mahakam bis zum Mujub, des Bĕrau und des Kajan, die alle an Borneos Ostküste ins Meer münden; ferner die Gebiete des Oberlaufs der Flüsse, die nach Norden strömen: des Limbang, des Baram und des Balúi oder Batang-Rèdjang. Von hieraus drang ein kleiner Teil der Bevölkerung in die Kapuasebene ein, wo er jetzt am Mendalam wohnt.
Die Bewohner dieser Ländergebiete nennen sich, wie oben gesagt, teils Bahau teils Kĕnja.
Zu den Bahau rechnen sich die Stämme am Mahakam bis zum Mujub. Oberhalb der Wasserfälle gehören also zu ihnen die:
Sĕputan im Gebiet des Kasoflusses; Pnihing vom Howong bis zum [53] Sumwé; Kajan vom Sumwé bis zum Dini; Long-Glat vom Dini bis zu den Wasserfällen; Ma-Suling am Mĕrasè.
Unterhalb der Wasserfälle des Mahakam gehören zu den Bahau die:
Hwang-Sirow; Long-Wai; Uma-Lohat in Udju Halang; Hwang-Ana; Hwang-Tring in Tĕpu.
Am oberen Batang-Rèdjang oder Balui fasst man die Bahaustämme unter dem Namen Kajan, der wieder verschiedene Stämme begreift, zusammen. Ebenso wohnen am Mendalam, dem nördlichen Nebenfluss des Kapuas, Bahau: die Kajan Uma-Aging zu Tandjong Karang und Tandjong Kuda, die Ma-Suling und Uma-Pagong weiter flussaufwärts.
Zu den Kĕnja rechnen sich vor allen die Stämme, die augenblicklich noch im Apu Kajan wohnen, ferner die, welche sich an den nach Osten strömenden Flüssen niedergelassen haben, nämlich die am Tawang, Brau und Kajan. Auch die Stämme am oberen Limbang und oberen Baram gehören zu den Kĕnja.
Die Kĕnjastämme, die gegenwärtig den Apu Kajan bewohnen, haben ihre Heimat an dem östlich gelegenen Iwan, einem linken Nebenfluss des Kajan. Neben diesem Nebenflusse befindet sich ein anderer, der Bahau, von dem wahrscheinlich der Name der Bahau herrührt, so dass diese also ursprünglich ebenfalls aus dem Osten herstammen.
Es entspricht nämlich der Gewohnheit der Kĕnja und Bahau, den Stämmen den Namen des Flusses, an dem sie lebten oder leben, zu geben. So setzt sich der Name “Long-Glat” zusammen aus: “long” = Mündung und “Glat” = Name eines Nebenflusses des Oga. Ma-Suling = Uma Suling = Haus am Suling; Uma-Mĕhak = Haus am Mehak (Nebenflüsschen des Boh); Uma-Tĕpai =- Haus am Tĕpai (Nebenfluss des Mahakam); Hwang-Tring = Stamm vom Tring (Berg im Gebiet des Boh).
Am Kajan wohnen von seinem Ursprung flussabwärts folgende Kĕnjastämme, die:
Uma-Tow; Uma-Bom; Uma-Djalan; Uma-Tokong; Uma-Kulit; Uma-Baka; Uma-Bakong; Uma-Lĕken (unmittelbar oberhalb des Baröm).
Die Bahau- und Kĕnjastämme wissen noch sehr wohl, dass sie vom Apu Kajan herstammen und die meisten können auch noch die Zeit ihrer Auswanderung angeben. Auch gegenwärtig finden solche Auswanderungen noch statt. Vor ungefähr dreissig Jahren sind die Kĕnja Uma-Time, die jetzt am Tawang wohnen, vom Kajan dorthin übergesiedelt; [54] der Stamm der Uma-Bom hat jetzt den Plan, in das Tal des Boh zu ziehen und sich dort niederzulassen. Im Lauf der Zeit wandert ein solcher Stamm immer weiter flussabwärts, den Weg der meisten Bahaustämme, die jetzt am Mahakam wohnen, folgend.
Obgleich die Geschichte ihrer Auswanderung den Stämmen sehr wohl bekannt ist, hat doch auch die Legende die Tatsache, dass alle vom Apu Kajan gebürtigen Stämme jetzt nach allen Himmelsgegenden zerstreut wohnen, zu erklären versucht:
In alten Zeiten, heisst es, entstand zwischen dem Feuer (apui) und dem Wasser (ata) ein Zwist, der sich so steigerte, dass beide im Kampfe die Kräfte aufs äusserste anspannten. Wind und Regen kamen dem Wasser zu Hilfe, welches infolgedessen so sehr stieg, dass es alles Land mit Wäldern und allem überflutete. Dadurch erlosch das Feuer, aber auch alle Menschen bis zum Apu Kajan hinauf kamen um. Nur einige wenige, die in Böten sassen, blieben am Leben. Diese sahen keine andere Möglichkeit, das Wasser zum Sinken zu bringen, als eine der Ihren, Hillo, die Tochter eines Häuptlings, zu töten, indem sie ihr die Schulter durchhieben. Da fiel das Wasser plötzlich vom hohen Bergland hinunter und führte zugleich die in den Böten überlebenden Menschen nach verschiedenen Seiten auseinander. So wurden die Bewohner von Apu Kajan in alle Himmelsrichtungen zerstreut und sprechen heute so viele verschiedene Sprachen.
Wenn irgend möglich, wohnen die Stämme im Mahakam- und Kajangebiete am Hauptfluss selbst; nur wenn der Wohnplatz für unsicher gehalten wird, wie nach dem Einfall der Batang-Lupar im Jahr 1885 am Mahakam, oder wenn eine starke Zunahme der Bevölkerung es gebietet, wie am Kajan, lassen sich Bahau und Kĕnja auch an Nebenflüssen, häufig hoch im Gebirge, nieder. Das Gleiche sehen wir am oberen Barito oder Murung, wo sich die Dajak vor den am Hauptfluss sich ansiedelnden Malaien an die Ufer der Nebenflüsse zurückgezogen haben.
Eine Eigentümlichkeit aller Bahau besteht darin, dass sich ihre selbständigen Stämme, obgleich sie einander nicht bekriegen, doch auch nur wenig vermischen. Heiraten zwischen Pnihing, Kajan und Long-Glat kommen, beispielsweise, nur selten vor, noch viel seltener sind Verbindungen zwischen Bahau und Kĕnja. Demnach müssen Heiraten zwischen Gliedern von Stämmen, die verschiedenen Gruppen [55] angehören, wie Bahau und Ot-Danum, früher eine grosse Seltenheit gewesen sein. Man sollte daher erwarten, dass sich das Blut der Stämme von Mittel-Borneo sehr rein erhalten habe, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Bahau haben nämlich alle ihre gegenwärtigen Wohnplätze erst erobern müssen; am Mahakam fanden sie Stämme vor, die mit den Ot-Danum vom Kahájan und Mĕlawie und den Siang vom oberen Barito verwandt waren. Die Bewohner wurden teils vertrieben, teils zu Sklaven gemacht und den Häuptlingen der Stämme zugeteilt. Diese Sklaven lebten anfangs in Familien, getrennt von den freien Gliedern des Stammes, aber allmählich wurden sie durch Heirat in den Stamm selbst aufgenommen, bei den Long-Glat z.B. beinahe vollständig. Daher bestehen die Bahaustämme am Mahakam gegenwärtig aus einer Mischung der dolichozephalen Ot-Danum mit den ursprünglichen Bahau, die wahrscheinlich brachyzephal waren.
Ähnlich verhält es sich mit den Kajan am Mendalam.
Die Kĕnjastämme im Apu Kajan jedoch müssen den ursprünglichen Charakter der Bewohner dieses Stammlandes noch sehr rein erhalten haben, und dürften daher für künftige anthropologische Untersuchungen einen ausgezeichneten Ausgangspunkt bilden.
Noch ein anderer Faktor zwingt uns bei der Beurteilung der Reinheit eines Stammes zur Vorsicht und zwar folgender: in Anbetracht, dass die Zahl seiner Glieder für die Macht und den Einfluss eines Stammes auf die anderen von grösster Wichtigkeit ist, streben die meisten Häuptlinge danach, diese Zahl nach Möglichkeit zu vergrössern. Vor allem suchen sie Heiraten ihrer Stammesgenossen in fremde Stämme zu verhindern; sobald sie sich aber stark genug dazu fühlen, wie die Long-Glat im Anfang des 19. Jahrhunderts, bekriegen sie schwächere Stämme und zwingen sie, mit ihnen zusammen zu wohnen und zwar als ihre Untergebenen, nicht als Sklaven. Es leben jetzt noch unter den bereits getrennten Long-Glat die Stämme der Ma-Tuwan, Manok-Kwe, Uma-Tepai, Uma-Wak und Batu-Pala, die wahrscheinlich auch vom Apu Kajan gebürtig sind. Merkwürdiger Weise haben diese oft nur 100 Individuen zählenden Stämme sich ihre eigenen Sprachen und Sitten erhalten; Heiraten mit den Long-Glat kommen jedoch häufig vor. So kann auch auf diesem Wege Vermischung stattfinden.

Junge Frauen der Mahakam Kajan.
In letzter Zeit ist in Borneo ein neues Moment entstanden, das die scharfen Gegensätze zwischen den verschiedenen Völkergruppen und die grosse Feindschaft, die früher zwischen ihnen herrschte, zum Verschwinden [56] bringt: es ist die europäische Nachfrage nach den Buschprodukten Borneos, vor allem nach Guttapercha und Rotang. Infolge dieser Nachfrage vereinigen sich Männer aus den entlegensten Gegenden der Insel in Gruppen und ziehen als Buschproduktensucher überall hin, wo diese Artikel noch zu finden sind. Diese Banden sind stark genug, um den Widerstand einzelner Stämme, die sie nicht aufnehmen wollen, zu brechen und sich allmählich auf freundschaftlichen Fuss mit ihnen zu stellen. Daher erscheinen jetzt Ot-Danum und Siang, die sich früher, wegen der feindlichen Gesinnung der Bahau, nie in das Gebiet des Mahakam wagten, scharenweise bei ihnen und gehen nicht selten sogar eine vorübergehende Eheverbindung mit deren Frauen ein.

Junge Mädchen der Mahakam.
Auch die Malaien der Küste haben begonnen, sich an dem Sammeln von Buschprodukten stark zu beteiligen; in grosser Zahl ziehen die Männer aus ihren Dörfern am Unterlauf der Flüsse nach deren Quellgebieten, um in ihren noch unberührten Wäldern nach Rotang und Guttapercha zu suchen. Man findet daher gegenwärtig in ganz Borneo Malaien, was für die einheimische Bevölkerung neben einigen Vorteilen sehr grosse Nachteile mit sich bringt.
Bei sämmtlichen Bahau und Kĕnja ist die Organisation der Gemeinwesen in der Hauptsache die gleiche, was sich aus der Verwandtschaft dieser beiden Stammgruppen sehr wohl erklären lässt. Ich beschränke mich daher darauf, hier nur die Verfassung des Stammes der Mendalam Kajan ausführlich zu besprechen und bei anderen Stämmen vorkommende Abweichungen gelegentlich zu erwähnen. Es sei mir gestattet, einige geschichtliche Bemerkungen über diese Kajan vorauszuschicken.
Der Stamm der Kajan bewohnt die Ufer des Mendalam gemeinsam mit dem der Ma-Suling und Uma-Pagong, mit denen sie, nach ihren geschichtlichen Überlieferungen, gemeinsame Abstammung aus dem Quellgebiet des Kajanflusses verbindet. Eine Hauptursache der Auswanderung bildete die zu starke Zunahme der Bevölkerung; den unmittelbaren Anstoss gab aber ein unter den Stämmen ausgebrochener Zwist.
Die Vorfahren der eben erwähnten Bahaustämme durchzogen damals das zwischen dem Berge Batu Tibang und der Oga-Quelle gelegene Land, in dessen ausgedehntem Urwald sich noch heute Spuren ihrer früheren grossen Niederlassungen finden. Von hier wanderten sie nach [57] dem Njangéjan, einem Nebenfluss des Batang-Rèdjang, den sie später wieder verliessen, um nach zwei verschiedenen Richtungen auseinander zu gehen.
Der eine Teil zog an den oberen Mahakam, wo er heute noch im Tal seines Nebenflusses, des Mĕrasè, wohnt; der andere Teil begab sich in das Gebiet des oberen Kapuas, wo er jetzt am Mendalam lebt. Bevor er sich jedoch hier niederliess, bewohnte er lange Zeit das Tal des Sibau, in welches er längs dem Batang-Rèdjang, auf dem heute noch gebräuchlichen Wege, gelangt war. Obgleich es sicher 150 Jahre her sind, seit die Mendalam Kajan dort wohnten, machen ihre Häuptlinge doch jetzt noch auf diese Gebiete und besonders auf die damals gepflanzten Fruchtbäume Ansprüche geltend. Während ihres Aufenthaltes am Sibau trennte sich auch dieser Zweig nochmals; ein Teil blieb am oberen Kapuas, der andere fuhr den Fluss hinunter und liess sich an verschiedenen Orten des Hauptstromes bis unterhalb Sĕmitau nieder. Aus verschiedenen Ursachen nahmen seine Glieder hier aber so stark an Zahl ab, dass ihre Häuptlinge beschlossen, zum alten Zweig am oberen Kapuas zurückzuziehen. Sie wurden dort aufgenommen, nachdem sie sich eidlich verpflichtet hatten, nicht wieder fortzuziehen. Als sie später trotz ihres Eides wiederum den Kapuas abwärts auswanderten, gingen sie dort aus unbekannten Ursachen völlig zu Grunde. Die drei überlebenden Kinder aus der Häuptlingsfamilie wurden von dem alten Stamm wieder aufgenommen und verbanden sich durch Heirat mit ihren früheren Stammesgenossen.
Auch dieser sesshaftere Teil der Bahaustämme wechselte seinen Wohnplatz, sei es aus Mangel an geeignetem Boden für seine Reisfelder, sei es, weil er an einem bestimmten Ort zu stark von Krankheiten, die von den vielen dort hausenden Geistern ausgehen sollen, heimgesucht wurde.
Im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts erhielten die Kajan den unerwünschten Besuch von Scharen ihrer Verwandten aus dem Gebiet des oberen Mahakam. Diese waren damals sehr mächtig und zogen unter Anführung zweier grosser Long-Glathäuptlinge, Lĕdju und Ibau, durch ganz Mittel-Borneo brandschatzend umher. Während aber das Haus der Taman am Mendalam und viele andere am Kapuas von ihnen verwüstet wurden, blieb das der Kajan am Mendalam verschont und zwar, der Überlieferung nach, aus dem Grunde, dass Lĕdju, durch das Erscheinen eines aussergewöhnlich grossen und starken [58] Kajan, namens Bang, erschreckt den Kampf einstellte. Im Friedensschluss kam man überein, dass Tipong Aging, die Tochter des vornehmsten Kajanhäuptlings, Ledju als Gattin an den Mahakam folgen sollte.
Fährt man heute den Mendalam einige Stunden weit aufwärts, so trifft man zuerst die Niederlassung von Tandjong Karang, bewohnt von dem Stamm, genannt Kajan Uma-Aging; etwas weiter oben, in Tandjong Kuda, wohnt ein anderer Teil des gleichen Kajanstammes, während noch weiter oben am Fluss die Ma-Suling und der Stamm Uma-Pagong gemeinsam wohnen. Der Rest des Tamanstammes, der vor der Ankunft des Lĕdju sehr stark war, lebt jetzt teils mit den Ma-Suling und Uma-Pagong, teils mit den Kajan in Tandjong Karang zusammen.
Die Kajan Uma-Aging haben sich erst vor wenigen Jahren infolge von Zwistigkeiten in der Häuptlingsfamilie getrennt. Sie wohnten früher gemeinsam in Tandjong Karang, aber neben Sĕniang, dem Manne der Bulan, die eigentlich allein erbberechtigter Häuptling war, hatte auch Akam Igau, der Gatte von Sĕniangs verstorbener Schwester, viel Einfluss und Ansehen gewonnen; die beiden Schwäger konnten sich jedoch nicht vertragen. Als Sĕniangs Sohn Tigang einst einen heftigen Streit herbeiführte, zog Akam Igau mit einem grossen Teil der freien Kajan und Leibeigenen an das gegenüberliegende Ufer und. baute sich dort ein neues Tandjong Karang. Auch Sĕniangs Familie zog später mit dem Rest der Kajan weiter den Fluss hinauf und liess sich in dem jetzigen Tandjong Kuda nieder. Seit ungefähr zehn Jahren wohnen diese Häuser oder Stämme nun getrennt in kleinem Abstand von einander und die gegenseitigen Eifersüchteleien und Zwistigkeiten haben in dieser Zeit nicht abgenommen.
Trotz des vielen Herumschweifens haben die Kajan die ursprüngliche Organisation ihres Gemeinwesens nicht verändert.
Ein Stamm der Kajan besteht aus folgenden Gliedern: einem Häuptling (hipui), Freien (panjin) und Sklaven (dipe̥n). Während der Häuptling stets einer bestimmten, bevorrechteten Familie angehört, setzen sich die Freien aus lauter Familien von der gleichen Rangstufe und den gleichen Rechten zusammen.
Die Leibeigenen sind meistens Nachkommen von Kriegsgefangenen und Eigentum des ganzen Stammes; ihre Arbeit kommt dem Häuptling zu Gute, der sie dafür zu unterhalten hat. Ab und zu werden [59] Sklaven von den nomadisierenden Jägerstämmen, die sie auf ihren Kopfjagden erbeuteten, gekauft.
Die eingeborenen Sklaven und auch die, welche einmal das Haus ihrer Herren betreten haben, dürfen nie mehr verkauft und auch nie auf den Gräbern der Häuptlinge geopfert werden; zu letzterem Zweck wurden früher die gekauften Sklaven verwendet.
Wegen Schulden oder Missetaten wird bei den Bahau nie jemand zum Sklaven gemacht.
Das Ansehen eines Häuptlings hängt im allgemeinen von der Höhe seiner Geburt ab. Die Häuptlingswürde ist erblich. Bei der Nachfolge wird aber nicht nur auf das Alter der Kinder, sondern auch auf deren Befähigung für das Häuptlingsamt Rücksicht genommen: Der Häuptling bestimmt oft schon bei Lebzeiten den Nachfolger und ist dieser einmal erwachsen, so spielt er häufig eine grössere Rolle als sein Vater.
Zu den physischen Gebrechen, die einen Sohn an der Nachfolge hindern, gehören Taubheit und Blindheit. So konnte Adjang, der älteste Sohn Sĕniangs, seiner Taubheit wegen, nicht Häuptling von Tandjong Kuda werden; es erbte daher sein jüngerer Bruder, Tigang, die Häuptlingswürde. Charakterfehler können die Nachfolge nicht verhindern, sie geben aber öfters zu heftigem Widerspruch seitens der Untertanen und nicht selten auch zu einer Spaltung des Stammes Anlass.
Die grössten Tugenden eines Häuptlings sind: Uneigennützigkeit und Rechtschaffenheit; neben diesen werden auch Tapferkeit und Redegewandtheit geschätzt, aber in geringerem Masse. Der Häuptling gewinnt sich die Gunst der Seinen hauptsächlich durch Milde und Freigebigkeit und diese Eigenschaften sind auch für alle, die mit den Bahau in Berührung kommen, eine Grundbedingung zu einem guten Empfang.
Die Häuptlingswürde kann auch auf die Töchter übergehen, die Söhne werden aber bevorzugt. Ist eine Frau jedoch einmal zum Häuptling gewählt, so geniesst sie alle Ehren, die ihrer Stellung zukommen.
Der Häuptling vertritt seinen Stamm nach aussen, übt durch Auferlegung der Strafen die richterliche Gewalt im Stamm, hat die Nutzniessung der Leibeigenen und ist Inhaber des allgemeinen Eigentums, wie alter, halb heiliger Erbstücke (dawan una).
Nicht nur weltlichen, sondern auch geistigen Mächten gegenüber muss ein Häuptling die Interessen der Seinen vertreten; daher leitet er alle bei den Ackerbaufesten stattfindenden religiösen Zeremonien [60] ein. Da jedes Verfahren, das der Reisbau erfordert, mit einer religiösen Feier begonnen werden muss, giebt der Häuptling das Zeichen für den Anfang jeder neuen Periode.
Obgleich der Häuptling nicht zur eigentlichen Priesterschaft gehört, muss er doch die Verbotsbestimmungen, gleich wie die Priester, strenger als alle übrigen befolgen.
Ferner fallen dem Häuptling grösstenteils die Kosten der öffentlichen Festmahlzeiten und der Sold für die Priester zur Last; auch hat er für die Entrichtung der Bussen, die dem Stamm durch Feinde oder die Regierung auferlegt werden, zu sorgen.

Ältere Frau der Mahakam Kajan.
Alle innerhalb des Stammes ausgebrochenen Zwistigkeiten werden bei den Kajan durch den eigenen Häuptling geschlichtet, sehr im Gegensatz zu den benachbarten Stämmen der Taman-, Sibau- und Kantu Dajak, die keine andere Autorität als die des holländischen Beamten anerkennen und ihn daher ständig mit kleinlichen Angelegenheiten belästigen. Die Mendalam Kajan wenden sich nur dann an den Kontrolleur, wenn Häuptlinge untereinander in Streit geraten und eire entscheidende Macht somit fehlt.
Erhält der Stamm Besuch von fremden Gästen, so nimmt der Häuptling die Gastherrnpflichten auf sich, auch wenn der Besuch einen Monat lang bleibt; sind die Gäste jedoch zu zahlreich, so werden sie unter die verschiedenen Familien verteilt, die in der Hilfe, die ihnen die Fremden bei ihrer Arbeit leisten, einigermassen Entschädigung finden. Ein Besuch kann sich nämlich, durch plötzliches Eintreten einer Verbotszeit bei Erntefesten oder beim Tode angesehener Personen, sehr in die Länge ziehen, da Fremde in dieser Zeit das Haus nicht verlassen dürfen.
Hat sich ein Glied eines Stammes etwas zu Schulden kommen lassen, so wird sein Vergehen dem Häuptling vorgetragen und diesem liegt die Rechtsprechung ob; er fällt sein Urteil jedoch nicht nach persönlicher Überzeugung oder Willkür, sondern nach den überlieferten, dem Stamme eigenen Gesetzen, die als Gewohnheitsrechte (adat) bezeichnet werden. Da die adat sehr verwickelt ist, ruft der Häuptling vor jeder Rechtsprechung die tüchtigsten, angesehensten und ältesten Männer der Freien, mantri genannt, zusammen und berät mit ihnen die Angelegenheit.
In gleicher Weise wie die Priester für die Erfüllung der religiösen adat zu sorgen haben, müssen die mantri auf die Befolgung der weltlichen [61] adat achten; sie bilden die ausführende Macht im Gemeinwesen der Kajan, üben aber auch auf jeden Beschluss grossen Einfluss aus.
Vor jeder Rechtshandlung werden nicht nur die mantri, sondern mit deren Hilfe auch die betroffenen Parteien und sämmtliche Bewohner des Hauses, Leibeigene und Frauen inbegriffen, zu einer öffentlichen Versammlung einberufen, und jedem steht das Recht zu, sich frei zu äussern. Derartige Versammlungen werden häufig abends oder an Tagen, an denen schwere Arbeit oder ein Verlassen des Hauses verboten ist, abgehalten und dauern oft eine ganze Nacht, bisweilen auch noch den folgenden Tag.
Lässt sich ein Kajan einem anderen gegenüber Diebstahl, Ehebruch oder Mord zu Schulden kommen, so kann sein Vergehen mit einer Busse gesühnt werden. Körperliche Strafen, Gefängnisstrafe und vorgeschriebene Blutrache kommen in diesem Falle nicht zur Anwendung. Den unmittelbaren Tod heischt die adat nur für Personen, die dem öffentlichen Interesse gefährlich sind oder zu sein scheinen.
Die Bussen werden teils der geschädigten Partei, teils dem Häuptling ausbezahlt, der bei der Auferlegung der Strafen vorsichtig zu Werke gehen muss; denn zeigt er einen Schimmer von Habsucht, so läuft er Gefahr, die Volksgunst zu verlieren.
Die Busse trägt den Charakter einer Schadloshaltung. Hat z.B. ein frei herumlaufendes Schwein einen Teil eines Reisfeldes vernichtet, so steht es dem Besitzer des Ackers frei, das Tier zu töten. Dessenungeachtet ist er aber verpflichtet, dem Besitzer des Schweines ein anderes Tier als Ersatz zu liefern. Der Eigentümer des Schweines wiederum muss den auf dem Reisfelde verursachten Schaden vergüten.
Auch Mordtaten werden mit Bussen gestraft; nur wenn die Bussen nicht bezahlt werden oder nicht auferlegt werden können, weil der Täter entflohen ist oder einem feindlichen Stamme angehört, tritt die Rache in den Vordergrund. Sie trifft jedoch nicht immer die schuldige Person, sondern auch deren Stammesgenossen, wenn die Gelegenheit sich gerade dazu bietet.
Handelt es sich um den Mord mehrerer Personen, der häufig durch Geisteskranke geübt wird, so wissen sich die Bahau nicht anders zu helfen, als indem sie den Mörder töten. In einzelnen Fällen, wenn der Mord nicht vollständig ausgeführt wurde, werden dergleichen Personen auch in kleinen Häuschen oder in gesonderten Räumen des grossen Hauses eingesperrt und verpflegt. [62]
Steht ein Stammesglied im Verdacht, Gift (puli) zu besitzen, mit dem es Menschen tötet oder krank macht, so riskiert es, von dem einen oder anderen niedergemacht zu werden, natürlich oft unschuldiger Weise.
Bei Ehebruch kommt es vor, dass der betrogene Ehemann die Schuldigen, wenn er sie überrascht, tötet; er ist jedoch verpflichtet, für die getötete Person Schadenersatz zu bezahlen. Nicht immer hat der Ehebruch eine Scheidung der Gatten zur Folge.
Frauen, welche ausserehelich schwanger werden, und die schuldigen Männer haben nach Anschauung der Bahau eine Missetat begangen, welche die Geister erzürnt und dem Stamme Unglück bringt. Die Strafe, die man ihnen auferlegt, gleicht daher einem Opfer an die Geister. Die Long-Glat am Mahakam lassen die Schuldigen mit einem Schwein als Opfergabe auf einem Floss mit der Strömung flussabwärts treiben. Das Schwein ertrinkt in den Wasserfällen, während sich das schuldige Paar durch Schwimmen rettet.
Zur Entdeckung des Schuldigen sah ich die Bahau von folgendem Mittel Gebrauch machen: Der Bestohlene liess jeden ein Ei anrühren in der Überzeugung, dass der Schuldige das Ei nicht zu berühren wagen würde, aus Furcht krank zu werden.
Die Bahau schwören auf den Zahn des Königstigers; in ernsten Fällen jedoch geschieht die Eidesleistung unter gleichzeitigem langsamem Töten eines Hundes. Dem Tiere werden mittelst eines Schwertes Stichwunden beigebracht und derjenige, der den Eid leistet, bestreicht sich mit dem ausströmenden Blute. Bei Meineid wird der Schuldige, nach dem Glauben der Bahau, später durch den Hund, d.h. durch den Geist, der in ihm steckte, verfolgt, gebissen und getötet.
Die Vollziehung der Strafen ist für die mantri keine leichte Aufgabe, denn sie besitzen keine Zwangsmittel und im Kajanstaat geniesst jeder die grösste Freiheit. Die mantri finden aber für die Aufrechterhaltung der Ordnung in zwei Faktoren eine wesentliche Stütze: erstens in der Achtung der Kajan vor der öffentlichen Meinung, zweitens in ihrer Furcht, bei Übertretung der adat zur Strafe krank zu werden, dem sog. “takut parid.”
Dass Menschen, die ihr ganzes Leben gemeinsam in einem Hause, in unmittelbarer Nähe von einander, verbringen, doch ein so ausgesprochenes Gefühl der Eigenwürde und beinahe eine Überempfindlichkeit für die Meinung ihrer Umgebung besitzen, setzt uns in Erstaunen. [63] Die adat und die Art ihrer Handhabung ist überhaupt nur bei einem Stamm mit derartigem Charakter denkbar.
Wird in einer öffentlichen Versammlung oder durch den Häuptling und die mantri einem Schuldigen eine Busse auferlegt, so wagt er es nur in seltenen Fällen, sich zu widersetzen. Es kommt noch hinzu, dass sich seine ganze Familie bei der Angelegenheit betroffen fühlt.
Nicht minder als die öffentliche Meinung trägt das “takut parid” dazu bei, im Staate und in der Familie der Kajan Ordnung und Sitte aufrecht zu erhalten. Der Aberglaube parid, krank, kachektisch zu werden, sobald man dieses oder jenes Verbot übertritt, übt auf das Tun und Lassen von alt und jung den grössten Einfluss aus. Im allgemeinen wird bei den Kajan jemand parid, wenn er etwas tut oder anrührt, das nur Älteren oder Höherstehenden zukommt. Das takut parid gilt somit nicht für sämmtliche, sondern nur für besondere Übertretungen. Kindern ist es verboten, Gegenstände, die älteren Männern oder dem Häuptling gehören, hauptsächlich aber Kriegswaffen, anzurühren. Junge Männer dürfen keine Schwertgriffe aus Horn schnitzen oder eiserne Schwerter und Speere gravieren oder Gestelle für Reiskörbe mit Rotang umflechten oder endlich sich nicht mit den Schwanzfedern des Nashornvogels schmücken—alle diese Dinge sind nur alten, tapferen Männern gestattet.
In bezug auf alles, was den für die Borneobewohner mystischen Tiger (le̥djo) betrifft, ist jeder in hohem Masse takut parid; nur einige der vornehmsten Häuptlinge wagen es, den Zahn eines Königstigers anzurühren. Als ich daher auf meiner letzten Reise als grosses Geschenk für die obersten Häuptlinge am Mahakam einige Tigerzähne aus Java mitnahm, hütete ich mich davor, zu verraten, in welcher Kiste sie sich befanden, da sonst kein Kajan sie hätte tragen wollen. Aus dem gleichen Grunde musste ich auch einen Tigerschädel in Putus Sibau zurücklassen. Jeder fürchtete sich davor, auch nur mit dem Staub des Tigerzahnes in Berührung zu kommen, den Demmeni für den Pnihinghäuptling Bĕlarè einst feilte.
Auch in allem, was den Gottesdienst angeht, seien es Gebräuche, Verbote oder religiöse Gegenstände, ist jeder Laie takut parid. Selbst die jungen Priesterinnen können parid werden und nur die ältesten, wie Usun in Tandjong Karang, wagten es, über ihre Wissenschaft zu sprechen und religiöse Gegenstände (barang lali) für mich nachzumachen.
Dass in einem Gemeinwesen, das, wie wir gesehen haben, mehr [64] durch die öffentliche Meinung und abergläubische Furcht als durch Gesetz und Recht zusammengehalten wird, einzelne Individuen mit ausgesprochener Persönlichkeit; leichter als wo anders, eine leitende Rolle zu übernehmen im stande sind, ist selbstverständlich. Daher hat der Häuptling auch hauptsächlich diesen einzelnen Rechnung zu tragen, die grosse Menge folgt von selbst.

Pnihing.
Treten jedoch aussergewöhnliche Ereignisse ein, wie z.B. meine Expedition zum Mahakam, so fühlt sich auch eine Persönlichkeit wie Akam Igau auf unsicherem Boden; denn sobald das Gewohnheitsrecht, keine Bestimmungen getroffen hat, ist der Häuptling seinen Untergebenen gegenüber machtlos. Zwar wagen diese ohne des Häuptlings Hilfe nichts zu beginnen, aber er hat kein Mittel, seine Leute zu zwingen, sich an einem besonderen Unternehmen zu beteiligen, sondern jeder beschliesst selbst, ob er mithält oder nicht. In Anbetracht, dass sein Ansehen zum grossen Teil von der Wohlgesinntheit seiner Untergebenen abhängt, zieht sich ein Häuptling, sobald es darauf ankommt, etwas Aussergewöhnliches durchzusetzen, gern zurück und schiebt die Entscheidung am liebsten einem anderen zu:

Pnihing.
Der freie Kajan (panjin) hat dem Häuptling gegenüber keine andere Verpflichtung, als ihm bei jedem neuen Verfahren, das der Reisbau erfordert, einen Arbeitstag zu leisten, ferner ihm bei der Ausführung grösserer Arbeiten, wie bei der Herstellung und beim Transport von Böten durch den Wald, sowie beim Bau seiner Wohnung behilflich zu sein.
Wird für den ganzen Stamm ein neues Haus gebaut, so liefert jede Familie, ausser dem Material für die eigene Wohnung, noch einen Pfahl, einige Planken und 100 Schindeln zum Bau der Häuptlingswohnung (amin aja). Der Häuptling wiederum ist verpflichtet, mit seinen Sklaven demjenigen zu helfen, der aus irgend einem Grunde sein Feld nicht bebauen kann oder sonst der Unterstützung bedürftig ist.
Ein derartiges gegenseitiges Hilfeleisten ist bei den. Kajan sehr üblich; bei jeder besonderen Ausgabe oder Unternehmung wendet man sich um Leistung von Geld oder Arbeitskraft an die Opferwilligkeit der Verwandten und Dorfgenossen.
Heiratet z.B. ein Kind des Häuptlings, so beteiligen sich alle Stammesgenossen an den Festkosten; für öffentliche Festmahlzeiten liefert jeder etwas gewöhnlichen Reis oder Klebreis; hat ein Häuptling eine ansehnliche Busse zu bezahlen, wie Akam Igau, als er sich zu bald nach dem Tode der ersten Frau. wieder verheiratete, so trägt jeder seines. Anteil bei. [65]
Befindet sich ein Kajan in Not, so sind in erster Linie seine Anverwandten, in zweiter der Häuptling verpflichtet ihm zu helfen.
Nicht nur bei öffentlichen, sondern auch bei privaten Festen hat der Häuptling eine besondere Rolle zu erfüllen: die Kinder, die zu Neujahr einen Namen erhalten, werden ihm zugetragen, damit er sie mit Wasser besprenge; will ein junger Mann in eine andere Niederlassung hineinheiraten, so muss ihm der Häuptling hierzu seine Bewilligung erteilen und der neue Häuptling erhält ein Geschenk; sind keine Angehörigen vorhanden, so fällt dem Häuptling die Vormundschaft und die Vermögensverwaltung der Waisen bis zu deren Volljährigkeit zu.
Was die Verpflichtungen der Leibeigenen (dipe̥n) gegenüber dem Häuptling betrifft, so liegt ihnen, wie erwähnt, alle Arbeit in Wald, Feld und Haus ob. Oft tritt auch Arbeitsteilung ein, so dass Männer und Frauen ohne kleine Kinder mehr ausserhalb des Hauses arbeiten, die anderen dagegen das Reisstampfen, Kochen, Reinigen der Wohnung und dergleichen übernehmen. Die Sklaven arbeiten unter Aufsicht der Häuptlingsfamilie oder unter der bestimmter, von dem Häuptling erwählter Personen. Das Verhältnis von Herr und Knecht ist jedoch derart, dass man lange unter den Kajan gelebt haben muss, um zu wissen, wer eigentlich Leibeigener ist.
Besonders fähige Sklaven schickt der Häuptling oft für Monate auf Reisen, um unter verwandten Stämmen am Mahakam oder Batang-Rèdjang Handel zu treiben. Da den Sklaven hierbei ein Teil des Gewinnstes zufällt, bringen sie es oft zu grösserer Wohlhabenheit als die freien Kajan.
Die Leibeigenen dürfen ausserdem noch für ihren unmittelbaren Vorteil arbeiten; früher scheint der Häuptling regelmässig einen bestimmten Prozentsatz ihres Gewinnes für sich beansprucht zu haben, gegenwärtig macht Akam Igau nur selten von diesem Recht Gebrauch. Anders verhält es sich in Tandjong Kuda, wo der Häuptling arm ist.
Für 100 Dollar kann sich ein Leibeigener am Mendalam loskaufen; ich habe aber nie von einem solchen Fall gehört. Ebenso ungewöhnlich sind Fluchtversuche Leibeigener aus Unzufriedenheit über ihr Los. Die meisten der gegenwärtigen Sklaven sind im Stamme geboren und können sich nirgends anders niederlassen, wenn ein anderer Häuptling sie nicht unter seinen Schutz nimmt.
Wie die freien Kajan, haben auch die Leibeigenen mannigfach Gelegenheit, [66] sich durch persönliche Eigenschaften eine einflussreiche Stellung zu verschaffen; sie können sogar in die Priesterschaft aufgenommen werden und sich durch ihr Amt ein bedeutendes Einkommen erwerben; auch können sie es im Kriege bis zum Anführer bringen.
In der Häuptlingswohnung essen die Leibeigenen gesondert, auch schlafen sie in besonderen Abteilungen.
Die Sklaven heiraten meist unter einander, aber eine Verbindung mit freien Kajan gehört nicht zu den Seltenheiten. Die Freien übernehmen durch eine Heirat mit Sklaven deren Verpflichtungen, sie “heiraten in die grosse Wohnung” = “ngahawa halam amin aja,” wie der offizielle Ausdruck lautet. In Wirklichkeit aber zieht das junge Paar nur selten in die Häuptlingswohnung, meist erhält es eine selbständige Wohnung im grossen Hause.
Erfolgt Scheidung, so tritt der Freie in seinen früheren Stand zurück und die Kinder folgen teils dem Vater teils der Mutter; eine besondere Bestimmung hierüber habe ich nicht ausfindig machen können.
Als allgemeines Eigentum des Stammes dürfen die Sklaven nie verkauft, bei Erbschaft verteilt oder bei der Heirat eines Häuptlings von ihm in eine andere Niederlassung mitgeführt werden. Den Sklaven wird nur selten gestattet, in ein anderes Dorf zu heiraten.
Man sollte nicht erwarten, dass in einem Staate, in welchem, dank seiner freien Organisation, der niederste Sklave durch persönliche Eigenschaften zu Einfuss und Ansehen gelangen kann, das Gefühl für Standesunterschiede sehr ausgeprägt ist—und doch ist dies bei den Kajan in hohem Masse der Fall. Sie unterscheiden in ihrem Gemeinwesen nicht nur Häuptlinge, Freie und Sklaven, sondern zwischen diesen noch verschiedene Übergangsstufen und zwar in der Art, dass eine bestimmte Stellung ihren Familien zwar rechtlich, aber nicht gesellschaftlich, zukommt. Dem Häuptling wird z.B. nachgerechnet, ob unter seinen Vorfahren Freie vorkommen und wie viele, ob Fremde oder nur Glieder verwandter Stämme in seine Familie hineingeheiratet haben; von allen diesen Verhältnissen ist sein Ansehen abhängig. Unter den panjin wiederum giebt es Familien, die seit alters zum Stamme gehören, in die womöglich Glieder der Häuptlingsfamilie durch Heirat aufgenommen worden sind, die sich nicht mit Fremden oder Sklaven vermischten und die überdies reich sind; man nennt sie Panjin saju = schöne Freie. Ihre ältesten Glieder üben einen besonderen Einfluss im Staate. Dagegen giebt es andere panjin, denen alle [67] diese günstigen Umstände fehlen und die daher eine viel tiefere gesellschaftliche Stufe einnehmen. Sind diese Familien lange arm gewesen oder haben sie öfters Sklaven oder Glieder fremder Stämme durch Heirat aufgenommen, so geniessen sie unter ihren Dorfgenossen oft viel weniger Ansehen als wohlhabende Sklavenfamilien, die kluge und einflussreiche Glieder zu den Ihrigen zählen.
Die Kajan dichten ihren Häuptlingen gern eine besonders hohe Herkunft an, so lassen sie Akam Igau, dessen Vater vom Mahakam gebürtig war, von den guten Geistern des Apu Lagan abstammen. Die Legende lautet folgendermassen
In alten Zeiten feierte das Haus der Uma-Aging am oberen Kajan einst das Saatfest (tugal). Nachdem der Häuptling Lĕdjo Aging mit den Priesterinnen auf dem heiligen Reisfelde (luma lali) alle Zeremonien ausgeführt und einen pe̥lale̱ (Opfergerüst mit Opferspeisen) errichtet hatte, bemerkte er beim Nachhausekommen, dass er sein Messer, das er bei der Arbeit gebraucht hatte, auf dem Opferplatze hatte liegen lassen. Als Lĕdjo allein auf das Feld zurückkehrte, fand er dort zu seinem Erstaunen eine Schar weiblicher Geister aus dem Apu Lagan (Aufenthaltsort der guten Geister), die die Aufforderungen der Priesterinnen er hört hatten und sich an den auf dem pe̥lale̱ niedergelegten Opferspeisen gütlich taten. Bei Lĕdjos Kommen entflohen die Jungfrauen bis auf eine, die mit ihrem langen, prachtvollen Haar am Opfergerüst hängen blieb und so dem Häuptling in die Hände fiel. Lĕdjo nahm das schöne Mädchen mit der heller Hautfarbe nach Hause und überredete es, als seine Gattin bei ihm zu bleiben. In damaliger Zeit war es aber im Kajanlande immer hell, daher schämte sich Jungfrau Mang vor innigeren Beziehungen und stieg zu ihrem Himmel hinauf, um von dort den Schutz des nächtlichen Dunkels in ihre neue irdische Heimat herniederzubringen. Mang brachte die Finsternis in einem samit (Palmblattsack) mit, den sie, zu Hause angekommen, im Gemache niederlegte, worauf sie sich nach der langen Reise etwas Erholung und Erfrischung gönnte. Ein neugieriges Kind, das wissen wollte, was sich in dem Sacke befand, schnitt ein Loch hinein; da entfloh die Finsternis und breitete sich zum Schrecken des Stammes über das ganze Land aus. Die Kajan wussten in ihrer Angst nicht, was sie beginnen sollten und entwarfen allerhand Pläne, um dem Unglück zu wehren, als die Hähne zu krähen anfingen und es wieder Licht wurde. Seit der Zeit kehren Nacht und Tag regelmässig zu den Menschen zurück. [68]
Nun war Mangs Eheglück vollkommen und bald darauf wurde sie schwanger. Als sie nach etlichen Monaten mit vielen anderen ihres Stammes auf einer Geröllbank mit Fischen beschäftigt war, fühlte sie, dass ihre Stunde gekommen sei. Sie zog sich daher zurück und hockte in der Ferne nieder, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Lĕdjo und die Seinen dachten aber, dass sie nur einem Bedürfnis nachkommen wolle; denn bis dahin war es bei den Kajan üblich gewesen, wenn ein Kind geboren werden sollte, der schwangeren Frau den Leib aufzuschneiden. Von Mang lernten die Kajan nun ein besseres Verfahren; denn bald brachte sie ihrem Gatten ein Töchterchen, Do Neha (ne̥ha = Geröllbank).

Bewaffnete Ma-Suling vom Mĕrasè mit ihrem Häuptling Ibau Li.
Als Do Neha erwachsen war, konnte Mang ihre Sehnsucht nicht länger bezwingen und kehrte zum Apu Lagan zurück. Ihre Tochter vermählte sich mit Tigang Aging, dem sie einen Sohn, Batang Huwang, schenkte. Bald nach der Geburt schnitt sich die junge Mutter, um ihr Söhnchen zu trocknen, einen Teil ihres langen Haares ab. Kaum hatte sie diese weggeworfen, als sie aus ihren Haaren so stark zu bluten begann, dass sie starb. Seither dürfen die Häuptlinge von dem Stamme Aging ihre Haare nicht schneiden lassen.
Da das Kind den Tod der Mutter veranlasst hatte, brachten es die Dorfbewohner in den Wald, um es dort umkommen zu lassen. Niemand wagte das Kind aufzunehmen. Endlich kam eine gute Frau, die das Kind aufhob und mit ihm an den Fluss Kaso zog. Dort liess sich Batang Huwang, der keine Lust mehr verspürte, nach seinem Stamm zurückzukehren, nieder. Seine Nachkommen blieben ebenfalls im Mahakamgebiet wohnen, nur Akam Igaus Vater zog an den Mendalam und heiratete in den Stamm der Ma-Aging (= Uma-Aging).
Durch diese Erzählung erhält Akam Igau eine Abstammung von den Himmelsgeistern und wird gleichzeitig zu einem Glied der Häuptlingsfamilie der Uma-Aging gemacht. [69]
1 Dr. G.A.F. Molengraaff: Geologische Verkenningstochten in Centraal-Borneo (1893–94).
2 Anthropometrische Untersuchungen von Dr. J.H.F. Kohlbrügge. Mittheilungen aus dem Niederl. Reichsmuseum f. Ethn.
Kapitel IV.
Lebenslauf eines Bahau bzw. eines Kajan—Geburt—Behandlung des Neugeborenen—Kindertragbrett (hăwăt)—Verpflegung des Kindes—Erste Namengebung—Zweite Namengebung—Namenänderungen—Das Kind bis zur Pubertät—Junge Männer und Mädchen—Tätowierung—utang—Künstliche Verunstaltungen—Beschäftigungen und Verkehr der jungen Leute—Mahlzeiten—Beirat—Stellung von Mann und Frau—Erbschaft—Tod—Trauer—Kopfjagden.
Bevor ein junger Kajan das Licht der Welt erblickt, haben sich seine künftigen Eltern zahlreichen Vorschriften der adat zu unterwerfen. Die Mutter darf keine Tiere töten und keine zu jungen Fische essen. Auch einige ausgewachsene Fische, das Fleisch des Schuppentieres (Manis javanica) und verschiedene Arten von Früchten und Gemüsen sind ihr verboten. Ferner muss sie sich hüten, während des Regens zu schlafen, geschieht dies doch, so wird sie geweckt.
Der Gatte darf vor und nach der Entbindung seiner Frau nicht auf die Jagd gehen, keine Pfähle einrammen und keine jungen Fische essen. Um die Geburt zu erleichtern, legt ein sorgsamer Ehemann während der Schwangerschaft seiner Frau seine Schnitzarbeit in Hirschhorn bei Seite; auch reisst er keinen Kattun, um sich ein Kleidungsstück herzustellen.
In der ersten Zeit ihrer Schwangerschaft geht die Kajanfrau ihrer gewohnten Arbeit im Hause und auf dem Felde nach. Sobald ihre Körperform im dritten oder vierten Monat auffallend wird, bedeckt sie zuerst den Leib und dann auch die Brust mit einem Tuche (djat butit).
Bei der Entbindung dürfen nur Frauen zugegen sein. Die Männer werden schon beim Beginn der Wehen aus dem Gemache entfernt und mit ihnen auch alle eisernen und schneidenden Gegenstände—wahrscheinlich um die Kindesseele nicht zu erschrecken. Die Mutter gebiert in hockender Stellung. Ist das Kind zur Welt gekommen, so schneidet ihm eine der Hilfe leistenden Alten mit einem Schwerte den Nabelstrang durch, nachdem er in einer Entfermung von 4 cm [70] vom Kinde unterbunden worden ist. Dieses Schwert, das nie verkauft werden darf, wird als altes Familienstück pietätvoll bewahrt. Die Nachgeburt wird in den Wald geworfen und dort in der Regel von Schweinen und Hunden aufgefressen.
Da die Kajanfrauen alle gut gebaut sind und Rhachitis nicht vorkommt, verläuft eine Entbindung gewöhnlich normal. Die Geburtshelferinnen sind auch nicht im stande, bei anormaler Kindeslage öder bei Blutungen Hilfe zu leisten; nur das Reiben des Leibes ist gebräuchlich. Als grosse Merkwürdigkeit wurde mir erzählt, dass eine Frau aus Pagong einst den prolabierten Uterus einer Wöchnerin mit gutem Erfolge zurückgestülpt hatte.
Einige bei den Kajan verbreitete Krankheiten, gonorrhoeische Endometritides und Lises, können jedoch dem Verlauf der Geburt eine ernste Wendung geben. Hilft sich die Natur nicht selbst, so hat jede Abweichung Tod oder schweres Leiden zur Folge. Berücksichtigt man, dass die Kajan den bei der Geburt sterbenden Frauen kein ehrenvolles Begräbniss und glückliches Leben im Jenseits zugestehen, so ist die Angst, mit welcher diese ihrer Entbindung entgegensehen, begreiflich. (Näheres f. Kap.).
Tot- und Frühgeburten sind so häufig, dass die Frauen nicht wissen, wie lange eine normale Schwangerschaft eigentlich dauert. Nach dem siebente und achten Monat sah ich besonders viele unausgetragenen Kinder zur Welt kommen. Abortus ist ebenfalls eine häufige Erscheinung, aber nur als Folge von Krankheit. Für künstliche Fruchtabtreibung besitzen die Kajan und, wie es scheint, auch die übrigen Dajak, im Gegensatz zu den Malaien, absolut kein Mittel.
Wenn die Mutter bei der Geburt stirbt oder schwer erkrankt oder böse Träume die Eltern erschrecken, setzt der Vater das Kind im Walde aus; es wird aber häufig von anderen Kajan oder Malaien aufgenommen und erzogen.
Unmittelbar nachdem das Kind gewaschen ist, werden seine Ohrläppchen von einer alten Frau mittelst scharf zugespitzter Bambusstäbchen durchstochen. Die Hölzchen bleiben bis zur Heilung der Wunde in der Öffnung, werden dann aber durch einen Zinnring, dessen Schwere das junge Gewebe ausrecken soll, ersetzt. Je grösser die Öffnung wird, desto mehr Ringe werden angebracht, so dass fünf- bis sechsmonatliche Kinder bereits 200 g Zinn an jedem Ohre tragen. Um ein Durchreissen der Ohrläppchen zu verhindern, ist den Müttern [71] in der ersten Zeit verboten, Fische zu essen, die mit einem Angelhaken gefangen worden sind.
Weitere Verbildungen werden mit den Neugeborenen nicht vorgenommen.
Gleich nach der Geburt erhält das Kind ein Armband (le̥ku lali = geweihtes Armband) aus bua dje̥le̱, den hellbraunen und schwarzen Früchten von Coix-Arten, welche auf die bösen Geister abschreckend wirken sollen. Beim Abfallen des Nabelstranges wird dieses Armband durch ein zweites ersetzt und dieses wiederum nach Ablauf eines Monats bei der ersten Namengebung durch ein drittes. Die abgelegten Armbänder des Kindes werden von der Mutter bis zur ersten und zweiten Namengebung an einer Halskette getragen, nach Schluss der betreffenden Verbotszeiten aber in einem Säckchen aus Kattun an das Kindertragbrett gebunden (pag. 72).
Die Kinder werden nicht gewickelt, sondern liegen völlig nackt auf einer mit Tüchern oder einer kleinen Matratze bedeckten Matte. Ein langes schmales Tuch, dessen Enden über einem Balken geknüpft werden, dient als Wiege, indem man das Kind in dem Bausch, welchen das Tuch bildet, schlafen legt.
Zum Herumtragen der Kinder besitzen die Kajan die sehr praktische hăwăt, die am Mendalam aus einem Liegebrett in Form eines beinahe völlig aufgeschlagenen Buches und eines senkrecht dazu angebrachten Sitzbrettes besteht. Solange das Kind sehr klein ist, trägt es die Mutter mittelst zweier um die Schultern gehängter Schnüre liegend vor sich auf der hăwăt; ist das Kind grösser, so trägt es die Mutter sitzend auf dem Rücken. Als weiche Unterlage für das Kind werden auf den Boden der hăwăt einige Tücher gelegt.
In Anbetracht, dass das Kind einen grossen Teil des ersten Lebensjahres auf der hăwăt verbringt, nehmen die Bahau an, dass auch dessen Seele (bruwā) mit dem Tragbrett eng verbunden ist und dieses ötters als Aufenthaltsort wählt. Um nun eine ständige Verbindung mit dem Kinde und dessen Seele zu unterhalten, versäumen die Mütter niemals, ihre Kleinen morgens und abends in innige Berührung mit der hăwăt zu bringen. Sie tun dies, indem sie einen Finger des Kindes in eine Schlinge aus Lianenfasern, welche an der hăwăt befestigt ist, stecken, ihn hin- und herbewegen und einige Worte dazu murmeln. Die Kindesseele wird durch diese Handlung aufgefordert, in ihren eigentlichen Wohnsitz zurückzukehren; eine längere Abwesenheit oder [72] ein gänzliches Fortbleiben der Seele hat nämlich Krankheit bzw. Tod des Kindes zur Folge. Der Vorgang wird mit njina bezeichnet. An jeder hăwăt hängen drei bis vier derartiger Schlingen und zwar sind sie alle an Häkchen aus dem Holz von Fruchtbäumen befestigt, für die die Seelen und Geister eine grosse Vorliebe haben sollen.

Kindertragbrett (hăwăt) der Kajan am Mendalam.
Verschiedene andere Gegenstände, welche ebenfalls an der hăwăt angebracht werden, haben den Zweck, die guten Geister für das Kind günstig zu stimmen und die bösen zu vertreiben.
Wie an der hăwăt auf nebenstehender Tafel zu sehen, hängt an ihrer Aussenseite eine Schnur mit vielen, kleinen, runden Päckchen; sie werden kawit (Kap. VI) genannt und enthalten allerhand Esswaren zur Anlockung der guten Geister. Bei jeder wichtigen religiösen Zeremonie, die im Laufe des Jahres stattfindet, wird ein derartiges Opferpäckchen an der hăwăt befestigt und hängen gelassen.
Neben diesen kawit befinden sich fünf verschiedene Schalen von Schnecken und Seetieren, die alle an Schnüren mit Perlenverzierungen hängen und ein beliebtes Mittel zur Vertreibung böser Geister bilden. Dem gleichen Zweck dient auch ein Bündel ble̥hiding, der Bast einer beim Verbrennen entsetzlich riechenden Anonacee.
Die zwei in der Mitte an der hăwăt hängenden Läppchen stellen die ersten Kleidungsstücke des Kindes vor.
An der zweiten, über der ersten hängenden Schnur sind, als Lockmittel sowohl für die Seele des Kindes als für die guten Geister, an Perlenschnüren zwei aus Muschelschalen geschliffene Knöpfe und ein europäischer weisser Porzellanknopf befestigt, ausserdem eine Reihe kleiner Geschenke (usut), bestehend aus kleinen Schnüren aus Lianenfasern mit Perlen von verschiedenem Werte; letztere sollen besonders zur Beruhigung der Kindesseele dienen.
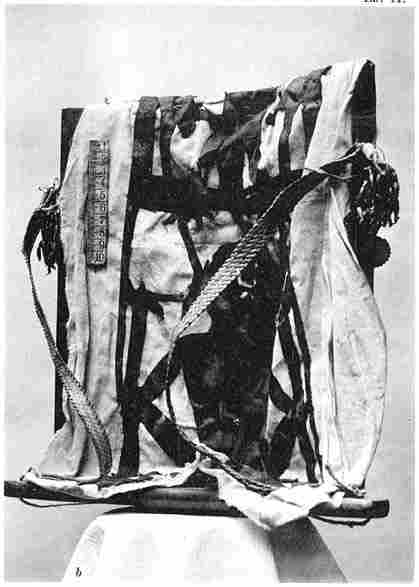
Kindertragbrett (hăwăt) der Kajan am Mendalam.
An der gleichen Schnur hängen ferner: ein Hundezahn zur Abwehr böser Geister; das erste Armband des Kindes und zwei aus Pandanusblättern (tika) geflochtene Streifchen (pag. 74).
Endlich werden an die hăwăt auch noch die vorhin erwähnten geweihten Armbänder des Kindes und die Halsketten, welche die Mutter nach Ablauf der Verbotszeiten, gelegentlich der ersten und zweiten Namengebung, ablegt, gebunden.
Die Kajan freuen sich über die Geburt von Mädchen mehr als über die von Knaben; denn diese verlassen die Eltern, wenn sie heiraten oder weite Reisen unternehmen, jene dagegen helfen häufig [73] während ihres ganzen Lebens bei der Arbeit und bringen ausserdem einen Schwiegersohn ins Haus.
Die Neugeborenen werden in den ersten Monaten ausschliesslich mit Muttermilch genährt; kann die Mutter diese nicht geben, so hilft eine andere Frau. Aus Gesundheitsrücksichten ist der Stillenden nur weich gekochter Reis als Nahrung erlaubt; scharfe Speisen darf sie nicht geniessen und im ersten Jahr auch nicht rauchen oder Betel kauen.
Die ersten zehn Tage ist der Wöchnerin jede Arbeit verboten; dann beginnt sie sich innerhalb des Hauses mit dem Haushalt und der Pflege des Kleinen zu beschäftigen.
Wöchnerin und Kind werden in den ersten Tagen zum Schutz gegen Krankheit mit dem Russ von Damaraharz eingerieben. Ausserdem darf, solange der Nabelstrang noch nicht abgefallen ist, ausser den Hausbewohnern niemand das Gemach betreten, da das Kind sonst krank werden könnte; als Warnungszeichen hängen zwei gekreuzte Holzstückchen vor der Tür. Der abgefallene Nabelstrang wird sorgfältig in ein Tuch gewickelt und in einem Bambusbehälter aufbewahrt; er bildet mit den Gerätschaften, die zum Durchstechen der Ohrläppchen und Durchschneiden der Nabelschnur dienten, den Grundbestandteil des le̥gén, einer Sammlung aller Gegenstände, die im Leben des Kajan eine Rolle gespielt haben. Das le̥gén wird nach dem Tode des Besitzers unter dem Wohnungsdache verborgen und als lālí (geweiht) seinem Schicksal überlassen. (Siehe Kap. VI).
In den ersten Monaten dürfen die neugeborenen Kinder nicht aus dem Hause gebracht oder im Fluss gebadet werden, eine Sitte, die für die unbekleideten Wichte nur zuträglich sein kann.
Vor Ablauf des ersten Jahres geht die Mutter nicht aufs Reisfeld; während dieser Zeit setzt sie das Stillen fort, bis die Milchabscheidung von selbst oder infolge einer neuen Schwangerschaft aufhört. Im dritten oder vierten Monat beginnt die Mutter dem Kinde etwas Bananen und dann weich gekochten Reis zu essen zu geben.
Die Mutter muss sich, hauptsächlich während des ersten Monats, solange das Kind noch keinen Namen erhalten hat, einer langen Reihe von Verbotsbestimmungen unterwerfen, welche sich vor allem auf Essen und Trinken, Arbeiten u.s.w. beziehen. Auch dürfen Mutter und Kind keinen Putz und besonders nichts Rotes tragen. Für die Ausstattung der Kleinen wird vorzugsweise gebrauchtes Material benutzt, selbst die hängende Decke aus Palmblättern über dem Schlafplatz muss bereits [74] gedient haben. Weiter verlangt die adat, dass bei jeder Mahlzeit dem Kinde etwas Speise auf dem uwit lāli (geweihten Teller) gespendet werde; auch muss die Mutter sich nach dem Essen stets für kurze Zeit entfernen.
Auch die Väter haben nach der Geburt ihres Kindes verschiedene Vorschriften zu befolgen, sie dürfen sich in der ersten Zeit z.B. nicht weit vom Hause entfernen.
Um ihr Kind vor bösen Geistern zu schützen, trägt die Mutter verschiedene Amulette: um den Kopf ein schlichtes Band aus den Blättern einer Pandanusart, an denen long, Stückchen des Wurzelstockes von daun long (Aroïdeae spec.) befestigt sind; letztere Pflanze gilt als sicherstes Schreckmittel gegen böse Geister. Um den Hals trägt sie eine Kette aus den Früchten von drei Pflanzen (Coix-Arten) und aus verschiedenen Muschelarten. Begiebt sich die Mutter mit dem Kinde auf die Galerie oder in den folgenden Monaten ausserhalb des Hauses, so nimmt sie stets ein brennendes Bündel ple̥hiding mit, dessen unangenehmer Geruch die bösen Geister in die Flucht schlägt.
Nach Ablauf des ersten Monats findet die erste Namengebung des Kindes statt; sie ist nur provisorisch, denn den eigentlichen Namen erhält das Kind erst bei dem nächsten dangei (Neujahrsfeste). Ein namenloses Kind heisst hăpăng; stirbt es, so wird ihm nicht öffentlich nachgetrauert.
Mit der ersten Namengebung endet die erste, strengste Verbotszeit; die Mutter darf jetzt ihre früheren Tätigkeiten, wie z.B. das Mattenflechten, wieder aufnehmen; als symbolisches Zeichen hierfür flicht sie einen Streifen, der an die hăwăt gebunden wird.
Man findet bei allen Stämmen von Mittel-Borneo die Eigentümlichkeit, dass sie Fremde nur mit Angst in die Nähe kleiner Kinder kommen sehen; bei den Punan darf niemand, der die Sprache des Stammes nicht kennt, ein Kind anrühren, da dieses sonst dumm werden muss. Bei den Kajan bringt jeder Fremde bei seinem ersten Eintritt in eine Wohnung, in der sich ein kleines Kind befindet, ein Geschenk (usut) von Perlen oder etwas Zeug mit; augenscheinlich liegt dieser Sitte die Überzeugung zu Grunde, dass die Seele des Kindes, die durch die neue Erscheinung erschreckt worden ist, durch etwas Schönes wiederum beruhigt werden muss; geschieht dies nicht, so entflieht die Seele und das Kind wird krank.
Bei der zweiten Namengebung wird den Geistern durch die Priester [75] ein Opfer von Schweinen und Hühnern gebracht; das Fleisch der Tiere wird bei fröhlichem Festmahl mit Freunden und Bekannten verzehrt. Darauf bringt man den jungen Weltbürger in die Wohnung des Häuptlings. Die sehr schlicht gekleidete Mutter trägt auf dem Kopfe einen schmucklosen und mit kāwit versehenen Hut, haung lāli (geweihter Hut); in der Hand hält sie eine Bambusklapper und ein Bambusgefäss mit Wasser, in dem von dem Häuptling die Füsse des Kindes gebadet werden. Das Kind erhält hierbei den Namen, mit dem es weiter genannt werden soll.
Bei der Wahl der Namen vermeidet man diejenigen kürzlich verstorbener Familienglieder, wahrscheinlich um deren Seelen nicht zu beunruhigen und auf das Kind abzulenken, was diesem schaden könnte. Gewöhnlich nennt man das Kind nach sehr alten oder bereits vor langer Zeit verstorbenen Verwandten.
Leidet ein Kind öfters an Krankheit, so verändert man seinen Namen, sobald es ihm wieder besser geht, um die bösen Geister, die es so häufig besuchen und dadurch krank machen, irre zu leiten.
Einige allgemeine Bemerkungen über Namengebung und Namenänderung bei den Bahau mögen hier eingeflochten werden.
Familiennamen existieren bei den Bahau nicht. Will man eine bestimmte Person bezeichnen, so fügt man ihrem eigenen Namen denjenigen von Vater oder Mutter bei; eine besondere Bestimmung hierüber ist mir nicht bekannt. Tipong Igau z.B. bedeutet: Tipong, die Tochter des Igau (Name des Vaters); Adjang Song bedeutet: Adjang, der Sohn der Song (Name der Mutter). Die Kinder behalten die Namen der Eltern auch nach deren Tode.
Wird bei den Bahau ein Mann Vater eines Sohnes, der Bang oder einer Tochter, die Kehad genannt wird, so verliert er meistens seinen eigenen Namen und man bezeichnet ihn fortan als: Vater des Bang bzw. Vater der Kĕhad. Bei den Mendalam Kajan z.B.: Amei (Vater) Bang oder Amei Kĕhad. Die Mutter wird dementsprechend Inei (Mutter) Bang bzw. Inei Kĕhad genannt. Bei den Pnihing heissen die Eltern in diesem Fall: Amun (Vater) Bang bzw. Kĕhad und Hinan (Mutter) Bang bzw. Kĕhad; am Mahakam in der Busang Sprache: Taman (Vater) Bang bzw. Kĕhad.
Sobald jedoch das erstgeborene Kind stirbt, nehmen die Eltern wieder ihren früheren Namen an; so wurde der Kĕnjahäuptling Taman Kuling (= Vater der Kuling) nach dem Tode seiner Tochter [76] Kuling wieder Djalong genannt und zwar mit dem Beinamen “Bui”, der die gleiche Bedeutung wie “Ujung” (siehe unten) bei den Mendalam Kajan hat.
Gewisse Familienereignisse werden bei den Bahau durch bestimmte Beiworte, welche den Eigennamen der Personen vorangesetzt werden, angedeutet. Bei den Mendalam Kajan sind die folgenden gebräuchlich:
Balo, wenn der Mann gestorben ist, z.B. Balo Paja = Wittwe Paja; Hawal, wenn die Frau gestorben ist, z.B. Hawal Igau = Wittwer Igau; Akam, wenn ein kleines Kind gestorben ist, z.B. Akam Igau; Ujung, wenn ein fast erwachsenes Kind gestorben ist, z.B. Ujung Igau; Hiat, wenn ein jüngerer Bruder oder eine jüngere Schwester gestorben ist, z.B. Hiat Bang; Abel, wenn ein älterer Bruder oder eine ältere Schwester gestorben ist, z.B. Abel Imu.
Für die gleichen Familienverhältnisse findet man bei den verschiedenen Stämmen verschiedene Bezeichnungen.
Sobald Männer und Frauen alt und grau werden, erhalten sie vor ihrem eigentlichen Namen die Bezeichnung “Bo”, z.B. Bo Bĕlarè, Bo Uniang.
Eigentümlicher Weise erhalten besonders vornehme Häuptlinge nach ihrem Tode ganz andere Namen, als sie zu Lebzeiten getragen. Man bezeichnet diese Namenänderungen mit “ge̥lo̤̱n”. So nannte man am Mahakam den Long-Glathäuptling Ding nach seinem Tode Bo Kulè und seinen Sohn Ngau nach dem Tode Bo Langit. Die Kajan am Mahakam sprechen jetzt von dem Häuptling Kwing Irang, unter dessen Anführung sie vor 150 Jahren an den Mahakam zogen, stets nur als von Singa Mĕlön.
Nach der zweiten Namengebung dürfen die Kinder schön gekleidet werden, auch geniessen sie bis zur Pubertät das Vorrecht, den zahlreichen Verbotsbestimmungen, welche für Erwachsene bestehen, nicht unterworfen zu sein. Sie dürfen z.B. Hirsche, graue Affen, Schlangen und Nashornvögel essen; auch werden ihnen bei religiösen Festen keine Beschränkungen auferlegt. Sie brauchen sich auch nicht die Wimpern und Augenbrauen zur Verschönerung ausziehen zu lassen, kurz, sie geniessen in jeder Beziehung einer grossen Freiheit.
Vater und Mutter widmen sich der Erziehung ihrer Kinder mit viel Liebe. Sobald die Sprösslinge einmal zur Welt gekommen sind, machen sie sich zum Mittelpunkt des ganzen Kajanhaushaltes. Die elterliche Zuneigung wird von den Kindern übrigens erwidert und es ist auffallend, wie selten sie zu Züchtigungen Anlass geben; man hört [77] sie eigentlich nur bei Krankheit schreien. Treibt die Jugend es gar zu arg, so halten die Eltern eine Bestrafung der Schuldigen mit ein paar Schlägen oder einer Strafrede wohl auch für angebracht. In einigen Fällen, die ich miterlebte, kam es jedoch nicht bis zum Weinen; die Wirkung der Strafe zeigte sich nur in einem etwas erschreckten Gesichtsausdruck der Kleinen.
Schon die 1½–2 jährigen Kinder gehen, wenn sie im Freien spielen, gewöhnlich bekleidet umher: die Knaben tragen das Lendentuch, die Mädchen das Röckchen; die meisten halten jedoch Kleidungsstücke fair unnützen Ballast und ziehen im Hause und nach dem Bade Adams Kostüm vor.
Die Hauptbeschäftigung der Knaben bilden Spiele im Freien und im Wasser; Ringkampf, Wettlauf und Schwimmen sind am beliebtesten; den Kampf in zwei Parteien üben sie nur in der Art, dass sie sich gegenseitig mit Lanzen aus Grashalmen bewerfen. Dem Kreiselspiel, Blasrohrschiessen und ähnlichen Vergnügungen widmen sich die Knaben, im Gegensatz zu den erwachsenen Männern, auch ausserhalb der Zeit der Ackerbaufeste. Ein beliebtes Spiel ist auch das Zielen mit platten Flusssteinen nach Erdgruben.
Bei keinem dieser Spiele macht sich Ehrgeiz oder Neid geltend; die Knaben spielen um zu spielen, nicht um als Sieger aus dem Spiel hervorzugehen.
In den ersten Jahren spielen Knaben und Mädchen zusammen; später unterhalten sich die Mädchen mehr innerhalb des Hauses, wo sie schon früh der Mutter an die Hand gehen. Puppen scheinen nur zum Stillhalten sehr kleiner Kinder benutzt zu werden.
Weder Knaben noch Mädchen erhalten einen systematischen Unterricht in irgend einem Fache. Während diese allmählich den Haushalt besorgen lernen, ziehen jene vom zehnten Lebensjahr an mit aufs Feld, helfen beim Bau von Böten, beim Fischen und bei allen sonstigen Arbeiten, mit denen sich die Männer beschäftigen.
Je nach ihrer eigenen Anlage und nach der Haupttätigkeit ihrer Eltern, beginnen die Kinder in der einen oder anderen Richtung allmählich eine gewisse Fertigkeit zu erlangen.
Da bei den Kajan keine erblichen Berufe bestehen, kann sich jeder nach eigener Wahl ausbilden, wenn nicht besondere Umstände, wie Krankheit, gezwungene Arbeit zum Unterhalt der Familie u.s.w., ein Hindernis bilden. [78]
Die Pubertät tritt bei den Mädchen ungefähr mit zwölf Jahren, bei den Knaben etwas später ein und bringt in ihre Lebensverhältnisse wichtige Veränderungen. Vor allem sind sie nun den Vorschriften, welche die adat den Erwachsenen auferlegt, hauptsächlich Verbotsbestimmungen bezüglich des Essens verschiedener Speisen, unterworfen. Ferner beginnen sie sich in diesem Lebensalter mit eigenartigen Verzierungen und Verbildungen des Körpers zu schmücken.
Beide Geschlechter lassen sich die Schneidezähne vorn hohl ausfeilen; einige treiben sich ausserdem, nach Sitte einiger Punan, goldene Stifte durch die Zähne. Die meisten fangen jetzt auch mit dem Schwärzen der Zähne und dem Betelkauen an.
Mit eintretender Geschlechtsreife wird an Knaben und Mädchen die eigentliche Tätowierung vorgenommen; jene lassen sich anfangs nur einen Stern auf der Schulter oder eine einfache Figur auf dem Arm ausführen; die übrigen Verzierungen erhalten sie erst, wenn sie durch weite Reisen oder durch Teilnahme an einer Kopfjagd Beweise ihrer Tapferkeit geliefert haben.
Für die Frauen bildet die Tätowiersitte eine wahre Marter, der sie sich aber mit staunenswerter Opferwilligkeit unterwerfen. Die Kajanfrauen am Mendalam lassen sich den unteren Teil des Unterarms, die Hand, den ganzen Schenkel bis unterhalb des Knies und den Fussrücken mit prachtvollen Tätowiermustern bedecken. Die tätowierten Teile erscheinen wie mit einem dichten, dunkel blauen Netz überzogen.
In der Entfernung verschwinden die Einzelheiten der oft künstlerisch schönen Muster, man erhält dann den. Eindruck, als trügen die Frauen blaue Trikots. Bei Frauen mit lichtgelber Hautfarbe treten die Figuren auf den der Sonne weniger ausgesetzten und daher helleren Schenkeln besonders schön hervor.
Die jungen Männer haben zwar durch die Tätowierung; weil sie bei ihnen nur in beschränktem Masse ausgeführt wird, viel weniger als die Frauen zu leiden, dafür müssen sie sich aber, um ihre volle Männlichkeit zu erlangen, einer anderen Prüfung unterwerfen, nämlich der Durchbohrung der glans penis. Bei dieser Operation wird folgendermassen verfahren: Zuerst wird die glans durch Pressen zwischen den beiden Armen eines umgeknickten Bambusstreifens blutleer gemacht. An jedem dieser Arme befinden sich einander gegenüber an den erforderlichen Stellen Öffnungen, durch welche man, nachdem die glans weniger empfindlich geworden, einen spitzen kapfernen Stift [79] hindurchpresst; früher benutzte man hierfür ein zugespitztes Bambushölzchen. Die Bambusklemme wird entfernt und der mittelst einer Schnur befestigte Stift in der Öffnung gelassen, bis der Kanal verheilt ist. Später wird der kupferne Stift (utang) durch einen anderen, meist durch einen zinnernen, ersetzt, der ständig getragen wird, nur in schwerer Arbeitszeit oder bei anstrengenden Unternehmungen macht der metallene Stift einem hölzernen Platz.
Besonders tapfere Männer geniessen mit dem Häuptling das Vorrecht, um den penis einen Ring tragen zu dürfen, der aus den Schuppen des Schuppentieres geschnitten und mit stumpfen Zacken besetzt ist; bisweilen lassen sie sich auch, gekreuzt mit dem ersten Kanal, einen zweiten durch die glans bohren.
Ausser den Kajan selbst, üben auch viele Malaien vom oberen Kapuas diese Kunst aus. Die Schmerzen bei der Operation scheinen keine sehr heftigen zu sein, auch hat sie nur selten schlimme Folgen, obgleich bis zur Genesung oft ein Monat vergeht.
Mit den Genitalien der Frauen werden keine Veränderungen vorgenommen.
Die jungen Männer lassen sich ferner, um ihre Unempfindlichkeit gegen Schmerz zu beweisen, Stückchen Damaraharz auf der Haut verbrennen. Diese Feuerproben hinterlassen eigentümliche runde Narben; sie werden in der Regel in einer Reihe angebracht und betragen im Durchmesser bis zu 1 cm.
Die jungen Leute beginnen zu dieser Zeit auch mehr Sorgfalt auf ihre Kleidung und auf ihr sonstiges Äussere zu verwenden; die jungen Mädchen ziehen sich bis auf das Kopfhaar alle Haare am Körper aus; die jungen Männer entfernen Wimpern, Augenbrauen und Bart (Siehe Kap. VII).
Auch mit dem Erlernen der Künste fangen Männer und Frauen erst nach der Pubertät an; diese legen sich auf das Flechten von Matten und das Ausführen von Perlenarbeiten; jene erlernen die Holz- und Knochenschnitzerei, das Entwerfen von Mustern für Verzierungen aller Art u.s.w.
Gleichzeitig mit den körperlichen Veränderungen, welche mit beiden heranwachsenden Geschlechtern vor sich gehen, wächst auch ihr Streben, das gegenseitige Wohlgefallen zu erregen. Das Verfertigen von Geschenken nimmt einen grossen Teil der freien Zeit der jungen Leuten in Anspruch; die Mädchen arbeiten aus Perlen Halsketten, Schwertgürtel [80] und Zierate für die Schwertscheiden und führen auf Palmblättern Stickereien für Hüte und kleine Gegenstände aus; die Männer erwidern die Geschenke mit schön geschnitzten Bambusgefässen, Flöten, Rudern und Messergriffen, oder sie schneiden den Mädchen aus Zeug hübsche Figuren als Belege für Hüte und Kleider aus. So haben beide Teile Gelegenheit, bei ihren Liebesbestrebungen in Kunstfertigkeit zu glänzen. Geld oder Wertgegenstände schenken sie sich nur selten.
Die erwachsenen jungen Mädchen verlassen die elterliche Wohnung nur, um aufs Reisfeld zu gehen oder Verwandte in benachbarten Niederlassungen zu besuchen; weitere Reisen unternehmen sie nicht. Für die erwachsenen jungen Männer dagegen beginnt jetzt die Zeit, wo sie ihre Eltern verlassen, um lange Reisen zu Handelszwecken, zum Buschproduktesammeln oder zum Besuch von Familiengliedern bei verwandten Stämmen zu unternehmen.
Die Kajan sind im Gegensatz zu den Malaien und benachbarten Stämmen von einem lebhaften Arbeitsdrang erfüllt. Ihre Arbeitsamkeit fiel nicht nur mir, sondern auch Akam Igau auf, denn er bemerkte mir gegenüber, dass die Lebhaftigkeit und der Tatendrang der Kajan zum Unterschied von den benachbarten Taman die Aufmerksamkeit der Geister zu sehr auf sich zögen und dass sie deshalb von Krankheit mehr heimgesucht würden als jene. Der Unterschied zwischen den beiden Stämmen ist allerdings auffallend.
Für die Frauen bildet das Reisstampfen (te̥pă) die wichtigste der häuslichen Arbeiten; Männer nehmen nur selten an ihr Teil. Gewöhnlich stampfen zwei Frauen gleichzeitig in dieselbe Vertiefung des Reisblockes (le̥so̱ng), welcher deren zwei bis sechs besitzt. Bei den Mendalam Kajan stehen die Frauen beim Stampfen auf dem Block selbst und schieben den bespelzten Reis mit den Füssen allmählich in das Loch; bei anderen Stämmen, wie den Pnihing, stehen die Frauen neben dem Block und gebrauchen die zweite Hand, um den Reis in das Loch zu schieben. Der Reis wird öfters zweimal gestampft; die Körner bleiben dabei heil und werden mittelst einer Art Schwinge von den Spelzen befreit.
Ausgenommen vor grösseren Unternehmungen, wird des Reis nur in kleinen Mengen für einige Tage gestampft, damit er nicht verderbe. Am beliebtesten sind die feinen Reisarten mit langem schmalem Korn; die groben Arten werden an die Händler verkauft. Es werden viele verschiedene Arten und Varietäten des Reises gebaut. Ichselbst [81] beobachtete 18 Arten des gewöhnlichen Reises, pārei (Oryza sativa) und 12 Arten von Klebreis, púlut (Oryza sativa var. glutinosa).
Die Zubereitung der Speisen ist ebenfalls ausschliesslich Arbeit der Frauen, doch verstehen auf Reisen auch die Männer sehr gut mit dem Kochtopf umzugehen.
Kăne̥n, in Wasser ohne Salz gekochter Reis, bildet bei jeder Mahlzeit das Hauptgericht und wird jedem gesondert auf einem Bananenblatt gereicht.
Bei Festmahlzeiten geniessen die Kajan statt des gewöhnlichen Reises Klebreis, den sie auf verschiedene Weise zubereiten. Entweder wickeln sie ihn in bestimmte Bananen- oder Palmblätter und kochen ihn in Wasser oder sie rösten ihn. Der geröstete und nachher zu grobem Mehl gestampfte Klebreis wird ke̥rtap genannt und bildet, besonders in Verbindung mit rohem oder eingedampftem Zuckerrohrsaft, einen geschätzten Leckerbissen. Am Mendalam, wo grosser Fischreichtum herrscht, wird Fischfleisch stets als Zuspeise zum Reis genossen. Meist werden die Fische in Wasser gekocht; die Suppe wird in besondere Schälchen oder hölzerne Teller (uwit) gegossen und mit einem gefalteten Bananenblatt als Löffel gegessen. Falls ein Kessel nicht vorhanden ist, werden die Fische geröstet.
Alle Fleischarten werden auf die gleiche Weise wie der Fisch zubereitet; der Bratprozess ist gänzlich unbekannt, obgleich das hierfür geeignete Tengkawang Fett vielfach vorkommt und auch als Zuspeise verwendet wird. Zahme Schweine und Hühner werden nur bei religiösen Festmahlzeiten genossen, während Wild auch an gewöhnlichen Tagen als Zuspeise gegessen wird. Salz wird niemals beim Kochen hinzugefügt, sondern stets nur als Leckerbissen in kleinen Stückchen nebenbei gereicht.
Als Würze für die Speisen dienen verschiedene essbare Blätter; am beliebtesten sind die Blätter der Bataten (Ipomoea Batatas) und die jungen Farnspitzen von Polypodium nigrescens Bl.
Für lange Reisen, oder wenn Zeit und Gelegenheit zum Kochen fehlen, nimmt man in Bambusgefässen oder in Palmblättern gerösteten Klebreis, unverändert oder in Form von grobem Mehl, mit; er kann wochenlang aufbewahrt werden, ohne zu verderben.
Die Kajan essen in gewöhnlichen Zeiten zweimal täglich und zwar, je nach Umständen, vor oder nach dem Gang zum Reisfeld und mittags nach der Heimkehr um vier oder fünf Uhr. Bei Nahrungsmangel [82] oder wenn sie still zu Hause sitzen, begnügen sie sich bisweilen mit einer einzigen Mahlzeit gegen zwölf Uhr; bei Überfluss an Reis oder schwerer Arbeit dagegen wird ihr Magen anspruchsvoller und verlangt dreimal täglich Zufuhr.
Bei den Mahlzeiten sitzen alle Familienglieder im Kreise neben einander; eine Rangordnung wird nicht beobachtet.
Die Kajan sind, wie alle Bahau und Kĕnja, sehr mässig im Essen und Trinken. Das tägliche Getränk besteht in Wasser und nur bei grossen Versammlungen und Festen wird tuwak, gegohrener Reiswein, getrunken. Die Stämme am Mendalam geniessen den Branntwein überhaupt nur an einem Tage des Jahres, beim Neujahrsfest; sie stellen ihn aus gekochtem Klebreis her, den sie zwei bis drei Tage in grossen Töpfen gähren lassen.
Am oberen Mahakam machte ich kein Neujahrsfest mit und sah daher auch keinen tuwak trinken, ich vermute jedoch, dass auch diese Bahau das Getränk kennen, da ich bei ihren Verwandten, den Kĕnja Uma-Tow, zur Begrüssung bei öffentlichen Zusammenkünften öfters grosse Töpfe tuwak leeren sah.
Die Kĕnja bereiten auch aus Zuckerrohrsaft ein alkoholisches Getränk; ausserdem trinken sie den Honig von wilden Bienen. Der häufigere oder seltenere Gebrauch derartiger Getränke scheint mit dem grösseren oder geringeren Überfluss an Lebensmitteln, dessen sich die verschiedenen Stämme erfreuen, im Zusammenhang zu stehen. Jedenfalls aber werden alkoholische Getränke weder bei den Bahau noch bei den Kĕnja regelmässig genossen und Missbrauch wird mit ihnen nie getrieben, auch scheinen ihnen die Alkoholika, nach den verzerrten Mienen zu urteilen, die ich beim Trinken beobachtete, nicht einmal sonderlich zu munden.
Eigentümlicher Weise ist das Tabakrauchen der Bevölkerung von Mittel-Borneo schon längst bekannt, während das Betelkauen erst vor kurzem durch die Malaien bei einigen Bahaustämmen eingeführt worden ist. Die Erscheinung ist um so auffallender, als das Betelkauen bei der Küstenbevölkerung das grösste Genussmittel bildet.
Bei den Mendalam Kajan wird die Sitte des Tabakrauchens immer mehr durch die des Betelkauens verdrängt. Der Tabak, den sie hierzu gebrauchen, stammt aus Java; zwar pflanzt die Bevölkerung auch eigenen Tabak, sie versteht ihn aber nur durch Trocknen und Schneiden zuzubereiten und verwendet ihn nur zum Rauchen in Zigaretten. [83]
Unter den Mahakamstämmen kaut bei den Long-Glat jung und alt Betel und raucht Tabak; bei den Kajan rauchen alte Männer und Frauen noch ausschliesslich, während die jüngeren auch Betel kauen; die Pnihing, bei denen nur das Rauchen gebräuchlich ist, bauen den Tabak selbst und lassen ihn, indem sie ihn feingeschnitten lange Zeit in Bambusgefässen fest zusammengepresst aufbewahren, gähren. Auch bei den Kĕnja, die nur das Rauchen kennen, legen sich Männer und Frauen von früher Jugend an auf die feinere Zubereitung des selbst gebauten Tabaks.
Erwähnenswert ist wohl auch noch die Tatsache, dass es auch die Eingeborenen Mittel-Borneos bisweilen nach einem besonderen Genussmittel gelüstet; so beobachtete ich, dass Männer und Frauen, hauptsächlich aber Schwangere, bisweilen im Uferboden nach einem gelblichen oder rötlichen Lehm suchten, der aus verwittertem Schiefer bestand; sie nannten ihn batu ke̥ro̤̱p oder tana ke̥ro̤̱p.
Die jungen Männer und Mädchen geniessen bei den Kajan im Verkehr mit einander die grösste Freiheit. Bemerkenswerter Weise stellt ihre gesellschaftliche Sitte an den männlichen Teil in moralischer Hinsicht die gleichen Anforderungen, wie an den weiblichen; dieses Verhalten stimmt mit der hohen Stellung, welche die Frau auch sonst im Gemeinwesen der Kajan einnimmt, überein. Die jungen Leute haben daher vor der Ehe alle Gelegenheit, einander kennen zu lernen und sich selbst zu prüfen; sie tun dies um so mehr, als eine Heirat bei ihnen als ernsthafte Verbindung aufgefasst wird, die von beiden Seiten Treue heischt. Vor der Heirat dagegen haben beide Geschlechter volle Freiheit, in ihrem Verkehr so weit zu gehen, als ihnen beliebt. Die Eltern versuchen wohl ab und zu ihren Einfluss geltend zu machen, aber meist mit schlechtem Erfolge.
Fassen zwei junge Leute eine Zuneigung zu einander, so bietet ihnen die Sitte für ein ungestörtes Beisammensein zahlreiche Gelegenheiten.
Am beliebtesten sind gemeinsame Fischpartieen. Vor Anbruch der milden Tropennacht, wenn das Mondlicht die Landschaft gerade genügend erhellt, um ihr das Unheimliche der Dunkelheit zu nehmen, schmückt sich der junge Mann mit seiner besten Kleidung, einem breiten blauen Lendentuch und einem bunten, bisweilen seidenen Kopftuch; eine besondere Zierde bilden schwarze Armbänder und Büschel Riechgras, welche er am Kopf und an den Armen befestigt. [84] Sein schönstes, oft mit Geschenken seiner Angebeteten verziertes Schwert an der Seite, mit Ruder und Wurfnetz bewaffnet, eilt der Jüngling zum Flusse, wo er mit kräftigen Ruderschlägen den Kahn bald in die Nähe der Harrenden bringt. Die gleichfalls schön gekleidete Geliebte steigt mit wohlgefüllter Beteldose ins Fahrzeug und setzt sich an das Hinterende des Bootes, um es mit ihrem Ruder zu steuern. Der junge Mann steht mit dem Wurfnetz (djālă) vorn im Kahn und schleudert es da, wo er Fische vermutet, mit kräftigem Schwunge ins Wasser. Ein grosses Netz misst im Durchschnitt 8 m und da es am Rande mit einer Zinn- oder Eisenkette beschwert ist, bedarf es ausser grosser Kraft auch grosser Gewandtheit, wenn das Netz gut ausgebreitet gleichmässig auf die Wasserfläche niederfallen soll. Gar mancher Wurf wird unter den aufmerksamen Blicken der Schönen mit besonderer Anspannung ausgeführt und, beim Fischreichtum dieser Gewässer, selten ohne Erfolg. So treibt das Pärchen den Fluss hinunter; liefert der Fang genügend Fische für eine Mahlzeit, so wird gelandet. In der Regel bildet eine leerstehende Hütte auf dem Reisfeld oder ein trautes Plätzchen unter den hohen Uferbäumen das Endziel der Bootfahrt. Dort stört niemand die Liebenden im Genuss aller Herrlichkeiten, welche die Kunstfertigkeit des Mädchens auf kulinarischem und musikalischem Gebiet zu liefern im stande ist. Die weichen Töne der Nasenflöte geben dem Ganzen einen besonderen Reiz; denn in der Stille der Nacht erwecken diese klagenden, aber lieblichen Laute Empfindungen, für die das sanfte Gemüt der Kajan sehr empfänglich ist.
In Zeiten, wo es am Mendalam unsicher ist, wie z.B. bei meinem Besuche im Jahre 1894, als die Bukat von der Serawakschen Grenze um die Niederlassungen der Kajan herumschwärmten, halten Freunde nachts in der Nähe des Pärchens Wacht. Die Freunde helfen auch später beim Aufrichten eines treppenartig behauenen Pfahls, den der glückliche Jüngling zur Erinnerung an die schöne Nacht beim Häuschen zurücklässt. Einer meiner gewandtesten, aber leichtsinnigsten jungen Leute zeigte mir einst seinen Schlupfwinkel für derartige Liebesfeste mit grossem Selbstbewusstsein; denn er hatte vier solcher Gedenkpfähle aufrichten können. Eine derartige Unbeständigkeit der Gefühle wird aber bei den Kajan, trotz aller Freiheit, welche die jungen Leute geniessen, von der öffentlichen Meinung streng gerügt.
Bisweilen vereinigen sich auch mehrere Pärchen, lassen sich fischend [85] und kosend den Fluss abwärts treiben und kehren nicht vor dem folgenden Mittag zurück.
Auch die gemeinsame Arbeit auf dem Felde bietet den jungen Leuten günstige Gelegenheit, sich kennen zu lernen, besonders wenn die Eltern mit dem Verkehr ihrer Kinder einverstanden sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Standhaftigkeit der Liebenden oft auf harte Probe gestellt.
So erlebte ich einst, dass ein jungen Mädchen, mit ebenso schönem Äusseren als kräftig entwickeltem Willen, ihren Eltern einen Verlobten ins Haus brachte, der diesen nichts weniger als willkommen war, weil er für schwere Feldarbeit und den Bau von Böten noch keine genügende Leistungsfähigkeit besass. Auch nach der mit viel Aufwand von Energie durchgesetzten Heirat, hatte der junge Ehemann alle Mühe, im Hause der Schwiegereltern seinen Platz zu behaupten.
Bei allen Bahau herrscht nämlich die Sitte, dass der junge Gatte zuerst in die Wohnung seiner Schwiegereltern zieht und erst nach drei bis vier Jahren mit der Frau in sein eigenes Haus oder das seiner Eltern übersiedelt. Ist die Frau jedoch im Hause ihrer Eltern einmal entbunden worden, so darf sie dem Manne schon vor Ablauf dieses Termins folgen. Eine Übertretung dieser Sitte gestattet die adat dem jungen Paar nur gegen Bezahlung einer recht bedeutenden Busse. Nur wenn der einzige Sohn des Hauses ein Mädchen aus einer zahlreichen Familie heiratet, kommen die Eltern oft überein, dass die Schwiegertochter von Anfang = an in das Haus des jungen Mannes zieht.
Hie und da findet ein Pärchen in dem Zustand der jungen Frau, bei der die Folgen des freien Verkehrs nicht ausgeblieben, eine etwas unerwünschte Hilfe für die Erlangung der Heiratszustimmung der Eltern. Unter solchen Umständen wird das Verhältnis der jungen Leute baldmöglichst durch eine Heirat besiegelt; denn die Schwangerschaft einer Unverheirateten wird allgemein verurteilt. Ein Mann, der ein Mädchen sitzen lässt, wird sehr schief angesehen. So etwas kommt daher nur höchst selten vor und wird, wenn besondere Umstände eine Heirat unmöglich machen, mit einer ansehnlichen Busse an die Eltern der Verlassenen und den Häuptling gestraft.
Einen derartigen Fall erlebte ich bei meinem zweiten Besuch am Mendalam, als die beiden Häuptlinge in Tandjong Karang und Tandjong Kuda aus persönlicher Feindschaft ihren jungen Untertanen nicht [86] gestatteten, sich mit einem Gliede des anderen Dorfes zu vermählen. Eines der Opfer, ein junges Mädchen, das ich gern hatte und das früher häufig zu mir kam, um sich in meiner Hütte auszuruhen, zeigte sich zwei Monate lang nicht mehr bei mir und als sie zum ersten Mal wieder erschien, wagte sie kaum die Augen aufzuschlagen, obgleich ich mir alle Mühe gab, ihr aus der Verlegenheit zu helfen; auch später besuchte sie mich nur noch einige Male.
Da die Frauen bei der Eheschliessung eine Hauptstimme haben, gehören Verlobungen in kindlichem Alter zu den Seltenheiten.
Obwohl Unverheiratete die grösste Freiheit geniessen und Verheirateten viele Beschränkungen und Pflichten auferlegt werden, nehmen die Kajan auffallender Weise gern das Ehejoch auf sich. Daher sind junge Männer, wenn sie nicht durch weite Reisen daran verhindert werden, mit 25 Jahren beinahe alle verheiratet; Mädchen verheiraten sich meist vor dem zwanzigsten Jahr.
Bei jeder Eheschliessung finden zwischen den beiderseitigen Eltern über die Mitgift und die Summe, welche der junge Mann seinen Schwiegereltern bei der Heirat ausbezahlen muss, Unterhandlungen statt. Leben die Eltern nicht mehr, so werden sie durch Angehörige oder den Häuptling vertreten.
Der Betrag, den der junge Gatte bezahlen muss, ist meist nicht hoch, mit einem Schwert oder einem Gong sind die Schwiegereltern gewöhnlich zufrieden; reiche Häuptlinge dagegen haben bis zu 300 Dollar zu bezahlen.
Polygamie ist am Mendalam nicht Sitte, sie kommt nur bei einigen Häuptlingen am Mahakam vor, die sie kürzlich von den Malaien übernommen haben.
Man sieht es gern, dass beide Teile, die eine Heirat mit einander eingehen, dem gleichen Stande angehören. Häuptlinge verlieren viel an Ansehen, wenn sie sich mit gewöhnlichen Kajan verheiraten und ihre Kinder haben wenig Aussicht, ihre Nachfolger zu werden; dass sie sich jemals mit Leibeigenen verheirateten, hörte ich nie.
Bei den Kajan sind nicht nur Ehen zwischen nahen Blutsverwandten, sondern auch Ehen zwischen angeheirateten Verwandten, wie den gegenseitigen Geschwistern von Eheleuten, verboten. Daher müssen die wenigen Häuptlinge am Mendalam, die aus Standesrücksichten auf Heiraten unter Verwandten angewiesen sind, bei der Eheschliessung eine Busse für die Übertretung der adat bezahlen.
Heiraten zwischen benachbarten, nicht verwandten Stämmen sind [87] zwar nicht verboten, kommen aber so selten vor, dass Taman und Kajan z.B. länger als ein Jahrhundert neben einander leben, ohne sich zu vermischen. Die meisten fremden Männer einer Niederlassung gehören verwandten Stämmen an und halten sich ihrer Heirat wegen für längere oder kürzere Zeit dort auf.
Für die Heirat, insbesondere für die Zeit von der Hochzeit bis zu dem folgenden Neujahrsfeste, bestehen so zahlreiche Verbotsbestimmungen, dass die Kajan, um diese lästige Periode abzukürzen, vorzugsweise kurz vor diesem Feste heiraten.
Bei den gewöhnlichen Kajan verläuft eine Hochzeit sehr schlicht; die Häuptlinge dagegen veranstalten bei der Heirat ihrer Kinder grosse Feste, die zwei bis drei Tage dauern und an denen sich alle angesehenen Dorfbewohner beteiligen.
Die Hochzeit wird im Hause der Braut gefeiert, in welches der Bräutigam durch seine Freunde geleitet wird. Die Wohnung, aus der aller Hausrat vorher entfernt wurde, ist mit Grün und bunten Tüchern festlich geschmückt und die Wände sind mit allem, was die Eltern der Braut dem Geleite des Schwiegersohnes schenken, behängt. Die Freunde haben denn auch das Recht, alles Schöne, das ihnen durch die Freigebigkeit des Häuptlings und die Beiträge der Dorfgenossen angeboten wird, mit sich heim zu nehmen.
Unter den Geschenken, die Braut und Bräutigam einander geben und auch unter denen der Familienglieder, spielen Perlen eine wichtige Rolle. Von dem Bräutigam erhält die Braut zuerst einen taksā hăwă (Gürtel für die Ehefrau), bestehend aus einer Schnur mit vier alten Perlen; beim Hochzeitsmahl findet sie zwei weitere Perlen im Reis; ausserdem erhält sie noch eine besonders schöne Perle, die “ko̱ho̱ gumān” (kumān = essen).
Die Verwandten und Bekannten schenken eine Perlenschnur (dje̱), die so lang als die Braut sein muss und die, je nach der Wohlhabenheit der Geber, einen höheren oder geringeren Wert besitzt.
Mann und Frau sind in der Ehe gleichberechtigt; die Leitung des Hauses gelangt aber auch bei den Kajan in die Hände der stärkeren Persönlichkeit. Wie bereits gesagt, wird von beiden Teilen vollkommene Treue verlangt, auch für den Fall, dass der Mann langdauernde Reisen unternimmt. Ein Treubruch wird schwer bestraft, scheint übrigens selten vorzukommen. Der Mann hat eine höhere Busse zu bezahlen als die Frau. [88]
Der schuldige Teil hat die Busse an die Familie des beleidigten Teils zu entrichten; weigert er sich, der Strafe nachzukommen, so ist die öffentliche Meinung stark genug, um seine Halzstarrigkeit zu brechen. Ist er durchaus nicht im stande, die Busse aufzubringen, so helfen ihm die Verwandten und Bekannten.
Wenn sich nach dem Tode von Mann oder Frau der überlebende Teil wieder verheiraten will, muss er nach dem Gebot der adat mindestens 1½ Jahre warten; eine Übertretung erfordert Busse.
Daher hatte Akam Igau, als ihm die Trauerzeit nach denn Tode seiner ersten Frau zu lang vorgekommen war und er sich vor Ablauf derselben mit Tipong, der Schwester seines Schwiegersohnes Sigau, verheiratet hatte, seinen Kindern eine bedeutende Entschädigung auszubezahlen. Die Busse wurde teilweise von den verschiedenen Familien in Tandjong Karang aufgebracht. Im Ganzen waren zur Sühnung der Schuld zwanzig Gonge erforderlich gewesen; ausserdem empfing jedes Kind eine kostbare alte Perle und ein Stück schwarzen Kattuns. Dieses sollten die Kinder, wie man mir erklärte, abends als Binde vor den Augen gebrauchen, bildlich, um die Schuld des eigenen Vaters nicht zu sehen.
In der Ehe herrscht Gütertrennung. Vater und Mutter sorgen gemeinschaftlich für den Unterhalt der Kinder. Sind diese einmal erwachsen, so bleiben sie zwar im Elternhause wohnen, bebauen aber mit Hilfe von Freunden und Freundinnen ihre eigenen Reisfelder. Sie leben von dem Ertrag des Ackerbaus und von den Nebenverdiensten, die sie sich als Kunsthandwerker, Schmiede, Tätowierkünstler, Priester u.s.w. erwerben. Müssen einige Artikel, wie Salz, Tabak und Kattun, in grösseren Mengen von Händlern an Ort und Stelle gekauft oder von der Küste herbeigeschafft werden, so wird die erforderliche Kaufsumme von allen Familiengliedern gemeinsam zusammengebracht; von dem Vorrat gebraucht jeder nach Bedürfnis. In allen derartigen Angelegenheiten hat der Vater die Hauptstimme.
Kommen Eheleute überein, dass sie sich auf gutwillige Weise trennen wollen, so behält bei der Scheidung jeder Teil sein Heiratsgut. Widersetzt sich dagegen der eine Teil einer Scheidung, so muss ihm der andere als Entschädigung sein Heiratsgut überlassen. Die Kinder dürfen selbst entscheiden, mit welche Partei sie es halten wollen; die kleinen folgen gewöhnlich der Mutter, meist stehen sie aber mit beiden Eltern auf gutem Fuss. [89]
So lange die Kinder im Elternhause leben, haben sie auf nichts anderes als die Geschenke, die sie ab und zu erhalten, und ihren eigenen Verdienst Anspruch. Auch nach dem Tode der Eltern wird, wenn die Kinder noch beisammen bleiben, das Erbe nicht geteilt. Gehen sie auseinander, so erben Söhne und Töchter gleich viel. Speziell bei den Mendalam Kajan erben die Töchter mehr als die Söhne, mit der Begründung, dass diese leichter ihren Unterhalt verdienen können.
Die Familienerbstücke (dāwăn ună) fallen gewöhnlich dein ältesten Kinde zu; die übrigen Kinder werden durch andere Wertgegenstände schadlos gehalten.
Mann und Frau erben nicht von einander. Im Falle dass keine Kinder da sind, geht der Besitz des verstorbenen Teils an dessen Familie zurück.
Ein Todesfall in der Familie veranlasst so viel Arbeit, dass die Angehörigen kaum Zeit haben, sich der Trauer hinzugeben.
Wenn der Tod infolge von Krankheit eintrat, siedelt die Seele des Verstorbenen nach dem Kajanhimmel, Apu Ke̥siọ, über und jeder beeilt sich, ihr alles für die Reise Erforderliche zu beschaffen. Die Vorbereitungen für das Begräbnis gewöhnlicher Kajan dauern zwei bis drei Tage, für Häuptlinge bis zu acht Tagen.
Die Leiche wird zuerst gewaschen, dann mit Blumen eingerieben und mit schönen Kleidern geschmückt.
Die Totenkleidung besteht aus weissem Kattun und wird mit schwarzen Arabesken und Menschen- und Tiergestalten verziert. Als Kopfbedeckung erhält der Tote eine altmodische Baumbastmütze. Den Schmuck, den die Kajan im Jenseits tragen wollen, wählen sie sich schon bei Lebzeiten aus; er ist in bezug auf Material und Arbeit von der besten Qualität. (Näheres über Totenkleidung siehe Kap. VII).
Zur Besänftigung der bösen Geister, die sich der Leiche des Verstorbenen bemächtigen könnten, versehen die Hinterbliebenen diese in liebevoller Sorgfalt mit Perlen. Nur die Reichen geben dem Toten alte Perlen mit, die Unbemittelteren begnügen sich mit neueren. Die Perlen haben, je nach dem Körperteil auf dem sie angebracht werden, verschiedene Namen:
kāli măta, 2 × 4 an ungedrehte Pflanzenfasern gereihte Perlen, werden auf jedes Auge gelegt.
kāli pro̱, eine Perle, die in die Kehle gesteckt wird.
kāli dje̥lă, eine Perle, die auf die Zunge gelegt wird. [90]
kāli lo-ong, eine grössere Perle, die mitten auf den Leib gebunden wird.
usut usu, Perlen, die um die Finger gebunden werden.
te̥we̥l buwa ăwo̱ng to̱, eine Perle, die an jedem Daumen befestigt wird.
usut tudăk, 2 × 4 Perlen, die an jedes Bein gebunden werden.
aaset udjo̱ng hălo̤̱bw, Eisen, das auf die Kniee gelegt wird.
Einem Häuptling wird ausserdem als weiterer Schutz ein hölzerner rimau oder le̥djọ (Tiger) mitgegeben.
Bei allen diesen Vorbereitungen helfen Freunde und Bekannte; sie sind die Zeit über Gäste der Leidtragenden.
Nach Beendung der Ausstattung wird der aus zwei Hälften ausgehöhlter Baumstämme bestehende Sarg ins Haus gebracht und die Leiche hineingelegt; die Ritzen werden mit Guttapercha luftdicht verschlossen. In den folgenden Tagen wird die Ausrüsting, die dem Toten ausserhalb des Sarges mitgegeben wird, in Ordnung gebracht. Dann wird der Sarg von Männern auf den Begräbnisplatz getragen und, je nach dem Stande des Verstorbenen, einfach auf dem Boden niedergesetzt oder auf ein hölzernes Gerüst gestellt, das oft mit einem schön geschnitzen hölzernen Dache überdeckt wird. An die Bäume und Sträucher ringsherum werden bunte Tücher und Wimpel gehängt und neben dem Sarge werden die übrigen für den Aufenthalt in Apu Ke̥siọ notwendigen Gegenstände, die im Sarge selbst keinen Platz fanden, niedergelegt; es sind dies: Waffen, Ruder, Gonge, Tempajang (grosse irdene Gefässe), Kleidungsstücke, Hausgerät und dergleichen. Die kostbaren Gegenstände werden oft zum Schutz gegen Diebstahl seitens der Malaien durch Zerbrechen wertlos gemacht.
Wenn es sich um einen vornehmen Häuptling handelt, wird der Sarg in einem sālo̱ng, einem nach allen Seiten geschlossenen Häuschen aus Eisenholz, beigesetzt. Der sālo̱ng ist oft mit künstlerisch schönen Malereien und einem prachtvoll gearbeiteten Dache verziert. In dem sālo̱ng werden noch so lange andere Leichen der Familie beigesetzt, bis er gefüllt ist oder verfällt.
Leibeigene ohne Familie werden nach dem Tode einfach zum Begräbnisplatz getragen, in eine Matte gewickelt und niedergelegt. Einst sahen wir, wie die Leiche eines wenige Stunden vorher verstorbenen Sklaven von einem anderen auf dem Rücken zum Flusse getragen und in einem Boote weggeführt wurde; bereits nach einer Stunde kehrten die Männer wieder zurück. Während die Bekannten [91] beim Tode eines freien Kajan die Rolle von Klageweibern übernehmen und das Weinen der Familie verstärken, hatte für den Sklaven nur eine einzige Frau kurze Zeit ihr Jammern ertönen lassen.
Alle, die auf andere Weise als durch Krankheit ums Leben kommen, geniessen weder das Vorrecht eines ehrenvollen Begräbnisses noch ist ihnen, nach der Überzeugung ihrer Hinterbliebenen, ein künftiges Leben in Apu Ke̥siọ beschieden. Die Seelen der Ermordeten, Selbstmörder, Verunglückten, im Kampfe Gefallenen, bei der Entbindung Gestorbenen und Totgeborenen gelangen auf zwei verschiedenen Wegen nach zwei anderen Orten, wo sie mit ähnlichen Unglücklichen, wie sie selbst, weiterleben müssen. Die Leichen dieser Armen flössen den Kajan Abscheu ein, daher werden sie nur in eine Matte gerollt und verscharrt. Ein besonderes Grauen erregen die Leichen von Wöchnerinnen; kein Mann und keine jüngere Frau darf sie berühren; sie werden auch nicht durch die Galerie vorn aus dem Hause hinausgetragen, sondern nach Entfernung einiger Bretter aus der hinteren Wand der Wohnung hinausgeworfen, in Matten gewickelt und an Rotangseilen zur letzten Ruhestätte geschleift.
Bei Begräbnissen von Personen, die eines ehrenvollen Todes gestorben sind, geben sowohl Männer als Frauen das letzte Geleite, letztere müssen der allgemeinen Trauer durch lautes Weinen Ausdruck verleihen.
Die eigentliche Trauer beginnt erst nach der Beisetzung des Verschiedenen und dauert vierzehn bis fünfzig Tage.
Während der Trauerzeit ist es Besuchern von auswärts verboten, die Wohnung oder die Reisfelder der Leidtragenden zu betreten. Beim Tode eines Häuptlings wird der ganze Mendalam für verboten (lāli) erklärt. Das Verbot wird durch Spannen eines Rotangseiles über den Fluss angezeigt; zerreisst jemand das Seil, so muss er Busse bezahlen, aber das lāli ist damit zu Ende.
Während der Trauerzeit darf nur Baumbastkleidung ohne jeden Schmuck getragen werden; die Frauen setzen sich ausserdem eine grosse Trauermütze mit hängenden Zipfeln auf. (Siehe Kap. VII).
Kommt ein Todesfall in der Zeit vor, wo eine Familie der Feldarbeit wegen auf dem Reisfeld wohnt, so darf sie vor Ablauf des Neujahrfestes das grosse Haus nicht wieder betreten und baut sich daher in dessen Nähe zwischen den Reisscheunen eine zeitweilige Hütte.
Am Ende der Trauerzeit feiert die Familie mit Hilfe einer Priesterin [92] eine me̥lă (siehe f. Kap.), bei der Schweine und Hühner geopfert und von den Hausgenossen und Gästen bei einem Festmahl verspeist werden. Nach der me̥lă muss sich die Familie noch einen, Tag still verhalten, me̥lo̱, dann darf sie ihr Alltagsleben wieder aufnehmen. Die Priesterin erhält für ihre Dienste ein Schwert, zwei Mass Reis und vier bis fünf mehr oder minder wertvolle Perlen.
In früheren Zeiten war zum Ablegen der Trauer ein frisch erbeuteter Schädel oder irgend ein anderer menschlicher Körperteil erforderlich gewesen, der, wenn es Häuptlinge galt, wahrscheinlich auf Kopfjagden (ajo) erlangt wurde. Gegenwärtig werden zu diesem Zwecke am Kapuas überhaupt keine Kopfjagden mehr unternommen; selbst alte Schädel werden nur noch in besonders ernsten Fällen bei benachbarten Stämmen geliehen; in der Regel begnügt man sich jetzt mit etwas Menschenhaar. Sehr wahrscheinlich ist die Bedeutung dieser Sitte die, dass man dein Verstorbenen einen Menschen opfert, damit er ihm als Diener ins Jenseits folge. Da bei den Bahau nur Häuptlinge sich Diener halten, wurden begreiflicherweise auch nur für diese Köpfe gejagt.
Dass bei anderen wichtigen Lebensereignissen, wie bei der Geburt eines Kindes und bei Hochzeiten, die Erbeutung eines Kopfes augenblicklich oder in früheren Zeiten jemals notwendig gewesen, habe ich während meines Aufenthaltes unter den Bahau und Kĕnja nie ermitteln können. Ich glaube mit Sicherheit erklären zu können, dass die adat diese Sitte nicht fordert. Auch herrschte bei ihnen nie der Gebrauch, das Schlachtopfer auf dem Häuptlingsgrabe langsam zu Tode zu martern, wie dies die Stämme am Barito und Kahájan und die Batang-Lupar noch jetzt zu tun scheinen. Es war selbst verboten, einen Haussklaven zu opfern und auch ein Kriegsgefangener oder eine gekaufte Person waren gerettet, sobald sie das Haus erblickt hatten. Dies geschah, beispielsweise, im Jahre 1893 am Mahakam, als Bang Jok, ein Häuptling in Long Dĕho, beim Ablegen der Trauer nach dem Tode seines Vaters Jok Bang, einen Menschen opfern wollte. Der Sklave hatte damals, wahrscheinlich durch Zufall, das Haus bemerkt und durfte daher nicht getötet werden.
Wir sehen somit, dass die Religion bei den Kajan am Kapuas auch früher nur beim Tode des Häuptlings die Opferung eines Menschen erforderte und dass gegenwärtig eine Erinnerung an diesen Brauch genügt. Dagegen besteht noch jetzt bei ihnen die Sitte, die Schädel ihrer erschlagenen Feinde aufzubewahren; man findet daher in einigen ihrer [93] Häuser, besonders aus früheren Zeiten, derartige Trophäen in grosser Zahl. Trotzdem bei den friedliebenden Bahau Tapferkeit und Stärke nicht zu den geschätztesten Eigenschaften gehören (Siehe f. Kap. Schöpfungsgeschichte: die Stärksten und Gewandtesten werden zu Sklaven), ist es doch für Häuptlingssöhne wünschenswert, wenn auch nicht unerlässlich, dass sie irgend welche Beweise ihres Mutes liefern. Daher hat sich jetzt noch die Sitte bei ihnen erhalten, dass erwachsene Häuptlingssöhne die Gelegenheit, die sich ihnen bietet, eine gefahrvolle Reise zu unternehmen oder einen Menschen zu töten, wahrnehmen. Selbst das Töten gekaufter alter Frauen wird nicht verschmäht; denn das Vergiessen von Menschenblut an und für sich sehen die Bahau schon als eine mutvolle Tat an, eine Auffassung, die mit ihrem furchtsamen Charakter völlig übereinstimmt. Auch suchen die jungen Häuptlinge stets auf eine für sie selbst ungefährliche Weise ihr Opfer zu treffen. Besonders geeignet zur Erbeutung eines Kopfes sind Handelszüge, hauptsächlich die zu den im Norden wohnenden nichtverwandten Stämmen; hierauf beruht auch die alte Feindschaft der Bahau mit den Batang-Luparstämmen am mittleren und unteren Batang-Rèdjang.
In früheren Zeiten unternahmen die Bahau auch Züge zu dem alleinigen Zwecke, Köpfe zu erbeuten; sie jagten hauptsächlich bei ihren Feinden am oberen Kahájan und Miri oder Mĕngiri, die sie früher aus dein Gebiet des oberen Mahakam vertrieben hatten.
Bei den Mendalam Kajan können Kopfjagden seit langer Zeit nicht mehr stattgefunden haben; am oberen Mahakam haben die Kajan am Blu-u ihre letzte Kopfjagd vor 13 Jahren am Kahájan unternommen. Obgleich sich nur 15 Mann an dem Unternehmen beteiligten und keine Köpfe, sondern nur ein Gefangener erbeutet wurden, betrachtete man diesen Zug doch als einen richtigen Kriegszug. Der gefangene Kahájan Dajak lebte noch bei meiner Ankunft am Blu-u, war mit einer der hübschesten Sklavinnen verheiratet und besass vier Kinder. Ein anderer Sklave, Sorong, trug auf seinen Waden eine Ot-Danom Tätowierung und war augenscheinlich in beinahe erwachsenem Alter erbeutet worden; er was Vater von elf Knaben, besass als Ratgeber des Häuptlings Kwing Irang eine bevorrechtete Stellung und war durch seinen Handel zu Wohlstand gelangt.
Da Kopfjagden unter grossen Anstrengungen und Entbehrungen mit viel Vorsicht unternommen werden und viele Monate, bisweilen [94] ein ganzes Jahr, dauern, Arbeitskräfte in einem Dorfe in der Regel aber nicht entbehrt werden können, ist es begreiflich, dass sie nur selten stattfinden.
Bemerkenswerter Weise trifft man weder bei den Bahaustämmen am Kapuas noch am Mahakam auf der Galerie ihrer Häuser die Schädeltrophäen, die den Eintretenden an anderen Orten so unangenehm berühren. Auch in den vier Niederlassungen der Bahau am Mendalam und in denen der Kajan, Long-Glat, Ma-Suling und anderer Stämme unterhalb der Mahakamfälle bemerkte ich keine Schädel. Nur in der Niederlassung des Pnihinghäuptlings Bĕlarè, der selbst halber Punan ist und dessen Stamm wahrscheinlich nicht zu den Bahau gehört, fand ich Schädel hängen. Indessen besitzen auch alle anderen Häuptlinge Schädel, sie bewahren sie aber an einem Ort, wo sie nicht sogleich ins Auge fallen. So bemerkte ich einen Teil eines Schädels in Batu Sala, einer Long-Glat Niederlassung, an der Aussenwand des Hauses, er war aber hinter einem Büschel Palmblätter kaum sichtbar.
Bahau und Kĕnja trocknen die Köpfe über dem Feuer, ohne die Fleischteile von den Schädeln zu entfernen; auch werden diese nie mit Figuren verziert.
Ich glaube die Tatsache, dass die Bahau keine Schädel auf die Galerie hängen, dem Umstande zuschreiben zu können, dass ihnen die Schädel selbst Abscheu und Angst einflössen. Sogar sehr alte Männer, denen die adat die geweihtesten Dinge zu berühren gestattet, fassen einen Schädel nur sehr ungern an. Als Beweis für diese Auffassung mag auch das folgende Begebnis dienen, das ich selbst am oberen Mahakam erlebte. Dort war nämlich das alte Haus der Ma-Suling am Mĕrasè so baufällig geworden, dass der Stamm sich einen neuen Wohnplatz suchen musste. Aller Besitz und die noch brauchbaren Materialien wurden mitgenommen, nur die Schädel wagte man nicht aus dem alten Hause zu entfernen. Man rief daher den Pnihinghäuptling Bĕlarè zu Hilfe, der die Schädel vorläufig in einer Hütte vor dem alten Hause unterbrachte und selbst als Belohnung für seine Mühe die Hälfte der Schädel mitnahm, um seine Galerie mit ihnen zu verzieren, was ihm sehr zu statten kam, da ihm bei der Brandschatzung seines Hauses im Jahre 1885 seine eigenen Trophäen verloren gegangen waren. Dieses geschah im Jahre 1897 und noch im Jahre 1900 standen die Schädel auf dem inzwischen verwilderten Platze vor dem verfallenen Hause, wo wilde Rinder, Hirsche und Schweine den [95] ganzen Boden aufgewühlt hatten. Bĕlarè sollte damals noch einmal kommen, um die Schädel in dem inzwischen vollendeten Hause der Ma-Suling aufzuhängen.
Die Schädel, die man bei den Stämmen in Mittel-Borneo antrifft, sind so verschiedenen und unsicheren Ursprungs, dass es keinen Wert hat, sie aus anthropologischem Interesse anzukaufen. Wie aus Obenstehendem hervorgeht, werden Schädel auf Kopfjagden erbeutet oder gekauft oder als Belohnung oder aus weit entfernten Gebieten als Geschenk erhalten. Der Sultan von Kutei schenkte z.B. dem Häuptling Kwing Irang zwei Köpfe, die im Gebiete des unteren Bulungan erbeutet worden waren. Bedenkt man, dass die Kopfjäger in ihrer Eile und Erregung oft nicht wissen, wessen Kopf sie eigentlich erbeutet haben, so nimmt es nicht Wunder, dass die Besitzer der Schädel selbst nicht immer angeben können, von wo oder von welchem Stamme diese herrühren; ausserdem teilen die Bahau den Fremden, aus Furcht vor Rache, nicht gern mit, auf welche Weise sie zu ihren Schädeln gelangt sind. [96]
Kapitel V.
Religiöse Vorstellungen der Bahau—Wichtigste Götter—Einteilung des Weltalls—Gute und böse Geister—Seelen der Bahau—Charakter und Schicksal der bruwā und to̱n luwā—Seelen der Tiere, Pflanzen und Gesteine—Vorzeichen—Erklärung der pemāli—Priester und Priesterinnen—Beseelung der dājung—Pflichten der dājung—Erklärung der melă—Das Ei als Opfergabe.
Um die Höhe der geistigen Entwicklung und die Eigenart eines Volkes beurteilen zu können, muss man vor allen Dingen die Vorstellungen kennen lernen, die dieses sich von seiner Stellung gegenüber der umgebenden Natur bildet. In höherem oder geringerem Masse sind diese Vorstellungen, die wir als Religion bezeichnen, jedem denkenden Wesen eigen. Je widerstandsfähiger ein Volk sich seiner Umgebung gegenüber fühlt, desto verschiedener und erhabener wird es sich ihr gegenüber vorkommen. Ein Volk gewinnt aber nur dann eine gewisse Furchtlosigkeit und Unabhängigkeit gegenüber den auf sein Dasein einwirkenden Naturkräften, wenn es bewusst oder unbewusst so viel Kenntnis von der Natur erlangt, dass es sein Leben mit deren Forderungen in Übereinstimmung zu bringen im stande ist.
Berücksichtigen wir, dass die Bahau und Kĕnja von Borneo ackerbautreibende Stämme sind, deren Lebensunterhalt von der Witterung und anderen sichtbaren Naturänderungen unmittelbar abhängig ist, dass ausserdem die schädlichen Einflüsse des Klimas ihr körperliches Befinden durch Krankheit so stark beeinträchtigen, dass sie an Zahl wenig zunehmen, so kann es uns nicht wundern, in den religiösen Überzeugungen dieser Stämme das Gefühl der Abhängigkeit von der sie umgebenden Natur stark ausgeprägt zu finden. In der Tat ist die Stellung, die sich die Bewohner von Mittel-Borneo im Reiche der Natur anweisen, eine sehr bescheidene; denn sie kommen sich selbst von den Pflanzen, Tieren und Gesteinen ihrer Umgebung nicht wesentlich, sondern nur graduell, verschieden vor.
Charakteristischer Weise schreiben die Bahau nicht mir sich selbst, [97] sondern auch allen belebten und unbelebten Wesen den Besitz von Seelen (bruwā) zu. Nach ihrer Auffassung reagieren die Seelen eines Baumes, eines Hundes oder eines Felsens auf dieselbe Art wie die eines Menschen, sie werden von denselben Empfindungen der Lust und Unlust bewegt. Daher suchen die Bahau die erzürnten Seelen der Tiere, Pflanzen und Steine, welche sie zu verletzen oder zu vernichten gezwungen sind, durch Opfer zu besänftigen; im übrigen aber empfinden sie vor ihnen keine besondere Angst. Die Wirkungen der Naturkräfte erscheinen ihnen dagegen für das Wohl und Wehe des Menschen viel bedeutungsvoller und auch gefährlicher.
Die wahren Ursachen von Donner, Blitz, Regen und Wind nicht kennend stellen sich die Bahau diese als. Äusserungen von Wesen oder Geistern (to̱) vor, die zwar mächtiger sind als sie selbst, sonst aber Angenehmes und Unangenehmes auf die gleiche Weise wie die Menschen empfinden. Die Geister können daher einerseits durch Geschenke und Opfer von lebenden oder toten Wertgegenständen günstig gestimmt werden, andererseits durch diejenigen Dinge, die auch den Menschen Abscheu und Angst einflössen, in die Flucht geschlagen werden. Ich beobachtete einige Male, dass der Sohn Kwing Irangs, des Häuptlings der Mahakam Kajan, bei heftigem Sturme aus dem Hause stürzte und, um den Geistern zu imponieren und sie gleichzeitig zu besänftigen, das erste beste Tier, das ihm in den Weg kam, einmal ein Schwein, einmal ein Huhn, mit Schwertschlägen tötete. Ein anderes Mal stürzte ein Mann, in der einen Hand ein gezogenes Schwert in der andern einen Schädel haltend, während eines Sturmes aus dem Hause, um den Sturmgeist in die Flucht zu schlagen.
Auch durch Schreien suchen die Bahau die Wind- und Regengeister zu vertreiben; hilft dieses Mittel nicht, so stellen sie zur Abschreckung einen Schädel vor das Haus. Als wir auf einer Reise mit den Mendalam Kajan von einem heftigen Gewitter überfallen wurden und sehr nahe Donnerschläge uns erschreckten, zogen die Kajan sogleich ihre Schwerter halb aus der Scheide, um die gewaltigen Geister zu verjagen.
Diese Naturgeister üben auch direkten Einfluss auf das Leben der Menschen aus; so werden bestimmte Vergehen durch die to̱ be̥lare̱, Donnergeister, bestraft. Das Lachen über Tiere z.B., das bei den Bahau als Verbrechen gilt, wird durch die to̱ be̥lare̱ sogleich gestraft, indem sie dem Schuldigen den Hals umdrehen. Es ist daher sehr unvorsichtig, mit einem Huhn, Hund oder Schwein etwas vorzunehmen, [98] was die Leute zum Lachen bringen könnte. Als am Mahakam plötzlich ein kleines Mädchen, wahrscheinlich an Vergiftung, starb, schrieben die Dorfbewohner ihren Tod dein Umstand zu, dass sie über irgend ein Tier gelacht haben sollte.
Ausser diesen Naturgeistern, die sich als Blitz, Donner, Wind und Regen äussern, kennen die Bahau noch eine Schar anderer to̱, die, je nachdem wie sie sich den Menschen gegenüber verhalten, als gute und böse bezeichnet werden. An jene wendet man sich bei Krankheit, Unglücksfällen und bösen Träumen um Hilfe, diese, als die Unglücksträger, sucht man durch Gewaltmittel zu vertreiben oder durch Opfer zu beschwichtigen.
Die to̱ werden, je nach der geistigen Entwicklungsstufe, welche die einzelnen Bahau einnehmen, verschieden aufgefasst. Während man die gewöhnlichen Leute nur von den to̱, als den Urhebern ihrer Freuden und Leiden, sprechen hört, betrachten die höher Stehenden, wie die Häuptlinge und Priester, die to̱ nur als die direkten oder indirekten Werkzeuge eines obersten Gottes Tamei Tingei (= unser hoher Vater).
Wenden wir uns, bevor wir näher auf die to̱ eingehen, im folgenden den höheren geistigen Mächten der Bahau zu.
Ihr ganzes Weltall wird von dem eben genannten Tamei Tingei, dem Allvater, beherrscht, der mit seiner Gemahlin Uniang Te̥nangan über allen anderen von Geistern und Menschen bewohnten Regionen lebt.
Ausser dem Allvater erkennen die Bahau noch andere hohe Götter an, die unter Tamei Tingeis Oberherrschaft im Weltall bestimmte Rollen zu erfüllen haben. Es sind dies:
Djājā Hipui (= alter Häuptling), die Mutter der Kajanwelt und Beherrscherin der guten Geister, jetzt mit Howong Hwan vermählt und Amei Awi (= Vater Awi) und dessen Gemahlin Buring Une̱, welche die Erde und ihre Erzeugnisse beherrschen.
Götter, Geister, Menschen und Seelen der Verstorbenen wohnen im Weltall nicht durcheinander, sondern in bestimmten Schichten oder Regionen, die zum Teil besondere Namen tragen; es existieren deren fünf, nämlich:
1. oberste Region, bewohnt von Tamei Tingei und dessen Gemahlin Uniang Te̥nangan;
2. Abu Lagan, bewohnt von Djaja Hiwi und dessen Gemahl Howong Hwān;
3. Apu Ke̥siọ, bewohnt von den Seelen der Verstorbenen; [99]
4. die Erde, bewohnt von den Menschen;
5. unterirdische Region, bewohnt von Amei Awi und dessen Gemahlin Buring Une̱.
Für die gebildeteren Bahau ist Tamei Tingei derjenige Gott, welcher das Lebenslos der Menschen beherrscht, der bereits hier auf Erden denjenigen straft, der sich Übertretungen der adat und andere Übeltaten zu Schulden kommen lässt, und denjenigen belohnt, der sich durch gute Werke auszeichnet. Er ist allwissend und hat zur Vollstreckung seines Willens eine Schar böser, die Erde bewohnender Geister zur Verfügung. Man sollte vom Allvater, der nicht nur straft, sondern auch belohnt, erwarten, dass ihm ausser den bösen Geistern auch gute direkt zu Diensten stehen. Ich habe aber letztere nie erwähnen hören; es ist daher wahrscheinlich, dass Tamei Tingei sich für seine Zwecke der im Apu Lagan unter Diaja Hiwis spezieller Aufsicht stehenden guten to̱ bedient.
Amei Awi und Buring Une̱ beherrschen die Erde und den Ackerbau. Da das Gelingen der Ernte von ihnen abhängt, wird ihnen besonders bei den Saatfesten und beim Beginn der Erntefeste geopfert. Sie leben in aller Herrlichkeit auf einer Erde, die unter derjenigen der Menschen liegt und so fruchtbar ist, dass sie nahrhaften Reis und Früchte aller Art in Hülle und Fülle hervorbringt.
Während Tamei Tingei, Amei Awi und ihre Gemahlinnen von Anbeginn an Gottheiten gewesen sind, lebte Djaja Hiwi, die Beherrscherin der guten Geisterwelt Apu Lagan, einst als menschliches Weib auf Erden und zwar im Stammland aller Bahau, im Apu Kajan, als Ehefrau von Tamei Angoi, einem Häuptling am Kajanufer. Djaja Hipuis Vorgeschichte ist folgende:
Im Apu Kajan, wo für gewöhnlich ein Überfluss an Reis und herrlichen Früchten herrschte, trat einst Hungersnot ein. Daher begab sich Tamei Angoi, Djaja Hipuis Gatte, mit seinem Sohne Te̥kwăn, auch wohl Sunung Kule̱ genannt, in das Land Lagan Pau, um dort für Gonge, Schwerter und Perlen Reis einzukaufen. Aber auch dort herrschte Reisnot, so dass sie sich unverrichteter Sache auf den Rückweg machen mussten. Zum Übermass des Unglücks ertrank Te̥kwăn unterwegs in den Wasserfällen des Flüsschens Lirong. Tief gebeugt kehrte der Vater in sein langes Haus am Kajan zurück; sein Kummer wurde von Djaja Hiwi und dem ganzen Volke geteilt.
Als Tamei Angoi nach Ablauf der Trauerzeit zufällig auf eine [100] Leiter stiess, die nach oben in die Geisterwelt Apu Lagan führte, beschloss er in seiner Not, von dort mit Hilfe seiner Tauschartikel Reis für seine hungernden Untertanen zu holen. So stieg er denn voller Hoffnung die Leiter hinauf und gelangte vor Buring Bango, die Frau, die damals den Abu Lagan beherrschte. Tamei Angoi wurde für seinen Mut belohnt; denn er fand hier nicht nur einen Überfluss an Reis, sondern feierte auch Wiedersehen mit seinem Sohne Te̥kwăn. Leider durfte ihm dieser aus der Geisterwelt nicht wieder auf die Erde folgen, was die Freude des Vaters, der im übrigen sehr befriedigt von dem Erfolg seiner Unternehmung in sein Land zurückkehrte, etwas beeinträchtigte.
Kaum hatte Djaja Hipui erfahren, dass ihr ältester Sohn im Apu Lagan wohnte, als sie sich auf Erden nicht mehr halten liess; trotzdem weder Tamei Angoi noch ihr jüngerer Sohn Imu Djoatut das Land, in dem sie bis jetzt so glücklich gelebt hatten, verlassen wollten, beschloss die Mutter dennoch, zu ihrem Te̥kwăn überzusiedeln. Ein grosser Teil der Dorfbewohner schloss sich Djaja Hipui an und so stiegen sie gemeinsam auf der Leiter nach oben, worauf sie diese zerbrachen. Buring Bango jedoch wollte die Neuangekommenen in ihrem Reiche nicht aufnehmen, daher entbrannte ein heftiger Kampf. Buring Bango wurde besiegt und gezwungen, nach Pu-u Siu zu flüchten und ihr Reich Djaja Hipui zu überlassen.
Von Tamei Angoi und Imu Djoatut, den auf Erden Zurückgebliebenen, stammen sämmtliche Bahau ab.
Djaja Hipui lebt mit den Ihren im Apu Lagan nach der Weise der Bahau auf Erden, in langen Häusern, an einem Flussufer. Ober- und unterhalb von Djaja Hipuis Hause stehen je zwölf dieser langen Häuser und zwar heissen die zwölf ersten, von oben gerechnet: Ingān I; Buā Kudjă; Ulọ Lawing; Pare̥n Tingin; Pare̥n Balui; Batang; Uniang Awang; Utan; Ingan II; Bua Kaping; Tijung und Apu Lagan. Die Namen der flussabwärts gelegenen Häuser sind mir nicht bekannt.
Djaja Hipui greift auch in das Lebenslos der Menschen ein; wird sie z.B. zu häufig oder zu ungelegener Zeit, besonders durch Fluchen, angerufen, so straft sie.
Die guten Geister des Apu Lagan sind den Bahau günstig gesinnt: sie beseelen die Priester und helfen ihnen dadurch, die in Krankheitsfällen entflohenen Seelen der Menschen zurückzurufen; sie beseelen [101] auch die Tätowierkünstler, Hirschhornschnitzer; Schmiede und ähnliche Leute; auch sind sie es, die mit Hilfe von Tieren, Träumen und Begebnissen aller Art die Bahau auf das, was sie tun und lassen müssen, aufmerksam machen.
Über die Vorstellung, die sich die Bahau von dem Aussehen der guten to̱ machen, habe ich nie etwas vernommen.
Dagegen schreiben sie den strafenden Geistern, die sie daher als die “bösen (djă-ăk)” bezeichnen, alle Körpereigenschaften zu, die sie selbst an ihren Nebenmenschen unangenehm und hässlich finden. Die bösen to̱ sind menschenähnliche Wesen mit grossen, dicken Leibern, riesigen Augen in grossen Köpfen, schweren Hauern, dichter langer Behaarung und aussergewöhnlicher Stärke. Die den Donner und Blitz verursachenden to̱ be̥lare̱ sind z.B. so stark, dass man glaubt, vom Blitz getroffene Bäume seien von ihnen auseinander gerissen. Das Blitzen erzeugen sie durch das Funkeln ihrer Augen, das Donnern durch das Tönen ihrer Stimmen. Sie bewohnen gewöhnlich Höhlen an Bergabhängen und bilden ähnliche Gemeinwesen wie die Bahau. Auch die übrigen bösen Geister suchen sich als Wohnplätze die Orte aus, die auf das Gemüt der Menschen einen beängstigenden Eindruck hervorbringen, wie stark bewachsene Berge, dunkle Waldgebiete, Felshöhlen und eigentümlich geformte Felsen und Steinklumpen.
Viele Berge werden von den Eingeborenen wegen der dort hausenden Geister gemieden und auch mir gestatteten sie öfters nicht, in die Nähe einer Berghöhle zu gehen. Bei der Besteigung des Batu Kasian hörte ich den Häuptling Kwing Irang unseren Pflanzensucher fragen, ob er nicht die Höhle des dort lebenden be̥lare̱ entdeckt habe. Während der Reise warfen meine Träger mit Steinen und Holzstücken nach allen Höhlen und Felsen, die für Wohnsitze von Geistern galten. Einst sah ich einen Mann den Mond anspeien, ich weiss nicht aus welchem Grunde.
Als weitere Abschreckungsmittel für böse Geister dienen auch menschliche Phantasiegestalten, deren Genitalien übertrieben gross dargestellt werden. Derartige Figuren, mit Schild, Schwert und Speer bewaffnet, werden, besonders wenn Krankheiten im Lande herrschen, an den Pfaden längs des Flussufers aufgestellt. Auch Genitalien an und für sich sind im stande, andringende Geister zu verscheuchen; sie werden daher in roher Form aus Holz geschnitzt häufig auf Treppen und Bretterstegen angebracht. Wie im Kapitel über Kunst gezeigt werden wird, [102] hat dieser Glaube den Bahau die eigenartigsten Motive für die Verzierung ihrer Häuser, Waffen und Gerätschaften geliefert. Aus der Schöpfungsgeschichte der Kajan geht hervor, dass ihre Götter und Geister vor geschlechtlichen Beziehungen ein Grauen empfinden; hieraus erklärt sich die abschreckende Wirkung, die der Anblick von Genitalien auf die bösen Geister übt.
Dass auch das Pflanzenreich zur Abwehr böser Geister vielerlei Mittel liefert, ist bereits im vorhergehenden Kapitel gezeigt worden, ebenso dass die Zähne von Hunden, Wildkatzen, Bären und Panthern, besonders geformte Steine u.s.w. als Schreckmittel benutzt werden.
Die bösen sowie die guten Geister besitzen einen viel weiteren Blick als die Menschen und sind, wie wir gesehen haben, auch viel mächtiger als diese; sie bilden für die meisten Bahau das religiöse Element, mit dem sie sich bei ihrem Gottesdienst hauptsächlich befassen.
Da die guten Geister nicht nur an sich ungefährlich sind, sondern den Menschen auch alles erdenkliche Gute anzutun bestrebt sind, die bösen Geister dagegen den Menschen, als Strafe für ihre Missetaten, alles Unglück übermitteln, haben diese für die Bahau begreiflicher Weise mehr Interesse als jene. Man hört sie daher viel häufiger von den gefürchteten bösen als von den harmlosen guten to̱ sprechen.
Obgleich die Bahau an eine wenn auch beschränkte Unsterblichkeit der Seele glauben, sind sie doch der Überzeugung, dass Tamei Tingei ihnen durch seine Diener schon hier auf Erden das Los zuerteilt, das sie sich durch ihre Lebensweise selbst verdient haben. Diejenigen, welche die menschliche oder göttliche adat übertreten, erleiden Missgeschick oder werden krank; sind die Geister sehr erzürnt, so lassen sie die Schuldigen im Kampfe fallen, verunglücken, sich selbst töten oder, wenn es Frauen betrifft, bei der Geburt sterben. Alle auf diese Weise Umgekommenen sind mătei djă-ăk, d.h. eines schlechten Todes gestorben. Es wird ihnen kein ehrenvolles Begräbnis zu Teil; auch gelangen ihre Seelen nicht in den Himmel Apu Ke̥sio, sondern an einen anderen Ort; aber von einer weiteren Vergeltung ihrer auf Erden begangenen Missetaten im künftigen Leben ist keine Rede.
Den guten Menschen sendet Allvater Glück und Wohlergehen; auch lässt er sie durch Krankheit eines schönen Todes (mătei saju) sterben. Ihre Seelen gelangen nach Apu Ke̥sio, wo sie in einem Überfluss an Nahrungsmitteln schwelgen und nicht zu arbeiten brauchen.
Im Anfang dieses Kapitels ist bereits gesagt worden, dass die [103] Bahau nicht nur sich selbst, sondern auch allen belebten und unbelebten Wesen auf Erden den Besitz von Seelen zuschreiben; sie glauben, dass die Menschen und deren Haustiere: Schweine, Hunde und Hühner, ferner die Hirsche, grauen Affen und Wildschweine von zwei Seelen, die übrigen Tiere, Pflanzen und toten Gegenstände dagegen nur von einer Seele bewohnt werden.
Betrachten wir zuerst die Seelen der Menschen, ihren Charakter und ihr Schicksal.
Alle Leiden, von Angstgefühlen und quälenden Träumen an bis zu Missgeschicken und Krankheiten, schreibt der Bahau dem Umstande zu, dass ein Teil seiner Persönlichkeit zeitweise seinen Körper verlässt; er nennt diesen nur locker mit seinem Körper verbundenen Teil: bruwa (malaiisch: mata kanan = rechtes Auge). Einen zweiten Teil seiner Persönlichkeit, der zeitlebens mit seinem Körper verbunden bleibt, nennt der Bahau: to̱n luwā (malaiisch: mata kiba = linkes Auge). Diese beiden geistigen Teile des Bahau, seine beiden Seelen, spielen sowohl in seinem Leben als nach seinem Tode eine wichtige Rolle.
Die stets unruhige bruwa entflieht dem menschlichen Körper, nach Aussagen der Priesterinnen, in Gestalt eines Tieres: eines Fisches, Vogels oder einer Schlange. Die Fischform verspricht ein langes, die Schlangenform ein kurzes Erdenleben. Der wichtigste Wohnsitz der bruwa liegt im Haupte des Menschen, sie verlässt den Leib durch den Scheitel. Schlägt man ein Kind daher aufs Haupt, so entflieht seine bruwa leicht.
Eine der wichtigsten Aufgaben der Priesterinnen besteht darin, die bruwa, die den Menschen schon bei geringen Anlässen, wie Schreck und Verstimmung, besonders aber bei Krankheit, verlässt, wieder in den Körper zurückzulocken. Sie tun dies mit Hilfe der Geister aus dem Apu Lagan und zwar auf sehr verschiedene Weise. Bisweilen lässt sich die bruwa schon dadurch besänftigen, dass ein schönes Stück Zeug auf das Haupt des Patienten gelegt wird; sonst spaltet die Priesterin in der Dunkelheit das Haupt zum Schein und lässt die entflohene Seele wieder in ihren alten Wohnsitz zurückkehren.
Bei dem Tode des Menschen verlässt die bruwa den Körper für immer und zieht nach Aras Kesio. So viel ich habe erfahren können, verweilt die Seele auch hier nicht ewig, sondern begiebt sich später an einen anderen Ort, Langit Mĕngun, und wird erst dort zu einem wirklichen, ewig fortlebenden Geiste. [104]
Der Weg, den die bruwa zum Apu Ke̥sio zurückzulegen hat, ist äusserst mühe- und gefahrvoll; daher giebt man dem Verstorbenen alles mit, was seiner Seele auf der Reise und auch später beim Aufenthalt im Jenseits von Nutzen sein könnte. Hierzu gehören: eine vollständige und prächtige Kleiderausrüstung nach altem Muster; schöne Schmucksachen; Waffen; Gerätschaften aller Art; Gonge, die neben dem Grabe aufgestellt oder bei Häuptlingen in die Prachtgräber (salong) gelegt werden; ferner eine winzige Leiter, um der Seele zu ermöglichen, Felsen zu erklimmen und Abgründe zu überschreiten und ein Vorrat von Nahrungsmitteln. Um die bruwa gegen Anfälle böser Geister unterwegs zu schützen, giebt man ihr in einem Tragkorbe (briut) seltsam geformte Steine und Tierzähne mit, zur Anlockung der guten Geister dagegen ein Bambusgefäss mit Zuckerrohrsaft.
Die bruwa begiebt sich nicht sogleich nach dem Tode des Menschen auf die Wanderung, sondern hält sich, solange die Angehörigen die Trauer noch nicht abgelegt haben, in der Nähe des Leichnams auf. Die Seelen der Kapuas Dajak wählen für diese Zeit den Berg Batu Tilung am Mandai als Aufenthaltsort. Beim Ablegen der Trauer ist es daher Aufgabe der Priesterin, durch Abhalten einer me̥la dafür zu sorgen, dass die Seele sicher nach Apu Ke̥sio befördert (anter) wird.
Die bruwa beginnt ihre Reise unterhalb der Erde und Flüsse und hat ausser den gewöhnlichen Terrainschwierigkeiten auch noch Brücken aus heftig wippenden Baumstämmen und Wege von der Schärfe der Schwerter zu überwinden. Kommt sie über diese Hindernisse nicht hinweg, so geht sie zu Grunde; stürzt sie z.B. von der Brücke in den Fluss, so fressen sie die Fische und sie ist vernichtet. Die Unsterblichkeit der bruwa ist somit eine begrenzte.
Die Seelen der matei saju, eines schönen Todes Gestorbenen, und der matei djă-ăk, eines schlechten Todes Gestorbenen, wandern zuerst auf gemeinschaftlichem Pfade, dann aber findet Dreiteilung des Weges statt: rechts führt ein Weg zum Apu Ke̥siọ, links führen zwei Wege, von denen der eine durch Schwerter, der andere durch Gonge bezeichnet ist, zu anderen Anfenthaltsorten, die für die eines gewaltsamen Todes Gestorbenen bestimmt sind. Die Verunglückten, Erschlagenen, Selbstmörder u.s.w. schlagen den Weg der Schwerter, die Frauen und Kinder, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind, dagegen den der Gonge ein.
Was die zweite Seele der Bahau, die to̱n luwa, betrifft, so ist sie [105] zeitlebens mit seinem Körper fest verbunden. Erst wenn der Leib gestorben ist, verlässt auch diese Seele die stoffliche Hülle. Die to̱n luwa bleibt jedoch auf dem Begräbnissplatz, wo sie solange herumirrt, bis sie endlich zu einem bösen Geiste wird. Gehen die Bahau daher an einem Begräbnisplatz vorüber, so werfen sie den to̱n luwa, um sie zu beruhigen, Stückchen Esswaren, Tabak u. dergl. zu, auch weisen sie nicht nach ihnen und sprechen nicht von ihnen.
Die to̱n luwa haben die Fähigkeit, während ihres Aufenthaltes auf der Totenstätte in Tiergestalt, als Hirsche und graue Affen, zu erscheinen. Desshalb essen die Bahau diese Tiere nur dann, wenn der Hunger sie dazu zwingt. Da die Malaien keine Schweine essen, glauben die Bahau, dass deren Seelen nach dem Tode bisweilen in Schweine übergehen.
Als Beweise für den gelegentlichen Aufenthalt der to̱n luwa in Tieren führten mir die Mendalam Kajan die folgenden Erzählungen an
Ein Mann zog aus um zu sile̥m, d.h. mit einem Blasrohr zu jagen. Obgleich er den ganzen Tag umherlief, hatte er doch keinen Erfolg, und so schlief er endlich müde und verstimmt auf einem Begräbnisplatze ein. Da erschien ihm ein wunderschönes Mädchen, mit der er den Rest der Nacht verbrachte. Beim Erwachen in der Frühe bemerkte der Mann, dass ein Hirsch, der neben ihm lag, eiligst aufstand und entfloh. Hieraus ersah er, dass die Seele des Mädchens sich tagsüber in einem Hirsch aufhielt.
Ein anderer Jäger stiess an einer Stelle des Waldes, wo er lange Zeit nicht gewesen war, auf ein Haus, das von grossen, dunklen Menschen bewohnt wurde; etwas weiter stand ein zweites Haus, in dem schöne Frauen lebten, und in einem dritten Hause fand er Menschen noch anderer Art. Mit allen diesen Leuten plauderte der Jäger, ass mit ihnen, kaute Betel und schlief endlich an der Seite einer der Frauen ein. Als er in der Nacht vor Kälte erwachte und sich zur Erwärmung ein Feuer anzündete, bemerkte er, dass sich ein Waffenhalter an der Wand in einen Baumast und die Hausbewohner in graue Affen verwandelten. Darauf ergriff er eiligst die Flucht. Im Vorüberlaufen sah er noch, dass sich die Menschen in den beiden anderen Häusern in Hirsche verwandelten.
Wenden wir uns jetzt den Seelen der Tiere, Pflanzen und leblosen Wesen zu.
Die Bahau bezeichnen diejenigen Tiere, die nur eine einzige Seele [106] besitzen, als tulār lān (wirkliche Tiere); die Haustiere, ferner die Hirsche, grauen Affen und Wildschweine dagegen sind im Besitze der gleichen Seelen wie die Menschen, einer bruwa und einer to̱n luwa; sie können daher auch zeitweilig als Menschen leben und wie diese Häuser bewohnen. Auch hierfür lieferten mir die Kajan durch eine Erzählung den Beweis:
Ein Mann, der sich mit seinem Blasrohr auf die Jagd begeben hatte, irrte lange im Walde umher, bis er an ein Haus gelangte, das von schönen Frauen bewohnt wurde.
Mit einer dieser Frauen lebte er mehrere Monate zusammen; eines Morgens erklärte sie ihm jedoch, dass sie eigentlich ein bawui (Wildschwein) sei und dass sie von nun an nicht länger in ihrer menschlichen Gestalt weiterleben dürfe, sondern in den Wald zurückkehren müsse. Sie hatte den Mann aber inzwischen sehr lieb gewonnen und legte ihm ans Herz, stets dabei zu sein, wenn die Jäger seines Stammes Wildschweine erlegten, da es leicht geschehen könne, dass auch sie sich unter den Jagdopfern befinde. Darauf nahm sie Abschied und begab sich mit vielen anderen Frauen an das Ufer eines Weihers, der vor dem Hause lag; in diesen tauchten sie unter und kamen am gegenüberliegenden Ufer in Gestalt von Wildschweinen wieder zum Vorschein. Die Tiere liefen einen Hügel hinan und verschwanden im dichten Walde.
Bald nachdem der Mann in sein Dorf zurückgekehrt war, erlegten seine Stammesgenossen wirklich ein Wildschwein. An einer Narbe an der Seite des Tieres erkannte der Mann seine frühere Geliebte und bemächtigte sich daher der Leiche. Gross war sein Erstaunen, als er beim Aufschlitzen von Brust und Bauch das ganze Tier mit Gold gefüllt fand. So wurde er zum reichsten Manne im ganzen Dorfe. Die Bahau jagen daher nie mehr Wildschweine, ohne deren Seelen zuvor ein Opfer gebracht zu haben.
Haben die Bahau einen kule̱, den gefürchteten borneoschen Panther geschossen, so sind sie für ihr Seelenheil sehr besorgt; denn die Pantherseele ist beinahe mächtiger als die ihre. Sie schreiten daher acht Mal über das getötete Tier unter der Beschwörungsformel: “kule, bruwa ika hida bruwa akui” = “Panther, Seele deine unter Seele meine”. Zu Hause angelangt werden Jäger, Hunde und Waffen mit Hühnerblut eingerieben, um ihre Seelen zu beruhigen und am Entfliehen zu verhindern. Die Bahau essen nämlich Hühnerfleisch so [107] gern, dass sie den gleichen Geschmack auch bei ihrer Seele voraussetzen, auch glauben sie, dass ihr schon der Genuss des Blutes allein genüge. Ausserdem müssen die Männer acht Tage lang sowohl tags als nachts baden. Nach Verlauf dieser acht Tage müssen sie sich aufs neue auf die Jagd begeben.
Haben die Jäger bei der Wildschweinjagd der Beute den Schwanz abgehauen, so müssen sie vorschriftsgemäss ebenfalls nach acht Tagen wieder jagen gehen; haben sie einen Bären erlegt, so gehen sie bereits nach sechs Tagen wieder auf die Jagd.
Die Pflanzen besitzen nach Auffassung der Bahau zwar nur eine Seele, diese ist aber oft sehr anspruchsvoll und rächt sich für jede Verletzung oder Vernachlässigung an den Menschen. Daher tun die Kajan nach dem Bau eines Hauses, wobei sie zahlreiche Bäume haben misshandeln müssen, ein Jahr lang Busse, d.h. es folgt eine Zeit, in der ihnen vieles verboten (lāli) ist, unter anderem das Töten von Bären, Tigerkatzen, Schlangen u.s.w.
Bei den Ulu-Ajar Dajak am Mandai, südlich vom oberen Kapuas, bestehen ähnliche, aber noch strengere Vorschriften für den Häuserbau. Dort hängt die Dauer der Busse von den hauptsächlich gebrauchten Baumarten ab; für ein Haus aus wertvollem Eisenholz muss man sich drei Jahre lang verschiedener Leckerbissen enthalten; die Seelen geringerer Baumarten machen dagegen bescheidenere Ansprüche.
Eine derartige Verbotszeit wird durch eine Festlichkeit abgeschlossen (be̥t lāli). Dabei spielt die Kopfjägerei, allerdings nur pro forma, auch noch eine Rolle; man entlehnt nämlich einen alten Schädel bei einem benachbarten Stamme.
Sehr verschieden geartet sind auch die Seelen der die Pfeilgifte liefernden Bäumeder Täsembaum (Antiaris toxicaria Lesch.) scheint schwer zu befriedigen zu sein; denn nur selten ist das Kernholz dieses Baumes wohlriechend; dies ist nur dann der Fall, wenn derjenige, der ihn fällt, die richtigen Opfer zu bringen versteht. Das Gleiche gilt für den in Ost-Borneo vorkommenden Kampferbaum.
Auch der Reis ist beseelt und die gute Gesinnung seiner Seele ist für den Ernteausfall von grosser Bedeutung, daher müssen die Priesterinnen, wie wir in der Folge sehen werden, beim Reisbau ein sehr kompliziertes Zeremoniell erfüllen.
Eigentümlicher Weise stellen sich die Bahau, wie schon gesagt, auch die toten Wesen ihrer Umgebung beseelt und mit menschlichen [108] Eigenschaften begabt vor. Aus diesem Grunde wirft ein Kajan, der schwer dazu zu bewegen ist, einen Gegenstand durch Verbrennen zu vernichten, ihn anstandslos in den Fluss, in der Überzeugung, dass er sich im Wasser doch noch durch Schwimmen retten könne.
Eine besonders rücksichtsvolle Behandlung erfahren bei den Mendalam Kajan und allen Busang sprechenden Stämmen am Mahakam die Seelen derjenigen Gegenstände, die im Leben des Menschen eine wichtige Rolle gespielt haben; sie werden zu Lebzeiten gesammelt und auch nach dem Tode ihres Eigentümers in einem grossen Packen, le̥ge̱n genannt, aufbewahrt. Zwar kümmert sich keiner weiter um den Packen, auch lässt man ihn beim Verlassen des Hauses unter dem Dache zurück; niemand würde jedoch wagen, ihn zu vernichten. (Siehe folg. Kap.)
Im vorhergehenden haben wir die Vorstellungen kennen gelernt, die sich die Bahau von sich selbst, ihrer irdischen Umgebung und den über ihnen stehenden Mächten gebildet haben; betrachten wir jetzt die Beziehungen, die zwischen der Geister- und Menschenwelt bestehen.
Das Bedürfnis, für ihren Lebenswandel eine Richtschnur und über ihre Zukunft einige Gewissheit zu erlangen, hat in den Bahau die Überzeugung entstehen lassen, dass ihnen die guten Geister des Apu Lagan durch die Vermittlung von Tieren und auffallenden Ereignissen den Willen und die Pläne Allvaters mitteilen. Aus dieser Überzeugung hat sich ein ausgebreitetes System von Vorzeichen entwickelt, das nicht nur bei wichtigen Unternehmungen, sondern auch im täglichen Leben, und zwar bei den verschiedenen Stämmen in verschiedenem Masse, eine grosse Bedeutung erlangt hat.
Die Zahl dieser Vorzeichen ist eine sehr grosse und ihre Arten sind sehr verschieden; die wichtigsten, welche unter allen Umständen bei den Bahau Gültigkeit haben, werden dem Vogelkluge entnommen. Es handelt sich hierbei hauptsächlich darum, ob gewisse Vögel rechts oder links vom Beobachter auffliegen oder ihre Stimme hören lassen. Die beiden massgebendsten der wahrsagenden Vögel der Bahau sind der hisit oder sit (Anthreptes malaccensis) und der te̥lăndjăng (Platilophus coronatus), beides auf Borneo sehr verbreitete Honigvögel. Die Kĕnjastämme legen ausserdem viel Gewicht auf das Erscheinen einer roten Trogonart (Trogon elegans) und eines verbreiteten braunen Falken mit milchweissem Kopf (Habiastur intermedia).
Zu den wahrsagenden Tieren gehören ferner auch das Reh, kidjang [109] (Cervulus muntjac) und eine schwarze Schlange mit 4 weissen Längsstreifen und einem lackroten Kopf, Bauch und Schwanz (Doliophis bivirgatus Boie).
Da auch ein sorgfältiges Befragen und Befolgen der Vorzeichen den Bahau nicht genügend erschien, um sich Tamei Tingeis Wohlwollen und somit ein glückliches Leben ohne Krankheit und Unglück zu verschaffen, erfanden sie ein System von Verbotsbestimmungen, eine religiöse adat, die ihnen zwar jede Freiheit des Handelns benimmt, ihren ängstlichen Gemütern jedoch eine grosse Beruhigung gewährt.
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf die zahlreichen Arten der Verbotsbestimmungen näher einzugehen; sie durchziehen das ganze Leben der Bahau derart, dass der Leser mit den Bewohnern von Mittel-Borneo gleichzeitig auch diese religiöse adat kennen lernen wird. Einige Beispiele mögen aber erläutern, was die Bahau im allgemeinen mit den ständig bei ihnen wiederkehrenden Worten “pe̥māli” und “lāli” bezeichnen.
Unter pe̥mali (Hauptwort) und lāli (Eigenschaftswort) wird in der Busangsprache alles, was sich auf religiöse Verbote bezieht, verstanden. Das Wort lāli hat die gleiche Bedeutung wie das polynesische tabu, wie das malaiische pantang und das buling im Kapuas-Malaiisch. Die Dajak legen dein lāli einen doppelten Sinn bei: das eine Mal bedeutet es “verboten” im allgemeinen, so wird z.B. beim Tode eines Häuptlings die Niederlassung und der Flusslauf für lāli erklärt, d.h. sie dürfen von keinem Fremden betreten werden; ferner ist es lāli, zu bestimmten Zeiten etwas Bestimmtes zu essen, zu tun, zu sagen. Das andere Mal wird lāli in dem Sinne von “geweiht” gebraucht, z.B.: “luma lāli” = “geweihtes Reisfeld”, das nur für religiöse Zwecke benutzt werden darf; “haureg lāli” = “geweihter Hut”, der nur bei religiösen Zeremonien aufgesetzt werden darf u.s.f. Wie dem Eigenschaftswort “lāli” kommt auch dem zugehörigen Hauptwort “pe̥māli” eine doppelte Bedeutung zu. Mit “pe̥māli” werden sowohl alle durch die religiöse adat vorgeschriebenen Verbotsbestimmungen als auch geweihte Gegenstände bezeichnet. Alle symbolischen Gegenstände, durch welche die Priesterinnen den Geistern ihre Wünsche vortragen, heissen “pe̥māli”, desgleichen alle Gegenstände, die überhaupt beim Gottesdienst gebraucht werden.
Obgleich die Bahau mit Hilfe der guten Geister und der Vorzeichen [110] selbständig mit Allvater in Verbindung treten können, halten sie unter Umständen doch noch eine besondere Vermittlung durch berufene Personen für notwendig. Durch die Erfahrung belehrt, dass auch eine gewissenhafte Beobachtung der Vorzeichen und Verbotsbestimmungen nicht im stande ist, sie vor Krankheit und Unglück zu schützen, wenden sie sich in schwierigen Fällen lieber an Menschen, die ihrer Meinung nach der Geisterwelt näher stehen als sie selbst, um Rat und Hilfe.
Eine eigentliche Priesterkaste existiert bei den Bahau nicht; die Personen, die eine Vermittlung zwischen Volk und Geisterwelt übernehmen, behalten ihre sonstigen Berufe als Ackerbauer, Hausfrauen u.s.w. stets bei. Die Zahl der weiblichen Priester ist eine weit grössere als die der männlichen; sie alle werden dājung (singen = dājung) genannt.
Die Pflichten der dājung sind sehr mannigfaltig; ihre Hilfe wird bei bösen Träumen, Krankheit, Tod und Unglücksfällen von ihren Stammesgenossen beansprucht; eine wichtige Rolle spielen sie auch; wie wir später sehen werden, bei den Ackerbaufesten. Die dājung sind zugleich auch die Gebildeten und Weisen des Stammes; denn sie sind es hauptsächlich, welche die Überlieferungen des Stammes bewahren, ausser der göttlichen auch die weltliche adat kennen, sich stets auf der Höhe der medizinischen Wissenschaft erhalten und diese auch praktisch anwenden.
Die dājung halten Versammlungen und Lehrstunden, in welchen die Jüngeren zwei Jahre lang unterwiesen werden. Die jungen Priester haben eine Probezeit zu überstehen, in welcher sie allerhand unangenehme Dinge tun müssen, wie z.B. Erde essen. Während der Lehrzeit tragen die Priesterinnen bei Festen Röckchen mit weissem Mittelfelde.
Trotzdem ich alle Ackerbaufeste bei den Mendalam Kajan mitmachte, beobachtete ich exaltierte Zustände der dājung nur in rudimentärer Form. Es war beim Neujahrsfeste, als eine der Hauptpriesterinnen, Tipong Igau, den Geistern die auf einem Opfergerüst (lasa) ausgebreiteten Geschenke als Opfer anbot. Sie umkreiste in immer schneller werdendem Tanze das Opfergerüst, bis sie zuletzt an ihm emporkletterte und es schüttelte, als wollte sie die Opfer gen Himmel steigen lassen. (Siehe Kap. VIII).
Um ihr priesterliches Amt antreten zu können muss die junge dājung zuvor durch einen guten Geist beseelt werden. Der Vorgang [111] der Beseelung wurde mir erst bei den Mahakamstämmen klar; ich beobachtete indessen bereits bei den Mendalam Kajan, dass einer jungen Priesterin eine am Opfergerüst befestigte Schnur in die Hand gegeben wurde, längs welcher der Geist sich auf sie herablassen sollte; eine ältere Priesterin weihte sie unterdessen in die Geheimnisse der priesterlichen Wissenschaft ein.
Bei den Bahau fehlt es zwar nicht an Frauen mit allerhand Nervenkrankheiten wie Epilepsie, sie gehörten aber nie zu den dājung, die alle als brave Hausmütter und -väter ihren Pflichten auf ruhige Weise nachkamen.
Die dājung geniessen seitens des Volkes grosse Achtung; selbst wenn die Ungeschickteren unter ihnen bei den religiösen Tänzen oft unverständliche und komische Sprünge und Bewegungen ausführen, erregen sie doch nie die Heiterkeit der Zuschauer.
In sexueller Hinsicht spielen die dājung auch durchaus nicht die Rolle der blian (Priesterin) und des basir (Priester) am Barito, ihr sittliches Leben ist untadelhaft.
Das Priesteramt verschafft an und für sich keine besonderen Vorrechte und Vorteile. Die eifrigen und gewandten dājung können allerdings, trotzdem sie einen Teil ihrer Einnahmen den sie beseelenden Geistern und höheren Göttern opfern müssen, sich durch ihr Amt eine reiche Erwerbsquelle erschliessen.
Die Priesterinnen sind verpflichtet, den Verbotsbestimmungen strenger als die Laien nachzukommen.
Äusserlich unterscheiden sich die dājung von den Laien nur, wenn sie ihres Amtes walten, durch ein bis mehrere besondere Armbänder und bei festlichen Gelegenheiten durch schöne, auf besondere Weise geschlungene Schale.
Jede Niederlassung am Mendalam besitzt ihre eigenen dājung, die mit einander in keiner Verbindung stehen; auch sind die religiösen Gebräuche selbst bei benachbarten, verwandten Stämmen von einander etwas verschieden.
Die dājung bedienen sich während ihrer Amtshandlungen einer besonderen, älteren Sprache, die von der gegenwärtigen verschieden ist und dahaun to̱ (Geistersprache) genannt wird.
Ausser durch die Sprache treten die dājung mit den Geistern auch durch Herstellung verschiedener Gegenstände in Verbindung, die sie selbst teils als Ausdruck ihrer Wünsche, teils als Opfergaben betrachten. [112] Diese symbolischen Gegenstände sind alle aus sehr einfachem, dem Pflanzenreiche entnommenem Material verfertigt und werden, wie weiter oben bereits ausgeführt ist, mit allen Gegenständen, Vorschriften und Verbotsbestimmungen, die auf den Gottesdienst Bezug haben, als pe̥māli zusammengefasst.
Sobald die Priesterschaft mit der Geisterwelt in Verbindung treten will, benachrichtigt sie diese durch Schläge auf alte, kupferne Becken oder runde, kupferne Platten, die 3–4 dm Durchmesser haben und mit einem 5 cm hohen Rande versehen sind. Die vibrierenden Töne dieses Instrumentes begleiten jede religiöse Handlung, man hört sie aber nie bei anderen Gelegenheiten.
In der Wirksamkeit der dājung lassen sich zwei Hauptaufgaben unterscheiden: die erste besteht darin, die bruwa des Menschen zu dessen Lebzeiten am Entfliehen zu hindern oder, wenn sie bereits entflohen ist, sie zurückzuholen und sie nach dem Tode des Menschen sicher nach Apu Ke̥siọ zu geleiten (anter); die zweite verlangt eine Vermittelung zwischen der Menschen- und Geisterwelt in allen Dingen, die den Ackerbau, die eigentliche Lebensquelle der Bahau, betreffen. Betrachten wir zunächst, wie sich die Priester ihrer ersten Aufgabe entledigen.
Unter einer me̥lă verstehen die Bahau eine religiöse Handlung, die den Zweck hat, die beunruhigte Seele eines Menschen, die im Entfliehen begriffen oder bereits entflohen ist, durch besänftigende Mittel und mit Hilfe der guten Geister zum Bleiben bzw. zur Rückkehr in den Menschen zu bewegen. Sobald ein Familienglied schlecht geträumt hat, sich krank fühlt oder Unglück erlitten hat, wird eine dājung zur Vornahme einer solchen me̥lă herbeigerufen. Auch mit gesunden Menschen wird eine me̥lă vorgenommen, wenn es sich darum handelt, ihre Seele für ein bevorstehendes, beunruhigendes Ereignis, wie z.B. eine Reise, feierliche Handlungen u.s.w. vorzubereiten.
Soll ein körperlich oder geistig Kranker geheilt werden, so findet die me̥lă stets in seiner Wohnung statt. Der gewichtige Tag wird morgens gegen acht Uhr mit einer besonders guten Mahlzeit, an der sowohl die Familie als auch die Priesterin teilnimmt, eingeleitet. Die Mahlzeit besteht aus Huhn, Fisch, Reis, Ei und einer Gemüsesuppe. Von allen diesen Herrlichkeiten wird für die Geister etwas auf die Seite gelegt und später zu einer Geisterspeise verarbeitet, welche, je nachdem es sich um Krankheit, böse Träume. oder einen Unglücksfall handelt, mit besonderen Zutaten versehen zu einer blăkă, dem materiellen [113] Ausdruck des von dem leidenden Teil Gewünschten, vereinigt wird. Einige dieser Geisterspeisen werden an die Kindertragbretter und die Dachfenster, durch welche die guten Geister eintreten sollen, gehängt.
Ausser durch Leckerbissen erfreuen die dājung die guten Geister auch durch Geschichtenerzählen; am Boden hockend berichten sie ihnen stundenlang die Stammesgeschichte oder sie erzählen ihnen allerlei Sagen, wie die von Bĕlawan Buring, von denen sie annehmen, dass auch die to̱ sie mit Interesse und Vergnügen anhören.
Mit allerhand derartigen Vorbereitungen verstreicht der Vormittag; nachmittags schlachtet einer der männlichen Hausgenossen ein Ferkel, dessen Blut auf Bananen- und sawang-Blättern (Cordyline javanica Bl. β.) aufgefangen wird, um später bei der eigentlichen me̥lă als Geistertrank zu dienen. Unterdessen hat sich die Priesterin auf einer schönen Rotangmatte vor dem offenen Dachfenster, durch welches die Geister eintreten sollen, niedergelassen und zwar nach Kajanweise mit gekreuzten Beinen hockend, das Haupt auf die rechte Hand gestützt.
Vor ihr stehen allerhand schöne Dinge: hübsche Zeugstücke, Perlenketten, alte Schwerter und Gonge, ausserdem die blăkă. Am Dachfenster hängt die ălān bruwa, der Seelenweg, eine Schnur mit Lockmitteln, welche der entflohenen Seele bei der Rückkehr den Abstieg durch das Fenster erleichtern soll. Die singende Priesterin sucht nun mit Hilfe der Geister von Apu Lagan die verirrte Seele des Patienten längs des ălān bruwa zurückzuholen. Glaubt sie ihr Ziel erreicht zu haben, so befördert sie die Seele in ein Körbchen mit Geisterspeise und setzt dieses, nachdem es sorgfältig geschlossen worden, in einer dunklen Ecke der Wohnung nieder. Hierauf geniesst die Familie wieder ein kräftiges Mahl, bei dem das Ferkelchen das Hauptgericht ausmacht.
Der Einbruch der Dunkelheit giebt das Zeichen für den Beginn der eigentlichen me̥lă. Türe und Fenster werden geschlossen, ein altes Schwert und eine Speerspitze werden mit der Geisterspeise und den mit Ferkelblut besprengten Blättern versehen und der Patient niedergesetzt. Er stützt den einen Fuss auf das Schwert, während ihm die Priesterin den Arm von oben nach unten mit der Speerspitze streicht. Die Handlung hat den Zweck, die verirrte Seele, welche die Priesterin vorher aus dem Korbe genommen und in das Haupt des Kranken geblasen, in dessen Körper fest zu halten. Nachdem der Patient wieder in den Besitz seiner bruwa gelangt ist, werden auch seine Angehörigen auf die gleiche Weise behandelt, um für ihr [114] Gesundbleiben zu sorgen. Hiermit ist die me̥lă zu Ende und die Priesterin kehrt beim, belohnt mit einem Schwert und vier bis fünf Perlen, deren Wert, wenn die behandelte Familie reich ist, 7½ fl das Stück betragen kann.
Wie im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, führen die dājung die me̥lă, je nach dem Zweck, den sie erfüllen soll, auf verschiedene Weise aus; das Prinzip ist aber stets das gleiche: eine Beruhigung der Seele mittelst ihr angenehmer Dinge.
An dem Tage nach der me̥lă ist den Hausbewohnern jede Arbeit verboten, auch dürfen sie mit den Dorfgenossen nicht verkehren, ihre Wohnung ist lāli. Als Zeichen hiervon legen sie sich ein besonderes Perlenarmband (le̥ku me̥lă) um, in dessen Mitte sich acht rote Perlen, an den Seiten je vier gelbe, vier blaue und vier schwarze, kleinere Perlen befinden; abgeschlossen wird die Kette durch zwei braune Früchte einer Coïx-Art, welche die bösen Geister zu vertreiben im stande ist. Dieses Armband wird erst am Ende des zweiten Tages abgelegt.
Ungefähr auf die gleiche Weise wird die me̥lă vorgenommen, wenn es sich um jemand handelt, der sich beunruhigt fühlt, der schlecht geträumt oder Missgeschick erlebt hat.
Gilt es das Wohlsein eines Häuptlings oder das des ganzen langen Hauses, so genügt eine Priesterin für die me̥lă nicht, sondern es vereinigen sich drei bis vier der ältesten, um ihren Einfluss auf die Geisterwelt geltend zu machen.
Sowohl bei der me̥lă als bei anderen Gelegenheiten spielt das Ei als Opfer eine besondere Rolle. Augenscheinlich liegt der Grund darin, dass ein Ei einen leicht zu beschaffenden und billigen Opfergegenstand bildet; die Kajan jedoch leiten den Ursprung dieses Gebrauches von folgendem Begebnis ab:
Umwo, das Kind eines Elternpaares Te̥djulong Apong und Buro Ling, fiel einst in den Fluss und kam nicht wieder zum Vorschein. Darüber entstand so viel Jammer und Verzweiflung im Hause, dass selbst die Geister oben aufmerksam wurden und untersuchten, was eigentlich geschehen war. Zwei grosse Geister, Be̥larè Kingan Tuman Tana und Be̥larè Tuman Langit, sandten mitleidsvoll aus ihrem Himmel ein Ei herab, um mit dessen Hilfe die entflohene Seele des Kindes zurückzurufen. Die Eltern wussten jedoch nicht, was mit dem Ei zu beginnen sei, wickelten es in ein Tuch und legten es unter ihre [115] Schlafstätte. Nachts träumte ihnen, dass es gut sei, das Ei an den Fluss zu bringen und ins Wasser zu werfen. Das taten sie denn auch in aller Feierlichkeit und, als sie nach Hause zurückkehrten, fanden sie zu ihrer Freude das Kind auf der Galerie sitzen.
Als die Eltern ihr Kind badeten, trat das Ei an die Oberfläche des Wassers und trieb den Fluss hinab, sie erkannten es jedoch nicht und stiessen es weg. Das Ei schwamm aber langsam den Fluss wieder hinauf; da nahmen die Eltern es als Spielzeug für das Kind mit nach Hause und bewahrten es in Tüchern. Nach Verlauf einiger Zeit, während welcher das Kind immer gesunder wurde, krochen aus dem Ei ein Hahn und eine Henne hervor. Da merkten die Eltern, dass das Ei ihnen von den Geistern gesandt worden war und eine besondere Bedeutung hatte, und seit der Zeit bringen die Kajan den to̱ Eier und Hühner als Opfer dar. [116]
Kapitel VI.
Opfergaben der Bahau: kawit—Die pemáli: bei der melă, beim Erntefest, in den Reisscheunen, auf dem Reisfelde, beim Säen, beim Neujahrsfest, bei der melă der Namengebung, bei der melă gegen Krankheit, bei der Rückkehr von grossen Reisen—Das legén—Schwierigkeiten bei den Nachforschungen auf religiösem Gebiet—Usun, die Oberpriesterin—Schöpfungsgeschichte der Mendalam Kajan.
Ihre zweite wichtige Tätigkeit, die Vermittlung zwischen dem Volke und der Geisterwelt, von welcher der Ausfall der Ernte abhängig ist, entwickeln die Priesterinnen bei den Ackerbaufesten; diese liefern daher die beste Gelegenheit, um in den Gottesdienst der Bahau einen Einblick zu gewinnen. Betrachten wir im folgenden die Art und Weise, in welcher die Priesterinnen ihre vermittelnde Rolle auszuführen suchen.
Als das wirksamste Mittel zur Anlockung der Geister betrachtet man das Anbieten verschiedener Esswaren. Schweine, Hühner, Eier, Fische und Reis werden als die wahren Götter- und Geisterspeisen angesehen. Bei einer gewöhnlichen me̥lă werden nur Ferkel und Hühner geschlachtet, während die grossen Schweine, und zwar nur die männlichen, für die grossen Festlichkeiten aufbewahrt werden. Ungeteilt werden den Geistern nur Ferkel, Küchlein und Eier angeboten, von den Schweinen und anderen Speisen erhalten sie nur kleine Teile. Die Geister begnügen sich nämlich mit dem geistigen Teil, der in dein Opfer steckt, das nach Auffassung der Bahau auch beseelt ist, und überlassen den körperlichen dem Genuss des Menschen.
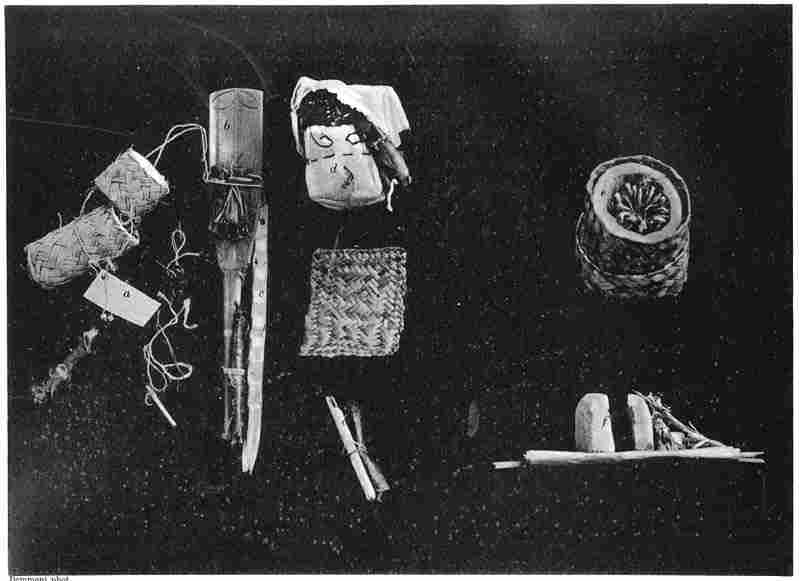
Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Die Opfergaben werden in Form von kawit gereicht, die bei keiner religiösen Handlung fehlen dürfen. Es sind dies kleine Rollen aus Bananenblättern, in welche Esswaren eingewickelt werden. Jede Rolle enthält, der bei den Bahau heiligen Zahl acht entsprechend, acht Lagen. Jede dieser Lagen wiederum besteht aus einem viereckigen, handgrossen Blattstück, auf welches ein zweites, kleineres, ausgefranstes Blatt und dann etwas Hühner- oder Schweinefleisch, Fisch, Reis oder [117] Mais gelegt wird; das Ganze wird mit einem fingerbreiten Blattstreifen bedeckt. Liegen acht derartiger Schichten aufeinander, so werden sie in Form einer Zigarre zusammengerollt und mit ungedrehten Bastfasern, deren Enden nicht geknüpft, sondern nur verschlungen werden dürfen, gebunden und die kawit ist fertig.
Flüssige Opferspeisen werden den Geistern gewöhnlich in Bambusgefässen gereicht.
Eine gleich wichtige Rolle wie die kawit spielen bei religiösen Handlungen die anderen pe̥māli, mittelst derer die Priesterinnen den Göttern und Geistern die Wünsche des Volkes auszudrücken suchen.
Die Herstellung dieser pe̥māli kostet den Priesterinnen viel Zeit; denn sie sind, je nach der Gelegenheit, für welche sie verwendet werden sollen, verschieden, ausserdem oft sehr kompliziert und zahlreich. Befassen wir uns zunächst ausführlich mit den pe̥māli und deren Anwendung.
Bevor der Reis geerntet (nge̥luno̱) wird, lässt jeder Bahau in seinem Hause eine me̥lă stattfinden und sich und die Seinen für die bevorstehende gewichtige Arbeit vorbereiten; tut er dies nicht, so darf er an der gemeinsamen Festmahlzeit nicht teilnemen. Die Sorge für die Vorbereitungen zum Erntefest überlässt er dem Häuptling.
Die Priesterin hat für diese me̥lă, die abends stattfindet, tagsüber drei pe̥māli zu verfertigen: das kahe̱ parei, das tuhe̱ lāli und das ao̱ lāli.
Das kahe̱ parei ist ein Stück einer Fruchtschale, an der zwei kawit und einige usut, jede aus zwei an eine Schnur gereihten Perlen bestehend, befestigt sind. Die usut, fünf an Zahl, heissen: usut parei (Reis), usut baha (entspelzter Reis), usut kane̥n (gekochter Reis), usut ata (Wasser) und usut apui (Feuer); für alle diese usut verwendet man am liebsten alte Perlen. Unter usut wird im allgemeinen ein Geschenk oder eine Busse zur Besänftigung einer erzürnten Seele verstanden; man bringt z.B. ein usut mit, wenn man als Fremder zu einem kleinen Kinde kommt (Siehe pag. 74.).
Tuhe̱ lāli heisst ein aus einem Kürbis verfertigter Löffel von altmodischer Form, an den vier kawit mit Mehl, Ei, Fisch und gekochtem Reis gehängt werden.
Ao̱ lāli ist ein hölzerner Spatel, wie man ihn beim Reiskochen stets gebraucht; auch er wird mit einer kawit versehen.
Mit dem kahe̱ parei werden bei der stattfindenden me̥lă alle Familienglieder von der Priesterin berührt, erst ihr Gesicht, dann ihre [118] Brust. Der Vorgang wird mit pe̥le̥sāt bezeichnet. Darauf ist jeder mit dem ao̱ lāli ein paar Reiskörner und trinkt mit dem tuhe̱ lāli etwas Wasser. Dann beginnt die Festmahlzeit.

Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Wie alle Gegenstände, welche bei religiösen Handlungen gedient haben, werden auch diese pe̥māli sorgfältig aufbewahrt.
Der eben erwähnte Reis ist der erste der neuen Ernte. Er muss, nach alter Sitte, in einer auf Backsteinen ruhenden Pfanne gekocht werden. Die Backsteine, drei an Zahl, zwei grosse (ăngăn băngă) und ein kleiner (ăngăn te̥pă), werden für diese Gelegenheit besonders hergestellt. Die zwei grossen Steine stehen, auf eine Kante gestützt, auf dem Herde und tragen die Pfanne; der kleinere Stein wird an einen der grösseren gelehnt und trägt eine kawit. Zur Abwehr böser Geister dient ein mit Haken versehener Bambusstab (udak āwăk), der beim Gebrauch an den kleinen Stein gelehnt wird. Diese Backsteine sind so ziemlich das einzige Überbleibsel der früheren Töpferkunst, die bei den verwandten, aber von den malaiischen Händlern seltener besuchten Stämmen jetzt noch im Schwange ist.
Bei der Festmahlzeit wird der neue Reis für alte tapfere Männer auf besondere Weise zubereitet; man kocht ihn, in Bananenblätter eingewickelt, in Form von länglichen Päckchen, welche aufgerollt werden. Jeder der Tapferen erhält acht solcher an einer Schnur befestigten Rollen.
Auch das erste Einbringen des Reises in die Scheune findet mit Hilfe der dājung statt, welche mit den Reisseelen unterhandeln muss, um sie für ihren künftigen Aufenthalt in der Scheune günstig zu stimmen. Die hierfür verwendeten pe̥māli sind bei den verschiedenen Stämmen verschieden.
Die dājung von Tandjong Karang gebrauchen das barang bulit, die von Tandjong Kuda den te̥lu mit hiko̤̱p bulit und die der Ma-Suling den sān lāli. Alle diese pe̥māli dienen dem gleichen Zweck, dem Anlocken; Auffangen und Aufbewahren der Reisseelen.
Zum barang bulit gehört eine winzige Leiter, ein Spatel, beide mit kawit versehen, und ein geschlossenes Körbchen. In diesem befinden sich, ausser einer kawit, Haken und Dornen von Pflanzen und Schnüre aus Pflanzenfasern, um die Reisseele nötigenfalls gewaltsam festzuhalten. Bei der Handlung streift die Priesterin die Reisseele mit dem Spatel längs der Treppe in den Korb, soll heissen: sie bringt die Seelein die auf Pfählen ruhende Reisscheune.
Das te̥lu mit dem hiko̤̱p bulit ist eine mit einem weissen Kattunstreifen [119] gebundene Bambusdose, in der sich einige kawit, eine Schnur und eine winzige Leiter befinden. Auf dieser Leiter wird die Reisseele mit dem hiko̤̱p bulit (Schöpfnetz) in das Bambusgefäss befördert, hier von der dājung mit der Schnur festgebunden und das Ganze in der Scheune aufgehängt. Netz und Leiter sind ebenfalls mit kawit versehen. Neben dieser Form existiert in Tandjong Kuda noch eine andere: zwei Bambusgefässe mit kawit, die neben einander an einer Schnur in der Scheune hängen; man unterscheidet an diesen die: tāwe̱ (Schnur) le̥po̱ (Scheune), parei (Reis), welche als Seelenweg dient, und das te̥hă hāto̱ to̱ko̱ hāwo̱, Gefäss für die Aufbewahrung der eingefangenen Seele.
Die sān (Leiter) lāli der Ma-Suling besteht aus einer Leiter, einem Bambusgefäss und einer Hühnerfeder, die zur Überführung der Seele in das Gefäss dient. Das Bambusgefäss enthält die kawit und wird, mit weissen Kattunstreifen umwickelt, man nennt es: njină bruwa parei wörtlich: Beruhigung der Reisseele.
Unter njină wird das tägliche Anlocken, Liebkosen und Beruhigen der Kinderseelen durch die Mütter verstanden. Eine genaue Wiedergabe des Wortes ist unmöglich (Über den Vorgang siehe pag. 72).
Um sich auch für das folgende Jahr eine gute Ernte zu sichern, halten es die Bahau für notwendig, nicht nur in den Besitz der Seelen des augenblicklich vorhandenen Reises zu gelangen, sondern auch der Seelen des auf den Boden gefallenen, von Hirschen, Affen und Schweinen gefressenen Reises habhaft zu werden. Auch hierfür haben die Priester ein Mittel erfunden: sie stellen ein te̥lu hina (Hauptwort zu njina = beruhigen) her, das ist ein Bambusgefäss (te̥lu) mit kawit, an welches vier Haken aus Fruchtbaumholz befestigt werden, mit deren Hilfe die verlorenen Reisseelen, falls solche vorhanden, aus der Ferne herbeigelockt werden können. Nachdem die Seelen im Behälter geborgen worden, hängt man ihn in der Wohnung auf.
Die Ma-Suling haben für den gleichen Zweck ein anderes pe̥māli, die usu bruwa = Seelenhände. Es sind zwei aus Fruchtbaumholz geschnitzte Hände, zwischen welche acht kawit gesteckt werden; man umwickelt sie mit Kattun und bindet sie mit einer Perlenschnur fest. Die Hände haben die gleiche Bedeutung wie die Gefässe, sie sollen die herbeigelockten Reisseelen festhalten. Auch dieses pe̥māli wird im Wohngemach aufgehängt.
Ein anderes pe̥māli, das barang usut, wird erst dann in die Reis [120] scheune gebracht, wenn diese bereits gefüllt worden ist; es ist ein Korb, dessen Inhalt die Reisseelen, falls diese erzürnt sind, beruhigen soll. In dem Korbe befinden sich noch drei andere, kleinere Körbe, in denen kleine und grosse rote Perlen als eigentliches usut (Geschenk) liegen; ausserdem enthält das Körbchen noch die Endtriebe eines Krautes und als Symbol für das Festhalten der Seele einige gekrümmte Dornen.

Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Wenn eine Kajanhausfrau für den täglichen Gebrauch Reis aus der Scheune holt, sorgt sie dafür, dass die Reisseelen hierüber nicht in Zorn geraten. Zu diesem Zweck hat sie das barang lāli stets in der Scheune hängen; seine wesentlichen Bestandteile sind ein Bündel Spähne aus Fruchtbaumholz und ein viereckiges Körbchen aus tika. Mitten zwischen die Spähne wird ein Ei gesteckt und unten am Bündel ein kleines Bambusgefäss mit Zuckerrohrsaft (te̥lāng te̥wo̱) als Opfergabe angehängt. Das Körbchen enthält eine geweihte Matte für das Holen des Reises: brāt (Matte) lāli (geweiht) ālā (holen) parei (Reis) und vier kawit, die besondere Namen tragen: barang bal o̱k; pakan le̥po̱ halam; pakan le̥po parei; bal o̱k a de̥sak; ausserdem einen Reishalm. Die Frau beginnt damit, als Opfer für die bruwa parei, etwas Zuckerrohrsaft auf das Ei zwischen den Spähnen zu giessen. Während sie den Deckel des Korbes abhebt, die kleine Matte herausnimmt, auf den Boden breitet und einen Reishalm darauf legt, erklärt sie den Reisseelen den Zweck ihres Kommens. Darauf kniet sie, einige Sprüche murmelnd, vor der Matte nieder und isst ein einziges Korn von dem Reishalm. Nachdem sie das barang lāli sorgfältig geborgen, geht die Frau mit der erforderlichen Menge Reis ruhig nach Hause.
Matten spielen beim Trocknen und Stampfen des Reises eine wichtige Rolle, es ist daher wahrscheinlich, dass das barang lāli und das Verzehren des Reiskorns den Reisseelen die bevorstehende Behandlung andeuten sollen.
Beim Beginn einer neuen Ernte werden die gebrauchten pe̥māli durch andere ersetzt, nur das bararg lāli und kahe̱ parei werden sorgfältig mit einer mit Reis gefüllten Eierschale bewahrt und bei jeder neuen Jahreszeit wieder zum Vorschein geholt. Wenn diese pe̥māli verloren gehen, ist eine me̥lă der dājung erforderlich, um die Reisseelen wieder anzulocken.
Beim Beginn des Reisschnitts stimmt man die Geister dadurch günstig, dass man ihnen Esswaren und Wasser, vielleicht einen Aufguss [121] auf Gemüseblätter, darbietet. Das Opfer, tāwe̱ lāli luno̱ genannt, wird von Kindern auf das Reisfeld getragen. Die Esswaren: gekochter Reis, Fisch und Huhn, befinden sich in drei von den dājung mit einfacher Schnitzerei verzierten Bambusbehältern, das Wasser in einem vierten, niedrigeren Behälter; an alle Gefässe werden kawit gehängt. Abends werden die Reishalme des ersten Schnittes in einem geweihten Korbe (ingan lāli) unter Beckenschlag feierlich ins Haus getragen. Aus der Wohnung sind Hunde und Katzen vorher entfernt worden, auch hat man die amin gereinigt und den Eingang mittelst einer Tür aus Rotanggeflecht verschlossen. Die Tür (bile̱t) besteht aus zwei durch eine Rotangschlinge verbundenen Hälften und einem hölzernen Handgriff. Soll der Korb in die Wohnung getragen werden, so streift man die Schlinge mit dem Handgriff ab, die beiden Flügel des Pförtchens springen auf und der Reis kann seinen Einzug halten.
Die mit dem Saat- und Neujahrsfest verbundenen Festlichkeiten haben auf die Verehrung der Götter Tamei Tingei und Djaja Hipui Bezug, daher besitzen die bei dieser Gelegenheit gebrauchten pe̥māli teilweise eine allgemeinere und wichtigere Bedeutung als die vorhin angeführten; denn nun gilt es nicht allein, die betreffenden Geister zufrieden zu stellen, sondern man verlangt von ihnen auch eine gute Ernte, Gesundheit und Wohlfahrt. Die dājung verfertigen für das Neujahrsfest ein besonderes pe̥māli, das sie auf dem geweihten Reisfeld (luma lāli), das als Ort der heiligen Handlung dient, aufrichten. Mit geringen gelegentlichen Abweichungen besteht dieses pe̥māli aus Stücken von Fruchtbaumholz, die durch ihre Form den Geistern die Bitten des Kajanvolkes übermitteln sollen. Die Konstruktion ist die folgende:
Mitten im Reisfeld werden, mit ihren zugespitzten Enden in die Erde gebohrt, vier etwa 20 cm lange runde Pfähle dicht neben einander in einer Reihe aufgestellt. Die beiden mittelsten tragen oben je einen Kranz von acht kleinen, in das Holz eingesenkten Häkchen, während zu den seitlichen Pfählen je eine Treppe führt. Die Pfähle sind oben mit zwei schmalen Brettern gedeckt; vor und hinter ihnen stecken etwas längere Hölzer mit ihren hakenförmigen Enden schräg im Boden. Die Bedeutung des Ganzen ist diese: die vier aufrechten Pfähle bitten die Götter um langes Leben, die beiden Hakenkränze um ein Ansammeln von Reichtümern, die beiden Treppen um ein Übersteigen aller Schwierigkeiten, die schief im Boden steckenden [122] Hölzchen um einen Boden, aus dem sich Reichtümer heben lassen. Dieses pe̥māli, als pe̥lāle̱ bezeichnet, wird beim Saatfest und später beim Neujahrsfest am Fuss des dangei aufgerichtet, nachdem man die Erde vorher mit dem Blut eines Küchleins als Opferspeise befeuchtet hat (Siehe Kap. VIII).
Das pe̥māli bliang unterscheidet sich vom pe̥lāle̱ hauptsächlich dadurch, dass die Hakenkränze durch acht längere Haken, die man rings um die vier Pfähle steckt, ersetzt werden. Zwischen die Haken werden als Opfergaben kleine Fische gelegt. Die Pfähle und Haken des pe̥māli bliang stecken nicht, wie beim pe̥lāle̱, in der Erde, sondern in einem Körbchen mit Klebreis, das mit einem Deckel verschlossen wird. Nachdem das Körbchen mit einem Streifen weissen Kattuns umwickelt worden, befestigt man an ihm ein winziges te̥ko̱k, zwei Bambusstäbe und eine Matte, mit denen beim Neujahrsfest die Geister angerufen werden; augenscheinlich ein Mittel, um die Aufmerksamkeit der Geister des Apu Lagan zu erregen. Jede dājung verfertigt am dritten Tage des Neujahrsfestes ihr eigenes pe̥mali bliang und stellt es am folgenden Tage mit denen der anderen Priesterinnen gemeinschaftlich an den Fuss des Opfergerüstes (lăsā); nach dem Feste bewahrt jede ihr pe̥māli.
Für das grosse Neujahrsfest werden ausserdem auch noch andere pe̥māli verfertigt.
Das eben erwähnte te̥kok wird dann täglich an Stelle eines Gongs zum Anrufen der Geister gebraucht. Es besteht aus einer geweihten Matte (brāt lāli) aus tika und zwei Bambusstäben von 3 dm Länge, welche am unteren Ende durch einen Halmknoten geschlossen sind. Beim dangei-Feste ruft die Priesterin morgens und abends die Geister an, indem sie in bestimmtem Rhythmus mit den Bambusstäben abwechselnd auf die Matte schlägt und den Geistern halb singend, halb rezitierend die Leiden und Wünsche des Stammes zu kennen giebt.

Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
An das Gestell (lăsā), an welches die Opfergaben gehängt werden, wird stets eine Rotangschnur und an diese wiederum eine tāwe̱ nangan (Leitbahn) befestigt, welche als ālān to̱ (Weg der Geister) dienen soll. Der ālān to̱ hängt an einem kupfernen Haken und besteht aus einem weissen Kattunstreifen, der in einige rote und blaue Streifen ausläuft, an welche jede der anwesenden dājung ein Bambusgefäss mit Zuckerrohrsaft, eine Art Halskette aus Perlen und verschiedene usut (Geschenke) und Schleifen, von mir unbekannter Bedeutung, bindet. [123] Neben dem weissen Kattunstreifen hängt eine Perlenschnur mit kawit, die mit einer Schlinge endet. Bei der Beseelung kommt der gute Geist längs dieser Schnur auf die darunter stehende dājung herab.
Die Art und Weise, in welcher die Bahau ihren Dorfgenossen ihre Neujahrswünsche ausdrücken, ist sehr eigentümlich. Die dājung verfertigen nämlich vor Beginn des Festes für die ganze Bevölkerung das hāto̱ kawit bruwa, ein Bündel von acht Haken aus Fruchtbaumholz und drei kawit, die zusammengebunden in einem Säckchen aus weissem Kattun stecken. In eine Schlinge aus ungedrehten Pflanzenfasern, welche aus dem Säckchen hervorragt, muss der Nachbar bei der Begrüssung seinen Finger stecken, der dann hin- und herbewegt wird; bisweilen wird auch der gute Einfluss, der von der Schlinge ausgeht, auf das Haupt des Betreffenden geblasen. Indem man die Seele des Freundes mittelst der Schlinge mit dem wohlschmeckenden Inhalte des Sackes in Berührung bringt, erweist man ihr etwas Angenehmes, ausserdem wünschen die hölzernen Haken ein Sammeln von Reichtümern für das folgende Jahr.
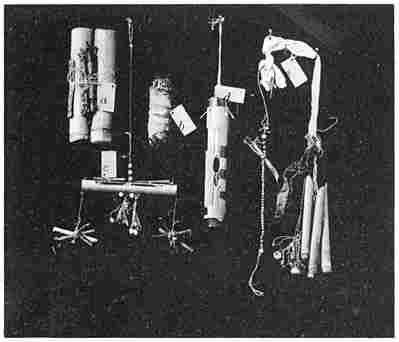
Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Beim marong uting (Schweinefleischessen, siehe Kap. VIII) verfertigen die dājung in der Wohnung des Häuptlings das bo̱wo̱ nangan, ein Gestell, auf welchem den Geistern das Schweinefleisch in kawit angeboten wird. Das bo̱wo̱ nangan ist ein mit Schnitzwerk etwas verziertes Bambusrohr, das horizontal an einer Perlenschnur hängt, innen und aussen mit kawit versehen ist und in der Mitte acht usut trägt, deren Bedeutung mir nicht klar ist. Zu beiden Seiten des Bambusrohres hängen gekreuzte Stöckchen mit kleinen Schnüren, an welche die kawit mit Schweine- und Hühnerfleisch gebunden werden. Tagsüber hängt das bo̱wo̱ nangan in der dangei-Hütte, abends wird es aber stets in die amin des Häuptlings zurückgebracht. Statt der Speerspitze und des Schwertes, welche die dājung bei einer gewöhnlichen me̥lā gebraucht, verwendet sie bei der gelegentlich des marong uting stattfindenden mĕla die te̥lingan uting, eine geschliffene Muschelschale (hulọ), an der eine alte Perlenschnur und eine kawit hängen. Diese von Nautilus-Arten stammenden Schalen und die alten Perlen werden bei den Bahau sehr geschätzt und sind daher, gleich wie alte Waffen, sehr geeignet, die Seele in gute Stimmung zu versetzen, besonders in Verbindung mit dem geliebten Schweinefleisch.
Nach der Sitte aller Stämme von Mittel-Borneo wechseln auch die Kajan am Mendalam ihren Wohnsitz, sobald für den Reisbau kein [124] geeigneter Boden in der Nähe mehr vorhanden ist. Bein Einzug in das neue Haus erbittet die Oberpriesterin den Segen Tamei Tingeis und zwar drückt sie ihre Bitte durch das be̥tungul, ein für den Häuptling bestimmtes pe̥māli aus. Dieses befindet sich, wie das pe̥māli bliang, in einem Körbchen aus tika und besteht aus einem selbst gebrannten irdenen Töpfchen (taring ladang) mit unregelmässigen Vertiefungen am Böden, in welche 2 × 8 Haken aus Fruchtbaumholz gesteckt werden; auch diese bitten um eine Anhäufung von Schätzen. Zwischen den Haken werden in geknickte Bambushölzer kleine Fische als Opfer geklemmt. Das Töpfchen bittet Tamei Tingei wahrscheinlich um Nahrungsmittel. Mit den Backsteinen, die beim Kochen des ersten Reises verwendet werden (pag. 118), bildet es das einzige Überbleibsel der alten Töpferkunst. Beim Umzug bleibt das be̥tungul, wie auch das le̥ge̱n der Verstorbenen, im verlassenen Hause zurück.
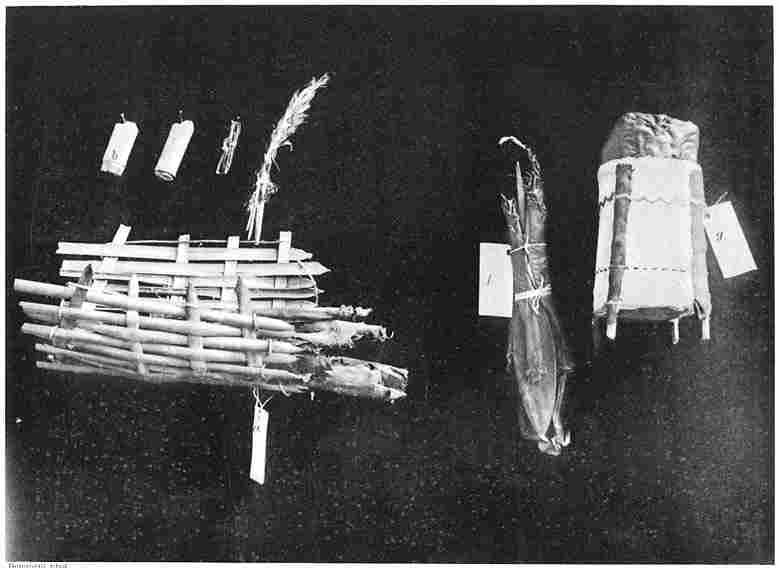
Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Ein wichtiges pe̥māli, das speziell für die dājung bestimmt ist, heisst hle̱n lāli und ist ein längliches Kissen aus weissem Kattun. Das Kissen wird von den Frauen bei ihrer Aufnahme unter die dājung hergestellt und bei jedem Saatfest zum Vorschein geholt und mit einer kawit versehen. Neben den kawit, welche die Zahl der Amtsjahre der Priesterin angeben, sind verschiedene Perlenschnüre angebracht. Ein Armband (kamang tukan oder lăku dājung) wird nur auf dem Kissen der ältesten Priesterin befestigt und darf nie entfernt werden. Auf jedem Kissen findet man drei usut: eine rote, eine gelbe Perle und einen Knopf (hulọ). Die Besitzerin trägt diese usut, sobald sie ihres Amtes waltet. Die gelbe Perle dient zugleich für die me̥lā der Priesterin selbst; fühlt diese sich nämlich krank oder fürchtet sie ein Entfliehen ihrer Seele, so sucht sie ihre bruwa zu beruhigen, indem sie die gelbe Perle fest in die Hand drückt. Neben den erwähnten drei usut wird das usut lāli angebracht, das aus kleinen Perlen besteht und während des Saatfestes täglich angefasst werden muss. Bei dieser Gelegenheit werden auch die Hausgenossen gesegnet, indem die dājung ihr Haupt mit dem Kissen, das für gewöhnlich sorgfältig in einer Kiste bewahrt wird, in Berührung bringt.
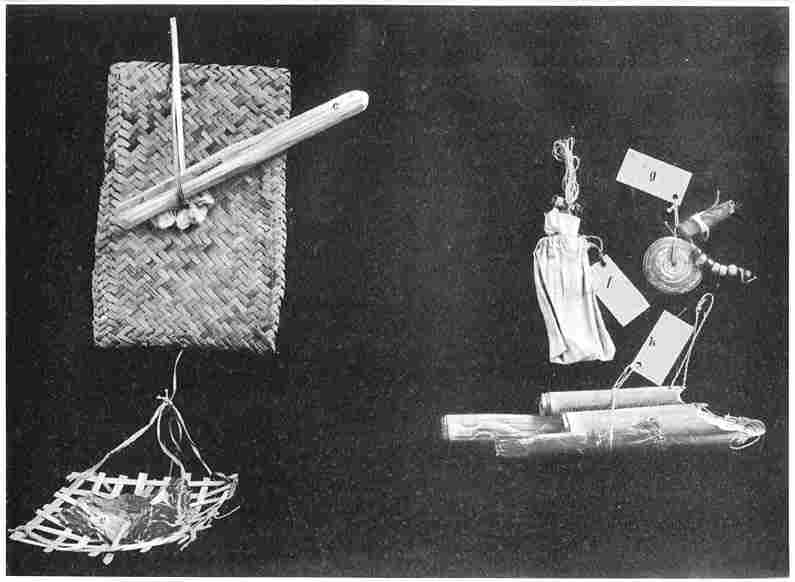
Religiöse Gegenstände der Mendalam Kajan.
Je nach der Gelegenheit, bei welcher eine me̥lā vorgenommen wird, benützt die dājung zur Beruhigung der Seele verschiedene Gegenstände. Bei der me̥lā, welche während des Saatfestes bei der zweiten Namengebung des Kindes stattfindet, streicht die Priesterin dieses in Tandjong Kuda mit einem durch kawit und Perlen geweihten Kürbis. [125] Gleich wie auch in Tandjong Karang, werden die Füsse des Kindes in Wasser gebadet, das in zwei hierfür bestimmten Bambusgefässen mit kawit mitgebracht worden ist. Kürbis und Bambusgefässe heissen zusammen: tāwe̱ anak o̱k = Seelenbefriediger eines kleinen Kindes.
Wenn die Kajan durch Vermittlung der Priesterinnen die Hilfe der Geister anrufen, stellen die Priesterinnen für die me̥lā folgende Gegenstände her: pe̥māli kaja, kawit me̥lā und malat kădjă.
Der pe̥māli kaja ist eine besondere Art von Seelenweg, welchen die dājung benützt, wenn es eine verirrte Seele mit Hilfe der guten Geister zurückzurufen gilt. Dieser Seelenweg, welcher an dem offenen Dachfenster angebracht wird, besteht in einer kostbaren Perlenschnur mit zwei gelben Perlen als usut. Auf die Schnur folgt ein aus acht Schlingen zusammengesetzter Knoten, der mit einem Päckchen von acht Haken aus Fruchtbaumholz vier Perlen, vier kleinen kawit, einer Hühnerfeder und einem Stück daun hugul (Dracaena-Blatt) verbunden ist. Die Perlen, die kawit und das in Schweineblut getauchte Blattstück dienen als Beruhigungsmittel für die herankommende Seele; die Haken bitten um Reichtum; die Hühnerfeder wird bei der eigentlichen me̥lă verwandt.
Die Priesterin streift bei der me̥lă die zurückkehrende Seele längs des Seelenweges auf den Knoten, den sie in einem Säckchen und dieses wieder in einem Körbchen bis zum Abend aufbewahrt. Mit der Hühnerfeder bestreicht die Priesterin den Patienten, nachdem sie ihm vorher im Dunkeln die Seele in das Haupt geblasen hat.
Kawit me̥lă wird das alte Speereisen genannt, mit dem die dājung den Aren des Patienten streicht; vier kawit und zwei mit Schweineblut bestrichene Blätter von hugul werden an ihm befestigt.
Malat kădjă ist der Name des alten Schwertes, auf welches der Patient während der me̥lă seinen Fuss setzen muss; auch dieses ist mit kawit versehen.
Die blăkă, die, wie die anderen pe̥māli, morgens vor der eigentlichen me̥lă hergestellt wird, bittet die aufgerufenen Geister um alles, was dem Menschen not tut; sie besteht im wesentlichen aus einem dünnen Flechtwerk in Form einer 1½ □ dm grossen Matte, welche um folgenden Inhalt geschlagen wird: acht sorgfältig hergestellte kawit, ein Päckchen von vier Hühnerfedern (ukur manok), ein gewundenes Stück Rotang (ukur uting) und zwei Bambusstäbe (tawe̱). Die drei letzten Gegenstände haben folgende Bedeutung: ukur manok = Mass [126] für Hühner, bittet die Geister um viele Hühner und giebt zugleich die gewünschte Grösse derselben an; ukur uting = Mass für Schweine, bittet um viele Schweine, ebenfalls mit Grössenangabe; tawe̱ bittet um langes Leben.
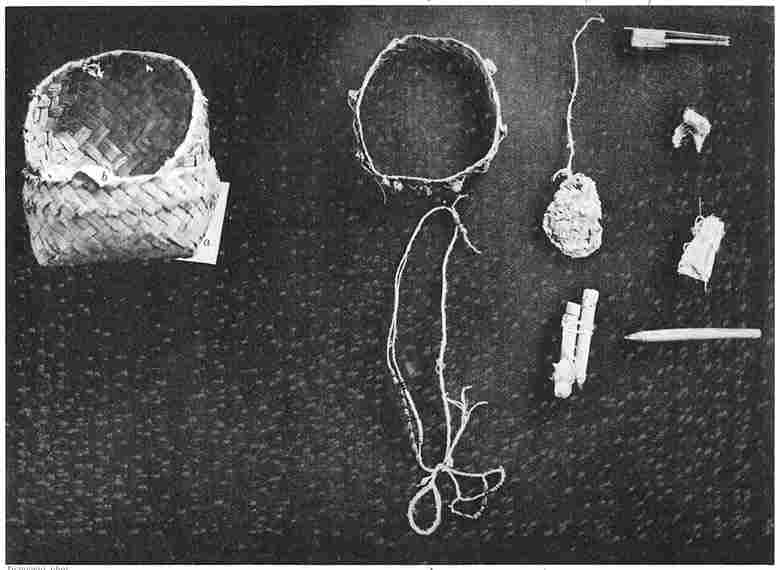
Legen.
Kehren die Bahaumänner von einer langen Reise zurück, so müssen sie, bevor sie das Haus betregen dürfen, vier Tage lang in einer für diesen Zweck besonders hergerichteten Hütte abgesondert leben. Der Anführer der Gesellschaft lässt für diese Zeit durch die dājung eine blăkă ajo̱ herstellen; sie besteht aus einer 2 □ dm grossen Rotangmatte, auf welcher mittelst eines Rotangstückes 2 × 8 Blätter von daue Jong befestigt werden; diese dienen zur Abwehr böser Geister. Zwischen die Blätter wird Reis gestreut. Die blăkă ajo̱ wird später in der Galerie (ăwă) afgehängt. Einen wichtigen Gegenstand für die Zeit dieser Absonderung bildet ferner ein alter Feuermacher der Bahau, der im täglichen Leben schon längst durch Stähl und Feuerstein ersetzt worden ist. Zwischen den Zähnen einer Gabel aus leichtem trockenem Holz wird ein halbiertes Stück Rotang hin- und herbewegt. Durch die bei der Reibung entstehende Wärme werden die abgeriebenen Holzteilchen zum Glühen gebracht und entzünden die feinen Baumbastteile, welche unter der geriebenen Stelle auf eine Matte aus tika gelegt werden. Die Gabel wird mit den Füssen festgehalten.
Mit dem bereits mehrmals erwähnten le̥ge̱n möge die Reihe der pe̥māli abgeschlossen werden.
Das le̥ge̱n, ein aus tika geflochtenes Körbchen, enthält alle Gegenstände, die im Leben des Kajan eine Rolle gespielt haben und nicht vernichtet werden dürfen, weil ihre Seelen sich sonst an dem Menschen rächen könnten.
Man findet im Körbchen folgende Gegenstände:
1. Einen Bambusbehälter mit dem abgefallenen Nabelstrang (obut) und einen zweiten mit einem habung awut, einem pe̥māli, das verhindern soll, dass das Kind zu viel isst und dadurch eine zu schnelle Verdauung erhält.
2. Ein Messerchen aus Bambus (hāling obut) und eine hölzerne Unterlage, die für das Abschneiden des Nabelstranges benützt wurden.
3. Die te̥we̥sing, eine Halskette der Mutter, welche aus Perlen und 2 × 4 Früchten zur Abwehr böser Geister besteht und an welcher die hină ana, die Schlinge vom Kindertragbrett, hängt. Ferner sind an der Halskette befestigt: das lăku krawa, das Armband, das gegen [127] Krämpfe schützen soll und das le̥ku pe̥lă, das Armband, welches das Kind zwischen der ersten und zweiten Namengebung trägt.
4. Das to̱l, ein Stöckchen, mit dem das Kind zum ersten Mal für die Reissaat Löcher in die Erde bohrte.
5. Ein Kreisel (asing), mit dem das Kind zum ersten Mal beim Saatfest spielte.
6. Die Eierschalen (te̥lo̱ lāli), mit welchen das Kind gelegentlich der ersten Namengebung bei der me̥lă gestrichen worden ist.
7. Das Röckchen (tā-ā) und
8. Das Jäckchen (băsong), welche bei der ersten Namengebung zum ersten Mal angelegt wurden.
9. hapin hăwăt, ein Zeugstück, das als Unterlage in dem Tragbrett benützt wurde.
10. Ein Tellerchen aus Kürbisschale (uwit lāli), auf welchem dem Kinde bei der Mahlzeit von Vater und Mutter einige Reiskörner gegeben wurden.
11. Ein Instrument zum Durchbohren der Ohrläppen (natap te̥linga).
12. Ein Stückchen Baumbast mit den ersten Exkrementen des Kindes.
13. Das lawong tika akar, das Kopfband, welches die Mutter während des ersten Lebensjahres des Kindes trug.
14. Das Bambusgefäss, in welchem das erste Badewasser für das Kind geholt wurde.
Aus allem, was im vorhergehenden über die religiösen Vorstellungen der Bahau gesagt worden ist, ersieht der Leser, dass die Besorgnis um die Ruhe ihrer Seelen ihr Tun und Lassen während ihres ganzen Lebens beherrscht. Da die bruwa durch alles, was dem Menschen selbst fremd, unbegreiflich und gefahrvoll erscheint, erschreckt und zum Fliehen gebracht werden kann, was Krankheit oder Tod zur Folge hat, stösst derjenige, der mit Hilfe der Bewohner von Mittel-Borneo in unerforschten Gegenden wissenschaftliche Untersuchungen vornehmen will, auf bisweilen unüberwindliche Hindernisse. Das Betreten eines unbekannten Gebietes, das Besteigen eines gefürchteten Berges, die Photographie, die anthropologischen Messungen u.s.w. erschienen meinem Geleite als gefährliche Experimente, die Wohlsein und Gesundheit aufs ernsteste bedrohten.
Eine besondere Seelenunruhe veranlassten meine Nachforschungen nach ihren Überlieferungen und ihrem Gottesdienst; die Hindernisse, [128] die man mir auf diesen Gebieten daher in den Weg legte, waren sehr grosse. Zum Glück liessen sich die beängstigten Seelen der Baliau meist mit allem, was diese selbst schön fanden, wie hübsches Zeug, Perlen und Geld, beschwichtigen. In bezug auf Mitteilsamkeit in religiösen Angelegenheiten machte sich übrigens, je nach Veranlagung und Höhe der geistigen Entwicklung bei den einzelnen Personen, Verschiedenheiten geltend. Während die einen sich völlig unzugänglich zeigten, konnte ich von den anderen doch mit Hilfe von allerhand Mitteln einiges erfahren. Indessen wären mir die religiösen Vorstellungen der Kajan am Mendalam auch nach elfmonatlichem Aufenthalt in ihrer Mitte ein Buch mit sieben Siegeln geblieben, wenn nicht gerade die Oberpriesterin von Tandjong Karang, Usun, eine rühmliche Ausnahme gemacht und sich in allem, was ihre heilige Wissenschaft betraf, zugänglicher gezeigt hätte. Trotz mancher unangenehmen Eigenschaften meiner alten Freundin kann ich nicht umhin, gerade an dieser Stelle mit Dankbarkeit ihrer zu gedenken.
Usun gehörte zu den wenigen Bewohnern des langen Hauses, die den ganzen Schatz der Überlieferungen von der Geisterwelt und der Stammesgeschichte kannten. Nach der Überzeugung der Kajan war ihr Tun und Lassen daher für die Gesinnung der Geister, somit für das Wohlergehen und den Gesundheitszustand des ganzes Stammes, massgebend. Durch aussergewöhnliche Handlungen, wie es ihre Unterhaltungen mit meiner profanen Person über Religionsangelegenheiten waren, schadete Usus also nicht nur sich selbst, sondern ihrer ganzen Umgebung; begreiflicher Weise sah man unseren Verkehr daher nur sehr ungern. Usun selbst stand ihren Stammesgenossen durchaus nicht furchtlos gegenüber, auch spielte die Besorgnis um das Wohl und Wehe ihrer eigenen Seele bei ihr eine grosse Rolle; ich musste daher jedesmal, wenn sie mir etwas Besonderes erzählt oder gebracht hatte, ihre bruwa mit etwas Geld, Kattun oder Perlen besänftigen, um bösen Träumen oder gar Krankheiten zuvorzukommen. Den Geldstücken schien dabei eine besonders beruhigende Wirkung eigen zu sein, auch wurden sie, um in innige Berührung mit ihrer Seele gebracht zu werden von der Alten beim Abschied gebissen. Auch ihr Enkel, ein ungezogener zwölfjähriger Knabe, beängstigte ihr Gemüt; denn er wollte, wie die übrigen Kajan, nichts von ihrem gefährlichen Umgang mit mir wissen.
Gegen alle diese Schwierigkeiten kämpften in Usuns Seele eine sehr entwickelte Habgier und Eitelkeit auf ihre Wissenschaft und [129] Stellung und, wenn ich mir schmeicheln darf, eine grosse Eingenommenheit für meine Person.
Unter diesen Verhältnissen entwickelte sich unser Verkehr derart, dass Usun, um ihre Umgebung irre zu führen, abends, wenn alle Hausbewohner schliefen, zu mir schlich. Dann packte sie ihre pe̥māli, die heiligen Gerätschaften, die sie für mich verfertigt hatte, aus und steckte die erhaltene Belohnung ein. Wenn sie sich im Dunkeln hie und da fürchtete, nahm sie den Enkel mit, der für die ausgestandene Seelenangst stets auch etwas bekam.
In der Stille meiner Hütte, nur unterbrochen von einzelnen Lauten, die von dem schlummernden Kajanhause herüberdrangen und von dem Gezirp der ewig munteren Grillen, vernahm ich in einem entsetzlichen Gemengsel von Kapuas-Malaiisch und Busang die Geschichte von Usuns Geisterwelt. Das energische Gesicht der alten Dajakfrau gab dem Bilde noch ein besonderes Gepräge. Wurden wir durch Neugierige gestört, so hatte die Alte sogleich ein harmloses Thema bei der Hand und fand sie bei ihrem Kommen meine Hütte besetzt, so schob sie das Mitgebrachte von aussen durch die Mattenwand der Hütte auf meinen Schlafplatz—die Rechnung blieb später nicht aus.
Tagsüber liess Usun ihren Gefühlen freieren Lauf, sprach öfters beim Doktor vor und liess sich zum Gaudium der ringsherum stehenden Jugend bald hier bald da auf allerhand Leiden untersuchen.
Der pekuniäre Vorteil, den Usun aus ihrem Handel mit ihrer priesterlichen Wissenschaft zog, weckte den Neid und die Konkurrenz ihrer Kolleginnen und diesem Umstande habe ich es zu verdanken, dass mir auch von anderer Seite religiöse Gegenstände geliefert wurden, von deren Existenz ich sonst nie etwas erfahren hätte.
Die Schöpfungsgeschichte der Mendalam Kajan, wie ich sie aus dein Munde der alten Usun vernommen, möge dieses Kapitel abschliessen.
Die Schöpfung der Erde, Geister und Menschen.
Eine Spinne liess sich einst vom Himmel an einem Faden herab. Diese Spinne wob ein Netz, in welches ein Steinchen von der Grösse einer sehr kleinen Perle fiel. Das Steinchen wurde grösser und grösser, erst wie eine owe̥r ane̱ (besondere Perlenart), dann wie eine ke̥tobong apo parei (besondere Perlenart), dann wie eine kleine Muschel, wie ein Nagel (hulọ), wie eine aus einer Muschelschale geschnittene Scheibe [130] (barang hulọ), wie ein Fussrücken, wie ein runder Teller (uwit), wie eine Sitzmatte, wie ein Sieb, dann wie eine grosse Matte u.s.f., bis es den ganzen Raum unter dem Himmel einnahm.
Auf diesen Stein fiel eine Flechte (ọro̱ nāpon) vom Himmel, die auf ihm kleben blieb; dann fiel ein Wurm (halang) hernieder, aus dessen Exkrementen die ersten Erdteilchen entstanden. Auch diese Erde nahm immer mehr zu, bis sie den ganzen Stein bedeckte. Da fiel der grosse Baum, kajo̱ aja auch wohl kajo̱ nangei (beim Neujahrsfest verwendet) genannt, vom Himmel; der Baum war anfangs nicht höher als ein Messerchen (nju) dick ist, dann wurde er so gross, als ein Beil (ase̱) dick ist, schliesslich erreichte er die Höhe eines Bananenstammes u.s.f.
Darauf fiel eine Krabbe vom Himmel und begann mit ihren vielen Gliedmassen in der Erde zu graben, wodurch Berge, Täler und Flussbetten entstanden, unter anderen der Kajan, Pĕngian, Danum Pè (Flüsse im Apu Kajan Gebiet beim Batu Tibang) und schliesslich alle übrigen Flüsse von Borneo.
Aus dem Boden wuchsen jetzt allerhand Pflanzen hervor, zuerst die verschiedenen Bambusarten: bulu buring; bulu pusa; bula tengun und bulu tan; dann die Bäume, die das rote zähe Holz für Schilde liefern und die Fruchtbäume. (Alle diese Baumarten werden beim Neujahrsfest zum Bau der dangei-Hütte verwendet). Schliesslich erschienen die Rotangarten: uwe̱ nga; uwe̱ haring; -bohong; -hawon; -kudjo; -nge̥lawáto; -pe̥se̥lilit; -se̥lat; -se̥putan und uwe̱ maling, die alle im Haushalt ihre verschiedene Verwendung finden.
Der Rotang wand sich an dem grossen Baum kajo aja hinauf und der Wind trieb ihn derart, dass er in die vulva des Baumes gelangte, wodurch dieser sehr gross wurde.
Zwei Geister, ein Mann, Be̥lare̱ Adje̱ Awe̱, und eine Frau, Ke̥tot Era Pode̱, kamen jetzt vom Himmel herab und liessen sich auf dem grossen Baum nieder; sie konnten sich aber als Geister nicht begatten. Als der Mann einst einen Schwertgriff schnitzte und die Frau am Webstuhl sass, fielen der Schwertgriff und das Weberschiffchen neben einander auf die Erde und paarten sich. Aus ihrer Vereinigung ging ein menschenähnliches Wesen, Ke̥lowe̥r Ga-aï (= schiebend sich vorwärts bewegen) hervor, dem aber Arme und Beine fehlten.
Die Paarung und ihr Resultat erschreckten die beiden Geister jedoch derart, dass sie eiligst in den Himmel zurückflogen.
Das gliederlose Monstrum bekam zwei Kinder verschiedenen Geschlechtes: [131] Huwar Ane̱ und Uti; deren beide Kinder: Klobe̱ Ange̱ und Klobe̱ konnten sich auch noch kaum bewegen, sie hatten aber ebenfalls zwei Nachkommen: Nguje̥r Bawe̱ und Lahnde̱, die beide nur sitzen (nguje̥r) konnten. Diese jedoch zeugten richtige Menschen: einen Mann Pare̥n Ke̥liter Pulut Luwe̱ und eine Frau Udjung Malen Le̥ke̱.
Die Tochter dieser ersten Menschen, Lahei Lalau, hatte so lange Arme und Beine, dass sie den Himmel berühren konnte. Sie bekam zwei Kinder: Amei Awi und Buring Une̱, die hauptsächlich die Erde und ihre Erzeugnisse beherrschen und daher als die wichtigsten Götter des Ackerbaus verehrt werden. Sie besitzen 2 × 8 Kinder, nämlich:
| Frauen: | Männer: |
| Usun Ke̥ten Apui | Bang Alang Tui |
| Usun Ke̥ten Apui Lawan | Bang Alweg Lawar |
| Hanja Ata Te̥re̱ | Bang A lang Nje̱ |
| Hanja Ata Tujan | ... |
| Husun Djulu Dje̥le̱ | Jok Une̱ |
| ... | Hang Pidang Le̱ |
ferner noch vier Kinder, die als die wichtigsten Mondphasen am Himmel stehen: Ke̥re̥bso̱ = aufgehender Mond; Ke̥lo-ong Pajāng = Halbmond; Kamat = Vollmond und Pe̥nje̥ro̤̱m Do̤̱m = dunkler Mond.
Amei Awi und Buring Une̱ liessen ihre Kinder, um darüber zu entscheiden, wer von ihnen Häuptling, wer Freier und wer Sklave werden sollte, einen Berg hinauflaufen. Die Stärksten, die die Spitze zuerst erreichten, machten sie zu Sklaven, die minder Starken, welche sich halbwegs befanden, machten sie zu Freien und einen Mann mit einem kranken Bein und eine schwangere Frau, die am Fuss des Berges zurückgeblieben waren, machten sie als die Schwächsten zu Häuptlingen.
Sämmtliche Kinder waren jedoch mit der Entscheidung ihrer Eltern unzufrieden und gingen daher nach den verschiedensten Orten im Weltall auseinander, wo sie jetzt als Monde und ähnliche Gebilde ein glückliches Dasein geniessen.
Die Eltern dagegen, die einsam zurückblieben, nahmen ein weisses Tuch und eine Matte und begaben sich zu dem grossen Baum kajo aja. Amei Awi kratzte von dein Baum eine grosse Menge Rinde ab und holte aus dem Walde ein langes Stück Rotang. Nachdem er die beiden Enden über dem Boden befestigt hatte, baute er darauf ein Haus und streute mit seiner Gattin die Baumrinde auf den Fussboden, [132] worauf Schweine, Hühner, Hunde und Menschen aus den Rindenteilchen entstanden. Die Menschen blieben jedoch stumm, obgleich sie ihnen Ohrringe (isang), Ruder (be̥se̱), und andere Dinge gaben. Daher begab sich Amei Awi auf den Fischfang, kochte die Fische und ass einen Teil mit Buring Une̱. Als sie darauf auch den Menschen von den Fischen zu essen gaben, begannen diese zu sprechen.
Von diesen echten Menschen stammen die Bahau ab, die krank werden und sterben können, da sie, wie auch ihre Haustiere, eigentlich aus vergänglicher Rinde (kul kajo̱) bestehen. [133]
Kapitel VII.
Auffassung der Kleidung seitens der Eingeborenen—Zweck der Kleidung—Einfluss der Malaien auf die Kleidung—Alltags-, Fest- und Kriegskostüm der Männer am Mendalam—Kopfbedeckungen—Schmuck—Tätowierung—Ausrecken der Ohrläppchen—Umformung der Zähne—Haartracht—Alltags- und Festkleidung der Frauen—Schmuck—Trauerkleidung—Ausrüstung der Toten—Waffen der Kajan: Schwerter, Speere, Blasrohre—Herstellung der Blasrohre—Pfeile und Pfeilgifte—Schilde.
Stämme, welche stets nackt gehen, kommen auf Borneo nicht mehr vor; dagegen findet man sehr nahe verwandte Stämme, welche, je nachdem sie viel oder wenig mit Fremden in Berührung gekommen sind, über ein zeitweiliges Nacktgehen sehr verschieden denken. Es scheint übrigens, dass die Fremden bei den ursprünglichen Bewohnern Borneos nicht nur auf die Entwicklung der Kleidung, sondern auch auf die Auffassung der Eingeborenen, ob und wann diese überhaupt erforderlich ist, einen starken Einfluss geübt haben. In Sambas, im Sultanat an der Westküste, beobachtete ich, dass bei den mehr landeinwärts und gesondert lebenden Siding Dajak beim gemeinsamen Baden sowohl Männer als Frauen ihre Kleidung gänzlich ablegten, während ihre Verwandten, die in malaiischer Umgebung an der Küste leben, beim Baden stets alte Kleidungsstücke anlegten.
Ähnliche Unterschiede zeigen sich im Innern der Insel bei den grossen Stammgruppen der Bahau und Kĕnja, von denen diese nur wenig, jene dagegen mehr von Malaien beeinflusst werden. Obgleich nämlich sowohl die Bahau als die Kĕnja stets völlig nackt baden, kleiden sich erstere doch unmittelbar nach dem Bad gleich vollständig an, während letztere unbekleidet in ihr Haus zurückkehren und sich erst dort anziehen. Auch um Wasser zu holen und ihre Kinder zu baden, begeben sich die Kĕnjafrauen vorzugsweise nackt zum Flusse. In Stromschnellen und Wasserfällen nehmen die Kĕnjamänner ihr Lendentuch ab, die Bahaumänner dagegen tun das nie. Dass das Schamgefühl und die Begriffe von Anstand sich bei diesen beiden [134] Stammgruppen unter malaiischem Einfluss verändert haben und noch verändern, ersah ich daraus, dass sich die Kĕnja in Gegenwart von uns Fremden in dieser Hinsicht bald wie die Bahau betrugen. So begaben sich die Mädchen und Frauen der Kĕnja nur nachts, wenn wir schliefen, nackt aus ihrer Wohnung zum Flusse.
Als Demmeni einmal spät abends seine Platten entwickelte, bemerkte er sechs unbekleidete junge Mädchen, die zum Flusse gingen; kaum hatten sie aber den roten Schein der photographischen Laterne bemerkt, als sie erschreckt und lachend ins Haus zurückeilten. Auch die Kĕnjamänner schämten sich vor uns Europäern, ihre Kleidung in den Wasserfällen gänzlich abzulegen. Ihr Betragen war nur eine Folge davon, dass unser Geleite von Malaien und Bahau den Kĕnja erzählt hatte, wir Weissen nehmen an dem nackten Erscheinen der Eingeborenen Anstoss, was übrigens gar nicht mit unserer europäischen Auffassung übereinstimmte. Man sieht hieraus, welch eine grosse Rolle angelerntes Schamgefühl bei der Entwicklung der Kleidung spielt.
Da Stämme, die stets völlig nackt gehen, in Borneo nicht mehr vorkommen, ist es jetzt schwer festzustellen, ob der Gebrauch einer Körperbedeckung überhaupt fremdem Einfluss zugeschrieben werden muss.
Augenblicklich dient die Kleidung der Dajak nachweisbar folgen den Zwecken: als Schutz gegen Sonnenwärme bei sämmtlichen Stämmen, als Schutz gegen Kälte nur bei den im rauhen Gebirgsklima lebenden Kĕnjastämmen, als Schutz gegen Einbrennen und Dunkelwerden der Haut, als Schmuck und als Schreckmittel gegen Feinde. Um sich gegen die Sonnenwärme zu schützen, bedecken sich Männer und Frauen bei der Feldarbeit und bei ihren Reisen auf offenen, der Sonne ausgesetzten Flüssen auch den Oberkörper.
Die Frauen, bei denen eine helle Hautfarbe für besonders schön gilt, suchen mehr als die Männer durch Kleidung ein Einbrennen und Dunkelwerden zu verhindern; ihre flachen konischen Sonnenhüte (haung) sind daher viel grösser als die der Männer. (Siehe Taf. Hüte der Bahau).
Eigentliche Kleidungsstücke werden als Schmuck nur selten, bei festlichen Gelegenheiten, getragen. Die Kajan am Mendalam z.B. legen ihre schönsten Kostüme nur einmal im Jahr, zum Neujahrsfest, an; dann tragen die Männer schöne Jacken und die Frauen schlingen sich Schale um die Schultern; Lendentücher und Röckchen bestehen dann auch aus den schönsten Stoffen. [135]
Rechnet man zur Kleidung, wozu man nach der Auffassung der Dajak berechtigt ist, auch Tätowierungen, Umbildungen von Zähnen und Ohren, Hals und Armbänder u.s.w., so findet die Kleidung als Schmuck allerdings eine viel ausgedehntere Verwendung.
Wenn die Bahau ihre Festkleider auch nur selten anlegen, verwenden sie doch auf ihre tägliche Toilette sehr viel Sorgfalt. Besonders ist dies bei unverheirateten jungen Männern und Mädchen und bei Jungverheirateten der Fall. Sind Männer und Frauen erst einige Jahre verheiratet, so tritt die praktische Seite der Kleidung mehr in den Vordergrund. Eine besondere Tracht für Verheiratete und Unverheiratete giebt es nicht.
Die Bahau bekleiden ihre Kinder, sobald sie gehen können. Die Kleinen zeigen aber für die Notwendigkeit und Schönheit von Kleidungsstücken meist gar kein Verständnis und einzelne leisten daher beim ersten Anlegen des Lendentuchs oder Röckchens heftigen, oft Jahre dauernden Widerstand. Die Eltern schreiben diesen Widerstand, wie alles Aussergewöhnliche, dem Einfluss böser Geister zu; daher baten mich die Mütter öfters, ihr eigensinniges Kind zu “belesen,” d.h. durch Lesen in einem Buche den bösen Geist aus ihm zu vertreiben.
Durch den ständigen Verkehr mit den Malaien, die auswärtige Stoffe, hauptsächlich billigen europäischen Kattun, bei ihnen einführen, ist die ursprüngliche Kleidung der Bahau am Mendalam viel stärker beeinflusst worden als die der Stämme am oberen Mahakam und Bulungan.
In früheren Zeiten verfertigten, wie es die Kĕnja und Bahau am Mahakam jetzt noch tun, auch die Mendalam Kajan die Stoffe für ihre Kleidungsstücke selbst; sie webten sie aus Baumwolle oder Lianenfasern oder stellten sie aus geklopftem Baumbast her. Die gewebten Stoffe wurden bei Festlichkeiten oder von den Reicheren getragen, während der Baumbast für die gewöhnliche Arbeitskleidung diente.
Auf die Herstellung dieser Kleidungsstücke verwandten besonders die Frauen viel Sorgfalt und Kunstfertigkeit. Sie webten sowohl prächtige Stoffe als auch einfachere, die dann, wie auch der Baumbast, durch schöne farbige Stickereien verziert wurden. Die Stickereien wurden in hübschen, farbigen Mustern, hauptsächlich im Kettenstich, ausgeführt und legen noch heute von dem Geschmack und Fleiss der damaligen Frauen ein gutes Zeugnis ab. Den Männern fiel die Bearbeitung der verschiedenen Arten von Baumbast zu, auch schnitten sie [136] aus Zeug Figuren aus, welche von den Frauen als Verzierung auf die Kleider genäht wurden.

Gut gekleideter junger Kajan.
Während die eben erwähnten Verzierungen und die schön bestickten Baumbastkleider am oberen Mahakam jetzt noch gebräuchlich sind, findet man am Mendalam Figurenverzierungen nur noch an der Totenkleidung und Baumbast, einfach bearbeitet, wird nur noch bei der Feldarbeit oder als Zeichen von Trauer getragen. An Stelle des Baumbasts wird bei der Trauerkleidung jetzt auch weisser Kattun angewandt, den man vor dem Gebrauch in den Morast legt und dann auswäscht, um ihm den braunen Ton zu geben, der dem Baumbast gewöhnlich eigen ist.
Seitdem der weniger dauerhafte aber billige Kattun am Mendalam eingeführt worden ist, webt man dort überhaupt nicht mehr. Merkwürdiger Weise ist mit der Qualität der Stoffe auch die ihrer Bearbeitung gesunken; denn statt des früheren sorgfältigen Nähens ist jetzt nur noch das Heften gebräuchlich und das Sticken hat ganz aufgehört.
Bei sämmtlichen Stämmen von Mittel-Borneo bekleiden sich die Männer mit einem Lendentuch, die Frauen mit einem Röckchen. Während dieses bei den verwandten Bahau- und Kĕnjastämmen hinsichtlich der Form völlig übereinstimmt, trägt es bei den übrigen Dajak, z.B. den Batang-Lupar, Taman und Ot-Danum, einen ganz anderen Charakter.
Beschäftigen wir uns im folgendem speziell mit der Kleidung der Mendalam Kajan.
Das wichtigste und einfachste Kleidungsstück der Männer bildet das Lendentuch (bă). Bei schwerer Arbeit und auf Expeditionen durch Urwald und über Wasserfälle gebraucht man ein kurzes (huch, das nur einmal um die Hüften geschlungen wird; im Hause und bei Festlichkeiten dagegen tragen besonders die Reicheren bis zu 12 m lange Lendentücher. Ein derartiges Tuch wird stets nur einmal zwischen den Beinen durchgezogen und der Rest dann um die Hüften geschlungen. Gegenwärtig ist weisser, roter und blauer Kattun hierfür am beliebtesten, falls aber die Feldarbeit einen dauerhafteren Stoff erfordert, wählt man Baumbast. Die grosse Haltbarkeit des Baumbasts ist wohl die Ursache, dass er noch nicht gänzlich durch den beim Tragen viel angenehmeren Kattun verdrängt worden ist.

Bahau in Kriegskostüm.
In der Regel wird das Lendentuch nicht verziert; seine Schönheit hängt von seiner Länge und vom angewandten Stoff ab. Zur Alltags [137] kleidung der Männer gehört ferner eine Sitzmatte (tabin) in Form eines 3 × 4½ dm grossen Rechtecks, das oben, an einer der schmalen Seiten, in ein 1½ dm hohes Dreieck verläuft. An der Dreieckspitze sind zwei Schnüre angebracht, mittelst deren die Sitzmatte über den Hüften an den Körper gebunden wird und zwar so, dass die Matte hinten an der Verlängerung des Rückens zu hängen kommt. Die Matte hat den Zweck, die blosse Haut beim Sitzen auf schmutzigem oder nassem Boden vor Verunreinigung zu schützen; sie wird daher beinahe ständig getragen und häufig auch auf Reisen nicht abgelegt. In der Regel werden die Matten aus Rotang geflochten und oft mit roten oder schwarzen Figuren oder mit Knöpfen und Zeugstreifen verziert.
In neuerer Zeit tragen die Männer an Festtagen gern eine lange, bunte, malaiische Hose, falls sie einer solchen habhaft werden können.
Auf Jacken (bāsong) aus Kattun sind die Kajanmänner sehr erpicht; ihre Frauen stellen aber für die Feldarbeit auch sehr gute Jacken aus Baumbast her. Um eine Trennung der Fasern zu verhindern, wird der Bast mit festem Zwirn oder dünner Schnur durchzogen. Bisweilen fassen die Frauen die Bastkleider mit rotem Kattun ein; die Arbeit lässt aber an Schönheit viel zu wünschen übrig. Weiter unterscheidet sich die Festkleidung der Männer von der Alltagskleidung hauptsächlich durch die bessere Qualität des angewandten Materials. Hinzu kommt nur noch ein sarong aus batik1 oder ein anderes schönes Stück Zeug, das quer über der linken Schulter getragen wird. Am Mahakam gebrauchen die jungen Leute diesen Schal, falls sie nicht arbeiten, täglich.
Zum Kriegskostüm der Männer gehört hauptsächlich eine dicke ärmellose Jacke (bāsong kapai), die aus zwei mit Kapok gefüllten Lagen Kattun besteht, welche in rechtwinklig sich schneidenden Linien durchsteppt ist; sie schützt den Oberkörper vor Speerstichen und Schwerthieben.
Als eine Ergänzung dieses ärmellosen Waffenrockes müssen wahrscheinlich zwei Ärmel betrachtet werden, die nur durch den obersten, nicht mehr als 2 dm betragenden Teil eines Jäckchens mit einander verbunden sind. Dieses eigenartige Kleidungsstück ist aus gewöhnlichem Stoff verfertigt und dient als Armbedeckung.
Die Kajan und alle übrigen Stämme auf Borneo tragen über den eben erwähnten Kleidungsstücken einen Kriegsmantel (sunung) aus [138] Tierfellen. Ein Pantherfell (sunung kule̱) gilt als das schönste; aber wegen seiner Kostbarkeit und Seltenheit begnügt man sich auch mit einem langhaarigen Ziegenfell (sunung kading). In früheren Zeiten scheinen mit Tierfiguren bestickte Baumbastmäntel in Form einer Tierhaut gebräuchlich gewesen zu sein, wenigstens wurde mir ein solcher, mit einer Reihe von 8 Schwanzfedern des Nashornvogels verziert, zum Kauf angeboten. Man nannte ihn sunung kapuwa.

Hüte der Bahau.
Ein Kopftuch (lawong) wird von den gewöhnlichen Männern nur gelegentlich, von den Häuptlingen jedoch, um ihre Würde anzuzeigen, täglich getragen. Der Kajan schlingt das Tuch in Form eines Wulstes um den Kopf und zieht seine für gewöhnlich offen hängenden Haare derart hindurch, dass sie unter dem Wulst eine auf die Schultern herabhängende Schlinge bilden und über demselben mit ihren Enden aufliegen. Ausser Baumbast wird besonders bunter Kattun und europäischer batik für Kopftücher gebraucht.
Hüte (haung) benützen die Männer nur gegen Sonnenbrand und heftigen Regen; sie werden aus Pandanusblättern verfertigt und haben die gleiche Form wie die der Frauen, ihr Durchmesser beträgt aber selten mehr als 50 cm (Fig. 5 u. 6 auf Tafel: Hüte der Bahau). Die Frauen, welche die Hüte herstellen, legen bisweilen viel Formen- und Farbensinn an den Tag, indem sie bei besonders schönen Exemplaren in der Mitte einen Beleg, bestehend aus einer Stickerei oder Perlenarbeit, anbringen und das Feld mit hübschen Figuren aus schwarzem Kattun verzieren. Derartige Hüte dürfen indessen nur von hochgestellten Personen getragen und Toten ins Jenseits mitgegeben werden (Fig. 6). Auch ist nur alten Männern gestattet, die Schwanzfedern des Nashornvogels (Buceros rhinoceros) auf ihre Hüte zu heften; häufig werden diese Federn an Perlenschnüren befestigt (Fig. 5).
Eine weitere Kopfbedeckung der Männer bildet die Kriegsmütze. Sie wird in Form eines runden Körbchens aus festem Rotang geflochten und von den Frauen mit besonderer Sorgfalt verziert. Mitten auf dem Boden werden Perlenstickereien und am Rande eigenartige Verzierungen—vorn meist glänzende Metallplatten oder Tiermasken—angebracht. Oben auf die Mütze werden lange Federn gesteckt; die beliebtesten sind die des Nashornvogels, des Argusfasans (Argusianus Grayi) und des Hahns. Für die Mützen gilt, wie für die Hüte, dass die mit breiten schwarzen Streifen gezeichneten weissen Schwanzfedern des Nashornvogels nur von angesehenen Personen oder bewährten [139] Kriegern getragen werden dürfen und dass nur wenigen Auserwählten gestattet ist, deren acht in der Mitte der Mütze von vorn nach hinten anzubringen.
Zu den wichtigsten Schmucksachen der Männer gehören: Bein- (am Mah. se̥khăd) und Armringe (le̥ku), Halsketten (te̥we̥sing, te̥we̥-āng) und Ohrringe (isang).
Die Armringe werden oberhalb der Ellenbogen, die Beinringe unterhalb der Knie getragen und von den Punan oder auch den Kajan selbst aus Rotang oder ke̥bālăn, dem dunkelbraunen oder schwarzen, sehr biegsamen Kernholz einer farnartigen Gebirgsliane, sehr fein geflochten. Bisweilen wird die Farbenwirkung dieser Ringe, die, je nach dem Material, aus dem sie bestehen, le̥ku ke̥bālăn oder le̥ku uwe̱ (Rotang) genannt werden, durch Einflechten goldgelber Pflanzenfasern erhöht. Häufig trägt eine Person bis zu 200 solcher Ringe gleichzeitig.
Diejenigen jungen Leute, welche mit den Batang-Lupar im Sĕrawakschen Gebiet zusammengekommen sind, bringen von diesen Holz- oder Elfenbeinringe mit, die sie dann selbst mit schönen Schnitzereien verzieren.
Auch die jungen Mädchen stellen für die Jünglinge Armverzierungen her und zwar aus Glasperlen, welche sie mit viel Geschmack zu zierlichen, farbenprächtigen Mustern in Form schmaler Bänder aneinanderreihen (Fig. 1 auf Tafel: Schmucksachen der Bahau).
Die Halsketten der Männer bestehen alle aus neuen oder alten und dann bisweilen sehr wertvollen Glasperlen.
Die schmalen, fest am Halse anliegenden Ketten (te̥we̥sing, Fig. 6) sind in der Regel aus bunten kleinen Perlen zusammengesetzt und enden vorn in einer Rosette.
Die frei auf die Brust herabhängenden Ketten (te̥we̥āng, Fig. 11 u. 8) dagegen bestehen aus mehreren Reihen grösserer—bis erbsengrosser Perlen. Bei der Zusammenstellung dieser Perlen wird auf eine gewisse Regelmässigkeit geachtet; sind es jedoch alte Perlen, welche selten in genügender Anzahl und gleicher Form vorhanden sind, so kann eine bestimmte Regel nicht eingehalten werden. Aus gleichartigen alten Perlen bestehende Ketten haben daher einen hohen Wert. Die Kapuasstämme unternehmen monatelange Reisen zum Mahakam, um diese Perlen, die dort noch in grösserer Anzahl vorhanden sind, zu kaufen.
Ausser der Tätowierung fällt bei den Männern am meisten die Umformung, welche die Ohren erlitten haben, auf; im Ausrecken der Ohrläppchen wetteifern sie nämlich mit den Frauen. [140]
Mit der Durchbohrung der Ohrläppchen wird daher, wie im Kapitel IV berichtet worden ist, schon gleich nach der Geburt des Kindes begonnen. Die Zinnringe (isang te̥mhā), welche das Kind anfangs ausschliesslich trägt, werden später häufig durch dicke Kupferringe (hisang te̥mbaga) ersetzt, deren Zahl so weit vermehrt wird, als, ohne Schmerzen und Entzündung zu verursachen, möglich ist. Um die Dehnbarkeit der Ohren zu erhöhen, wird bei Kindern ausserdem öfters innen an der Oberseite der Öffnung ein Einschnitt gemacht.
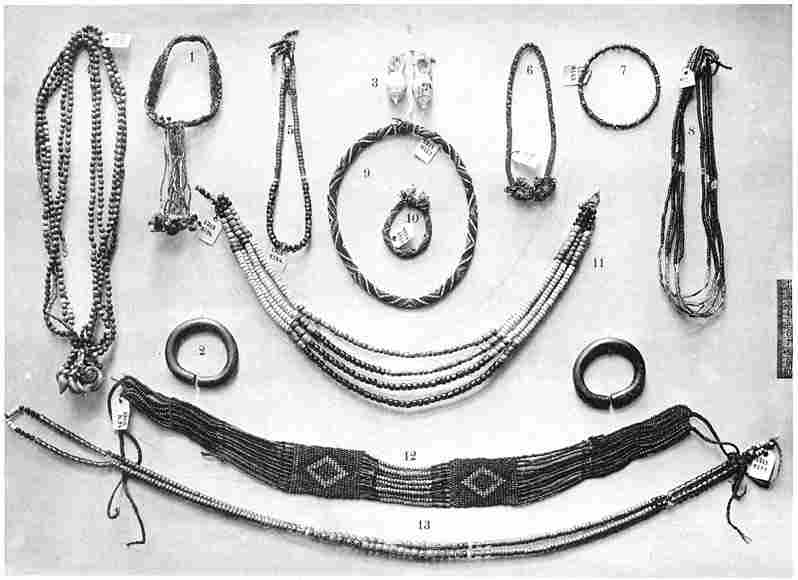
Schmucksachen der Mendalam Kajan.
Die Eltern achten sorfältig darauf, dass bei diesen Operationen keine Entzündungen entstehen, da die dünnen Ohrläppchen sonst Gefahr laufen, durchgescheuert zu werden, was bei sehr kleinen Kindern bisweilen auch vorkommt. Die Ringe erreichen oft ein so hohes Gewicht, dass die Kleinen sie bei jeder lebhaften Bewegung mit der Hand stützen müssen. Durchgerissene Ohrläppchen werden als ernsthafter Schönheitsfehler aufgefasst. Obwohl die Kajan es in der Chirurgie nicht weit gebracht haben, verstehen es einige ihrer Männer doch, die beiden zerrissenen Enden wieder aneinanderwachsen zu lassen; sie erzeugen mit ihrem gewöhnlichen Messer an jedem der Enden eine wunde Oberfläche, legen sie übereinander, wickeln einen weichen Blattstreifen herum und befestigen das Ganze mit einem Faden. Ich sah verschiedene auf diese Weise geheilte Ohren, die vom aesthetischen Standpunkt zwar viel zu wünschen übrig liessen, deren 6–8 mm übereinander gelegte Enden jedoch wieder kleine Ringe zu tragen vermochten.
Wenn die Ohrläppchen durch Verwundung oder Hautkrankheit öfters entzündet werden, entstehen Verdickungen des Bindegewebes (Keloide), welche die Schönheit sehr beeinträchtigen. Ein übrigens hübsches Mädchen sah ich einst ihre derart verunzierten Ohren ängstlich verbergen.
Während die Frauen sich mit diesen Umformungen begnügen, lassen sich die Männer in späterem Alter ausserdem noch oben in der Ohrmuschel eine Öffnung von der Grösse eines Pfennigstückes und häufig auch noch eine zweite über dem Hinterende des ausgereckten Ohrläppchens, anbringen. In diesen Öffnungen dürfen alte, tapfere Männer die Eckzähne (ipe̥n) des seltenen borneoschen Panthers (kule̱) tragen; häufig begnügt man sich auch mit geschliffenen oder ungeschliffenen Bärenzähnen. Diese Zähne werden oft, wahrscheinlich um ein Verlieren zu verhindern, mit einer um Hinterhaupt und Hals geschlungenen Perlenschnur verbunden. [141]
In den grossen Ohrlöchern tragen die Mendalam Kajan gewöhnlich Ringe (isāng) aus eingeführtem Zinn oder Kupfer (Fig. 2); in letzter Zeit schinücken sie sich auch, nach der Sitte der Mahakamstämme, mit einer grossen Anzahl dünner silberner Ringe.
Statt dieser Ringe werden bei festlichen Gelegenheiten auch noch hölzerne oder metallene Ohranhängsel angebracht; sie sind birnförmig und greifen mit einem grossen Haken um das Ohrläppchen herum (Fig. 3). Während die Ringe beinahe ausnahmslos unverziert sind, werden diese eigentlichen Ohrgehänge, sowohl was ihre Form als was ihre Bearbeitung betrifft, mit viel Sorgfalt und Kunstsinn hergestellt.
Weniger auffallend als die Umformung der Ohren ist die der Zähne. Die Schneidezähne werden am Ober- und Unterkiefer von vorn hohl ausgeschliffen; einige lassen sich auch nach Sitte der Punan goldene Stifte durch einen oder mehrere Zähne treiben.
Über den menschlichen Haarwuchs haben sowohl Bahau als Kĕnja sehr eigenartige Anschauungen, die sich zum Teil aus der Tatsache erklären lassen, dass sie selbst gewöhnlich sehr schwach behaart sind. Es flösst ihnen nämlich, da sie selbst an den Anblick stark behaarter Wesen nicht gewöhnt sind, eine Person mit starkem Voll- oder Knebelbart fast Abscheu und Schreck ein. Aus Rücksicht für unsere Gastherren rasierten wir Europäer und einer der Javaner uns daher, so lange der Besitz von Seife es gestattete, regelmässig.
Da die Kajan nur das Haupthaar schön finden, herrscht bei ihnen die Sitte, dass sich sowohl Männer als Frauen alle Haare im Gesicht, in den Achselhöhlen und an der pubis ausziehen. Die jungen Frauen der Mahakam- und Kĕnjastämme halten sich besonders streng an diese Vorschrift; die am Mendalam lassen einen schmalen Streifen an den Augenbrauen stehen.
Alte Männer lassen sich bisweilen, um auf ihre Umgebung Eindruck zu machen, ihren Bart nach Belieben wachsen; junge Leute dagegen sorgen dafür, dass von ihren Barthaaren möglichst wenig sichtbar wird.
Die Männer rasieren sich ohne Seife mit dem gewöhnlichen Messer (nju); die Achsel- und Pubishaare entfernen sie weniger sorgfältig als die Frauen.
Zum Ausziehen der Wimpern dienen kleine, kupferne oder silberne Zangen (tso̤̱p), die stets zu einer vollständigen Toilettenausstattung von Mann oder Frau gehören.
In vorgerücktem Alter oder während der strengen Arbeitszeit verfährt [142] man häufig weniger sorgfältig mit der Entfernung der Haare. Das Haupthaar, das Männer und Frauen sich lang wachsen lassen, wird schlicht zurückgestrichen; zum Kämmen dient ein geschnitzter Bambuskamm.
Bei Frauen gilt langes Haar für sehr schön und, wenn sie sich etwas Kokosnussöl—am Mendalam eine grosse Seltenheit—verschaffen können, versäumen sie nie, ihre Frisur damit einzureiben. Ebenso nehmen sie, sobald sie eines Stückchens Seife habhaft werden, sogleich eine Extrareinigung des Haares vor; gewöhnlich gebrauchen sie dafür Citronensaft. Die Männer lassen das Haar am Hinterhaupt lang wachsen; vorn schneiden sie es gerade und kurz ab und kämmen es glatt auf die Stirn, während sie an den Schläfenstellen über den Ohren einen 5 cm hohen Streifen rasieren.
Betrachten wir jetzt die Kleidung der Frauen.
Das wichtigste Kleidungsstück der Frauen besteht aus einem rechteckigen Stück Zeug, an dessen oberen Ecken Bänder befestigt sind. Dieses Tuch (tă-ā) wird in der Beckengegend um den Körper geschlungen und derart festgebunden, dass es unterhalb der Darmbeinkämme zu liegen kommt. Bei den Frauen am Mendalam schlagen die seitlichen Kanten der tă-ā rechts am Körper, bei denen am Mahakam dagegen hinten über einander. Dieses Röckchen reicht bei den Kajanfrauen bis zu den Füssen herab, bei den Frauen der anderen Kapuasstämme bedeckt das Röckchen, das sie geschlossen tragen, kaum noch die Kniee. Beim Laufen oder wenn sie am Boden hocken, kommen die Beine der Frauen und zugleich die schönen Tätowierungen ihrer Schenkel zum Vorschein.
Die tă-ā ist, je nach dem Vermögen ihrer Besitzerin und nach der Gelegenheit, bei welcher sie gebraucht wird, mehr oder minder hübsch-. sie besteht jedoch immer aus einem Mittelfeld mit 4 ungefähr 1 dm breiten Rändern.
Für Feströckchen wählt man als Mittelstück einfarbigen Kattun oder Seide und für die Ränder meist roter. Flanell oder, falls diese zu kostbar ist, roten oder geblümten Kattun.
Der obere Rand des Röckchens (kohong tă-ā) ist meist etwas breiter als die übrigen und wird in Fällen besonderer Eleganz durch eine Silberborte von dem Mittelstück abgegrenzt.
Einfache Jacken (basong) aus Baumbast oder Kattun werden von den Frauen als Schutz gegen Sonnenbrand bei der Feldarbeit oder [143] auch sonst getragen. Es giebt Jacken mit und auch ohne Ärmel; diese enden hinten in einem ungefähr 1 dm langen Zipfel. Besonders hübsche Jacken werden in den Neujahrstagen getragen; bei häuslichen Festen dagegen werden sie selten angezogen.
Statt der Jacken werden an Festtagen auch Schale gebraucht. Die, Frauen, die keine Priesterinnen sind, bedecken sich dann den Oberkörper derart mit einem langen Stück Zeug von ungefähr ½ m Breite, dass die beiden Enden vorn und hinten bis zur Mitte der Schenkel gerade herunterhängen und der mittlere Teil rechts unter der Achsel liegt, während zwei Falten der linken Tuchhälfte oberhalb der linken Schulter aneinander genäht werden. In Tandjong Karang waren hauptsächlich Schale aus rotbrauner, golddurchwirkter Seide beliebt.
Ähnliche Schale tragen auch die Priesterinnen, wenn sie an Festtagen ihres Amtes walten; sie schlingen sie jedoch nur einmal um den Körper und zwar so, dass die Mitte des Tuches über der Brust zu liegen kommt und die unter den Armen hindurchgezogenen Enden auf dem Rücken festgebunden werden. Nur die Oberpriesterin Usun bedeckte sich den Oberkörper nicht.
Frauen, welche die Würde einer Priesterin noch nicht völlig erreicht haben, unterscheiden sich von diesen durch die weissen Felder ihrer tă-ā.
Alle Frauen der Bahau tragen, sobald ihre Schwangerschaft äusserlich sichtbar wird, ein Tuch (djăd butit), das sie auf gleiche Weise wie die Priesterinnen um Brust und Leib schlingen. Durch straffes Anziehen dieses Tuches erhält der Leib, besonders in den letzten Monaten, eine gute Stütze. Nach der Entbindung wird das djăd butit bald abgelegt und durch ein schmäleres Tuch (djăd uso̱k) ersetzt, welches nur die Brüste bedeckt und noch während mehrerer Monate getragen wird.
Die Frauen schmücken sich mit den gleichen Ohrgehängen wie die Männer, nur lassen sie sich in der eigentlichen Ohrmuschel keine Löcher bohren.
In noch höherem Masse als die Männer, lieben sich die Frauen mit Perlenschnüren, Armbändern und Fingerringen zu zieren. Sie sind es auch, die für den Wert alter Perlen am meisten Verständnis haben, die jede Art beim Namen kennen; für den Besitz mancher dieser Perlen sind sie im stande, sehr viel aufzuopfern. Die neuen Glasperlen, Nachahmungen der alten Formen, werden in Europa verfertigt und über Singapore eingeführt.
Sogar über dem Alltagsröckchen trägt die Kajanfrau einen Gürtel, [144] (tăksā), bestehend aus einer doppelten Reihe oft sehr kostbarer alter Perlen (Fig. 12 u. 13) und dazu zahlreiche Halsketten aus kleineren Perlen (Fig. 11 u. 8).

Frau der Bahau in Trauerkleidung.
Zu den Kostbarkeiten der Frau gehört auch ein Satz elfenbeinerner Armbänder (le̥ku tulāng). Es sind 16–60 glatte Elfenbeinringe, die, in der Grösse aufeinanderfolgend, zusammen einen stumpfen Kegel bilden, der den Unterarm vom Puls bis 1 dm unterhalb des Ellen bogens bedeckt.
Sowohl diese Armbänder als auch die beliebtesten Seidenstoffe werden in China verfertigt und von dort bezogen, vielleicht im Zusammenhang mit den früheren chinesischen Niederlassungen an Borneos Nordküste.
Fingerringe. werden von den Kajan nie selbst hergestellt; besonders beliebt sind die europäischen Ringe aus unechtem Golde mit glänzenden bunten Steinen; sie haben die von den Taman Dajak stammenden kupfernen Ringe fast gänzlich verdrängt.
Sobald in einer Kajanfamilie ein Trauerfall stattfindet, müssen alle Schmuckgegenstände abgelegt werden; auch bunte Kleidungsstücke dürfen dann nicht mehr getragen werden. Die veraltete Baumbastkleidung (kapua) wird wieder hervorgeholt und, falls man diese nicht mehr besitzt, muss alles aus- weissem Kattun hergestellt werden.
Nach Ablauf der Trauerzeit (be̥t lāli) steht es jedem frei, seine frühere Kleidung wieder anzulegen; es kommt jedoch häufig vor, dass die nächsten Angehörigen durch das Tragen dieser Trauerkleidung ihrem Schmerz über den erlittenen Verlust noch Monate und Jahre lang Ausdruck geben. Wittwen zeigen dadurch an; dass sie sich nicht wieder verheiraten wollen.
Zu der eigentlichen Trauerkleidung der Frauen gehört eine besondere Baumbastmütze, bestehend aus einem langen breiten Streifen, der wie ein Tuch von hinten nach vorn um das Haupt geschlungen wird, wo die Enden über einander geschlagen und dann frei von vorn über den Kopf nach hinten bis zum halben Rücken herab hängen gelassen werden; Männer tragen nichts dergleichen.
Als Zeichen der Trauer das Haupthaar abzuschneiden, scheint bei den Mendalam Kajan nicht üblich zu sein; ich weiss auch nicht, ob die Sklaven nach dem Tode des Häuptlings hierzu verpflichtet sind, wie dies am Mahakam der Fall ist.
Die Liebe zu ihren Verstorbenen äussern die Kajan dadurch, dass sie diese für die Reise in den Himmel und. den dortigen Aufenthalt so gut als möglich auszurüsten suchen. In erster Linie handelt es sich [145] hierbei um eine Aussteuer von schönen Kleidungsstücken. Interessanter Weise giebt man sich alle Mühe, diese Kleider nach der Mode der Vorfahren zu verzieren, eine Mode, die sich bis heute noch bei den Stämmen am oberen Mahakam erhalten hat (Tafel: Totenausrüstung).

Totenausrüstung.
Das Charakteristische dieser Totenkleidung besteht in einer Applikation von Figuren, die aus schwarzem Kattun geschnitten sind, auf weiss kattunenen Röcken und Jacken. Von der schwarzen Farbe glauben die Kajan, dass sie auf die bösen Geister, die die Seele des Verstorbenen unterwegs bedrohen könnten, schreckenerregend wirkt. Die Figuren werden von den Männern entworfen und ausgeschnitten und von den Frauen auf die von ihnen verfertigten Kleider geheftet. Gleichfalls von Männern entworfen und von den Frauen angebracht werden auch die mit schwarzer Farbe auf Pandanusblätter gemalten oder aus schwarzem Kattun geschnittenen Figuren für die Hüte und Tragkörbe der Toten. Den Verzierungen der Totenkleidung liegen bei den Kajan als beliebte Kunstmotive der Hund (aso̱, Fig. 3 b), der Mensch (ke̥lunăn, Fig. 3 a) und Stilisierungen beider zu Grunde. Beim Hunde tritt dabei der Kopf stets am deutlichsten hervor; die übrigen Körperteile verlaufen in so zierlich gebogenen Linien, dass man deren Bedeutung im ersten Augenblick meist nicht erkennen kann.
Die Hüte der Toten (Fig. 6 auf Tafel: Hüte der Bahau) werden viel schöner verziert als die der Lebenden; so dürfen, wie bereits gesagt, mit schwarzen Figuren belegte Kopfbedeckungen bei Lebzeiten nur Abkömmlinge der vornehmsten Häuptlingsgeschlechter tragen, nach dem Tode jedoch werden sie neben dem Grabe viel niedrigerer Personen niedergelegt.
Der Leiche selbst wird im Sarge eine eigenartige Mütze aus Baumbast, die nicht mit Zwirn, sondern mit den früher gebräuchlichen umgedrehten Pflanzenfasern genäht werden muss, aufgesetzt. Die Form dieser Mütze ist für Männer und Frauen verschieden; jenen ist eine Zipfelmütze, diesen eine anschliessende, nach hinten etwas verlängerte Mütze vorgeschrieben.
Einen wichtigen Gegenstand der Totenausrüstung bildet ein Tragkorb (ădjāt, Fig. 1), in dem sich ausser Armbändern (Fig. 1 d) und einem Palmblattsack (sāmit, Fig. 1 e) mit Handarbeiten auch noch Gegenstände befinden, die zur Überwindung aller Gefahren auf dem Wege zum Apu Ke̥siọ dienen. Der Korb enthält eine kawit (Fig. 1 c) und zwei kleine Bambusgefässe (Fig. 1 b) mit Speise für die guten Geister, für die auch [146] das Barnbusgefäss (Fig. 1 g) mit Zuckerrohrsaft, das am Tragkorb hängt, bestimmt ist. Drei Säckchen (Fig. 1 h) enthalten eigentümlich geformte Steinchen, die zur Abwehr böser Geister dienen. Zum gleichen Zweck werden auch Tierzähne am Tragkorbe befestigt. Um auf wilden Flüssen das Wasser aus dem Boot schöpfen zu können, wird dem Toten eine halbe Kalabasse (Fig. 1 a) mitgegeben. Schliesslich hängt am Tragkorbe noch eine Leiter (Fig. 1 f), um über Felsen und Abgründe klimmen zu können (Siehe pag. 104).
Den Toten werden auch die schönsten und kostbarsten Armbänder, Halsketten und Ringe für den Aufenthalt im Jenseits in den Sarg gelegt. Daher übt das Grab eines Vornehmen eine so grosse Anziehung auf die raubgierigen Malaien, dass selbst die am Kapuas errichteten Prunkgräber aus Eisenholz nicht fest genug sind, um ihren kostbaren Inhalt vor diesem Gesindel zu schützen. So wurde das Grab von Akam Igaus erster Frau bereits kurz nach deren Begräbnis von Malaien erbrochen und geplündert. Auch in Sĕrawak ist Grabschänderei nichts Unbekanntes.

Schwerter der Mendalam Kajan.
Die Hauptwaffen der Kajan sind Schwert (malat) und Speer (bakir); das Blasrohr (se̥put) spielt als Waffe nur eine nebensächliche Rolle; nur wenige verstehen überhaupt mit ihm umzugehen und kein eigentlicher Kajan ist im stande, das Pfeilgift zu sammeln und zu bereiten. Hauptsächlich sind es Abkömmlinge der Punan unter ihnen, die sich mit Vorliebe des Blasrohrs, der ursprünglichen Waffe der Nomadenstämme, bedienen. Das Schwert dagegen ist für den Kajan nicht nur im Kriege. die wichtigste Waffe, sondern auch im täglichen Leben der wichtigste Gebrauchsgegenstand und wetteifert hierin nur mit dem kleinen Messer (nju, Fig. h, Taf.: Schwerter der Mendalam Kajan), das an der Innenseite der Schwertscheide in einem besonderen Behälter stets mitgetragen wird. Alle Arbeit, die mit Messer oder Beil nicht ausgeführt werden kann, verrichtet der Kajan mit seinem Schwert, das ihn daher nie verlässt. Bei der Feldarbeit verwendet er zum Abhacken von Zweigen und Gestrüpp allerdings ein für diesen Zweck hergestelltes einfaches Schwert; befindet er sich aber auf weiten Reisen, so benützt er sein Kriegsschwert sowohl gegen den andringenden Feind als auch zum Behauen von Brettern und zum Hacken von Brennholz. Kein Kajan nimmt auf Expeditionen zweierlei Schwerter mit, aber jeder sorgt dafür, dass sein Exemplar alle Zwecke erfüllen kann. Daher werden sowohl am Kapuas als am Mahakam für ernsthafte [147] Kriegszüge meist einfache, aber gut gearbeitete Klingen vorgezogen, während die schönen, mit eingelegtem Kupfer und Silber verzierten Exemplare nur als sehr geschätzte Prunkgegenstände dienen. Nur ein kriegerischer Häuptling, wie der Pnihinghäuptling Bĕlarè, nahm auch auf Expeditionen schön gearbeitete Kriegsschwerter mit, aber gelegentlich wird er mit ihnen wohl auch Bäumchen gefällt haben.
Ebenso unzertrennlich wie von seinem Schwerte ist der Kajan von seinem Speer; in den Wohnungen findet man selbst ganze Reihen von Speeren aufgestellt.
In früherer Zeit wurden die Speerspitzen (tite̱ bakir) sehr sorgfältig bearbeitet, gegenwärtig aber begnügt man sich mit sehr schlichten Speeren und auf gute Herstellung der Schäfte wird in der Regel gar nicht geachtet. Einen mit Schnitzwerk verzierten Speerschaft sah ich niemals bei den Bahau, höchstens hatte man ihn rund und glatt poliert.
Die Spitzen der Speere, die täglich aufs Feld mitgenommen werden, gleichen einem länglichen, scharf zugespitzten, zweischneidigen, eisernen Blatte; dagegen haben die wirklichen Kriegsspeere die Form eines ausgehöhlten Meissels; sie sind besonders zum Durchbohren der Schilde sehr geeignet, werden aber nie auf die Jagd mitgenommen.
Zum Werfen dient ein kurzer Speer mit kurzer Spitze.
Das Schwert wird, nach der grösseren Sorgfalt, die auf seine Herstellung verwandt wird, zu urteilen, dem Speere bei weitem vorgezogen.
Beim Verzieren der Schwerter nebst Zubehör entwickeln die Kajan viel Geschmack und Kunstfertigkeit; die Männer beim Schnitzen der Griffe (haupt, Fig. b) und Scheiden (bukăr, Fig. c), die Frauen beim Verfertigen von Gürtelquasten (Fig. d) und Belegen (tāp) aus Wolle oder Perlen. (Siehe Tafel: Schwerter der Mendalam Kajan. u.s.w.).
Die Bestandteile eines Kajanschwertes sind genügend bekannt, weniger ist dies vielleicht mit den Anhängseln der Fall, welche ein gut ausgerüsteter Krieger stets am Schwertgürtel hängen hat. Die wichtigsten sind zwei Bambusdöschen mit Feuerstein (batu te̥kik) und Rauchmaterial: Tabak und Bananenblättern; ferner einige Fläschchen mit Arzneien, meist malaiischen Ursprungs, und endlich allerhand Amulette zur Abwehr böser Geister: Flusssteinchen von besonders auffälliger Form, z.B. länglich und stark gebogen oder mit einem auf natürliche Weise entstandenen Loch in der Mitte; Eckzähne von Hunden und Bären, die an alten Perlenschnüren in einem Bündel beieinander hängen; auch Glöckchen (anhing), besonders solche aus altem Eisen, üben eine schutz [148] bringende Wirkung. Unter all diesen Merkwürdigkeiten fiel mir noch etwas Besonderes auf: ein sogenanntes Hahnenei, ein kleines Exemplar des letzten unfruchtbaren Eies einer Henne. Kein Najan beginnt einen Kriegszug ohne ein solches Ei, das bisweilen Jahrzehnte alt ist und in ein Tüchlein eingewickelt in einem besonderen Bambusdöschen (Fig. e) mitgenommen wird. Sonderbarer Weise glauben auch die Bahau, dass ein derartiges Ei von einem Hahn gelegt wird; am Mahakam verteidigte ein Kajanjüngling mir gegenüber mit grossem Ernst diese Überzeugung.
Alle diese Anhängsel sind an der rechten Seite, wo der Gürtel (Fig. f ) mit einer scheibenförmigen Schnalle (hulọ bukar, Fig. g) geschlossen wird, befestigt. Das Schwert hängt für gewöhnlich an der linken Seite, ist sein Träger jedoch linkhändig, was ziemlich häufig vorkommt, so hängt es rechts und auch die Klinge (tite̱, Fig. a) ist dann rechts und nicht, wie sonst, links ausgeschweift geschmiedet. Auch gewöhnliche Arbeitsschwerter werden für Linkhändige angefertigt.

Schwerter der Bahau.
Hauptsächlich der eigentümlichen Art ihrer Herstellung wegen von Interesse sind die Blasrohre (se̥put): 2 m lange hölzerne Rohre mit gleichmässig weitem Kanal; ist dieser bisweilen nach einer Seite etwas gekrümmt, so wird die Unregelmässigkeit durch Beschweren mit einer Speerspitze (tite̱ se̥put) ausgeglichen. Oft sind die Rohre auch tadellos gerade; unregelmässig gekrümmte sah ich nie.
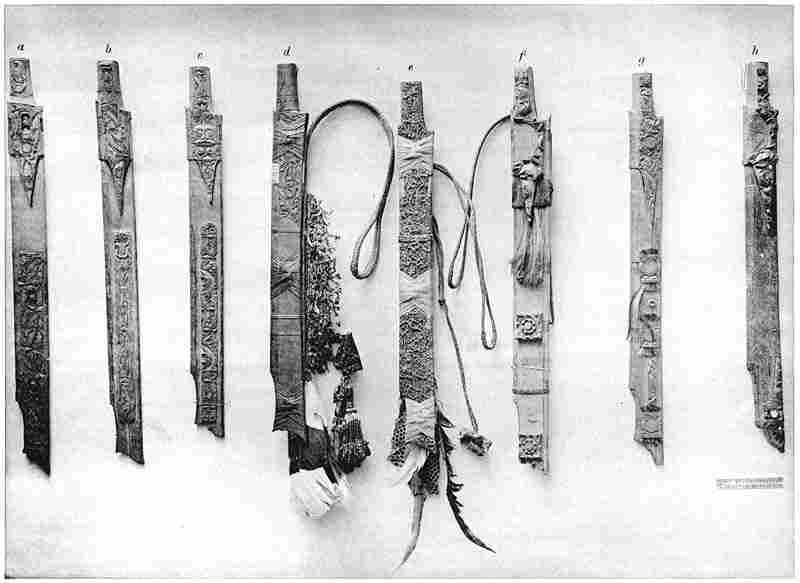
Schwertscheiden der Bahau.
Die meisten Stämme von Mittel-Borneo verfertigen die Blasrohre selbst aus einem harten Stück Holz, das sie zuerst mit einem 2 m langen Eisen bearbeiten, dessen eines, meisselförmiges Ende schart geschliffen ist. Das Holzstück wird zu diesem Zweck in horizontaler Lage gut befestigt und das Eisen, das stets dünner sein muss als der gewünschte Kanal, wird in dessen Richtung gelegt und durch etliche gekreuzte Bambusstücke gegen den Block gestützt. Durch fortwährendes Stossen mit diesem Meissel wird langsam ein Weg durch den Block gebohrt. Bei ununterbrochener Arbeit kann ein Mann einen solchen Kanal innerhalb eines Tages herstellen, bevor das Blasrohr aber fertig ist, hat es noch manche Prozedur zu erleiden. Zuerst schneidet man das überschüssige Holz an der Aussenseite fort und giebt dann der Wand eine gleichmässige Dicke. Das Glätten des Kanals wird durch Schaben bewirkt. Man benützt hierzu ein Reibeisen (tossok se̥put, Fig. a, Taf.: Pfeilköcher), bestehend aus einem doppelt gefalteten Eisenstab, in den man mit einem Schwert oder Meissel Einschnitte gehackt hat. Mittelst eines [149] langen, dünnen Stieles aus festem Holz oder Rotang wird dieses Reibeisen so lange im Kanal herumgedreht und hin- und hergezogen, bis keine Splitter mehr zum Vorschein kommen.

Schwerter mit Scheiden der Stämme von Nord- und West-Borneo.
Zur feineren Bearbeitung verwendet man die harten, scharfen Ränder zweier ungefähr 2 dm langer Bambusstücke, die, an den gleichen Stab zusammengebunden, gerade in die Öffnung passen; durch Hin- und Herdrehen dieser Stäbe erhält der Kanal beinahe die gewünschte Glätte. Den letzten Schliff giebt man ihm durch an einen Stab gebundene Blätter, die unter der Epidermis soviel Kieselsäurekristalle angehäuft enthalten, dass sie sich wie feines Reibpapier anfühlen. Auf ähnliche Weise wird die Aussenfläche des Blasrohrs behandelt: wenn das Messer nichts mehr verbessern kann, kommt eine Art Bambusreibe (kasa se̥put, Fig. b) an die Reihe, bestehend aus dünnen Bambusspähnen, die an 2 Schnüren so nah aneinander gereiht sind, dass sie in gleichen Entfernungen den scharfen, kieselhaltigen Rand nach innen kehren. Diese scharfen Ränder umschliessen das Blasrohr und scheuern, wenn man sie einen Tag lang um die Oberfläche bewegt, alle Unebenheiten ab. Zum Schluss poliert man die Aussenseite mit den gleichen Blättern wie die Innenseite.
Der Kanal hat bei allen Blasrohren ungefähr den gleichen Durchmesser, nur seine Länge variiert innerhalb bestimmter Grenzen. Gute Exemplare besitzen ein Mundstück aus Horn, Zinn oder Kupfer und ein aufrechtes Eisenstäbchen am andern Ende dient dazu, dem Schützen das Zielen zu erleichtern.
Die Pfeile (Fig. c und d), welche mit dem Blasrohr abgeschossen werden, besitzen, je nach dem Zweck, für den sie bestimmt sind, eine verschiedene Form und sind ausnahmslos vergiftet. Ihr Schaft wird aus Palmblattstielen, in der Regel aus denen der Sagopalme (Eugeisonia tristis), verfertigt.
Die Pfeile tragen, damit sie im Kanal dicht anschliessen, an ihrem Ende ein kegelförmiges, sehr leichtes Holzstückchen. Ihre Spitze wird, zum Töten kleiner Tiere, durch Einschrumpfenlassen am Feuer gehärtet und dann mit einer Lage schwarzen Giftes bestrichen (Fig. c.) Sollen mit den Pfeilen Menschen, Hirsche oder Wildschweine getötet werden, so fügt man in einen Einschnitt der Schaftspitze eine feine, dünne Spitze aus Bambus oder am liebsten aus Blech und bestreicht diese mit einer dickeren Lage Gift, die sie zugleich auch im Schaft befestigt, jedoch nur so weit, dass sie, wenn sie einmal durch die Haut gedrungen [150] ist, mit ihren Widerhaken in der Wunde stecken bleibt und sich vom Schafte leicht lösen kann (Fig. d). Bisweilen bewirkt man auch das Abbrechen eines Teiles des Schaftes selbst, indem man ihn mit einem ringförmigen Einschnitt versieht.

Pfeilköcher, Giftbrett u.s.w.
Die Pfeile werden in grösserer Anzahl in einem besonderen Bambusköcher (te̥langa, Fig. e und f) von ungefähr 9 cm Durchmesser aufbewahrt.
Der Bambus ist 30 cm oberhalb des Halmknotens, der den Boden des Köchers bildet, abgeschnitten und am oberen Teil rings um die Öffnung etwas beschnitten, um bequem mit einem Bambusstöpsel (am Kapuas, Fig. e) oder mit einem runden, kegelförmigen, hölzernen Stöpsel (am Mahakam, Fig. f) geschlossen werden zu können. Am Köcher wird ein oft hübsch geschnitzter hölzerner Haken (Fig. g) befestigt, den die Jäger, wenn sie sich auf die Jagd oder in den Krieg begeben, an der rechten Seite in ihr Lendentuch stecken.
In einem Köcher befinden sich ungefähr 24 Pfeile von verschiedener Form und zwar sitzt jeder gesondert in einem dünnen Bambusbehälter (Fig. h), damit sie einander auf langdauernden Reisen nicht beschädigen. Da die Pfeile und ihre Behälter viel kürzer als der te̥langa selbst sind, werden sie noch gesondert in Stückchen Fell (Fig. k) des grossen Eichhörnchens oder des kleinen Hirsches gehüllt, an welchen sie bequem hervorgeholt werden können. Durch verschiedene Farben oder an das Ende aufgeschobene kleine Perlen unterscheidet man die Pfeile für grössere und kleinere Tiere.
Neben diesen fertigen Pfeilen stecken im Köcher noch mehrere Päckchen (Fig. i und l) unvollendeter Pfeilschäfte, deren noch stumpfe Spitzen meistens bereits im Feuer gehärtet worden sind (Fig. m). Jedes dieser Päckchen wiederum befindet sich in einer besonderen ledernen Hülle. Der Köcher enthält ausserdem noch ein Stöckchen mit scharfer Spitze (Fig. n), auf die man beim Schneiden die konischen Hölzchen steckt, welche hinten an die Pfeilschäfte befestigt werden. Die Bahau und Punan nehmen stets einen Vorrat dieser Hölzchen in einer flaschenförmigen Kalabasse (Fig. o) mit hölzernem Stöpsel mit, die sie an den Köcher hängen; da sie überdies auf dem Grunde des Köchers immer ein bis mehrere Stücke Pfeilgift mitnehmen, können sie auch im Walde stets neue Pfeile herstellen. Neben der Kalabasse hängt noch ein Bambusbehälter mit Zunder und Feuerstein (Fig. p), die auf Reisen stets mitgeführt werden.
Die Gifte, welche die Stämme von Mittel-Borneo für ihre Pfeile [151] benützen und durch welche unbedeutende Wunden oft tötlich wirken, sind sehr verschiedenen Ursprungs. Die Bahau unterscheiden 6 verschiedene Arten von Pfeilgiften, die sich von ebenso vielen verschiedenen Bäumen und Lianen herleiten; sie heissen: tase̥m; tase̥m te̥lāng; ipu kajo̱; ipu aka; ipu tana und ipu se̥luwăng.
Die zwei tase̥m-Arten werden aus den Giften verschiedener Pflanzen, welche in ganz Mittel-Borneo, sowohl am oberen Kapuri, oberen Barito und oberen Mahakam als am oberen Kajan vorkommen, zusammengesetzt; daher können die tase̥m-Gifte von allen Stämmen, die diese Flussgebiete bewohnen, hergestellt werden.
Dagegen wachsen die die ipu-Gifte liefernden Pflanzen nur am oberen Kapuas und oberen Barito, so dass sie nur von den in diesen Gebieten umherschwärmenden Punan und Bukat gesammelt und den anderen Stämmen verkauft werden. können. Die ipu-Gifte werden nämlich, als die wirksameren, den tase̥m-Giften vorgezogen. Da die ipu liefernden Pflanzen auch am Kapuri nur an bestimmten Stellen vorkommen, müssen die Sammler oft weite Züge unternehmen, um die Gifte zu finden. Eine gute Fundstelle für die betreffenden Pflanzen bilden die Wälder am Fuss des Bukit Tilung im Mandaigebiet.
Die Herstellung der Pfeilgifte und die sie liefernden Pflanzen sind in Mittel-Borneo nur den Jägerstämmen der Bukat und Punan oder deren Abkömmlingen unter den ackerbautreibenden Dajakstämmen bekannt; daher ist es nur unter besonders günstigen Umständen möglich, sich Pfeilgifte von bekannter Herkunft und die dazu gehörigen Pflanzen zu verschaffen.
Auf meinen drei Reisen in Borneo glückte es mir nur im Jahre 1894, in den Besitz einer einigermassen vollständigen Sammlung der ipu-Gifte und des dazugehörigen Herbariums zu gelangen. Bei meiner zweiten Reise 1896 waren die Bukatsöhne, die früher bei den Mendalam Kajan wohnten und mir zu der Sammlung verholfen hatten, fortgezogen und ich konnte in vier Monaten keine zweite zuverlässige Sammlung zu Stande bringen. Im Jahre 1898 erhielt ich zwar die verschiedenen Gifte und das Holz und die Blätter der ipu-Pflanzen, aber man führte mich mit den Blüten und Früchten, für die die richtige Zeit augenscheinlich noch nicht gekommen war, irre. Diese letzte Sammlung wurde von Dr. Boorsma im botanischen Institut zu Buitenzorg untersucht; die erlangten Resultate sind in “Mededeeling uit ’s Lands Plantentuin” (deel 52) veröffentlicht worden; ihnen entnehme [152] ich auch die weiter unten angeführten Bestandteile der Pfeilgifte. Die beiden Gifte: tase̥m und tase̥m te̥lāng, werden gewonnen, indem man die gleichnamigen Bäume anzapft und den ausfliessenden Milchsaft auffängt. Der tase̥m-Baum erreicht eine bedeutende Grösse, der tase̥m te̥lang dagegen wird nicht über 1 dm dick.
Der Milchsaft wird mit dem wässerigen Auszug aus dem geriebenen Bast einer Liane, aka kia, vermengt. Die Mischung wird in einem alten eisernen Topf, der für andere Zwecke nicht mehr gebraucht wird, bis zu Sirupdicke eingedampft; die Masse erhärtet beim Abkühlen. Das Gift wird vor dem Gebrauch fein gerieben und mit den Blättern von gambir utan (Euphorbiacee) gemengt, ein Verfahren, für welches besondere, oft schön verzierte Brettchen (Fig. q) und Reib stöcke (ligan, Fig. r) verwendet werden.
Die tase̥m-Gifte werden auf weite Expeditionen in viereckigen Körbchen aus Palmblattscheiden (takong, Fig. s) mitgeführt und vor dem Gebrauch in der Nähe des Feuers aufgehängt, um sie zäh-flüssig werden zu lassen.
Eine Analyse des Pfeilgiftes, das einen zähen, schwarzen Extrakt mit intensiv bitterem Geschmack liefert, stellte folgende Bestandteile fest: Antiarin, das giftige Glycosid, das im Saft von Antiaris toxicaria Lesch. enthalten ist; die zwei Alkaloide: Strychnin und Brucin; Upaïn, das durch Wefers Bettink aus dem Milchsaft von Antiaris gewonnen wurde, und Antiaretin, das von Mulder und Lewin als Bestandteil des antjar-Milchsaftes angegeben wurde; ferner eine schwach giftige pflanzliche Säure, die ein Aufschäumen verursacht. Derrid, das hauptsächlich in den aus Malakka stammenden Pfeilgiften enthalten ist, fehlte.
Die giftige Wirkung der tase̥m-Gifte muss somit den in Antiaris vorkommenden Stoffen und den Strychnos-Alkaloiden zugeschrieben werden; der hohe Antiaringehalt spielt hierbei zweifellos die Hauptrolle.
Auf Grund der in den tase̥m anwesenden aufschäumenden Säure nimmt Dr. Boorsma an, dass nicht nur der Milchsaft, sondern wahrscheinlich auch ein Auszug aus dem Bast des tase̥m-Baumes (höchst wahrscheinlich Antiaris toxicaria) bei der Zubereitung verwendet werden. Das in viel geringerer Menge vorkommende Strychnin und Brucin liess sich in kleinen Quantitäten auch in den Holz- und Bastteilen der Liane aka kia nachweisen; diese gehört, wie auch eine mikroskopische Untersuchung feststellte, zu den Strychnosarten.
Was die ipu-Gifte betrifft, so bildet: [153]
ipu tana eine teils zähe, teils brüchige, dunkelbraune Masse;
ipu kajo̱ einen weichen, schwarzen Extrakt;
ipu aka eine zähe, braune, von aussen schwarze und bröckelnde, teilweise auch steinharte Masse;
ipu se̥luwang einen zähen, schwarzen Extrakt.
Alle diese ipu-Arten haben einen intensiv bitteren Geschmack. Sie enthalten sämmtlich Strychnin und ipu tana ausserdem auch Brucin. Derrid fehlte auch bei diesen Giften.
Augenscheinlich stammen alle ipu-Gifte von Strychnosarten ab. Die Holz- und Bastteile der diese Gifte liefernden Pflanzen ergaben bei der Untersuchung alle als giftige Bestandteile Alkaloide. Nicht nur der Bast, sondern hauptsächlich auch das Holz erwiesen sich als strychninreich, während das Holz von ipu se̥luwang ausserdem auch noch Brucin enthielt. Es ist daher wahrscheinlich, dass ipu tana und ipu se̥luwang oder die dazu gehörigen Holzproben aus Versehen verwechselt worden sind.
Da bei ipu kajo̱ hauptsächlich in den Holzteilen viel Strychnin gefunden wurde, ist es wahrscheinlich, dass bei der Herstellung dieses Giftes nicht nur geschabter Bast, sondern auch geschabtes Holz verwendet wird.
Man bereitet sämmtliche ipu-Pfeilgifte, indem man den Bast, vermutlich auch das Holz der betreffenden Pflanzen, fein zerreibt, mit Wasser auszieht und die Lösung vorsichtig eindampft, bis sie eine dicke, zähe, schwarzbraune Masse bildet. Diese wird in kleinen Mengen in den Palmblättern einer Licula-Art aufbewahrt. Beim Gebrauch erweicht man das Ende eines Stückchens ipu über Wasserdampf und bestreicht damit die Pfeilspitzen, welche sodann in einiger Entfernung vom Feuer getrocknet werden. Den Wasserdampf lässt man durch die Öffnung eines trichterförmig gewundenen Bananenblattes, das über ein Bambusgefäss mit kochendem Wasser gestülpt worden, hindurchstreichen.
Dass die Wirkung des ipu mit derjenigen des Strychnins übereinstimmt, davon überzeugte ich mich einst, als ein Hund von einem Pfeile nicht sogleich tötlich getroffen wurde. Das Tier lag mit Bewusstsein auf der Seite, die Zunge aus dem Maule hängend und litt, wie die schnellen, kurzen Atemzüge andeuteten, an Atemnot. Ab und zu stellten sich spontan Konvulsionen ein, bei denen sich der ganze Körper streckte; sie wechselten mit tonischen Krämpfen. Erschütterte [154] man das eine Ende des freiliegenden Fussbodenbrettes, auf dem das Tier lag, so wurden die Zuckungen so heftig, dass der Hund bis auf ½ m Höhe aufsprang; er gab dabei keinen Laut von sich.
Das Schiessen mit dem Blasrohr hat auf der Jagd und im Kriege den grossen Vorteil, dass man auf das Opfer, ohne es zu verscheuchen, so lange Pfeile abschiessen kann, bis einer trifft. Übrigens sind auch viele Nachteile damit verbunden, besonders bei der Jagd auf grosse Tiere, für die die Wunde niemals sofort tötlich ist und die auch durch die Giftwirkung nicht sogleich bewegungslos werden. Sie behalten daher immer noch genug Kraft, um bedeutende Abstände zurückzulegen, was den Jägern viel Schwierigkeiten bereitet, da bereits ganz in der Nähe gefallenes Wild in dem dichten Walde, auf dem mit Blättern, Ästen und Gestrüpp bedeckten Boden, schwer zu finden ist.
Die Pfeile erfahren ferner, ihres geringen Gewichtes wegen, leicht eine Ablenkung, hauptsächlich auf freier Fläche bei Wind.
Unter den sesshaften Dajak begegnete ich nie einem, der im Schiessen mit dem Blasrohr eine besondere Geschicklichkeit an den Tag legte; die Punan verstanden sich hierauf viel besser. In den Proben, die sie vor mir ablegten, schossen sie zwar auf 40–50 m Abstand, aber die Treffsicherheit liess viel zu wünschen übrig und war mit derjenigen eines Gewehrschusses mit Kugel nicht zu vergleichen. Für die Jägerstämme jedoch, die in den fast windstillen Wäldern leben, bildet das Blasrohr, weil es mehrere Pfeile auf das gleiche Tier abzuschiessen gestattet, eine praktische Waffe, der sie sich auch Menschen gegenüber gut zu bedienen verstehen.
Die Schilde (kle̥bit) der Bahau haben die bekannte länglich viereckige Form mit dreieckiger Verlängerung nach oben und unten. Die mit Menschen- und Tierfiguren und Masken stark verzierten Exemplare, die bisweilen nach Europa ausgeführt werden, traf ich bei den Stämmen von Mittel-Borneo nur selten; sie bedienen sich auf ihren Zügen stets einfacher, glatter Schilde aus leichtem, festem, braunem Holze, die in der Mitte und an den Seiten, der Breite nach, mit Rotangschnüren verstärkt werden. Ich fand bei den Kajan noch eine alte, viereckige, eiserne Platte mit zwei Spitzen, die, als Schutz für die an der Rückseite befindliche Hand, vorn in der Mitte der Aussenfläche befestigt wurde.
Die einfachen Schilde werden nie mit Haar verziert; dies geschieht nur mit den bemalten Schilden, die daher kle̥bit bo̱k (Haarschild) genannt [155] werden. Gegenwärtig wird am Kapuas nicht mehr das Haar erschlagener Feinde als Zierat gebraucht, auch ist es verboten, als Waffenverzierung Menschenhaar aus dem eigenen Stamm zu verwenden. Das Haar für die Schilde wird jetzt hauptsächlich von den Taman Dajak gekauft, die mit ihrem eigenen Haar Handel treiben. Für die Schwerter benützt man vielfach eingeführte, gefärbte Tierhaare.
Nur die Punan und Bukat gebrauchten ursprünglich und zum Teil auch noch jetzt keine Schilde. [156]
1 Batik ist gefärbter Kattun in javanischen Mustern.
Kapitel VIII.
Rolle des Ackerbaus bei den Bahau und Kĕnja—Religiöse Vorstellungen beim Ackerbau Legende von der Entstehung der Ackerbauprodukte—Art der Feldbewirtschaftung—Vorzeichensuchen bei der Wahl der Felder—Bestimmung der Saatzeit-Perioden des Reisbaus—Bedeutung der Ackerbaufeste—Saatfest: religiöse Zeremonien; Masken- und Kreiselspiel—Neujahrsfest Festgebräuche—Zweite Namengebung der Kinder—Darbietung der Opfer—Tänze der Priesterinnen—Ringkampf—aro̱n uting = Festtag des Schweinefleischessens—aro̱n kertap = Festtag des Klebreisessens—nangeian = Rundtanz der Priesterinnen und Laien—Schlusszeremonien beim Neujahrsfest.
Die Bahau und Kĕnja sind Ackerbauer; sie widmen sich hauptsächlich dem Bau ihres wichtigsten Nahrungsmittels, des Reises; alle übrigen Bodenerzeugnisse spielen daneben eine untergeordnete Rolle. Der Ackerbau beherrscht im Grunde das ganze Leben dieser Stämme: ihr Jahr ist das Jahr des Reisbaues, das sie in die verschiedenen Perioden einteilen, welche die Bearbeitung des Reisfeldes und die Behandlung des Reises selbst bedingen.
Die Herstellung von Wohnung, Kleidung und sonstigen Artikeln nehmen die Kajan in der Zeit vor, die der Reisbau ihnen gerade übrig lässt, vor allem nach dem Jäten der neuangelegten Felder und in der letzten Ernteperiode. Dinge, die sie jetzt nicht mehr selbst verfertigen oder gewinnen, wie Salz und einige Arten Zeug, werden den malaiischen Händlern mit Bodenprodukten bezahlt.
Bei Stämmen, deren Denken so stark vom Ackerbau in Anspruch genommen wird, nimmt es nicht Wunder, dass sie ihre Vorstellungen von den ihr Wohl und Wehe beherrschenden Mächten mit diesem in engen Zusammenhang bringen. Die Geisterwelt steht mit dem Ackerbau der Bahau in inniger Verbindung, ohne ihre Zustimmung kann eine Feldarbeit überhaupt nicht vorgenommen werden. Auch fallen alle grossen Volksfeste mit den verschiedenen Perioden des Reisbaus zusammen. Da nach der Ernte ein besonderer Wohlstand herrscht, werden, schon aus praktischen Gründen, auch alle Familienfeste, die einen grossen Aufwand erfordern, auf das Neujahrsfest am Schluss der Ernte verlegt. [157]
Die beiden mächtigen Geister, Amei Awi, und dessen Gattin, Buring Une̱, die nach der Überzeugung der Kajan in einer Welt leben, die unter dem Erdboden liegt, beherrschen den ganzen Ackerbau und lassen den. Ausfall der Ernte grösstenteils vom Benehmen des Feldeigentümers abhängen, und zwar nicht nur von dessen sittlichem Betragen, sondern vor allem davon, ob er alle ihnen zukommenden Opfer und ihre Warnzeichen genügend beachtet hat.
Dem Häuptling fällt eine wichtige Rolle beim Ackerbau zu: er muss bei den Festen im Namen des ganzen Stammes die vorgeschriebenen Beschwörungen durch die Priesterinnen ausführen lassen.
Alle religiösen Zeremonien, die der Ackerbau erfordert, finden auf einem kleinen, besonders zu diesem Zweck angelegten Reisfeld (luma lāli) statt; hier leitet auch die Häuptlingsfamilie jedes neue Verfahren des Reisbaus, wie das Säen, Jäten, Ernten ein; die feierlichen Handlungen, die dabei vorgenommen werden, haben symbolische Bedeutung.
Die Geister walten nicht nur über dem Gelingen oder Misslingen der ganzen Ernte, sondern sie haben auch die angebauten Produkte: Reis, Mais, süsse Erdäpfel, Tabak u.s.w. besonders für die Bahau auf Erden entstehen lassen.
Nach der Überlieferung der Mendalam Kajan lebte nämlich in alten Zeiten, als sie noch das Stammland Apu Kajan bewohnten, ein Ehepaar: Batang Timong Nangei und seine Frau Uniang Bulan Batang Ngaui Ingan (ihre Namen stehen mit dem Ackerbau in Verbindung, denn nangei bedeutet das Feiern des neuen Jahres am Ende der Reisernte, ingan ist ein Reiskorb u.s.f.). Das Ehepaar hatte zu seinem Kummer keine Kinder und, um sie zu erlangen, ging der Mann, auf Anraten der Geister, darauf aus, eine bestimmte Art Rotang zu suchen. Nach mehr als einem Jahr kehrte der Mann ohne Erfolg und völlig erschöpft heim. Seine Gattin Uniang war aber inzwischen gestorben, weil sie während einer Verbotszeit des Säens genäht und hierdurch den Zorn der Geister erregt hatte. Ihr Tod hatte sich folgendermassen zugetragen: Als Uniang einmal wieder zu verbotener Zeit bei der Arbeit sass, fiel durch das Dach eine Nadel vom Himmel gerade auf ihren kleinen Finger, der zu bluten begann. Die Blutung war nicht zu stillen und so musste die Frau allmählich verbluten; aus ihrem hervorquellenden Blute entstand aber Reis (parei) und nach ihrem Tode aus dem Rumpf Bananen (pute̱), aus ihren Haaren Zuckerrohr (te̥wo̱), aus ihren Oberarmen kladi, aus ihren übrigen Körperteilen andere mit dem Reis zugleich [158] gebaute Gewächse wie: Gurken, süsse Erdäpfel (obe̱) u.s.w., aus den Schamteilen ging Tabak (băko̱) hervor, daher geben die Frauen ihren Liebhabern Zigarren zu rauchen.
Sowoht Bahau als Kĕnja legen trockene Reisfelder (luma im Busang ladang im Malaiischen) an. Ein Stück Wald, jung (talon) oder alt (tuwān), wird einige Meter oberhalb des Erdbodens gefällt, das Holz liegen gelassen, bis die Sonne es etwas getrocknet hat und das Ganze dann in Brand gesteckt. Ohne den Boden weiter zu bearbeiten, werden mit einem hierfür bestimmten Stocke (to̱l) Löcher in die Erde bzw. die Asche gebohrt, in welche man dann den Reis (parei) sät.
Jede Familie besitzt ein eigenes Reisfeld; sobald erwachsene Kinder da sind, erhalten sowohl Söhne als Töchter ein eigenes Feld. Hier bauen sie neben Reis auch Mais, Bataten, Tabak, Zuckerrohr und kladi (Colocasia antiquorum); ein besonderes Feld wird nur für die das Fischgift (tuba) liefernden Schlingpflanzen angelegt. Da man das Reisfeld jedes Jahr oder spätestens nach zwei Jahren wieder verlässt, werden nur selten Fruchtbäume ausser Bananen und Papaya (Carica Papaya) darauf gepflanzt; diese werden vielmehr von jeder Familie dicht vor oder hinter dem langen Hause mit Betel und Ähnlichem in kleinen Gärten gezogen, die, zum Schutz gegen die frei umherlaufenden Schweine, mit festen Hecken umgeben werden.
Unter den Fruchtbäumen sind die wichtigsten: duku (Lansium domesticum), durian (Durio zibethinus), verschiedene Citrusarten, Papaya (Carica Papaya), djambu (Jambosa) und blimbing (Capura Zollingeriana T. et B.).
Die Kokospalme kommt selten vor, trägt wenig Früchte und ist nur, insofern sie Leckerbissen liefert, von Bedeutung.
Obgleich die Frauen sowohl bei der Feldarbeit als bei den zugehörigen religiösen Handlungen eine wichtige Rolle spielen, wird der Boden für ein neu anzulegendes Feld doch ausschliesslich von Männern ausgesucht. Das männliche Haupt des Dorfes trachtet zuerst von den Vögeln und anderen wahrsagenden Tieren zu vernehmen, ob das von ihm gewählte Grundstück auch einen guten Ertrag verspricht. Handelt es sich darum, Urwald (tuwān) oder jungen Wald (talon) zu fällen, so benützen die Bahau am Mendalam den te̥landjang (Platylophus coronatus) als wahrsagenden Vogel; wegen des Urwaldes wird auch noch das Reh (Cervulus muntjac) befragt. Der Häuptling begiebt sich zu diesem Zwecke in das gewählte Waldstück und klopft an den Bäumen, bis er den te̥landjang hört oder sieht. Zeigt sich der Vogel [159] rechts von ihm, so ist das Grundstück gut gewählt, zeigt er sich jedoch links, so muss ein anderes Stück Wald gesucht werden. Hat der Häuptling das gewünschte Vorzeichen gefunden, was oft 2–3 Tage dauert, so beginnen die übrigen Männer ebenfalls die Tiere zu befragen. Ist dies geglückt, so muss das ganze Dorf 4 Nächte “me̥lo̱ njaho̱” d.h. “stillsitzen wegen der Vorzeichen”. Es darf dann kein Dorfbewohner mit der Aussenwelt in Berührung kommen oder mit einem Vorübergehenden sprechen; es darf auch kein Fremder das Dorf betreten. Dann verwendet man 3 Tage darauf, das Unterholz mit dem Schwerte wegzuräumen, me̥dā, worauf wiederum ein me̥lo̱ njaho̱ von 4 Nächten folgt. Die Bahau rechnen nämlich nach Nächten statt nach Tagen.
Auch der Schrei des kidjang (Reh), rechts oder links vom Beobachter, zeigt an, ob ein Stück Urwald gefällt werden darf oder nicht. Hat das Reh die Wahl gebilligt, so muss das ganze Dorf 8 Nächte me̥lo̱ njaho̱. Man darf dann das Haus wohl verlassen, aber keinen Reis als Proviant mitnehmen und keine Nacht ausserhalb des Hauses verbringen (sān).
Obgleich im Innern von Borneo nur eine geringe Anzahl Menschen wohnt, ist doch alles Land so unter den verschiedenen Stämmen verteilt, dass jeder nur in einem bestimmten Gebiete seine Reisfelder anlegen darf. Wenn ein Stamm aus einer Gegend fortzieht, hat ein anderer das Recht, sie zu bebauen; auf die herangewachsenen Fruchtbäume jedoch machen die früheren Besitzer noch viele Jahre Anspruch.
Auf noch nie bebaut gewesene Grundstücke haben alle Glieder eines Stammes gleiche Rechte und dürfen sich daher ihren Teil nach Belieben wählen. Ein einst bebaut gewesener Boden bleibt aber, auch wenn er seit Jahren verlassen ist, stets das Eigentum desjenigen, der ihn zuerst bearbeitete. Am Mahakam werden derartige Grundstücke nicht verkauft, wohl aber verpachtet oder gegen andere eingetauscht. Als Grenzzeichen benützt man Bäume, grosse Steine oder Bäche.
In Anbetracht, dass für das Trocknen und Verbrennen des gefällten Waldes die trockenste Jahreszeit erforderlich ist, sucht man, unter normalen Verhältnissen, diese Arbeiten während des Juli und August, wo die grösste Aussicht auf Trockenheit vorhanden ist, zu Ende zu führen. Dass die Ernte dann auf die Regenzeit zwischen Dezember und März fällt, ist für die Stämme von Mittel-Borneo von geringerer Bedeutung.
Den Beginn der verschiedenen Perioden des Reisbaus lässt man [160] von den Umständen abhängen, nur für das Säen sucht man bestimmte Tage einzuhalten. Wenn irgend möglich, beginnt man mit der Saat an dem Tage, wo die Sonne an einem bestimmten Punkte des Horizontes untergeht.
Bei den Kajan am Mahakam richtete der Oberpriester neben dem neuen Hause am Blu-u zwei längliche Steine von verschiedener Höhe auf und stellte sie so, dass das Zeichen für die Saat gegeben war, wenn die Sonne in der Verlängerung ihrer Verbindungslinie unterging.
Man erzählte mir, dass die Höhlungen in einem Felsblock bei Batu Sala, im Flussbett des oberen Mahakam, dadurch entstanden seien, dass die Priesterinnen der umliegenden Stämme von alters her jedes Jahr auf dem Stein gesessen hätten, um zu beobachten, wann die Sonne hinter einem bestimmten Gipfel des gegenüberliegenden Gebirges untergehen würde; dieser Zeitpunkt war dann für den Beginn der Saat massgebend.
Ausser bei zu grosser Nässe wird mit dem Reisbau auch dann noch mit einer Verspätung angefangen, wenn die letzte Ernte besonders günstig ausgefallen war. In solchen reichen Zeiten begeben sich die Männer auf Handelsreisen, bauen Böte, bessern das Haus aus, oder verrichten sonstige Arbeiten, die sie während der Zeit drückender Feldarbeit nicht vornehmen können. Herrscht dagegen Reismangel im Stamme, so beginnt man baldmöglichst mit der Saat.
Jede umfangreichere Arbeit, so auch die Bearbeitung der Reisfelder, wird bei den Bahau stets durch die gemeinsame Arbeit verschiedener Gesellschaften von 4–6 Personen besorgt. Es sind nicht immer Familienglieder, sondern, vor allem bei jungen Männern, häufig Freunde, die einander Hilfe leisten und diese später mit einer gleichen Anzahl von Arbeitstagen heimzahlen. Nur Söhne und Töchter sind ausdrücklich verpflichtet, ihre Eltern bei der Arbeit zu unterstützen. Dieses gemeinschaftliche Verrichten einer Arbeit nennen die Bahau: pala dọw, wörtlich: tagweise.
Derjenige, bei dem gearbeitet wird, muss seinen Gehilfen am betreffenden Tage das Essen liefern; am Mendalam wird aber, besonders in Zeiten von Reismangel, nicht immer während der Arbeit eine Mahlzeit gehalten.
In der drückendsten Arbeitszeit geht jeder, der arbeiten kann, aufs Feld; im Hause bleiben nur Kinder unter 8–10 Jahren, Frauen, die Kinder unter zwei Jahren zu versorgen haben, Greise und Kranke zurück. [161]
Der Auszug aufs Feld findet am Mendalam bei Sonnenaufgang, um 6 Uhr, statt. Ausgerüstet mit den augenblicklich gerade erforderlichen Ackergerätschaften, z.B. Schwertern und Beilen zur Zeit des Waldfällens, Schaufeln zur Zeit des Jätens, dazu stets mit einem Speer bewaffnet, begeben sich die Trüppchen zum paladow in einem Boot oder längs einem Waldpfad auf das Arbeitsfeld. Hat man zu Hause noch nicht gefrühstückt, so macht sich einer von der Gesellschaft, meist eine Frau, an die Zubereitung des Morgenimbisses.
Nicht immer erreicht die Gesellschaft ihr Arbeitsfeld; begegnet sie unterwegs einem links auffliegenden Vogel, der gerade zu den wahrsagenden gehört, oder bemerkt sie eine rotköpfige Schlange (Doliophis bivirgatus Boie), die den Kopf in die Richtung des Hauses dreht, oder hört sie den Schrei eines Rehs, so kehren sämmtliche Teilnehmer unverrichteter Sache wieder nach Hause zurück. Auch wenn die Gesellschaft in dem Häuschen, das oft auf dem Felde errichtet wird, eine beliebige Schlange erblickt, macht sie sich schleunigst auf den Heimweg.
Bei den verschiedenen Stämmen sind auch die Warnzeichen, welche einen Aufschub der Feldarbeit verlangen, einigermassen verschieden.
Die Bahau beschäftigen sich an den Tagen, an denen die Tiere ihnen die Arbeit auf dem Reisfelde verbieten, zu Hause mit Flechtarbeit, Nähen und dergl.
Das Wahrnehmen schlechter Vorzeichen ist am ersten Tage der beginnenden Feldarbeit besonders verhängnisvoll; begegnet man nämlich morgens beim ersten Auszug einem ungünstigen Zeichen, so darf man ein ganzes Jahr lang überhaupt keinen Reis bauen, nur Bataten, Mais u.a. dürfen dann gepflanzt werden. Um derartigen Zuständen vorzubeugen, geht man das erste Mal, kluger Weise, nachts aufs Feld.
Sieht man in der Zeit der Vorarbeiten ein Reh übers Feld laufen, so darf dieses ebenfalls nicht im gleichen Jahre bearbeitet werden, sondern man beschränkt sich auch in diesem Falle auf den Anbau anderer Bodenprodukte.
Die Jahreseinteilung richtet sich bei den Bahau, wie bereits erwähnt, nach den verschiedenen Arbeiten, die auf dem Reisfelde vorgenommen werden. Das Jahr zerfällt demnach in 8 Perioden:
ne̥băs = me̥dā = Fällen des Unterholzes.
ne̥wăng = Fällen der Bäume.
nutung =Verbrennen des gefällten Holzes. [162]
nugal = Säen; tugal = Saatfest; nugal = Feiern von tugal.
nawo̱ = Jäten.
nge̥luno̱ = Ernten.
ne̥wuko̱ = Beenden der Ernte.
nangei = Feiern des neuen Reisjahres; dangei = Neujahr.
Will ein Kajan an einer Stelle, wo im Laufe von 15 Jahren ein ungefähr 100 Fuss hoher Wald gewachsen ist, sein Feld anlegen, so beginnt er damit, die kleineren Pflanzen und Gebüsche mit einem eigens für diesen Zweck hergestellten Schwerte umzuhauen. Wenn alles Unterholz am Boden liegt, kommt das Fällen der Bäume an die Reihe, die einzige ausschliesslich von Männern verrichtete Arbeit; sie wird mit kleinen, selbst hergestellten oder auch eingeführten Beilen aus hartem Stahl bewerkstelligt.
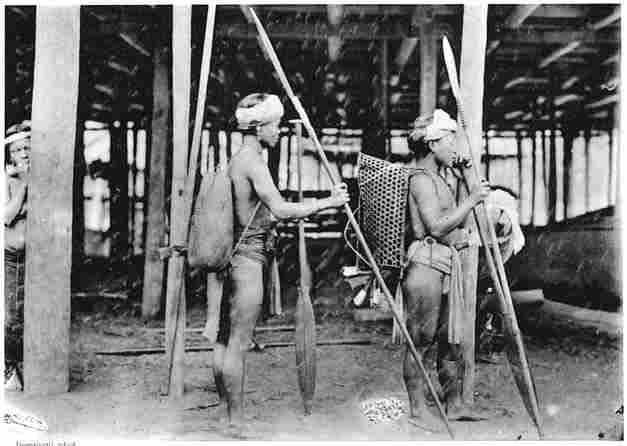
Auszug aufs Feld mit Tragkorb, Schwert, Ruder und Speer.
Die Bäume werden 1–4 m über dem Boden gefällt, worauf auch die Zweige abgehackt werden, so dass die Stämme flach auf dem Boden zu liegen kommen. Auch nach einmonatlicher Dürre lassen sich die Stämme und dicksten Äste nur teilweise verbrennen; man räumt sie jedoch nicht fort, sondern sät den Reis einfach zwischen und neben dem Holz hin. Mit einem Teil dieses Holzes wird übrigens, um Hirschen und wilden Rindern den Eintritt zu wehren, das Reisfeld eingezäunt. In wildärmeren Gegenden unterlässt man die Herstellung dieser Hecke, weil sie viel Arbeit erfordert und opfert lieber einen Teil der Ernte. Auch den Vögeln, von denen bei beginnender Reife drei Arten Reisdiebe (Padda oryzivora; Munia fuscans; Munia bruneiceps) in grossen Schwärmen das Feld heimsuchen, und den Affen muss ein Teil des, Bodenertrages abgetreten werden. Bisweilen verursachen auch Insekten und deren Larven einen so grossen Schaden, dass von der ganzen Ernte beinahe nichts übrig bleibt. Allen diesen Schädlingen gegenüber sind die Bahau viel wehrloser als die Malaien; nur durch Schreien und Schlagen auf Bambusgefässe gelingt es ihnen mit viel Anstrengung, einige der Räuber zu vertreiben.
Befindet sich ein Reisfeld in der Nähe des Hauses, so wird es von diesem aus bewirtschaftet, hat man es aber in grösserer Entfernung anlegen müssen, so wird das tägliche Hin- und Herziehen zu mühsam; man baut daher auf dem Felde selbst ein Häuschen (le̥po̱ luma) auf Pfählen, in welches die ganze Familie einzieht. In sicheren Gegenden wohnen die Familien oft weit auf den Feldern zerstreut, wodurch der Stammverband oft gelockert wird.

Neu angelegtes Reisfeld der Bahau.
[163]
Die den Reisbau begleitenden religiösen Feste sind bei allen Stämmen etwas verschieden, nur die ihnen zu Grunde liegenden Vorstellungen sind überall die gleichen. Im wesentlichen handelt es sich stets darum, die Geister und die Seelen des Reises durch Opfer aller Art zu versöhnen und günstig zu stimmen.
Die Mendalam Kajan erfreuen sich eines ziemlich regelmässigen Ernteertrages; ihre Ackerbaufeste finden daher auch jedes Jahr statt; die Mahakam Kajan dagegen können wegen häufiger Missernten nur alle 2–3 Jahre ein Neujahrsfest (dangei) feiern.
Trotzdem diese Festlichkeiten am Mendalam regelmässiger gefeiert werden, folgt man ihnen am Mahakam doch mit lebhafterem Interesse und die Bedeutung aller Zeremonien und Spiele lässt sich hier auch viel besser verfolgen. Am Mendalam kam ich zu der falschen Vorstellung, dass die Volksspiele, die bei den Festen stattfinden, rein willkürlich zur Saat- oder Erntezeit vorgenommen werden; am Mahakam dagegen merkte ich, dass selbst dem Maskenspiel beim Saatfest eine gleich tiefe Bedeutung wie irgend einer durch die Priesterinnen verrichteten Handlung zukommt.
Für die Denkweise der Kajan ist die Tatsache charakteristisch, dass bei den Erntefesten nicht nur die Menschen im Überfluss schwelgen dürfen, sondern dass auch ihre Haustiere: Schweine, Hunde und Hühner, die für gewöhnlich vom Abfall leben, in der Festzeit sich gut gekochten Reises erfreuen dürfen. Als ich einst Akam Igau fragte, warum sich die Kajan aller geistigen Getränke enthielten, gab er mir als einen der Gründe an, dass sie sonst nicht genügend Reis hätten, um auch die Tiere an den Festmahlzeiten teilnehmen zu lassen. Ausserdem wies er auf die traurigen Folgen hin, die der Genuss von Reisbranntwein (tuwak) für seine Nachbarn, die Taman Dajak, hatte.
Bei allen religiösen Handlungen fürchten die Kajan die Anwesenheit Fremder, weil diese die angerufenen Geister erschrecken und verstimmen könnten; daher dürfen die malaiischen Händler in Tandjong Karang auch nie Festlichkeiten beiwohnen.
Obgleich ich mich nun stets davor hütete, meinen Gastherren meine Gegenwart, falls sie nicht gewünscht wurde, aufzudrängen, erschien mir das Saatfest doch so interessant, dass ich es mitzumachen beschloss, auch auf die Gefahr hin, den Unwillen der Dorfbewohner zu erregen.
Ich hatte daher auf die schüchternen Fragen, ob ich bei den Festlichkeiten [164] zugegen sein wolle, bejahend geantwortet. Am Morgen des Festtages war aber ein guter Teil der Häuptlingsfamilie mit der Priesterschaft bereits aufs geweihte Feld (luma lāli) gezogen, als Akam Igau mich noch mit dem Versprechen hinhielt, mir später das Boot seines ältesten Sohnes zur Verfügung stellen zu wollen, das mich an das jenseitige Ufer zum Schauplatz der Festlichkeit bringen sollte. Nachdem ich vergeblich auf dieses Boot gewartet hatte, bestieg ich dasjenige, in dem Akam Igaus älteste Tochter, Tipong Igau, zum Festplatz fahren sollte. Tipong besass im grossen Hause von Tandjong Karang die einflussreichste Stellung; auch gehörte sie zu den obersten Priesterinnen und legte als solche meinen Nachforschungen nach den Lebensverhältnissen und religiösen Überzeugungen der Kajan die grössten Hindernisse in den Weg. Aber obwohl fanatisch, war Tipong Igau doch nicht boshaft und wies daher auch meine Begleitung nicht ab, trotzdem sie diese durchaus nicht zu schätzen schien. Sie hatte übrigens gleich einen Grund gefunden, um ihr religiöses Gewissen zu beschwichtigen; denn als ihr mitten auf dem Flusse ein vorüberfahrender Malaie zurief, dass ich, als Fremder, nicht zur Feier gehöre, gab sie ihm sofort zur Antwort, dass ich Kajanisch spreche und folglich auch zu den Kajan gehöre.
Dass meine Anwesenheit als etwas Aussergewöhnliches betrachtet wurde, merkte ich auch später, bei der Rückkehr von dem Feste. Ein zum Islam übergetretener Kajan fragte mich nämlich, ob ich bei der Feier zugegen gewesen sei. Auf meine bestätigende Antwort ergriff er schweigend meine Hand, lächelte mich von der Seite an und ging weiter—ein Ausdruck seiner Bewunderung, dass ich es in der Volksgunst bereits so weit gebracht hatte.
Durch Tipong Igaus Auffassung beruhigt, bestieg ich mit ihr das hohe Ufer und befand mich sogleich auf dem luma lāli, das unmittelbar hinter den Trümmern eines früheren Kajanhauses angelegt worden war. Neben dem luma lāli der Häuptlingsfamilie lagen die geweihten Felder der übrigen Familien, die das Fest am folgenden Tage begehen sollten. Diese kleinen Felder werden niemals des Ertrages wegen bebaut, sie dienen nur als Schauplatz religiöser Handlungen, auch werden auf ihnen symbolisch alle Arbeiten eingeleitet, die später auf den wirklichen Reisfeldern vorgenommen werden müssen.
Bei meiner Ankunft bemerkte ich zuerst, unter einem auf vier Pfählen ruhenden Baldachin aus Palmblättern, zwei weibliche und zwei männliche [165] Priester, die sich mit der Zubereitung der Opfer beschäftigten; die Frauen stellten kawit her, während die Männer aus Fruchtbaumholz die erforderlichen Stücke für das Opfergerüst (pe̥lale̱) schnitzten.
Inzwischen befasste sich der profanere Teil der Familie und Sklaven mit deren irdischen Interessen, indem er in einigen grünen Bambusgefässen Klebreis und in anderen Hühner- und Schweinefleisch kochte. Die Kinder umringten alle diese Herrlichkeiten, während Jünglinge und Jungfrauen, im Schatten abgelegenerer Gebüsche sitzend, bei süssem Minnespiel die Welt um sie her zu vergessen schienen.
Um die Stelle, wo das Opfergerüst aufgestellt werden sollte, bauten zwei Männer aus dickem Holze eine feste, ungefähr 1 m hohe pyramidenförmige Hülle mit seitlicher Öffnung, worauf die älteste dājung um die Hülle etwas Reis säte und dann die jungen Leute herbeirief, um das ganze Feld weiter zu besäen. Während die jungen Männer mit ihrem Pflanzstock (to̱l) Löcher in den Boden bohrten, streuten die jungen Mädchen, hinter ihnen hergehend, den Reis in die Gruben; die gegenseitigen Sympathieen der Pärchen blieben dabei nicht verborgen.
Unterdessen waren die Bambusgefässe teilweise schon verkohlt, ein Zeichen, dass ihr Inhalt bereits gar geworden war und dass das Festmahl beginnen konnte. Höflicher Weise bot man mir zuerst meinen Anteil an der Mahlzeit an, den ich, mit Rücksicht auf die in Ungeduld harrende Jugend, so schnell als möglich zu bewältigen trachtete. Der Anblick der Gesellschaft, die jetzt in festem Klebreis und dem so seltenen Schweine- und Hühnerfleisch förmlich schwelgte, erheiterte mich nicht wenig.
Nach beendetem Mahl fragte mich Tipong, ob ich nun, da alles vorüber sei, nicht nach Hause fahren wollte; da aber niemand sonst sich zum Aufbruch rüstete, glaubte ich ihre Langmut noch weiter auf die Probe stellen zu müssen und erklärte, noch etwas warten zu wollen.
Da holte Tipong mit den anderen Priesterinnen einen grossen Behälter mit kawit herbei, erwärmte sie zum Schein, steckte sie in kleine Bambusgefässe und stellte diese zerstreut auf dem Felde auf. An jeder Stelle, wo ein solches Opferpäckchen niedergelegt wurde, blieb Tipong mit zwei Oberpriesterinnen stehen und redete halblaut mit den Geistern. Leider konnte ich wegen der lauten Schläge der Gonge nichts von ihrem Gemurmel verstehen. [166]
Darauf folgte die Aufrichtung des Opfergerüstes unter der pyramidenförmigen Hülle: fünf dājung knieten vor der Öffnung; die älteste nahm aus einem Behälter die von den Männern geschnitzten Hölzer und stellte sie so zu einem pe̥lale̱ auf, wie es in dem Kapitel über Gottesdienst beschrieben worden ist. Über das Ganze setzte sie ein Dach, das gleichzeitig dazu diente, zwischen den vier, oben herausragenden, kleinen Stützbalken eine grosse Anzahl kawit zu tragen. Rings um das Gestell wurde etwas Hühnerblut gegossen und einige Reiskörner gesät, worauf die Öffnung der Hülle mit ein paar Holzstücken geschlossen wurde. Auch hierbei musste die Priesterin den Geistern eine lange Rede halten, die erst beendigt wurde, nachdem ein paar Bambushalme und Fruchtbaumzweige rings herum in den Boden gepflanzt worden waren. Einige geschlachtete Küchlein, einige Eier und kleine Bambusgefässe mit Schweineblut wurden als weitere Opfer für die Geister an die Zweige gehängt.
Hiermit war die eigentliche Zeremonie beendigt; die Teilnehmer waren aber noch nicht befriedigt; besonders trachteten die Mütter kleiner Kinder von dem aussergewöhnlichen Einflusse, der von dem Opfergestell ausströmen musste, für ihre Kleinen Nutzen zu ziehen. Zuerst wurde uns der Behälter mit den übriggebliebenen kawit gereicht, um unsere Hand hineinzustecken und darauf eine Schüssel mit Wasser. Durch beide Handlungen sollte unseren Seelen etwas Angenehmes erwiesen werden.
Hierauf verteilte man kawit unter die Frauen, die sich mit den Kindern auf den Tragbrettern oder mit diesen allein zum Opfergerüst begaben; unter Hersagen einiger Worte liessen sie den guten Einfluss des pe̥lale̱ auf die am Tragbrett hängende Schlinge übergehen und legten dann eine kawit neben ihm auf den Boden nieder. Mit dem Befestigen einer kawit am Tragbrett erreichte die Zeremonie ihr Ende.
Erst im letzten Augenblick traf Ju, der älteste Sohn des Häuptlings (Akam Igau hatte ihn seltsamer Weise, wie er angab, um ihm ein glücklicheres Dasein zu verschaffen, in Bunut Malaie, d.h. Mohammedaner werden lassen), mit seiner Frau ein, so dass ich, sehr befriedigt über meine Beharrlichkeit, mit der Gesellschaft heimkehrte.
Am ersten Tage des Saatfestes darf die ganze Bevölkerung, die sehr jugendliche und sehr alte abgerechnet, von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends nicht baden (pongăn); hierauf folgt eine 8 nächtliche Ruhezeit (me̥lo̱), in der man weder arbeiten noch mit seiner Umgebung [167] verkehren darf. Am 10ten Tage, dem ersten einer zweiten Periode von einem Tage und acht Nächten, folgt, wie am ersten, das pongăn, das Badeverbot. In der folgenden, achtnächtlichen Periode wird das grosse, eigentliche Reisfeld besät. Am roten Tage gilt wieder das pongăn, diesmal ohne folgendes lāli, und mit einem weiteren pongăn am loten Tage ist die Zeit der Reissaat abgelaufen.
Ausser dem grossen Festmahl am ersten Tage des Saatfestes und dem zweiten für die geringeren Leute am folgenden Tage haben die Kajan in der ersten Periode der Abgeschlossenheit noch allerlei andere Gelegenheit, um sich zu unterhalten. Sie lassen sich durch das erzwungene Niederlegen von Hammer und Beil, durch das Verbot, abends oder nachts ausser dem Hause zu verweilen, und durch die Abwesenheit von Fremden die Laune nicht verderben. Die Männer finden auch zu Hause in ihren Schnitz- und Flechtarbeiten, die Frauen in ihren geliebten Perlenarbeiten angenehme Beschäftigung. Ausserdem haben die jüngeren Leute mit den Vorbereitungen zu der am Ende der ersten Verbotszeit stattfindenden Maskerade viel zu tun.
Die Masken der Männer und die der Frauen sind ganz verschieden, stellen aber alle die bösen Geister dar. Die entsetzlichen Köpfe und lang behaarten Leiber, welche sie den Dämonen zuschreiben, veranschaulichen die Männer durch hölzerne Gesichtsmasken (hudo̱ kajo̱) und fein zerschlitzte Bananenblätter, die sie sich um den Leib wickeln. Die Frauen verfertigen sich Masken aus Tragkörben (hudo̱ ădjāt), indem sie diese cylinderförmigen, aus feinem Rotang geflochtenen Körbe mit weissem Kattun, auf den mit grossen Stichen ein menschliches Antlitz genäht ist, überziehen; zu beiden Seiten des Korbes befestigen sie die grossen Ohrgehänge der Kajan. Der Korb wird mit der Öffnung nach unter auf den Kopf der Trägerin gestülpt und diese bis zur Unkenntlichkeit mit Zeug umwickelt.
Während des Saatfestes unterhalten sich die Männer auch öfters mit dem Kreiselspiel (păsing). Die Kreisel sind oval, abgeplattet, glatt und 2 bis 3 kg schwer. Das Spiel besteht darin, dass einer den Kreisel (ăsing) seines Vorgängers mit dem seinigen aus dem Wege zu räumen versucht und zwar so, dass der eigene Kreisel sich dabei stets weiter fortdreht, bis auch er das Opfer des folgenden wird. Die älteren Männer benützen bisweilen mehrere Kilo schwere Kreisel aus Eisenholz; meist werden für die Festlichkeit neue Kreisel geschnitzt. Stets fand sich abends auf dem Platze vor der Häuptlingswohnung eine Gesellschaft [168] junger, bis 30 Jahre alter Männer ein, die vor den weiblichen Zuschauern auf der Galerie in Kraftentfaltung und Geschicklichkeit mit einander wetteiferten.
Der achte Tag bot den Kajanmägen wieder etwas Besonderes, nämlich ein Festmahl mit dem beliebten Klebreis als Hauptgericht.
Am folgenden Tage sammelten die Frauen allerhand essbare Blätter in ihren Gärtchen und auf den Feldern. Wie bei allen religiösen Festen, dienten zum Kochen auch dieser Blätter frische grüne Bambusgefässe. Gegen Abend fuhren die Frauen ans jenseitige Ufer und besprengten die Erde des geweihten Reisfeldes mit dem Wasser, in welchem die Blätter gekocht worden waren. Nachdem sie die geleerten Bambusgefässe zerschlagen und die Trümmer neben dem Opfergestell niedergelegt hatten, kehrten sie befriedigt nach Hause zurück.
Der Tag des zweiten pongăn war der Maskerade gewidmet. Gegen Abend begannen sich die Hausbewohner auf der Galerie vor der Häuptlingswohnung zu versammeln und sich ein Plätzchen, von dem aus sie die kommenden Dinge gut beobachten konnten, auszusuchen.
Zuerst erschienen einige in grüne Massen zerschlitzter Bananenblätter verwandelte Männergestalten mit Holzmasken und Kriegsmützen und begannen schweigend, nach dem Rhythmus der Gonge, in der Weise der Javaner beim “tandak”, einen Tanz auszuführen. Es folgten noch mehr solcher Gestalten, von denen einige auch Kriegstänze nachahmten; infolge des grossen Gewichtes der Blättermassen ermüdeten sie jedoch bald, auch begleiteten sie ihre hohen Sprünge nicht mit Kreischen, wie bei den eigentlichen Kriegstänzen.
Bei Einbruch der Dunkelheit wurden diese Tänze von der aufregenden Vorstellung einer Wildschweinjagd abgelöst. Das Schwein stellte ein Mann dar, der sich einen aus Holz geschnitzten Schweinekopf aufgesetzt und einige Tücher umgebunden hatte; mit seinen gut nachgeahmten Bewegungen und Lauten machte er auch wirklich einen sehr schweineähnlichen Eindruck. Einige junge Leute funktionierten als Hunde, die den alten Eber zum Stehen gebracht hatten, und verursachten durch Anfallen, Zurückweichen und Kläffen einen entsetzlichen Lärm auf dem kleinen Platze. Die für gewöhnlich so ruhigen Kajan nahmen an dem Geschick des bawui (Wildschwein) lebhaften Anteil; es herrschte ein buntes Durcheinander, das sich bei gelegentlichen Seitensprüngen des Schweines mitten unter die weibliche Jugend noch erheblich steigerte. Trotz der Wildheit des seltenen Schauspiels war auch [169] bei den jüngsten bis einjährigen Zuschauern von Angst und Schrecken nichts zu merken; aus aller Mund klang mir lautes, herzliches Lachen entgegen.
Dem Auftreten der jungen Mädchen mit ihrem hudo̱ ădjāt ging eine obszöne Vorstellung eines Mannes voraus.
Mittags hatten mir bereits Paja, die zweite Tochter Akam Igaus, und deren Freundin mit viel Grazie vorgetanzt, um mich bei Tageslicht alles gut sehen zu lassen. Jetzt erschienen aber acht auf gleiche Weise verkleidete junge Mädchen. Beim trüben Schein der wenigen Harzfackeln und unter den sanften Tönen einer Art Mundharmonika, welche einer der Zuschauer spielte, gingen die Mädchen im Tanzschritt mit begleitenden Armbewegungen langsam hinter einander her. Nur zwei oder drei der Mädchen zeigten wirkliche Begabung zum Tanz und führten, für einen Kenner indischer Tänze, gefällige Bewegungen aus; die übrigen liefen mit eckigen, unverständlichen Gebärden nur so mit.
Mit einem letzten pongăn wurde die Zeit der Reissaat abgeschlossen und zugleich die des Jätens eingeleitet. Wir liessen uns nochmals, von der Wohnung des Häuptlings aus, mit einigen Priestern zum geweihten Reisfeld übersetzen. Dort wurden wiederum kawit verfertigt und unter dröhnendem Geläut der Gonge und Gemurmel in altem Kajanisch auf dem Opfergerüst zu den alten, bereits vertrockneten, hinzugefügt.
Inzwischen hatte die älteste Priesterin Usun mit einer Schaufel, an welche eine kawit gebunden worden war, auf dem Platze rings um den pe̥lale̱ gejätet, und nun begann auch die übrige Gesellschaft auf dem anderen Teil des Feldes zu jäten. Hierauf wurde das Feld nochmals mit einem Dekokt essbarer Blätter, in das wir vorher unsere Finger hatten tauchen müssen, besprengt und die Bambusgefässe zertrümmert zu den anderen gefügt. Nachdem die Kindertragbretter wieder mit kawit versehen worden waren, konnten wir befriedigt das andere Ufer aufsuchen, Opfer und Feld den Sorgen der aufgerufenen Geister überlassend. Gleichwie diese an den Herrlichkeiten auf dem pe̥lale̱, konnten wir uns zu Hause an einer Extramahlzeit von Klebreis, den die Frauen der Häuptlinge selbst gestampft hatten, erquicken.
So wurde jede weitere Behandlung des Reisfeldes mit religiösen und kulinarischen Zeremonien eingeleitet, während welcher der Gemeinde stets einige Nächte Verbotszeit und bestimmte Spiele vorgeschrieben waren. Wie wir gesehen haben, wurde während des Saatfestes [170] Kreisel- und Maskenspiel vorgenommen; beim ersten Einbringen des Reises (lāli parei) beschoss man einander mit Lehmpfropfen aus kleinen Blasrohren—früher fanden dabei auch noch Scheingefechte mit hölzernen Schwertern statt—; während des Neujahrsfestes sind bei den Männern Wettkämpfe im Ringen, Hoch- und Fernspringen und Laufen im Schwange. Auch mit den Frauen wird unter grosser Fröhlichkeit gekämpft, wobei mit Wasser gefüllte Bambusgefässe die Hauptwaffen darstellen.
Den Glanzpunkt des Jahres bildet bei den Kajan das dangei, das Neujahrsfest; die Ernte ist dann völlig eingebracht und in allen Familien herrscht Überfluss. Die schönsten Kleider, die während des ganzen Jahres sorgfältig aufbewahrt liegen, werden hervorgeholt und die ganze Bevölkerung lebt 8 Tage lang nur ihrem Vergnügen. Beim nangei herrscht auch keine Verbotszeit, fremde Gäste sind im Gegenteil bei den Festen sehr willkommen. Alle wichtigen Familienereignisse, welche das Herrichten einer Festmahlzeit erfordern, werden in dieser Zeit des Wohllebens gefeiert: alle im Laufe des Jahres geborenen Kinder erhalten nun ihren endgültigen Namen; die bis dahin verschobenen Hochzeiten finden nun statt.
Die adat hat Jungverheirateten übrigens für die ganze Zeit vor dem gemeinsamen Neujahrsfeste so viel Verbotsbestimmungen vorgeschrieben, dass junge Leute, schon um allen diesen Unbequemlichkeiten in den Flitterwochen zu entgehen, erst kurz vor dem Neujahrsfest heiraten.
Begreiflicher Weise wurde im langen Kajanhause bereits lange vor dem Feste von nichts anderem als von den kommenden Tagen gesprochen, und mancher opferte viele Mass Reis, um von den Malaien noch etwas besonders Schönes zur Ergänzung seiner Festkleidung zu erhandeln.
In grossen Mengen wurde alles, was für die Mahlzeiten und religiösen Handlungen erforderlich war, aus Wald und Feld zusammengebracht; die Männer holten in Böten Brennholz und frischen Bambus herbei, die Frauen gingen gebückt unter der Last grosser Körbe mit Bananenblättern, welche als Unterlage für den zu stapelnden Reis und als Material für die pe̥māli dienen sollten.
Am 2. Juni wurde es Ernst: aus der Wohnung des Häuptlings, der die ganze Leitung und die Hauptkosten des Festes auf sich zu nehmen hatte, zogen 4 Mann aus, um einen Fruchtbaum zu fällen [171] und 4 Planken daraus zu hacken, welche den Priestern bei den heiligen Handlungen als Diele (tasu nangei) dienen sollten.
Diese 2,5 m langen Bretter tragen an den beiden zugespitzten Enden roh geschnitzte Menschenfiguren und werden von dem Häuptling bis zum folgenden dangei-Fest, wo sie durch andere ersetzt werden, aufbewahrt.
Die dājung, welche über die ganze Dauer des Festes Gäste der Häuptlingsfamilie sind, zogen, zehn an Zahl, bereits am Vorabend des nangei in die Wohnung Akam Igaus und verkündeten den Geistern aus Apu Lagan, dass das Neujahrsfest angebrochen sei.
Als Willkommgruss und zur Anlockung der Geister hatte man vor dem noch geschlossenen Dachfenster (huwăbw) in der Häuptlingswohnung ein Bambusgefäss mit Esswaren befestigt und darunter alte Schwerter und Speerspitzen aus dem sehr geschätzten Eisen vom Balui oder Batang Rèdjang, von wo die Kajan es in früheren Zeiten mitgebracht hatten, aufgehängt. Aber nicht nur der Häuptling bereitete den Geistern einen festlichen Empfang, sondern aus allen Wohnungen der Wohlhabenderen wurden Tragkörbe mit kostbaren Gegenständen geholt und neben einander vor dem Fenster niedergesetzt, wo sie während der ganzen Festdauer verblieben.
Meine alte Freundin Usun gab jedesmal an, bei welcher Familie ein solcher Korb geholt werden musste; sie schien aber trotz ihrer priesterlichen Würde profane Empfindungen nicht ablegen zu können. Sie lebte nämlich mit einer ihrer Nachbarinnen, Anjè Do, in Unfrieden, weil diese ihr im Handel mit religiösen Gegenständen mir gegenüber stark Konkurrenz machte, und suchte sich jetzt dadurch an ihrer Feindin zu rächen, dass sie deren Korb nicht holen liess. Tipong Igau jedoch durchschaute den Gemütszustand der Alten und kam ihrem Gedächtnis zu Hilfe, so dass auch Anja Dos Korb zu seinem Rechte gelangte und wie die übrigen von den Frauen bei Fackellicht und unter Beckenschlag in die amin des Häuptlings getragen wurde.
Nachdem alle Körbe mit ihren Herrlichkeiten beisammen waren, bedeckten sich die Priesterinnen die Brust mit einem Tuche, öffneten das Dachfenster und hielten alle gleichzeitig an die Geister von Apu Lagan eine lange Ansprache, bei der Usun immer den Anfang machte. Das Gleiche geschah aussen auf der Galerie unter dem zweiten, ebenfalls geöffneten Dachfenster. Die Bedeutung dieser Rede war die, dass [172] die guten Geister von Apu Lagan, angelockt durch alles Schöne, das man ihnen in den Körben zum Opfer brachte (natürlich nur zum Schein), den Bitten der dājung Gehör geben und durch das geöffnete Fenster in die Wohnung des Häuptlings eintreten und während der ganzen Festzeit im Stamme verweilen sollten.
Hierauf begannen die Priesterinnen um eine Kriegsmütze und einen Kriegsmäntel, die sie mitten auf eine Matte gelegt hatten, herumzulaufen; leider konnte ich wegen des ständigen Schlagens auf kupferne Becken nichts von ihrem Gemurmel verstehen.

Dangei-Hütte.
Am 3. Juni fand das eigentliche Fest statt. Die Frauen begannen beizeiten für eine genügende Menge Klebreis zu sorgen, der in gedörrter Form als ke̥rtăp, mit oder ohne Palmzucker, mit geräuchertem tāpā als Zuspeise, eines der beliebtesten Gerichte bildet. Die Männer beschäftigten sich inzwischen mit dem Aufrichten des dje̥he̱ nangei (Neujahrspfahl), den sie aus einem Fruchtbaum hergestellt hatten. Hierbei verfuhren sie folgendermassen: sie gruben auf dem Platze vor der Häuptlingswohnung ein Loch, in welches die Priesterinnen Reis, Fisch und Hühnerfleisch legten. Um diese Grube legten sie die vier tasu nangei als Diele für die Priesterinnen, die während der heiligen Handlungen den Erdboden nicht berühren durften. Nachdem die Oberpriesterin acht Mal (der heiligen Zahl entsprechend) um die anderen, die zusammengedrängt ebenfalls auf den Brettern standen, herumgelaufen war, fing sie durch eine Bewegung mit einem Stück weissen Kattuns eine Seele, wahrscheinlich die des Fruchtbaumes, warf sie schleunigst in die Grube und schloss diese mittelst eines mit Bananenblättern überzogenen Rotangringes von der Grösse der Grubenöffnung; das Blatt hatte sie zuvor mit einem alten Schwerte durchstossen.
Unterdessen liess eine zur Seite kauernde dājung, um die Geister auf die wichtige Handlung aufmerksam zu machen, zwei Bambusstäbe rhythmisch auf eine Matte niederfallen. Bei den Tönen dieses te̥ko̱k berichtete die Priesterin den Geistern von den Festplänen ihres Stammes, von seinen Nöten und Wünschen. Die zwei männlichen Priester hoben hierauf das Bäumchen, stellten es mit dem Gipfel voran in die Grube und pflanzten es fest, so dass seine etwas bekappten Wurzeln 3–4 m über dem Boden zu stehen kamen. Zu diesem Bäumchen fügten andere Männer, in gleicher Reihe und in gleichen Abständen, noch 7 andere Bäumchen hinzu und pflanzten dann eine zweite Reihe [173] von 8 Bäumchen dieser gegenüber, in ungefähr 1½ m Entfernung. Beide Reihen wurden auf halber Höhe durch kleine Querbalken mit einander verbunden. An allen Bäumchen hatte man, etwas unterhalb der Wurzeln, eine Fläche mit 8 Einschnitten, deren Bedeutung mir unbekannt geblieben ist, angebracht. Auf die Querbalken wurden vier weitere Balken und auf diese die vier Bretter (tasu nangei), die vorher den Boden bedeckten, gelegt; so entstand oben, zwischen den zwei Reihen Pfählen, ein gedielter Raum. Das ganze Gerüst war so gestellt worden, dass man mittelst einer Treppe bequem aus der Häuptlingswohnung in diese kleine Kammer gelangen konnte. Die Wände der Kammer wurden mit meterlangen, kunstvoll hergestellten Spähnen aus besonderem Fruchtbaumholze gefüllt und der Raum schliesslich mit Bambuszweigen leicht beschattet. Zum Schluss wurde das Opfergerüst, dangei genannt, noch an den vier Seiten durch gekreuzte Balken gestützt und stand jetzt fix und fertig da. So bleibt das Gerüst nicht nur während der ganzen Festzeit, sondern auch während des ganzen folgenden Jahres stehen, bis Wind und Wetter es zum grössten Teil zerstören und sein Nachfolger es beim nächsten nangei völlig verdrängt.
Nachmittags wurde unter dem dangei, bei dem zuerst errichteten Pfahl, ein gleicher pe̥lale̱ (Opfergestell), wie der auf dem geweihten Reisfelde beim Saatfest, aufgestellt, diesmal mit weniger kawit. Statt dessen opferte man gegen 4 Uhr ein Ferkel, befestigte es an einem Querbalken und liess es dort hängen, bis es verweste.
Auch jetzt brachten die Mütter ihre Kleinen zum pe̥lale̱; zuerst erschienen die zwei ältesten Enkelkinder des Häuptlings, der jüngste auf seinem Tragbrett, schön geputzt mit einem Kopftuch aus chinesischer Seide; ebenso schön gekleidet war das junge Mädchen, das die hăwăt auf dem Rücken trug. Der andere Enkel wurde, als zu gross, nur durch seine hăwăt vergegenwärtigt, deren heilsamen Einfluss man später auf die übliche Weise auf ihn übertrug, indem man seinen Zeigefinger in einer am Tragbrett hängenden Schlinge hin- und herbewegte (njină). Die beiden Trägerinnen der hăwăt hatten, wie beim Saatfest, den von den vielen Opfergaben am pe̥lale̱ ausströmenden guten Einfluss in den Schlingen aufgefangen, um den bruwa der Knaben etwas Angenehmes zu erweisen.
Nach Sonnenuntergang fand für alle, die augenblicklich in der amin des Häuptlings wohnten, also für Familienglieder im engeren Sinne, Leibeigene und Priesterinnen, eine gemeinsame me̥lă statt. Hinter ein [174] ander begaben sich erst Männer, dann Frauen, dann Leibeigene und zuletzt die dājung von der Galerie des Hauses auf die kleine Plattform des dangei, auf der eine Priesterin mit einem alten Schwerte stand. Die betreffende Person, mit der die me̥lă vorgenommen wurde, stellte einen Fuss auf einen alten Gong und die Priesterin bestrich ihren Arm von oben nach unten mit dem Schwerte. Je älter und vornehmer die Person war, desto länger wurde sie gestrichen. Alle hatten sich für diese Gelegenheit besonders schön gekleidet; die dājung trugen ihre hübschen Brusttücher umgeschlungen. Als die me̥lă mit ihnen selbst vorgenommen wurde, setzten sie sich eine Kriegsmütze aufs Haupt, die vorn mit dem Kopfe des Rhinozerosvogels und hinten mit dessen Schwanzfedern geschmückt war. Den Priesterinnen wurden hauptsächlich Handflächen und Fusssohlen gestrichen. Zuletzt nahm auch die diensttuende dājung auf dem Gong Platz und liess sich von einer anderen streichen.
Am Morgen des 4. Juni erklangen vom dangei herab wiederum die Töne des te̥kok, unter denen eine dājung den Geistern ungefähr 3/4 Stunden lang erzählte, wer die Kajan eigentlich seien, von wem die Häuptlingsfamilie abstamme, was der Stamm in dem betreffenden Augenblick vornehme und was er sich wünsche. Auch mit der Züchtigung der Batang-Lupar, der Erzfeinde der Kajan, wurden die Geister beauftragt. Die ganze Erzählung wurde in Reimform in singendem Tone vorgetragen, wobei das Reimwort lange Zeit die gleiche Endsilbe behielt. An den folgenden Festtagen wiederholte die Priesterin morgens und abends das te̥kok.
Unterdessen herrschte auf der Galerie reges Leben; die jungen Mädchen stampften Klebreis und fanden während des Entspelzens und Beutelns der Reiskörner immer noch Zeit, auf die in der Nähe zuschauenden Jünglinge Geschosse aus Mehl und Wasser abzufeuern. Natürlich wurden diese Angriffe seitens der jungen Männer mit fröhlichen Racheakten beantwortet. Einige sehr ausgelassene junge Mädchen hatten sogar ein kleines Boot auf die Galerie heraufgetragen, um es als Wasserfass zu benützen, und machten den Vorübergehenden, besonders uns bekleideten Europäern, den Weg sehr unsicher.
Das Mehl wurde in der Galerie vor der Häuptlingswohnung auf einen Haufen geschüttet und ein Teil desselben von Knaben mittelst breiter Pandanusblätter in dreieckige Päckchen gebunden und ebenfalls in Dreieckform auf dem Boden aufgestapelt. Nachdem der Vorrat [175] für genügend erachtet worden war, traten die Priesterinnen nach ihrer Altersfolge aus der Häuptlingswohnung auf die Galerie, fassten einander bei der Hand und bildeten einen Kreis um den Mehlhaufen. Usun stand dabei vor den Mehlpäckchen, über welche hin sie wiederum eine me̥lă vornahm: die Glieder der Häuptlingsfamilie reichten ihr der Reihe nach über dem Haufen Mehlpäckchen hin die Hand, die sie mit ihrem alten Schwerte berührte. Dann kamen die Leibeigenen und kleinen Kinder, voran die beiden Enkel des Häuptlings, wiederum von jungen Mädchen getragen, an die Reihe. Schliesslich traten auch die Mütter der übrigen Familien mit ihren Kleinen heran; diejenigen, deren Kinder bereits zu gross waren, um getragen zu werden, brachten deren alte Tragbretter in die Nähe des Mehlhaufens, um dessen segensreichen Einfluss aufzufangen. Auch die Priesterinnen selbst liessen zum Schluss die me̥lă mit sich vornehmen. Alle Anwesenden bekamen einige Mehlpäckchen mit nach Hause, der Rest wurde unter der Häuptlingsfamilie und den dājung verteilt.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch die im Laufe des Jahres geborenen Kinder zum ersten Mal öffentlich gezeigt; sie wurden, wie die Häuptlingskinder, von jungen Mädchen auf dem Rücken getragen. Abends gaben die Mütter den Kleinen zu Ehren ein Familienmahl.
Der Vormittag des 5. Juni verlief nach dem te̥ko̱k des Morgens sehr still. Erst gegen 2 Uhr mittags ertönte der Gong der Priesterinnen, als Zeichen, dass wieder etwas Besonderes vor sich gehen sollte; ich eilte daher aus meiner Hütte in die Wohnung des Häuptlings, wo die dājung mit dem Verfertigen ihrer pe̥māli beschäftigt waren, was stundenlang dauerte.
Nachdem die grösste Hitze vorüber war, wurde den grösseren Kindern ein Fest gegeben; die kleinen, ungefähr 6 Jahre alten Mädchen trugen jetzt zum ersten Mal einen kleinen, leeren, mit kawit versehenen Reiskorb (ingan); sie zeigten sich hie und da auf der Galerie, schienen aber beim Eintritt in die neue Lebens- und Arbeitsperiode recht verlegen zu sein.
Abends ging es in der Galerie besonders feierlich zu: Priester und Laien fassten sich an der Hand und schritten langsam um eine Bambusmatte, auf der wiederum die priesterliche Kriegsmütze (haung lāli) und ein Stück Zeug lagen, herum. Die alte Usun marschierte mit unbedecktem Oberkörper, aber schönem Röckchen, voran, die anderen Priesterinnen folgten mit bedeckter Brust, ausser den beiden jüngsten, [176] die ihre zweijährige Lehrzeit noch nicht hinter sich hatten; diese trugen ein langes, rotes Gewand, das vorn und hinten gerade herunterhing und in der Mitte eine Öffnung für den Kopf frei liess; ihre Röckchen hatten, zur Unterscheidung von den anderen, ein weisses Feld. Die dājung leiteten den Rundgang ein, bis allmählich immer mehr junge Männer und Frauen herbeikamen und, erst mit Zeugstreifen zwischen einander, später ohne diese, sich in den Kreis fügten. Die schliesslich ermüdeten Priesterinnen liessen sich jetzt abwechselnd auf der Matte nieder.
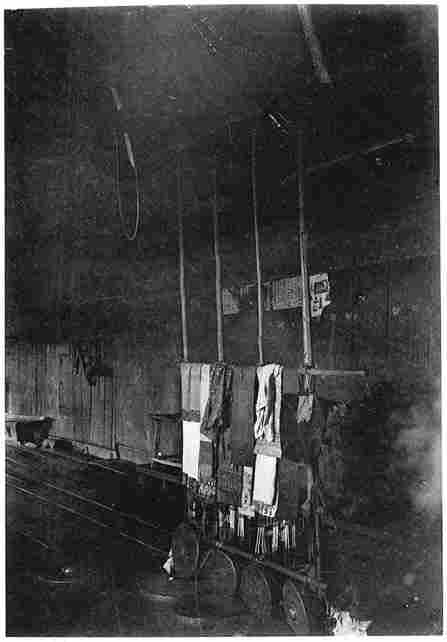
Lăsa, Opfergerüst mit Opfergaben.
Sowohl Priester als Laien stimmten während des Rundganges (nangeian) halb rezitierend, halb singend, ein geistliches Lied an; Usun sagte die Verse, die übrigen wiederholten den Refrain. Nach einigen Stunden stellten sich die Laien längs den Wänden der Galerie auf, um die Beseelung der jüngsten dājung zu beobachten. Die Betreffende stand zu diesem Zwecke vor der Matte und hielt eine Art Kette fest (alan to̱ = Geisterweg), längs welcher der Geist zu ihr herabkommen sollte. Neben ihr stand eine der ältesten Priesterinnen, um sie in die Geheimnisse ihrer Wissenschaft einzuweihen, während Usun, die Kriegsmütze auf dem Kopfe, deklamierend und tanzend um sie herumlief; zu beiden Seiten führten männliche dājung Kriegstänze auf. Wahrscheinlich hatten diese letzten Vorstellungen den Zweck, böse Geister abzuwehren. Die Szene dauerte nur eine Viertelstunde, worauf die Laien ihren Marsch bis nach 1 Uhr nachts fortsetzten. In den Familien mit Täuflingen herrschte bis in den Morgen fröhliches Beisammensein.
Der 6. Juni war für Priester und Priesterinnen ein Tag der Erquickung; denn bis jetzt hatten sie unter allerhand Verbotsbestimmungen, von denen nicht baden und kein Wasser trinken zu dürfen die schlimmsten waren, geschmachtet. An diesem Tage war es den Priestern endlich erlaubt, ihren auswendigen Menschen durch ein Bad zu erquicken; den inwendigen erfrischte ich ihnen bereits seit mehreren Tagen, indem ich in ihre Wasserflaschen einige Tropfen Salzsäure goss, wodurch, nach Auffassung der dājung, das Wasser so verändert wurde, dass sie es mit reinem Gewissen trinken konnten. Nach den grossen Mengen so präparierten Wassers, die von mir verlangt wurden, liess sich die Grösse des priesterlichen Durstes bemessen.
Nach dem te̥ko̱k des Morgens folgte der Glanzpunkt des Festes—die Opferung der Schweine. Zuerst begann unter dem Hause eine Jagd nach den frei herumlaufenden Tieren- der Häuptling lieferte [177] deren fünf; jede Familie, in der ein kleines Kind bei diesem Neujahrsfest einen Namen erhielt, lieferte eines.
Als ich mich bald nach dem Ertönen des priesterlichen Gongs auf die Galerie begab, fand ich die Schweine des Häuptlings gebunden neben einander niedergelegt und die Priesterinnen vor den Tieren knieend, die sie in Geistersprache den Bewohnern von Apu Lagan als Opfer anboten. Hinter den Opfertieren, schräg unter dem Galeriefenster und dem als Geisterweg dienenden Rotangseil vom vorigen Tage, hatte man aus 4 senkrechten und 4 horizontalen Hölzern ein Gerüst (lasa) aufgestellt und dieses mit schönen Stoffen, einem Kriegsmantel und einigen Gürteln aus alten Perlen, alles Opfergaben des Häuptlings, behängt; ebenfalls Opfergaben waren die schönen kupfernen Gonge am Fusse des Gerüstes. Durch symbolische Gegenstände (pe̥māli) in einem danebenstehenden Korbe suchten die Priesterinnen den Geistern die Wünsche des Stammes zu erkennen zu geben.
Die Priesterinnen begannen nun, um das Opfergerüst langdauernde Tänze auszuführen, die, besonders da sie bei Tageslicht stattfanden, viel Interessantes boten.
Sämmtliche Priesterinnen beteiligten sich an dem Tanze; jede deutete durch ihre Bewegungen den Geistern droben das Darbringen der Opfer auf dem Gerüst und der fünf Schweine an. Erst schmückte sich die oberste Priesterin, dann jede der übrigen mit dem Kriegsmantel aus Pantherfell und der Kriegsmütze, während zu beiden Seiten zwei mit Schwertern bewaffnete Priester, zur Abwehr böser Geister, Kriegstänze aufführten. Hie und da veränderten die Priesterinnen den Charakter ihrer Bewegungen; sie zeigten viel Individualität beim Tanze und nach der Art seiner Ausführung liess sich die Höhe der erreichten priesterlichen Entwicklung bemessen. Nur den drei obersten Priesterinnen: Usun, Tipong Igau und einer gewissen Uniang gelang es, durch Pantomimen das Anbieten der Opfer an die Himmelsbewohner wirklich verständlich auszudrücken. Usun, mit einer Speerspitze tanzend, erweckte den Eindruck, als wolle sie mit ihr das ganze Opfergerüst den Geistern droben entgegenreichen. Tipong dagegen führte einen ruhigen Tanz aus, mit gefälligen Bewegungen die Seelen der Opfer auffordernd, himmelwärts zu steigen. Ihre korpulente Gestalt bewegte sich dabei mit bewundernswerter Weichheit, welche die anderen; günstiger Gebildeten, bei weitem nicht erreichten. Diese sprangen und hüpften unbeholfen um die Opfer herum und verstanden nur selten [178] Ausdruck in ihre Bewegungen zu bringen. Einige Priesterinnen liessen sich sogar, um recht deutlich zu sein, zu den absonderlichsten Vorstellungen verleiten. Während z.B. Tipong sich zu den nahebei liegenden Opfertieren beugte, scheinbar einen Teil von ihnen ergriff und mit einigen Bewegungen in die Höhe schwang, gingen andere, in der Meinung, dass eine bloss symbolische Bewegung nicht genüge, hüpfend, mit der Kriegsmütze auf dem Kopfe, auf die Schweine zu, packten das kleinste an den Hinterbeinen und trugen das quiekende Tier, mit Anspannung aller Kräfte, im Tanzschritt zum Opfergestell und wieder zurück. Zum Schluss wurde auch Tipong zu grösserer Lebhaftigkeit hingerissen, schüttelte einige Male das Gestell, bestieg es sogar und bewegte es hin und her, um die Seelen der Opfer hinaufsteigen zu lassen. Im allgemeinen waren die Bewegungen bei diesen Tänzen viel lebhafter als bei denen der Javaner und erforderten grosse Kraftanspannung; die alte Usun leistete in dieser Beziehung Bewundernswertes.
Die Priesterinnen wurden jetzt von jungen Männern und Frauen abgelöst, welche mit dem gleichen Gesang wie am vorhergehenden Tage den Tanz um das Opfergerüst in ruhigerer Weise bis zum Abend fortsetzten. Man hatte sich für diesen Tanz besonders schön geschmückt; die Männer mit prächtigem Kopf- und Lendentuch und einer Art se̥lendang (langer, schmaler, malaiischer Schal) als Bandelier um die Schultern. Auch die Frauen trugen derartige Schale und zwar in der Weise, wie es im vorigen Kapitel beschrieben worden ist. Beinahe alle hatten Elfenbeinarmbänder und Fingerringe angelegt; ausserdem hatten sie sich für diese festliche Gelegenheit Augenbrauen und Wimpern besonders sorgfältig ausgezogen.
Kurz vor Einbruch der Dunkelheit schlachteten die Männer die Schweine und zwar auf der Galerie vor der Tür der verschiedenen Wohnungen; sie schnitten ihnen jedoch nicht, wie die Ulu-Ajar Dajak, den Hals durch, sondern schächteten sie. Da man das Schreien der Tiere nicht gern hörte, hatte man ihnen nicht nur die Schnauze zugebunden, sondern hielt diese ausserdem noch fest. Der älteste, ungefähr zehnjährige Enkel des Häuptlings machte den Anfang beim Schlachten; man gab ihm ein Messer in die Hand, welche von einem älteren Manne geführt wurde. Auch in den Wohnungen der Familien mit Täuflingen wurden die Opfer geschlachtet, worauf man ihnen den Bauch durch einen Querschnitt öffnete, um zu sehen, ob die Unterseite der Leber hell oder dunkel war, d.h. ob sie eine günstige oder ungünstige [179] Farbe zeigte und ob die Gallblase und andere Teile durch ihr normales gegenseitiges Verhalten dem Kinde eine gute Zukunft versprachen.
Ebenfalls auf der Galerie versengte man den Tieren in hochflammendem Feuer die Borsten, weidete sie aus und zerstückelte sie, was bei der inzwischen hereingebrochenen Dunkelheit einen sehr phantastischen Anblick bot. In der darauf folgenden Nacht durften sich weder Männer noch Frauen zur Ruhe begeben, obgleich der Tag für alle sehr anstrengend gewesen war.
Nicht minder anspannend war der folgende Tag, genannt “aron uting” = “Festtag des Schweinefleischessens”, an dem der Häuptling bereits früh morgens im Freien in grossen, eisernen Kesseln das Schweinefleisch kochen liess.
Das te̥ko̱k datierte diesmal besonders lange. Die Mütter fingen an diesem Morgen mit ihren Täuflingen einen Rundgang durch alle Wohnungen an, um sie bei allen Hausbewohnern als neue Stammesglieder vorzustellen. Die Kinder wurden dabei wieder von schön geputzten und mit dem geweihten Hut geschmückten jungen Mädchen in ihren hăwăt auf dem Rücken getragen, begleitet von den ebenso schön gekleideten Müttern, welche zwei geweihte Bambusgefässe mit Wasser und eine Klapper für eine me̥lă in die Wohnung des Häuptlings trugen; von dort aus begaben sie sich zu allen übrigen Hausbewohnern.
Auch aus der Wohnung des Häuptlings begann jetzt ein Kinderauszug: voran gingen die beiden Enkel, gleich hinter ihnen wurden die in der amin im verflossenen Jahre geborenen Kinder der Leibeigenen von ihren Müttern geträgen. Zwar waren die Häuptlingskinder bereits viel zu alt für den Umzug, aber als Söhne des Häuptlings mussten sie ihn noch etliche Jahre mitmachen. Dem ältesten, Tingè, wurde von einem Mädchen ein winziger Schild und ein hölzernes Schwert nachgetragen. Eine Sklavin begleitete den Zug mit einem Gong.
Mittags wurde, nachdem man aus gekochtem Schweinefleisch und Klebreis gesonderte Päckchen gebunden und diese in Dreieckform auf der Galerie aufgestapelt hatte, in gleicher Weise wie früher, mit allen Familiengliedern des Häuptlings und den Müttern, welche ihrer Täuflinge wegen den Geistern geopfert hatten, eine me̥lă vorgenommen, genannt “me̥lă uting” = “Seelenberuhigung durch Schweinefleisch”. Nach der heiligen Handlung erhielt jeder wiederum seinen Anteil an den Päckchen mit [180] nach Hause. Der grosse Festtag verlief, wahrscheinlich wegen des tags zuvor erfolgten Todes eines kleinen Kindes, sehr ruhig. Die Kajan behaupteten zwar, Arak getrunken zu haben, ihr stilles, besonnenes Betragen und die nur zwei Tage lang dauernde Bereitung des Trankes sprachen aber mehr dafür, dass sie Zuckerwasser genossen hatten.
Vor der “me̥lă uting” hatte ich noch einem interessanten Ringkampfe (pajow) der jungen Männer beigewohnt. Bereits einige Tage zuvor hatten sich die Jünglinge hie und da mit einander gemessen, jetzt waren alle auf der Galerie versammelt und ein Paar nach dem anderen betrat den Ringplatz. Die Kämpfer waren nur mit dem Lendentuch bekleidet, das sie straff anzogen, um dem Gegner einen festen Angriffspunkt zu bieten. Die Partner umfassten einander, packten sich gegenseitig hinten am Gürtel fest und suchten einander emporzuheben und rücklings auf den Boden zu werfen. In Anbetracht, dass ein Fall auf die Eisenholzbretter nicht ungefährlich war, suchten einige Mütter ihre Söhne von dem gefährlichen Spiele abzuhalten. In Gegenwart der Kameraden blieben diese mütterlichen Mahnungen leider erfolglos, und so mancher hatte bereits mit heftigem Anprall den Boden berührt, als ein stämmiger Sklave als Sieger des Tages hervorzugehen schien. Dem jungen Manne waren die vielen Siege so zu Kopfe gestiegen, dass er nach seinem letzten Triumph mit herausfordernden Gebärden einen lauten Juchzer erschallen liess. Auch bei den Kajan kommt Hochmut vor dem Fall: einer der bis dahin unbeteiligt gewesenen Zuschauer betrat jetzt den Kampfplatz. Überlegen durch seine frischen Kräfte und durch seinen ansehnlicheren Wuchs, gelang es ihm bald, seinen Partner vom Boden zu erheben und ihn, den rechten Arm gestützt auf das rechte Knie, in die Höhe zu halten. Auf dem gleichen Bein hatte der zappelnde Gegner aber einen Stützpunkt für seine Füsse gefunden und so wurde das Umdrehen nicht leicht. Mit Anspannung aller Kräfte gelang es dem Neuen endlich, den hochmütigen Helden mit hartem Aufschlag zu Boden zu werfen. Die gebräuchliche Revanche brachte dem Besiegten keinen besseren Erfolg.
Am 8. Juni wurde der “aron ke̥rtăp” = “Festtag des Klebreisessens” gefeiert; er begann wieder mit einer me̥lă, nach welcher diesmal Päckchen mit Reis und Klebreis ohne Schweinefleisch verteilt wurden.
Abends war es, wegen des Todes des kleinen Kindes, sehr still im [181] Hause; man begrub es, um das Fest nicht durch Trauerfeierlichkeiten zu unterbrechen, erst nach beendetem Fest. Die eigene Mutter hatte den Heimgang des kleinen Kranken nach Apu Ke̥sio dadurch beschleunigt, dass sie ihn morgens beim Rundgang zur me̥lă mitgenommen hatte.
Der 9. Juni bildete den letzten Festtag. Acht dājung begaben sich morgens auf die kleine Plattform des dangei, bildeten einen Kreis, reichten einander die Hände und begannen gemeinsam im Tonfall des te̥ko̱k eine Ansprache an die Geister; der Rhythmus wurde dabei durch Bewegen der Hände angegeben. Nachdem sie sich über eine Stunde lang von der warmen Sonne hatten bescheinen lassen, brachte man ihnen einen geschlossenen Korb (ingăn), in dem sich verschiedene kawit, acht aneinander gereihte Eierschalen und einige Küchlein befanden. Usun öffnete den Korb und begab sich mit ihm nach einer Ecke des dangei, in welcher täglich auf einem trichterförmig gespaltenen Pflanzenstengel Esswaren für die Geister niedergelegt wurden, und forderte diese auf, in den Korb überzugehen. Der Korb wurde darauf geschlossen und von den Priesterinnen in die amin des Häuptlings getragen.
Nach einer kleinen Erholung und einem kräftigen Trunk von dem von mir präparierten Wasser versammelten sich die dājung auf der Galerie, legten acht unverletzte Bananenblätter auf und neben einander auf den Boden und stapelten darauf die Esswaren, welche sie aus dem erwähnten Korbe hervorgeholt hatten. Durch Auseinanderschieben der Schindeln hatte man zuvor eine Öffnung im Dache hergestellt. Wiederum murmelten die Priesterinnen eine Zeitlang über dem Haufen, bildeten ihren phantastischen Kreis und begannen, wie früher, zuerst mit den Gliedern der Häuptlingsfamilie, dann mit den Müttern und kleinsten Kindern eine me̥lă vorzunehmen Darauf verteilten sie einen kleinen Teil der kawit, Eierschalen und Küchlein an die Teilnehmer.
Es folgte jetzt eine Szene, die mich aufs lebhafteste interessierte aus der amin des Häuptlings wurde eine Sammlung alter hăwăt und geweihter Hüte herausgetragen. Die Tragbretter und dann auch die Hüte wurden ehrfurchtsvoll über dem Haufen Opferspeisen hin- und herbewegt und dann ins Haus zurückgetragen. Jetzt durften auch die gewöhnlichen Kajanfrauen mit ihren alten hăwăt und Hüten herantreten und den wohltätigen Einfluss der Opfergaben auffangen. Diese Zeremonie bot mir die seltene Gelegenheit, die alten, ehrwürdigen [182] Familienstücke zu sehen, die mir einen Begriff von der früheren Kunstfertigkeit der Kajan gaben. Es lagen auf den hăwăt noch Zeugstücke, die früher von den Kajan mit ähnlichen Figuren bemalt worden waren, wie man sie jetzt in den Webearbeiten der Batang-Luparstämme findet; derartige Arbeiten werden längst nicht mehr von den Kajan ausgeführt. Diejenigen, die diese Tragbretter und Hüte einst benützt hatten, waren entweder längst gestorben oder bereits betagte Leute; so wurde z.B. auch Akam Igaus Kindertragbrett hervor geholt. Augenscheinlich sollte die neue Weihe, die die hăwăt empfingen, rückwirkend noch auf die Seelen der Verstorbenen und Betagten einen guten Einfluss üben. Kaum hatten sich die Priesterinnen entfernt, so suchte jeder noch etwas von dem Rest der Opferspeisen zu erwischen.
Die offizielle Schlussfeier des ganzen Festes erfolgte vor dem Hause beim dangei, wo man den Erdboden, den die Priesterschaft auch jetzt nicht berühren durfte, mit den Brettern des tasu nangei belegt hatte. Wiederum waren alle aufs schönste gekleidet. Mit Kriegsmütze und Kriegsmantel geschmückt umkreiste Usun etliche Male tanzend den Fuss des dangei und führte mit ihrem alten Schwerte Bewegungen aus, als wollte sie den ganzen dangei gen Himmel heben. Die übrigen Priesterinnen, von denen die ältesten gleich wie die männlichen Priester mit Speeren bewaffnet waren, unterstützten Usuns Bemühungen und wehrten, indem sie in die Luft schlugen und stachen, ausserdem die bösen Geister ab, die ihre Handlungen stören konnten. Die Priesterinnen setzten ihren Tanz bis gegen Mittag fort, dann aber verschwand, von der jüngsten beginnend, die eine nach der anderen. Schliesslich waltete nur noch die alte Usun ihres heiligen Amtes und verliess den Tanzplatz erst, nachdem die Sonne ihren Höhepunkt bereits erreicht hatte. Nach drei anstrengenden Tagen durften die dājung nun zum ersten Mal wieder ihr wohlverdientes und heissersehntes Bad nehmen.
Abends sollte wiederum ein nangeian um das Opfergerüst, das in gleicher Weise wie früher (pag. 177) aufgestellt worden war, stattfinden. Die Häuptlingsfamilie begann sich gegen 6 Uhr abends auf den Rundgang, der nach alter Sitte bis zum Anbruch des folgenden Tages dauern musste, vorzubereiten, indem sie auf der Plattform des dangei ein symbolisches Bad nahm. Die Familienglieder und darauf auch die dājung wurden der Reihe nach, den Fuss auf einen alten Gong gestützt, mit Weihwasser aus einem Bambusgefäss übergossen. Unter den Tönen eines Gongs wurden gleichzeitig alle Speiseabfälle, welche von [183] der Herstellung der pe̥māli übrig geblieben und bis jetzt sorgfältig bewahrt worden waren, in grossen Körben von der Höhe des dangei herabgeworfen.
Gegen 9 Uhr abends erklängen die Gonge von neuem, als Zeichen, dass die Priesterinnen den nangeian mit Singen und Tanzen begonnen hatten; sie setzten den Rundgang fort, bis der Zustrom der Laien so gross geworden war, dass sie von diesen abgelöst werden konnten. Die Beteiligung am nangeian war jetzt eine viel regere als früher; selbst bejahrtere Personen scharten sich in den Kreis der Jungen und stimmten in den eintönigen aber melodischen Gesang ein. Alle hatten ihre schönsten Festkleider angetan; die Frauen trugen ausserdem ihre prächtigen Schale und die Männer ihre Schwerter. Unterdessen hockten die Priesterinnen auf einer Matte und unterhielten sich mit Betelkauen und Singen, bis die Reihe an sie kam, unter verstärkter Begleitung der Gonge wieder in den Kreis einzutreten. Auf uns Fremde machte die ganze Zeremonie, des schlichten Ernstes wegen, mit dem sie vorgenommen wurde, einen feierlicheren Eindruck, als wir ihn in dieser seltsamen und ungewohnten Umgebung erwartet hätten.
Bis zur Dämmerung setzten alle unermüdlich den Rundgang fort. Nachdem ich mich zur Ruhe begeben hatte, wurde ich stets wieder durch ein besonders starkes Einsetzen der Gonge geweckt.
Bei Tagesanbruch erschallte aus der Häuptlingswohnung lauter Gesang. Auf den Schluss des Festes begierig eilte ich nach oben und fand alle Festteilnehmer in der noch dunklen amin aja versammelt; sie standen unter dem noch geschlossenen Dachfenster um die dājung herum und stimmten unter deren Vorgang einen Gesang an, der an Ernst und Feierlichkeit nichts zu wünchen übrig liess. Nach beendigtem Gesang zogen sich alle still in ihre Wohnungen zurück.
Der 10. Juni begann für alle mit dem, nach den Anstrengungen der letzten Tage, so nötigen Schlaf. Die Priesterinnen sollten erst nach genossener Ruhe in ihre eigenen Wohnungen zurückkehren, wo sie noch 8 Tage lang nach Vorschrift leben mussten. Die aussergewöhnliche Stille auf der Galerie benützten wir sogleich, um einige photographische Aufnahmen zu machen.
Die Tür der Häuptlingswohnung wurde zuerst photographiert. Da ich auch gern eine Aufnahme von dem noch danebenstehenden lasa gemacht hätte, fragte ich, allerdings mit wenig Hoffnung auf Erfolg, Akam Igau, ob dies gestattet sei. Obgleich sehr aufgebracht, wagte [184] er doch nicht, nein zu sagen, und so machte ich denn von dieser halben Zustimmung und dem Schlaf der noch abergläubischeren Frauen Gebrauch, um auch von dem lasa ein Cliché anzufertigen.
Was ich jedoch gefürchtet, traf ein, denn bereits abends kam Akam Igau mit verstörtem Gesicht zu mir und erzählte, dass unsere Aufnahmen einen Sturm der Entrüstung seitens der erwachten Priesterinnen auf sein armes Haupt beschworen hatten. Da eine günstige Stimmung der Kajan kurz vor unserem Zuge zum Mahakam von der grössten Bedeutung wir, glaubte ich den Häuptling mit ein paar Dollar entschädigen zu müssen. Ob nun die photographischen Aufnahmen oder dies Geldgeschenk beunruhigend gewirkt hatte, weiss ich nicht, aber am folgenden Morgen erschienen Usun und Tipong Igau, setzten sich mit ernster Miene zu mir auf den Boden und erklärten, dass böse Träume ihnen in der vergangenen Nacht die Entrüstung der Geister verkündet hätten. Tipong hatte geträumt, dass man sie nach dem Ritus der Kajan in ihren Sarg gelegt hatte; Usun, dass ihr Boot aufs Land gezogen war: beide Träume deuteten auf ihren bevorstehenden Tod. Ich fürchtete anfangs, dass man die Vernichtung der Clichés verlangen würde, aber ihr dajakisches Gewissen zeigte sich zum Glück mit dem Bezahlen einer Busse zufrieden gestellt. Mir gegenüber wollte Tipong jedoch noch Nachsicht üben und verlangte daher eine Seelenberuhigung von nur 3 Dollar. So waren die Schwierigkeiten beiderseits fortgeräumt, aber ich rechnete in Zukunft doch auf weniger kostspielige Aufnahmen.
Die Priesterinnen waren nach dem Fest, wie gesagt, noch nicht frei: den ersten Tag mussten sie me̥lo̱ bruwa, (= ruhen für die Seele); den zweiten Tag begaben sie sich alle in grosser Gala mit Kriegsmütze und Schwert aufs geweihte Reisfeld ans jenseitige Ufer, um die Verbotszeit abzuwerfen (be̥t lāli); am dritten Tage mussten sie wieder ruhen; am vierten Tage versammelten sie sich wieder alle in der amin aja, wo morgens und abends bei geschlossener Tür eine grosse me̥lă stattfand; am fünften und sechsten Tage wurde wieder geruht.
Auch für die übrigen Bewohner war alles Aussergewöhnliche in dieser Zeit verboten. Als in diesen Tagen ein von der Regierung mit der Impfung der Kajan betrauter Malaie aus Putus Sibau ankam, um hier seines Amtes zu walten, liess sich keiner von ihm impfen, obgleich man ihn selbst herbeigewünscht hatte. Erst einige Tage später kamen die Kajan, dann aber in Haufen heran. [185]
Am siebenten Tage mussten die dājung in Gruppen von vieren in der eigenen Wohnung eine me̥lă abhalten, worauf am achten wieder ein me̥lo̱ folgte, nach welchem sie endlich ihr Armband der Verbotszeit (le̥ku lāli) endgültig ablegen durften. Diese Armbänder bestanden aus vier Reihen grosser, wertvoller Perlen, welche sie von der Häuptlingsfamilie als wichtigste Belohnung erhalten hatten. [186]
Kapitel IX.
Fischreichtum des Kapuasgebietes—Fischereigerätschaften—Fang des tapa—Fang mit tuba-Gift—Jagd—Hunde der Bahau—Erträgnisse der Jagd—Vogelfang—Haustiere.
Die Bahau am Mendalam erfreuen sich, wie auch die anderen Stämme am oberen Kapuas, eines grossen Fischreichtums ihrer Gewässer. Fische bilden daher auch nach Reis ihr Hauptnahrungsmittel. Nicht nur der Kapuas und seine Nebenflüsse, sondern auch alle Seeen, die ihm ihr Dasein verdanken, sind reich an Fischen. Der Fluss schlängelt sich nämlich in zahlreichen Windungen durch das flache Land, verlegt bei Hochwasser öfters sein Bett, hier seinen eigenen Bogen abschneidend, dort wiederum einen neuen bildend, und lässt als Folge hiervon zu beiden Uferseiten zahlreiche Seeen von länglicher Form zurück. Bei Hochwasser, wenn ihnen die Flüsse schwerer zugänglich sind, fischen die Kajan vorzugsweise in diesen Flussseeen.
Die Kajan gebrauchen für den Fischfang folgende Gerätschaften die Angel (pe̥se̱); das Schöpfnetz (hiko̤̱p); das Wurfnetz (djăla); den Speer mit einer Spitze (bakir); den Speer mit mehreren Spitzen (se̥răpăng) und verschiedene Arten von Reusen; ausserdem fischen sie mit Fischgift (tuba).
Die Angel und das runde Wurfnetz werden täglich gebraucht; jene hauptsächlich von Kindern und alten Männern, dieses von erwachsenen, kräftigen Männern.
Je nachdem, ob es sich um den Fang grosser oder kleiner Fische handelt, gebrauchen die Bahau verschiedene Angelhaken. Die kleinsten stellen sie mit einem Widerhaken aus Kupferdraht her. Als ich ihnen Stecknadeln mitbrachte, die sie bis dahin noch nicht kannten, verwandelten die Kinder diese, indem sie sie umbogen, bald in Angelhaken. Auf meinen folgenden Reisen bildeten Fischangeln verschiedener Grösse für alt und jung sehr geschätzte Geschenke.
Die grossen bis sehr langen Angelhaken werden geschmiedet; [187] man benützt sie hauptsächlich für Setzangeln, die man, mit Köder und Schwimmer versehen, den Fluss abwärts treiben lässt, während man selbst, beispielsweise, eine weiter unten gelegene Niederlassung besucht. Als Schwimmer dient ein trockener, hohler Kürbis.
An Wurfnetzen gebraucht man, nach der Grösse der zu fangenden Fische, drei verschiedene Arten. Sie bestehen aus einem runden Netz, das rings herum eine Kette aus Zinn oder Eisen (awit tite̱ = Eisenkette) trägt; letztere wird am liebsten aus grossen Nägeln, die man durch Klopfen in Kettenglieder verwandelt, hergestellt.
Die Netze für kleine Fische (djala se̥luwang) haben 2½–4 qcm grosse Maschen und einen Durchmesser von 3–4 m; sie werden gegenwärtig meist aus eingeführtem, grobem Strickgarn verfertigt.
Für grössere Fische gebraucht man Netze mit 4–9 qcm grossen Maschen und einem Durchmesser von 5–6 m. Die Netze werden aus den zu einer Schnur gedrehten Fasern der Liane aka te̥ngāng hergestellt. Die grossen Wurfnetze, deren Durchmesser bis zu 8 m beträgt, haben bis zu 16 qcm grosse Maschen; sie bestehen aus den gleichen Lianenfasern wie die kleineren Arten, nur verwendet man für sie dickere Schnüre.
Die Bahau imprägnieren ihre Netze nicht und verstehen sie nach dem Gebrauch vor Fäulnis nur durch Trocknen an der Sonne zu schützen.
Beim Auswerfen nimmt der Fischer das Netz über beide Arme und sucht es, durch drehende Bewegung, so ausgebreitet als möglich auf die Wasserfläche zu schleudern; die schwere, in zentrifugaler Richtung auseinander getriebene Kette bewirkt, dass das Netz flach niederfällt. Zum Herausziehen des Netzes dient eine im Mittelpunkt befestigte Schnur, während die Fische durch die am Boden schleifende Kette gefangen gehalten und mit heraufgezogen werden. Ist der Boden jedoch durch Gestein, Baumwurzeln und Zweige sehr uneben, so lässt der Fischer das Netz liegen, taucht unter und holt die Fische, aus Furcht, dass sie sonst entfliehen könnten, mit der Hand hervor. Bisweilen werden die Fische auch, bevor man das Netz über sie wirft, mit gekochtem Reis an eine bestimmte Stelle gelockt.
Das Auswerfen der Netze erfordert viel Kraft und Gewandtheit; um die grossen Netze gleichmässig niederfallen zu lassen, nimmt der Fischer den mittleren Teil oft in den Mund.
Ausser diesen sind auch lange Netze den Dahau bekannt; sie [188] gebrauchen sie, um ein Flüsschen abzusperren, besonders beim Fischen mit Gift. Zugnetze jedoch sind ihnen unbekannt.

Landschaft am oberen Kapuas.
Beim Fischen mit dem se̥răpang ist, um die Fische anzulocken und sichtbar zu machen, Licht erforderlich. Der Fischer lässt sich nachts in aller Stille flussabwärts treiben und hält vorn im Boot das tapong hirui, das Brettchen, unter dem die Harzfackel (damat hirui) brennt, die ihm auf diese Weise nicht hinderlich wird. Am Brettchen ist, um es bequemer zu handhaben, ein Griff (tagin) angebracht. Sobald sich, vom Fackelschein angelockt, Fische zeigen, sucht sie der Fischer zu spiessen.
Reusen werden besonders bei Hochwasser ausgesetzt und zwar an Stellen, wohin sich die Fische vor der heftigen Strömung geflüchtet haben. Diese Reusen haben meist die gewöhnliche malaiische Form; nur eine Art ähnelt einem runden Vogelbauer mit rundlicher Öffnung, in welcher ein am Aussenende geschlossenes Bambusrohr mit ebenfalls runder Öffnung oben steckt. Kleine Fische, durch den im Bambus befindlichen Reis angelockt, lassen sich dazu verleiten, in den Bauer zu schwimmen. Der Rückzug wird ihnen durch zusammeneigende Ästchen an der inneren Bambusöffnung abgeschnitten.
Auch der hiko̤̱p, ein kreisförmiges Stück Rotang von ½ m Durchmesser mit eingespanntem Garnnetz, wird hauptsächlich bei Hochwasser angewendet, um zwischen das Ufergras geflüchtete Fische zu fangen. hiko̤̱p und Reusen werden vorzugsweise von Frauen und Kindern benützt.
Die Kajan ziehen zwar grosse Fische vor, verschmähen aber auch die kleinsten nicht; diese werden auch vielfach zu Opferzwecken verwendet.
Da Salz auch am Mendalam sehr teuer ist, werden grössere Mengen Fische durch Trocknen und Räuchern über dem Feuer für längeres Aufbewahren präpariert.
Während bei allen vorhin besprochenen Arten von Fischfang nur wenige Personen beteiligt sind, vereinigen sich zum Fischen des tāpā die Bewohner eines oder mehrerer Häuser.
Der tāpā ist ein grosser, bis 1 m langer, dunkelbrauner Fisch mit sehr breitem, plattem Kopf und weit klaffendem Maul, bewaffnet mit mehreren Reihen scharfer Zähne.
Gegen August zieht der Fisch aus dem Hauptstrom in kleine Nebenflüsse, um dort zu laichen; die Kajan benützen diesen Augenblick, um hinter den bisweilen grossen Schwärmen das Flüsschen mittelst eines Heckwerks oder Netzes abzuschliessen.
Einem derartigen tāpā-Fang wohnte ich während meines ersten [189] Aufenthaltes in Tandjong Karang bei, wo es einem Manne aus Tandjong Kuda glückte, einen Fischschwarm im Samus, einem rechten Nebenfluss des Mendalam, einzuschliessen. Am ersten Tage hatten die Hausgenossen des glücklichen Finders, unsere Nachbarn oben am Fluss, das Recht, so viel Fische zu fangen als sie gelüstete; den folgenden Tag sollten wir uns zum Feste aufmachen.
Man hatte auch mich zur Teilnahme aufgefordert, und, wie immer mit Stock und Revolver bewaffnet, nahm ich anderen Morgens früh in einem schmalen Nachen Platz, dessen Wände nur wenige Centimeter über das Wasser herausragten; ich musste mich daher sehr ruhig verhalten, wenn ich das Boot nicht zum Umkippen bringen wollte. Zwei junge Kajan ruderten, und so ging es schnell den Mendalam hinauf. Die Samusmündung lag weiter unten, aber das eigentliche Jagdgebiet befand sich am Oberlauf des Flüsschens, so dass wir, um zeitig das Ziel zu erreichen, erst ein anderes Nebenflüsschen hinauffahren und dann eine Strecke über Land gehen mussten. Der Weg führte, nach dajakischer Weise, mehr über liegende Bäume als über mit Gras und Gestrüpp bedeckten Boden. Bald bildeten die Bäume den einzigen passierbaren Weg; zu meinem Erstaunen lagen sie aber nicht, wie gewöhnlich, der Äste beraubt am Boden, sondern teilweise über einander und zwar so, dass der nur wenig abgekappte Gipfel des einen Baumes auf dem Fussende des folgenden ruhte und der so entstandene Baumpfad bis zu 4 m hoch über dem Erdboden lag. Er führte nämlich zu früheren Reisfeldern durch einen Wald, der so nass und morastig war, dass man mit bewundernswerter Geschicklichkeit den einen Baum über den anderen hatte fallen lassen und, nachdem die hinderlichsten Äste entfernt waren, einen Pfad geschaffen hatte, auf dem man niemals den Boden berührte. Es lagen hier Baumriesen von mehreren Metern Durchmesser, auf denen man mühelos 40 m weit gehen konnte; dann trat man aber auf andere, deren glatte, hellgraue Stämme zwar sehr schön anzusehen waren, in dieser beträchtlichen Höhe von einem beschuhten Europäer jedoch nur mit einer gewissen Kaltblütigkeit begangen werden konnten. Besonders kritisch wurde die Situation beim Überschreiten der oberen, dünnsten Stammenden, an denen Äste gesessen hatten; da die hinter mir gehenden Kajan ihren Schritt dann etwas mässigen mussten, wurden die Schwingungen unseres Pfades unregelmässiger und wir liefen Gefahr, das Gleichgewicht zu verlieren. Letzteres war jedoch nicht wünschenswert, [190] denn unter uns lagen zwischen dornigem Gesträuch die abgehackten Äste übereinander, so dass ein Fall bedenkliche Folgen gehabt hätte. Glücklicher Weise betrat ich hier nicht zum ersten Mal einen Baumpfad im Morastwalde, aber 1½ Stunden hintereinander, wie hier, war ich noch nicht auf solchem Wege marschiert und so hielt ich mich vor Ermüdung kaum noch auf den Füssen, als wir endlich wieder den Boden betraten. An meinen Begleitern bemerkte ich jedoch keine Ermattung, sie wären auch zu sehr von der freudigen Erwartung des bevorstehenden Fischfangs erfüllt, um sich in die Schwierigkeiten hineinzudenken, die ein solcher Gang über glatte Baumstämme ohne stützendes Geländer dem schuhbedeckten Fusse eines Europäers bereiten musste.
Der Marsch durch ein verlassenes, dicht bewachsenes Reisfeld zählte für gewöhnlich schon zu den Prüfungen, jetzt jedoch erschien er mir wie eine Erholung.
Zeitig genug langten wir am Ufer des Samus an; die hier versammelte Gesellschaft hatte ihre Reismahlzeit noch nicht begonnen.
An den sandigen, weissen Ufern des Samus, mitten im hohen Urwald, boten die geschäftigen Männer, Frauen und Kinder eine Reihe anmutig wechselnder Bilder. Auch die Ma-Suling hatten diesen Tag zum Fischen gewählt und ich bemerkte unter ihnen fremde Gestalten, die ihre Scheu jedoch bald ablegten, als sie die anderen sich so frei in meiner Gegenwart bewegen sahen.
Während des Essens kam die Nachricht, dass sich die Fische, diesmal in geringerer Zahl als sonst, weiter oberhalb im Bache befanden. Sogleich machten sich die Männer auf, durchwateten das Flüsschen und verschwanden im Walde. Nur mit Mühe konnte ich einige Knaben bestimmen, bei mir zu bleiben und mir den Weg zu weisen. Dieser führte gleich anfangs quer durch den Fluss, den meine braunen Führer einfach durchschwammen, während ich ihn, um nicht gleich durch und durch nass zu werden, watend zu passieren versuchte. Diese Vorsicht erwies sich aber als unnütz, da ich doch bis an die Brust ins Wasser musste; die Erfrischung war übrigens angenehm und bei der ständigen Bewegung nicht schädlich. Nachdem wir ein Stück Wald und mehrmals den gleichen Bach durchquert hatten, erreichten wir den Schauplatz des grossen Ereignisses: einige Meter unter uns zwischen steilen Uferwänden standen die Kajanmänner im Wasser, bewaffnet mit grossen Fischhaken, die so lose an langen Stöcken befestigt waren, dass sie [191] beim Zurückziehen im Fischkörper haften blieben. Da der Haken ausserdem an eine Schnur gebunden war, konnte der Fischer die erfasste Beute bequem heranholen. Bei meiner Ankunft hatten die Leute bereits viele Fische gefangen; zwar waren die Tiere diesmal nicht, wie es früher vorgekommen sein soll, in solch gedrängter Masse erschienen, dass ihre Rücken an der Wasseroberfläche sichtbar wurden, vielmehr musste man sie aus Uferhöhlen und unter Baumstämmen, die im Bache umherlagen, hervorstöbern, doch gelang es, eine grosse Anzahl aus diesen Schlupfwinkeln aufzuscheuchen.
Es ging sehr lebhaft beim Fischen her. Der Fang eines besonders schönen Exemplars erfüllte jeden mit Genugtuung und, wenn ein aufgejagter Fisch mit kräftigen Schlägen zwischen den Fischern hindurchschoss, stürzten alle voll Eifer auf ihn zu, da jeder den ersten Speerwurf tun wollte, selbst auf die Gefahr hin, einen Menschen statt des Fisches zu spiessen.
Die Männer beeilten sich, sobald ein Fisch am Haken zappelte, das wütende Tier mit dem schrecklichen Gebiss durch einen kräftigen Schwertschlag hinter dem Kopfe unschädlich zu machen; auf dem Trocknen wurde der Kopf gänzlich vom Rumpf geschieden und dieser ausgeweidet. Wenn die Fische sehr zahlreich erschienen, wagte man sich, aus Furcht gebissen zu werden, nicht ins Wasser. Dass diese Furcht nicht unbegründet war, bewiesen einige grosse Narben an den Beinen der Kajan. Diesmal schienen nur grosse Fische den Samus hinaufgeschwommen zu sein; denn die gefangenen Exemplare waren mindestens 10 kg schwer.
Nach einigen Stunden besassen alle einen genügenden Vorrat an Fischen und, da der Weg noch weit war, begann man an den Rückzug zu denken. Die Knaben hatten bereits die Fische an den Platz vor ausgetragen, wo die Frauen schon seit dem Morgen mit den Vorbereitungen zur Mahlzeit beschäftigt waren; geröstete tapa bildeten nun das Hauptgericht und es schmeckte so gut, dass keiner Lust zum Aufbruch verspürte, was mir, in der Voraussicht auf eine Wiederholung der Expedition vom Morgen, sehr angenehm war.
Unter einem hohen Uferbaum hielten einige mir wohl bekannte Frauen der Ma-Suling Siesta, und ich nahm mir die Freiheit, mich in ihrer Nähe im Schatten des gleichen Baumes niederzulegen; ihr Schlaf schien aber durch meine Anwesenheit gestört zu werden; denn sie begannen zu schwatzen. Eine von ihnen war ihres Gesanges wegen [192] berühmt und liess sich zum Glück nicht lange nötigen, einige Proben ihrer Kunst zum besten zu geben.
Auf dein Rücken liegend, die Hände unter dem Haupte gekreuzt, trug sie, teils rezitierend, teils wirklich singend, einige Stücke vor; in dieser Umgebung klang es sehr lieblich und, wenn es auch kein europäischer Gesang war, machte er doch einen viel besseren Eindruck als der der Javaner oder Malaien. Die Melodieen glichen am meisten den unsrigen. Leider konnte ich die Worte nicht verstehen; sie erweckten die Heiterkeit der Zuhörer und, da ich einige Mal meinen Namen unterscheiden konnte, improvisierte die Sängerin augenscheinlich. Auch diese Idylle nahm ein Ende; das Mahl war eingenommen, die Fische in Körbe gepackt, und so zogen Männer, Frauen und Kinder beutebeladen in langer Reihe auf dem gleichen halsbrecherischen Wege heimwärts. Auch jetzt wieder beschützten reich die Urwaldgeister der Kajan und ich kam mit heilen Gliedmassen, aber mit etwas labilem Gleichgewichte nach Hause.
Was die Fischerei mit der tuba, dem Fischgift, betrifft, so nimmt auch an ihr die ganze Bevölkerung Anteil. Am oberen Kapuas wird nur in den kleineren Nebenflüssen mittelst Gift gefischt, am oberen Mahakam auch im Hauptfluss.
“tuba” ist ein Sammelname für verschiedene Wurzeln und Baumrindenarten, deren narkotisch wirkende Milchsäfte zum Betäuben der Fische benützt werden. Die für die tuba-Fischerei erforderlichen Pflanzen werden teils gebaut, teils aus dem Walde geholt.
Haben die Bewohner eines Kajandorfes beschlossen, einen Fluss mit tuba abzufischen, so wird alles lebendig; denn um eine für alle genügende Menge Fische zu fangen, muss auch jede Familie ihren Teil tuba liefern. Man zieht daher in grossen Scharen zur ladang und sammelt dort die schwarzen, fingerdicken Wurzeln, die man zu Bündeln von 1 Fuss Länge und 2 dm Dicke vereinigt. Binnen weniger Tage, wenn ungefähr 200 Bündel zusammengebracht worden sind, kann der Fischzug in einem Flüsschen beginnen.
So fuhren eines Tages bei Sonnenaufgang viele Männer mit der tuba in Böten an den Platz voraus, wo der Fang stattfinden sollte. Etwas später begaben sich auch die Frauen, Mädchen und Knaben zum Fluss und auch ich nahm in einem der schwankenden Fahrzeuge Platz, in welchem mich einige Männer flussaufwärts ruderten.
Der Schauplatz der Jagd war ein kleines Flüsschen, in dem unser [193] Nachen bald hier bald dort über eine Geröllbank geschoben werden musste.
Das nur 20 m breite Gewässer schlängelte sich, von den Uferbäumen völlig überdacht, zwischen urwaldbedeckten Hügeln hindurch. Nach einstündiger Fahrt, als das Boot nicht weiter konnte, führte uns ein Waldpfad längs dem Ufer weiter hinauf. An einer buchtartig verbreiterten Stelle des Flusses stiessen wir zu den Männern, die damit beschäftigt waren, die tuba durch Klopfen in eine weissliche, faserige Masse mit scharfem, betäubenden Geruch zu verwandeln. Inzwischen hatten sich die übrigen Teilnehmer in malerischen Gruppen auf den Uferfelsen gelagert. Die erfreuliche Aussicht, die Fische auf bequeme Weise überlisten und verspeisen zu können, schien vor allem die Frauen und Mädchen fröhlich zu stimmen. Sie hatten alle Schöpfnetze (hiko̤̱p) mitgenommen, während die Männer, ausser mit ihren gewöhnlichen Waffen, auch mit den gleichen Harpunen wie bei der tapa-Fischerei ausgerüstet waren. Jedem hing ein Rotangkorb über der Schulter; im übrigen waren sie in ihren Bewegungen nicht durch übermässig viele Kleider gehindert: die Männer trugen nur ein kleines Lendentuch, die Frauen nur ein Röckchen.
Nachdem das Klopfen beendet war, begaben sich die Männer mit den gefüllten Körben reihenweise in den Fluss und spülten, den Bach durchquerend, die geklopften tuba-Wurzeln im Wasser aus. Das milchweiss aus der faserigen Masse strömende Wasser färbte den Fluss in seiner ganzen Breite, während der betäubende Geruch des tuba-Giftes sich doppelt stark in der Umgebung fühlbar machte. In dem breiteren und zugleich sehr tiefen Teil des Flussbettes strömte das Wasser nur langsam und das Gift hatte Zeit, sich bis auf den Grund mit der ganzen Wassermasse zu vermengen.
Die Wirkung zeigte sich schon nach wenigen Minuten bei den kleinen Fischen, die nach oben kamen, aus dem Wasser zu springen suchten und gleich darauf ihren weissen Bauch statt ihres oft prächtig metallglänzenden Rückens sehen liessen. Dies war für alle ein Zeichen, sich mit Schöpfnetzen und Harpunen in Bewegung zu setzen; man verteilte sich im Fluss, die Jugend längs dem Ufer, die Älteren in der Mitte. Doch nach kurzer Zeit war von der anfänglichen Ordnung nichts mehr zu merken. Die allerdings etwas betäubten, aber durchaus nicht bewegungslosen Fische konnten nur mit viel Gewandtheit gefangen werden und so musste man sich bald ihnen vorsichtig [194] nähern, bald ihnen nachtauchen oder über Flussgeschiebe nachsetzen.
Alles lief, fiel und tauchte durcheinander; hier holte einer ein schönes Exemplar mühelos zwischen Flussgestein hervor, dort sahen drei andere etwas Weisses sich im Wasser bewegen und warfen sich von allen Seiten auf die erschreckte Beute, die gerade noch Zeit hatte, unterzutauchen und durch eine rasche Wendung den dreien zu entschlüpfen, um etwas weiter unten in das Netz eines ruhigeren Fischers zu geraten, der sich das Tier bedächtig zutreiben liess.
Anfangs kamen nur wenig grössere Fische nach oben; entweder waren sie nur in geringer Zahl vorhanden oder sie widerstanden besser der Wirkung des Giftes und entschlüpften den zahlreichen Verfolgern.
Langsam zog das vergiftete Wasser abwärts und gleichzeitig mit ihm die fröhliche Schar, der auch ich mich angeschlossen hatte. Ans Fischen konnte ich jedoch nicht denken; denn bekleidet und beschuht durch einen Bergstrom zu waten ist ohnehin schon eine schwierige Aufgabe; zudem wurde der Fluss hie und da so tief, dass ich bis zur Brust einsank und mich auf dem schlüpfrigen Geröll nur mit Mühe aufrecht hielt. Zum Glück strömte das vergiftete Wasser, aufgehalten durch die vielen Steinblöcke, nur langsam weiter und man hatte Zeit, ihm zu folgen. 1½ Stunden lang gingen wir so weiter, geleitet vom tuba-Geruch, den wir bis zuletzt wahrnahmen. Ober- und unterhalb des vergifteten Wasserstreifens verschwand der lästige Reiz in der Nase, der übrigens keinem gefährlich zu sein schien. Endlich wurde das Wasser zu tief, um darin waten zu können, und ich schwang mich in ein am Ufer liegendes Boot und liess mich abwärts treiben.
Das Schauspiel gewann immer mehr an Lebhaftigkeit, denn jetzt kamen die grossen Fische zum Vorschein, deren Fang bisweilen viele Schwierigkeiten bereitete. Mit erstaunlicher Schnelligkeit und Sicherheit tauchten die Männer den Tieren nach, trafen sie im klaren Wasser mit dein Speer und brachten die Beute im Triumph nach oben.
Die Frauen und Mädchen gaben übrigens dem stärkeren Geschlechte an Geschicklichkeit nichts nach und tauchten mit dem gleichen Erfolge auch unter den Böten durch, um ihre Schlachtopfer zu erjagen.
Nicht leicht werde ich das liebliche Bild vergessen, das mir ein Kajanmädchen bot, als es plötzlich neben meinem Nachen aus dem Wasser auftauchte. Ich hatte die Kleine nicht verschwinden sehen und erblickte nun unversehens ihr liebes Gesichtchen mit den freudestrahlenden Augen, umgeben vom lang herabhängenden, schwarzen Haar, [195] das ihr wie ein triefender Mantel über dem Rücken hing und das helle Braun der wohlgeformten Schultern und des Busens um so schöner hervortreten liess. Nicht ohne Koketterie erhob sich das Mädchen halb aus dem Wasser und eilte darauf mit dem erbeuteten Fisch dem Ufer zu.
An der Einmündung in den Hauptfluss schien sich das langsam herbeiströmende Wasser zu stauen; wenigstens kamen eine Menge grosser Fische betäubt an die Oberfläche und gaben den Männern mit ihren Harpunen genug zu tun. Auf einer verhältnismässig kleinen Fläche mehrere Meter tiefen Wassers schwammen und tauchten alle durcheinander und warfen in ihrer Verfolgungswut die Harpunen mit solcher Schnelligkeit, dass nur wie durch ein Wunder keine Verwundungen vorkamen. An diesem letzten gefährlichen und anstrengenden Spiel beteiligten sich die Frauen nicht mehr, sie suchten befriedigt vom Erfolg des Tages die Böte auf und legten sich triefend und ermüdet, aber doch fröhlicher Stimmung, neben ihren Fischen nieder.
Während des ganzen Fischzugs hatte ich mich an der allgemeinen Heiterkeit und Einigkeit erfreut; durch keinen einzigen Misston war die Harmonie unterbrochen worden. In dieser günstigen Gemütsverfassung zeigten sie mir auf Wunsch des Häuptlings ihre Schätze, so dass ich bald 30 verschiedene Fischarten für die zoologische Sammlung beieinander hatte. Die Exemplare waren zwar meist klein, aber bei keiner Gelegenheit so bequem zu erlangen als bei dieser.
Dass ein Flüsschen durch eine derartige tuba-Fischerei gänzlich ausgefischt wird, kann man sich vorstellen; die jüngsten Fischchen leiden am meisten unter dem Gift und es dauert daher lange, bis sich der Fischstand wieder erholt. Darum bekümmerten sich die Dajak jedoch nicht, sondern fuhren allgemein befriedigt den Fluss hinab. Zu Hause angekommen kleidete ich mich schnell um und vergass bald, dass ich einen halben Tag in triefenden Kleidern gesteckt hatte.
Sind die abzufischenden Flüsse grösser und tiefer, so schliesst man ihre Mündung mit einem hohen Bambusgitter, dessen Stäbe eng beieinander stehen, ab, um die grossen, nur halb betäubten Fische aufzuhalten. Dann spielt sich die Jagd wegen der Gefahr, durch Fische oder zufällig aufgejagte Krokodile verwundet zu werden, in Böten ab. Zum Schluss sammeln sich alle Fischer vor dem Gitter, das hinten mit Bambuskörben und Netzen versehen ist, um die Fische, welche hinüberzuspringen versuchen, aufzufangen. Bei dieser Gelegenheit sah [196] ich einzelne Fische unglaublich hoch springen. Exemplare von etwa 1 Fuss Länge und auch einige grosse Arten schnellten plötzlich zwischen den Böten empor und verschwanden hinter der mehr als 2 m hohen Bambuswand. Die weniger guten Springer fielen in die Körbe und Netze.
Die Jagd spielt bei den Bahau am Mendalam nur eine nebensächliche Rolle: begeben sich die Männer aufs Reisfeld oder in den Wald, so werden die Hunde stets mitgenommen und zeigt sich Wild, so wird darauf Jagd gemacht.
Aus dem Begriff “Wild” schliessen die Bahau alle Tiere aus, die sie nicht essen dürfen, wie Horntiere, graue Affen und Schlangen. Als Wildpret kommen daher hauptsächlich Wildschweine, verschiedene Wildkatzen, kleinere Säugetiere und hühnerartige Vögel in Betracht. Besonders erstere sind als Wild sehr beliebt, auf meiner ersten Reise waren sie aber noch selten; eine heftige Epidemie in den Jahren 1888 und 1889 hatte nicht nur die wilden, sondern auch die zahmen Schweine in Mittel-Borneo fast ausgerottet.
Eine wichtige Rolle spielen bei der Jagd die Hunde, die sich trefflich zum Aufspüren und Stellen des Wildes eignen. Sie wagen sich aber nur an kleinere Tiere heran, da sie nicht über 1 Fuss hoch werden; grössere Schweine bellen sie nur aus einiger Entfernung an oder sie bemächtigen sich ihrer Jungen.
In allen Gegenden, die ich besuchte, fand ich bei den Dajak die gleiche Hunderasse: kurzhaarige, schlank aber kräftig gebaute Tiere mit aufrecht stehenden Ohren und langem, spitzen Kopf. Die männlichen Tiere, besonders die guten Jagdhunde, werden häufig kastriert, um sie anhänglicher an den Herrn und gleichgültiger gegen die Weibchen werden zu lassen. Die Bahau bilden sich ein, dass die Kastration dem Fortpflanzungsvermögen nicht schade, doch ist die Hunderasse bei ihnen durch dieselbe stark zurückgegangen. Von den Punan, die ihre Jagdhunde nicht kastrieren, beziehen die Häuptlinge der sesshaften Stämme ihre guten Exemplare. Eigentümlicher Weise bestimmen die Bahau auch bei den männlichen Tieren hauptsächlich nach der Zahl und Entwicklung der Zitzen, ob es gute Jagdhunde sind oder nicht. Vor allem wird ihr Mut hiernach beurteilt.
Bei Stämmen, wie die Pnihing, die sich für die Jagd interessieren und daher nicht, wie es meist geschieht, die Hunde selbst für ihren [197] Unterhalt sorgen lassen, besitzen die Häuptlinge schöne, kräftige Hunde.
Überall im Innern haben die Hunde die Eigenschaft, wenig, Fremden gegenüber überhaupt nicht, zu bellen. Begegnen sie letzteren, so ergreifen sie entweder mit eingezogenem Schwanz die Flucht oder sie beachten sie gar nicht. Auf der Jagd stossen sie ein kurzes Kläffen aus, für gewöhnlich aber machen sie sich durch ein höchst unangenehmes Heulen bemerklich, in welches, wenn einer den Anfang gemacht hat, alle übrigen im grossen Dajakhause einstimmen. Aus der Ferne erinnert ein derartiges Konzert an das Lärmen einer Menschenmenge. Auf die gleiche Weise heulten die einheimischen Hunde auf der Insel Lombok, was in der ersten Nacht auf dem Kriegsschauplatze einen unheimlichen Eindruck machte. Bei den Dajak wurde man durch das Heulen nur im Schlaf gestört und zwar hauptsächlich in mondhellen Nächten, die auf das Hundegemüt eine besondere Wirkung auszuüben schienen.
Nur wenige Häuptlinge, besonders eifrige Jäger, behandeln ihre Hunde gut, füttern sie reichlich und halten sie nicht, wie die übrigen Bahau, für gänzlich gefühllos. Für gewöhnlich sind die Hunde infolge schlechter Behandlung mager, sehr scheu und für Freundlichkeiten unempfindlich. Doch hängen auch bei den Dajak Herr und Hund auf ihre Weise aneinander und sobald ein Hund auf einem Zug mit darf, giebt er seine Zufriedenheit durch Springen und Heulen deutlich zu erkennen.
Die Kajan bedienen sich bei der Jagd keiner besonderen Waffen; sie gebrauchen Schwert und Speer, die sie stets bei sich tragen; nur gegen Vögel und kleine Säugetiere verwenden sie das Blasrohr mit vergifteten Pfeilen. Mit diesen schienen die Jäger, so viel ich beobachtete, nur schlecht umgehen zu können; sie trafen selbst in kleinen Abständen nur selten. Wie an einem anderen Ort bereits gesagt ist (pag. 154), handhaben nur wenige Leute das Blasrohr wirklich gewandt; es sind dies mit Kajanfrauen verheiratete Punan und Bukat, die ihrer Gewohnheit, in Wäldern herumzuschwärmen, getreu bleiben. Diese verbringen die meiste Zeit auf der Jagd statt auf dem Reisfeld und unterhalten auch ihre Familien mit dem, was die Jagd ihnen liefert. Besonders geschätzt sind die Hörner der Hirsche, die als Material zu Schnitzarbeiten dienen; die Gallenblase (o̤̱mpe̥du) und Klauen der Bären, welche die Chinesen zur Bereitung von Arzneimitteln verwenden, die Zähne des borneoschen Panthers, aus denen Ohrschmuck für Männer und sein Fell, aus dem Kriegsmäntel hergestellt werden; einen [198] wichtigen Artikel bilden auch die Bezoare, die runden oder ovalen Steine aus dem Darm oder der Leber der genannten Tiere, sowie der Affen, Stachelschweine und Schlangen, die unter dem Namen gliga oder guliga einen hohen Wert besitzen und vor allem an chinesische Apotheken verkauft werden.
Zum Erlegen der Tiere wird meistens der Speer gebraucht; nur selten findet man bei den Mendalam Kajan Gewehre und noch seltener das notwendige Pulver. Da die Gewehre in der Regel von schlechter Beschaffenheit sind und recht häufig Unglück mit ihnen angestiftet wird, schiessen die Dajak meist mit abgewandtem Gesicht, was nicht gerade zur Erhöhung der Treffsicherheit dient.
Im Fangen der Vögel mittelst Schlingen zeigen sich die Kajan auffallend ungeschickt und das Stellen von Fallen, mit denen andere Stämme grössere Tiere erbeuten, scheint ihnen gänzlich unbekannt zu sein.
Während meines ersten Besuches am Mendalam wünschte ich, in den Besitz einiger Argusfasanen zu gelangen, deren schöner Ruf mir öfters aus dem Walde entgegenklang, die ihrer Scheuheit wegen jedoch beinahe nur mit Schlingen zu fangen sind. Nur wenige Kajan waren zu dieser Jagd geneigt und in den ersten Wochen hatte keiner Erfolg. Erst als ich sehr hohe Preise aussetzte, 10 Dollar für ein Männchen, 5 für ein Weibchen, begab sich der Schwiegersohn des Häuptlings mit zwei Leibeigenen, Söhnen von Punan, für einige Tage in den Wald. Mit dem Blut schienen diese auch die Geschicklichkeit ihrer Väter geerbt zu haben, denn nach 3 Tagen brachten sie mir einige prachtvolle Exemplare zurück; nur sie waren auch im stande, mir die verschiedenen Sorten von Pfeilgift mit den verschiedenen Pflanzenarten, aus denen es gewonnen wird, aus dem Walde zu holen.
Bei meinem zweiten Besuch 1896 waren diese beiden Jäger auf weiten Reisen und von einer ferneren Sammlung von Pfeilgiften oder Argusfasanen war keine Rede mehr.
Zu den gewöhnlichen Haustieren der Bahau und Kĕnja gehören Schweine, Hühner, Hunde und Katzen; Pferde, Kühe, Ziegen und Schafe besitzen sie nicht. Nur seit kurzer Zeit kommen bei einigen Stämmen einzelne eingeführte Ziegen und Schafe vor, sie werden aber von den Bahau, wie alle anderen wilden und zahmen Horntiere, noch nicht gegessen. Bei den Kĕnjastämmen essen nur die Priester keine Horntiere. [199]
Die Schweine bilden in Mittel-Borneo eine einheitliche Rasse und stammen wahrscheinlich von den einheimischen wilden Schweinen ab oder sind doch wenigstens stark mit diesen vermischt; da die Schweine ständig frei um das Haus herumlaufen und bisweilen tief in den Wald eindringen, ist eine Vermischung mit wilden Schweinen durchaus nicht ausgeschlossen. Die Bahau behaupten auch, dass eine Vermischung wirklich stattfindet. Die jungen Schweine sind braun und schwarz gestreift wie die wilden Schweine; die älteren Tiere sind meist weiss, bisweilen auch schwarz.
Die Bahau füttern ihre Schweine so lange gut, als ihre eigenen Nahrungsmittel es zulassen. Sie werden des Morgens früh, hauptsächlich aber gegen 4 Uhr nachmittags, nach dem Reisstampfen, gefüttert, da die Reisspelzen mit Wasser vermengt das Hauptnahrungsmittel für die Tiere bilden. Ausserdem werden auch unreife Früchte, besonders Papaya, in Wasser gekocht, als Futter verwendet. Einige wohlhabende Familien halten sich bisweilen ein Schwein, das stets frei auf der Galerie des Hauses umherläuft und ausschliesslich mit Reis-, Früchte- und Gemüseabfällen genährt wird. Diese Tiere werden oft sehr dick, einige Exemplare wogen sicher 150 kg. Die unter dem Hause frei herumlaufenden Schweine erreichen niemals diese Grösse und dieses Gewicht.
Die Hühner Mittel-Borneos gehören zu einer Rasse, die sich in nichts von denjenigen der Malaien unterscheidet. Auch die Kampfhähne gehören dieser Hühnerrasse an. Tagsüber laufen die Tiere in und unter dem Hause frei umher und einzelne werden im Walde ein Opfer der Raubtiere. Um die Küchlein zu beschützen, werden sie jeden Abend eingefangen und mit der Henne in einem Korbe oben an die Galerie des Hauses gehängt. Die älteren Hühner schlafen auf dem Dache, auf den Fruchtbäumen oder an anderen hohen, sicheren Stellen. Die Eier werden als gelegentliche Opfergaben oft monatelang bewahrt. Nur ab und zu werden frische Eier von Erwachsenen gegessen; man giebt sie vor allem Kindern. [200]
Kapitel X.
Von Putus Sibau nach Siut—Besuch bei den Taman Dajak—Verlust eines Hundes durch ein Krokodil—Nachtlager auf der Geröllbank Liu Tangkilu—Kampf gegen die Strömung—Aufenthalt wegen des telandjang—Umschlagen eines malaiischen Handelsbootes—Ausflug auf einen Berg—Eigentümliche Lianen—Fortsetzung der Fahrt bis zur Gung-Mündung—Aufenthalt wegen schlechter Vorzeichen—Passieren der “Gurung Dĕlapan”—Nachtlager an der Bungan Mündung—Bier und Obet Lata fallen in den Fluss—Begegnung mit unserer ersten Gesandtschaft—Ankunft an der Bulit-Mündung—Aufschlagen der Lagers—Nächtlicher Überfall durch Hochwasser—Akam Igaus Reiseplan—Begegnung mit Bungan Dajak—Aufbruch zum pangkalan Howong—Kalkberge am Bulit.
Hat man die Mendalambewohner nach langdauernden Unterhandlungen endlich dazu gebracht, sich an einer Expedition zu beteiligen, so fassen sie ihre Verpflichtungen dafür wirklich ernst auf. Auch jetzt wieder hatten sie, sorgsamer Weise, die Bootsränder durch zwei Reihen übereinander gelegter Planken erhöht und die Ritzen mit geklopftem Baumbast verstopft; diesen auch noch, nach malaiischer Art, mit Harz zu durchtränken (dumpul) halten die Kajan aber für überflüssig; daher dringt stets etwas Wasser ins Boot und muss von Zeit zu Zeit ausgeschöpft werden. Um uns 4 Europäer, den Jäger Doris und unser Hab und Gut vor Sonne und Regen zu schützen, hatten sie mitten im Boot ein Palmblattdach von 1 m Höhe errichtet, das wenige Tage später, als wir unter dem dichten Ufergebüsch nicht hindurch fahren konnten, leider wieder fortgenommen werden musste.
Die Böte waren, je nach ihrer Länge, mit 4–6 Mann besetzt; unser grösstes Boot hatte eine Länge von 14 m und eine Breite von 80 cm, die übrigen waren, um besser zwischen den Geröllbänken lenken zu können, kleiner. Vorn und hinten im Boot sass ein Steuermann, die anderen nahmen als Ruderer Platz. Malaien und Bahau benützen im Oberlauf der Flüsse stets 1.60–1.70 m lange Ruder (be̥se̱), welche bis auf ⅓ der Länge aus einem breiten Brett von hartem Holz bestehen. Alle hatten ihre eigenen, neuen Ruder mitgebracht und waren auch sonst mit allem versehen, was sie auf einer Reise über Wasser und [201] durch Urwald nötig haben konnten. Vor allem hatten sie für ihre Waffenrüstung, bestehend in Schwert, Blasrohr, Schild, Kriegsjacke und Kriegsmütze gesorgt; als Unterlage zum Schlafen und als Dachbedeckung hatten sie einen genügenden Vorrat Palmblattmatten (samit) mitgenommen. Die Reisegarderobe war bei allen sehr schlicht und bestand nur aus 2 oder 3 einfachen Lendentüchern und einem besonders schönen Lendentuch und Jäckchen, die für die Ankunft bei ihren Freunden am Mahakam bestimmt waren. Zu meiner grossen Zufriedenheit hatten sie genügend viel Gerätschaften, wie Beile, Hobel und Meissel mit sich genommen, um die Böte ausbessern, nötigenfalls im Wald gänzlich neue herstellen zu können. Alle diese Dinge waren in einem aus gespaltenem Rotang geflochtenen Tragsacke (bruit) verpackt und von jedem Manne in die Mitte des Bootes zu seinem übrigen Gepäck gelegt worden. Hierdurch war aber der kleine Raum in der Mitte so angefüllt, dass für unsere eigenen Güter und Personen nicht viel Platz übrig blieb und die 25 Böte kaum alles bergen konnten.
Der Platzmangel hatte noch eine andere Ursache: wie gewöhnlich hatten die Ruderer auch diesmal vor der Abreise einen grossen Vorschuss von ihrem Lohn (½ Dollar pro Tag) empfangen und ihn teilweise dazu verwendet, ihren zurückbleibenden Familien allerhand notwendige Dinge zu kaufen; grösstenteils hatten sie aber für das Geld Tauschartikel eingehandelt, um sich für diese am Mahakam Schwerter, Matten und alte Perlen, die dort besser als am Kapuas zu erhalten waren, anzuschaffen. In Anbetracht, dass ich das schwere Silbergeld dann nicht mitzuführen brauchte, um es erst am Mahakam auszubezahlen, hatte ich den Leuten gern den Vorschuss bewilligt; malaiische und chinesische Händler in Putus Sibau erzählten mir jedoch bald, dass der Lohn in der viel umfangreicheren Form von Kattun, Glasperlen und selbst Salz mitgeführt werden sollte. Wohl wissend, dass hieran nichts zu ändern war, weil mein Geleite hierüber seine eigene Auffassung besass, dass es ferner durch Handeln am Mahakam noch einen besonderen Vorteil aus unserer Reise ziehen konnte, widersetzte ich mich nicht gegen das Einladen der bisweilen verräterisch dickbäuchigen Tragsäcke. Ich wusste aus Erfahrung, wie sehr das eigene Interesse am Gelingen der Expedition meine Kajan allen Schwierigkeiten gegenüber stählte.
Ich war froh, endlich unterwegs zu sein; denn das trockene Wetter hatte mit einer für Borneo seltenen Standhaftigkeit bereits 3 Monate [202] angehalten; die Regenzeit nahte, in den letzten Tagen war bereits eine starke atmosphärische Veränderung eingetreten. Die bis dahin klare, blaue Luft, in der sich nur oberhalb des fernen Gebirges eine weisse Wolkenschicht abhob, wurde täglich grauer und bewölkter, so dass die Regenperiode jeden Augenblick eintreten konnte.
So blickte ich denn bei unserer Abreise voll guter Hoffnung und Selbstbefriedigung auf die mit vieler Mühe zu Stande gebrachte Flotte zurück. In langer Reihe fuhren die Böte dicht am Ufer entlang, um so wenig als möglich durch die Strömung aufgehalten zu werden; aus dem gleichen Grunde suchten wir auch stets die Innenseite der Buchten auf und mussten daher während einer Tagreise den Fluss öfters durchqueren.
Der erste Tag bot keine Schwierigkeiten, weil das Wasser besonders niedrig war; wir konnten sogar Siut erreichen, was uns 1894 und 1896 nicht geglückt war.
Oberhalb Putus Sibau ist der Kapuas nur für Fahrzeuge der Dajak, hāro̱k oder bung genannt, und leichte malaiische Handelsböte schiffbar. Zwar ist stets genügend Wasser im Fluss vorhanden, aber sein in der Mitte oder an den Ufern befindliches Geschiebe verengt ihn bisweilen so stark, dass er bereits bei niedrigem Wasserstande Stromschnellen bildet und bei Hochwasser selbst für Fahrzeuge der Eingeborenen schwer passierbar ist. Vor dem verlassenen Nanga Era trifft man jedoch noch keine Felsen im Fluss oder bergige Ufer; diese bestehen hier noch aus den alluvialen Ablagerungen des Flusses selbst, in die er sich stets von neuem sein Bett gräbt.
Wegen des tiefen Wasserstandes, den wir jetzt hatten, fuhren wir 4–5 m unterhalb des Uferniveaus. Zu beiden Seiten erhoben sich steile, vom Flusse ständig unterspülte Wände. Der Anschnitt zeigte eine Humusschicht von wechselnder Mächtigkeit und darunter eine 3 m dicke Schicht von gelbbraunem Sande, vermengt mit pflanzlichen Überresten, bestehend aus grossen Mengen angehäufter Blätter und Zweige oder aus übereinander geworfenen Baumstämmen. Unter der Sandschicht kam altes Flussgeschiebe zum Vorschein, welches ebenfalls, aber in geringerem Masse, Pflanzenreste enthielt; diese sahen bisweilen der Braunkohle ähnlich. Die oberste Humuslage war nur einige Dezimeter dick, was sich wohl daraus erklären liess, dass die Ufer des Kapuas in dieser Gegend längst des Urwaldes beraubt waren und bereits öfters als trockene Reisfelder gedient hatten. Daher findet [203] man einen dichten Waldbestand auch nur da, wo ihn die Taman Dajak als Begräbnisstätte benützen. Auch an Orten, die durch die Überlieferung geheiligt sind, wird der Wald geschont.
Die Begräbnisplätze der Taman machen auf den Vorüberfahrenden eher einen heiteren als einen finsteren Eindruck: die auf Pfählen stehenden, mit schönen, bunten Zeichnungen verzierten Grabmäler mit ihren zahlreichen Wimpeln aus rotem und weissem Kattun beleben den dunkelgrünen Waldesrand. In der Nähe betrachtet wirken die älteren, verfallenen Grabmäler mit dem wegen der Raubsucht der Malaien halb vernichteten Hausrat: irdenen Töpfen, Gongen, Rudern, Kleidungsstücken u.s.w., welche den Toten ins Jenseits mitgegeben werden, allerdings unheimlich düster.
Die Häuser der Taman werden nicht, wie die vieler anderer Stämme, alle paar Jahre von ihren Bewohnern verlassen; sie sind daher auch von zahlreichen alten Fruchtbäumen: Kokospalmen, Duku, Durian, Rambutan und Blimbing umgeben, die als dunkelgrüne Wäldchen aus Reisfeldern und Gestrüpp hervorragen. In einiger Entfernung vom Hause bepflanzen die Taman ganze Felder mit Bananen; die anderen Fruchtbäume würden dort zu viel von Affen, Eichhörnchen und Vögeln zu leiden haben.
Da unser Zug zum Mahakam bereits monatelang am oberen Kapuas besprochen worden war, strömte bei unserer Ankunft die ganze Bevölkerung von Siut herbei und forderte uns auf, in ihren Häusern zu übernachten.
Der Kontrolleur Barth und ich zogen es vor, unser Nachtquartier im neueren Hause am rechten Ufer aufzuschlagen, während Demmeni und Bier in ihren Böten übernachten wollten. Sie liessen diese mit dem Vorderteil auf eine Geröllbank ziehen und zwar mit dem Resultat, dass, als das Wasser nachts noch weiter fiel, der hintere Teil des Bootes unter Wasser geriet und Bier, bei Tagesanbruch, halb im Wasser liegend erwachte. Das Kajangeleite schlief in den Häusern der Taman, hatte aber in jedem Boot einen Wächter zurückgelassen.
Die Taman waren erfreut über unsere Ankunft und sahen es, wie immer, als Ehre an, uns für eine Nacht als ihre Gäste aufnehmen zu können. Wie auf der vorigen Reise, wurde ich auch jetzt von Leuten, die um Arzneien baten, überlaufen; hie und da kam auch jemand, in der Hoffnung auf besseren Erfolg, mit etwas Reis oder Früchten an. Zu meiner Freude bemerkte ich auch einen meiner früheren [204] Patienten, den ich bereits 1894 behandelt hatte. Man hatte ihn mir damals nach Tandjong Narang gebracht, weil er sich durch einen Fall eine scharfe, hölzerne Pfahlspitze in die Seite, 20 cm weit unter die Haut, getrieben hatte. Mit Hilfe einiger Schnitte und einer Zange gelang es mir, das Holzstück zu entfernen. Die Blutung war nicht heftig, grosse Gefässe waren also nicht verletzt und die Pleurahöhle nicht erreicht; bei der grossen Widerstandsfähigkeit der Dajak sah der Fall also nicht so schlimm aus. Obgleich auch das Fieber abnahm, entwickelte sich doch, einige Tage vor meiner Abreise, eine schwere Pleuritis. Von einer gründlichen Behandlung konnte keine Rede mehr sein und so überliess ich den Kranken, nach Erteilung einiger Vorschriften wegen der Behandlung der Wunde und sonstigen Verpflegung, den Seinen und der Natur. Glücklicher Weise gelang es beiden, die Krankheit zu überwinden. Als ich den Patienten jedoch 1896 wiedersah, litt er so hochgradig unter ständigen Malariaanfällen, dass seine Milz durch die Bauchwand hindurch als dicke Geschwulst fühlbar war. Ich hinterliess ihm daher eine grosse Dosis Chinin mit ausführlicher Gebrauchsanweisung. Mit grossem Eifer musste er den Vorschriften gefolgt sein, denn er kam mir jetzt als kräftiger Mann entgegen und brachte mir als Zeichen seiner Dankbarkeit einige Früchte, allerdings mit der Bitte um eine weitere Dosis Chinin. Bei einer Untersuchung ergab es sich, dass die pleurae an der verwundeten Seite noch verwachsen waren, von einer Hypertrophie der Milz oder Leber war aber nicht mehr viel zu merken.
Allmählich strömten so viele Männer und Frauen herbei, die alle um Heilmittel baten, dass mein Junge mich durch die Ankündigung, dass das Essen bereit sei, aus grosser Verlegenheit rettete. Der Beginn einer Mahlzeit macht nämlich auf alle Dajak grossen Eindruck, sie wagen es daher nur sehr selten, einen beim Essen zu stören, dagegen kommen sie nie auf den Gedanken, dass einem auch beim Ankleiden und Zubettegehn ein allzu grosses Interesse der Umgebung unliebsam sein könnte.
Nach dem Essen stellte es sich heraus, dass der Tag nicht ganz ohne Unfall verlaufen war; denn der Jäger Doris kam mit der Meldung, dass einer unserer Hunde während der Fahrt von einem Krokodil aufgefressen worden war. Doris, der mit einigen anderen Halbblutfreunden in Batavia für die Wildschweinjagd eine grosse Koppel Hunde hielt, hatte zwei der besten Exemplare mitgenommen; es waren [205] kleine, kurzhaarige Tiere mit spitzem Kopf und spitzen, aufrechtstehenden Ohren, die für Treibjagden sehr geeignet zu, sein schienen. Doris hatte die Hunde, weil sie an das Fahren in Böten nicht gewöhnt waren, längs dem Ufer laufen lassen. Da wir aber der Strömungen wegen öfters die Ufer wechseln mussten und Doris den Dajak ausserdem zeigen wollte, dass seine Hunde ebensogut schwimmen konnten als die ihrigen, hatte er sie mehrmals den Fluss durchqueren lassen. Bei dieser Gelegenheit kam neben einem der Hunde plötzlich der Kopf eines Krokodils zum Vorschein, der sich dem erschreckten und bellenden Tiere bedächtig näherte und es unter Wasser zog, bevor man den frechen Räuber durch einen Gewehrschuss verjagen konnte.
Um meinen Vorrat an Arzneien, der tatsächlich für die Mahakambewohner bestimmt war, nicht zu sehr anzugreifen und um den niederen Wasserstand noch auszunützen, fuhren wir gleich nach Sonnenaufgang weiter; wir frühstückten auf einer Geröllbank in der Nähe von Lunsa, machten jedoch weder bei dieser Niederlassung noch bei Lunsa Ra, einem kleinen Pnihinghause, dem letzten am oberen Kapuas, Halt. Auch diese Dörfer waren bereits aus der Ferne an ihren Bananenanpflanzungen erkennbar. Auf unserem Zuge 1894 hatte ich in einem Punanhause an der Mündung des Era übernachtet, jetzt war von dem ganzen Gebäude nichts als ein einziger aufrechtstehender Pfahl bemerkbar. Bis auf 50 m Abstand vom Ufer hatten Bäume und Sträucher den ganzen Platz, auf dem das Haus gestanden, eingenommen und waren dabei so von Lianen überwuchert worden, dass man sich nur mit Hilfe eines Beiles einen Durchgang hätte verschaffen können.
Im Laufe des Tages fuhren wir an einer Reihe kleiner Inseln, waldbedeckten Geröllbänken, vorüber, die hie und da das Flussbett sehr verengten, bei diesem niedrigen Wasserstande jedoch keine Schwierigkeiten verursachten. Wir erreichten noch am selben Tage Liu (= Insel) Tangkilu, eine am linken Ufer des Kapuas in einer Bucht gelegene Geröllbank, die unseren zahlreichen Böten einen vorzüglichen Schlupfwinkel für die Nacht lieferte. Hier fanden wir noch Spuren der kleinen Reisfelder der Punan aus dem verlassenen Hause von Nanga Era und befanden uns somit an der Grenze des sogenannten Punangebietes, wo feste Niederlassungen nicht mehr vorkommen und wo nur die nomadisierenden Stämme der Punan und Bukat die ständigen Bewohner der Urwälder bilden. [206]
Der ganze Charakter der Gegend verkündete den Anfang eines neuen Gebietes. Mächtige Waldriesen zu beiden Uferseiten breiteten ihre Äste so weit über den 50–60 m breiten Fluss aus, dass sie einander berühren zu wollen schienen.
Hart am Uferrand wuchsen Bäume, die in ihren hohen, breiten Bretterwurzeln genügende Stütze fanden, um ihre meterdicken Stämme und schweren Kronen in horizontaler Richtung über den Fluss beugen zu können. Bei Hochwasser sind die Stämme oft auf eine Länge von ungefähr zehn Metern überschwemmt und auch jetzt konnten wir nur mit Mühe unter ihnen hindurch fahren. Auffallender Weise kommt in den Urwäldern von Mittel-Borneo längs den Flussufern stets nur diese eine Art von Bäumen vor, während man in einiger Entfernung vom Ufer überhaupt mir selten zwei oder drei Exemplare der gleichen Spezies beieinander stehend findet. Die Früchte dieser Bäume sind essbar, werden aber nie gross, so dass nur Kinder sich bemühen, den Fischen die Ernte streitig zu machen. Infolge ihres eigentümlichen Wuchses und der Steilheit der Ufer des Kapuas, zog sich das grüne Dach dieser Urwaldbäume vom Wasserspiegel an in breiten, welligen Falten bis Hunderte von Metern an den Wänden der Kluft hinauf.
Ergriffen von dem grossartigen und geheimnisvollen Charakter unserer Umgebung nahmen wir in feierlicherer Stimmung als gewöhnlich unser Mahl ein und begaben uns früh zur Ruhe. Wir hatten hoch oben auf der Bank Zelte und in diesen unsere Klambu aufschlagen lassen, nur Bier bestand, trotz seines Unfalles in der vergangenen Nacht, darauf, wieder in seinem Boot zu schlafen. Nachts fiel aber ein kurzer, heftiger Regen, der seine Lagerstätte, diesmal von oben, vollständig durchnässte. Als aber morgens die Sonne wieder schien und der Wasserstand sich noch als günstig erwies, zogen wir in heiterer Stimmung in das unbewohnte Gebiet hinein. Weiter oberhalb musste aber doch viel Regen gefallen sein, denn im Laufe des Morgens stieg das Wasser, was uns das Passieren verengter Stellen und überhängender Bäume sehr erschwerte. Als an einer Stelle ein quer im Fluss halb unter Wasser liegender Baumstamm umfahren werden musste, schien das grosse Boot von Tigang Aging, in dem sich der Kontrolleur befand, der Mannschaft zu schwer zu werden; denn die besonders bei steigendem Wasserstande heftige Strömung drohte das Boot, sobald sich sein vorderer Teil um das Ende des Baumes dem Ufer zuwandte, der Länge nach an den Stamm zu drücken, wodurch [207] das von unten reissende Wasser das Boot zweifellos erst in schiefe Stellung und dann zum Umschlagen gebracht hätte. In der Mitte des Flusses wiederum konnte gegen die starke Strömung überhaupt nicht gefahren werden. Zwei Männern, die erst auf den Baumstamm und dann in das Wasser gesprungen waren, gelang es endlich, die Spitze des Bootes so lange gegen die Strömung zu halten, bis die übrigen Leute mit ihren Stangen am Ufer eine Stütze gefunden hatten.
Wir kamen aber doch noch ein gutes Stück vorwärts, wohl mit Hilfe des te̥lăndjăng, des wahrsagenden Vogels, der sich günstiger Weise am rechten Ufer hören liess. Es war für die Kajan eine grosse Beruhigung, dass nun auch der te̥lăndjăng seine Zustimmung zum Unternehmen gab; sie hatten ja vor unserer Abreise an der Mündung des Mendalam vergeblich auf ihn gewartet. Uns kostete diese Seelenberuhigung unseres Gefolges jedoch zwei Nächte Aufenthalt (me̥lo̱ njaho̱), da die Religion den Kajan vorschreibt, an der Stelle, wo sich der Vogel gezeigt hat, das Lager aufzuschlagen. Allein die Überzeugung, dass unsere Leute nur auf diese Weise mit Vertrauen unseren weiteren Zug mitmachen würden, brachte mich dazu, ihrem Aberglauben wiederum zwei kostbare Reisetage zum Opfer zu bringen.
Abends sassen wir still in unserem Waldlager, die einen mit Lektüre, die anderen mit allerhand Kleinigkeiten beschäftigt, als 6 Malaien in einem kleinen Boote flussabwärts gefahren kamen und uns um Hilfe baten. Sie hatten nämlich etwas oberhalb unseres Lagers mit einem grossen Boot voll Handelswaren an einem Felsen, den sie umfahren mussten, Schiffbruch gelitten; die reissende Strömung hatte das Boot gegen einen halb unter Wasser liegenden Stein geworfen und zum Umschlagen gebracht. Die unglücklichen Leute hatten nichts übrig behalten und baten um ein Unterkommen.
In unserer Ruheperiode war es jedoch lāli, mit irgend welchen anderen Menschen in Berührung zu kommen, und die armen Tröpfe kannten das unerbittliche Festhalten der Kajan an ihrer adat zu gut, um überhaupt noch einen Schritt bei mir zu wagen, und zogen mit hungrigem Magen weiter nach Lunsa.
Für die Meinen bildete das Missgeschick der Malaien einen Glücksfall. Da die adat ihnen bei Tageslicht einen kleinen Ausflug gestattete, fuhr Tigang in Gesellschaft einiger Stammesgenossen in einem leeren Boote den Kapuas hinauf, um die Unglücksstätte zu untersuchen, und kam abends mit einem Gong zurück, den sie durch Tauchen aufgefischt hatten. [208]
Nachts fiel das Wasser, daher machten sich am zweiten Tage des me̥lo̱ beinahe alle Kajan auf, um ebenfalls etwas von den verunglückten Habseligkeiten aufzufischen. Vor Einbruch der Dunkelheit mussten alle wieder zurück sein, aber sie hatten ihre Zeit augenscheinlich gut angewandt, denn beinahe jeder brachte ein Beutestück mit. Von den aufgefischten Leckerbissen, die eigentlich für die malaiischen Buschproduktensucher am oberen Kréhau bestimmt waren, genossen die Kajan leider nicht viel, da sie ihnen unbekannt waren.
Der eine verzehrte auf ein Mal eine ganze Büchse Sardinen, so dass ihm übel wurde, der andere leerte eine grosse Flasche mit konzentriertem Himbeerensirup und bekam Magenbeschwerden und selbst der glückliche Besitzer des erbeuteten Gongs beunruhigte sich seines zweifelhaften Eigentumsrechtes wegen.
Wir übrigen hatten inzwischen, um eine Aussicht über unsere Umgebung zu erlangen, einen, nach den Aussagen der Leute günstig gelegenen Hügel bestiegen. Auf dem Gipfel des Berges angelangt standen wir jedoch, wie es uns häufig bei noch viel höheren Bergen passierte, in einem ebenso dichten Urwald als an seinem Fuss und einen Ausblick zu erlangen war also unmöglich. Um uns für unsere Enttäuschung etwas zu entschädigen, machten uns unsere Begleiter auf einige botanische Merkwürdigkeiten aufmerksam, von denen zwei Lianen allerdings interessant genug waren. Sie hiessen “aka kahir” und “aka hiling” und bildeten wahre Milch- und Wasserquellen, wenn man ihre Stämme durchschnitt und vertikal hielt. Im übrigen brachten wir von diesem Ausflug nicht viel mehr heim als ermüdete Gliedmassen.
Die im Lager zurückgebliebenen Kajan hatten uns unterdessen eine Überraschung bereitet und das dichte Ufergebüsch vor unserer Hütte umgehackt, so dass wir jetzt eine freie Aussicht genossen. Das gegenüberliegende Ufer lag nun in seiner ganzen Grossartigkeit vor uns. Die in allen Schattierungen von Grün prangenden Abhänge stiegen 300 m an und wurden von einer hohen, beinahe senkrechten, nackten Wand abgeschlossen. Die Wand trug eine schwere Decke von hohen Stämmen, deren zum Flusse hin frei entwickelte Kronen auch in dieser bedeutenden Entfernung ihren verschiedenen Charakter erkennen liessen.
Der Eindruck dieser Umgebung wurde nicht wenig durch die scheinbar völlige Abwesenheit tierischen Lebens erhöht. Die kleinen Vögel in den weit entfernten Baumkronen fielen nicht auf und nur selten bemerkte man einige Rhinozerosvögel, die in grosser Höhe über den [209] grünen Wellen vorüberschwebten. Nur der Argusfasan liess seinen hellen, vollen Ruf von nah und fern ertönen und zeugte von der reich entwickelten Tierwelt des tropischen Urwaldes, von der der Mensch trotz aller Anstrengung nur einen sehr kleinen Teil wahrnehmen kann.
Am anderen Morgen, den 24. August, begannen die Kajan, vergnügt über den günstigen Wasserstand, bereits bei Sonnenaufgang unsere Kisten und den Reis in die Böte zu verteilen, verpackten unsere Klambu und brachen das Zelt ab, so dass wir, als das ganze Kapuastal noch in Morgennebel gehüllt war, bereits in unseren Böten sassen und unter den besten Auspizien flussaufwärts fuhren. Nach Übereinkunft sollten wir unsere erste Mahlzeit an der Stelle halten, wo das malaiische Handelsboot gesunken war, denn meine Ruderer wollten während der Vorbereitungen zum Mahl noch einige Habseligkeiten herausfischen.
Nach einer Stunde erreichten wir die Unglücksstätte, ein Becken unterhalb Pulau Balang, in welchem hervorragende Felsblöcke in der Mitte und zu beiden Seiten so heftige Strudel verursachten, dass wir auch jetzt, bei niedrigerem Wasserstande, nur dank der Geschicklichkeit und Anstrengung der ganzen Bemannung vorwärts kamen. Die Verunglückten hatten versucht, ihr Boot längs eines Felsvorsprunges des linken Ufers über eine kleine Stromschnelle hinaufzuschaffen, und ihre Ladung war beim Umschlagen in das durch Felsblöcke vom Flusse abgeschiedene Becken gesunken.
Auch musste eine grosse Menge Reis gesunken sein, denn noch jetzt liessen sich auf dem Grunde des Wassers dicke, weisse Schichten erkennen. Gleich nach unserer Ankunft entledigte sich ein Teil der jungen Männer seiner ohnehin spärlichen Kleidung und verschwand im Becken, während andere überlegten, wohin die Strömung noch weitere Gegenstände weggeführt haben könnte. Ausser einigen Flaschen und Konservenbüchsen wurde noch ein Gong zum Vorschein gebracht, aber die leichteren Sachen, wie Packen Kattun, mussten vom Wasser bereits fortgetragen worden sein. Die Taucher blieben in ihrem Eifer bisweilen so lange unter Wasser, dass ich besorgt wurde. Sie berichteten, dass noch viele Säcke Reis am Grunde lagen, aber dass das Wasser zu tief sei, um sie hervorholen zu können; übrigens war der Reis durch das lange Liegen im Wasser sicher auch schon verdorben. So konnten denn die Kajan nach dem Essen mit ruhigem Gemüt von diesem kostbaren Fleckchen Abschied nehmen und ihre Aufmerksamkeit [210] darauf richten, uns selbst wohlbehalten über alle Strudel hinwegzubringen.
An der Mündung des Kréhau trafen wir einige zwanzig malaiische Händler mit ihren Warenböten, die unseren neugierigen Kuli die neuesten Nachrichten über die Buschproduktensucher am Kréhau und die Einzelheiten des Schiffbruchs berichteten.
Teils mit Rudern, teils mit Stangen kämpfte die Bemannung immer weiter gegen das wilde Wasser des Kapuas an. Durch das ständige Schaukeln des Bootes und die warme Mittagssonne in einen leichten Halbschlummer eingewiegt vernahm ich das Krächzen einiger Krähen in den Uferbäumen und wurde so im Traume über Meere und Weltteile nach einem kleinen Fleckchen Europas geführt, wo kühle Winde auf frischen Wiesen Mühlen treiben.
Bald aber verlangte eine besonders schwierige Stelle wieder die ganze Kraftanspannung meiner braunen Ruderer, deren Stimmbänder, während sie einander mit lauten Zurufen anfeuerten, in gleicher Weise wie ihre Muskeln angestrengt wurden. Meine Gedanken wurden dadurch bald in die Wirklichkeit; zum Kapuas, zurückgeführt und ich erfreute mich an der Geschicklichkeit und dem Eifer meiner Kajan, die mit ruhiger Sicherheit alle Schwierigkeiten zu überwinden wussten.
Wir kamen diesmal auch viel weiter als auf der vorigen Reise und fuhren auch an Long Mensikai vorbei, dessen üppige Vegetation jetzt nicht mehr erraten lässt, dass der Ort einst bebaut und von Menschen bewohnt gewesen ist.
Das kleine Stück Himmel, das zwischen den Uferbäumen sichtbar war, kündigte uns Unwetter und Regen an; wir waren daher froh, dass wir unseren Zug noch bis zur Mündung des Gung forsetzen und auf einer Geröllbank (ne̥ha Barau) unser Lager aufschlagen konnten.
Sehr unangenehm berührte mich am anderen Morgen Akam Igaus Vorschlag, dass wir an diesem Tage nicht weiter fahren sollten, weil er schlecht geträumt und ein anderer nachts den bilang, einen Baumgecko, gehört hatte. Im Hinblick auf die herandrohende Regenzeit musste ich das Äusserste wagen, um Akam Igau von seinem Aberglauben abzubringen und rief daher Tigang Aging und noch einige der wichtigsten Häuptlinge zu einer Beratung zusammen. Es war mir bereits früher aufgefallen, dass Akam Igau auf dieser Reise ganz besonders an den Vorzeichen hing, weil seine beiden jungen Söhne, Adjāng und Djawè, zum ersten Mal an einem grossen Zuge teilnahmen. [211] Ich hatte also nicht viel Nachgiebigkeit seinerseits zu erwarten und spielte daher die Missgunst des Tigang Aging, der nicht geträumt hatte und zur Weiterreise geneigter war, gegen ihn aus. Ich gab zu erkennen, dass ich, nachdem beim Beginn der Reise alle Vorzeichen als günstig befunden worden waren, eine weitere ernsthafte Unterbrechung unseres Zuges wegen der Vorzeichen nicht mehr wünschte, dass ich es auch so mit Kwing Irang, dem grossen Häuptling am Mahakam, gehalten hatte, der sich, wenn er den bilang hörte, mit einer Scheinexpedition begnügt hatte, und dass ich überzeugt war, dass Tigang Aging ebenso gehandelt hätte. Letztere Bemerkung reizte Akam Igau am meisten, wenigstens zeigte er sich zur Weiterreise bereit, nur wollte auch er vorher mit allen Kajan bis zu der Stelle hinziehen, wo der bilang sein “tjok, tjok” hatte ertönen lassen. Der Sinn einer solchen Expedition scheint darin zu bestehen, dass man dem wahrsagenden Tier, das eine Weiterreise verbietet, durch einen Spaziergang im Walde weismacht, man setze die Reise in der Tat nicht fort.
Um die Gemüter in gute Stimmung zu versetzen, versprach ich für diesen Tag einen Extralohn von ½ Dollar, falls es uns gelänge, die kommenden 8 Wasserfälle “Gurung Dĕlapan” zu passieren und den Bungan zu erreichen. Diese “Acht Wasserfälle” bilden nämlich für die Fahrt auf dem oberen Kapuas das Haupthindernis. Der Fluss drängt sich hier zwischen zwei Bergrücken hindurch in einem Bette, das die grossen Wassermassen oft nicht fassen kann; ausserdem werden die zum Teil haushohen Felsblöcke am Ufer bei Hochwasser durch die Strömung rund und glatt geschliffen. Diese Felswüstenei erstreckt sich 600 m längs des Flusses, der brausend und schäumend durch das unregelmässige Bett, das er sich selbst im Laufe der Zeit gegraben hat, hindurchschiesst.
Bei dem niedrigen Wasserstande, den wir jetzt glücklicher Weise hatten, legten wir die Strecke bis zu den Wasserfällen in kurzer Zeit zurück und landeten guten Mutes unterhalb eines haushohen Sandsteinblockes am linken Ufer. Der Block benahm uns zwar die Aussicht auf den “Gurung Dĕlapan”, beschützte aber unsere Böte vor den seitlich vorbeischiessenden Wassermassen. Während wir beschuhten Europäer nach einiger Übung beim Gehen auf Baumstämmen oder über Flussgeröll noch eine erträgliche Figur bilden, ist es auf einem Terrain wie dem vor uns liegenden um unsere Haltung bald geschehen. Bereits das Verlassen des kiellosen Bootes, das schaukelnd [212] und ächzend zwischen den anderen auf dem bewegten Wasser lag, erforderte Überlegung und Balancierkunst, und gleich der erste Tritt auf dem nassen, runden, glatten Felsblock am Ufer war ein Wagstück. Trotz unserer gut beschlagenen Sohlen wurde uns das Vorwärtskommen über und zwischen diesen glatten Steinmassen sehr schwierig, während die barfüssigen Kajan, schwer belastet, den langen Weg nach oben mit viel Würde und Bedachtsamkeit zurücklegten. Auch die kleinsten Päckchen mussten aus den Böten genommen und über die Felsen bis oberhalb der Wasserfälle getragen werden, so dass es Stunden dauerte, bevor man an den Transport der Böte denken konnte. Mit Rudern und Stangen war in diesem Wasserchaos nichts anzufangen; daher holten die Kajan aus dem Walde lange Stücke Rotang, von der Stärke dicker Taue, und befestigten sie vorn und hinten an den beiden Bootsenden. Die gewandtesten Männer erfassten die Rotangenden, kletterten auf den Felsen, zogen die Böte erst um den schützenden Block herum und dann längs dessen Fusses hin die Fälle hinauf. Sind die Umstände günstig, so riskiert es ein Mann, im Boote zu bleiben, um dessen Anprall an die Felswände zu verhindern. Auf diese Weise wurde ein Boot nach dem anderen um die verschiedenen vorspringenden Felsblöcke bugsiert, ein mühevolles und zeitraubendes Werk.
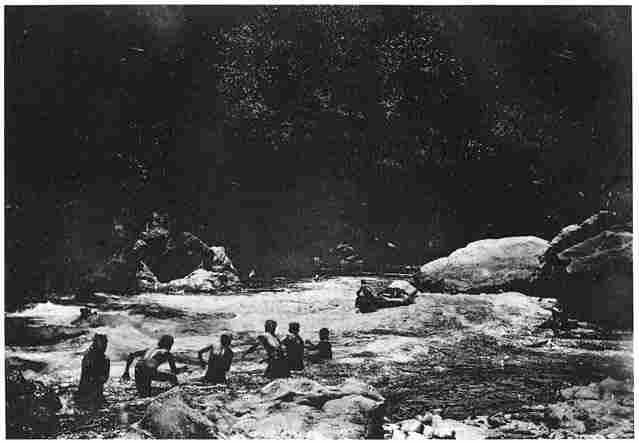
Aufwärtsziehen der Böte mittelst Rotangtaue im Gurung Dĕlapan.
Der Zug der Gepäckträger über die Felsen bot ein lebendiges und belustigendes Schauspiel; denn der Transport so vieler Güter stellte auch an die hoch entwickelte Kletterkunst der Kajan grosse Anforderungen und, sobald Form und Gewicht des Packens ein Tragen auf dem Rücken nicht zuliessen, schwankte der Träger ununterbrochen, und so manches Ausgleiten hatte einen Fall zur Folge.
Noch lebhafter und aufregender ging es auf der Wasserseite zu; hier entfalteten die Dajak eine solche Kraft, Umsicht und Fertigkeit, dass auch ein an dergleichen wilde Schauspiele Gewohnter von Bewunderung erfüllt werden musste. Da jeder, durch die Anspannung erregt, dein anderen’ über das Gedonner des Wassers hin etwas zuzuschreien versucht, herrscht überall ein scheinbares Durcheinander; in Wirklichkeit weiss aber jeder genau, was er zu tun hat. Das Boot wird durch die beiden Rotangseile in der richtigen Stellung gehalten und prallt nur selten an die Felswände an. Während die erste Gruppe bereits einen neuen Felsblock erklimmt, steht die zweite oft bis über die Mitte im Wasser und hält das hintere Seil straff, um das Boot [213] nicht anstossen zu lassen; dann wird auch dieses Seil nach oben geholt und so geht es langsam weiter. Ein Europäer tut unter solchen Verhältnissen am besten, sich jeder Einmischung zu enthalten und ganz dem Rat der sorgsamen Häuptlinge zu folgen.
Bei dem vorhandenen günstigen Wasserstande liess man mich, als die gefährlichsten Stellen überstanden waren, im Boote Platz nehmen. Nachdem wir mit einigen Böten bereits ein gut Stück vorwärts gekommen waren, stand ich einen Augenblick allein in dem meinigen, um die Ankunft der übrigen zu erwarten. Da fing das Wasser plötzlich mit solcher Geschwindigkeit an zu steigen, dass ich allein nicht im stunde war, den einen Rand meines Bootes; der eben noch frei unter einem vorspringenden Felsrand geschaukelt hatte und jetzt unter diesem eingeklemmt war, zu befreien. Das Boot neigte sich sogleich stark, aber einige Dajak sprangen in den Fluss und ich auf den Felsblock und so glückte es diesmal, mein Boot vor dem Umschlagen und einige meiner Güter vor einem unwillkommenen Bad zu behüten.
Mit dem immer schneller ansteigenden Wasser vermehrten sich alle Schwierigkeiten derart, dass an ein Überschreiten der Wasserfälle nicht zu denken gewesen wäre, wenn wir nicht bereits den halben Weg zurückgelegt gehabt hätten und nicht der Rückzug ebenso viel Hindernisse wie das Vorwärtsgehen verursacht hätte.
Unsere weitere Fahrt bestand in einem heftigen Kampfe mit den tobenden Wellen. Bald im Boote schaukelnd, bald im dornigen Uferwalde allein einen Weg suchend überliess ich die Bestimmung über meine Person und Habe gänzlich meiner Mannschaft. Bald nach Mittag glaubte ich, an einzelnen grossen Felsblöcken am Ufer zu erkennen, dass wir die eigentlichen Fälle überwunden hatten. Obgleich ich bereits zwei Mal den Kapuas hinaufgefahren war, konnte ich doch in dem schnellfliessenden, unruhigen Strom nicht das stille Wasser, das sich von hier bis zur Mündung des Bungan hinziehen musste, nicht erkennen.
Die Felsblöcke am Ufer, die das Flussbett verengten und mich stets wieder das Boot zu verlassen zwangen, verschwanden jetzt, aber die Schwierigkeiten verminderten sich darum nicht. Die heftige Strömung konnte nur mit der grössten Kraftanspannung und dadurch, dass man an der Innenseite der Buchten entlang fuhr, überwunden werden. Zu diesem Zweck mussten wir immer wieder die hoch brausende Mitte des Flusses durchqueren, ein Wagstück, das nur wenige Dajak zu unternehmen sich getrauten. Ihrem Beispiel folgend stellten die [214] übrigen ihr Boot in einem bestimmten Winkel gegen die Stromrichtung, ruderten aus aller Macht und kamen so hinter einer beschirmenden Landzunge zum Vorschein, um im nächsten Augenblick von der rasenden Strömung der Flussmitte gepackt und mit schaudererregender Schnelligkeit gegen das andere Ufer geschleudert zu werden. In solch einem Augenblick spannte die Bemannung zuerst alle Kräfte an, um den ersten Anprall der Bootspitze gegen das Ufer zu verhindern; war dies geglückt, so sprangen alle im Fahrzeug in die Höhe, ergriffen die Stangen und suchten nun auch den Anstoss der Bootsränder zu brechen.

Gurung Bakang.
Die Bewegungen, die die langen, schmalen Fahrzeuge ausführten, waren äusserst unangenehm und sicher ist, dass ich dem Himmel dankte, als uns nachmittags gegen 4 Uhr die braunen Wellen des Kapuas nicht mehr an das andere Ufer, sondern in das stille, dunkle Wasser seines Nebenflusses, des Bungan, warfen, der sich wie ein See unter dem Gewölbe der überhängenden Uferbäume hinzog.
In der folgenden Nacht legten sich die Kajan, erschöpft von allen Anstrengungen, ohne andere Bedeckung als ihre Matten, auf der ersten besten Geröllbank zur Ruhe nieder. Wir Europäer verbrachten die Nacht in einer schlecht gebauten Hütte mit der beruhigenden Überzeugung, dass uns ein Regenfall im Bungangebiet nur einen und nicht mehrere Tage Aufenthalt verursachen würde, wie in dem so viel grösseren Gebiete des Hauptflusses.
Nachts bereits begann der Bungan zu steigen und beim Erwachen mussten die Kajan vor seinem verräterisch braunen Wasser von der Bank an das höhere Ufer flüchten; der stille See von gestern stürzte jetzt schäumend an uns vorüber. An eine Forsetzung der Reise war nicht zu denken und so genossen meine Kajan einen wohlverdienten Ruhetag.
Ebenso schnell wie das Wasser gestiegen war, fiel es auch wieder und wohlbehalten und erfrischt konnten wir am anderen Morgen den Bungan aufwärts ziehen. Das Wasser hatte gerade die richtige Höhe. Ist es niedriger, wie es auf meiner früheren Reise der Fall war, so muss die Bemannung nebenherlaufend das Boot über die Steine des Flussbettes ziehen, eine viel ermüdendere Arbeit als das Vorwärtsstossen mit Stangen (gala). Trotzdem all unser Gepäck beim Überschreiten der zwei folgenden Wasserfälle, des Gurung Bakang, wo Georg Müller 1825 ermordet wurde, und des Gurung Langau über Land [215] getragen werden musste, legten wir an diesem Tage doch über die Hälfte des Weges bis zur Mündung des Bulit zurück.
Durch einen kleinen Unfall lernte Bier an diesem Tage das Fahren in Dajakböten. Er glaubte nämlich anfangs, ebensogut hoch oben auf ein paar Kisten als am Boden des Bootes, wie alle übrigen, sitzen zu können. In einer Stromschnelle verlor aber der Führer seines Bootes, Obet Lata, das Gleichgewicht, suchte unwillkürlich an ihm einen Halt und riss ihn mit sich in den Fluss. Zum Glück kehrten beide wohlbehalten in ihr Boot zurück.
Der gleich günstig gebliebene Wasserstand veranlasste uns auch am folgenden Morgen, früh aufzubrechen. Vor der Mündung des Bulit hatten wir keine Wasserfälle mehr zu passieren und so erreichten wir bereits gegen Mittag die Verbreiterung, in der Pulu (= Insel) Daru liegt. Ein fröhlicher Sonnenschein, der uns aber in der Tiefe der Kluft, unter dem überhängenden Grün des Gebirgswaldes, nicht erreichen konnte, belebte das Bild. Als sich hie und da Fische zeigten, konnten einige Kajan dieser Versuchung nicht widerstehen, holten ihre Wurfnetze hervor und begannen ihr Glück zu versuchen. Da vernahmen wir zu unserer aller Freude unter der dunkelgrünen Halle, die sich über uns ausspannte, das Plätschern von Rudern und bemerkten auch bald die auf dem Rückwege begriffenen Böte von Sĕniang und Akam Lasa. Diese hatten bei dem trockenen Wetter eine sehr günstige Reise gehabt, alle Vorräte unversehrt zum Bulit gebracht und dort auch die drei Männer, die unser Gepäck bewachten, angetroffen; diese befanden sich sehr wohl, sehnten sich aber in ihrer Einsamkeit sehr nach unserer Ankunft.
Akam Lasa und Sĕniang bekamen noch, als vorläufig letzten Gruss an die gebildete Welt, einen Pack Briefe mit nach Putus Sibau und setzten dann ihre Heimreise fort; auch wir verliessen den freundlichen Ort, um noch Long Bulit zu erreichen.
Im Laufe des Nachmittags wurde uns die Fahrt auf dem stillen Wasser unter hohen Uferbäumen und Girlanden herabhängender Lianen durch einen Regen verdorben. Da der Regen immer stärker wurde und alle, die keinen Mantel besassen, bis auf die Haut durchnässte, begrüssten wir mit Freuden die Reihe Felsblöcke, welche die Mündung des Bulit beinahe abschliesst.
Hier hatten die drei Wächter bereits eine Leiter zur Ersteigung des hohen Uferwalls und Gerüste für unsere Hütten hergestellt, so [216] dass nur noch das Segeltuch aus den Böten geholt zu werden brauchte, um uns ein schützendes Obdach vor dem Sturzregen zu verschaffen; bei hungrigen und ermüdeten Menschen ruft der Regen auch in den Tropen eine sehr unangenehme Stimmung hervor. Für uns Europäer gab es aber so viel Interessantes zu hören, dass nach dem Wechsel der nassen Kleider die letzten Unannehmlichkeiten bald vergessen waren.

Mündung des Bulit.
Mehr als drei Wochen hatten die Wächter allein, mitten in diesem nur von den nomadisierenden Stämmen der Bukat und Bungan Dajak durchzogenen Urwäldern, zugebracht; sie hatten sich aber nie geängstigt. Bereits wenige Tage nach ihrer Ankunft hatte sich das Gerücht von ihrer Anwesenheit mit so vielen guten Esswaren auch in diesen weiten Wäldern verbreitet. Erst waren ein paar Bunganmänner auf Kundschaft gekommen und, nachdem man sie freundlich empfangen hatte, folgten bald auch Frauen und Kinder, die alle ein Geschenk an Reis und Tabak erhielten, das für sie einen ganz besonderen Glücksfall bedeutete. So gestaltete sich den drei Männern die Einsamkeit noch erträglich und die Ungeduld wurde ihnen nicht zu quälend.
Da in den letzten Jahren alles niedrigere Gehölz der nächsten Umgebung von vorüberreisenden Gesellschaften zum Bau von Lagern gefällt worden war und unser zahlreiches Geleite es zu mühsam fand, Holz von weiter her zu beschaffen, übernachteten sie in sehr primitiven Hütten auf den Geröllbänken unten im Fluss. Auf einen trockenen Abend folgte aber eine nasse Nacht. Wir schliefen noch nicht lange, als wir von einer allgemeinen Unruhe am Flussufer geweckt wurden. Der Regen vom Nachmittag musste auch in einem Teil des Stromgebietes des oberen Bulit gefallen sein; denn das Flüsschen stieg innerhalb einer halben Stunde um zwei Meter und seine Wassermassen überfielen plötzlich die Schläfer auf der Bank.

Befördern der Böte über einen Wasserfall im Bulit.
Die Gesellschaft musste so schnell nach oben flüchten, dass einige ihr Hab und Gut nicht mehr in Sicherheit bringen konnten und zusehen mussten, wie ihre Tragkörbe mit dem so kostbaren Inhalt von dem Strome fortgerissen wurden. Während des folgenden Tages stieg und fiel das Wasser abwechselnd. An eine Fahrt auf dem Bulit war nicht zu denken, daher widmeten wir uns ganz dem Ordnen des Gepäckes, das uns, seines Umfanges wegen, trotz der ansehnlichen Trägerzahl für den Landtransport viel Schwierigkeiten verhiess. Daher kam Akam Igau mit dem Vorschlag, nicht wie auf der letzten Reise [217] südlich vom Berge Lĕkudjang zum Pĕnaneh zu ziehen, sondern durch das Tal des oberen Bungan und seines Nebenflusses, des Betjai, nördlich vom Lĕkudjang, den Howong, einen Nebenfluss des Mahakam, zu erreichen. Der Weg über den Pĕnaneh führte nämlich über die zahlreichen Bergrücken, welche die südlichen Quellflüsse des Bungan trennen, ausserdem waren die Pnihing, die früher am oberen Pĕnaneh wohnten und uns auf der Reise 1896 die erste Hilfe im Mahakamgebiet geleistet hatten, inzwischen an einen weiter unter am Fluss gelegenen Ort gezogen, so dass wir diesmal einen viel weiteren Weg selbständig zurückzulegen gehabt hätten als damals.
Um an den Howong zu gelangen, konnten wir erst dem Bungan und dann dem Bĕtjai bis zur Wasserscheide folgen, hatten diese dann auf bequemem Pfade zu überschreiten und zum Howong hinunterzusteigen. Dort wohnte seit langer Zeit ein Pnihingstamm, der uns beim Transport helfen und nötigenfalls auch mit Reis versehen konnte.
In Anbetracht dass auch Georg Müller im Jahre 1825 diesem Weg, allerdings in umgekehrter Richtung, gefolgt war und dass er überdies für mich neu war, ging ich gern auf Akam Igaus Vorschlag ein, und wir beschlossen, nur bis zum pangkalan (Halteplatz beim Beginn des Weges zum ...) Howong den Bulit aufwärts zu fahren und nicht, wie in den Jahren 1894–1896, erst vom pangkalan Mahakam aus den Landzug zu beginnen.
Gegen Abend fiel das Wasser ständig und wir hofften, unsere Fahrt am anderen Morgen auf dem nur 15 m breiten Flüsschen bei einer für unsere Böte genügenden Tiefe des Wassers fortzusetzen.
Alles auf einmal zu transportieren war jedoch unmöglich, daher sollten der Sergeant Duni und ein Schutzsoldat Bajan mit einigen kranken und auf der Reise verwundeten Kajan beim Reis zurückbleiben und später vom pangkalan Howong aus abgeholt werden.
Am ersten Tage begegneten wir Bungan Dajak, die auf der Reise nach Putus Sibau begriffen waren. Sie zeigten sich anfangs scheu, obgleich ich bereits auf der früheren Reise mit ihnen verkehrt hatte. Augenscheinlich fürchteten sie unseren Zorn, weil sie den Malaien Adam ermordet hatten. Ich wusste aber, dass dieser Adam, ein aus Sĕrawak entflohener Bandit, diese schwachen Stämme entsetzlich betrogen hatte, dass er sich sogar als Repräsentant der Regierung aufgespielt und sich als solcher vieler vom Mahakam stammender Güter bemächtigt hatte; ausserdem hatte er im Jahre 1896 alles getan, damit unsere [218] Expedition von den Mahakamstämmen schlecht empfangen würde. Ich beruhigte die Leute über die Folgen ihrer Tat und beschloss, um Zeit für die Erneuerung unserer Bekanntschaft zu gewinnen, erst kochen und das Nachtlager aufschlagen zu lassen. Nachdem sich die Bungan beruhigt hatten, erzählten sie mir, dass Adam sehr schlecht gegen sie gewesen sei. Als sie einst gemeinsam von Putus Sibau, wohin sie sich begeben hatten, um Handel zu treiben und den Kontrolleur zu sprechen, zurückkehrten, liess Adam nicht zu, dass sie die mitgebrachten Waren in ihre Hütten brachten, sondern zwang sie, einen Teil ins Wasser zu werfen. Einen kleinen Knaben, der noch etwas von den Schätzen retten wollte, verwundete er mit dem Schwerte, worauf dessen älterer Bruder einen vergifteten Pfeil auf ihn abschoss. Nun fassten auch die anderen Mut und beschossen ihn mit Pfeilen; sie wagten aber nicht, sich ihm zu nähern, und so hatte er noch Zeit gehabt, sich bis zu einer Felsenhöhle fortzuschleppen, wo er sein Leben endete.

Stalaktiten am Liang Bubuk.
Die Bungan besassen keine guten Böte und baten mich daher um eines der unseren, von denen wir ohnehin einige zurücklassen mussten; denn meine Kajan hatten für ihre Rückkehr nicht so viele nötig. Ich sagte ihnen ein Boot zu unter der Bedingung, dass sie beim Transport unserer Güter längs des Bulit bis zum Bungan behilflich sein sollten, worauf sie hauptsächlich wegen der zu erwartenden guten Reismahlzeiten eingingen.
Wir befanden uns hier inmitten einer interessanten Bergformation. Bereits an der Mündung des Bulit bemerkte ich einen weissen Kalkstein, weiter aufwärts wurden die Kalksteine immer zahlreicher, bis wir, nach einer Fahrt von einigen Stunden, zu beiden Seiten des Bulittales steile, 150–250 m hohe Kalkberge auftauchen sahen. Beim ersten Blick erinnerten ihre überhängenden Wände im unteren Teil an die Tufflager im Mandaigebiet, aber die unregelmässigen Höhlen und tiefen Klüfte hoch oben benahmen mir bald den Irrtum. Über eine Geröllbank klimmend, auf der einige Felsstücke anderer Formation mit ausgesprochener Schichtung hervorragten, gelangten wir bald an den Fuss eines der Berge. An der Seite, wo wir standen, hing eine 60 m hohe Felswand über uns, die an den Stellen, wo nicht Moose und Algen eine rote, braune oder graue Farbe hervorgerufen hatten, bräunlich weiss war. Zahlreiche, bis ein Meter lange Bienennester, deren Bewohner auf diese Entfernung kaum sichtbar waren, hingen von den Wänden wie von Gewölben herab. [219]
Der untere Teil der überhängenden Wand war, infolge der Erosion des durch die poröse Kalkmasse dringenden Wassers, in tiefe, breite Gruben und Spalten zerklüftet, die ganz unten zu Höhlen anwuchsen, an deren Eingang wir prachtvolle Stalaktiten bewunderten. Aussen waren diese bewachsen und dunkel gefärbt, an der inneren Seite waren sie aber schön weiss geblieben.
Ausser zahlreichen Schmetterlingen und Bienen, die das an vielen Stellen durchsickernde Wasser aufsaugen, beobachteten wir als Hauptbewohner dieser Höhlen nur Fledermäuse und Schwalben, von denen letztere essbare Nester bauen, die am Mahakam einen wichtigen Ausfuhrartikel bilden. Auf dem Boden hatte sich im Laufe der Zeit eine dicke Guanolage gebildet, deren durchdringender Geruch sich weit in der Umgegend verbreitete.
Die Höhlen dienen den nomadisierenden Familien der Punan und der ihnen ähnlichen Bungan Dajak als Schatz- und Totenkammern.
Unser Geleite zeigte für die Kalkbildungen viel weniger Interesse als wir und nur einzelne wagten es, sich den Höhlen, welche ihre Phantasie mit einem Heer von Geistern bevölkert, zu nähern. Keiner war auch dazu zu bewegen, irgend etwas in der Umgebung anzurühren, und so begannen wir denn selbst mit einem Hammer einen Teil eines Stalaktiten abzuschlagen, um seine Bestandteile später untersuchen zu können. Er erwies sich als sehr porös; trotzdem kostete es viel Mühe, ein Stück abzutrennen. Der lange Stab tönte dabei wie eine Glocke, wir hörten aber aus Furcht, das ganze Stück auf unsere Köpfe zu bekommen, bald mit diesem gefährlichen Glockenspiel auf.
Um eine gute photographische Aufnahme machen zu können, musste ein Baum gefällt werden. Während wir mit dem Aufsuchen eines geeigneten Standplatzes beschäftigt waren, verschwand, aus abergläubischer Furcht, einer der Kajan nach dem anderen, und von den drei übriggebliebenen wagte keiner, den Baum zu fällen. Ich ergriff daher ein Dajakbeil und machte mich selbst an die Arbeit. Einem danebenstehenden Pnihing wurde die Situation allmählich doch peinlich und, nachdem er sich überzeugt hatte, dass ich immer noch lebend auf meinen Beinen stand, überwand er seine Angst und nahm mir die Arbeit ab, die er sicher in einem Zehntel der Zeit vollführte. [220]
Kapitel XI.
Ankunft am pangkalan Howong—Unterhaltung im Lager—Akam Igau zieht zum Mahakam voraus—Aufbruch eines Teils der Kuli zur Wasserscheide—Erscheinen von Bungan Dajak Besuch im Lagerplatz der Bungan—Rückkehr der Träger—verschwinden des leises—Landzug in Eilmärschen—Passieren des Bungan—Nahrungsnot—Lager unterhalb der Wasserscheide.
Bereits früh am folgenden Tage erreichten wir den pangkalan Howong. Ida wir hier voraussichtlich einige Tage warten mussten, bis all unser Gepäck beisammen war, wurde ein festeres Lager als gewöhnlich aufgeschlagen. In kurzer Zeit wurden für uns und die verschiedenen Gruppen unserer Ruderer gute Hütten und für unsere Vorräte ein paar feste Schutzdächer aufgestellt.
Es zeigte sich, dass wir alles ohne Unglücksfälle und wenig beschädigt, in kürzerer Zeit als die vorigen Male, zu Wasser befördert hatten. Leider liessen die ungeschickten Punan noch im letzten Augenblick ein Boot, als es zwischen zwei Felsblöcken eingeklemmt sass, voll Wasser laufen. Die mit Harz verklebten eisernen Kisten trieben anfangs auf dem Wasser und konnten aufgefischt werden; sie mussten aber, da trotzdem Wasser eingedrungen war, doch ausgepackt werden. Unglücklicher Weise regnete es den ganzen Tag, so dass in der ohnehin feuchten Umgebung ein Trocknen kaum möglich war.
Unsere ganze Gesellschaft genoss übrigens die erzwungene Ruhe in dem angenehmen Gefühl, dass ein wichtiger und gefährlicher Teil der Reise bereits zurückgelegt war. Wie gewöhnlich verstanden die Kajan, die freie Zeit am besten zu benützen; sie hatten in ihren Tragkörben allerhand Arbeit mitgenommen, mit der sie sich während der langen Abende angenehm beschäftigten. Beim Schein einer kleinen Blechlampe schnitzte der eine ein neues Ruder, der andere einen Teller, ein dritter, Liebhaber feiner Arbeit, stellte einen Mandau-Schwertgriff her. Viele lagen auch neben einander und plauderten über die Tagesereignisse; trotz aller Anstrengungen der verflossenen Tage [221] schien keiner ruhebedürftig zu sein. Wurde die Stimmung besonders heiter, so begann einer der älteren Männer, Couplets, welche die Stammesgeschichte behandelten, vorzutragen; in den Kehrreim stimmte die ganze Gesellschaft mit ein. Der Gesang wirkte auf die Dauer etwas eintönig, klang in dieser Umgebung aber doch anziehend und legte ein gutes Zeugnis für die Stimmung meiner Kuli ab; daher horchte ich mit Vergnügen, wenn mir nicht vor Müdigkeit die Augen zufielen. Wir Europäer hatten nämlich trotz unserer guten Lampen keine Lust gehabt, irgend etwas vorzunehmen und hatten uns früh schlafen gelegt.
Am anderen Morgen sandte ich einen Teil unserer Leute an die Mündung des Bulit zurück, um die dort mit dem Reisvorrat Zurückgebliebenen abzuholen. Abends langten alle und alles wohlbehalten bei uns an.
Hatten an dem einen Abend die Männer aus Tandjong Karang etwas vorgetragen, so begannen am folgenden die Leute aus Pagong sich hören zu lassen und zwar wieder auf ganz verschiedene Weise.
Da wir nun einmal unsere Reise so weit gefördert hatten, durfte ich mit Ruhetagen auch nicht mehr allzusehr geizen und liess daher meine Kajan nach ihrer Art geniessen.
Der Wald, in dem wir uns eben befanden, war von der Regierung, aus Furcht vor Zusammenstössen mit den Köpfe jagenden und Buschprodukte raubenden Stämmen aus Sĕrawak, den Dajak noch nicht zur Ausbeutung frei gegeben worden und daher in seiner Unberührtheit besonders reizvoll. Die Gipfel der Bäume erhielten durch die wehenden, meterlangen Blätter der Rotangpalmen einen eigenen Schmuck; auch zeigten die Baumfarne hier zum ersten Mal ihr helles, spitzenartiges Laubwerk. Ein überall vorkommender Baum, dessen weisse Blüten die Geröllbänke bedeckten und das ganze Flusstal mit ihrem herrlichen Duft erfüllten, schien auch auf eine grosse Menge Insekten sehr anziehend zu wirken: Zahllose Arten Fliegen, Bienen und Wespen umschwärmten die Blüten und da, wo die Sonnenstrahlen einen Durchgang fanden, schwebten Gruppen eigenartig schöner Schmetterlinge. Es fiel uns aber auf, dass sich unter diesen im Ganzen wenig neue Arten befanden, während die Nachtschmetterlinge und die übrige Insektenwelt uns abends durch ihren Reichtum in Erstaunen versetzte. Der Schein unserer Lampen lockte aus der dunklen Umgebung zahllose kleine Nachtfalter herbei, die sich an der hellen Innenseite unserer [222] Dachbedeckung niederliessen und uns durch ihre unbeschreibliche Mannigfaltigkeit in Formen und Farben erfreuten. Fingen wir die sitzenden Tierchen mit dem weiten Hals einer Flasche mit Cyankalium auf, so fielen sie von selbst hinein und wir konnten sie nach Belieben bewundern. Matte und metallglänzende Farben auf dem verschiedensten Grunde und in den schönsten Zeichnungen erfreuten das Auge; unser Entzücken erregte aber ein sehr grosser Falter mit weissen Atlasflügeln, deren Ränder mit den zierlichsten Arabesken aus Gold geschmückt waren. Leider liess sich gerade dieser Falter nicht fangen, er war, wie auch die anderen grossen Arten, sehr scheu und zeigte sich nur auf Augenblicke. Auch das Aufstellen von Lampen im Walde führte zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Die Kajan hatten für dergleichen weder Auge noch Zeit und zogen beinahe alle in den Wald hinein. Die Punan gingen mit ihren Hunden auf die Jagd; einige Kajan suchten aka klẹa, eine Liane, um mit ihren Fasern unsere Fischnetze auszubessern, die beim Auswerfen auf dem mit totem Holz und Steinen bedeckten Grunde des Flusses stark gelitten hatten; wieder andere begaben sich auf den Fischfang.
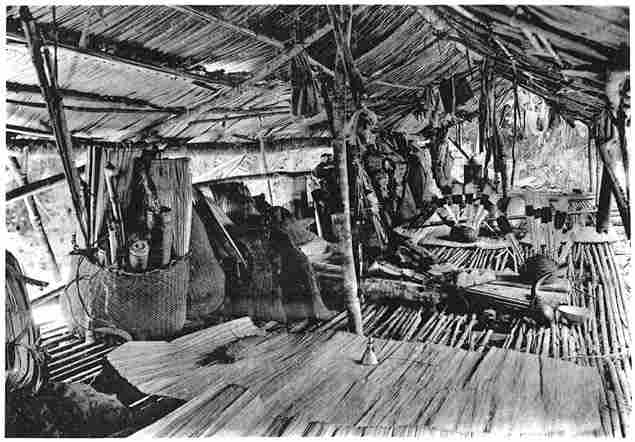
Inneres einer Kuli-Hütte.
Dank dem Fischreichtum dieser Flüsse stand unserem Geleite stets reichlich Fischfleisch als Zukost bei seinen Reismahlzeiten zur Verfügung. Das brachte mich auf den Gedanken, von allen Arten kleine Exemplare zu konservieren; eine derartige Sammlung, verglichen mit einer zweiten aus dem Mahakamgebiet jenseits der Wasserscheide, musste von Interesse sein. Ich suchte daher, wenn die Fischer abends ins Lager zurückkehrten, kleine, unverletzte Fische aus und legte sie in die hiefür mitgenommenen Flaschen in 20 % ige Formalinlösung. Auch sorgte ich dafür, dass meine Sammlung durch die besonderen, kleinen Arten der Fische der kleinen auf 500–600 m Höhe gelegenen Bergbächen bereichert wurde. Ich hatte bereits auf meiner vorigen Reise eine grosse Anzahl Fischarten sammeln lassen, aber aus Mangel an gut schliessenden Flaschen verdarb ein grosser Teil auf der weiteren Reise.
Unser schön tätowierter Bĕkĕtan, namens Ganilang, benützte die Musse, um sich an Stelle seines baumwollenen Lendentuches, das durch das ständige Nasswerden in Wasserfällen und Strudeln stark gelitten hatte, eines aus Baumbast herzustellen. Er suchte zu diesem Zwecke einen ihm bekannten Baum aus, entkleidete ihn auf 4 m Länge seiner Rinde und begann mit seinem Mandau-Messer, die Rinden- und Bastteile von [223] einander zu trennen. Den ungefähr 4 m langen, 3 dm breiten und 1 bis 1½ cm dicken, weissen Baststreifen, den er erhielt, rollte er von beiden Enden aus so fest als möglich zusammen und klopfte ihn darauf mittelst eines mit Einkerbungen versehenen Holzstückes mürbe. Indem er das Bündel immer steifer aufrollte, gelang es ihm, die Fasern aus einander zu pressen und den Streifen dadurch zu verbreitern. Nach mehrstündiger Arbeit erhielt er einen 4 m langen und 8 dm breiten, dünnen, biegsamen Lappen, aus dem durch Klopfen beinahe alle weicheren Teile entfernt worden waren. Zur Nacht band ihn Ganilang an einen Baumstamm in stark strömendem Wasser, wodurch vollends der Rest der weichen Teile ausgespült wurde; nach dem Trocknen bildete der Bastlappen ein hellbraunes, praktisches Lendentuch. Kleidungsstücke aus guten Bastarten können monatelang getragen werden.
Die jüngsten unserer Männer verfolgten inzwischen ganz andere Interessen. Im Gegensatz zu meiner vorigen Reise, wo Akam Igau dafür gesorgt hatte, dass sich hauptsächlich kräftige, kriegstüchtige Männer an unserer Expedition beteiligten, befanden sich diesmal viel jüngere Personen, welche das achtzehnte Jahr kaum erreicht hatten, unter unserem Geleite. Ich betrachtete ihre Gegenwart als ein Zeichen von Vertrauen, das man dem Wohlgelingen unserer Unternehmung entgegen brachte, und, da sie sich unterwegs in den Böten gut gehalten hatten, sah ich die fröhlichen, geschmeidigen jungen Männer gern um mich. Für viele bildete dieser Zug, gleichwie für Adjang und Djawè, das erste grössere Unternehmen, das sie mitmachten, daher sollten sie bei ihrer Rückkehr unter die erwachsenen Männer des Stammes aufgenommen werden. Vorher mussten sie sich aber, der Sitte gemäss, den utang, das Stäbchen, anlegen lassen, welches als Zeichen erreichter Männlichkeit durch die glans penis getrieben und während des ganzen Lebens nicht abgelegt wird. Zu Hause schämen sich die jungen Leute zu sehr vor den Frauen, um dergleichen Manipulationen mit sich vornehmen zu lassen, daher benützen sie lieber eine Reisegelegenheit dazu. In der Besorgnis, dass uns am Ende ein Aufenthalt verursacht werden könnte, war ich über die Nachricht, dass einige bereits den Ruhetag an der Mündung des Bulit und andere den Abend zuvor zur Ausführung der Operation benützt hatten, nichts weniger als erfreut. Obgleich die Operation sehr wenig aseptisch vorgenommen wurde, zeigte sich doch nur in einem Fall eine unangenehme Entzündung; heftige Blutung kam überhaupt [224] nicht vor, auch wurden die jungen Leute dadurch nicht an der Arbeit gehindert; nur ab und zu sah ich einen von ihnen mit schmerzhaft verzogenem Gesicht in einer kühlen Bergquelle sitzen, was ihm augenscheinlich Linderung verschaffte.
Wohl aus Rücksicht auf diese Verhältnisse zeigten Akam Igau und Tigang am folgenden Morgen wenig Lust, den Landzug zu beginnen: da ich aber nicht wusste, wie lange wir noch von unserem Reisvorrat zu leben hatten, hielt ich Eile für geraten und begann, als die Kajan zögerten, mit den Malaien den Reis- und Salzproviant, der vorausgetragen werden sollte, unter die verschiedenen Häuptlinge, je nach der Anzahl ihrer Leute, zu verteilen. Als uns darauf einige der Bungan Dajak, die wir, wie früher mitgeteilt, als Träger und Wegweiser zum Bungan in Dienst genommen hatten, zu Hilfe kamen, rafften sich schliesslich auch die Kajan auf. Zwar blieben hie und da einige in den Hütten zurück und andere begannen mit dem Transport ihrer eigenen Sachen, aber die meisten machten sich doch auf den Weg.
Tags zuvor hatte ich einige Bungan Dajak als Kundschafter und Träger an den Bungan vorausgeschickt; sie kamen jetzt mit der Meldung zurück, der Wasserstand im Bungan sei so hoch, dass man diesen nur mittelst über den Fluss gespannter Rotangseile habe passieren können, auch habe man das Gepäck noch vor der Mündung des Bĕtjai unterbringen müssen; erst am folgenden Tage sollten sie bis an den Betjai geschafft werden.
Der Bericht klang zwar nicht ermutigend, ich hatte aber ohnehin eingesehen, dass wir nicht sogleich weiter konnten, weil sich bei Demmeni, der seit dem ersten Tage unserer Ankunft an Malaria litt, noch immer keine Besserung zeigte; gegen Abend kehrte das Fieber stets zurück und liess sich auch nicht durch 2 g murias chinini, die er 8 Stunden vor dem Anfall, innerhalb einer halben Stunde, einnahm, niederschlagen. Da man den Patienten unmöglich über Land transportieren konnte und auch eine Rückreise für ihn nichts Gutes versprach, in Anbetracht, dass es mindestens acht Tage dauern musste, bevor er in Sintang ärztliche Hilfe finden konnte, musste ich versuchen, ihn an Ort und Stelle zu kurieren. Ich brachte daher den Patienten zu Bett und erhöhte die Chinindosis von 2 auf 3 Gramm mit dem Erfolge, dass sich der Kranke zwar schwindelig fühlte, die Temperatur aber nicht mehr stieg. Als am folgenden Tage 2 g Chinin wiederum [225] kein genügendes Resultat ergaben, beschloss ich, noch einige Tage mit strenger Bettruhe und 3 g Chinin fortzufahren. Obgleich diese Behandlung Demmeni durchaus nicht angenehm war, überstand er sie doch mutig, überzeugt, dass er nur auf diese Weise wieder marschfähig werden konnte.
Wir benützten die Wartezeit, um unser Hab und Gut, das während der Reise doch mehr oder weniger feucht geworden war, auf hoch gelegenen Geröllbänken zu trocknen. Einige Packen Seidenstoffe waren durch die Feuchtigkeit gänzlich entfärbt worden, obgleich sie sich in eisernen, mit Harz verklebten Kisten befunden hatten; derartige kostbare Artikel hätten in besonderen, verlöteten Blechkisten aufbewahrt werden müssen.
Den im Lager zurückgebliebenen Malaien hatte ich aufgetragen, auf verschiedene Weise Fische zu fangen; der Erfolg war aber, da die Träger das feinmaschige Wurfnetz mitgenommen hatten, gering.
Mittags kehrte die Trägergesellschaft zurück und bestätigte die Meldung der Bungan Dajak, dass der Weg längs dem Bungan sehr beschwerlich sei. Ferner hatten sie die in diesem Gebiete liegenden Niederlassungen einiger Bungan Dajak erreicht. Deren Häuptling Lakau war mir von der vorigen Reise her bekannt und trug die unmittelbare Schuld an dem Tode des Malaien Adam. Diese Bungan hatten meinen Kajan beim fragen nicht helfen wollen, trotzdem sie ihre Reisfelder bereits besät hatten. Ihre Weigerung erklärte sich aus der bei ihnen herrschenden Hungersnot, die sie dazu trieb, ihre Reisfelder zu verlassen und irgendwo am Bulit Waldfrüchte zu sammeln; sie zogen daher mit Frauen und Kindern aus, ihre Felder der Sorge der Natur überlassend.
Nachdem ich mit einigen in diesen Gegenden gut bekannten Punan, Djĕléwan und Udjan, darüber beraten hatte, ob wir diesen wenig verlockenden Landweg überhaupt einschlagen sollten, wurde beschlossen, ihm dennoch zu folgen. Davon, dass wir Europäer aufbrechen konnten, bevor Demmeni wieder zu gehen im stande war, konnte aber nicht die Rede sein; denn in dieser Umgebung mussten wir so lange als möglich beieinander zu bleiben trachten. Ich war daher gezwungen, den Gütertransport gänzlich den Trägern zu überlassen, was ich aus verschiedenen Gründen nur sehr ungern tat. Auch mussten wir überlegen, auf welche Weise wir die Häuptlinge am oberen Mahakam, deren Hilfe wir nötig hatten, am besten von unserer Ankunft benachrichtigen [226] sollten. Da Akam Igau sich bereits auf meiner Reise im Jahr 1896 trotz schwieriger Umstände seines Auftrages trefflich entledigt und uns bei seinen Verwandten eine gute Aufnahme erwirkt hatte, schien er mir auch jetzt wieder die gegebene Persönlichkeit dafür zu sein. Meine Wahl bereitete jedoch Tigang Aging, der sich selbst für am besten geeignet hielt, Haupt einer so wichtigen Gesandtschaft zu sein, viel Verdruss; auch erschien ihm der Transport des Gepäcks und die Aufsicht über seine eigenen Stammesgenossen viel weniger angenehm. Ausser Akam Igau beauftragte ich noch vier andere ältere Männer aus verschiedenen Häusern am Mendalam, an den oberen Mahakam vorauszuziehen und Kwing Irang, dem mächtigsten Häuptling der dort lebenden Bahaustämme, zu melden, dass unsere Expedition im Anzuge sei und wir ihn um seinen Beistand ersuchten.
Tigang Aging behielt ich, damit er unterwegs keine Händel mit Akam Igau anfing, bei mir zurück, auch sollte er mir bei den Bungan Dajak als Dolmetscher dienen.
Am nächsten Morgen wurden wiederum hauptsächlich Reis und Blechkisten mit Salz unter die Träger verteilt, die in der Voraussicht, längere Zeit allein reisen zu können, sehr vergnügt waren. Es schien mir am besten, dass sie ohne Aufenthalt bis an den oberen Bĕtjai zogen. Sie befanden sich dort auf einem Bergrücken nur einige Hundert Meter unterhalb der Wasserscheide zwischen den Quellen des Bĕtjai und Howong, also an der Scheide des Kapuas- und Mahakamgebietes. Bis zu diesem Punkte sollte Akam Igau die Träger beaufsichtigen und Sorge tragen, dass alles Gepäck dort gut aufbewahrt wurde; dann sollte er mit seinen Begleitern allein weiter zum Mahakam hinunterziehen. Der Korporal Suka und zwei andere Malaien, die unser Hab und Gut bereits am Bulit so gut bewacht hatten, sollten auch jetzt bei den Sachen zurückbleiben und dafür sorgen, dass alle Träger so schnell als möglich zu uns ins Lager zurückkehrten, um uns abzuholen.
Nachdem die ganze Gesellschaft fortgezogen war, blieben wir Europäer mit einigen hier gänzlich unbekannten Javanern, zwei Kapuas Malaien und drei Kajan, von denen zwei krank waren, einsam am Bulit zurück.
Wir konnten uns, da nur ein einziger, von den vielen Trägern ausgetretener und durch den Regen aufgeweichter Pfad in den Wald führte und es überdies viel regnete, nur auf dem kleinen Platz, den ich vor unserem Lager hatte abholzen lassen, einige Bewegung verschaffen. [227]
Um meine Leute die einsame Umgebung, die durch den ständigen Regen noch trostloser wurde, in der Arbeit vergessen zu lassen, liess ich sie Reusen für den Fischfang herstellen; der Bulit führte aber gerade jetzt nicht so viel Wasser, als für das Fischen mit Reusen erforderlich war, und so erhielt ich nur wenige neue Fischarten.
Zum Glück war Demmeni nach dreitägiger sehr strenger Behandlung fieberfrei geworden, und wir konnten ihn, um einen grösseren Ausflug auszuführen, für längere Zeit allein lassen.
Es war nämlich Zeit, dass wir Vorbereitungen für eine topographische Aufnahme des Mahakamgebietes trafen. Diese Aufnahme sollte sich an diejenige anschliessen, welche das topographische Institut in Batavia im Auftrage der Regierung in den Jahren 1885–1896 von dem Flussgebiet des Kapuas hatte ausführen lassen.
Der Topograph Werbata hatte damals den Weg über die Wasserscheide bis Pĕnanéh aufgenommen, hatte aber seine Absicht, von hier aus den Mahakam zu erreichen, aufgeben müssen.
Da wir nun nicht, wie es anfänglich unser Plan gewesen, den Weg über Pĕnanéh einschlugen, sondern längs des nur oberflächlich aus der Ferne von ihm aufgenommenen Bĕtjai zogen, mussten wir versuchen, auf der Wasserscheide einen Punkt zu fixieren, indem wir von dort aus mit dem Theodoliten die Azimute einiger hoher, bekannter Berge bestimmten. War der Fixpunkt gefunden, so konnte von ihm aus, mit Hilfe von Theodolit und Massstab, das ganze Mahakamgebiet aufgenommen werden.
Unser Topograph Bier hatte aber bis jetzt nur in Sumatra gearbeitet und auch meine Reisegenossen hatten bis jetzt nichts von dem Lande gesehen, weil wir von Nanga Era an in der Tiefe eines schmalen, von den bis 600 m hohen, steilen Abhängen des Kapuas-Kettengebirges begrenzten Tales gefahren waren.
Um uns von dem, was die Wasserscheide am Howong nördlich des Berges Lĕkudjang an Aussicht liefern konnte, eine Vorstellung zu machen, mussten wir eine Bergspitze besteigen und den Wald dort niederschlagen.
Etwas weiter oberhalb unseres Lagerplatzes am Bulit, bei dem pangkalan Mahakam, führte auf den Gipfel des Liang Tibab ein Pfad, den der Topograph Werbata hatte durchhauen lassen, um von diesem Berge aus seine Beobachtungen anzustellen; er hatte daher auch auf dem Gipfel den Wald fällen lassen. Ich hatte den Liang [228] Tibab bereits im Jahre 1894 mit Professor Molengraaff bestiegen, um von hier aus einen Überblick über das durchreiste Gebiet und das Kapuas-Kettengebirge nördlich des Bungan zu erhalten. Zwei Jahre später hatte ich mit Demmeni dort einige photographische Aufnahmen gemacht.
Auch der Kontrolleur Barth wollte das interessante Panorama des Liang Tibab sehen, und so machte er sich denn am 14. September bei herrlichem Wetter mit uns auf den Weg. Ein Bungan Dajak führte uns durch den Wald bis an den Fuss des Berges, von wo aus wir nach einer kleinen Kletterei bald auf den bekannten Pfad gelangten. Dieser war inzwischen so stark mit jungen Bäumen und Sträuchen bewachsen, dass man ihn kaum wieder erkennen konnte. Der Pfad war übrigens leicht zu verfolgen, denn er führte bereits auf 100 m Höhe über einen längs dem Bulit verlaufenden Kamm. Ein Verirren war nicht möglich, da der Bergrücken nur wenige Meter breit war; eher riskierte man einen Absturz von seinen sehr steilen Wänden. Glücklicher Weise verhinderte die dichte Vegetation ein Schwindeligwerden und ermöglichte zugleich auch den Gebrauch der Hände beim Klettern. Der ganze Weg bestand aus Lehmboden und war durch die vielen Regengüsse sehr schlüpfrig geworden.
Ich habe mich immer wieder darüber gewundert, dass so scharfe, steil abfallende Rücken, die ganz aus Lehm und sehr verwittertem Gestein bestehen, den vielen Sturzregen im Gebirgsland von Borneo Widerstand zu leisten vermögen. Eine der Hauptursachen hierfür ist zweifellos in der dichten Waldbedeckung zu suchen, da die tief eindringenden Wurzeln die kleinen Erdteilchen vor Wegspülung und Absturz beschützen und das dicke Blätterdach die Kraft der niederfallenden Regen bricht.
Trotzdem die Bäume und Sträucher uns den Marsch erleichterten, dauerte es doch beinahe zwei Stunden, bis ich mit Bier den Punkt erreichte, von dem aus der Topograph Werbata seine Beobachtungen angestellt hatte. Der Rücken war hier nur 1 m breit, bestand aus ganz losem, nur durch Wurzeln zusammengehaltenem Gestein und gestattete längs seiner im Winkel von fast 60° ansteigenden Seitenwände hinunterzuschauen. Um Aussicht zu gewinnen, mussten wir erst die seit dem letzten Besuch auf dem Gipfel aufgeschossenen Sträucher forträumen lassen und begannen unterdessen unsere verschiedenen Höhenbarometer nach dieser bekannten Höhe zu regulieren. Von den [229] beiden Aneroïden schien der eine auf der Reise gelitten zu haben, wenigstens wich er stark von dein Hypsometer ab, mit dem er, wie auch der andere, noch in Putus Sibau gut übereingestimmt hatte. Die beiden anderen Barometer gaben, mit Berücksichtigung der Temperatur, die Höhe von 740 m richtig an.
Kaum hatten wir unsere Arbeit beendet, als auch der Kontrolleur mit seinen Begleitern eintraf. Der steile und mühevolle Pfad hatte ihn bis zum Erbrechen angestrengt, aber doch hatte er seinen Zug nicht aufgeben wollen. Das prachtvolle Panorama des Kapuasgebirges, das sich weithin ausdehnte, entschädigte ihn übrigens reichlich für die ausgestandenen Strapazen.
Nach Norden traf der Blick das Ober-Kapuas-Kettengebirge, das, von dichten, ernsten Wäldern gänzlich überdeckt, mit seinen in Wolken gehüllten Gipfeln einen beklemmenden, schwermütigen Eindruck auf den Beschauer machte. Zu Füssen des Gebirges strömte mit allen seinen Nebenflüssen der Bungan, auf dem wir uns so lange mühsam fortbewegt hatten. Aus diesem Tal erhoben sich wie Kulissen die Ketten hinter einander und stiegen erst schnell, dann immer allmählicher nach Norden hin auf, bis ihre höchsten Spitzen, der Kaju Tutung und Kĕrihum, in den Wolken verschwanden. Das eintönige dunkelgrüne Gewand, welches das ganze Kettengebirge bis auf seine höchsten Erhebungen hinauf umhüllte, machte in seiner stolzen Einfachheit, die weder durch Abwechslung der Farbentöne noch durch eigenartige Felsformationen belebt wurde, einen imposanten Eindruck. Tief unter uns schlängelten sich die Täler des Bulit und Bungan als schmale Streifen nach Westen; zwar waren auch sie mit dunklem Grün überdeckt, aber die steilen Wände der sie einschliessenden Kalkberge hoben sich leuchtend weiss von der Umgebung ab. Als einziges Zeichen menschlichen Lebens sahen wir ganz in der Tiefe zwischen zwei Querkämmen eines hohen Bergrückens eine feine Rauchwolke zwischen den Bäumen aufsteigen. Die Flüsse selbst blieben unserem Auge gänzlich verborgen.
Südlich des Bungan Tales erhoben sich nur zwei höhere Bergrücken, der Tanah Kuban, dicht bei den “Gurung Dĕlapan”, und der Rücken, von dem der Liang Tibab einen der höheren Gipfel bildet; dieser stieg weiter nach Süden bis zu einer Höhe von 1100 m an. Zwischen diesen beiden Bergrücken zog sich in leichten Windungen, nach Süden immer breiter werdend, das Flusstal des Langau hin. Obgleich Punan und Buschproduktensucher in diesem Gebiete umherstreiften, liess die ununterbrochene [230] Waldbedeckung deren Anwesenheit doch nicht ahnen. Im Süden und Westen begrenzten zwei spitze Berge, der Sara und der Hariwun, das Langau Gebiet, während im Hintergrunde zwischen diesen beiden der Mĕnakut aus dem Stromgebiet des Kréhau zum Vorschein kam. Am südlichen Ufer des Kréhau, fern am Horizont, wurde das eigenartige Müllergebirge mit seinen langgestreckten Tuff-Hochflächen sichtbar.
Nach Süden hin benahm uns der ansteigende Rücken des Liang Tibab die Aussicht; dagegen bot uns der freie Osten einen interessanten Anblick. In der Mitte zahlreicher, waldbedeckter Kämme von viel geringerer Höhe erhob sich im Süd-Osten der obeliskenförmige Pĕmĕluan bis zu 1300 m Höhe, während etwas östlicher der riesige Tĕrata die Landschaft beherrschte. Die Wände beider Berge waren viel zu steil, um von der Vegetation bedeckt sein zu können, und bildeten daher mit ihren weissen, grauen und braunen Farben einen schönen Gegensatz zu dem schlichten Grün um ihren Fuss und Gipfel. Im Nord-Osten lag der Lĕkudjang, längs welchem wir zum Mahakam ziehen mussten. Von unserem Standpunkt aus hob sich der westliche, abgestürzte Teil der Kraterwand dieses alten Vulkans von dem übrigen waldbedeckten Teil schön ab. Wegen der vorgelagerten Gebirgskämme und des schmalen Raumes zwischen ihr und dem nördlich gelegenen Kettengebirge, kam die Wasserscheide mit dem Howong nicht klar zum Vorschein, aber doch schien es möglich, auf ihr einen passenden Punkt zu finden, von dem aus man auf den Sara, den Hariwung und irgend welche anderen Gipfel visieren und dadurch Fixpunkte für unsere topographische Aufnahme des oberen Mahakamgebietes gewinnen konnte. Der nördliche Abhang des Lĕkudjang war allerdings steil, aber wir beschlossen doch, zu versuchen, den Berg von dieser Seite aus zu besteigen, weil wir hierdurch eine Aussicht auf das Gebiet des Howong und Mahakam gewinnen konnten.
Der Wind wehte heftig auf unserem hohen Punkt und wir konnten uns auf dem schmalen Platze nicht bewegen; ein längerer Aufenthalt auf der Höhe erschien uns somit nicht verlockend und wir beeilten uns, trotz der genussreichen Aussicht, wieder in die Tiefe zu gelangen. An den steilen Abhängen des Kammes ging der Abstieg schnell von statten und im Lager angekommen suchten wir, müde aber befriedigt, unsere Klambu auf.
In den letzten Tagen hatten wir in unserer Nähe öfters Hunde [231] bellen gehört; augenscheinlich zogen ihre Eigentümer, die Bungan Dajak, unter Lakau um unser Lager herum und wagten nicht, sich bei uns zu zeigen. Als sie sich endlich davon überzeugt hatten, dass wir nicht kamen, um den an dem Malaien Adam verübten Mord zu rächen, wagten sich erst einige Männer heran und, als diesen nichts geschah, auch mein Bekannter Lakau mit seinen Töchtern, an die ich auf den früheren Reisen bereits Arzneien verabreicht hatte. Die armen Leute litten sehr an Nahrungsmangel, ich konnte ihnen aber keinen Reis, nur Salz mitgeben. Nachdem sie ihren Hunger bei uns gestillt hatten, baten sie um Arzneien. Die Häuptlingstöchter hatten wiederum dringend Jodkali nötig; der Vorrat, den ich ihnen 1896 gegeben, hatte sie völlig hergestellt, seit einigen Monaten waren die alten Leiden aber wiederum zum Vorschein gekommen. Ich versprach einen neuen Vorrat Jodkali, falls sie mir Flaschen bringen würden. Das versprachen sie für den folgenden Tag, wo der ganze Stamm an uns vorüber ziehen sollte, um im Gebiete des unteren Bulit nach Waldfrüchten zu suchen. Ein Malaie, der mit den Bungan Dajak zusammenwohnte, schien den Reis minder gut entbehren zu können, wenigstens brachte er ein uns sehr willkommenes Huhn, um es gegen Reis auszutauschen.
In der Tat zogen am anderen Morgen Männer, Frauen und Kinder, alle beladen, am jenseitigen Ufer vorüber und warfen auf uns und unsere Umgebung neugierige, scheue Blicke. Nur einige Männer wateten zu uns herüber und erzählten, dass sie sich fürs erste in unserer Nähe niederlassen wollten, um in der Umgegend Früchte zu suchen. Unsere Malaien hatten bereits einige Male herrliche Früchte gefunden, die Bungan kannten aber die Fruchtbäume dieser Wildnis, wie wir die unserer Gärten kennen. Aus dem Bericht der Bungan ersahen wir, dass man unsere Gegenwart nicht allzusehr fürchtete, und beschlossen daher, unseren augenblicklichen Nachbarn einen Besuch abzustatten. Um ihnen eine Freude zu machen, nahmen wir Glasperlen und Angelhaken als kleine Geschenke mit. Unter Tigangs Führung gelangten wir nach einer halben Stunde auf einem für uns Europäer nicht erkennbaren Pfade zu einer mit wenig Gestrüpp bedeckten Lichtung im Walde. Einige sehr primitive nach Art der Punan und Bukat gebaute Hütten standen hier neben einander.
Eine schräge Wand, die aus ineinander geflochtenen Zweigen bestand und mit Blättern gedeckt war, ruhte mit einem Ende unter [232] einem Winkel von 60° auf dem Erdboden, während das andere von Pfählen gestützt wurde. Aus den gleichen, grossen, runden Baumblättern, mit denen dieses Dach gedeckt war, bestanden auch die Seitenwände, welche gegen Regen und allzu heftigen Wind Schutz bieten sollten. Die grösste Hütte in der Mitte wurde von der Häuptlingsfamilie bewohnt. Sowohl in dieser Hütte als auch in den übrigen hatte man den Boden mit dünnen, neben einander ruhenden Baumstämmen belegt. Der Herd befand sich dem Eingang gegenüber unter der schrägen Wand; er bestand nur aus einigen Steinen, auf denen eiserne Kochtöpfe standen. Unter dem Herde hatte man etwas Erde auf den Boden gestreut und über demselben ein Gestell für Brennholz angebracht.
Nach den Britschen zu urteilen, die je zu zweien an den Seitenwänden standen, schliefen der Häuptling und seine Frau auf der einen und ihre beiden Töchter auf der anderen Seite. Wo der Erdboden etwas abschüssig war, ruhten die vorderen Enden der Balken des Fussbodens auf einem starken Querbalken, so dass der Fussboden ein Stück weit vor dem Dache hervorragte und eine kleine Plattform bildete, von der aus ein frisch gefällter Baumstamm als Pfad zum Boden führte. Alle Hütten waren nach dem gleichen Plan gebaut.
Wir fanden nur wenige Bewohner im Lager; die meisten suchten in der Umgegend nach Waldfrüchten; nur Kranke und sehr kleine Kinder hatte man in den Hütten zurückgelassen. Die anwesenden Frauen litten entweder an Malaria oder an luëtischen Ulcerationen und bereiteten uns aus Scheu einen sehr kühlen Empfang, der auch, als wir unsere kleinen Geschenke austeilten, nicht wärmer wurde. Während wir einige Zeit zwischen den Hütten umhergingen, in der Hoffnung, dass man sich an unsere Anwesenheit gewöhnen würde, traten einige ältere Frauen und Kinder am jenseitigen Ufer aus dem Walde hervor; kaum merkten sie aber, dass Besuch im Lager war, als sie schleunigst die hohe Ufermauer wieder hinauf flüchteten.
Da es durchaus nicht in unserer Absicht lag, diesen scheuen Waldmenschen Schreck einzuflössen und ihnen unangenehm zu sein, machten wir uns sogleich auf den Heimweg. Abends suchte ich den ungünstigen Eindruck unseres Besuches zu verwischen, indem ich dem Häuptling Lakau ein Boot schenkte, das er sich für eine Fahrt nach Putus Sibau sehnlichst gewünscht hatte.
Die Bungan Dajak nehmen unter der Bevölkerung von Mittel-Borneo eine eigenartige Stellung ein; sie bilden im Bungan Gebiete [233] einen Übergang von den echten Nomadenstämmen, wie den Punan und Bukat, zu den sesshaften, Ackerbau treibenden Stämmen. Sie bauen hauptsächlich Reis und süsse Erdäpfel, aber da der Ernteertrag infolge ihrer primitiven Bearbeitung der Felder gering ist, sind sie gezwungen, diese nach der Saat sich selbst zu überlassen, wodurch ein grosser Teil der Ernte den Vögeln, Hirschen, Affen und Wildschweinen zum Opfer fällt. Sie selbst müssen für ihren Unterhalt den Wald durchstreifen, nach Früchten, wildem Sago und Wild suchend. Bei ihren Feldern bauen sich die Bungan Häuser nach Art der ackerbauenden Stämme, nur weniger dauerhaft, während ihres Nomadenlebens begnügen sie sich aber mit den primitiven Hütten der im gleichen Gebiet lebenden Bukat. In ihrer Kleidung, Tätowierung und Bewaffnung ähneln sie sowohl den Bahau als den Punan.
Es fiel mir auf, dass ihre Männer besonders kräftig gebaut und gross von Wuchs waren, einige erreichten eine Höhe von 1.75 bis 1.80 m; die Frauen dagegen waren eher klein von Gestalt. Auch in Hautfarbe, Haaren u.s.w. zeigen sie Verwandtschaft mit den Bahau und Punan.
Am Abend des 15. September kehrten von unseren Trägern zuerst die Ma-Suling mit dem Bericht zurück, man habe das Gepäck bis an den Fuss des Bergrückens, der auf die Wasserscheide führte, gebracht und dort die drei Malaien und zwei Bukat als Bewachung zurückgelassen; ferner, Akam Igau und die Seinen seien weiter an den Mahakam gezogen. Da Demmeni nun auch so weit war, dass er, mit einigen Vorsichtsmassregeln gegen neue Strapazen, weiter ziehen konnte, legten wir uns in der angenehmen Voraussicht, dass die langen, eintönigen Tage nun ein Ende erreicht hatten, schlafen. Zwar regnete es viel und der Bungan musste schwer zu passieren sein, aber dass dies doch möglich war, bewies die Ankunft der übrigen Träger am folgenden Morgen.
Unsere freudige Stimmung wurde leider bald gründlich gedämpft. Auf meine Frage, wie viel Reis man bis an den oberen Bĕtjai gebracht hatte, erfuhr ich zu meinem grossen Schrecken, dass von dem ganzen grossen Vorrat, den sie mitgenommen hatten, nur sechs Säcke übrig geblieben waren und dass wir uns somit gänzlich auf den kleinen Rest, den wir bei uns zurückbehalten hatten, angewiesen sahen. Eine Stunde lang kämpfte ich mit mir selbst, um meine Entrüstung nicht zum Ausbruch kommen zu lassen, denn in dieser kritischen Lage bedeutete eine [234] schlechte Stimmung der Kajan ein Missglücken des Zuges zum Mahakam. Trotz all meiner ernsten Fürsorge vom Beginne an hatte ich nun doch nicht genügend Proviant für mein Personal.
Wie solche Mengen Reis hatten verschwinden können, darüber konnte oder wagte man mir keinen Aufschluss zu geben. Die älteren Männer schoben die Schuld auf die vielen de̥ha njām (= jungen Leute), welche, der langen Reisen und der Sorge für die Zukunft nicht gewöhnt, unterwegs so viel Reis verzehrt hätten; die anderen wiederum behaupteten, sie hätten viel nass gewordenen Reis wegwerfen müssen. Trotz dieser Erklärungen blieb mir die Sache rätselhaft, da ich nicht voraussetzen wollte, dass sie den Reis für ihre Rückreise im Walde verborgen hatten. Eine Erklärung der Tatsache konnte den Reis übrigens auch nicht wieder herbeischaffen, und so rief ich denn die Häuptlinge zusammen, um mit ihnen zu überlegen, was weiter zu tun sei. Durch die Sorglosigkeit ihrer Untergebenen hatten wir nun nicht einmal für die Reise bis zum Howong genügenden Proviant, trotzdem erhob keiner seine Stimme gegen eine Fortsetzung des Zuges. Das war schon viel, denn die Häuptlinge wussten sehr wohl, dass wir nun in Eilmärschen den Landweg zurücklegen mussten, dass von Ruhetagen keine Rede sein konnte und vom Gepäck auch nichts zurückbleiben durfte. Die Vertrautheit der Häuptlinge mit der Umgegend eröffnete eine Aussicht, aus der schwierigen Lage herauszukommen. Sie schlugen mir zuerst vor, den Bungan Dajak ein Batatenfeld, das doch von Wildschweinen abgeerntet wurde, abzukaufen; auch sollte ich ihnen an der Wasserscheide einen Tag frei geben, da sie in der Umgegend einige Stellen kannten, an denen man wilden Sago sammeln konnte; ausserdem wusste ich, dass meine Leute für den äussersten Notfall alle ke̥rtăp, den fein gestossenen Klebreis, in ihren Tragkörben mitgenommen hatten.
Eine andere Schwierigkeit bestand darin, dass wir uns auf der Wasserscheide längere Zeit aufhalten mussten, um den zurückgelegten Weg am Mahakam messen zu können. Das war unbedingt nötig, da sonst die ganze topographische Aufnahme des Mahakamgebietes in Verbindung mit derjenigen des Kapuasgebietes überhaupt nicht stattfinden konnte.
Um so schnell als möglich von den Pnihing am Howong Hilfe zu erlangen, erschien es mir am geratenster, das Prinzip des Zusammenbleibens der Europäer und der meisten Malaien zunächst aufzugeben. Nach allgemeiner Beratung wurde daher beschlossen, am folgenden [235] Morgen gemeinschaftlich aufzubrechen und an diesem Tage noch beisammen zu bleiben, um zu sehen, ob alles gut ging, und vor allem, ob Demmeni folgen konnte; war dies der Fall, so sollte ich mit Bier und einigen tüchtigen Männern in Eilmärschen vorausziehen, während der Kontrolleur Barth mit Demmeni dafür sorgen sollte, dass der Nachschub alles Gepäck bis zur Wasserscheide brachte. Hierdurch hoffte ich zu erreichen, dass, bis alle an die Wasserscheide gelangten, sowohl der Lĕkudjan erstiegen als mit der Messung des Weges begonnen worden war.
Trotz ihres guten Willens zur Weiterreise nahmen die Träger am anderen Morgen nur zögernd unser Gepäck auf den Rücken; kindischer Weise sahen sie sich um, ob die Leute des einen Dorfes nicht am Ende etwas weniger zu tragen bekamen, als die eines anderen, auch kamen sie mit den eigenen Dorfgenossen aneinander. Da unsere Malaien wenig Einfluss auf die Kajan hatten, mussten der Kontrolleur und ich schliesslich selbst alle Kisten, Reispacken, unsere Matratzen und Zeltdecken unter sie verteilen und am Ende noch hier einen Kochtopf und dort eine Lampe in den verschiedenen Tragkörben unterbringen lassen. Nachdem alle gegessen hatten, begannen sie doch eifrigst ihre Tragkörbe in Ordnung zu bringen.
Alle Stämme im Innern von Borneo gebrauchen beim Tragen von Lasten auf ungebahnten Wegen den takin, einen aus starkem, gespaltenem Rotang geflochtenen und daher biegsamen Tragsack von viereckiger Form. Die hintere Wand des Sackes besteht aus zwei Teilen und ist mit Rotangschnüren versehen, so dass auch umfangreiche Gegenstände in den Korb aufgenommen werden können, indem man die Klappen öffnet und die Fracht an beiden Seitenwänden mittelst der Schnüre festbindet. Auf diese Weise wurden auch die eisernen Köfferchen, in welchen ich die meisten Tauschartikel und meine Kleider bewahrte, transportiert. Ein grosser Vorteil bestand darin, dass die Koffer nicht wegen zu grosser Länge oder Breite aus dem Korbe hervorragten, daher wurde ein Klettern zwischen und unter Felsen und umgefallenen Baumstämmen nicht allzu beschwerlich. Viel Mühe und Überredungskunst war stets erforderlich, um lange, wenn auch leichte Gegenstände, wie Stative und Massstäbe den Trägern aufzubürden. Um g Uhr war das Gepäck verteilt. Die Kajan packten alles so praktisch als möglich zusammen und banden schliesslich noch ihre eigenen Sachen an den Korb. Die takin werden mittelst zweier Rotangseile über der Schulter [236] auf dem Rücken getragen. Ist die Haut nicht ganz gesund, so leiden die Schultern bei längeren Märschen stark und die Tragseile werden daher oft mit Zeug umwunden. Diejenigen, die ihre dicken Kriegsjacken mitgenommen hatten, zogen sie öfters an und setzten dann auch ihre schweren Kriegsmützen aus Rotang auf. Das Schwert hängen alle an die Seite, und in den freien Händen halten einige ihre Schilde, alle aber ihre Speere, die ihnen auf beschwerlichen Pfaden einen ausgezeichneten Halt bieten.
Das Abbrechen des Lagers bestand nur darin, dass die Kajan ihre Schlafmatten zusammenfalteten und vorsichtig aufrollten, die Hütten selbst blieben unversehrt zurück und werden wohl noch ein Jahr lang Zeugnis von unserem Aufenthalt am Ufer des Bulit abgelegt haben.
Ein Träger nach dem anderen verschwand auf dem ausgetretenen Pfade im Walde, und nun wurde es auch für uns Zeit, an den Aufbruch zu denken. Demmeni war mit Bier bereits vorausgegangen, um den Weg langsam zurücklegen zu können; wir hatten bis zuletzt gewartet, um uns davon zu überzeugen, dass nichts im Lager zurückgelassen wurde.
Der Weg bis zum Bungan war nur 5 km lang und nicht steil und wurde daher ohne Schwierigkeiten zurückgelegt. Von Bergen und Gestein sahen wir, bis wir an das Ufer des Bungan gelangten, nichts. Hier fand ich alle vereinigt. Der 60 m breite Fluss war seit dem vorigen Tage stark angewachsen und man fürchtete, dass das Rotangkabel, das früher beim Durchqueren des Flusses als Stütze gedient hatte, die schwer beladenen Träger jetzt nicht würde halten können. Daher waren bereits einige Männer in den Wald gegangen, um neuen Rotang zur Verstärkung zu suchen; gleichzeitig befestigte man das eine Ende des Kabels doppelt stark an den kräftigen Wurzeln der Uferbäume und sandte einen unbeladenen jungen Mann an die andere Uferseite, um dort das Gleiche vorzunehmen.
Einer nach dem anderen stieg darauf vorsichtig längs der steinigen Uferwand zum Flussbett hinab, das gänzlich aus glatten, rundgeschliffenen Felsblöcken von ¼ bis zu 1 m Durchmesser bestand.
Bereits bei stillstehendem Wasser musste das Gehen auf ihnen beschwerlich sein. Jetzt wateten die Träger bis zur Brust in dem brausenden Strom, erreichten aber doch, mit der einen Hand auf den Speer gestützt, mit der anderen das Rotangseil festhaltend, wohlbehalten das andere Ufer. Da nie mehr als zwei bis drei Träger gleichzeitig [237] sich am Seil festhalten durften, dauerte der Übergang sehr lange, hatte aber den Vorteil, dass keiner der Männer fiel und unser Gepäck auch nicht nass wurde. Demmeni, für den ein kaltes Bad durchaus nicht wünschenswert war, nahm der kräftige Jung sogleich bereitwilligst auf den Rücken und brachte ihn glücklich, nur mit nassen Füssen, an das andere Ufer. Jetzt kam die Reihe an uns andere Europäer. Ich übergab meinen Revolver und mein Gewehr einem Kajan und begann dann mutig den Kampf mit dem Wasser. Kaum war ich 20 m vom Ufer entfernt, als ich mich mit Erstaunen fragte, wie die Kajan in diesem Chaos runder Blöcke unter Wasser einen Stützpunkt für ihre Füsse hatten finden können. Augenscheinlich boten meine Kleider der heftigen Strömung besonders viele Angriffspunkte, denn ich musste mich mit beiden Händen am Rotang festklammern, um Stand zu halten. Sehr bedächtig suchte ich für jeden Fuss einen Stützpunkt und war bisweilen froh, wenn sich der Fuss zwischen zwei Steinen festklemmte, obwohl ich ihn beim nächsten Schritt oft nur mit Mühe wieder befreien konnte. Vorsichtshalber gingen ein Kajan vor und einer hinter mir, ich kam aber doch noch ohne ihre Hilfe hinüber. Drüben tröstete ich mich an dem Anblick, den Barth und Bier bei ihrem Durchzug boten.
Nachdem alles heil herübergebracht worden, konnten wir endlich weiter ziehen, waren aber doch froh, als wir nach einer Stunde eine Gruppe Hütten erreichten, in welchen unsere Leute früher übernachtet hatten. Ich beschloss, es für den ersten Tag genug sein zu lassen und sah mit Vergnügen, dass Demmeni sich gut gehalten und auch kein Fieber bekommen hatte.
Am folgenden Morgen wollte ich mit Bier und den notwendigsten Trägern vorausgehen, um noch den Lagerplatz mit unserem Gepäck an der Wasserscheide zu erreichen; die Kajan meinten jedoch, dies sei unmöglich. Erst regnete es und, als es etwas trockener wurde, schienen nur wenige Lust zu einem Eilmarsch zu verspüren. Ich hatte aber Jung als Oberhaupt der Träger und als Führer gewählt und mit seiner Hilfe brachte ich die Leute in Bewegung. So machte ich mich denn mit Bier, 4 Malaien, unter denen auch mein Diener Midan war, und 6 Kajan auf den Weg.
Auf einem abscheulichen Pfade begegneten wir einigen unserer Träger, die sich auf eigene Hand aufgemacht hatten. Sie gaben uns eine Vorstellung davon, auf welche Weise schwer beladene Eingeborene [238] Wegstellen überwinden, die dem Europäer, auch unbelastet, der Schwierigkeiten genug bieten. Vor unserer letzten Lagerstätte hatte der Weg über einen Bergrücken geführt und war nicht besonders mühsam gewesen, jetzt aber lief er einen steilen Abhang aufwärts, mit dem sich ein Bergrücken, den wir seiner Höhe wegen nicht überschreiten konnten, zum Bungantal hin abdachte. Wäre der Abhang nicht bewachsen gewesen, wodurch der Ausblick auf den brausenden Strom in der Tiefe verdeckt wurde und man unwillkürlich ein Gefühl der Sicherheit erhielt, so hätten wir dem Pfade nicht folgen können. Man musste ständig auf und nieder klettern, unter überhängenden Felsen hindurch, um abgestürzte Baumstämme herum kriechen und hatte über dem gähnenden Abgrund nie mehr als ein paar Fuss Raum zur Verfügung. Auf derartigen Pfaden kommen den Eingeborenen ihre beweglichen, kräftigen Zehen, mit denen sie sich in dem weichen Boden festklammern, und ihr geschmeidiger Körper zu Gute. Sie legten auch nur bei solchen Spalten ihre Last ab, die entschieden zu schmal waren, um mitsamt der Packung hindurchzuschlüpfen. Nach kurzer Zeit sahen wir sämmtliche Träger hinter uns und hatten jetzt nur selbst darauf bedacht zu sein, uns durchzuschlagen. Den ganzen Morgen über behielt der Weg den gleichen Charakter und erst an der Mündung des Léja veränderte sich das Bild.
Hier lagen die verlassenen Hütten der Bungan Dajak unterhalb eines prachtvollen Wasserfalles, über den sie als Brücke einen Baumriesen hatten fallen lassen. Die zwei Felsen, die den Fall senkrecht zu beiden Seiten einschlossen, waren 25 m von einander entfernt und obwohl der hellgraue, glatte Stamm gewiss 40 in über dem brausenden Wasser lag, hatte man es für überflüssig gehalten, den Stamm mit einem Geländer zu versehen.
Die verlassenen Hütten machten die Wildheit und Einsamkeit der Umgebung doppelt fühlbar, und so eilten wir nach kurzer Rast von hier fort, den neuen Reisfeldern der Bungan zu, die nach Jung nicht mehr weit entfernt waren und uns eine freie Fläche bieten sollten.
Die Steilheit der Bergwand nahm allmählich ab und der Pfad längs dem Fluss wurde gangbarer. Wir passierten noch einen der mächtigen Wasserfälle, von denen wir bereits fünf an diesem Morgen begegnet waren, und dann lag plötzlich an der Mündung des Léja eine fast ebene Fläche vor uns, auf welcher die Bungan den Wald gefällt und Reisfelder angelegt hatten. [239]
Die freie Fläche und der warme, heitere Sonnenschein machten nach den vielen Tagen, die wir in den feuchtkalten Wäldern in der Tiefe der Talgründe zugebracht hatten, einen wahrhaft erquickenden Eindruck. Wie verlockend war es, sich am Waldesrande niederzulegen und sich in den Anblick des lieblichen Bildes zu versenken. Wir hatten aber einen noch zu weiten Weg zurückzulegen, um uns diesen Genuss gönnen zu können, und so wartete ich denn mit Jung, der allein meinem schnellen Schritt zu folgen im stande gewesen war, die Ankunft von Bier und den Trägern ab, um uns nach dem besten Pfad über diese Felder zu erkundigen.
Nach einigem Zögern behauptete einer der Kajan, dass wir längs des Flussufers am bequemsten weiter kommen würden, und sogleich machte ich mich auf den Weg. Der Mann hatte sicher nicht gewusst, was er sagen sollte; denn gerade dieser Teil der Felder war kaum zu überschreiten. Wie die Bahaustämme im allgemeinen, hatten auch die Bungan nur einen kleinen Teil des gefällten Holzes verbrennen können, aber, entweder aus Nachlässigkeit oder wegen zu grosser Feuchtigkeit, war auch viel kleines Holz, Zweige und niedere Sträucher, unverbrannt geblieben. Viele der gefallenen Baumriesen versperrten mit einem Wald halb verkohlter Äste den Weg, was bei anderen Stämmen nie vorkommt. Alle Bäume waren längs des Abhanges mit ihren Kronen zum Ufer hin gefallen, so dass wir über jene hinweg oder unter ihnen hindurch klettern mussten; die verkohlte Baumrinde erleichterte uns einigermassen die Arbeit. Lagen zu viel Bäume über einander oder waren die Stämme zu dick, so mussten wir uns durch ihr dichtes Gezweige hindurcharbeiten und noch dazu auf freiem Felde in der heissen Mittagssonne, nachdem wir wochen lang im kühlen Walde gelebt hatten. Der etwas vollblütige Bier kam daher ziemlich erschöpft auf der anderen Seite der Felder an und sehnte sich nach Ruhe und Erfrischung in einer Kajanhütte.
Leider fanden wir hier nichts anderes als Wasser und einen Baumstamm, um darauf zu sitzen, bis unsere Träger ankamen und einen verborgenen Vorrat Bataten hervorholten. Sogleich machten sie sich daran, die Bataten in einem Topf gar zu kochen, aber vor Hunger ass jeder von uns eine Knolle roh auf. Die Träger waren nicht minder ermüdet als wir, sie waren aber von den Hütten der Bungan an über dem Bergrücken hoch über der Ladang einem viel besseren Wege gefolgt. [240]
Obgleich es erst Mittag war, behaupteten die Leute doch, an dem Tage nicht mehr weiter zu können; augenscheinlich hatten sie überlegt, dass die folgenden von ihnen gebauten Hütten sehr hoch am Bĕtjai lagen und dass sie diese doch nicht mehr erreichen konnten. Auch die malaiischen Schutzsoldaten und mein Junge Midan, die alle an ihrem Gepäck zu tragen hatten, erklärten, vor Ermüdung nicht weiter gehen zu können.
Bei dem herrschenden Nahrungsmangel bedeutete aber ein Aufenthalt ein Aufgeben der ganzen topographischen Aufnahme und so musste ich denn trotz allem versuchen, mit Bier weiter zu kommen. Dieser war zwar sehr ermüdet, wollte aber, als erprobter Topograph und weil es sich um sein Amt handelte, doch nicht zurückbleiben. Jung war, wie immer, zu allem bereit und nahm die topographischen Instrumente, den Theodolit und die kleinen Massstäbe auf seine Rechnung; sein Bruder belud sich mit meinem Bettzeug und einem Dreifuss, und zwei andere kräftige junge Leute trugen das Bettzeug von Bier und die notwendigsten Nahrungsmittel, und so machten wir sechs uns auf den Weg.
Als man uns im letzten Augenblick noch einige heisse Bataten zu verspeisen gab, wurden in der Ferne die ersten schwer beladenen Träger sichtbar. Ich fürchtete jedoch, sie könnten meine Getreuen wankend machen, brach daher eiligst auf und begann mit steifen Beinen weiter zu marschieren. Zum Glück wanderten wir jetzt längs des Léja durch ein Längstal, das zwar nicht so wild romantisch war wie das Quertal des Bungan, dafür aber viel breiter und ebener; auch folgten wir einem für diese Gegenden guten Pfade.
Das Strauchwerk benahm uns nicht gänzlich das Sonnenlicht, daher konnten wir uns in unseren nassen Kleidern, in denen es uns während der Rast gefröstelt hatte, etwas erwärmen. Nach 3/4 Stunden verliess der Pfad den Léja und führte uns dessen Nebenfluss, den Bĕtjai, aufwärts, der uns in östlicher Richtung direkt zur Wasserscheide bringen sollte. Der Pfad lief hier wieder durch den Wald, verursachte uns aber keine Schwierigkeiten, nur mussten wir öfters die Uferseiten wechseln und daher den nur 20 m breiten, wenig tiefen Fluss durchqueren; bisweilen wateten wir auch 100 m weit im Flussbette selbst. Das Wasser reichte zwar nur bis an die Kniee, war aber sehr kalt, so dass wir wiederum fröstelten; zudem war der Grund auch hier ganz mit glattem, rundem Geröll bedeckt und nötigte bei der heftigen Strömung [241] auch den mit einem Stocke versehenen zu vorsichtigem Gehen. Treu blieben unsere Wachthunde uns zur Seite; war das Wasser tief, so schwammen sie, war die Strömung zu heftig, so liefen sie am Ufer entlang. Auf solchen Expeditionen waren sie stets viel zu müde, um mit einander zu kämpfen, was sie sonst mit Vorliebe taten, auch wagten sie es, aus Furcht vor der neuen Umgebung, nicht, sich von uns zu entfernen.
Eine Stunde nach der anderen verging, während welcher wir im Wasser gegen Strömung und Geröll und auf dem Lande gegen Baumwurzeln und Felsblöcke ankämpften. Jeder Schritt verlangte so viel Aufmerksamkeit, dass wir für unsere Umgebung kein Auge hatten. Begreiflicher Weise wurde auch kein Wort unnütz gesprochen. Da wir über den noch zurückzulegenden Weg unsicher waren, begann unsere Lage gegen drei Uhr, unserer grossen Ermüdung wegen, kritisch zu werden. Indem ich mit Jung stets voran marschierte, schleppte ich die anderen mit; um ½ 4 Uhr musste ich jedoch Halt machen, da Bier vor Erschöpfung am Flussufer niedergefallen war. Er erklärte zwar, dass etwas Ruhe und Nahrung ihn bald wieder herstellen würden; aber es war mir doch eine grosse Beruhigung, als der hinterste Träger erklärte, die gesuchten Hütten seien ganz in der Nähe. Jungs Bruder brachte aus seinem Tragkorbe ke̥rtap zum Vorschein und reichte ihn mit Wasser dem Erschöpften als Magenstärkung. Nun merkten Jung und ich, dass auch wir eine Erfrischung sehr nötig hatten, setzten uns daher auf eine Sandbank im Flusse und teilten brüderlich den übrigen ke̥rtap. Die Rast gab auch mir den letzten Stoss; nur mit Mühe schleppte ich mich die 300 m bis zu den Hütten weiter und legte mich dort auf einer zum Lagerplatz für die Nacht bestimmten Bank nieder.
Auch jetzt wieder kam uns unsere Gewohnheit, zwischen unserer Matratze stets einen Reserveanzug einzupacken, sehr zu statten. Als wir unsere durch und durch nassen und von der Kletterei über halb verkohlte Baumstämme geschwärzten Kleider gegen trockene vertauschten, durchzog uns das erste Gefühl von Wohlbehagen. Die Kajan zündeten schnell ein Feuer an und kochten Wasser, das uns, mit etwas kondensierter Milch vermischt, einen herrlichen, heissen Trank lieferte. Bei unserer Übermüdung waren wir aber nicht im stande, von dem primitiv zubereiteten Reis etwas zu geniessen. So war es uns eine angenehme Überraschung, als einer der Kajan mit [242] einer unserer Konservenkisten ankam, die er ganz in der Nähe im Walde gefunden hatte. Einer der Träger musste die Kiste dort niedergelegt haben, statt sie, wie es seine Pflicht war, bis zu dem Proviantlager weiter oben zu bringen. Durch seine Nachlässigkeit waren wir nun in den Besitz verschiedener Konservenbüchsen gelangt, deren Inhalt auch bald unseren Appetit wieder belebte. Unsere Hunde waren jedoch so müde, dass sie die Reste, für sie aussergewöhnliche Leckerbissen, nicht einmal anrührten; sie waren nicht dazu zu bewegen, ihren Platz hinter unseren Klambu zu verlassen und schliefen jetzt friedlich neben einander, während sie sich für gewöhnlich immer den besten Platz streitig machten. Wir Europäer waren übrigens auch zu nichts mehr aufgelegt, gingen bei Sonnenuntergang schlafen und erwachten erst als es heller Tag war.
Nach der Aussage unserer Kajan war es bis zum Stapelplatz unseres Gepäckes nicht mehr weit, daher eilten wir auch nicht mit dem Aufbruch.
Gleich nachdem wir gespeist hatten, erschienen zu unserer grossen Verwunderung mein Diener Midan und einige Malaien. Sie hatten es nämlich doch nicht über sich gebracht, uns gänzlich im Stich zu lassen und waren uns, nachdem sie sich etwas erholt hatten, doch noch am vorigen Tage ohne die Kajan gefolgt. Bevor sie uns aber einholen konnten, war die Dunkelheit eingebrochen und sie hatten unter höchst mangelhafter Bedeckung die Nacht im Walde zubringen müssen. Sie hatten aber trotz ihrer Ermüdung aus Verdruss darüber, dass sie uns nun doch allein gelassen hatten, und aus Angst vor Kopfjägern nicht schlafen können, waren bei Morgendämmerung bereits aufgebrochen und daher so früh bei uns eingetroffen. Nun fingen wir gemeinsam die Wanderung durch den Fluss an und bereits nach zwei Stunden begegneten wir erst einem Hund, dann einem kleinen Knaben und schliesslich unserem Korporal Suka selbst, der sich eben auf den Fischfang begab. Der kleine Knabe war ein Bukat, dessen Familie mit uns zum Howong ziehen wollte. Der pater familias war mit Akam Igau bereits vorausgegangen, um ihm als Führer zu dienen und ihn bei den Pnihing von Amun Lirung einzuführen.
Es stellte sich heraus, dass aller Proviant, mit Ausnahme des Reises, gut angekommen war. Von den mehr als 50 Packen Reis, die ich vorausgesandt hatte, waren zum Glück 11 statt nur 6, wie man mir früher berichtet hatte, angekommen. Wir beschlossen nun, [243] hier auf die Ankunft unserer Träger zu warten und uns für diesen Tag Ruhe zu gönnen. Da unser Lagerplatz auf einer Höhe von 500 m lag und stark beschattet war, kam uns die Temperatur sehr niedrig vor; eine wollene Decke in unseren Klambu war daher sehr angenehm. Immerhin zeigte das Flusswasser noch eine Temperatur von + 20° C. [244]
Kapitel XII.
Auf der Wasserscheide zwischen Kapuri und Mahakam—Opfer der Kajan—Längs des Howong zu den Pnihing—Amun Lirung—Nahrungsmangel und Schwierigkeiten mit dem Transport des Gepäckes—Kwing Irang—Löhnung der Träger—Besuch bei den Bukat—Reise zu Bĕlarè—Einkauf von Böten am Tjĕhan—Fahrt zu Kwing Irang am Blu-u.
Im Laufe des Tages kamen genügend viele Träger an, um unser notwendigstes Gepäck über die Wasserscheide zu befördern. Sie brachten auch gute Nachrichten von Barth und Demmeni, die uns langsam folgten. Ich merkte bald, dass die Träger diesmal selbst Eile hatten mit dem Transport- die Bataten der Bungan und der eigene ke̥rtap ernährten sie nur kümmerlich, auch fürchteten sie das Schlimmste für die nächsten Tage.
Der zur Wasserscheide führende Bergrücken lief steil aufwärts, aber der Pfad schien viel benützt zu sein, denn er war nicht mit Rotang und Gestrüpp verwachsen. Auf halber Höhe hörten wir rechts von uns den Ruf eines hisit, was meinem Geleite und daher auch mir eine grosse Beruhigung gewährte, da wir nun das Mahakamgebiet unter günstigen Vorzeichen betraten. Etwas weiter aufwärts bemerkten wir Opferpfähle, die Akam Igau und seine Begleiter hier mit der Spitze zum Kapuasgebiet aufgerichtet hatten, um die bösen Geister zu verhindern, sie weiter an den Mahakam zu begleiten. Obwohl die Vegetation zu beiden Seiten des Bergrückens sehr üppig war, kamen doch ab und zu zwischen dem dichten Grün die benachbarten Berge zum Vorschein; rechts von uns tauchte der gesuchte Lĕkudjang auf. Zuletzt führte der Pfad wieder durch undurchdringlichen Wald, und bei der starken Steigung hatten wir auch nicht viel Lust, uns weiter Umzusehen.
Nach zwei Stunden veränderte sich das Bild gänzlich; wir zogen mitten über einen Morast, der nach Aussage der Träger auf der Höhe [245] der Wasserscheide selbst lag. Da unser Geleite hier ein Opfer zu bringen verpflichtet war, mussten wir Halt machen und unser Lager aufschlagen. Der Wind wehte aber auf dieser Passhöhe so heftig, dass ich es für geratener hielt, die Zelte ungefähr 50 m weiter unten, jenseits der Höhe, aufrichten zu lassen. Sehr einladend sah es auch dort nicht aus: in der engen Schlucht des Howong stiegen zu beiden Seiten dicht bewachsene, steile Wände auf und ein eisiger Wind blies durch die schmale Spalte. Infolge der vielen Regenfälle triefte die ganze Umgebung vor Nässe; um 6 Uhr morgens zeigte das Thermometer nur + 18.5° C und um 12 Uhr mittags + 21° C; einen schlechteren Lagerplatz hatten wir seit Jahren nicht gehabt.
Unsere Träger schlugen in aller Hast die Zelte auf und eilten dann wieder zum alten Lagerplatz zurück, um so schnell als möglich alles Gepäck auf die Mahakamseite zu schaffen. Nur einige Kajan blieben unter Obet Lata bei uns zurück, um uns bei der Besteigung des Lĕkudjang zu helfen, die wir sogleich vornehmen wollten. Wir hofften von diesem Berg aus einen Überblick über das Gebiet des Howong und Mahakam zu erhalten und auf der Wasserscheide einen geeigneten Punkt zu finden, von dem aus Bier seine Messungen beginnen konnte.
Einem schmalen Kamm auf der linken Seite des Morasts folgend gelangten wir zu einem Punkt, von dem aus einige spitze Gipfel im Kapuasgebiet sichtbar waren. Plötzlich war uns aber der Pfad durch eine steile Wand des Lĕkudjang abgeschlossen und wir mussten uns nach einer Stelle umsehen, von der aus der Aufstieg möglich war. Obgleich die Steigung durchschnittlich 40° betrug und wir uns auf einer Schutthalde befanden, boten uns doch die wilden Sagopalmen, die hier wuchsen, genügende Stützpunkte, so dass wir uns leidlich fortbewegen konnten. Erschwert wurde die Kletterei durch den Rotang, der uns mit seinen Dornen und Widerhaken auf alle erdenkliche Weise festhielt; auch wurde uns an dieser offenen, der Sonne ausgesetzten Bergwand die Hitze lästig. Nach zwei Stunden war an ein Weiterkommen nicht mehr zu denken; denn wir befanden uns vor einer senkrechten Wand, deren Höhe wir wegen der überhängenden grünen Massen nicht schätzen konnten. Umgehen konnten wir die Wand nicht, weil der Bergrücken, auf dem wir uns befanden, an beiden Seiten steil abfiel. Um nach Norden und Osten Aussicht zu gewinnen, liessen wir einige Bäumchen umhacken, deren Stämme zugleich als [246] Stützen für den Theodolit dienten, mit dem Bier einige Peilungen im Mahakamgebiet vornehmen wollte. Wir befanden uns auf 950 m Höhe, direkt gegenüber dem Ober-Kapuas-Kettengebirge, dessen zwei Erhebungen, Tipung und Dadjang, dicht vor uns lagen. Die Bergkette setzte sich, soweit wir sie nach Osten verfolgen konnten, im Gebiete des oberen Mahakam weiter fort und schien an Höhe immer mehr zuzunehmen. Der Mahakam hat sich in nord-östlicher Richtung in diese Kette sein Bett gegraben. Die zu beiden Seiten des Mahakamtales hinter einander aufsteigenden Bergrücken boten einen prachtvollen Anblick. Der Abstand war aber zu gross und die Luft zu undurchsichtig, um in dem Panorama irgend welche Einzelheiten wahrnehmen zu können. Der Howong schlängelte sich durch ein Hügelland, das in dem alles bedeckenden dunklen Grün hie und da hellere Töne zeigte, die von älteren und jüngeren Reisfeldern der Pnihing, welche hier seit langen Jahren wohnten, herrührten. Nach Westen und Süden benahm uns der Lĕkudjang jede Aussicht.
Auf dem Rückwege sahen wir uns nach einem Punkt um, von dem aus Bier auch einige Bergspitzen im Westen anvisieren konnte.
In unserem Lager angekommen fanden wir bereits einen grossen Teil unseres Gepäckes vor, aber Barth und Demmeni hielten sich immer noch im Lager am Bĕtjai auf, das sie nicht verlassen wollten, bevor alles Gepäck abgeholt worden war.

Wasserscheide zwischen Kapuas und Mahakam.
Tigang Aging, der sich in Akam Igaus Abwesenheit als Herr und Meister aufspielte, wollte bereits am anderen Tage den Geistern auf der Wasserscheide opfern (napo̱) lassen, aber bevor alle und alles im Lager beisammen waren, konnte davon keine Rede sein. So machten sich anderen Tages alle Träger und Malaien mit Tigang wieder auf den Weg zum alten Lager. Beinahe alle Männer brachten mit grosser Kraftanspannung an diesem Tage zwei Mal eine Fracht nach oben; trotzdem blieb aber immer noch ein Rest im Lager am Bĕtjai zurück. Da Demmeni sich von der Reise etwas ermüdet, im übrigen aber wohl fühlte, blieb er noch unten, während der Kontrolleur bei uns im Lager eintraf.
Trotz der grössten Sparsamkeit begann der Reismangel so fühlbar zu werden, dass wir abends berieten, was weiter zu tun sei. Dass Bier mit seiner Aufnahme begann, war dringend notwendig, daher wurden ihm drei Malaien und drei Kajan mit einer genügenden Menge Reis zugeteilt, um am folgenden Morgen die Messungen anfangen [247] und den Weg selbständig bis an den Mahakam fortsetzen zu können. Barth sollte mit Demmeni wiederum für den Gütertransport sorgen und ich mit den notwendigsten Trägern vorausgehen und bei Amun Lirung, dem Pnihinghäuptling weiter unten am Howong, Proviant und Hilfe für unsere Leute suchen.
Um den Rest unseres Gepäckes abholen und dann opfern zu können, hauptsächlich aber, um im Walde nach Nahrungsmitteln suchen zu lassen, musste ich noch einen Tag in unserem nasskalten Lager verbringen. Alle Männer, die nicht beim Tragen halfen, schickte ich in den Wald, um owur nanga (Palmkohl = junge Sprosse von Eugeisonia tristis) und wenn möglich auch Sago aus dem Stamm der Palme zu sammeln. Leider fanden die Leute zwar viel owur aber nur sehr wenig Sago, so dass der erste Hunger zwar gestillt wurde, eine kräftigere Nahrung aber immer noch fehlte.
Abends fand das Opferfest statt; alle kleideten sich etwas sorgfältiger als gewöhnlich an, legten sich ihr Schwert um und begaben sich mit einigen Eiern, die stets auf grösseren Expeditionen zu diesem Zwecke mitgenommen werden, auf die Wasserscheide; dort pflanzten sie Stöcke in den Boden, spalteten deren Spitzen in 4 Teile und klemmten die Eier als Opfergabe für die Geister der Wasserscheide hinein.
Da Tigang viel redete, aber mit seinen Leuten weniger gut als Jung, der selbst mitarbeitete, umzugehen verstand, teilte ich ihm mit, dass ich seine Hilfe bei Amun Lirung, dem Pnihinghäuptling, nötig hätte. Obgleich ihm der grosse Marsch nicht verlockend erschien, fühlte er sich in seiner Eitelkeit dadurch doch so geschmeichelt, dass er Jung gern sein Amt, die Überwachung des Gütertransportes, überliess, und so machten wir uns bereits früh Morgens mit 8 Mann und einem Bukat, Udjan, als Führer auf den Weg. Wie immer, ging ich, um mein Geleite zur Eile anzuspornen, voraus, schlug aber einen falschen Pfad ein, so dass die Träger bereits ein gutes Stück auf dem richtigen Wege weitergegangen waren, bevor ich mit Tigang mein Versehen bemerkte. Hoch über einem steilen Abhang holte ich die Träger ein. Die Eingeborenen nannten den Platz “labu aso”, d.h. Platz, an dem die Hunde stürzen. Ein halb verfaulter Baumstumpf wurde mir als Überrest eines Baumes gezeigt, auf den Georg Müller 1825 mit den Punan um die Wette geschossen hatte; seine Flinte hatte über ihre Blasrohre den Sieg davon getragen. [248]
Von dieser Stelle an fiel der Pfad so steil ab, dass man bis in das Tal hinunter mehr gleiten als gehen musste. Im Tal lagen grosse Mengen scharfkantigen Gesteins, das sich durch seine leuchtende Weisse lebhaft von der dunkelgrünen Umgebung abhob; es waren die Reste einer Goldmine, welche die Pnihing hier früher angelegt, jetzt aber verlassen hatten. Der Howong hatte so viel von diesem Gestein mitgeführt, dass es noch in einer Entfernung von vielen Kilometern im Flussbette Bänke bildete. Für unsere beschuhten Füsse war das Gehen auf den spitzen Steinen angenehmer als auf dem runden Geschiebe des Bĕtjai; unsere barfüssigen Träger dachten allerdings anders und waren froh, als wir weiter unten im Flussbett wieder die gewöhnlichen, runden Geröllsteine antrafen.
Bereits bei Beginn unserer Wanderung war unser Führer Udjan sehr schweigsam gewesen und hatte uns weder über den Weg noch über die Möglichkeit, noch am gleichen Tage die Niederlassung der Pnihing zu erreichen, viel mitgeteilt. Er hatte in den letzten Tagen an Fieber gelitten; jetzt blieb er ständig zurück und klagte über unseren schnellen Gang. Als er endlich merkte, dass Eile dringend notwendig war, raffte er sich auf. Mittags erreichten wir das Nebenflüsschen, das Udjan uns als geeigneten Platz zum Übernachten angegeben hatte; unter den gegenwärtigen Umständen konnte davon aber keine Rede sein. Zwar wartete ich hier alle meine zurückgebliebenen Träger ab, erklärte diesen aber sogleich, dass ich in der Hoffnung, das Pnihinghaus zu erreichen, bis zum Einbruch der Nacht den Marsch fortsetzen wolle; vom Lĕkudjang, aus gesehen, war mir nämlich der Abstand nicht sehr gross vorgekommen. Meine Erklärung wurde von allen, hauptsächlich von Tigang, mit verdrossener Miene aufgenommen Ich machte jedoch Tigang darauf aufmerksam, dass ihm jetzt, wo er mich zum ersten Mal begleitete, sein Ehrgefühl gebieten müsse, nicht zurückzubleiben. Das sah er auch ein und zeigte sich zum Weitergehen bereit. Noch einige Stunden ging es im Bette des Howong abwärts, dann trafen wir auf frühere Reisfelder, die wir, um grosse Windungen des Flusses abzuschneiden, durchquerten.
Gegen 3 Uhr erreichten wir die neuen Reisfelder der Pnihing. Die freie Aussicht, die wir hier wieder einmal genossen, und die Gewissheit, in der Nähe menschlicher Wohnungen zu sein, die wir seit 40 Tagen nicht gesehen hatten, belebten meine Kräfte. Um 4 Uhr befand ich mich endlich mit Udjan und einem Malaien vor dem eingekerbten [249] Baumstamm, der als Treppe zum hohen Pnihinghause hinaufführte; es kostete mich aber einige Mühe, meine erschlafften Glieder noch diese letzten 4 Meter hinaufzubefördern. Zwei Stunden darauf langten auch meine Träger an.
Das Haus erschien fast leer; auf der Galerie befanden sich nur eine alte Frau und ein Kind, die mit Erstaunen den ersten Weissen betrachteten, der sich bei ihnen zeigte. Amun Lirung (= Vater von Lirung) kam mir aber sogleich vor seiner Wohnung entgegen. Er schien sich bereits über die Begrüssungsform der Weissen unterrichtet zu haben, denn er reichte mir die Hand; auch erzählte er, dass beinahe niemand im Hause anwesend war, da fast alle Familien augenblicklich auf den Reisfeldern wohnten. Hierauf verschwand er eiligst in seiner Wohnung, aus der er sehr bald mit einer Sklavin und einigen Rotangmatten wieder zum Vorschein kam. Die Matten breitete er für mich und mein Gepäck auf dem Boden der Galerie aus. Nachdem wir uns niedergelassen hatten, begann die Unterhaltung. Mein Gastherr zeigte sich als lebhafte, gesprächige Natur, machte mir aber im übrigen einen so wenig vertrauenerweckenden Eindruck, dass ich mir die Geringschätzung, mit der die weiter unten am Flusse wohnenden Pnihing- und Kajanhäuptlinge mir auf meiner vorigen Reise von ihm gesprochen hatten, sehr wohl erklären konnte. Seine Frau Hinan Lirung ( = Mutter von Lirung) blieb vorläufig noch verborgen, ich suchte sie aber, auf Anraten Tigangs, später in ihrem Wohngemache auf. Sie empfand über unsere Ankunft weder Angst noch Unwillen, sondern schien ganz von den Vorbereitungen für unseren Empfang in Anspruch genommen zu sein. Bei meinem Eintritt kniete sie gerade vor einem grossen Topf mit Reis und Bataten. Sie hatte mit ihrer Fürsorge das Richtige für unseren Empfang getroffen und besass, wie ich später bemerkte, in der ganzen Häuptlingsfamilie am meisten Verstand, den sie auch in wichtigen Angelegenheiten des Stammes gut zu gebrauchen wusste. Meinem Diener übergab sie für mich eine Portion Reis und ein Ei und versprach auch etwas Früchte.
Als ich draussen auf der Galerie an die Aussenwand gelehnt in dem herrlichen Gefühl sass, wieder ein festes Dach über mir und einen trockenen, ebenen Boden unter mir zu haben, bemerkte ich einige Malaien, die von der Mahakamseite aus den Howong durchwateten und bald darauf vor uns erschienen. Sie erzählten, dass Kwing Irang, der Kajanhäuptling vom Blu-u, der mir bis an die Mündung des Howong [250] entgegen gereist war, sie auf Kundschaft zu Amun Lirung gesandt habe, um zu erfahren, ob wir bereits eingetroffen seien.
Akam Igau hatte seine Sendung, wie es sich zeigte, gewissenhaft erfüllt; er hatte sich zuerst zu dem wichtigsten Pnihinghäuptling, Bĕlarè, begeben, dann weiter flussabwärts Kwing Irang am Blu-u aufgesucht und war schliesslich noch weiter zu Bo Léa, dem Häuptling der Long-Glat, gegangen; alle drei Niederlassungen hatte er auf unsere Ankunft und unsere Absichten vorbereitet. Seine Aufforderung, uns baldmöglichst Hilfe zu senden, hatte grossen Eindruck gemacht, denn Kwing Irang war sogleich mit vielen Böten den Mahakam hinaufgefahren, unglücklicher Weise ohne vorher eine für längere Zeit ausreichende Menge Reis zu beschaffen. Sie hatten Tage lang mit Hochwasser kämpfen und jetzt sogar einen Tag warten müssen und wären, wenn ich nicht gekommen wäre, aus Reismangel wieder umgekehrt, was für unsere Expedition, bei der herrschenden Nahrungsnot, sehr verhängnisvoll hätte sein können. Die Malaien berichteten, dass nach Kwing Irangs Beispiel auch Bĕlarè und andere Pnihing mir entgegengefahren seien. Sehr beruhigend wirkte auf mich die Nachricht, dass sich die Batang-Lupar Banden auf Befehl des Radja von Sĕrawak aus dem Gebiet des oberen Mahakam zurückgezogen hatten. Halb ausgeruht und ermuntert durch die guten Nachrichten raffte ich mich nach Ankunft der Träger auf, nahm ein erfrischendes Bad und wechselte meine Kleidung.
Obgleich diese Niederlassung der Pnihing nur 20 Familien umfasste, die ihren Reisvorrat beinahe gänzlich verbraucht hatten, bewirtete Hinan Lirung meine Leute doch mit Reis und Bataten; ich selbst genoss zum Reis noch das Ei und würzte es mit dem Salz, das ich mitgenommen hatte und von dem ich meiner Wirtin sogleich als Gegengeschenk einen Teil anbot. Amun Lirung forderte mich auf, die Nacht sicherheitshalber in seiner amin zu verbringen und, sobald sich die Unruhe dort etwas gelegt hatte, verschwand ich in meinem Klambu.
Am 25. September erwachte ich mit dem angenehmen Bewusstsein, keinen Marsch mehr unternehmen zu müssen. Die Pnihing zogen dem Kontrolleur zu Hilfe und kehrten abends jeder mit einer schweren Kiste beladen zurück. An den folgenden Tagen konnte ich sie aber auch gegen gute Belohnung nicht dazu bewegen, den Zug zu wiederholen. Um Kwing Irang von unserem Tun und Lassen zu unterrichten, sandte ich ihm Tigang entgegen, der sich gleichzeitig auch nach einer [251] Gelegenheit, Reis für uns zu beschaffen, umsehen sollte. Tigang brach auch sogleich in Gesellschaft der malaiischen Kundschafter auf. Er musste, um Kwing Irangs Lagerplatz zu erreichen, zuerst das Flussbett des Howong ein Stück weit durchwaten und dann über Land zum Mahakam ziehen. Der Howong stürzt sich nämlich mit einer Reihe sehr steiler Fälle von ungefähr 120 m Höhe in den Mahakam und ist daher auf dieser Strecke nicht befahrbar. Da auch unser Gepäck auf jenem Wege zum Mahakam getragen werden musste, liess ich Kwing Irang bitten, mir seine Kajan zu Hilfe zu schicken.
In Anbetracht, dass durch die Höhe der Wasserfälle an der Mündung des Howong eine Verbindung mit dem Mahakam auch für Fische unmöglich gemacht oder doch sehr erschwert wurde, hielt ich eine gesonderte Sammlung der Fischarten von Haupt- und Nebenfluss zwecks späterer Vergleichung für wertvoll. Ich setzte daher für jede neue Fischart, die man mir brachte, eine Belohnung aus, wodurch unsere ichthyologische Sammlung mit 15 neuen Arten aus dem Howong bereichert wurde.
Tags darauf sandte mir Kwing Irang einige seiner Kajan, die mich als alte Bekannte sehr freudig begrüssten; sie erzählten, dass sie meiner Ankunft wegen ihr Saatfest aufgeschoben hatten und dass sie wegen Reismangel baldmöglichst in ihre Niederlassung zurückkehren mussten. Da auch Tigang nur einen einzigen Packen Reis hatte auftreiben können, schickte ich ihn am folgenden Tage mit einer reichlichen Menge Tauschartikel wieder aus, um zu versuchen, in einer Pnihingniederlassung am Pĕnaneh wenigstens Bataten aufzukaufen.
Gegen Mittag des folgenden Tages traf Kwing Irang in Gesellschaft des Pnihinghäuptlings Kaharon und einiger anderen mit 50 Trägern bei uns ein.
Es sei mir gestattet, Kwing Irang, der grössten und eigenartigsten Persönlichkeit, der ich im Innern Borneos begegnete, hier einige Worte zu widmen. Ist er es doch gewesen, der mir als Berater und Freund auf allen Reisen treu zur Seite stand und dessen Hilfe ich die guten Erfolge meiner Unternehmungen zum grossen Teil verdanke. Ich glaube den Leser am schnellsten mit diesem seltenen Manne bekannt machen zu können, indem ich ihm unsere erste charakteristische Begegnung schildere.
Als ich im Jahre 1896 zum ersten Mal die Mündung des Blu-u [252] erreichte, hatte Kwing Irang, der damals weiter oben am Fluss wohnte, ein malaiisches Haus zu meinem Empfange in Stand setzen lassen. Ich verbrachte die Nacht vor unserer Begegnung in unruhiger Erwartung, wusste ich doch aus den Berichten der anderen Stämme, dass das weitere Schicksal unserer Expedition von der Entscheidung des grossen Häuptlings des Mahakamgebietes abhing. Kwing Irang, der abends zuvor, nachdem wir uns bereits zur Ruhe begeben hatten, eingetroffen war, schien ebenfalls auf unsere Begegnung gespannt zu sein; wenigstens war ich noch nicht angekleidet, als er melden liess, dass er mich begrüssen wolle. Sogleich wurden zwei Klappstühlchen einander gegenübergestellt und bald darauf sah ich an dem nebenstehenden Hause eine Reihe Männer hinab- und an unserer Baumtreppe wieder hinaufsteigen. Der erste, dessen Haupt über dem Boden erschien, trug eine schwarze Mütze mit breitem Goldrande, unter der ein ältliches, mageres Gesicht mit eingefallenen Wangen, gerader Nase und kleinen Augen mit ruhigem, festem Blick zum Vorschein kam. Dem goldenen Abzeichen nach, das nur er trug, musste der Mann Kwing Irang sein, auch bestätigte mir die Sicherheit seines Auftretens im Gegensatz zu der Steifheit seines Gefolges, dass der grosse Häuptling in der Tat vor mir stand. Ich ging ihm einige Schritte entgegen, reichte ihm die Hand und forderte ihn auf, sich mir gegenüber auf Demmenis Stuhl zu setzen, was dein verschlossenen Eingeborenen einen Ausruf der Verwunderung entlockte. Augenscheinlich war ihm so etwas bei seinen Zusammenkünften mit dem Sultan von Kutei und dem Radja von Sĕrawak noch nicht vorgekommen, denn die Behandlung eines Stuhles war ihm so neu, dass er im Augenblick, wo er sich setzen wollte, umgefallen wäre, wenn ich ihn nicht rechtzeitig aufgefangen hätte. Der Unfall brachte ihn aber durchaus nicht aus der Fassung. Einige Minuten lang sassen wir einander schweigend gegenüber und lernten uns mit den Augen kennen. Was mich betraf, so war ich mit dem empfangenen Eindruck zufrieden und, wie er mir später gestand, ging es ihm ebenso.
Kwing Irangs Körper zeigte noch deutlichere Spuren des Alters als sein Gesicht; er schien ein Mann von 55 Jahren zu sein, mit feinem Körperbau, kräftigen Muskeln und geringer Neigung zur Wohlbeleibtheit. Seine Kleidung zeugte von Sorgfalt; ein Tuch aus blauem Kattun bedeckte in zahlreichen Windungen die Lenden und ein Schwert mit schönem Horngriff hing ihm an einem Rotanggürtel zur Seite. An [253] Schmucksachen trug er nur einige Halsketten und silberne Ringe von cm Durchmesser, die an seinen weit ausgereckten Ohrläppchen hingen und unter den offen herabfallenden Haaren hervorkamen. Von einer Tätowierung bemerkte ich keine Spur.
Das freie Auftreten, die sichere Haltung und der gutmütige Gesichtsausdruck Kwing Irangs flössten mir sogleich Vertrauen und die Hoffnung ein, dass wir einander verstehen würden. Die Vorteile, mit den Niederländern auf gutem Fuss zu stehen, leuchteten dem klugen Manne ein und so verständigten wir uns bald über meine weiteren Pläne. Nachdem der sachliche Teil erledigt war, begannen wir eine lebhafte Unterhaltung über allerhand Dinge. Ich zeigte dem Häuptling Bilder und Gewehre, von denen ihn besonders letztere interessierten. Über unserer ersten Begegnung schien ein besonderer Glückstern zu walten. Während ich nämlich Kwing Irang die Einrichtung eines Winchester Repetiergewehres sehen liess, ging plötzlich ein Schuss los, der keinen geringen Schrecken verursachte. Aber glücklicher Weise schlug die Kugel nur ein Loch in das Dach und, da keiner verletzt war, blieben alle auf ihren Plätzen. Ich hatte wiederum Gelegenheit, die grosse Besonnenheit meines neuen Freundes zu bewundern, der die beruhigenden Worte seines Geleites kaum nötig hatte. Ein rechtes Gespräch wollte jedoch nicht mehr in Gang kommen und so verabschiedeten sich unsere Besucher bald darauf.
Kwing Irang ist vor zwei Jahren, bald nachdem ich Borneo verlassen hatte, gestorben.
Der Tod dieses klugen, friedliebenden Mannes, der mit weitem Blick im Interesse seiner Untertanen auch mit ihm fremden Völkern Beziehungen anzuknüpfen sich nicht scheute, bedeutet für das Mahakamgebiet einen grossen Verlust.
Die Mahakam Kajan waren zwar gern bereit, unser Gepäck bis zum Mahakam zu tragen, sahen es aber als Aufgabe ihrer Mendalam Verwandten an, alles Gut, das sich noch beim Kontrolleur befand, bis zu Amun Lirung zu befördern. Die Mendalam Träger waren jedoch nach ihrer Ankunft im Pnihinghause nicht mehr dazu zu bewegen, auch noch den Rest der Sachen abzuholen, was ich ihnen in Anbetracht ihrer hungerigen Mägen nicht verdenken konnte. Gegen hohen Preis gelang es mir, unseren Ma-Suling Trägern noch etwas Reis zu verschaffen und den Kajan teilte ich mit, dass sie unterwegs Tigang [254] mit einem Vorrat Bataten begegnen würden. Diese Aussicht erschien so verlockend, dass sie fast alle wieder auf die Beine brachte. Abends kehrten sie mit dem Kontrolleur und Demmeni, die sich beide wohl befanden, zu uns zurück. Demmeni Wurde als alter Bekannter von den Mahakam Kajan freudig begrüsst; dem fremden Kontrolleur gegenüber trat aber die, ihnen eigene ängstliche Zurückhaltung wieder zu Tage.

Zwei aus verflochtenen und verwachsenen Lianen entstandene Bäume.
Gegen Abend kam Kaharon, um mit mir über die Lohnfrage zu beraten; er forderte für den Transport des Gepäckes an den Mahakam nicht weniger als 2.50 fl täglich für den Träger. Für alle Anstrengungen und Entbehrungen, welche die Leute diesmal auszustehen hatten, war der Preis nicht zu hoch, aber als Taggeld für später hätte die Erteilung eines solchen Lohnes Schwierigkeiten verursacht, besonders da den Pnihing Geld viel weniger bedeutete als Tauschartikel. Im Laufe des Gespräches merkte ich, dass Kaharon die Lohnfrage nur berührt hatte, um zu erfahren, ob ich die geleistete Hilfe überhaupt bezahlen wollte. Ich beeilte mich natürlich, ihm zu erklären, dass ich jeden, der mir zu Hilfe gekommen war, belohnen wollte.
Anderen Tages kam Tigang von seiner Forschungsreise nach Nahrungsmitteln zurück; seine Bataten war er unterwegs leider grösstenteils an seine hungerigen Dorfgenossen los geworden, er brachte aber noch einen Packen Reis und eine gute Menge bulung obe̱ ( = Mehl von Bataten) mit. Die Pnihing verstehen dieses Mehl ausgezeichnet zu bereiten, indem sie die Bataten in feine Scheiben schneiden, sie in der Sonne trocknen lassen und dann fein zerstampfen. Jedem Manne liess ich von dem Batatenmehl eine Portion zuteilen, und da auch unsere Wirtin noch von ihren bescheidenen Vorräten nach Kräften beisteuerte, genossen unsere wackeren Träger nach langer Zeit die erste gute Mahlzeit.
Wir hatten alle Ursache, mit unserem Empfang im Mahakamgebiet zufrieden zu sein; denn alle grossen Häuptlinge waren uns zu Hilfe geeilt, auch waren wir hier am Howong mit aussergewöhnlicher Selbstlosigkeit aufgenommen worden. In der ersten Zeit gab ich meinen Gastherren nämlich nichts anderes als etwas Salz und einige Kleinigkeiten, ausserdem erregte ich noch Hinan Lirungs Neid, indem ich Djulan, einem lieblichen Bukatmädchen, das mich unter dem Schutz von Tĕtuhè, einem unserer Punan vom Mendalam, öfters besuchte, etwas Tabak, hübsche Zeugstückchen und Ringe schenkte. Die Kleine [255] hatte sich anfangs nur schüchtern in der Ferne gezeigt, wurde nachher aber so zutraulich, dass sie später sogar allein zu mir zu kommen wagte. In Anbetracht der mit Furcht gemischten Missachtung, mit der die Bahau die nomadisierenden Bukat sowie alle Jägerstämme ansehen, stellte ich an Hinan Lirungs Nachsicht hohe Anforderungen; es lag mir aber daran, mit diesen scheuen Waldmenschen auf gutem Fuss zu stehen. Ich nahm mir jedoch vor, meine Gastwirtin beim Abschied für alle Güte und Toleranz zu entschädigen. Als praktische Frau gab mir die Alte übrigens bald zu verstehen, dass ihr ein Satz Armbänder aus Elfenbein, wie sie deren mehrere bei mir bemerkt hatte, am willkommensten wäre. Ihre eigenen Armbänder hatte sie nämlich, wie ich später hörte, dazu verwendet, den Reis einzukaufen, mit dem sie uns bewirtete. Um den Wert des Geschenkes zu erhöhen, zögerte ich anfangs mit der Erfüllung ihres Wunsches, liess sie dann aber das Mass angeben und suchte ihr einen besonders schönen Satz aus. Den vielen Besuchen nach zu urteilen, die mir Hinan Lirung im Laufe des Jahres am Blu-u machte, schien ihr unsere Bekanntschaft gut gefallen zu haben.
In der Nähe unseres Hauses hatten sich die Bukat, nach Art der Pnihing, drei kleine Häuser gebaut, die sie jetzt vorübergehend bewohnten. Ich hatte diese scheuen Kinder der Wildnis bis jetzt nicht besucht, um ihnen erst Zeit zu lassen, sich an unsere Gegenwart zu gewöhnen. Jetzt glaubte ich aber, mit Barth einen Besuch bei ihnen wagen zu dürfen.
Der Stamm der Bukat lebt in Gruppen von Familien für gewöhnlich in den Urwäldern des Quellgebietes der Flüsse Kapuas und Mahakam und hält sich, wie auch die anderen Nomadenstämme, bald in diesem bald in jenem Flusstal auf, je nachdem die Anwesenheit von Wild, Baumfrüchten und wildem Sago ein Verweilen wünschenswert erscheinen lassen. Selbst in dieser Wildnis dürfen sich die Bukat nicht willkürlich irgend einer Gegend bemächtigen, sondern ihre verschiedenen Familiengruppen sehen bestimmte Flussgebiete als ihr Eigentum an und lassen die anderen nur gegen eine Entschädigung dort jagen und Früchte sammeln. Die Bukat verbringen den grössten Teil des Jahres im Walde und kommen überhaupt nur ungern mit den sesshaften Stämmen am Kapuas und Mahakam in Berührung. Zur Zeit der Reisernte jedoch lassen sie sich vorübergehend bei dem einen oder anderen Stamme, wie z.B. jetzt am Howong, nieder, um Reis, [256] Zeug, Salz, Perlen und dergl. gegen ihre Waldprodukte einzutauschen. Die Bukat empfingen uns ängstlich, aber doch, nach Art der Bahau, freundlich, breiteten einige Rotangmatten für uns aus und setzten uns einige Waldfrüchte vor. Zu meinem Erstaunen entdeckte ich hier eine Frucht namens kapulasan, die in der Umgegend von Buitenzorg auf Java viel gebaut wird, deren Heimat dort jedoch nicht mehr bekannt ist. Aufmerksam geworden beobachtete ich später längs des ganzen oberen Mahakam das Vorkommen des Baums, der diese Frucht liefert. Zufälligerweise hatte unter den vielen herrlichen Waldfrüchten, die man mir auf der vorigen Reise brachte, gerade diese gefehlt. Zur grossen Genugtuung unserer Gastherren assen wir die saftreichen Früchte geradezu mit Gier, worauf sie von allerhand wichtigen Angelegenheiten, die ihnen auf dem Herzen lagen, zu reden begannen. Es handelte sich, wie so häufig bei diesen Leuten, wieder um Verletzung ihrer Ansprüche auf verschiedene Gebiete. So hatte man am Kapuas bei der Verteilung des Zehnten aus dem Ertrage der Buschprodukte ihre Häuptlinge übergangen, obwohl diese vor langen Jahren ebenfalls das Kapuasgebiet durchstreift hatten. Ihre hierauf begründeten Rechte hatten die Bukat jedoch am Kapuas nie geltend gemacht, so dass wir ihnen rieten, sich an den Kontrolleur von Putus Sibau zu wenden, zu dem sich in der gleichen Angelegenheit auch der ihnen verwandte Stamm der Bukat aus dem Gebiete des Gung begeben hatte. Hiermit kamen wir auf ein anderes Kapitel zu sprechen, auf Streitigkeiten zwischen diesen Gung Bukat und einem vornehmen Bukathäuptling, der sich augenblicklich bei den Pnihing am Sĕrata aufhielt. Diesem sollte nämlich infolge seiner Abstammung das Gebiet des Gung eigentlich gehören; in Putus Sibau konnte man natürlich auch von diesen Verhältnissen keine Ahnung haben. Der Punan Tĕtuhè, der uns begleitete, weil er selbst als Nomade mit diesen Bukat in Verbindung stand, übernahm es, bei seiner Rückkehr zum Kapuas alle diese Rechtsfragen zur Sprache zu bringen.
Während wir mitten in unserer Unterhaltung mit den Bukat begriffen waren, traf wieder eine Schar Träger mit dem auf dem Wege noch zurückgebliebenen Gepäck ein. Wir hatten des Morgens, in Anbetracht der starken Ermüdung und schlechten Ernährung unserer Leute, nicht durchzusetzen gewagt, dass sich alle energisch an der Arbeit beteiligten; so hatte sich denn auch nur ein Teil der Träger auf den Weg gemacht und die Malaien, die bei dem Rest des Gepäckes [257] als Wache zurückgeblieben waren, meldeten, dass sich immer noch 24 Blechkisten mit Salz im Walde befanden. Wir verliessen daher eiligst unsere neuen Bukatfreunde, um zu beraten, was weiter zu tun sei.
Um nur schnell fortzukommen, hatten viele Träger von Kwing Irang sich bereits von selbst mit unseren Kisten an den Mahakam aufgemacht. Kwing selbst jedoch wartete mit 20 jungen Kajan und einigen Pnihing auf unsere Befehle. Mit Amun Lirung, oder besser gesagt mit dessen Frau, kam ich überein, dass sie mir für 12 Packen schwarzen Kattuns zu 12 m Länge die 24 Kisten mit Salz an den Blu-u schaffen sollten. Zwar dauerte es einen ganzen Monat, bis sie mit ihrer Fracht bei mir am Blu-u anlangten, aber die Reisnot entschuldigte die Verspätung.
Aus Furcht vor einer Steigerung der Lasten und des Hungers hatten es unsere Träger mit dem Aufbruch zum Mahakam sehr eilig. Da ich aber nichts mehr von unserem Gepäck zurücklassen wollte, vereinbarte ich, dass unsere ermüdeten Mendalam Kajan unter Aufsicht von Barth und Demmeni alles Gepäck dem Howong entlang bis an den Pfad, der zum Mahakam führte, bringen sollten, während die frischeren und kräftigerer Mahakam Kajan es von dort über die Hügelrücken bis an den Anlegeplatz der Böte befördern sollten. Nicht minder froh als seine Leute war Kwing Irang über unsere Abreise; denn er hatte im Pnihinghause keinen Platz gefunden und mit den Seinigen in und unter einer Reisscheune übernachten müssen. Das Übernachten im Freien ohne Dach über dem Haupte finden die Bahau aber sehr unangenehm und, wenn es geregnet hätte, wären viele von ihnen krank geworden.
So verabschiedete ich mich denn von meinen Gastwirten und zog mit Kwing Irang an den Mahakam voraus. In unserem Eifer fortzukommen übersahen wir jedoch das winzige Nebenflüsschen des Howong, längs dessen wir zum Mahakam abbiegen mussten, und irrten einige Zeit umher, bevor wir es wiederfanden. Ich hatte in der letzten Zeit so viel an Märschen durch Wald und Flüsse genossen, dass ich unseren jetzigen Zug, besonders da mir die Hügelrücken, die uns vom Mahakam trennten, recht hoch vorkamen, sehr unangenehm empfand.
Auf einem dieser Hügel trafen wir Bier mit seinem Geleite; er hatte die ganze Zeit über mit gutem Resultat gearbeitet und es gelang ihm, seine Messungen bis zum Mahakam noch am gleichen Tage zu beenden. [258]
Die Pnihing hatten zwar den besten Anlegeplatz am Mahakam ausgesucht, dennoch mussten wir von der Höhe des Bergrückens einen sehr steilen Abhang hinunterklettern, um an das Flussbett zu gelangen. Hier fanden wir die Mahakamer auf einem Platze gelagert, der nirgends eben genug war, um ein Zelt aufschlagen zu können. Es mussten erst Terrassen aus Holz, die teilweise über das Wasser hinausragten, gebaut werden, um für unsere Zelte einen Untergrund zu beschaffen.
Inzwischen erneuerte ich die Bekanntschaft mit dem vornehmen Pnihinghäuptling Bĕlarè und feierte Wiedersehen mit Akam Igau.
Nach seinem guten Äusseren zu urteilen, das von dem unserer erschöpften und abgemagerten Kuli stark abstach, war es Akam Igau inzwischen am Mahakam gut ergangen, was er mir denn auch zugab. Bĕlarè erzählte, dass er mich nicht bei Amun Lirung begrüsst habe, weil er einen kleinen Enkel mit auf die Reise genommen hatte.
Es dauerte bis zum Mittag des folgenden Tages, bis unsere ganze Gesellschaft mit allem Hab und Gut am Ufer des Mahakam vereinigt war, und es erwies sich bald als unmöglich, mit allen und allem gleichzeitig den Mahakam hinabzufahren. Zwar hatten alle Niederlassungen der Kajan und Pnihing am Mahakam ihre grössten Böte zur Verfügung gestellt, aber wegen des hohen Wasserstandes durften sie nicht schwer beladen werden. Auf einen günstigeren Wasserstand zu warten, war bei der herrschenden Nahrungsnot unmöglich; und so musste ich mich dazu entschliessen, einen Teil unserer Leute vorläufig zurückzulassen. Ich teilte den Häuptlingen in einer Zusammenkunft meinen Plan mit, sie selbst hatten nicht gewagt, mir diesen Vorschlag zu machen. Alle zeigten sich einverstanden und versprachen, ihre Reisegenossen in einigen Tagen abzuholen. Die Zurückbleibenden sollten sich bei Amun Lirung, den Bukat oder im Walde die notwendige Nahrung zu verschaffen suchen.
Am anderen Morgen zeigte es sich, dass das Fassen und Ausführen von Beschlüssen für Bahauhäuptlinge sehr verschiedene Dinge sind; denn keiner von ihnen war im stande, einen Teil seiner Untertanen zum Zurückbleiben zu zwingen. Die Insubordination, die überall herrschte, veranlasste seltsame und komische Szenen.
Zwar begann man damit, mein Gepäck regelrecht in den Böten unterzubringen, kaum war dies aber geschehen, so ergriff jeder eiligst seinen Tragkorb, lud ihn auf den Rücken und sprang, zur Abfahrt [259] bereit, in ein Boot. So kam es, dass die Böte der Kajan und Pnihing, die vor unseren Hütten lagen, bevor wir sie noch betreten hatten, teils von der eigenen Mannschaft teils von Eindringlingen überfüllt waren. Ein Boot war sogar zum Sinken überladen, und doch wagte es die eigene Bemannung nicht, die Zuströmenden abzuweisen. Unterdessen standen die Häuptlinge rat- und machtlos am Ufer und in der Furcht, zurückbleiben zu müssen, mischte sich sogar einer von ihnen, seine Würde vergessend, unter die Schar der Bestürmer. Mit strenger Miene, drohendem Stock und ernsten Ermahnungen suchte ich nun allein die Ordnung aufrecht zu erhalten. Zuerst schickte ich die am Ufer stehenden zurück und entlastete dann die Böte von denjenigen, die zurückbleiben mussten. Aus jeder Mendalam Niederlassung nahm ich 8 Mann mit und dank dem sanften Charakter meiner Kajan gelang es mir, nur mit Einbusse der Hälfte meiner Stimme abzufahren.
Unterhalb einer Landzunge des anderen Ufers hatte sich Akam Igau mit seinen Leuten gelagert und bei unserer Ankunft bot sich dort ein noch heiterer Anblick.
In dem sehr grossen, breiten Boote des Pnihinghäuptlings Bĕlarè standen die Kajan Mann an Mann neben den Pnihing, ohne für den Häuptling selbst einen Platz frei zulassen. Dieser betrachtete mit seinem Enkel an der Hand vom Ufer aus gelassen die Bestürmung seines Fahrzeuges. Ich kam diesmal wirklich in Versuchung, von meinem Stocke Gebrauch zu machen; aber da mir eine derartige Einführung bei den Mahakamstämmen doch nicht geraten erschien, suchte ich schliesslich auch hier auf Kosten meiner Kehle die weisen Beschlüsse der Häuptlinge zur Ausführung zu bringen.
In Anbetracht des hohen Wasserstandes waren unsere Fahrzeuge auch jetzt noch sehr schwer beladen, aber bei der Umsicht der Pnihing und Mahakam Kajan und der Besorgnis ihrer Häuptlinge für unsere Sicherheit hatten wir nichts zu fürchten und fuhren schnell flussabwärts an den Mündungen des Kaso, Sĕrata und Tjĕhan vorüber bis vor das Haus des Häuptlings Bĕlarè.
Der Pnihinghäuptling wies uns Europäern und den Malaien als Wohnung ein alleinstehendes Haus an, das so hoch und auf so dünnen Pfählen gebaut war, dass mir angst und bange wurde beim Gedanken, dass 20 Menschen und alles Gepäck da hinauf geschafft werden sollten. Der Boden des Hauses befand sich 6 m über der Erde und die Pfähle waren nur 2 × 1.5 dm dick. Da meine Malaien [260] aber nichts gegen den Einzug in diesen Vogelbauer einzuwenden hatten, liess ich alles Gepäck nach oben bringen und erklomm zuletzt selbst die steile Leiter. Die Höhe unserer Behausung schützte uns wenigstens vor dem oft lästigen Besuch von kleinen Kindern und Hunden.

Haus des Pnihinghäuptlings Bĕlarè.
Jetzt, wo ich zum ersten Mal seit langer Zeit all unser Hab und Gut beisammen in einem geschlossenen Raum aufgestapelt sah, wurde es mir bewusst, wieviel Sorgen und Mühen diese hundert Packen und Kisten meinen Trägern auf den schwierigen Pfaden durch Wälder und Flüsse verursacht hatten, und die abgearbeiteten Gestalten meiner braunen Reisegenossen wurden mir dadurch um so lieber. Ich beeilte mich denn auch, meinen Mendalam Kajan so schnell als möglich Reis und Böte zu verschaffen, damit sie ihre zurückgebliebenen Stammesgenossen abholen konnten. Mit Geschenken und guten Worten gelang es mir bei den Pnihing, die Hälfte meiner Leute auszurüsten und sie am folgenden Tage flussaufwärts zu schicken. Die andere Hälfte begab sich mit Kwing Irang an den Blu-u, um sich dort verproviantieren zu lassen, und zwei Tage darauf fuhren auch sie an uns vorüber den Mahakam aufwärts. Die Häuptlinge hatten ihnen natürlich nicht ihre besten Böte zur Verfügung gestellt, aber es kamen doch alle unsere Kuli wohlbehalten bei uns an, so dass ich froh sein konnte, so viel Gepäck ohne Verlust oder Schaden an Menschenleben bis an den Mahakam gebracht zu haben.
Meine erste Aufgabe bei Bĕlarè bestand in der Löhnung aller, die mir geholfen hatten. Kwing Irang und seine Kajan wollten warten, bis ich zu ihnen zog, und begaben sich daher gleich weiter auf die Heimreise. In der Lohnfrage kamen zuerst die Pnihing aus den Niederlassungen am Tjĕhan und Long Kub in Betracht. Mein reicher Vorrat an Tauschartikeln erlaubte mir, ihre Dienste mit batik-Stoffen, weissem, rotem, und schwarzem Kattun und rotem Flanell reichlich zu bezahlen. Ihre Häuptlinge erhielten je eine hübsche Jacke oder ein seidenes Umschlagetuch. Meine Dankbarkeit für unsere wohlbehaltene Ankunft verleitete mich, den Leuten zu viel zu geben, mit Rücksicht auf künftige Lohnansprüche musste ich mich daher bereits am anderen Tage den Pnihing von Bĕlarè gegenüber mässigen. Diese erhielten nun zwar weniger, eine Handvoll Salz als Zugabe stellte aber jeden zufrieden, ausserdem hatten wir, da wir noch einige Tage bei ihnen bleiben sollten, Gelegenheit, ihren Frauen und Kindern mit allerhand beliebtem Tand wie: Fingerringen, bunter Wolle, Nadeln und Perlen [261] eine Freude zu bereiten. Ich hatte mich nämlich, hauptsächlich auf Anraten von Kwing Irang, dazu entschlossen, noch einige Tage Bĕlarès Gast zu bleiben, ein Beschluss, der nach den überstandenen Anstrengungen bei allen Beifall fand.
Einen weiteren Grund für diese Verlängerung unseres Besuches bei den Pnihing bildete für mich der Wunsch, mit diesem einflussreichen Häuptling und den Seinen gut zu stehen; denn nur so konnte ich den Hauptzweck meines Aufenthaltes am Mahakam, die Bevölkerung vom politischen Standpunkt aus zu studieren, erfüllen. Ich hatte mir nun zwar, wie auch bei meiner früheren Reise, vorgenommen, meinen festen Wohnplatz bei dem mächtigsten Mahakamhäuptling Kwing Irang aufzuschlagen; Bĕlarè war aber von alters her sehr neidisch auf dessen Stellung, und so riet mir jener selbst an, auch seinen Nebenbuhler mit einem längeren Besuch zu beehren. Inzwischen hatte Kwing auch Zeit, ein Haus für mich in Stand zu setzen und für meine Leute ein Unterkommen zu beschaffen.
Unser Besuch befriedigte nicht nur die Eitelkeit der Pnihing, sondern kam ihnen auch in praktischer Hinsicht sehr zu statten; denn meine ärztliche Hilfe war auch hier wieder sehr nötig. Gleich am ersten Tage wurde ich zu zahlreichen Malaria- und Lueskranken gerufen. Indem der Kontrolleur mich auf meinen Krankenbesuchen begleitete, hatte er Gelegenheit, sich in vielen Wohnungen vorzustellen, die er sonst, ohne indiskret zu sein, nicht hätte betreten dürfen. Meine Praxis gewann mir bald das früher bereits erworbene Vertrauen der Leute wieder zurück, so dass bald dieser, bald jener sich wieder in meine Hütte wagte, um gegen Reis oder Früchte etwas von meinen Artikeln zu erhandeln. Die einen lockten die anderen heran und bald kletterten die Besucher ununterbrochen auf der hohen Treppe in unsere mit Gepäck und Menschen ohnehin schon überfüllte Hütte hinauf.
Auch aus der Ferne brachte man mir Kranke. In einer weiter unten am Fluss gelegenen Niederlassung, Long Kub, hatte man Kwing Irang auf seiner Durchreise gebeten, dort zu übernachten, um den Häuptling Erang Parèn, der wie seine Schwester, Bĕlarès Frau, an periodischen Ausbrüchen von Wahnsinn litt, am folgenden Tage zu mir zu geleiten. So kamen die Häuptlinge denn auch mit grossem Gefolge bei mir an—leider ohne ein Resultat zu erzielen; denn es schien mir geratener, lieber sogleich meine Ohnmacht einzugestehen, als die Leute mit Scheinmitteln hinzuhalten oder ihnen Beruhigungs [262] mittel zu geben, die in den Händen dieser Menschen gefährlich hätten werden können.
Da Bĕlarè so viel daran gelegen war, als einer der vornehmsten Häuptlinge angesehen zu werden, war es mir sehr angenehm, dass ich sowohl ihm als Kwing Irang als Anerkennung für die Hilfe, die sie mir auf der vorigen Reise geleistet hatten, seitens der Regierung ein Geschenk anbieten konnte. Bĕlarè fand nun zwar den vergoldeten Silberbecher, den ich ihm überreichte, als Schaustück sehr schön, aber viel zu prunkend, um ihn täglich zu gebrauchen, und erbat sich daher von mir persönlich zum Alltagsgebrauch noch einen Satz Elfenbeinarmbänder, wie ich ihn Hinan Lirung geschenkt hatte. Überzeugt, dass mein wegen seiner Wildheit berüchtigter Freund nicht daran gewöhnt war, einen einmal geäusserten Wunsch fahren zu lassen, gab ich ihm nach, nahm mir aber vor, in Zukunft so sparsam als möglich mit meinen Tauschartikeln umzugehen.
Die Pnihing verlangten wohl unter dem Eindruck meiner grossen Vorräte für Böte, die ich jetzt anschaffen musste, so hohe Preise, dass Akam Igau mir riet, mich lieber an ihre Verwandten am Tjĕhan zu wenden, die an neuen Böten eine grosse Auswahl besassen. Meinem Gastherrn gefiel dieser Plan jedoch durchaus nicht, und ich hatte alle Mühe, ein kleines Boot mit 4 Ruderern zu erlangen, das mich mit Akam Igau und meinem Diener Midan an den weiter oben in den Mahakam mündenden Tjĕhan bringen sollte. Nach sechsstündiger Fahrt erreichten wir um 4 Uhr nachmittags das Haus der Pnihing, das am rechten Tjĕhanufer erbaut war; bei meinem ersten Besuch vor zwei Jahren war es noch nicht vollendet gewesen.
Trotzdem die Häuptlinge nicht zu Hause waren, begannen wir doch sogleich die vielen halb und ganz fertigen Böte zu besichtigen, und mit Akam Igaus Hilfe erwarb ich für schwarzen Kattun und Perlen sogleich zwei derselben. Zwei andere Böte, die ich gern erstanden hätte, gehörten dem Häuptling Parèn, der abends zurückkehren sollte; daher machte ich es mir inzwischen auf der grossen Galerie vor seiner Wohnung bequem. Reis einzukaufen, glückte mir nicht, da die Pnihing den Sĕputan am Kaso bereits viel verkauft hatten; einen besseren Erfolg hatte ich mit Batatenmehl.
Nach Parèns Ankunft wurde ich mit ihm wegen der Böte bald handelseinig; da er so viel von meinen schönen Tauschartikeln gehört hatte, sprach er den Wunsch aus, dass seine Frau Adjei und sein [263] kleiner Neffe Kwing mich zu Bĕlarè begleiten sollten, um sich als Lohn für die Böte unter allen Herrlichkeiten selbst etwas auswählen zu dürfen. Obwohl ich diesem Dorfe nur einen kurzen Besuch machte und seine Männer für ihre Dienstleistungen von meiner mildtätigen Stimmung bei der Ausbezahlung des Lohnes am meisten Vorteil gehabt hatten, wollte ich doch auch bei den übrigen Bewohnern eine gute Erinnerung hinterlassen und forderte daher Frauen und Kinder auf, mich am folgenden Morgen vor meiner Abreise zu besuchen, um sich kleine Geschenke abzuholen. Trotz unserer früheren Bekanntschaft wagten sich anfangs doch nur wenige in meine Nähe, kaum hatten diese aber jeder einen Ring mit bunten Glassteinen erhaltet), als die Besucher in hellen Haufen aus allen Türen zum Vorschein kamen. Die Frauen waren auf diese wertlosen Ringe ganz versessen. Als ich auf meiner vorigen Reise in der Zeit der Reisnot nirgends mehr Reis auftreiben konnte, verkauften mir diese Frauen ihren letzten Vorrat für diese Fingerringe.
Gegen 10 Uhr morgens fuhren wir mit vier neuen Böten und einem fünften mit Adjei und Kwing ab. Bei Bĕlarè angekommen fiel es meinen Gästen, Adjei und Kwing, sehr schwer, unter allen Tauschartikeln eine Wahl zu treffen. Endlich gaben sie sich mit einer hübschen Jacke, einem Sarong aus batik und einigen Perlen zufrieden.
Demmeni hatte seine Zeit inzwischen auf andere Weise gut verwendet; durch allerhand Gaukelspiel, durch Explodierenlassen von Magnesiumpulver und Verbrennen von Magnesiumband hatte er die Pnihing in so gute Stimmung versetzt, dass der Kontrolleur es für wünschenswert hielt, mit ihm noch einige Zeit zu bleiben. Da auch Bĕlarè diese Gäste gern behalten wollte, beschloss ich, allein zu Kwing Irang an den Blu-u zu ziehen, um dort alles für einen längeren Aufenthalt vorzubereiten.
Als Bĕlarè abends mit einigen der vornehmsten Familienväter zu einem Plauderstündchen zu mir kam, brachte ich das Gespräch auf einen Zug zur Mahakamquelle. Ich hatte nämlich bereits 1896 Bĕlarè, der auf seinen Jagden und zahlreichen Expeditionen nach Sĕrawak diesen Teil des Mahakamgebietes gut kennen gelernt hatte, zu diesem Unternehmen zu bereden versucht. Die grosse Reisnot verhinderte uns aber damals an der Ausführung des Planes. Bĕlarè zeigte sich auch jetzt wiederum bereit, mich zu begleiten, verlangte aber für jeden seiner Leute einen und für sich selbst zwei Reichstaler (2½ fl.) als Tageslohn. [264] Da ich noch lange auf tagweise bezahlte Dienste der Bahau angewiesen war, konnte ich auf eine derartige Bedingung natürlich nicht eingehen und begann ihn, wie ich es früher mit Kaharon getan, auf das Unsinnige seiner Forderung aufmerksam zu machen. Auch die Pnihing zeigten sich logischen Beweisgründen zugänglich; denn als ich ihnen den hohen Wert eines Reichstalers begreiflich zu machen suchte und ihnen sagte, dass der Tageslohn in Sĕrawak und Kutei so viel niedriger sei, und dass auch meine Mahakam Kajan so viel weniger erhielten, musste auch Bĕlarè, allerdings ungern, zugeben, dass 1 fl. für den Tag bei eigener Beköstigung genügend sei.
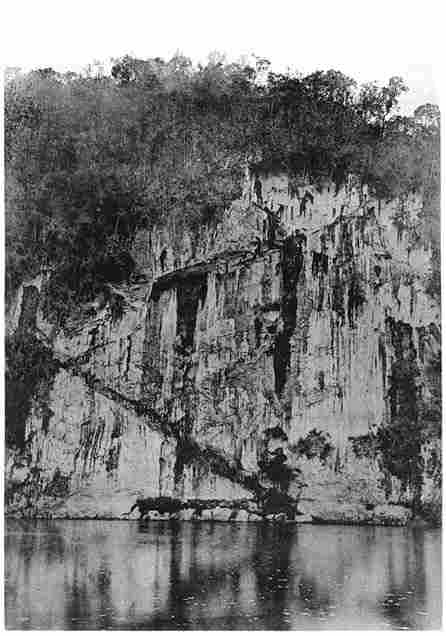
Massenkalk mit undeutlicher Schichtung.
Den Lohn für die Begleitung an den Blu-u setzte ich mit Bĕlarè gleichfalls im voraus fest; die Pnihing forderten ein Kopftuch und einige Glasperlen für den Mann. Auch versprach ich Bĕlarè, am folgenden Morgen vor unserer Abreise nach seiner Frau zu sehen, die bereits bei meinem ersten Besuch an Anfällen von Verfolgungswahnsinn litt und die ich schon damals für unheilbar erklärt hatte. Während meiner Abwesenheit hatten sich die Anfälle noch einige Mal wiederholt; die grosse, schlanke Frau erschien jetzt magerer und bleicher als je. Vor dem Eintritt eines Anfalls empfand sie Schwindel und einen sonderbaren Geruch in der Nase, dann stellten sich Kopfschmerzen, Blutandrang zum Kopf, glühende Wangen und rot unterlaufene Augen ein. Bald darauf glaubte sie sich von bösen Menschen und Geistern verfolgt, griff nach Schwertern und Speeren zur Verteidigung und wurde dadurch für ihre Umgebung gefährlich. Da man ausserdem noch fürchtete, dass sie sich in ihrer Angst ertränken könnte, mussten einige Männer bei ihr Wache halten. Die zarte Frau entwickelte während der Anfälle so viel Kraft, dass mehrere starke Männer sie nur mit Mühe bewältigen konnten. Nach derartigen Anfällen, die bis zu 8 Tagen dauerten, kam sie wieder zur Besinnung und nach einigen Tagen gedrückter Stimmung wurde sie ganz normal. Die Anfälle waren zum ersten Mal aufgetreten, nachdem die Batang-Lupar aus Sĕrawak im Jahre 1885 Bĕlarès Niederlassung verbrannt und viele Menschen getötet oder als Sklaven fortgeführt hatten. Dass dieser Umstand die Krankheit nicht verursacht, sondern eine erbliche Anlage nur zum Ausbruch hatte kommen lassen, ging daraus hervor, dass ihr Bruder, der Häuptling von Long Kub, ohne diesen Anlass an der gleichen Krankheit litt. Auch jetzt konnte ich leider nichts anderes tun, als die Leute trösten. [265]
Unterdessen hatten meine Begleiter gegessen, ihre grossen Böte unter dem Hause hervorgeholt, ins Wasser gelassen und ihr eigenes Gepäck in den Böten untergebracht. Ich machte von den starken Armen und frischen Kräften der Pnihing Gebrauch, um die meisten und schwersten Kisten sogleich von ihnen an den Blu-u mitnehmen zu lassen, der Rest sollte mit den übrigen Europäern nachkommen. Die meisten Malaien und Javaner zogen sogleich mit mir, um sich nach einer passenden Wohngelegenheit für sich umzusehen. Dass Bĕlarè und die Vornehmsten seines Stammes mir bis zum Blu-u das Geleite gaben, war ein Beweis dafür, wie sehr sie meinen Besuch und den verlängerten Aufenthalt des Kontrolleurs in ihrer Mitte zu schätzen wussten.
Die Fahrt ging bei dem hohen Wasserstande sehr schnell von statten, bereits nach zwei Stunden befanden wir uns an der Mündung des Blu-u. Die Ufer boten jetzt einen ganz anderen Anblick, als bei meiner Abreise im Frühling des vergangenen Jahres. Man hatte damals längs des rechten, 30 m hohen Ufers bereits zum dritten Mal alles Gestrüpp und Gras ausgerodet, um dort für den ganzen Stamm ein neues Haus zu bauen. Seitdem die Batang-Lupar ihre Niederlassung verbrannt hatten, lebten die Kajan nämlich zerstreut im ganzen Gebiet des Blu-u auf ihren Reisfeldern, auch hatte jede Familie im Laufe der Zeit bereits Pfähle und Planken zum Bau ihrer eigenen amin hergestellt und sie im Walde oder im Blu-u unter Wasser aufbewahrt. Schlechte Ernten, ungünstige Vorzeichen und die Angst vor den immer noch im Quellgebiet des Mahakam nach Guttapercha suchenden Batang-Lupar hatten den Hausbau ständig verzögert.
Während meines achtmonatlichen Aufenthaltes in ihrer Mitte (1896–97) hatten sich die Kajan, im Gefühl der Sicherheit wegen meiner Anwesenheit, mit neuem Mut an den Bau des Hauses gemacht und waren auch während meiner Abwesenheit in der Arbeit fortgefahren; denn jetzt standen eine lange Reihe amin auf dem hohen Ufer. Nur eine einzige Familie, zu der besonders viele arbeitsfähigen Männer gehörten, hatte ihre Wohnung völlig beendet, die übrigen wohnten noch in kleinen, aus alten Brettern gebauten Hütten rings umher und sollten erst später die letzte Hand an ihre amin legen. Kwing Irang hatte mit dem Bau seiner Wohnung überhaupt noch nicht anfangen können und wohnte augenblicklich mit seiner Familie und einigen Sklaven in einem sehr kleinen Hause, das wie die übrigen 3 In über dem Erdboden lag. Die meisten seiner Sklaven lebten mit ihren [266] Familien auf den Reisfeldern des Häuptlings, die sie zu bebauen hatten und um welche herum sie ihre eigenen kleinen Felder angelegt hatten.
Da Kwing Irangs provisorische Wohnung nur eine sehr kleine Galerie besass, hatte man zur Aufnahme von Gästen und zur Abhaltung von Versammlungen seinem Hause gegenüber an der anderen Seite eines freien Platzes ein längliches Gebäude aufgeführt. Diesen Versammlungssaal hatte man zur vorläufigen Unterkunft meines Personals und Gepäckes bestimmt, während man für uns Europäer an dieses Gebäude angelehnt a m über dem Boden ein festes Haus von 48 □ m Grundfläche errichtet hatte. Man hatte sich, gleich nachdem Akam Igau meine Ankunft gemeldet hatte, ans Werk gemacht und mir ein so gutes, starkes Haus gebaut, wie ich es bis dahin auf meinen Reisen noch nicht besessen hatte. Uns Europäern stand nun ein ausgezeichneter Wohnraum zur Verfügung, der nur als Zeichenatelier für Bier, als photographisches Atelier für Demmeni und als Arbeits- und Handelslokal für Barth und mich zu eng war. Doch konnte allen diesen Anforderungen später entsprochen werden; vorläufig musste ich für meine Malaien eine Unterkunft zu beschaffen suchen. Kwing Irang meinte, dass hierfür ein leer stehendes, am Fusse des Uferwalles gelegenes, malaiisches Haus am geeignetsten sein würde. Es hatte hier lange Zeit ein malaiischer Anführer einer Gesellschaft Buschproduktensucher, ein gewisser Hadji Umar, gewohnt, der sich augenblicklich unterhalb der Wasserfälle aufhielt. Das etwas baufällige Haus konnte schnell wieder hergestellt werden, indem der Wald Pfähle, der Häuptling Planken und meine Malaien die Arbeit lieferten. Die Lage des Hauses, weit ab von der eigentlichen Niederlassung der Kajan, war insofern günstig, als die Malaien, die für die Dajak nie Sympathie empfanden, hier ungestört wohnen konnten. Zwar war unser Geleite während der Nacht hier weit von uns entfernt, aber einige Männer konnten als Wache stets oben im Versammlungssaal schlafen.
Nachdem ich Bĕlarè und die Seinen belohnt und verabschiedet hatte, wandte ich mich an meine alten Kajan Bekanntschaften, die sich während der Anwesenheit der Pnihing in einiger Entfernung gehalten hatten. Ihrer Sitte gemäss, äusserte keiner der Kajan, bevor ich das Wort an ihn gerichtet hatte, seine Freude über meine Ankunft, dann aber war die Zunge plötzlich gelöst und ich wurde mit Fragen, wo ich die Zeit über gewesen sei, ob ich mich nicht verheiratet hätte u.s.w. über schüttet; leider begannen sie auch sogleich wieder um [267] allerhand Dinge zu betteln. Das Willkommgeschenk, das die meisten erwarteten, schob ich noch einen Tag hinaus.
An den beiden folgenden Tagen trafen in gesonderten Gruppen die Mendalam Träger bei uns ein: zuerst die Ma-Suling mit denen aus Pagong. Diese wollten sich den Mahakam abwärts zu ihren Verwandten am Mĕrasè begeben, sich 10 Tage bei ihnen ausruhen und dann wieder an den Kapuas zurückkehren. Obgleich sie bereits in Putus Sibau einen Vorschuss von ihrem Lohn erhalten hatten und es abgemacht war, dass sie den Rest bei ihrer Heimkehr dort vom Kontrolleur in Empfang nehmen sollten, baten sie mich doch wieder um Geld. Mit Rücksicht auf meinen beschränkten Geldvorrat und darauf, dass alle anderen wahrscheinlich mit den gleichen Forderungen herantreten würden, musste ich ihre Bitte abschlagen und gab jedem nur eine kleine Summe als Vorschuss; für den Rest gab ich ihnen einen Brief an den Kontrolleur von Putus Sibau mit. Der gleiche Auftritt spielte sich mit den Kajan aus Tandjong Karang und Tandjong Kuda ab, die sich, um Blutsverwandte zu besuchen und Handel zu treiben, nach anderen, weiter unten am Mahakam gelegenen Niederlassungen begaben. Nur den armen Punan, die wenig oder gar keine Tauschartikel besassen, händigte ich einen grösseren Betrag aus, damit sie unter Tĕtuhès Anführung bei ihren Verwandten am Sĕrata, wo sich bei den Pnihing eine grosse Bukat Niederlassung befand, keine allzu klägliche Rolle spielten.
Ferner besprach ich mit Kwing Irang, was ich seinen Untergebenen, die mir entgegengereist waren, geben sollte. Zu meiner angenehmen Überraschung schlug er mir vor, jeden auf die gleiche Weise mit einem Stück schwarzen und roten Kattuns zu belohnen; so hatte ich denn nicht mit dem persönlichen Geschmack der einzelnen zu streiten. Ein chinesischer Bankerottierer, Mi-Au-Tong, der aus Pontianak dein Kapuas entlang an den Mahakam geflüchtet war und jetzt bei den Kajan durch Handel mit Buschprodukten und Arzneien sein Leben fristete, half mir beim Messen des Zeuges. Die Abmachung mit dem Häuptling wurde von seinen Untergebenen natürlich wieder nicht für gut befunden; jeder verlangte noch eine Portion Salz dazu, die ich ihm gern gab.
Dem Häuptling selbst übergab ich im Namen der Regierung eine silberne Beteldose mit Zubehör, die ihn sehr zu beglücken schien. Seinen beiden Frauen hatte ich schöne seidene Tücher mitgebracht, [268] ausserdem liess ich sie von meinen geblümten Seidenstoffen selbst noch etwas auswählen. Kwing Irangs Pflegetochter Kehad erfreute ich mit einem Ohrschmuck, bestehend aus 20 Silberringen von 4 cm Durchmesser. Ich hatte in Batavia 1500 dieser Ringe anfertigen lassen; sie bildeten einen kostbaren und wenig umfangreichen Tauschartikel.
Der Satz Armbänder aus Elfenbein, den ich Hinan Lirung und Bĕlarè gegeben hatte, spukte auch Kwing Irang im Kopfe herum, und er ruhte nicht eher, bis ich auch den Arm seines 10 jährigen Söhnchens Hāng mit Elfenbeinringen geschmückt hatte. Alle Bahau besitzen die Eigenart, dass sie ihre Wünsche starrsinnig auf einen bestimmten Gegenstand richten und dass man sie dann mit Geschenken von viel grösserem Werte nicht entsprechend erfreuen kann. Es ist daher am einfachsten, sie ihre Wünsche stets vorher äussern zu lassen.

Unvollendete Niederlassung der Kajan an der Mündung des Blu-u.
Zu meiner grossen Beruhigung war es diesmal mit dem Reisvorrat der Kajan viel besser bestellt, als auf meiner vorigen Reise. Bereits in den ersten Tagen kamen Scharen von Mädchen und Knaben, um gegen kleine Mengen Reis Nadeln, Perlen u.a. einzutauschen, so dass ich einen ganzen Vorrat beisammen hatte, bevor Barth, Demmeni und Bier am 11. Oktober bei uns eintrafen. Kaharon begleitete die Gesellschaft, um mit mir noch einmal über die Expedition zum Quellgebiet des Mahakam zu reden, die nach Ablauf der mit der Reissaat verbundenen Verbotszeit, die jetzt bei den verschiedenen Stämmen eintrat, stattfinden sollte. [269]
Kapitel XIII.
Der Mahakam in seinem Ober- Mittel- und Unterlauf—Bewohner des Mahakamgebietes—Vorgeschichte der Stämme—Stellung und Einfluss der Fremden—Ursprüngliche Bewohner am oberen Mahakam—Vorherrschaft der Long-Glat—Kwing Irang und dessen Stellung unter den übrigen Häuptlingen—Verkehr und Handel unter den Stämmen—Selbständigkeit der Stämme—Verteilung der Ländergebiete—Bestimmungen in bezug auf Feld- und Waldfrüchte, Buschprodukte, Jagd und Fischfang—Industrie—Verkehr mit den Nachbarländern—Handel und Handelswege.
Der Mahakam (im Malaiischen; Mĕkám im Busang) ist von den Strömen Borneos, die sich an der Ostküste ins Meer ergiessen, der grösste. Er entspringt unter dem Namen Sĕlirong an der südwestlichen Seite des Batu Tibang, eines wahrscheinlich vulkanischen Berges, der sich in der Fortsetzung des Ober-Kapuas-Kettengebirges, das aus alten Schiefern besteht, erhebt. Der Mahakam folgt anfangs einem Längstal dieses Gebirges, aber bald nachdem sich der Sĕlirong mit dem Sĕliku, einem zweiten Quellflüsschen, das auf dem Lasan Tujan entspringt, auf 550 m Höhe vereinigt hat, bricht der Fluss in südwestlicher Richtung der Reihe nach durch alle Ketten des Gebirges hindurch. Bis zur Mündung des Howong, auf etwa 300 m Höhe, behält der Mahakam diese Richtung bei, wendet sich hier, in gleicher Entfernung von dem Batu Lĕsong, ungefähr gerade nach Osten und biegt dort, wo dieses Sandsteingebirge sich unter dem Namen Batu Ajo nach Süden fortsetzt, ebenfalls nach Süden. An der Biegung bei Long Tĕpai hat sich der Fluss durch die weissen Hornsteinschichten, auf denen das Sandsteingebirge liegt, nur ein schmales 15–40 m breites Bett erodieren können, während das Flussbett oberhalb Long Tĕpai an einigen Stellen eine Breite von 200 m erreicht.
An der Verengung bildet der Mahakam eine lange Reihe von Wasserfällen, die von oben nach unten folgende Namen tragen: Kiham (Wasserfall im Busang) Ulu, Kiham Hida, Kiham Nub, Kiham Lobang Kubang, Kiham Binju, Kiham Kĕnhè. Unterhalb dieser verengten [270] Stelle verbreitert sich das Flussbett über eine ausgedehnte Strecke, bis beim Kiham Udang der Fluss wiederum nur 30 m breit wird, während noch weiter unten, beim Kiham Halo auf 100 m Höhe, die Wassermassen sich über eine Entfernung von über 2000 m durch eine Verengung, die zwischen 20–50 m breit und zwischen Sandsteinbergen gelegen ist, hindurchzwängen. Obwohl noch eine Strecke weit von Hügeln beengt, erreicht der Fluss doch bald wieder die normale Breite und wird von Long Bagung an auch nicht mehr stark durch Berge verengt. Während daher der oberhalb Long Bagung gelegene Teil des Mahakam nur unter günstigen Verhältnissen für die eigenartigen Böte der Eingeborenen schiffbar ist, können bis zu dieser Stelle, ausser bei sehr niedrigem Wasserstande, kleine Dampfböte den Fluss hinauffahren. Bereits bei der Mündung des Mĕrah beträgt die Breite des Flusses 300 m und nimmt nach unten hin immer mehr zu. Nur bei Uma Mĕhăk Tĕbă, wo der Strom sich um eine Hügelreihe windet, wird er noch einmal 100 m breit, später jedoch nicht wieder. Erst dort, wo die südöstliche Richtung in eine östliche übergeht, jenseits des Gunung Sindáwar, wird das Land zu beiden Flussseiten zu einer alluvialen Tiefebene, auch erhebt es sich nicht hoch über dem Meeresspiegel. Das Land behält aber nicht den gleichen Charakter bis zur Mündung bei, denn die ganze Ostküste von Borneo wird nach Süden, bis zum Pasirfluss, durch eine Gebirgskette begrenzt. Durch diese Gebirgskette muss der Fluss sich hindurcharbeiten, bevor er sich in zahlreichen Mündungen ins Meer ergiessen kann.
Betrachten wir uns den Oberlauf des Mahakam näher, so zeigt es sich, dass er so lange die südwestliche Richtung beibehält, als er sich in der Fortsetzung des Ober-Kapuas-Kettengebirges befindet, beim Howong jedoch wird er gezwungen, sich nach Osten zu wenden, da er dort auf das vulkanische Gebiet stösst, dessen wichtigste Erhebungen der Lĕkudjan, Penaneh und Mĕnĕtokai sind, und auf die Sandsteinformation, in welcher nach Osten hin der Batu Lĕsong die Hauptkette bildet.
Von der Vereinigung des Sĕlirong und Sĕliku an bis zur Mündung des Howong fällt der Fluss in seinem sehr geraden Lauf von 550 auf 300 m über dem Meeresspiegel. Da das Quertal überall eng ist, behält der Mahakam in diesem Gebiet ganz den Charakter eines Bergstromes, der nur bei niedrigem Wasserstande befahrbar ist und in welchem grosse Wasserfälle, wie der Kiham Matandow (Sonnenfall), die Reise sehr gefahrvoll machen. [271]
Die Ufer bestehen, ausser auf kurzen, ebeneren Strecken, aus steilen Schieferwänden; im Flussbett selbst kommen nicht wie weiter unterhalb grosse Geschiebeablagerungen vor, die an den Ufern oder in der Mitte Geröllbänke bilden.
Da, wo der Fluss in der Richtung des Sandsteingebirges Batu Lĕsong im Süden und des Batu Apap Kaju Hun und Ong Dia im Norden nach Osten strömt, ändert sich sein Charakter. Bis Long Tĕpai kommen eigentliche Wasserfälle nicht vor, obgleich der Höhenunterschied zwischen Long Howong und Long Blu-u noch 100 m beträgt. Die grössten Hindernisse für eine Bootfahrt bilden auf dieser Strecke die Stromschnellen und die unterhalb der konvexen Uferseite gelegenen Geröllbänke. Der gewundene Lauf des Flusses zwischen Long Blu-u und Pahngè lässt bereits andere Verhältnisse vermuten. Von dem Gipfel des Batu Mili aus sieht man denn auch, dass sich das Flusstal nach Osten verbreitert; nur einige Hügel nähern sich den Ufern und am Horizont erscheinen die Berge Batu Niaan, Batu Boh und Batu Ajo. Auch eine Fahrt auf dem Flusse zeigt ein verändertes Bild; der Fluss hat hier sein Bett in seine alten Ablagerungen, viele Meter dicke Geröll- und Sandschichten, gegraben und zahlreiche kleine, bewachsene Geröllinseln erschweren die Fahrt auf dem Flusse.
Diese Flussablagerungen enthalten zahlreiche Schichten mit Pflanzenresten und haben ihr Entstehen dem Umstande zu danken, dass der Fall zwischen Blu-u und Tĕpai nur 20 m beträgt, während die grosse Enge des Bettes unterhalb Tĕpai durch Stauung bei Hochwasser auf die Stosskraft des Flusses sicher einen schwächenden Einfluss übt. Bei Lulu Njiwung ist die Anzahl kleiner Geröllinseln besonders gross. Unterhalb Long Tĕpai stösst der Mahakam auf das Bergmassiv, das nach Westen in den Pajang ausläuft; er windet sich hier durch zwei enge Täler nach Süden und bildet dabei zwei Reihen grosser Wasserfälle. Auf dieser Strecke ist der Fall des Flusses ein sehr bedeutender, er beträgt zwischen Long Tĕpai und Kiham Halo 80 m.
Nach der ersten, westlichen Reihe Wasserfälle folgt ein breiterer Teil des Flusses, an dem er den Bo aufnimmt, der, aus einem grossen Stromgebiet kommend, dem Mahakam ⅓ seiner Wassermenge zuführt.
Den verhältnismässig ruhigen Charakter dieser Strecke behält der Fluss bis Long Dĕho, wo bei Kiham Udang wiederum sehr enge Stellen folgen, [272] da der Fluss die mächtigen Konglomeratblöcke, die in seinem Bette liegen, nicht hat entfernen können. Der Kiham Udang wird gänzlich aus diesen Blöcken gebildet, welche von den Konglomeratschichten aus rundem Griess abgebröckelt sind, die zu beiden Uferseiten mit Sandsteinschichten abwechselnd eine Mächtigkeit von 10–30 m erreichen. Der weiche Sandstein wurde vom Flusse weggeführt, während die Konglomeratmassen liegen blieben. Dass derartige Verengungen auf den Strom einen grossen Einfluss ausüben können, ersieht man daraus, dass der Fluss bei Long Dĕho im Jahre 1897 in zwei Tagen 15 in stieg, in 3 Tagen aber wieder seinen normalen Stand erreichte.
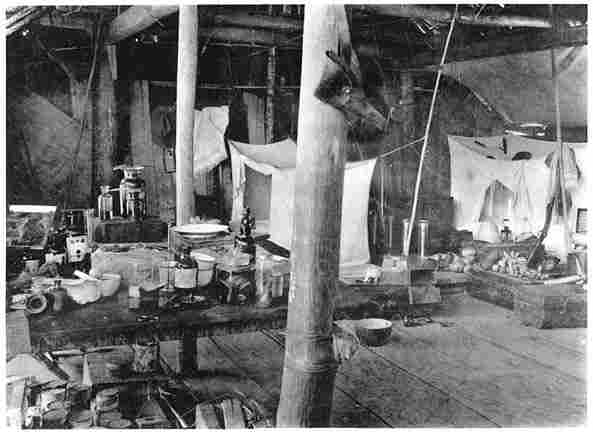
Unsere Wohnung in Long Blu-u.
Unterhalb Long Bagun hat der Fluss für seinen gewundenen Lauf eine breitere Ebene, die er sich selbst aus seinen Ablagerungen von Griess und Sand geschaffen hat, zu seiner Verfügung. Zwischen der Mündung des Mĕra und Ma Mĕhak Tĕba liegen besonders viele Inseln, die alle durch abgesetztes Geschiebe entstanden sind. Da Ana nur noch 50 m über dem Meeresspiegel liegt, ist der Fall des Flusses weiter unten nicht mehr bedeutend.
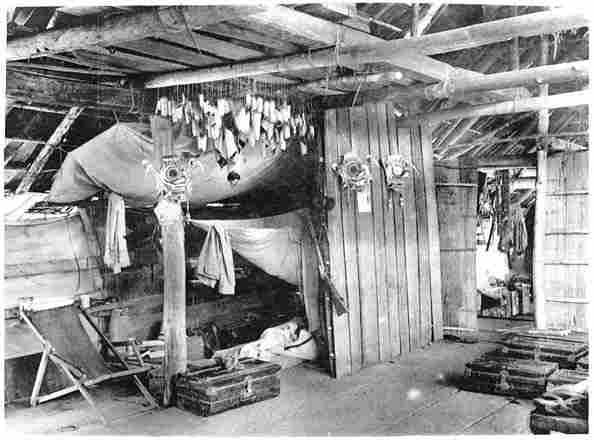
Unsere Wohnung in Long Blu-u.
Griessbänke kommen noch bis Ana vor, aber der Mahakam betritt erst bei Gunung Sindáwar die ausgedehnte Tiefebene von Kutei und erhält erst von hier an den Charakter eines Unterlaufs.
Das weite, gänzlich flache Gebiet nördlich und südlich vom Mahakam, das den grössten Teil des Binnenlandes von Kutei ausmacht, scheint in früherer Zeit ein grosses Wasserbecken gewesen zu sein, das durch den Mahakam und seine Nebenflüsse allmählich angefüllt und dann durch die Vegetation überwuchert worden ist. Als Überbleibsel dieses Beckens sind zu beiden Seiten des Flusses eigenartige Seeen zurückgeblieben. Diese tragen mit ihrer runden Form und grossen Oberfläche einen ganz anderen Charakter als die länglichen, gewundenen, kleinen Seeen, die in der “Wester-Afdeeling” zu beiden Seiten des Kapuas vorkommen und einen Teil des früheren Flussbettes darstellen. Obwohl ein Teil des Mahakam, vom Blu-u bis Long Pahngè, nach Auffassung von Professor Molengraaff, der Art seiner Geschiebeablagerung wegen nicht als Oberlauf betrachtet werden sollte, muss es doch aus praktischen Gründen zweckmässig genannt werden, den Teil des Mahakam ọberhalb Long Bagun als Oberlauf zu bezeichnen. Die ausgedehnten Geröll- und Griessablagerungen unterhalb dieses Ortes stempeln den folgenden Teil zum Mittellauf; während der Lauf des Flusses durch die Alluvialebene unterhalb [273] Gunung Sindāwar alle Eigentümlichkeiten eines Unterlaufs aufweist. Nur wird der Fluss an der Küste durch eine Hügelkette gezwungen, erst durch sie hindurch zu brechen, bevor er sein Delta bildet.
Dass die Bevölkerung am oberen Mahakam aus Bahaustämmen besteht, die alle in den letzten zwei Jahrhunderten aus dem hoch gelegenen Gebirgsland Apu Kajan ausgewandert sind, ist bereits an anderer Stelle berichtet worden.
In dem Quellgebiet des Mahakam trifft man bis zum Kiham Matandow nur unberührten Urwald, in dem einige kleine Gruppen von Bukat umherschweifen. Sie gehören dem Bukatstamme an, der in den Gebieten des oberen Kapuas, oberen Mahakam und Njangejan zu Hause ist. Da sie in jedem Jahr und zu jeder Jahreszeit ihren Aufenthaltsort wechseln, wissen selbst die ansässigen Bahau oft nicht genau, wo sie sich gerade befinden. Sie stehen mit den übrigen Nomadenstämmen, die sich unter dem gleichen Namen von Bukat oder Punan am Sĕrata, Boh und am Kapuas im Flussgebiet des Gung, Kréhau und Mendalam aufhalten, in Verbindung.
Vor dem Kriegszug der Dajak aus Sĕrawak im Jahre 1885 wurde das Flussgebiet des Mahakam, vom Kiham Matandow bis zum Sumwé, von verschiedenen Niederlassungen des Pnihingstammes bewohnt. Diese Niederlassungen wurden damals jedoch alle verwüstet mit dem Resultat, dass sämmtliche Bewohner den Hauptstrom abwärts zogen und sich in den ersten Jahren am Danum Parei östlich vom Kajangebiete niederliessen und später, ungefähr 1893 und 1894, zwei Wohnplätze im Gebiete der Kajan selbst gründeten, den einen an der Mündung des Sumwé unter dem Häuptling Bĕlarè, den anderen dicht daneben zu Long ’Kub, unter den Häuptlingen Erang Paren und Tingang Kohi. Nach dem Tode des ersteren liess sich letzterer im Jahre 1901 wieder oberhalb der Mündung des Kaso nieder.
Die Dörfer an den Nebenflüssen wurden von den Sĕrawakischen Dajak verschont, so z.B. dasjenige am Howong unter Amun Lirung und das am Penaneh unter Kaja, dem Bruder Amun Lirungs.
Die Bewohner des Hauses an der Mündung des Tjĕhan konnten noch, bevor ihr Haus verbrannt wurde, flussaufwärts flüchten und setzten sich weiter oben an der Mündung des Paketè fest, wo sie noch 1898 unter dem Häuptling Paren lebten. Seit der Zeit wohnen sie aber näher an der Mündung des Tjĕhan, um Vorbereitungen für den [274] Bau eines Hauses an der Mündung selbst zu treffen. Am Sĕrata, oberhalb der Wasserfälle, die hinter dessen Mündung liegen, war die Pnihingniederlassung unter Njangun Diu, in der auch viele Punan wohnten, von den Batang-Lupar verschont geblieben.
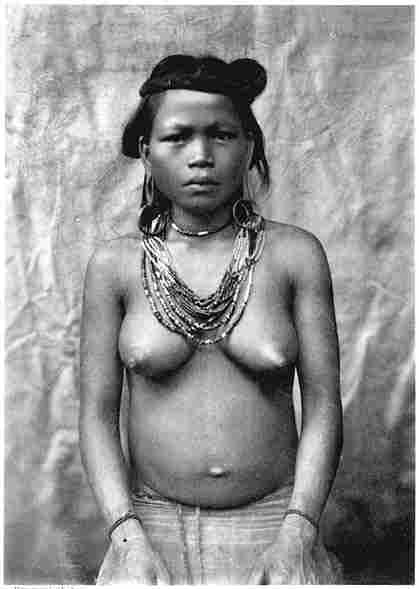
Kajanfrau vom oberen Mahakam.
Der Stamm der Seputan, der nicht zu den Pnihing zu gehören scheint, sondern in seiner Lebensweise mehr Übereinstimmung mit den Bungan Dajak zeigt, lebt im Gebiet des Kaso, teils hoch oben an diesem Flusse, teils am Penaneh.
Fährt man den Mahakam weiter abwärts, so gelangt man in das Gebiet der Kajan, die nach dem im Jahre 1901 erfolgten Tode ihres Häuptlings Kwing Irang unter dessen Neffen Bang Lawing stehen.
Der Stamm der Kajan beherrscht den zwischen dem Sumwé und dem Dini gelegenen Teil des Mahakamgebietes. Auch sein Haus, das sich früher unterhalb des Blu-u befand, wurde durch die Sĕrawakischen Dajak niedergebrannt, worauf sich die Bewohner zerstreut auf ihren Feldern im Gebiet des Blu-u niederliessen. Bei meiner Ankunft im Jahre 1898 bauten sie sich bereits eine neue Niederlassung auf dem hohen Mahakamufer an der Mündung des Blu-u. Im Lande der Kajan halten sich keine Punan auf.

Kajanfrau vom oberen Mahakam.
Östlich vom Dini beginnt das Gebiet der Long-Glat, eines Stammes, der sich gegenwärtig am Mahakam selbst festgesetzt hat und zwar in Lulu Njiwung unter Ding Ngow, in Batu Sala unter Paren Dalong und in Long Tĕpai unter Bo Lea, dessen Besitz an der Grenze des Njian endet. Mit Ausnahme des Mĕrasè, an dem die Ma-Suling leben, gehört das ganze Flussgebiet den Long-Glat. Auch hier kommen keine Punan oder Bukat vor.
Die Niederlassungen der Long-Glat unterscheiden sich insofern von denen der Pnihing, Kajan und Ma-Suling, dass in jeder derselben mehrere Stämme beieinander wohnen, die alle eigene Häuptlinge besitzen, welche dem Long-Glat-Häuptling gehorchen müssen. Diese Verhältnisse bestehen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, wo die Long-Glat am oberen Mahakam eine grosse Macht entwickelten und unter den zwei Häuptlingsbrüdern Bo Ibau und Bo Lĕdju Aja alle dort ansässigen Stämme unterwarfen. Die kleineren Stämme, wie die Ma-Tuwān, Ma-Tĕpai, Ma-Manok-Kwe und Batu-Pala wurden von ihnen gezwungen, mit ihnen zusammen zu wohnen, um ihre Anzahl zu vergrössern. Seit der Zeit teilten sich diese Stämme, sobald sich die Long-Glat teilten. Obwohl sie viel von den Long-Glat übernommen [275] und sich auch durch Heirat mit diesen vermischt haben, hat sich doch noch vieles aus der Zeit ihrer Selbständigkeit bei ihnen erhalten. Sie haben sich ihre Sprache, ihren Häuserbau und ihren Gottesdienst ein Jahrhundert lang bewahrt, auch besitzen einige Stämme eine eigene Art der Tätowierung. Jeder dieser Stämme wohnt in seinem eigenen, langen Hause neben dem der Long-Glat, so dass man in einem Dorfe, das vielleicht 1–2 Hektare umfasst, 3–4 bisweilen sehr verschiedene Sprachen reden hört, beim Ackerbau sehr verschiedene Zeremonien, Verbotszeiten und Vorzeichen beobachten sieht und, besonders bei den Frauen, verschiedene Arten der Tätowierung feststellen kann.
Allen Sprachen, die in einer Niederlassung gesprochen werden, die allgemeine Umgangssprache, das Busang, mit einbegriffen, liegt der gleiche Stamm zu Grunde. Dem Laute nach weichen diese Sprachen aber sehr von einander ab; das Long-Glat z.B. ist den anderen Stämmen so fremd, dass die Bahau etwas Unverständliches als “dahaun Long-Glat” = “Sprache der Long-Glat” bezeichnen. Im gegenseitigen Verkehr benützt man das Busang.
In Lulu Njiwung wohnen die Long-Glat jetzt mit den Ma-Tuwān und drei anderen, kleineren Stämmen zusammen; in Batu Sala leben die Long-Glat mit den Ma-Tuwān und Uma-Tĕpai; in Long Tĕpai leben ausser den 3 letzten auch noch Manok-Kwe und Batu-Pala.
Die Ma-Suling und die Ma-Pagong haben sich im Mĕrasègebiet in zwei Dörfern gemeinsam niedergelassen, bei Napo Liu (oberhalb der Insel) dicht bei der Flussmündung, und weiter oben in Lulu Sirāng. Diese beiden Dörfer waren früher Jahrzehnte lang vereinigt gewesen, aber im Jahre 1896 trennten sie sich derart, dass jetzt in beiden sowohl ein Haus der Ma-Suling als eines der Uma-Pagong steht. Die Niederlassung von Napo Litt regiert der Häuptling Lĕdju Li und die von Lulu Sirāng der Häuptling Bo Ngow. Am Mendalam und in den beiden Niederlassungen am Mĕrasè wohnen die Uma-Pagong mit den Ma-Suling zwar gemeinschaftlich, aber, so viel mir bekannt, in gegenseitiger Unabhängigkeit.
Nach ungefährer Schätzung beträgt die Seelenzahl bei den Sĕputan 500, den Pnihing 1500, den Kajan 800, den Ma-Suling mit den Uma-Pagong 1300, den Long-Glat 1600 und den Nomadenstämmen 400, so dass die Bevölkerung am oberen Mahakam oberhalb der Wasserfälle ungefähr 6000 Seelen stark sein muss.
Neben dieser eigentlichen Bevölkerung halten sich im Gebiet des [276] oberen Mahakam bei allen Stämmen, die ihnen Zuflucht gewähren, d.h. bei allen ausser den Pnihing, zahlreiche Fremde auf.
Diese sind hauptsächlich Malaien oder, besser gesagt, Mohammedaner verschiedener Blutmischung und Dajak aus anderen Gegenden, die sich hier vor allem mit dem Sammeln von Buschprodukten befassen. Unter den Malaien befinden sich viele, die ihr eigenes Land in der Nähe der Küste Verbrechen oder Schulden wegen verlassen und bei den Bahau Schutz gesucht haben. Die zahlreichen Arten Guttapercha und Rotang, die am oberen Mahakam zu finden sind, lockten mit der Zeit immer mehr Fremde heran. Besonders unter dein gutmütigen, rechtschaffenen Häuptling Kwing Irang erschienen viele malaiische Buschproduktensammler, die aus dem Gebiet des oberen Murung gebürtig waren; ihr Häuptling Temenggung Itjot, ein Nachkomme des von dem Krieg mit Bandjarmasin her bekannten Antassari, erhielt jedoch von den Kajan kein Niederlassungsrecht und durfte daher auch nicht mit einer Tochter aus der Häuptlingsfamilie in die Ehe treten. Itjot, der sich mit den Seinen verfeindet hatte, zog zu den Ma-Suling an den Mĕrasè, heiratete dort die Tochter eines vornehmen Häuptlings und lebte seit 1893 in der neuen Heimat. Es sammelten sich um ihn die Buschproduktensucher, von denen sich viele gleichfalls eine Frau unter den Ma-Suling wählten, und beuteten die Wälder am Mĕrasè aus, die sehr gross und reich an Buschprodukten waren. Nachdem sie die Wälder erschöpft hatten, zogen die meisten nach anderen Gegenden. Unter anderem suchten sie bei den Long-Glat in Long Tĕpai, Batu Sala und Lulu Njiwung Einfluss zu gewinnen, um sich in ihren Gebieten der Buschprodukte bemächtigen zu können; sie konnten aber, hauptsächlich beim Häuptling Bo Lea, ihre Raubpolitik nur mit grosser Vorsicht betreiben. Die meisten durften nicht einmal in einem Dorfe längere Zeit wohnen bleiben. Der energische Pnihinghäuptling Bĕlarè verstand diese für die Stämme gefährlichen Gäste sogar fast gänzlich fernzuhalten.
Der Wunsch der Häuptlinge, den Stamm nach. Möglichkeit zu vergrössern und das Ansehen, das sich die Fremden durch wirkliche oder vorgegebene Talente als Medizinmänner und Handwerker zu geben wissen, erleichtern den Fremden im allgemeinen die Aufnahme unter den Bahau.
Das Verhältnis zwischen Malaien und Dajak ist darin eigentümlich, dass einige Häuptlinge die Malaien gänzlich abzuwehren trachten, in [277] dessen sie bei anderen zu hohem Ansehen gelangen. Von Einfluss ist hierbei die grosse Bewunderung, die sie bei den jungen Mädchen erregen. Viele Malaien sind daher auch mit den vornehmsten oder schönsten Mädchen der Stämme, in denen sie sich gerade aufhalten, verheiratet. In der Regel lassen diese Männer ihre Frauen, sobald ihre Existenz mühsamer wird, einfach im Stich und ziehen zu anderen Stämmen oder in andere Gebiete. Das geschah u.a. bei den Ma-Suling, als der Guttapercha am Mĕrasè sein Ende erreichte.
Zu den Bahau, die aus dem Apu Kajan gebürtig sind, gehören zweifellos die Kajan, Ma-Suling und Long-Glat. Die Pnihing schreiben sich zwar gern den gleichen Ursprung zu, wahrscheinlich aber mit Unrecht. Erstens ist es gewiss, dass sie aus dem Gebiet des oberen Kapuas, wo noch ein kleiner Teil Pnihing wohnt, in das Tal des Mahakam gezogen sind und dass sie seit dieser Zeit ständig in dessen Quellgebiet gelebt haben. Zweitens haben die Pnihing einen viel kräftigeren Körperbau und andere Sitten als die übrigen Stämme am Mahakam. Sie können nicht, wie die Bahau, Schwerter schmieden und in Holz und Knochen schnitzen; ihre Männer und Frauen tätowieren sich nur wenig, unsystematisch, augenscheinlich als Nachahmung anderer Stämme; Kriegstänze, die unter den Bahau allgemein üblich sind, kennen sie nicht. Der Umstand, dass sie das Fleisch der Horntiere essen, was andere Stämme nicht tun, macht es mir besonders wahrscheinlich, dass sie eher zu den Kapuasstämmen als zu den Bahau gerechnet werden müssen. Ihre Sprache ist mir unbekannt.
Die Pnihing gehören vielleicht zu der Bevölkerung, die im Gebiet des Mahakam wohnte, bevor die Bahau hier eindrangen. Diese berichten, dass sie das Land von Stämmen eroberten, die Pin-Mĕtjai, Nè-Kiham, Pin-Buwat, Pin-Kunjong, Ten-Nean, Pĕra-Téran, Nè-Bĕrang und Pin-Bawan hiessen.
Alle diese Stämme flohen durch das Kasotal, teils nach dem Kapuas, teils nach dem Barito. Die Ot-Danum am Miri, einem Nebenfluss des Kahājan, werden noch mit Sicherheit als Nachkommen dieser Stämme bezeichnet. Zu ihnen begeben sich die Mahakambewohner auch vorzugsweise, um Köpfe zu jagen. Man schreibt diesen Urbewohnern alle Überreste aus früheren Zeiten zu, hauptsächlich die Steine mit Figurenzeichnungen am oberen Mahakam. Den einen, im Tjĕhan, suchten wir auf; ein zweiter liegt auf dem Abhang am Auer Kĕbalan unterhalb Long ’Kup und ein dritter im Fluss vor der Mündung [278] des Danum Parei; letzterer kommt nur bei niedrigem Wasserstande zum Vorschein.
Auch die steinernen Gerätschaften und Tempajan, die beim Fällen der mächtigen Wälder am Blu-u gefunden wurden, sind wahrscheinlich diesen Stämmen zuzuschreiben. Als lebende Beweise ihres Bestehens können die zahlreichen Sklaven der Mahakamstämme gelten, welche alle in den damals geführten Kriegen erbeutet wurden. Die Überlieferung ihrer Herkunft ist den Sklaven noch wohl bekannt und sie bleibt ihnen unter den Kajan auch bewusst, da diese ihre Sklaven in grösserer Abgeschiedenheit halten als die anderen Stämme. Sie fühlen sich grösstenteils noch fremd unter den Kajan, obwohl sie, mit Ausnahme einiger später geraubter Sklaven, alle im Stamme geboren sind, und folgen ihren eigenen Sitten, indem sie z.B. noch Hirsche und wilde Rinder essen.
Unter den Long-Glat sind die meisten Sklaven durch Heirat in den Stamm aufgenommen worden. Eine von dort gebürtige intelligente Sklavin, Uniang Pon, die viel gereist war, erzählte mir, dass man die Sklaven, ihrer grossen Anzahl wegen, unter die Stämme unterhalb der Wasserfälle verteilt hatte, da sie sonst den Bahau hätten gefährlich werden können.
Wie gross der Einfluss der Sklaven bisweilen gewesen ist, erkennt man daraus, dass die Kajan, die früher, nach eigener Angabe, Busang sprachen, sich jetzt des ke̥ho̱b Pin (Sprache der Pin) bedienen, eines Dialektes des Busang, der durch die Sklaven verändert worden ist.
Die Bahau zogen auf verschiedenen Wegen und zu verschiedenen Zeiten zum Mahakam, der sie, der Überlieferung nach, durch seinen grossen Fischreichtum angelockt haben soll.
Die Ma-Suling und Ma-Pagong zogen mit denjenigen, die jetzt am Mendalam wohnen, aus dem Apu Kajan zuerst zum Njangejan und teilten sich erst dort. Sie zogen teils zum Mendalam, teils zum Mahakam, wo ihnen das grosse Kalkgebirge, in dem sich der Batu Matjan, Batu Ulu und Batu Brok erheben, lange Zeit zum Wohnplatz diente. Auch die anderen Bahaustämme, die jetzt bei den Long-Glat leben, hielten sich ursprünglich dort auf. Die Batu-Pala haben ihren Namen noch vom Batu Pala, dem kleinen Kalkplateau am Mĕrasè in der Nähe des Batu Situn, von wo die Long-Glat sie zwangen, zum Mahakam herunterzuziehen.
Die Kajan dagegen kamen vom Apu Kajan längs dem Boh herab, [279] unter Anführung des Häuptlings Kwing Irang, der nach seinem Tode den Beinamen Singa Mĕlön erhielt. Sie fuhren den Mahakam hinauf, bis zu dem Lande, in dem sie jetzt noch wohnen. Seit der Zeit wurden sie von sechs Häuptlingen regiert, also dauert ihr dortiger Aufenthalt noch nicht länger als 150 Jahre. Gleichzeitig mit ihnen zogen noch viele andere des gleichen Stammes aus dem Apu Kajan fort. Nach ihrer Überlieferung hatten sie sich, um über einen Fluss zu gelangen, eine Brücke gebaut. Als die Vordersten das andere Ufer erreicht hatten, bemerkten sie einen Hirsch (pajo) und begannen: “pajo, pajo” zurufen. Die Hinteren verstanden jedoch: “ajo (Kopfjagd), ajo” und erschraken darüber so sehr, dass sie die Rotangtaue, an denen die Brücke befestigt war, durchschnitten, worauf diese in den Fluss fiel. Darauf kehrten sie für immer nach dem Apu Kajan zurück und liessen die anderen allein zum Mahakam ziehen.
Die Long-Glat wanderten aus dem Apu Kajan am Ende des 18. Jahrhunderts unter dem Häuptling Ding aus. Streitigkeiten mit anderen Stämmen zwangen sie zum Auszug; wahrscheinlich liegen allen anderen Auswanderungen die gleichen Ursachen zu Grunde.
Auch die Long-Glat folgten dem Boh, aber sie lebten längere Zeit an der Mündung (long) des Glat, nach dem sie auch ihren Namen tragen. Von hier aus zogen sie zum Mahakam hinunter und liessen sich an der Mündung des Njiān nieder, von wo sie durch eine Kriegsbande unter dem Häuptling Ding aus Long Howong, am mittleren Mahakam, vertrieben wurden. Eine Frau hatte hierzu die Veranlassung gegeben.
Darauf zogen die Long-Glat, unter Anführung der beiden Brüder Ibau und Lĕdju über die westlichen Wasserfälle bis dicht an die Mündung des Mĕrasè. Diese beiden Brüder waren als Söhne des früheren Häuptlings Ding noch im Apu Kajan geboren und spielten am oberen Mahakam viele Jahre hindurch eine grosse Rolle. Noch einmal mussten sie, wahrscheinlich infolge ihrer eigenen Übeltaten, bis zur Mündung des Sĕrata flüchten, wenigstens unternahm Lĕdju vom Sĕrata aus den grossen Kriegszug gegen die Turi (Taman), die am oberen Kapuas wohnten. Sämtliche Stämme mussten sich ihm ergeben. Er fuhr selbst den Kapuas bis Sĕmitau abwärts und verbrannte unterwegs alle Niederlassungen. Auch unternahm er grosse Züge nach dem Barito und oberen Kahájan, dem mittleren Mahakam und sogar nach dem Apu Kajan, wo er jedoch in der Nähe der [280] grossen Wasserfälle des Batu Plakau geschlagen wurde. Für alle dies: Kriegszüge beanspruchte er die Hilfe aller Stämme am oberen Mahakam, die ihm tributpflichtig waren oder die er gezwungen hatte, aus ihren Bergfestungen am oberen Sĕrata und oberen Mĕrasè hinunterzuziehen. Die Ma-Suling liessen sich damals am unteren Mĕrasè nieder, die Ma-Tuwan mussten mit den Long-Glat zusammenziehen, ebenso die Batu-Pala, die ein Jahr lang belagert werden mussten, bevor man ihr Haus verbrennen konnte. Dies war überhaupt die gebräuchliche Weise, um die Bewohner zum Auszug zu zwingen; bisweilen trug man ihnen vorher noch ihr Hab und Gut aus dem Hause.
So zwang z.B. Lĕdju seinen Bruder Ibau, der sich mit einem Teil des Stammes von ihm geschieden hatte und auf einem Kalkplateau bei der Mündung des Sumwé lebte, sich wieder mit ihm zu vereinigen. Die Kalkberge tragen noch jetzt den Namen Liang Totong (totong = brennen). Lĕdju trieb die Untertanen seines Bruders mit ihrer Habe aus dem Hause und verbrannte dieses. Seither wohnten sie gemeinsam in Lirung Bān, einer Ebene am Mahakam, in der Nähe der Mĕrasèmündung.
In damaliger Zeit waren auch die Kajan und Pnihing von den Long-Glat unterworfen und ihnen tributpflichtig gemacht worden. Die Tributpflichtigkeit muss darin bestanden haben, dass die Long-Glat das Recht hatten, sich an Böten und Vieh einige beliebige Stücke mitzunehmen. Wahrscheinlich stand aber dieses Recht nur den Häuptlingen zu. Noch gegenwärtig herrscht die Sitte, dass ein junger Pnihinghäuptling, sobald er zum ersten Mal eine Niederlassung der Long-Glat betritt, dem betreffenden Häuptling ein Geschenk, ein Boot, ein Fischnetz oder einen Gong mitbringt. Übrigens sind die Stämme, die nicht mit den Long-Glat zusammenwohnen, unabhängig. Die Kajan erkennen die Oberherrschaft der Long-Glat nicht mehr öffentlich an, da ihr vor kurzem verstorbener Häuptling Kwing Irang aus der Häuptlingsfamilie der Long-Glat stammte.
Die Macht der Long-Glat hat sich einerseits vermindert, weil ihr Charakter weniger kriegerisch geworden ist, anderseits, weil der Stamm nicht mehr beieinander blieb. Bereits Lĕdju zog, nachdem der ganze Mahakam oberhalb der Wasserfälle unterworfen war, mit der Hälfte des Stammes nach dem mittleren Mahakam, unterhalb der Wasserfälle. Er führte einen Teil der Ma-Tuwān, Uma-Wak, Batu-Pala und anderer Stämme mit sich und überliess Ibau die Herrschaft über den [281] oberen Mahakam. Der Auszug war durch die Heirat veranlasst worden, welche zwischen Lĕdju und der Tochter eines dort lebenden vornehmen Häuptlings, namens Owat, stattfand, und vielleicht auch durch Mangel an gutem Ackerboden für die zahlreichen Bahau und durch die Nähe der Küste, die ihnen Salz, Tabak und Leinwaren lieferte. Seine Nachkommen herrschten über alle Bahaustämme am mittleren Mahakam.
Im Jahre 1825 traf Georg Müller mit Lĕdju zusammen und wurde von ihm über die Wasserfälle geleitet und der Sorge seines Bruders Ibau anvertraut. In gleicher Weise verfuhr man später mit mir, bei meinem Zuge in der umgekehrten Richtung. Da in damaliger Zeit sowohl die Kajan als die Pnihing, die Müllers Geleite bildeten und ihn beim Gurung Bakang ermordeten, unter Ibaus Herrschaft standen, ist anzunehmen, dass der Mord auf dessen Befehl stattfand. Dass der Sultan von Kutei an dem Mord die Schuld trägt, ist unwahrscheinlich, weil die Bahau damals von Kutei gänzlich unabhängig waren.
Bemerkenswert ist, dass nur Müller ermordet wurde. Zwei seiner Soldaten erreichten den Kapuas, die übrigen wurden als Sklaven zum Mahakam zurückgeführt; keiner von diesen sah Java wieder. Ich erfuhr dies sowohl durch einen Augenzeugen, Adjang, den jüngsten Sohn von Lĕdju, als auch noch durch andere. Adjang, mit dem ich in Long Dĕho viel verkehrte, starb dort im Jahre 1900, im Alter von 90 Jahren.
Ibau war eine friedsame Natur und hatte einen Ruf als Schnitzkünstler. Er und sein Sohn Bo Kulè verstanden, die Long-Glat beisammen zu halten, aber nach des letzteren Tode war ein Teil des Stammes mit seinem Nachfolger Ngow Kulè unzufrieden und zog mit Bo Lea, einem Häuptling von niederer Geburt aber hohem Ansehen, weiter abwärts. Von den Manok-Kwe kamen sämtliche mit, weil Bo Lea mit der Tochter ihres Häuptlings verheiratet war. Gegenwärtig leben sie alle in Long Tĕpai. Auch Ngow Kulè blieb nicht an dem alten Ort Lirung Bān, wo der Stamm sich nach vielen Jahren wiederum ein Haus gebaut hatte, sondern liess sich in Lulu Njiwung nieder. Sein Sohn Ding Ngow, der sein Nachfolger geworden ist, lebt jetzt noch dort.
Trotzdem die Ma-Suling und Kajan jetzt von den Long-Glat unabhängig sind, besteht doch noch zwischen ihnen ein Band, nämlich die Häuptlinge, die alle entweder von der Häuptlingsfamilie der Long-Glat [282] abstammen oder mit Gliedern von ihr verheiratet sind. So heiratete Bo Edo, die Schwester von Bo Kulè, einen Kajanhäuptling Owat, dessen Söhne der Reihe nach über die Kajan regierten; der letzte war Kwing Irang.
Bo Edo hatte aus zweiter Ehe mit einem panjin einen Sohn Li, der mit der vornehmsten Ma-Suling Frau verheiratet war. Sein Sohn Lĕdju Li war in Napo Liu, einer der Niederlassungen der Ma-Suling am Mĕrasè, Häuptling. In Lulu Sirāng wiederum ist ein anderer Häuptling mit einer Schwester von Bo Lea verheiratet. Auch unter den Häuptlingen der Pnihing vom Tjĕhan, dem Sĕrata und von Long ’Kup giebt es verschiedene, die aus dem Geschlechte von Bo Kulè abstammen, so dass sich weitaus die meisten Häuptlinge am Mahakam oberhalb Tĕpu von derselben Familie herleiten.
Diese Familienbeziehungen haben zur Folge, dass bei einigen grossen Arbeiten, wie beim Bau von Häusern durch die Häuptlinge, alle Stämme am oberen Mahakam Hilfe leisten, indem sie einen schweren Pfahl aus Eisenholz liefern.
Dies geschah auch beim Bau des mächtigen Hauses von Kwing Irang. Jede Niederlassung lieh ihre Hilfe, ausser Lulu Njiwung, dessen junger Häuptling, Ding Ngow, sich zu hoch achtete, um seine Hilfe anzubieten, weil er in direkter, männlicher Linie von Ibau abstammte. Wegen der Eigenart der Bahau, das Ansehen eines Stammes auch von den persönlichen Eigenschaften und vom Alter seines Häuptlings abhängen zu lassen, stand Kwing Irang, als Häuptling der Kajan, höher als sein junger Neffe in Lulu Njiwung und alle übrigen Häuptlinge. Vor diesen hatte er ausserdem voraus, dass sowohl sein Vater als seine Mutter aus Häuptlingsfamilien abstammten, ferner war er der älteste seines Geschlechtes und ein Mann nach dem Sinn der Bahau. Im Vergleich mit seiner Umgebung zeichnete er sich durch Friedensliebe aus, so dass unter seiner Regierung bei den Kajan nur noch selten Kopfjägerei geübt wurde; jedem gegenüber war er gerecht und selbstlos, nur war er ein Feind von energischen Massregeln. Obwohl einige andere, wie Bĕlarè bei den Pnihing und Bo Lea bei den Long-Glat, viel mehr Energie zeigten, erkannten sie doch mit den anderen Häuptlingen Kwing Irang als den Höchststehenden oberhalb der Wasserfälle an. Diese Oberherrschaft bezog sich tatsächlich aber nur auf allgemeine Interessen, wie Unterhandlungen mit Sĕrawak und den benachbarten Ländern, auch genoss er das Vorrecht, [284] für die hohen Bussen aufkommen zu müssen, die von diesen Ländern aus wegen erbeuteter Köpfe auferlegt wurden. [283]
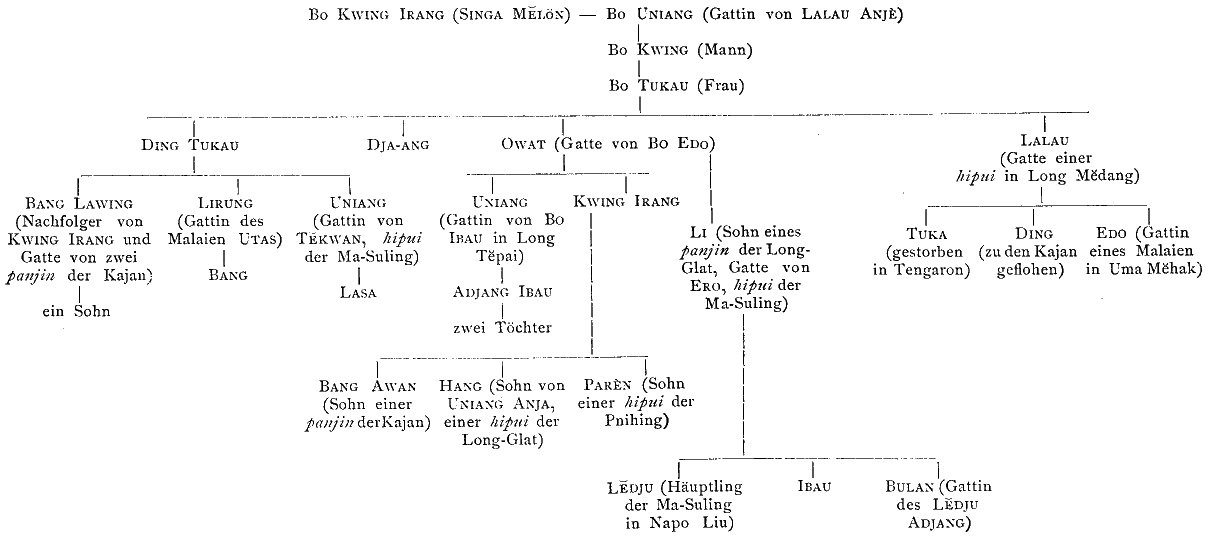
Stammbaum der hipui bei den Mahakam Kajan.
Bo Kwing Irang (Singa Mĕlön)—Bo Uniang (Gattin von Lalau Anjè) Bo Kwing (Mann) Bo Tukau (Frau) Ding Tukau Bang Lawing (Nachfolger von Kwing Irang und Gatte von zwei panjin der Kajan) ein Sohn Lirung (Gattin des Malaien Utas) Bang Uniang (Gattin von Tĕkwan, hipui der Ma-Suling) Lasa Dja-Ang Owat (Gatte von Bo Edo) Uniang (Gattin von Bo Ibau in Long Tĕpai) Adjang Ibau zwei Töchter Kwing Irang Bang Awan (Sohn einer panjin der Kajan) Hang (Sohn von Uniang Anja, einer hipui der Long-Glat) Perèn (Sohn einer hipui der Pnihing) Li (Sohn eines panjin der Long-Glat, Gatte von Ero, hipui der Ma-Suling) Lĕdju (Häuptling der Ma-Suling in Napo Liu) Ibau Bulan (Gattin des Lĕdju Adjang) Lalau (Gatte einer hipui in Long Mĕdang) Tuka (gestorben in Tengaron) Ding (zu den Kajan geflohen) Edo (Gattin eines Malaien in Uma Mĕhak)
[284]
Auf die inneren Angelegenheiten eines Mahakamstammes hat niemand anders als die Glieder des Stammes selbst Einfluss. In dieser Beziehung wird die Autonomie des Stammes streng gewahrt. Einem Europäer, der an andere Verhältnisse gewöhnt ist, erscheint es auffallend, dass so kleine Stämme so gänzlich unabhängig voneinander und mit so wenig Verbindung untereinander am gleichen Flusse leben können.
Der gegenseitige Verkehr findet in der Tat nur durch einzelne Männer, die an Handelsreisen gewöhnt sind, statt. Nach der allgemeinen Sitte kehren diese Händler in den meisten Niederlassungen, an denen sie vorüberfahren, ein, um Neues zu hören oder mitzuteilen.

Junger Mann der Kajan am oberen Mahakam.
Frauen begeben sich zu fremden Stämmen nur, um Familienangehörige zu besuchen, und auch dies geschieht selten. So besuchen sich die Frauen der verschiedenen Niederlassungen der Long-Glat. Gleichwie viele 20 jährige Frauen der Mendalam Kajan noch nie in dem nur 3 Stunden entfernten Putus Sibau gewesen waren, kannten die meisten Frauen der Mahakam Kajan nur ihre eigene Niederlassung.
Während meines Aufenthaltes im Jahre 1899 ging Hiāng, die angesehenste von Kwing Irangs Frauen, mit ihrer Pflegetochter Kĕhad zum ersten Mal in ihrem Leben zum Stamm der Ma-Suling mit; dabei war sie bereits 50 Jahre alt. Da beide nur Kajan zu sprechen wagten, konnten sie sich nur mit Mühe mit den Frauen der Ma-Suling verständigen, die ein einigermassen verändertes Busang sprachen. Es dauerte zwei Tage, bis Kĕhad mit ihrer Nichte Bulan in ihrem mangelhaften Busang zu sprechen wagte. Um noch weiter, zu den Long-Glat nach Long Tĕpai, mitzufahren, fehlte ihnen der Mut. Ebenso verhielt es sich mit den anderen Frauen.
Derartige Verhältnisse führen die Stämme in hohem Masse zum Konservatismus und erwecken in ihnen die Neigung, sich in der ihnen eigenen Richtung weiter zu entwickeln, mit dem Resultat, dass unter allen diesen kleinen Menschengruppen, die aus derselben Umgebung abstammen, eine besondere Sprache und viele besondere Sitten hervorgegangen sind. Misstrauen, Eifersucht und Zwistigkeiten aller Art halten diese Stämme gleich stark von einander entfernt als dies anderswo bei Leuten geschieht, deren Verkehr durch Berge, Wasserfälle oder Wüsteneien verhindert wird.

Junge Frau der Kajan am oberen Mahakam.
Eine Verbrüderung der Stämme wird dadurch erschwert, dass die [285] Bahau praktisch endogam sind, obgleich in der Theorie weder ihre adat noch ihre Religion ihnen verbietet, in einen anderen Stamm zu heiraten. Die Endogamie erklärt sich daraus, dass die Häuptlinge ihren ganzen Einfluss aufbieten, um eine Verminderung ihres Stammes durch den Wegzug seiner Glieder zu verhindern; denn im Hinblick auf eine eventuelle Verteidigung ist es wünschenswert, dass die Zahl der Stammesglieder möglichst gross ist.
Ich hatte diese Erscheinung schon bei den zwei Teilen des Kajanstammes zu Tandjong Kuda und Tandjong Karang am Mendalam bemerkt und fand sie in ganz derselben Weise am oberen Mahakam wieder. Hat sich ein Mann in einem anderen Dorfe niedergelassen, so werden noch nach Jahren Versuche gemacht, ihn zur Rückkehr zu bewegen.
Trotzdem ist seit Jahrzehnten von wirklicher Feindschaft und Kampf unter diesen Stämmen keine Rede mehr gewesen. Begreiflicher Weise ist aber auch ein gemeinsames Vorgehen unter ihnen nicht üblich und, wenn, wie es im Jahr 1885 geschah, die Batang-Lupar am Oberlauf grosse Verwüstungen anrichten, fühlen sich die Ma-Suling und Long-Glat durchaus nicht verpflichtet, den anderen Stämmen ernsthaft beizustehen, solange sie selbst nicht bedroht sind.
Der Boden, den ein Stamm der Bahau eingenommen hat, ist Eigentum des Stammes und Glieder anderer Stämme dürfen innerhalb dieser Grenzen kein Land besitzen oder Fische fangen. Alle innerhalb dieses Gebietes gelegenen Landstücke, die noch nicht bebaut gewesen sind, stehen jedem Stammesglied, die Sklaven mit einbegriffen, frei zur Verfügung; nach Beratung mit dem Häuptling wählt jeder den Boden, den er nötig zu haben glaubt. In Zeiten von Reismangel sind die Berge, in denen wilder Sago (nanga = Eugeisonia tristis) wächst, von grosser Bedeutung. Jeder darf dann nach Bedürfnis dort Nahrungsmittel sammeln. Das Gleiche gilt für den Rotang und andere Artikel, welche der Wald liefert; die freien Stammesglieder dürfen sie sogar zum Verkauf sammeln, ohne ihrem Häuptling einen Teil des Ertrages zu geben. Lässt der Häuptling die Buschprodukte durch seine Sklaven suchen, so erhält er den Zehnten des Ertrags; den gleichen Tribut erhält er auch von den Fremden.
Auch Jagd und Fischfang dürfen die Stammesglieder frei betreiben, nur steht dem Häuptling das Recht zu, sobald der Fischstand oder der Stand der Buschprodukte es erforderlich machen, einen bestimmten [286] Fluss oder ein Waldgebiet für verboten zu erklären und demjenigen eine Busse aufzuerlegen, der dieses Verbot übertritt.
Die Waldfrüchte sind ebenfalls allgemeines Eigentum, ein Umstand der in günstigen Fruchtjahren von grosser Wichtigkeit ist, da in den Wäldern Borneos viele essbare Früchte vorkommen. Anders verhält es sich mit den Fruchtbäumen, die irgendwann von Familien des Stammes gezogen wurden. Doch werden die Früchte an entlegenen Orten vielfach gestohlen, was um so begreiflicher ist, als der Stamm bald hier bald da innerhalb seines Gebietes ein Haus baut und in der Nähe wieder neue Reisfelder anlegt. Die Fruchtbäume werden in der Regel dicht beim Hause gepflanzt und beginnen oft erst dann zu tragen, wenn das Haus wieder verlassen wird.
Der Grund zum Umzug eines Stammes liegt nur selten im Mangel an in der Nähe liegendem Ackerboden. Wenn der Feind durch Brandschatzung keine Veranlassung hierzu giebt, ist es meist der Aberglaube, der eine Rolle spielt. Kommen nämlich viele Todesfälle in einem Hause vor, so wird die Umgebung, in der es steht, für von bösen Geistern bewohnt angesehen, und der Stamm zieht an einen anderen Ort. Ferner hat auch Zwietracht im Stamme zur Folge, dass er sich teilt und die Parteien weit von einander wohnen gehen, wie es z.B. die Long-Glat von Lirung Bān taten, die sich in Lulu Njiwung und Long Tĕpai niederliessen. Die Ma-Suling mussten ihr Haus am Mĕrasè verlassen, weil es alt und baufällig geworden war. Dies geschieht jedoch nur selten; denn erstens besteht das Baumaterial, hauptsächlich am oberen Mahakam, aus sehr dauerhaftem Holz, zweitens finden sich schon viel früher Gründe, welche die Bewohner zum Auszug zwingen, vor allem Krankheit und Tod des Häuptlings. Im allgemeinen wohnen die Stämme selten länger als 8 bis 10 Jahre am gleichen Ort.
Nicht nur die Fruchtbäume, sondern auch der Boden bleibt Eigentum derjenigen Familie, die ihn zuerst bebaute; sie darf ihn nicht verkaufen, wohl aber umtauschen oder an andere Stammesglieder verpachten. Der Häuptling kann, wenn er viele Sklaven besitzt, viele Äcker bebauen lassen, er ist hierzu auch wegen der grossen Mengen Reis, die er zum Empfang von Gästen und für den Unterhalt seiner Sklaven nötig hat, gezwungen. Die Sklaven haben keinen Grundbesitz, aber sie erhalten vom Häuptling ein Stück Land zum Bebauen.
Auf je einen Arbeitstag für sie selbst kommen bei den Sklaven zwei für den Häuptling. [287]
Zusammenhangslos wie die Stämme am oberen Mahakam sind, haben sie in früherer Zeit doch ein oekonomisches Ganzes gebildet, weil es nicht nur ihrer Neigung entsprach, alles für den Lebensunterhalt Erforderliche selbst herzustellen, sondern auch weil der Zugang zu ihrem Lande und das oft feindliche Verhältnis mit den umliegenden Ländern einen regelmässigen Verkehr zwecks Austausch von Handelsprodukten ausschloss. In den letzten 10 Jahren haben sich die Zustände zwar sehr verändert, doch kann man noch jetzt verfolgen, wie sich das Zusammenleben damals gestaltete. Feldfrüchte bauten alle für sich selbst und zwar in einem solchen Überfluss, dass noch etwas an die verwandten Stämme unterhalb der Wasserfälle, die damals noch keine Reiszufuhr von der Küste erhielten, verkauft werden konnte. Die Kleidung stellten sich die verschiedenen Stämme ebenfalls selbst her: während aber die Pnihing, Kajan und Ma-Suling sich lange Zeit ausser in Baumbast auch in selbst gewebte Stoffe kleideten und dies zum Teil auch jetzt noch tun, benützen die Long-Glat, wahrscheinlich ihres grösseren Wohlstands und der Nähe der Küste wegen, bereits seit langem eingeführten Kattun zur Kleidung, den sie nur mit eigenen Stickereien verzieren. Ein weiterer Grund für das Verschwinden der Webekunst, die von den Long-Glat ursprünglich gewiss ebenfalls betrieben wurde, ist, dass sie durch Herstellung von Schwertern und eisernen Ackergerätschaften einen bei den anderen Stämmen sehr gesuchten Tauschartikel besitzen, mit dem sie sich alles, was sie zum Leben brauchen, anschaffen können. Noch heutigen Tages ist die Schmiedekunst bei den Long-Glat viel höher entwickelt als bei den Kajan, Ma-Suling und Pnihing. Diese dagegen zeichnen sich im Bau von Böten aus, die aus einem Stück gearbeitet werden und eine Länge von 23 m und eine Breite von 2 m erreichen können. In ihren weiten, unberührten Wäldern finden sie die hierfür erforderlichen, sehr grossen Baumstämme, zugleich sind sie selbst aber auch die besten Bootbauer. Auch ihrer vortrefflichen Netze wegen sind sie bekannt. Dies sind hauptsächlich runde Wurfnetze, welche aus den gedrehten Fasern einer Liane, tengāng genannt, gewebt werden. Die übrigen Stämme verfertigen die gleichen Schnüre und Netze, aber die Pnihing verstehen diese Kunst am besten. Die Kajan stellen ebenfalls gute Böte her, auch können sie schmieden und Netze weben, aber ihre Leistungen stehen nicht besonders hoch.
Auch die Töpferei wurde vor nicht sehr langer Zeit noch am Mahakam [288] betrieben. Man verfertigte Töpfe zum Reiskochen. Es gelang mir, noch einige dieser Exemplare aufzutreiben und zu erwerben. Die Ma-Suling und Ma-Tĕpai haben sich mit der Töpferei am längsten befasst, vielleicht weil sie den hierfür geeigneten Lehmlagern an der Mündung des Mĕrasè am nächsten wohnten.
Beim Beginn der Reisernte formen auch gegenwärtig noch alle Stämme grosse, viereckige, flache Töpfe von 2½ × 3½ dm Oberfläche, um den noch nicht völlig reifen Reis, der schwer zu entspelzen ist, darin zu trocknen. Diese Töpfe werden aber nur in der Sonne getrocknet und vertragen kein Wasser.
Das Schnitzen von Schwertgriffen aus Holz oder Hirschhorn bildet gegenwärtig eine blühende Industrie, die ebenfalls besonders von der. Long-Glat betrieben wird, jedoch sah ich auch bei den Kajan einige schöne Stücke, die aus jüngster Zeit stammten. Die Pnihing üben diese Kunst gar nicht und die Ma-Suling sehr wenig aus.
Auch der Reisbau regt zum Handelsverkehr an, indem er bei den verschiedenen Stämmen einen verschiedenen durchschnittlichen Ertrag liefert. Die Pnihing sind auch jetzt noch die schlechtesten Ackerbauer, während die Ma-Suling sich sowohl früher als gegenwärtig der besten Ernten erfreuen und nie Reismangel leiden; den überschüssigen Reis tauschen sie gegen die Erzeugnisse der anderen Stämme aus.
In früherer Zeit gewann man das Salz aus den Salzquellen, die sich im Gebiet der Kajan, Ma-Suling und Long-Glat befinden.
Auch im Flechten von Rotangmatten sind die Long-Glat den anderen Stämmen überlegen. Es lässt sich ganz allgemein behaupten, dass der Stamm der Long-Glat sich vor allen anderen im Herstellen gut gearbeiteter und schön verzierter Gegenstände auszeichnet, dass Kunstfertigkeit und Geschmack bei ihm am höchsten stehen. Sein politisches Übergewicht und die damit verbundene grössere Wohlhabenheit scheint hierin von bedeutendem Einfluss gewesen zu sein.
Die Long-Glat nehmen auch augenblicklich noch in bezug auf Schönheit der Kleidung die erste Stelle am Mahakam ein. Sie pflegen sich auch Alltags sorgfältig und hübsch zu kleiden. Ihre Art und Weise der Tätowierung ist ganz oder teilweise von anderen Stämmen, die sich früher wenig oder anders tätowierten, übernommen worden.
Erst in letzter Zeit hat sich bei den Long-Glat die Sitte eingebürgert, am Ober- und Unterkiefer die vordersten sechs Zähne zur Hälfte absägen zu lassen. Sowohl Männer als Frauen glauben sich hierdurch [289] zu verschönern. Unter den jungen Leuten der Kajan und Ma-Suling hat diese Sitte, die vom Barito stammt, ebenfalls ihr Bürgerrecht erworben und sie unterwerfen sich, der neuen Mode zu liebe, gern dieser Marter.
Die einflussreiche Stellung der Long-Glat beruht, ausser auf der Überlieferung ihrer früheren Oberhoheit, auch darauf, dass Glieder ihrer Häuptlingsfamilie in diejenigen der Pnihing, Kajan, Ma-Suling und der abhängigen Stämme, mit denen sie zusammenwohnen, verheiratet wurden. Diese Verhältnisse wurden noch dadurch begünstigt, dass die Long-Glat-Häuptlinge, bald nachdem sie den Mahakam hinuntergezogen waren, von den Malaien die Vielweiberei annahmen, eine Sitte, die weder bei ihren Vorfahren herrschte noch bei irgend einem anderen Stamme besteht, die ihnen aber eine zahlreichere Nachkommenschaft sichert. Als Abkömmlinge der Long-Glat sind auch die letzten Kajanhäuptlinge dieser Sitte gefolgt.
Bildeten die Stämme am oberen Mahakam, wie wir gesehen haben, früher unter der Long-Glat-Herrschaft eine politische und später eine mehr oekonomische Einheit, so blieben sie doch von einer Berührung mit den Nachbarländern nicht gänzlich ausgeschlossen.
Weiter oben ist bereits erwähnt worden, dass im Beginn des 19. Jahrhunderts nach dem Kapuas, Barito und mittleren Mahakam Kriegszüge unternommen wurden, während sich später, bereits vor 1825, ein Teil der Long-Glat unterhalb der Wasserfälle niederliess. Hierdurch wurden freundschaftliche Beziehungen mit den südlicheren Gebieten angeknüpft. Mit den Bewohnern am Barito, Kapuas und Batang-Rèdjang blieb das Verhältnis lange feindlich, so dass dorthin, wenigstens von den Kajan, Ma-Suling und Long-Glat, nur selten Handelszüge unternommen wurden. Unter den Kajan war der Häuptling Kwing-Irang der erste, der sie vor ungefähr 30 Jahren nach dem Batang-Rèdjang geleitete, wo der Radja von Sĕrawak geordnetere Zustände geschaffen hatte. In jener Zeit wurden aber die Beziehungen, die man mit dem Apu Kajan noch stets unterhalten hatte, abgebrochen, weil die Kriege unter den Kĕnja selbst einen Zug in ihr Gebiet zu gefährlich machten. Bemerkenswert ist, dass, obwohl die Bahau nach dem Barito und Kapuas oft Kopfjagden unternahmen, von dort aus, so viel ich weiss, doch niemals am oberen Mahakam Köpfe gejagt wurden.
Durch den vorteilhaften Markt in Sĕrawak am Batang-Rèdjang angelockt, unternahmen hauptsächlich die Pnihing, Kajan und Ma-Suling, [290] in geringerem Masse auch die Long-Glat, geregelt dorthin Handelszüge. Da sie dort aber ständig mit feindlich gesinnten Batang-Luparstämmen in Berührung kamen, bot sich beiden Parteien fortwährend ein Anlass, um Köpfe zu jagen, was die Regierung von Sĕrawak nicht verhindern konnte.
Wiederholte Unterredungen mit Kwing Irang und dem damals noch mächtigen Pnihinghäuptling Bĕlarè blieben so gut wie resultatlos, da diese kaum im stande waren, dergleichen Heldentaten bei den eigenen Stämmen zu unterdrücken und auf die anderen überhaupt keinen Einfluss hatten. Hierdurch ereignete sich folgendes:
Als Bĕlarè einst nach einer ernsthaften Beratung mit dem Radja von Sĕrawak von Fort Kapit, an der Mündung des Njangejan, diesen Fluss aufwärts fuhr, um nach dem Mahakam zurückzukehren, kam ihm ein anderer Pnihinghäuptling, Owat, mit einer Gesellschaft Dorfgenossen entgegen. Bĕlarè, der sie auf einer Kopfjagd vermutete, suchte die Leute zur Rückkehr zu bewegen, aber Owat, als geborener Ma-Suling, der bei den Pnihing nur verheiratet war, weigerte sich zu gehorchen. Als ihm bald darauf in einem Boot sieben Batang-Lupar begegneten, die Buschprodukte suchen gingen, ermordete er sie alle. Sĕrawak verlangte der Übereinkunft gemäss von den Mahakam Häuptlingen die Auslieferung der Mörder, aber diese, besonders die Ma-Suling, verweigerten die Auslieferung und die übrigen wagten nichts durchzusetzen. Als Folge hiervon beschloss der Radja von Sĕrawak, das schuldige Pnihinghaus, das sich unter dem Häuptling Paren am weitesten oben am Mahakam stand, zu züchtigen. Berücksichtigt man, dass zum Zusammenbringen und Ausrüsten einiger Tausend Dajak viel Zeit erforderlich ist und so etwas auch nicht im Geheimen geschehen kann, so erscheint es einem Europäer unbegreiflich, dass man am Mahakam nichts davon merkte. Auch die Fahrt den Njangejan aufwärts und der Zug über die Wasserscheide zum Sĕliku blieben unbemerkt, und die grosse Bande konnte sich dort, um Böte zu bauen, lange Zeit aufhalten, ohne dass man weiter unten etwas davon ahnte. Daher konnten die Pnihing völlig unvorbereitet überfallen werden. Das schuldige Haus wurde erobert, geplündert und verbrannt und die Bewohner grossenteils ermordet oder zu Sklaven gemacht. Die Banden kannten keine Disziplin und setzten ihren Plünderzug flussabwärts fort. Sie hielten sich am Hauptfluss, wo Bĕlarè ihnen in seinem Hause an der Kasomündung mit seinen wenigen Leuten einen heldenhaften Widerstand bot. Durch die Übermacht [291] der Leute, die zudem von dem Radja mit Gewehren versorgt waren, wurde Bĕlarè schliesslich überwunden und musste flüchten. Sein Haus wurde ebenfalls geplündert und verbrannt. Nach seiner Angabe verlor er an Toten und Sklaven 234 Personen, vielleicht die Hälfte der ganzen Anzahl.
Wegen dieses Aufenthaltes hatten die Bewohner an der Mündung des Tjĕhan Zeit, diesen Fluss aufwärts zu flüchten; sie verloren daher nur ihr Haus, das verbrannt wurde. Die Plünderer fuhren noch weiter zum Kajanstamm, der völlig unschuldig war und so wenig an einen Überfall dachte, dass er sogar eine Gesellschaft Batang-Lupar in seinem Hause beherbergte. Das Haus wurde belagert und einen ganzen Tag lang mit Gewehren beschossen, ohne dass jemand verletzt wurde. Nur ein Malaie wurde bei ihnen dadurch getötet, dass sein Gewehr ihm beim Schiessen sprang. Gegen Mittag waren die Batang-Lupar bis unter das Haus gekommen, sie wagten sich aber nicht auf die Galerie hinauf. Da warf sich der geflohene Pnihinghäuptling Paren, der sein Haus und einen grossen Teil seines Stammes verloren hatte und sich daher bei den Kajan aufhielt, aus Verzweiflung mitten unter die Angreifer. Da die Kajan ihm nicht beizustehen wagten, machten ihn die Feinde nieder.
Der Tod dieses Häuptlings machte auf die Kajan und auch auf eine Schar Long-Glat, die nach oben gezogen war, um Nachrichten zu holen und Hilfe zu leisten, einen gewaltigen Eindruck. Die Batang-Lupar hatten jedoch viele der Ihrigen verloren und zogen sich daher abends auf eine weiter oben gelegene Geröllbank zurück, um später wieder flussaufwärts zu ziehen.
Des Abends spät jedoch zogen die Long-Glat aus dem Kajanhause fort, ein Umstand, der neben dem Tode Parens die Bewohner so erschreckte, dass sie nachts alle mit dem Notwendigsten versehen das Haus verliessen und auf den Batu Kasian flüchteten, der nur von einer Seite, von der Mündung des Blu-u aus, zu besteigen war. Die zurückgelassenen Hunde heulten aber in dem verlassenen Kajanhause die ganze Nacht über, wodurch die Batang-Lupar aufmerksam wurden. Als es Tag wurde, kamen sie noch einmal, um nachzusehen, was geschehen war. Sie plünderten und verbrannten das ganze Haus und zogen dann beutebeladen den Mahakam hinauf, zurück nach Sĕrawak.
Seit der Zeit werden höchstens Züge, um kriegsgefangene Blutsverwandte und Stammesgenossen zurückzufordern, und nur noch selten [292] Handelsreisen nach Sĕrawak unternommen; und die Bewohner am oberen Mahakam müssen sich wegen Salz und javanischen Tabak, an die sie sich durch den Kontakt mit der Küste gewöhnt haben, nach dem mittleren Mahakam oder dem oberen Barito wenden, wo man diese Artikel noch bei meiner Ankunft im Jahre 1896 am besten erlangen konnte.
Die Beziehungen mit der Aussenwelt, die hauptsächlich den Verkauf der eigenen und den Kauf fremder Produkte zum Zwecke haben, werden meist von den Bahau selbst unterhalten, die, wenn ihre Arbeiten es zulassen, besonders in Zeiten niedrigen Wasserstandes, in einem oder mehreren Böten Handelszüge unternehmen. Für derartige Reisen vereinigen sich stets Leute desselben Stammes.
In der Regel bildete Udju Tĕpu, der Stapelplatz der Buschprodukte und Endpunkt der Dampferverbindung auf dem unteren Mahakam, das Ziel der Reise. Früher suchten die Stämme aus den oberen Gebieten ihre Webereien, Reis, Eisenwaren und Böte bereits unterwegs zu verkaufen; jetzt sind Webereien, Reis und Eisenwaren wegen der Zufuhr von unten nicht mehr viel wert; neben Geld bilden in Udju Tĕpu augenblicklich Böte, Guttapercha, Rotang, Bezoarsteine und Rhinozeroshörner brauchbare Tauschartikel. Ihrer Bedeutung nach geordnet bedürfen die Bahau folgender Artikel: Salz, Kattun, Tabak, Perlen, Eisenwaren und Tempajan.
In früherer Zeit bestand für alle diese Artikel durchaus kein fester Preis. Dieser wurde auch hier durch Nachfrage und Angebot und in noch höherem Masse durch die Persönlichkeit des Käufers und Verkäufers bestimmt. Buginese und Bahau standen einander gegenüber. Da jener im Handel kein Gewissen kennt und dieser, besonders auf fremdem Boden und in fremder, gefürchteter Umgebung, sehr leicht eingeschüchtert wird, wurde er stets auf die gröbste Weise betrogen.
Um von dem, was die Bahau für ihren wichtigsten Lebensartikel bezahlen müssen, eine Vorstellung zu geben, möge hier ein Fall unter vielen angeführt werden, den ich selbst erlebte und zwar mit der Autorität eines Europäers gegenüber diesen eingeborenen Kaufleuten. Der Sultan von Kutei in Samarinda verkauft das monopolisierte Salz an der Mündung für fl. 9 den Pikol (61,75 kg), in Tĕpu bezahlt man hierfür, je nach Umständen, in Geld fl. 12.50 und mehr, bei den Wasserfällen betrug der Preis im Jahre 1897 in Geld fl. 25 bis 30, während ich am Blu-u bei den Malaien das Salz nur für fl. 1.50 bis 2.50 pro Kilo kaufen konnte. [293]
Javanischer Tabak, der in Samarinda mit fl. 13 bezahlt wird, kostet bei den Wasserfällen fl. 35 bis 40; weiter oben verlangen die Malaien sogar 60 fl. und mehr.
Die Dauer der Handelsreisen ist eine sehr verschiedene, weil sie auf der Strecke zwischen Long Tĕpai und Long Bagun durch den Wasserstand bestimmt wird. Werden die Böte hier nicht aufgehalten und sind sie nicht zu schwer beladen, so kann man in 5 Tagen von Long Blu-u nach Udju Tĕpu reisen und in 10 Tagen von hier wieder zurück sein. So günstige Umstände findet man aber nur sehr selten. Meist dauert ein solcher Zug über einen Monat. Die Verbindung mit dem Murung ist noch viel ungünstiger. Wenn möglich sucht man die nötigen Gegenstände in Muara Laung am Murung einzukaufen, wohin man sich vom oberen Mahakam aus auf verschiedenen Wegen begeben kann. Erstens vom Kaso aus, der für die kleinen, bis zu i o m langen Böte der Bahau längs der Niederlassungen der Sĕputan gut befahrbar ist. Nachdem man 3 Tage lang den Fluss hinaufgefahren ist, kann man das Boot in einem halben Tag über die Wasserscheide ziehen bis zu einem Nebenflüsschen des Busang, eines Nebenflusses des Djoloi, welch letzterer wiederum in den Murung mündet. Wegen der zahlreichen grossen Wasserfälle folgt man diesem Wege mir selten, um Muara Laung zu erreichen, sondern meist um in den höher gelegenen Gebieten den Buschproduktensuchern Reis zu verkaufen, für den sie einen sehr hohen Preis an Guttapercha und Geld bezahlen. Zweitens kann man den Murung vom Tjĕhan aus erreichen, der viel schiffbarer als der Kaso ist. Der Landweg dauert hier aber für einen nicht zu schwer beladenen Bahau 3 bis 4 Tage und führt über den Batu Lĕsong zum Busang, der wegen zahlloser Wasserfälle ein sehr schlechtes Fahrwasser bietet. Auch vom Blu-u aus folgt man bisweilen diesem Wege und zwar, indem man ein linkes Nebenflüsschen, den Ikang, an dem früher eine kleine Kajanniederlassung lag, hinauffährt. Weiter folgt man aber dem gleichen Pass des Batu Lĕsong, der dort ungefähr 1800 m hoch ist. Die Passhöhe beträgt über 1000 m. Der gebräuchlichste Weg nach Muara Laung ist jedoch der, östlich vom Batu Lĕsong längs des Pahngè und Bĕlătung, eines Nebenflusses des Murung. Dieser Weg führt zwischen dem Batu Lĕsong und Batu Ajo hindurch, die hier durch einen sehr niedrigen Pass geschieden sind. Der Bĕlătung ist zwar gut schiffbar, weil er keine hohen Wasserfälle besitzt, aber der Fall ist so bedeutend, dass man, um Gepäck und Menschen abwärts zu bringen, Flösse baut, auf denen alles festgebunden wird. Mit langen [294] Rudern sucht man dann die Mitte des Stromes zu halten, gelingt dies nicht, so zerschmettern die Flösse und alles ist verloren.
Die Fahrt den Bĕlătung aufwärts ist nur bei sehr niedrigem Wasserstande möglich. Dieser Weg wurde bereits in früheren Zeiten viel benützt, um vom Mahakam aus nach dem Murung und weiter Köpfe jagen zu gehen; daher trägt das Gebirge den Namen Batu Ajo (ajo = Kopfjagd). In späteren Jahren sind diese Wege meistens von Buschproduktensuchern aus den Gebieten des Murung, Bĕlătung und Busang begangen worden, die sich zum Mahakam begaben, um dort Reis und andere Lebensmittel einzukaufen.
Die Reisen nach den malaiischen Niederlassungen am Murung dauern in der Regel viele Monate, und die Beschaffung von Salz, Tabak und Leinwaren ist des Transportes wegen sehr schwierig.
Die Bahau vom oberen Mahakam unterhielten längs des Penaneh und Howong auch mit dem Kapuasgebiet Handelsbeziehungen, aber wegen der grossen Entfernung und der früheren ungünstigen Handelsverhältnisse kamen sie nur selten hin. Dagegen kamen die Mendalambewohner und die Taman öfters nach dem oberen Mahakam, um Schwerter, Schwertgriffe, Matten und alte Perlen einzukaufen.
Die günstigen Handelsverhältnisse, welche der Radja von Sĕrawak am Batang-Rèdjang geschaffen hat, brachten besonders die Pnihing und Kajan dazu, den Beschwerden der Reise Trotz zu bieten. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen sie den Mahakam hinauffahren, was 9 bis 60 Tage dauert, ferner längs des Sĕliku auf einer Höhe von 1100 m. die Wasserscheide überschreiten, um nach zweitägiger Fahrt den Njangejan abwärts nach Fort Kapit zu gelangen. [295]
Kapitel XIV.
Verkehr mit den Eingeborenen—Einkauf von Ethnographica—Sammeln und Konservieren von Tieren und Pflanzen—Sammlungen und Untersuchungen auf geologischem Gebiet—Topographische Aufnahmen—Photographie.
Obgleich die Verhältnisse, unter denen die Eingeborenen von Mittel-Borneo leben, derart sind, dass diese selbst den Schutz eines höher stehenden Volkes herbeiwünschen, machen sich ihre ängstlichen Gemüter doch allerhand entsetzliche Vorstellungen von dem, was geschehen könnte, wenn die ihnen so fremden Weissen, die so mächtig sind, dass sie in Krankheitsfällen und auf gefährlichen Bergspitzen den bösen Geistern zu widerstehen vermögen, in ihr Land einziehen. Um daher einen politischen Einfluss auf die Stämme zu gewinnen, mussten wir nicht nur alles vermeiden, was bei ihnen Unwillen oder Schreck erregen konnte, sondern auch alles daransetzen, um ein vertrauliches Verhältnis mit ihnen anzubahnen.
Nach meiner ärztlichen Praxis waren es die Samenlungen auf den verschiedenen Gebieten der Wissenschaften, die uns mit der Bevölkerung in intimen Verkehr brachten. Sie boten ausserdem einen zweiten grossen Vorteil, indem sie den Teilnehmern der Expedition, sowohl den weissen als den farbigen, ständig Beschäftigung verschafften. Für einander fremde, auf niedriger Entwicklungsstufe stehende Menschen ist es ungemein schwierig, unbeschäftigt lange Zeit friedlich miteinander zu verkehren.
Da. ich nun hauptsächlich Malaien bei mir hatte, die als Mohammedaner ohnehin auf die heidnischen Bahau herabsehen und von alters her daran gewöhnt sind, auf deren Auffassung von Eigentum, Anstand u.s.w. nicht zu achten, trachtete ich von Anfang an danach, meine Leute durch Ableitung in Banden zu halten. Eine grosse Versuchung bildete für meine stattlichen Reisegenossen auch der Umgang mit den Frauen, von denen sich besonders die Mädchen für sie interessierten und die, [296] bei der grossen Freiheit, die sie in dieser Beziehung in ihrer Gesellschaft geniessen, aus ihren Gefühlen keinen Hehl machten.

Kajanknaben vom oberen Mahakam.
Nachdem ich die Leute anfangs selbst auf die grosse Gefahr eines Verkehrs mit Frauen hingewiesen hatte, waren sie später verständig genug, zu Eifersucht und eventuellen Racheakten keinen Anlass zu geben.
Unsere Sammlungen brachten der Bevölkerung einen bedeutenden materiellen Vorteil, denn für die dafür erforderlichen Exkursionen hatten wir Führer und häufig auch Träger nötig, so dass viele Männer monatelang bei uns einen Verdienst fanden; inzwischen fingen die Frauen und Kinder während der Feldarbeit allerlei Tiere, die sie uns für Nadeln, Perlen und andere kleine Dinge verkauften. Jeder, der sich photographieren liess, bekam eine Belohnung, und selbst, wenn der eine oder andere etwas Interessantes erzählt hatte, verlangte er nachher eine Kleinigkeit.
Sobald die jungen Leute begriffen hatten, dass wir junge, seltene Pflanzen, die auf eine bestimmte Weise aus dem Boden genommen waren, gern kauften, benützten sie ihre freie Zeit, um für uns sammeln zu gehen, und ihnen verdanken wir auch manchen seltenen Fund.
Ferner lieferte der Verkauf von Ethnographica vielen ein Mittel, um sich aus unseren Vorräten einen gewünschten Gegenstand zu erwerben.
Gleichwie die Stämme am Mendalam, waren auch die am Mahakam anfangs durchaus nicht geneigt gewesen, mir irgend etwas von ihrem Besitz zu verkaufen. Unter einander sind sie nämlich kaum daran gewöhnt, mit etwas anderem als mit Reis und anderen Nahrungsmitteln Tauschhandel zu treiben; denn jede Familie verfertigt ihre Kleider und Gerätschaften selbst und ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Nur in besonderen Fällen, wenn es sich um ein Kunstwerk handelt, wendet man sich an einen Fachmann, wie einen Schmied oder Schnitzer. Daher konnten sie sich anfangs nicht entschliessen, mir ein Messer, einen Korb oder eine Matte abzutreten; hierzu trat auch noch Misstrauen, da die Leute nicht begriffen, zu welchem Zwecke ich alle diese Gegenstände kaufen wollte.
Nun befand ich mich jedoch zum zweiten Mal in ihrer Mitte. Zweifellos hatten es nach meiner vorigen Abreise viele Leute bereut, die gute Gelegenheit, für sie wertlose Gegenstände zu hohem Betrag zu verkaufen, nicht benützt zu haben; denn jetzt kamen sie während [297] unseres ganzen Aufenthaltes, von Kindern, die noch kaum laufen konnten, an bis zu weisshaarigen Alten, mit allerhand Dingen, von denen sie glaubten, dass sie uns interessieren könnten. Öffnete ich einen Packen Perlen von einer neuen Art oder ein besonders schönes Stück geblümten Kattuns, so entschloss sich so mancher, uns einen geliebten Gegenstand abzutreten, falls wir Reis, Eier oder Früchte als Kaufpreis nicht genügend fanden.
Beim Einkauf der Ethnographica ging ich, soweit Umstände und Mittel es erlaubten, darauf aus, nicht nur alles, für das tägliche Leben den Eingeborenen Notwendige, sondern auch alles, was ihnen zur Verschönerung ihres Daseins dient, zu erwerben. Schon früher war es mir aufgefallen, dass die Bahau in der Herstellung von Gegenständen, die sich durch Form und Farbe auszeichnen, eine hohe künstlerische Entwicklung erlangt haben. Dies ist besonders bei den Gegenständen der Fall, für die sie bei den Malaien einen Absatz und daher auch einen Ansporn zu weiterer Vervollkommnung finden, wie z.B. im Schnitzen von Schwertgriffen und im Schmieden von Schwertern. Diese schönen Industrieprodukte der Bahau geben uns daher eine Vorstellung von dem, was sie leisten könnten, wenn die Umstände ihnen die nötige Anregung verschafften.
Indem ich sehr hohe Belohnungen für besonders schöne Gegenstände aussetzte, suchte ich denn auch den Arbeitseifer der Künstler im Stamme anzuspornen, und diesem Verfahren habe ich in der Tat einige aussergewöhnlich schöne Stücke zu danken. Hierbei beschränkte ich mich natürlich darauf, den gewünschten Gegenstand anzugeben; die Art der Verzierung und Ausführung überliess ich ihnen vollständig.
Leider stiess ich gerade bei der Erwerbung der interessantesten Kunstprodukte auf besondere Schwierigkeiten, die auch durch hohe Preise nicht zu überwinden waren. Die oft wundervoll geschnitzten Kindertragbretter (hăwăt) werden z.B. nicht verkauft, weil die Seele des Kindes lange Zeit in ihnen haust; das gleiche gilt für andere dem Kinde gehörige Gegenstände. Daher musste ich, hauptsächlich bei den Kajan am Mendalam, derartige Dinge neu herstellen lassen. Bei den Kajan am Mahakam wagt man es nicht, die Kleider unerwachsener Kinder zu verkaufen; mit den Tragbrettern ist man hier dagegen weniger ängstlich.
Glücklicher Weise waren die Schwertgriffe aus Hirschhorn käuflich, allerdings nur zu hohen Preisen, da die Malaien, die, sobald sie Geld [298] besitzen, sehr freigebig sind, für diese Kunstgegenstände stets viel übrig haben. Am Mendalam kosteten schön gearbeitete Griffe bis zu 10 Dollar das Stück; am oberen Mahakam musste ich für ein altes, schönes Exemplar 25 fl. bezahlen.
Am Mahakam erregten hauptsächlich die Frauenarbeiten meine Aufmerksamkeit, die geschmackvollen Perlenverzierungen für Kindertragbretter, Mützen und Hüte und die Stickereien auf Röcken und Lendentüchern. Als die Bevölkerung sich bei meinem zweiten Besuch an den Handel mit mir gewöhnt und den eigenen Vorteil eingesehen hatte, suchte sie für schöne Dinge einen möglichst hohen Preis herauszuschlagen. Dass man oft viel Zeit nötig hat, um eines bestimmten Gegenstandes habhaft zu werden, möge man daraus ersehen, dass ich wegen einer hübschen Perlenmütze zwei Jahre lang unterhandelte, wegen einer anderen zehn Monate; eine dritte konnte ich überhaupt nicht erlangen.
Wie eingangs bereits erwähnt worden ist, mussten wir uns bei der Ausrüstung auf das Notwendigste beschränken, da, besonders beim Landtransport, jedes Gepäckstück in Betracht kam. Am meisten wurde hierdurch die zoologische Sammlung getroffen, für die man sowohl Konservierungsmittel als Flaschen und Büchsen mitführen musste. Ich nahm mir daher vor, an Säugetieren, die ohnehin schon bekannt waren, nur sehr wenige und dann mir sehr kleine mitzunehmen; für meine Jäger sollte das Sammeln von Vögeln, deren Bälge wenig wogen, leicht zu verpacken waren und als Konservierungsmittel nur Arsenikseife erforderten, die Hauptaufgabe bilden. Sobald wir denn auch an einem Orte länger verweilten, begab sich Doris mit einigen bewaffneten Schutzsoldaten und einem Führer auf die Vogeljagd. Um die Anzahl der Bälge zu beschränken und die Munition zu sparen, durften von den gewöhnlichen Vogelarten nur je 6 oder 8 Exemplare gesammelt werden; trotzdem wuchs unsere Sammlung doch noch auf 1400 bis 1500 Exemplare an.
Mühsam war die Konservierung von Insekten, die trocken aufbewahrt werden mussten, da die Leute sie uns, besonders anfangs, bei der Rückkehr von der Feldarbeit in grosser Anzahl brachten und die Witterung nicht immer ein Trocknen in der Sonne zuliess. Dazu kam noch, dass wir uns auf dem ersten Teil unserer Reise ohne Naphtalin behelfen mussten, weil man den Vorrat aus Versehen nach Samarinda geschickt hatte. [299]
An flüssigen Konservierungsmitteln hatte ich hauptsächlich Formol und nur sehr wenig Spiritus mitgenommen, weil Formol mit Wasser verdünnt seinen Zweck meist gut erfüllt, wenn man nur dafür sorgt, dass es in hermetisch schliessenden Flaschen mitgenommen wird und dass die Flaschen mit den Präparaten sogleich völlig gefüllt werden, so dass nicht durch Sauerstoff eine Umsetzung in Ameisensäure bewirkt werden kann. Für die Aufbewahrung von Reptilien, Amphibien und hauptsächlich von Fischen erwies sich eine Lösung von 1 Teil Formol auf 5 Teile Wasser als am geeignetsten. Bringt man die Tiere lebend oder unmittelbar nach dem Tode in das Konservierungsmittel und trifft man die erwähnten Vorsichtsmassregeln, so erhalten sich die Farben mindestens zwei Jahre lang; nur die ausgesprochenen Metallfarben verschwinden auch in Formol. Auch die Farben gereinigter und abgeschnittener Schnäbel und Füsse zerschossener und daher wertloser Vögel, die beim Trocknen meist schwarz werden, erhalten sich gut in Formol.
Während sehr kleine Tiere unverletzt bewahrt werden können, muss man an Fischen, Reptilien und Amphibien einen mindestens 2 cm langen Bauchschnitt ausführen und ein Schliessen der Öffnung mittelst eines Querhölzchens verhindern.
So weit möglich liess ich unsere Konservenbüchsen und -Flaschen gebrauchen; für grössere Tiere liess ich aus Blech Behälter herstellen.
Zum Schliessen der Flaschen benützten wir stets Harz, das zerstossen und mit Petroleum angefeuchtet eine teigige Masse liefert, mit der Glas- und Metallgefässe luftdicht verschlossen werden können. Da Harz stets zu finden und Petroleum meist auch vorhanden ist, kann dieses Verschlussmittel sehr empfohlen werden; wir benützten es auch, mit Kapok oder Werg gemischt, um unsere Stahlkoffer wasserdicht zu schliessen.
Für Fische und kleine Tiere hatte ich 3 Kisten mit cylinderförmigen Gläsern von 200–500 ccm Inhalt mitgenommen; schraubbare Metalldeckel verschlossen mittelst eines von innen angebrachten Kautschukstreifens die Gläser luftdicht; sicherheitshalber wurden sie aber auch noch mit einem Harzring umgeben. In diesen Gläsern haben sich besonders Fische, Reptilien und Amphibien jahrelang gut gehalten, auch, als ich später nicht mehr im stande war, das Formol zu erneuern.
Während meines ersten Aufenthaltes am oberen Mahakam wurde ich beim Sammeln ständig von der Bevölkerung unterstützt, nur sah sie es nicht gern, dass wir ihre wahrsagenden Tiere töteten. So bedauerten [300] es die Kajan lebhaft, dass Doris zwei hisit (Anthreptes malaccensis) und zwei te̥lăndjăng (Platylophus coronatus) geschossen hatte. Als später bei den Kĕnja das gleiche geschah, wurde der te̥lăndjăng, während er zum Trocknen hing, gestohlen, was sonst nie vorkam. Ich hielt es für geratener, kein Wort darüber zu verlieren und das Töten dieser Tiere zu verbieten. Obgleich auch die Rehe zu den wichtigen wahrsagenden Tieren gehören, schienen die Bahau doch nichts dagegen zu haben, dass ich sie schoss. Ihre dje̥lẹwan, die Schlange mit dem roten Kopf, Bauch und Schwanz, wagten sie weder lebend noch tot anzurühren. Zum Entsetzen der Bahau töteten wir auf dem Wege von Kapuas zum Mahakam eine dje̥lẹwan in unserer Hütte und legten sie in eine Flasche mit Formol. Da keiner die Flasche tragen wollte, versteckte ich sie in einer der Kisten, ohne dass sie es sahen. Später schrieb die Bevölkerung den Erfolg meiner Expedition zum grossen Teil dem Besitz dieser Schlange zu und ich musste sie so häufig vorzeigen, dass ich mich zuletzt weigerte.
Eine besondere Furcht flösst den Bahau ein Halbaffe (Tarsius spectrum) ein, der tagsüber bewegungslos auf einem Baumstamm sitzend den Vorübergehenden mit seinen grossen Nachtaugen anstarrt und den Kopf weit nach rückwärts zu drehen vermag; keiner wagte es, dieses ungefährliche Tierchen zu töten. Zu den Tieren, welche der Aberglaube schützt, gehört auch der grosse Erdwurm, der im stande ist, Töne auszustossen; er soll die Fruchtbarkeit der Felder befördern, wir konnten daher kein Exemplar erhalten.
Bis zum Jahre 1899 verursachte uns das Sammeln wenig Mühe; während unseres Zuges an die Ostküste jedoch wurden die Kajan von verschiedenen Unglücksfällen betroffen, und ein Priester der Pnihing, der den Ruf genoss, durch Träume prophezeien zu können, erklärte die Unglücksfälle für eine Strafe der Geister, weil die Kajan für uns so viele Insekten getötet hatten. Im Grunde war der Priester nur neidisch auf den Verdienst der Kajan, den diese sich durch das Sammeln von Tieren verschafften. Nach unserer Rückkehr zu den Mahakam Kajan wagten sie uns kein einziges Insekt mehr zu bringen, obgleich ich eine Verstimmung hierüber nicht bemerkte.
Einfacher gestaltete sich das Sammeln auf botanischem Gebiet. Die Anlage eines Herbariums und einer Sammlung lebender Pflanzen betrachtete ich als die Hauptsache und nahm daher aus dem botanischen [301] Garten von Buitenzorg zwei Malaien, einen Mantri, Sĕkarang, und einen Pflanzensucher, Amja, mit, die beide im stande waren, selbständig ihre Arbeit auszuführen. Meine Aufgabe bestand daher nur darin, ihnen für ihre botanischen Exkursionen Führer und Träger zu verschaffen und etwas Aufsicht zu üben.
Belehrt durch unsere Erfahrungen von der Reise 1896–97 gelang es uns diesmal am oberen Mahakam, eine Sammlung der verschiedensten Pflanzen, und zwar 500 Exemplare, lebend aus dem Innern Borneos nach Buitenzorg zu transportieren. Dabei hatten die am Anfang unseres Zuges am Blu-u gesammelten Pflanzen sechs Monate lang dort gepflegt werden müssen.
Beim Aufbewahren lebender Pflanzen verfuhren wir folgendermassen: wenn möglich, wurden junge Exemplare aus dem Boden genommen und zwar so, dass, um die feinen Wurzelenden nicht zu verletzen, gleichzeitig auch eine grössere Menge Erde herausgehoben wurde. Zu Hause angekommen setzten wir die Pflanzen sogleich in Bambuskörbe in eine Erde, die aus Humus, Flusssand und etwas feiner Holzkohle bestand. Die gleiche Erde wird in Buitenzorg in den Treibhäusern benützt. Unter dem dichten Laubwerk der Fruchtbäume bei der Wohnung der Malaien wurde ein Grundstück vor Besuchen von Kindern, Hunden, Schweinen und Hühnern durch Bambuslatten geschützt und die Pflanzen unverdeckt auf Holzgestellen niedergesetzt und täglich versorgt. Auf diese Weise kamen während unseres Aufenthaltes am Mahakam nur wenige Pflanzen um. Bei unserer Abreise zur Küste wurden die Körbe mit den Pflanzen in Holzkisten von ungefähr 4 × 6 dm Bodenfläche und 5 dm Höhe dicht neben einander gesetzt. Die Kisten hatte ich grösstenteils an Ort und Stelle anfertigen lassen.
Die ganze Sammlung umfasste 37 derartiger Kisten; sie wurde in ein grosses Boot gesetzt und mittelst eines Palmblattdaches vor Sonne und Regen geschützt. An jedem Ort, wo wir länger als eine Nacht blieben, wurden alle Kisten aus dem Boot genommen und ans Ufer getragen, wo man die Pflanzen im Schatten der frischen Luft aussetzte. Für die Seereise wurden die Kisten mit Rotangschirmen, über die weisser Kattun gespannt worden war, überdeckt. Durch ständiges Benetzen des Kattuns blieb die Atmosphäre unter diesem Dach auch während der Hitze auf der Seereise und später während der Eisenbahnfahrt stets genügend kühl. Obwohl zwischen der Abreise vom Blu-u und der Ankunft in Buitenzorg zwei Monate lagen, hatten sämmtliche Pflanzen in dieser Zeit doch nur wenig gelitten. [302]
Die Ausrüstung für das Herbarium bestand hauptsächlich in grobem chinesischem Packpapier, das sich zum Pflanzentrocknen sehr gut eignet.
Während eines Aufenthaltes auf einem freien Platz, wie eine Bahauniederlassung ihn bietet, konnte man die Pflanzen der Sonne aussetzen; in der feuchten Waldatmosphäre jedoch mussten sie zwischen vielen Bogen Papier vorsichtig über dem Feuer getrocknet werden.
Grosse fleischige Früchte, die sich zum Trocknen nicht eigneten, und Blüten, die eine besondere Aufbewahrung verlangten, wurden ebenfalls in eine Formollösung gelegt. Die Farben der Orchideenblüten erhielten sich auffallend gut in einer Formollösung im Verhältniss von 1 : 5.
Unerwartete Schwierigkeiten bot das trockene Aufbewahren von Früchten und Samen zwecks späteren Aussäens. Trotz der sorgfältigen Behandlung, die sie seitens der hierin erfahrenen Javaner erfuhren, hatten bei Ankunft in Buitenzorg doch beinahe alle die Keimkraft verloren. Der Grund hierfür lag nicht in der Behandlung, sondern in der Eigentümlichkeit der Samen vieler tropischer Pflanzen, in beträchtlich kurzer Zeit die Keimfähigkeit einzubüssen; wir hätten daher die Samen sogleich aussäen und später die jungen Pflänzchen transportieren sollen.
Die vielen kleineren Ausflüge, die wir während unseres Aufenthalts am Blu-u zu benachbarten Stämmen unternahmen, kamen mehr den botanischen als den zoologischen Sammlungen zu gute. Wir beobachteten immer wieder, dass eine bestimmte Gegend zahlreiche ihr eigene Pflanzenarten besass, denen wir an einem anderen Orte nie wieder begegneten. In dem so gleichförmig aussehenden Urwald trafen wir hauptsächlich auf bestimmten Bergen eine eigene Vegetation, die auf gleichartigen benachbarten Bergen nicht mehr zu finden war.
Da wir mit Rücksicht auf die Reise nach der Küste und der in diesen tiefgelegenen Gebieten und auf Java herrschenden Wärme die lebenden Pflanzen in unserem Kulturgarten in keinen zu tiefen Schatten setzen durften, zeigten viele Arten die eigentümliche Erscheinung, dass bereits bei ihren ersten neugebildeten Blättern die prachtvolle metallblaue Färbung zu schwinden begann. Diese Färbung, die vielen Arten von Farren, Aroïdeen, Dracaeen, Begonien u.a. eigen, ist somit von der im Urwald herrschenden Feuchtigkeit und Dunkelheit abhängig und verschwindet unter veränderten Umständen sehr bald, um einem reinen Grün Platz zu machen.
Während ich mich in bezug auf Zoologie und Botanik darauf beschränkte, [303] die Anlage und Pflege der Sammlungen und die Aufzeichnungen zu beaufsichtigen und Notizen und Etiquetten oft selbst zu schreiben, ging ich, um eine Vorstellung von der geologischen Formation des oberen Mahakamgebietes zu erhalten, selbst darauf aus, Gesteine zu sammeln und ihre Fundorte zu untersuchen.
Diese wie auch die anderen Sammlungen wurden so angelegt, dass sie später von Fachleuten bearbeitet werden konnten.
Die geologischen Untersuchungen nahm ich während der Exkursionen vor, die wegen der topographischen Aufnahme des Mahakamgebietes stattfanden. Während Bier die eigentliche Aufnahme ausführte, beschäftigte ich mich mit eigenen Beobachtungen.
Als Ausrüstung hatte ich folgende Gegenstände mitgenommen: zwei Sätze geologischer Hämmer, einen Schmiedehammer, einen geologischen Kompass und Höhenbarometer und für die Verpackung der Handstücke sehr starke Leinwand und Metallnummern. Die Erfahrung hatte mich auf den beiden früheren Expeditionen gelehrt, dass das zum Aufbewahren von Gesteinen so häufig gebrauchte Packpapier für die Tropen ungeeignet ist, weil es bei einer Bewegung der aufeinander liegenden Stücke leicht durchreibt, besonders wenn es feucht wird, was auf langdauernden Reisen, wie den unsrigen, kaum zu vermeiden war; ausserdem wird Papier leicht von Ameisen, Termiten und anderen Tieren aufgefressen. Aus den gleichen Gründen fand ich es unpraktisch, Etiquetten aus Papier zu gebrauchen, die überdies nur an sehr trockenen Steinen haften bleiben und schnell unleserlich werden. Ich verpackte die Stücke daher in starke Leinwand, band sie mit einer Schnur fest und versah sie mit einer Metallnummer, die mit derjenigen meiner Aufzeichnungen übereinstimmte.
Den geologischen Beobachtungen kam es sehr zu statten, dass wir, wenn irgend möglich, grosse und kleine Flüsse als Reisewege zu benützen suchten. Hierdurch befanden wir uns stets an den einzigen Stellen, die uns über die geologische Formation des Gebietes, das wir durchreisten, Aufschluss geben konnten. Da mit Ausnahme der beinahe senkrechten, das Tal begrenzenden Felswände das ganze Gebiet des oberen Mahakam mit Urwald bedeckt ist, wird das unterliegende Gestein nahezu gänzlich vor Erosion geschützt. Nur die feinsten Teilchen werden von dem ablaufenden Regenwasser mitgeführt, alle grösseren Stücke bleiben liegen. Daher stösst man im Walde zuerst auf eine Humusschicht von wechselnder Dicke, die der Tiefe zu immer [304] mehr mit verwitterten Teilen des unterliegenden Gesteins vermischt ist. In unverwittertem Zustand trifft man das Gestein erst in einer Tiefe von vielen Metern an, daher ist es, um eine Übersicht über die geologische Beschaffenheit eines grösseren Gebietes zu erlangen, praktisch nicht erreichbar. Selbst an den steilen, aber bewachsenen Bergabhängen und oben auf den oft nur ½–2 m breiten Bergrücken findet man kein unverwittertes Gestein; man trifft es hier als eine Anhäufung loser, verwitterter Stückchen in einem Sack von Pflanzenwurzeln. Das ursprüngliche Gestein tritt hauptsächlich in den Flussbetten zu Tage. Hier ist das Wasser ständig damit beschäftigt, das unterliegende, feste Gestein von den stark verwitterten Lagen zu befreien; alles kleinere vom Ufer abgebröckelte oder von Bergstürzen herrührende Gestein wird abwärts geführt. Dies geschieht hauptsächlich, wenn die grossen Wassermassen eines tropischen Regens in den Gebirgsbächen unter heftigem Gefälle abwärts stürzen; derartiges Gestein wird dann mit Macht übereinandergeworfen und fortgeführt, wodurch es gleichzeitig von allen lockeren, verwitterten Teilen entblösst und glatt geschliffen wird. Vom Ursprung der Quellflüsse an bis zur letzten Geröllbank an der Flussmündung bedeckt dieses Geschiebe, stets kleiner und kleiner werdend, das ganze Flussbett.
Man findet daher in den Flussbetten sowohl festes Gestein, das in grösserer oder kleinerer Ausdehnung an den Ufern blossgelegt wird, als auch in den Geröllbänken eine Übersicht über das im Flussgebiet aufwärts anstehende Gestein. Beginnt man somit in den verschiedenen Nebenflüssen ein Stück weit oberhalb ihrer Mündungen die verschiedenen Gesteinsproben zu sammeln und ausserdem das blossliegende, feste Gestein bis zur Quelle hinauf zu untersuchen, so kann man zu einer für die Tropen möglichst exakten Vorstellung der geologischen Beschaffenheit eines Gebietes gelangen. Dieses Verfahren ist von besonderem Wert, wenn man es, wie es am oberen Mahakam der Fall ist, mit einem grösstenteils nicht vulkanischen Gebirge von einfachem Bau zu tun hat. Denn die zahlreichen Bergbesteigungen, die ich der topographischen Aufnahme wegen ausführen musste, boten mir nur sehr selten einen neuen Einblick in die geologische Formation des Gebirges; das Gestein, das wegen der alles überdeckenden Buschvegetation nur hier und da frei zum Vorschein kam, lieferte mir nur eine willkommene Bestätigung meiner im Flussbett gemachten Beobachtungen. Wichtiger war es, von den Berggipfeln, auf denen man die Bäume [305] gefällt hatte, eine Übersicht über das ganze Gebiet zu erlangen. Von hier aus liessen sich die Wirkungen der Erosion verfolgen, auch zogen eigenartig gebildete Berge oder Bergketten die Aufmerksamkeit auf sich und veranlassten besondere Untersuchungen. Diese waren hauptsächlich bei Formationen aus weichem Kalkstein wichtig, da letzterer bereits in geringem Abstand von seinem Standort durch die Gebirgsströme vernichtet wird.
Die Erklärungen, die sich die Eingeborenen über unser Sammeln von Gesteinen bildeten, waren sehr mannigfaltig. Dass es uns um Goldsuchen zu tun war, hielten sie für das Wahrscheinlichste; sie suchten zwar selbst am oberen Mahakam kein Gold, hatten aber von den Malaien gehört, dass wir darauf ausgingen. Als es sich herausstellte, dass ich Gestein der verschiedensten Art mitnahm, glaubte die Bevölkerung in mir einen Alchimisten zu sehen, der bei der Heimkehr alles Gestein zusammenschmelzen und daraus Gold herstellen würde. Auch diese Auslegung kam mir malaiischen Ursprungs vor. Von dieser Anschauung beherrscht gingen die Bahau auf unseren Exkursionen daher häufig darauf aus, Gestein zu suchen, das Pyrit oder Glimmer enthielt, weil sie diese für Gold ansahen. Obwohl sie selbst Flusssteinen von besonderer Form, mit einem Loch in der Mitte oder mit eigenartiger Krümmung, eine beschirmende Kraft zuschreiben und sie als Sitz eines bestimmten Geistes ansehen und obwohl sie auch hübsches Gestein, wie den batu boh aus dem Boh, als Schnallen für Schwertgürtel und als Perlen schleifen, konnten die Bahau doch mein Interesse für das Gestein an sich nicht begreifen. Nur selten widersetzten sich die Leute dem Sammeln der Gesteine,’ trotzdem sie oft unter der Last, die sie zu tragen bekamen, stöhnte.
An einigen Stellen des Flussufers, wo Geister hausen sollten, bat man mich allerdings, mit meinem Schmiedehammer keine Stücke abschlagen zu lassen, was ich denn auch nicht tat. An einigen anderen: Orten, wie in dem Flüsschen Tasan beim Berge Situn, wo die Ufer aus dunklen, senkrechten Felswänden bestehen, ergriffen alle Bahau die Flucht, als ich die Malaien einige Kalkstücke abschlagen liess.
Die topographische Aufnahme des oberen Mahakamgebietes stiess, der eigenartigen Umstände wegen, unter denen sie vorgenommen werden musste, auch auf besondere Schwierigkeiten. Bevor wir unser eigentliches Arbeitsfeld erreichten, hatten wir Bootfahrten auf kleinen, wilden Gebirgsbächen und Landzüge durch den Urwald im Quellgebiete des [306] Kapuas auszuführen, daher war es unmöglich gewesen, für die Bestimmung des Meridians eines Ortes Chronometer mitzunehmen, weil diese durch die Erschütterungen, denen sie während der Reise ausgesetzt gewesen wären, ihre Zuverlässigkeit eingebüsst hätten.
Die Möglichkeit, mittelst astronomischer Beobachtungen die Lage eines Ortes zu bestimmen, war somit ausgeschlossen und wir waren darauf angewiesen, an die topographische Aufnahme des Kapuasgebietes, welche nach neunjähriger Arbeit (1886–1895) von dem topographischen Institut der indischen Armee in Batavia ausgeführt worden war, anzuknüpfen. Während dieser Aufnahme waren bis zur Mündung des Kréhau Punkte astronomisch bestimmt und von diesen aus mittelst Triangulation die wichtigsten Bergspitzen fixiert worden, um als Anhaltspunkte für Detailaufnahmen zu dienen. Um diese vorzunehmen, hielten sich die Topographen monatelang in den unbewohnten Gebieten des oberen Kapuas auf.
Wie bereits im Kapitel XI berichtet worden ist, hatte der Topograph Werbata 1893 den Weg zum Pĕnaneh genau gemessen; da dieser Weg aber für unsere Verhältnisse zu beschwerlich war, hatten wir den nördlicheren zum Howong einschlagen müssen. Hätten wir mehr Zeit gehabt, so wäre es möglich gewesen, den zurückgelegten Weg direkt zu messen; da dies nicht der Fall war, mussten wir selbst einen Punkt suchen, den wir durch Anpeilen bereits bestimmter Berge im Kapuasgebiet zum Fixpunkt machen konnten. Daher scheuten wir keine Mühe, um auf der Wasserscheide nach einem derartigen Punkt zu suchen, den wir in der Tat auch fanden. Somit eröffnete sich uns die Aussicht, von hier aus durch direkte Messung des zurückgelegten Weges eine Grundlage für die weitere Aufnahme des ganzen Mahakamgebietes zu erhalten.
Ich hatte bereits auf meiner vorigen Reise feststellen können, dass das ganze Flussgebiet des oberen Mahakam, in gleicher Weise wie der übrige Teil Mittel-Borneos, aus einem Berg- und Hügelland ohne Ebenen besteht, das von zahlreichen Flüssen durchschnitten wird und ausser an den Stellen, wo die Bahau ihn zur Anlage von Reisfeldern gefällt haben, mit dichtem Walde vollständig überdeckt ist. Auch hatte ich mich bald davon überzeugt, dass wir von Landwegen nur sehr geringen Gebrauch würden machen können und dass wir den Mahakam und seine Nebenflüsse als wichtigste Reisewege würden benützen müssen. Da sich nur an den Ufern des Hauptstromes und [307] einiger Nebenflüsse Niederlassungen befinden, mussten, um weiter abgelegene Beobachtungspunkte zu erreichen, besondere Expeditionen ausgeführt werden.
Mit Rücksicht auf die noch unbekannten Verhältnisse, denen wir auf der Reise begegnen würden, und auf den Zweck unserer Reise, war es nicht möglich, von vorn herein einen festen Plan für die topographische Aufnahme auszuarbeiten. Die Umstände sollten bestimmen, wie lange wir am oberen Mahakam bleiben konnten und welche Züge wir in dieser Zeit zwecks der topographischen Aufnahme oder aus politischem Interesse würden unternehmen können. In jedem Falle musste auf eine feste Grundlage gebaut werden und, da das Messen des Weges sehr wohl möglich erschien, wurde beschlossen, von dem Fixpunkt auf der Wasserscheide aus den Landweg längs des Howong bis an den Mahakam und dann diesen Fluss selbst direkt zu messen. Im übrigen sollte die Zukunft lehren, in wie weit es möglich sein würde, durch Messen von Seitenwegen zu Wasser und zu Lande, durch Anpeilungen von Fixpunkten aus und durch Bergbesteigungen die Aufnahme dieses ausgedehnten Gebietes auszuführen.
Der Topograph Bier hatte sich für die Aufnahme mit einem Theodolit Tranche-Montagne, mit dem Azimuth und Höhe bestimmt werden konnten, und mit 3 m langen Massstäben, auf welchen eine Skala in Centimetern angegeben war, ausgerüstet. Im Fernrohr des Tranche-Montagne waren Kreuzfäden und Horizontalfäden gespannt, in solch einem Abstand, dass dieser mit der Anzahl Centimeter auf der Skala des Masstabes, welche man zwischen ihnen auf 100 m Distanz ablas, in einfachem Verhältnis stand. 100 Meter Abstand entsprachen 100 Centimetern auf der Skala. Eine Messkette hatten wir nicht mitgenommen, da unser Weg grossenteils zu Wasser zurückgelegt wurde und von einer regelrechten Triangulation des Gebirgslandes keine Rede sein konnte.

Junger Sklave der Kajan am oberen Mahakam.
Zur Kontrolle für die Höhenbestimmung durch direkte Messung mittelst des Theodolits war ich mit zwei guten Aneroidbarometern und einem Hypsometer ausgerüstet, an denen an allen wichtigen Punkten Ablesungen gemacht wurden.
Einer der Aneroidbarometer von der Firma Kipp en Zonen in Delft stimmte mit dem Hypsometer auf jeder Höhe überein; er hatte bereits die Reise 1896–1897 mitgemacht und war damals in der Sternwarte zu Leiden verifiziert worden.
Während der Reise wurde eine Abweichung des Kompasses des [308] Theodolits nur ein einziges Mal am Blu-u festgestellt, was teilweise auch dem Umstand zugeschrieben werden muss, dass der Himmel selten unbewölkt genug war, um während ẹines grossen Teils des Tages den Stand der Sonne mit genügender Schärfe mittelst des Fernrohres bestimmen zu können. Diesem Umstand muss vielleicht zugeschrieben werden; dass bei der Zeichnung der Karte im Massstab von 1 : 20000 die Länge des Mahakam bis zum astronomisch bestimmten Punkte Ana sich als richtig erwies, die Richtung jedoch um einen Grad nach Süden abwich.
Die Aufnahme des Landweges bereitete unserem Topographen, der jahrelang in dem waldbedeckten Gebirge Mittel-Sumatras gearbeitet hatte, keine Schwierigkeiten. Einer der ursprünglich 3 m langen Massstäbe wurde auf die Hälfte verkürzt, um auf den Waldpfaden seiner Länge wegen nicht hinderlich zu sein, ferner wurde etwas mehr Zeit darauf gewendet, um die gewundenen, steigenden und fallenden Pfade in kleinen Abständen messen zu können. Anders verhielt es sich mit dem Messen des Mahakam selbst, da die langen, schmalen Böte der Bahau zum Aufstellen des Theodolits nicht stabil genug sind. Auch das Aneinanderbinden mehrerer Böte war wegen der zahlreichen Verengungen und Stromschnellen im Fahrwasser sehr beschwerlich. Daher musste der Topograph auch bei der Flussmessung zum Aufstellen seines Instrumentes das feste Ufer wählen. Die Gehilfen, die in gesonderten Böten die Massstäbe hielten, lernten es bald, sich entweder mit ihren Böten zwischen Felsblöcken und Geröllbänken festzusetzen oder am Lande eine passende Stelle zu finden. In der Regel waren drei Böte erforderlich: eines für den Topographen und zwei für die Gehilfen. Indem Bier einen Massstab oberhalb und einen unterhalb seines eigenen Standplatzes aufstellen liess, konnte er von einem Punkte aus zwei Abstände im Flusse messen. Der stromaufwärts befindliche Gehilfe suchte sich, während der Topograph den stromabwärts befindlichen Massstab visierte, mit seinem Bote einen passenden Punkt weiter unten im Fluss aus, worauf der Topograph wiederum zwischen beiden Stand fasste und erst den jetzt flussaufwärts befindlichen Massstab visierte dann den flussabwärts befindlichen u.s.f.
Dadurch, dass Bier seine Messungen stets von dem am weitesten flussaufwärts gelegenen Punkt aus begann, lief er am wenigsten Gefahr, durch plötzliches Hochwasser aufgehalten zu werden, auch konnten sich die Böte mit dem Strome schnell abwärts bewegen. [309]
Dank der langen Zeit von beinahe zwei Jahren, die wir am oberen Mahakam zu verbringen gezwungen waren, und der Sicherheit, mit der wir uns bewegen konnten, gelang es dem Topographen, den Mahakam stückweise, von seinem Ursprung an der Grenze von Sĕrawak an bis zu dem astronomisch bestimmten Punkt Ana am mittleren Mahakam, zu messen. Indem er den Kaso bis zum Pĕnaneh, dem Endpunkt der Messung des Topographen Werbata, hinauffuhr, konnte er später seine Messung des Mahakamgebietes nochmals mit derjenigen des Kapuas in Verbindung bringen.
In Anbetracht, dass der Kapuas, von Pontianak aus, seiner ganzen Länge nach bereits gemessen war, wurde mit einer Messung des Mahakam diejenige Borneos von West nach Ost vollendet.
Im Zusammenhang mit dieser Aufnahme wurde die Wasserscheide zwischen Mahakam und Barito vier Mal erstiegen: im Januar 1899 längs des Blu-u der Batu Lĕsong; im Juni 1899, bei der Messung des Bunut, der Batu Ajo; im Juli 1899 von Long Deho aus das gleiche Gebirge, nördlicher; und im April 1900, dem Mobong entlang, wiederum der Batu-Ajo, an einer dazwischen liegenden Stelle.
Auch bei der Messung des Pahngè, eines der gebräuchlichsten Verbindungswege mit dem Baritogebiet, gelangte der Topograph bis dicht an die Wasserscheide. Ausser den genannten Nebenflüssen wurden auch noch der Tjĕhan, Mĕrasè und der Tĕpai so weit als möglich gemessen. An Bergen wurden der Aufnahme wegen bestiegen: der Liang Tibab am oberen Kapuas; der Lasan Tojang im Quellgebiet des Mahakam; der Batu Balo Baun am oberen Mahakam; der Lĕkudjan auf der Kapuas-Wasserscheide; der Liang Karing am Tjĕhan; zwei Berge am Kaso; der Batu Lĕsong auf der Barito-Wasserscheide; der Batu Karang und Batu Situn am Mĕrasè, der Batu Mili am Blu-u und der Batu Ajo an drei verschiedenen Stellen.
Zwar suchten wir, um eine möglichst vollständige Übersicht über die Umgebung zu erlangen, zur Besteigung freiliegende Berge zu wählen, doch mussten wir oft auf besondere Umstände Rücksicht nehmen.
Da viele dieser Berge von den Kajan noch nie erstiegen waren, mussten wir, von anderen Erhebungen aus, häufig selbst eine Seite aussuchen, von der aus man den Gipfel wahrscheinlich erreichen konnte. Auf dem Gipfel angekommen befanden wir uns in einem dichten Walde, so dass zur Erlangung einer Aussicht erst Durchhaue ausgeführt [310] werden mussten. War der Gipfel sehr klein oder nur mit Gestrüpp bewachsen, wie wir es jedoch nur einmal trafen, so wurden auf das Fällen der Bäume einige Tage verwandt. Für gewöhnlich war dieses Verfahren aber wegen der grossen Oberfläche des Gipfels und wegen der grossen Härte der Gebirgsbäume nicht möglich. Wir wählten dann den höchsten Baum aus, liessen die meisten Äste entfernen und auf den übriggebliebenen eine feste Plattform bauen, auf der man mit Sicherheit visieren konnte. Der Auf- und Abstieg auf der primitiven Leiter war aber sowohl für Bier als für mich ein Wagstück. In unmittelbarer Nähe unseres Beobachtungspostens musste ausserdem stets eine grössere Anzahl Bäume gefällt werden, weil deren Kronen die Aussicht zu sehr beeinträchtigten.
Wegen der Abreise des Topographen Bier vor dem Beginn unserer Expedition ins Quellgebiet des Kajan konnte von einer sorgfältigen Aufnahme dieser Gegend keine Rede sein. Dafür übernahm es der Photograph Demmeni, den Weg mittelst Handbussole und Schätzung des Abstandes zu messen, wie er es bereits während der ersten Reise 1896–1897 am Mahakam mit gutem Erfolg getan hatte.
Auch für unsere topographischen Arbeiten hatten die Eingeborenen bald eine Erklärung gefunden oder von den Malaien übernommen, sie glaubten nämlich, dass es uns darum zu tun sei, ihre Schlupfwinkel zu Kriegszwecken kennen zu lernen. Wir konnten sie von ihrer Überzeugung nicht abbringen, trotzdem wir darauf hinwiesen, dass wir uns doch nur an die Häuptflüsse und wichtigsten Berge hielten und dass Bier seine Karte ausarbeitete, ohne ihre nächste Umgebung viel zu beachten. Trotzdem sind wir am oberen und mittleren Mahakam nie auf Widerstand seitens der Bahau gestossen; diese unternahmen unserer Arbeit wegen häufig weite Reisen in ihnen selbst unbekannte Gegenden.
Anfangs hatte es allerdings den Anschein, als arbeite man uns entgegen; denn nur selten erhielten wir über die Namen kleinerer Flüsse oder etwas abgelegenerer Berge richtige Auskunft. Entweder behauptete man, nichts zu wissen, oder man gab falsche Namen an. Zu unserem Erstaunen stellte es sich aber später heraus, dass mit geringen Ausnahmen wirkliche Unwissenheit in bezug auf alles, was sich nicht in unmittelbarer Nähe des Stammesgebietes befand, vorlag. Selbst hohe, die ganze Landschaft beherrschende Berge trugen nur bei den in nächster Nähe wohnenden Stämmen einen Namen. Nur diejenigen, [311] die zu wiederholten Malen längs des gleichen Flusses gereist waren, konnten mit einiger Sicherheit dessen Namen angeben.
Die meisten kamen übrigens ihr Leben lang nicht aus ihrer Umgebung heraus und hatten für alles, was im Gebiet des benachbarten Stammes lag, kein Interesse. Da wir uns mit Hilfe eines Bahau von einer Bergspitze aus absolut nicht orientieren konnten, lernten wir bald, unsere eigenen Erfahrungen und Beobachtungen zu Rate zu ziehen, sowohl wenn es galt, die Identität eines Berges festzustellen, als auch wenn ein Plan zur Erreichung eines bestimmten Punktes als Beobachtungspunkt gefasst werden musste.
Sollten unbekannte oder gefürchtete Gegenden besucht werden, so bildete für die Bahau nicht nur Unwissenheit, sondern auch Angst um ihre eigene und unsere Sicherheit einen Hinderungsgrund. Unserer topographischen Arbeit wegen mussten wir immer wieder Bergspitzen zu erklimmen suchen und gerade vor diesen fürchten sich die Eingeborenen so sehr, weil die Berghöhlen von bösen Geistern, hauptsächlich von den Donnergeistern, bewohnt werden. Um die gefürchteten Unternehmungen zu verhindern, nahmen die Bahau häufig zu falscher oder entsetzlich übertriebener Auskunft ihre Zuflucht; den Kern von Wahrheit mussten wir selbst herauszufinden suchen. Sobald ich aber den Zug mit einigen ihrer Männer wirklich antrat, taten sie alles, um ihm einen guten Erfolg zu sichern.
Wenige Hilfsmittel für Untersuchungen aller Art gewähren einem auf der Reise so viel Befriedigung als die Photographie; sie erfordert jedoch, je nach dem Ziel, das man verfolgt, und dem Land, das man bereisen will, eine besondere und sorgfältig gewählte Ausrüstung. Für ein sehr feuchtes Tropenklima, wie dasjenige von Borneo, sind Apparate von besonderer Widerstandsfähigkeit erforderlich. Obgleich wir bei der Zusammenstellung der Ausrüstung die verschiedensten Punkte eingehend berücksichtigten, wäre es uns ohne die besondere Geschicklichkeit Demmenis als Mechaniker, der im stande war, bald dieses, bald jenes an der Kamera und vor allem an den Wechselkassetten zu reparieren, nicht geglückt, länger als einige Monate zu photographieren. Hauptsächlich erforderten die neu aus Europa empfangenen Gegenstände, obgleich sie aus sehr gutem Material verfertigt waren, eine ständige Ausbesserung; bald krümmten sie sich vor Feuchtigkeit und Hitze, bald löste sich der Leim und musste durch Schrauben ersetzt werden. [312]
Auch in bezug auf die photographische Ausrüstung galt unser Grundsatz: so vollständig und so leicht transportierbar als möglich. Hierbei kamen hauptsächlich die Platten in Betracht. Als besonders geeignet erwiesen sich die Extra-Rapid-Films 13 × 18 der Firma Perutz in München; sie hatten den grossen Vorzug, leicht und unzerbrechlich zu sein und ein kleines Volumen einzunehmen. Der Apparat selbst bestand aus einer für die Tropen gearbeiteten Reisekamera aus Mahagoniholz, Format 13 × 18, auf sehr festem Stativ, versehen mit einem Anastigmat von Zeiss mit einem Momentverschluss von Linhof.
Die Kamera hatte mir bereits auf den beiden vorigen Reisen gedient und war somit klimabeständig. Der lederne Balg war gegen Insekten und Schimmel mit einer starken Lösung von arsenigsaurem Natron eingerieben und verursachte uns während der ganzen Reise keine Schwierigkeiten. In Verband mit der Benützung von Films gebrauchte ich auf der Reise 1896–97 eine Wechselkassette, welche in der Tat grosse Dienste geleistet hat, aber, wie erwähnt, nicht ohne ständige Ausbesserung seitens des Photographen. Nachdem wir sie mit einem neuen Sack ausgerüstet hatten, wurde sie gelegentlich auch auf der letzten Reise gebraucht, hauptsächlich wurde aber mit einer Wechselkassette von Grundmann Zaspel gearbeitet, sie erwies sich aber, bevor wichtige hölzerne Teile durch metallene ersetzt worden waren, als vollständig ungeeignet für die Tropen. Für diese Wechselkassetten mussten Filmsträger aus Aluminium gebraucht werden, in welche die Films seitlich eingeschoben wurden. Häufig standen die Films verbogen darin, so dass die Bilder in der Mitte oder an den Seiten weniger scharf wurden als an anderen Stellen; hiervon abgesehen, erfüllten sie ihren Zweck sehr gut.
Eine metallene Kamera mitzunehmen, ist sehr ratsam; jedenfalls aber sollte man sich mit metallenen Chassis versehen; ihrer sechs werden sich stets als genügend erweisen.
Die Extra-Rapid-Films von Perutz haben mir auch, was Haltbarkeit der Films und Deutlichkeit der Bilder betrifft, stets gut gefallen. Sobald man nicht in der Lage ist, einen neuen Vorrat Films anzugreifen, lernt man deren grosse Haltbarkeit schätzen; sie hatten auch nach zwei Jahren nichts an Empfindlichkeit eingebüsst und lieferten ebenso deutliche Bilder als zuvor. Vorsichtshalber hatte ich bereits in der Fabrik jedes Dutzend gesondert in Zinkkästchen verlöten lassen, so dass wenigstens der Einfluss der Feuchtigkeit ausgeschlossen war; vor zu grosser Erhitzung suchten wir sie ebenfalls so viel als möglich zu schützen. [313]
Chemikalien und Gerätschaften, um die belichteten Films schon auf der Reise entwickeln zu können, wurden in genügender Menge mitgenommen. Das Entwickeln wurde denn auch stets, sobald Aussicht vorhanden war, das Negativ vollständig abarbeiten zu können, baldmöglichst vorgenommen. Als Entwickler diente fast ausschliesslich Hydrochinon; für Momentaufnahmen diente zuletzt auch Methol.
Da ohne Dunkelkammer gearbeitet werden musste, wurde immer abends entwickelt und es zeigte sich, dass bei einer Entwicklung im Walde auch eventueller Mondschein den Prozess wenig benachteiligte.
Positive wurden während der Reise nicht verfertigt. Auf allen Reisen hatten wir ausser dieser Ausrüstung noch Detektivkameras für Momentaufnahmen von kleinerem Format mitgenommen. Obgleich wir kostbare Apparate angeschafft hatten, waren sie für die Tropen doch ungeeignet und lieferten selten gute Resultate. Teilweise trugen hieran die eigenartigen Umstände, unter denen wir photographieren mussten, und die Gegenstände, welche wir photographieren wollten, die Schuld. Bei unserem Reiseleben musste eine Aufnahme oft in einem bestimmten Augenblick, bei schlechter Beleuchtung, bei Regen u.s.f. gemacht werden. Handelte es sich um Personen, so waren fast stets nur Momentaufnahmen möglich, da die Bahau vom Stillestehen keine Ahnung haben; erst viel später konnten wir bei einigen von ihnen eine Zeitaufnahme ausführen.
Innerhalb der Häuser konnte nur bei sehr langer Exposition photographiert werden, weil die Beleuchtung in den Wohnungen eine sehr schlechte ist und die Wände noch dazu so dunkel sind, dass auch Momentaufnahmen bei Magnesiumlicht wegen der starken Absorption des Lichtes durch die Wände missglückten. Nur da, wo wir Zeitaufnahmen bei Magnesiumlicht machen konnten, hatten wir guten Erfolg. Festlichkeiten, Versammlungen und allerhand Szenen, bei denen viele Menschen anwesend waren, konnten wir innerhalb des Hauses daher nicht photographieren.
Ausser durch ihre Unfähigkeit stillzusitzen bereitete die Bahaubevölkerung den photographischen Aufnahmen auch sonst noch so grosse Schwierigkeiten, dass wir häufig von einer Aufnahme ganz absehen oder sie auf Monate, auf eine günstigere Gelegenheit, verschieben mussten. Die Abneigung der Eingeborenen gegen die Photographie hatte ihre eigenen Gründe. Der unbekannte Zweck und das Geheimnisvolle der einen, augenartigen Linse erschreckte die Leute. [314] Man hätte eine derartige Angst durch angemessene Belohnung überwinden können, wenn die Bahau nicht überzeugt gewesen wären, dass ihre Seele (bruwa) vor Schreck den Körper verlassen könnte, was Krankheit und Tod zur Folge gehabt hätte.
Noch eine andere Eigenschaft der Bahauseele schreckte die Leute von der Photographie ab: die Seele konnte nämlich Bild und Original verwechseln und ersterem, somit auch uns, folgen, was natürlich grenzenloses Elend veranlasst hätte; denn nicht nur, dass der Körper dadurch erkrankt wäre, sondern ich hätte dadurch auch auf weite Entfernung auf die abgebildete Person Einfluss ausüben können.
Einige Male hörte ich auch einige alte Männer erklären, dass sie sich nicht photographieren lassen wollten, weil ihre Bilder später in ein Buch aufgenommen und von jedem besehen werden würden. Von der Aufnahme in ein Buch hatten sie natürlich durch unsere Malaien gehört, die sich übrigens auch selbst nur zögernd und ängstlich zu einer Aufnahme hergaben.
Anfangs gaben sich die Menschen von dem allem nicht Rechenschaft. Als wir daher zum ersten Mal im Jahre 1896 am Mahakam zur Zeit des Saatfestes eintrafen, waren uns die Kajan bei der Aufnahme der interessanten Maskentänze, die zum Glück im Freien stattfanden, noch selbst behilflich. Nachdem alle Zweifel einmal entstanden waren, dauerte es aber vier Monate, bevor wir jemand dazu bringen konnten, sich vor unsere Kamera zu stellen. Zuerst überwanden einige junge Männer ihre Skrupel, dann zeigte sich auch ein leichtsinniges, fröhliches junges Mädchen, Anja Song, zur Aufnahme bereit. Das Mädchen verkehrte so häufig in unserer Hütte, dass sie einerseits die Angst vor allem Ungewöhnlichen verlor, anderseits der Verlockung, mit Perlen und hübschem Zeug belohnt zu werden, nicht länger widerstehen konnte. Anja Songs Heldenhaftigkeit hatte übrigens auch noch einen tieferen Grund; das Mädchen, eine halbe Sklavin, liebte Sawang Jok, einen der vornehmsten jungen Leute des Stammes, und, da dieser sich hatte photographieren lassen, wollte ihm Anja Song an Mut nicht nachstehen. Als sie von den Eltern ihres leichtsinnigen Benehmens wegen streng bestraft wurde, überredete sie zur eigenen Entschuldigung einige Freundinnen, sich ebenfalls zur Photographie herzugeben. Nachdem die Bresche einmal geschlagen war, erhielten unsere Aufnahmen einen grossen Zulauf, besonders war dies bei unserem zweiten Besuch bei den Kajan am Blu-u der Fall, aber erst nachdem wir wiederum einige [315] Monate bei ihnen gelebt hatten. Diesem Zulauf haben die Bilder, welche die verschiedenen Industrieen der Bahau darstellen, ihr Dasein zu verdanken.
Bei den Mendalam Kajan war das Vorurteil vor der Photographie viel schwerer zu überwinden als bei denen am Mahakam; das Gleiche galt auch in bezug auf die anthropometrischen Messungen. Da mir bei meinem ersten Aufenthalt unter ihnen, im Jahre 1894, hauptsächlich an letzteren gelegen war, liess ich die Photographie ruhen. Im Jahre 1896, als ich meine Expedition zum Mahakam bei ihnen vorbereitete, vermied ich alles, was irgendwie ungünstig auf den Verlauf unserer Unterhandlungen hätte einwirken können; als man sich daher zur Aufnahme nicht willig zeigte, suchte ich nichts durchzusetzen. Nur meine alte Freundin Usun überwand sich selbst, um mir eine Freude zu machen, und kam nach meiner Abreise von Tandjong Karang nach Putus Sibau, um sich photographieren zu lassen. Bei ihrem hohen Alter spielte wohl auch die Überlegung, dass der Photograph ihrer Ehrbarkeit Abbruch tun könnte, wenn er an ihrem umgekehrten Bilde auf der Mattscheibe unerlaubte Dinge sehen würde, keine grosse Rolle. Die vielen Malaien, die am Mendalam verkehrten, hatten nämlich erzählt, dass beim Photographieren sowohl die Personen als deren Kleider sich umkehrten. Auf Usun Photographie ist daher zu sehen, dass sie über die gewöhnliche tă-ā noch ein besonderes Tuch geschlungen hat und dass sie beide Arme krampfhaft an ihre Beine presst, um den Röck festzuhalten. Obgleich wir den Kajan häufig das Bild auf dem Mattglas zeigten, konnten wir ihnen doch die von den Malaien übernommene Überzeugung nicht nehmen. [316]
Kapitel XV.
Verhältnisse bei den Mahakam Kajan.—Zeitrechnung—Beschäftigungen während der Verbotszeit—Besteigung des Batu Mili—Saatfest—Maskenspiel—Kreiselspiel—Abschied von Adam Igau und Jung—Fahrt zum Mĕrasè—Tod des Häuptlings Bo Li—Begegnung mit malaiischen Rebellen—Beginn mit der Mahakamaufnahme—Zweite Besteigung des Batu Mili—Sage vom Batu Mili—Hahnenkämpfe.
Der Stamm der Kajan befand sich bei unserer Ankunft in einer Übergangsperiode. Nach der letzten günstigen Ernte im Frühling waren zwar die meisten Familien, die seit dem Niederbrennen ihres langen Hauses, 13 Jahre lang, zerstreut auf ihren Reisfeldern gewohnt hatten, an die Mündung des Blu-u gezogen, aber der Hausbau schritt doch nur sehr langsam vorwärts; auch waren viele Familien durch die jahrelange Trennung einander völlig entfremdet und so scheu geworden, dass sie es nicht wagten, mit den eigenen Stammesgenossen am Blu-u zusammenzuziehen. Aus Besorgnis, dass diese Entfremdung den Stammverband und somit die innere Macht des Stammes lockern könnte, wünschte Kwing Irang, dass sich alle Familien baldmöglichst in der neuen Niederlassung vereinigten.
Die Familien der Sklaven zur Rückkehr zu bewegen, war für den Häuptling eine besonders schwierige Aufgabe; denn diese hatten in oft weit entlegenen Flusstälern jahrelang die grösste Freiheit genossen und fürchteten nun mit Recht, dass sie nach ihrer Rückkehr zum Stamme gezwungen sein würden, mehr für den Häuptling zu arbeiten. Nur 10 Sklavenfamilien hatte Kwing Irang, dem wenigstens 150 dipe̥n gehörten, bei sich zurückbehalten und einige andere bebauten unter Aufsicht einer ihm befreundeten, freien Kajanfamilie seine weiter abgelegenen Felder.

Steine zur Bestimmung des Sonnestandes während der Saatzeit.
Die gute Ernte, der sich die Kajan in diesem Jahre erfreuten, spürte ich sogleich an der Schnelligkeit, mit der sich die vom Häuptling geliehenen grossen Fässer aus Baumrinde mit gewöhnlichem Reis und Klebreis füllten. Der reichen Ernte wegen hatte der Stamm auch noch nicht mit Säen begonnen, obgleich es bereits Oktober war. Bei meiner [317] Ankunft 1896 hatte man bereits Anfang September gesät; damals war aber eine Missernte vorangegangen, auch wurden diesmal viele durch den Umzug an der Feldarbeit verhindert.
Die meisten Familien legten in diesem Jahre, des Überflusses an Reis und des Häuserbaues wegen, nur kleine Reisfelder an.
Der offizielle Saattag fiel diesmal, wie auch sonst öfters, nicht mit dem wirklichen Saattag zusammen. Den ersteren bestimmt der alte Priester Bo Jok, nach dem Stand der Sonne, indem er neben dem Hause zwei längliche Steine, einen grösseren und einen kleineren, aufrichtet und dann den Zeitpunkt beobachtet, in dem die Sonne in der Verlängerung der Verbindungslinie dieser beiden Steine hinter den gegenüberliegenden Hügeln untergeht. Der Saattag ist der einzige, den Bo Jok auf astronomischem Wege bestimmt. Im übrigen ist die Zeitrechnung bei den Kajan eine mehr oder weniger willkürliche und vom Ackerbau abhängige (Siehe Kap. VIII).
Der Monat oder, wie sie sagen, der Mond (bulăn) spielt bei den Kajan eine grössere Rolle als das Jahr (dumān), von dem kaum jemand recht weiss, aus wievielen Monden es besteht. Für gewöhnlich rechnen sie ein bis zwei Monde auf die Saat, 5 Monde auf die Zeit, die der Reis zum Reifen nötig hat, zwei bis drei Monde auf die Ernte und drei Monde bis zur folgenden Saat.
Die verschiedenen Monde besitzen bei den Bahau keine besonderen Namen.
Bei den Mendalam Kajan besitzen die verschiedenen Tage in der Zeit des sichtbaren Mondes folgende Namen in der Busang Sprache: njinā (sehen) dang (genügend); matan (Auge) dang; lĕkurdang; butit (Bauch) halab (Tetradon, ein Kofferfisch) ok (klein); butit halab aja (gross); kĕlĕong (Körper) paja ok; kĕlĕong paja aja; bĕliling (Rand) dija und kamat (voller Mond). Die folgenden Tage tragen die gleichen Namen, aber in umgekehrter Reihenfolge und mit der Hinzufügung von uli = nach Hause gehen. Die Tage des unsichtbaren Mondes werden nicht bezeichnet.
Die verschiedenen Tageszeiten heissen im Busang der Mendalam Kajan: dow (Tag) bĕkang (offen, gespalten), um 6 Uhr morgens; dow njirang (scheinen) mahing (kräftig), um 9 Uhr ungefähr; dow nĕgrang (aufrecht) marong (wirklich), um 12 Uhr; dow njaja (gross), um 4 Uhr; dow lĕbi (klein), um 6 Uhr abends.
Die Mahakam Kajan besitzen für die Tageszeiten andere Bezeichnungen: [318] bĕluwa (halb) dow, um 12 Uhr mittags; dow uli (von der Feldarbeit heimkehren), ungefähr 4 Uhr; tiling (ein Heimchen, das sich nur bei Sonnenuntergang hören lässt) duan (tönen), um 6 Uhr.
Während die übrigen Stämme mit den Saatfesten und Verbotszeiten bereits begonnen hatten, trafen die Kajan erst ihre Vorbereitungen. Am 13. Oktober liess auch Kwing Irang endlich für seinen Stamm die Verbotszeit eintreten, die auch für uns eine Zeit grosser und sehr erwünschter Ruhe wurde, denn weitaus die meisten arbeitsfähigen Familienglieder zogen bereits morgens früh nach ihren Reisfeldern, um dort die erforderlichen Zeremonien zu verrichten und mit dem Säen zu beginnen. Da die Bahau bei dieser Gelegenheit intim mit ihren Geistern verkehren und die Gegenwart der schreckenerregenden Fremden hierbei von nachteiligem Einfluss ist, überwand ich, um mit allen Leuten auf gutem Fuss zu stehen, meine Neugier und blieb mit den Meinen ruhig zu Hause. Übrigens hatte ich ja auch schon am Mendalam das Saatfest miterlebt. Die Verbotszeit erstreckte sich auch auf uns, und so genossen wir, da ausser Kajan niemand zur Niederlassung Zutritt hatte, auch von aussen her der Ruhe.
Als Tigang mit den Seinen bereits am 16. Oktober bei uns eintraf, durfte er unser Dorf nicht betreten. Er hatte den Mĕrasè hinauffahren wollen, um die Ma-Suling zu besuchen, hatte aber seinen Plan aufgeben müssen, da bei diesen am Tage zuvor die Verbotszeit eingetreten war.
Die Ma-Suling vom Mendalam waren dort noch rechtzeitig, zwei Tage zuvor, angekommen, durften nun aber vor Ablauf des lāli nugal nicht von dort weg. Tigang hatte auch die Niederlassung Lulu Njiwung wegen des lāli gesperrt gefunden und war dann flussabwärts bis nach Long Tĕpai gefahren, wo er Reis für seine Rückreise hatte einkaufen können. Er hatte die Absicht, bei Bĕlarè einen günstigen Wasserstand abzuwarten und dann schnell nach dem Mendalam zurückzukehren; daher beendeten wir eiligst unsere Briefe und Berichte für die Aussenwelt und reichten sie ihm unter Kwing Irangs Zustimmung in sein Boot. Reis, Tabak und andere Dinge durften wir ihm jedoch nicht mitgeben.
Glücklicher Weise war es meinen Jägern und Pflanzensuchern, falls sie nicht die Nacht fortblieben, gestattet, täglich in der Umgegend umherzuschweifen. Abends waren wir wohl ein bis zwei Stunden damit beschäftigt, den Kajan die vom Felde mitgebrachten Insekten und anderen Tiere abzukaufen; Demmeni und zwei der geschicktesten Malaien, [319] Murchar und Abdul, übernahmen die Verpackung der Tiere. Gleichzeitig suchte Demmeni auch den Schaden, den die photographischen Apparate während der Reise durch Feuchtigkeit erlitten hatten, wieder gut zu machen, was ihm auch, dank der praktischen Ausrüstung an Werkzeugen aller Art, die er mitgenommen hatte, glückte.
Der Kontrolleur, der bisher jeden Tag Adjāng, Akam Igaus Sohn, unterrichtet und gleichzeitig auch von ihm gelernt hatte, gab sich alle Mühe, diese Quelle des Busang noch nach Möglichkeit auszunützen; denn so gern wir diesen allgemein beliebten Reisegesellen auch bei uns behalten hätten, mussten wir ihn jetzt doch mit seinem Vater, der sich zu den Kĕnja am Tawang begab, weiter ziehen lassen, da Akam Igau aus Furcht vor seiner Tochter Tipong nicht wagte, Adjāng zurückzulassen, obgleich dieser selbst gern bei uns geblieben wäre.
Inzwischen überlegte ich mit Bier, was mit Rücksicht auf die Überzeugungen unserer Gastherren im Augenblick für die Aufnahme des Mahakamgebietes getan werden konnte. Ein systematisches Zuwerkegehen, wie in einem Lande, in dem man sich jederzeit frei bewegen kann, war hier unmöglich. Am wünschenswertesten wäre es gewesen, mit der Messung des Mahakam vom Howong an zu beginnen, aber in dieser Zeit des lāli nugal durften wir nicht von Hause fort, ich musste sogar 6 Tage warten, bevor ich Bier von einem hoch gelegenen Reisfelde aus eine Übersicht über die Umgegend geben durfte. Die Reisfelder liegen hier nämlich nicht, wie in dem flachen Lande am Mendalam, tief, sondern an den Abhängen oder auf den Gipfeln der Hügelreihen, welche die Kajan zu diesem Zweck entwaldet haben. Da sich die Felder oft bis 200 m oberhalb des Mahakam befinden, bieten sie prachtvolle Aussichtspunkte auf die mit dichtem Walde bedeckte Umgebung.
Ein viel verlockenderer Aussichtspunkt lag jedoch gegenüber, am anderen Ufer des Mahakam, nämlich ein ganz freistehender, oben beinahe kahler, 800 m hoher Andesitkegel, der Batu Mili, der ein prachtvolles Panorama des oberen Mahakamgebietes liefern und daher auch für unseren weiteren Plan der Aufnahme von grösster Wichtigkeit sein musste. Dieses ins Auge fallende Ungeheuer, das seinen 100 m hohen zylinderförmigen Gipfel so unheilverkündend grau aus dem mit dunkelgrünem Urwald bedeckten Kegel erhob, hatte natürlich auf die Gemüter der Kajan tiefen Eindruck gemacht.
Über den Ursprung des Batu Mili und über seine Rolle als Wohnplatz [320] vieler Donnergeister bestehen zahlreiche Erzählungen und sowohl sein Gipfel als auch die Wälder auf seinen Abhängen flössen Schrecken ein; selbst die am anderen Ufer oberhalb am Fluss wohnenden Malaien vermeiden den Berg. Nur in grosser Entfernung darf man Wald zur Anlage von Reisfeldern fällen und dem in diesen unberührten Wäldern zahlreichen Wild Fallen stellen.

Der Batu Mili bei Long Blu-u.
Die Angst der Kajan vor dem Batu Mili erscheint um so unverständlicher, als sie sehr wohl wissen, dass ein Mann einst einen Monat lang unbeschadet auf seinem Gipfel zugebracht hat. Wie mir nämlich Lirung, Kwing Irangs Nichte, erzählte, hatte in ihrer Jugend, vor zwanzig Jahren, in dem damals weiter oben gelegenen Hause ihres Vaters ein Mann gewohnt, für den das Leben nach dem Tode seiner Frau keinen Reiz mehr hatte. Um mit der geliebten Gattin in Apu Ke̥siọ bald wieder vereinigt zu werden, beschloss der Mann, sich das Leben zu nehmen. Er hielt es jedoch für des Gedächtnisses seiner Frau unwürdig, sich auf die übliche Weise, durch Ertränken, Halsabschneiden oder Pfeilgiftessen umzubringen, und bestieg daher den Batu Mili, in der Hoffnung, von den auf dem Gipfel hausenden Geistern getötet zu werden. Länge hörte man nichts von dem Manne, bis er eines Tages entsetzlich abgemagert, sonst aber unversehrt, zurückkehrte—die Geister hatten ihn nicht töten wollen. Er lebte noch mehrere Jahre im Stamme, heiratete aber nicht wieder. Einige meiner Leute hatten ihn noch gekannt.
In der letzten Zeit, wo die Kajan in nächster Nähe ihres Dorfes nach Grundstücken suchten, hatten sich einzelne doch viel näher an den gefürchteten Berg herangewagt als früher. So hatte einer der angesehensten Männer des Stammes, Bo Kwai, dessen Sohn Maring uns bei unserem vorigen Besuch oft als Führer gedient hatte, sogar auf dem westlichen Rücken des Batu Mili sein Reisfeld anzulegen gewagt. Nach diesem hochgelegenen Punkte wollte ich Bier zur Orientierung führen, zugleich aber auch versuchen, längs dieses Rückens, der, nach den Gipfeln der Bäume zu urteilen, am höchsten auf die nach allen anderen Seiten senkrecht abfallende Spitze hinaufführte, zu einem noch günstigeren Aussichtspunkte zu gelangen. Kwing Irang schüttelte das Haupt und erklärte bestimmt, dass wenigstens der Gipfel des Berges nicht zu besteigen sei. Keiner der Kajan wollte uns weiter als bis zum Reisfeld des Bo Kwai führen und auch dahin wollten nur zwei mit; die anderen fürchteten, dass man sie am Ende doch noch [321] zwingen würde, in diese schreckenerregenden Wälder einzudringen. Meine eigenen Leute waren, als Fremde in dieser Gegend, weniger bang vor den Geistern des Batu Mili und drei der besten, der Korporal Suka, der dajakisches Blut mit malaiischer Energie vereinigte, und zwei Pinau Malaien erklärten sich zum Mitgehen bereit. Unter dem fremden Gesindel, das sich am Mahakam auf hielt, befand sich auch der bereits erwähnte Chinese Mi-Au-Tong, der wegen Schulden aus Pontianak erst nach Sintang, dann an den oberen Kapuas und schliesslich an den oberen Mahakam geflüchtet war; da der Mann die Umgegend kannte und auf einen guten Taglohn erpicht war, nahm ich ihn mit.
Am Morgen des 22. Oktober machten wir uns auf den Weg. Über die neu angelegten Reisfelder am Fusse des Berges gelangten wir an einen bewaldeten Abhang, den wir hinaufstiegen, bis wir endlich nach einigen Stunden auf 650 m Höhe vor einer senkrechten Felswand standen, die ein Erklimmen des Gipfels unmöglich zu machen schien. Die Vegetation kam uns aber auch diesmal zu Hilfe, denn die Malaien entdeckten bald hinter ein paar Felsblöcken eine 2–3 m breite Felsspalte, an welcher einige mächtige Lianen wie dicke Kabel herabhingen und eine vorzügliche Gelegenheit zum Klettern boten. Meine barfüssigen Begleiter kletterten denn auch sogleich an den Lianen hinauf und schwangen sich dann auf eine durch Baumwurzeln zusammengehaltene Felsmasse an der rechten Seite der Spalte. Von dort aus fanden sie augenscheinlich eine Möglichkeit zum Weiterkommen; denn ihre Stimmen verklangen mehr und mehr. Da ich mit meinen beschuhten Füssen das Kletterkunststück meiner Leute nicht nachmachen konnte, rief ich sie mit meiner Pfeife zurück, um ein Mittel zu ersinnen, das auch mich über die Felswand brächte. Dünne, gerade Stämmchen und Rotang, um sie zu verbinden, waren in nächster Nähe im Überfluss vorhanden; so war denn bald eine Art Leiter hergestellt, auf der ich unter Zurücklassung meines Hundes und Stockes gut folgen konnte. Der Hund erhob allerdings ein Jammergeheul, das erst endete, als ich mich später wohlbehalten wieder bei ihm einfand.
Weiter oben ging es an einer Seitenwand des Rückens hinauf, wobei wir die Hände mindestens ebensoviel als die Füsse gebrauchten. Zwischen Gestrüpp hindurch führten mich meine Begleiter über moosbedeckte Wurzeln den Abhang aufwärts, der ohne diese gänzlich unzugänglich gewesen wäre. Vor und hinter mir achtete je ein Malaie darauf, dass die Wurzeln, denen ich mein Gewicht anvertraute, auch [322] stark genug waren und dass ich meinen Fuss nicht auf Moos setzte, das von unten nicht genügend gestützt war oder auf einem verfaulten Baumstamm lag. So kamen wir langsam aber doch stetig vorwärts und, nachdem wir noch einen Punkt passiert hatten, von dem aus ich auf Anraten des Chinesen nicht nach rechts blicken durfte, wurde der Rücken weiter oben gangbarer, da wir einem augenscheinlich durch Tiere unterhaltenen Pfade folgen konnten. Wir mussten ihn zwar kriechend zurücklegen, standen aber bald vor der nackten Felswand dicht unter dem Gipfel. Ein Spalt in der Mauer und einige Unregelmässigkeiten im Gestein genügten, um meine Leute bei 70° Steigung über die 20 m hohe Wand zu bringen, und, da sie der Meinung waren, dass ich, einmal so weit gekommen, nun auch die Spitze besteigen müsste, entledigte ich mich meines Schuhwerks und langte mit einiger Hilfe ebenfalls oben an.
Nachdem wir die herrliche Aussicht über die weite Waldlandschaft genossen hatten, beeilten wir uns, auf dem gleichen Wege wieder nach Hause zu gelangen, und kamen in der Tat glücklich, wenn auch sehr ermüdet, heim.
Das Erstaunen der Kajan über das unerwartete Gelingen unseres Unternehmens war gross; sie hatten von unserer Anwesenheit auf dem Gipfel aber nichts gemerkt und auch unsere Schüsse nicht gehört, so dass ein an einen Stock gebundenes Stück weissen Kattuns, das wir oben als Signal zurückgelassen hatten, unserer Erzählung als Beweis dienen musste.
In Anbetracht, dass wir auf dem Gipfel für Beobachtungen keine Zeit gehabt hatten und Bier auch nicht dabei gewesen war, nahm ich mir vor, bald wieder dorthin zurückzukehren. Kwing Irang, von Natur unternehmend, aber durch seine Umgebung und seinen Aberglauben eingeschüchtert, erklärte sich jetzt sogleich bereit, mich zu begleiten. Darauf meldeten sich auch einige zwanzig junge Kajan als Begleiter auf den bisher so gefürchteten Berg an; doch musste die zweite Besteigung bis nach Ablauf der Verbotszeit und der drückendsten Arbeit während der Saatzeit verschoben werden.
In allgemeinen gelten am Mahakam für die Verbotszeit die gleichen religiösen Vorschriften wie am Mendalam, doch machen sich Verschiedenheiten in der Auffassung der adat geltend. Die Saatzeit zerfällt in drei neuntägige Perioden, von denen jede, nach Rechnung der Kajan, aus einem Opfertag und acht Nächten besteht. [323]
Am ersten Tage der ersten Saatperiode begiebt sich der Häuptling mit den Seinigen und vielen anderen Familien auf das Reisfeld, um den Geistern zu opfern (murang). Da die Geister am Geruch merken können, wer sich am Opfer (kurang) beteiligt hat, werden auch die sehr kleinen Kinder mitgenommen, damit auch diese das Opfer berühren. Bei dieser Art des Opfers wird zweimal im Laufe des Vormittags eine Mahlzeit gehalten. Darauf müssen die Kajan acht Tage me̥lo̱.
Am ersten Tage der zweiten Periode findet das Maskenspiel statt.
Am zweiten Tage beginnt man das grosse Feld des Häuptlings zu besäen, eine Arbeit, an der sich Vertreter sämtlicher Familien sowohl der Freien als der Sklaven beteiligen. Am gleichen Tage opfern die Familien der Freien auf ihren eigenen Feldern, worauf sie an den Tagen zu säen beginnen, die sich für sie in dieser Periode als günstig erwiesen haben. Gewisse Tage sind nämlich nur für gewisse Familien günstig; der Häuptling darf nur am 1ten, 3ten und 7ten Tage säen, andere Familien haben wieder andere Saattage. Die Tage, an denen nicht gesät werden darf, leiten sich von Todes- oder grossen Unglücksfällen oder besonderen Missernten her. Alle diese Bestimmungen gelten nicht nur für diese zweite neuntägige Periode, sondern auch für die dritte, ebenfalls neuntägige Saatperiode. Während der zweiten Periode darf aber nur an sechs Tagen gesät werden, der achte und neunte sind Ruhetage.
Am folgenden Tag beginnt die dritte Periode mit Maskenspiel und verläuft in gleicher Weise.
Haben am zweiten Tage der dritten Periode Freie und Sklaven wieder für den Häuptling gesät, so dürfen letztere mit dem Besäen der eigenen Felder beginnen; sie opfern jedoch nicht selbständig, sondern mit dein Häuptling gemeinsam.
Das grosse Reisfeld des Häuptlings wird lumā ajọ genannt.
Jede Kajanfamilie richtet am zweiten Tage der ersten Periode auf ihrem Felde ein Opfergerüst (pe̥lāle̱) auf, mit dem die Säer während des Säens in Verbindung bleiben müssen; daher ist es Fremden verboten, zwischen diesen und dem pe̥lāle̱ hindurchzugehen; auch dürfen die Kajan sich auf dem Felde nicht mit Fremden abgeben, vor allein nicht mit ihnen sprechen. Ist dies zufällig doch geschehen, so hört man an diesem Tage mit dem Säen auf.
Die erste neuntägige Periode bildet die eigentliche Verbotszeit, während welcher kein Fremder die Niederlassung betreten und kein Dorfbewohner [324] die Nacht ausserhalb des Hauses verbringen darf. Ferner dürfen die Kajan nicht jagen, Früchte pflücken und mit dem Wurfnetz (djala) oder Schöpfnetz (hiko̤̱p) fischen gehen. Im Gegensatz zu der adat der Mendalam Kajan dürfen die Mahakam Kajan in dieser Zeit Blut vergiessen, indem sie Schweine und Hühner schlachten, auch ist Angeln (niese) erlaubt und menstruierenden Frauen gestattet, das Reisfeld zu betreten. Dagegen dürfen die Frauen in dieser Periode einige Arten Fische nicht essen. Auch ist es bei ihnen lāli, nach Anfang der Saat zeit die Felder durch Fällen von Wald noch zu vergrössern, und erst, nachdem vier Tage der zweiten Periode verlaufen sind, darf das kleine, übriggebliebene Holz auf dem Felde verbrannt werden.

Hudo̱ Kajo̱, als Geister verkleidete Männer.
In den letzten Tagen vor der Maskerade haben besonders die jungen Leute vollauf mit den Vorbereitungen zu tun. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Maskenspiels lässt sich nur noch an dem Geistertanz, den die jungen Männer aufführen, erkennen. Das Spiel wurde, wahrscheinlich weil der Stamm nun zum ersten Mal wieder beisammen wohnte und als Ganzes das Fest feierte, gerade jetzt vollständig aufgeführt, was bei meinem vorigen Aufenthalt und auch im folgenden Jahr nicht mehr der Fall war.
Ihrer Überzeugung gemäss, dass die Geister mächtiger sind als die Menschen, nehmen die Kajan an, dass, wenn sie die Gestalt der Geister nachahmen und deren Rollen erfüllen, sie auch Übermenschliches zu leisten vermögen. Gleichwie ihre Geister also die Seelen der Menschen zurückzuholen im stande sind, glauben diese, auch die Seelen des Reises zu sich heranlocken zu können. Zu diesem Zwecke handhabt die Hauptperson beim Maskenspiel einen langen, hölzernen Haken (krawit bruwa), dessen Schaft teilweise zu langen, feinen Spänen zerschnitten und mit diesen verziert ist (Siehe Taf.: hudo̱ kājo̱). Die Darsteller treten in einem bestimmten Augenblick hinter einander in eine Reihe und reichen einander hinter der Hauptperson, die voranschreitend den langen Haken in die Höhe hebt, die Hand. Hierauf macht der Vordermann, und mit diesem zugleich auch die ganze Reihe, eine Bewegung, als wolle er mit dem langen Haken etwas zu sich heranholen, nämlich die Seelen des Reises, die sich bisweilen zum Kapuas und Barito verirren.
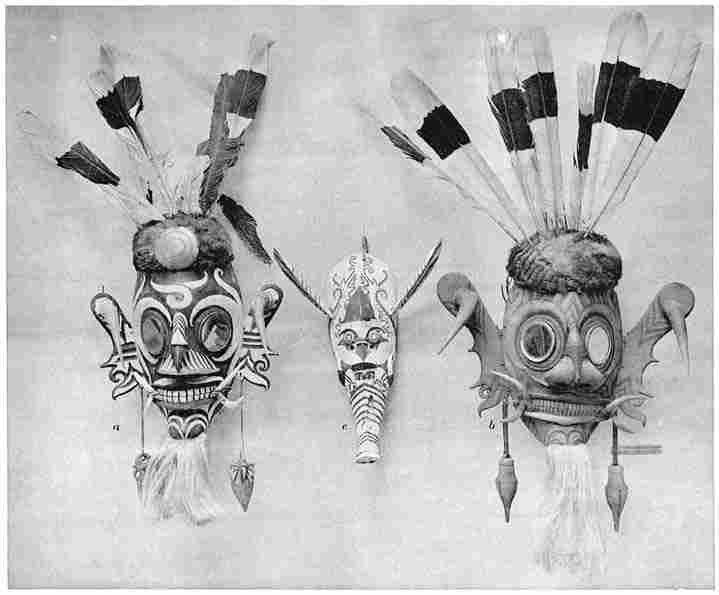
Holzmasken.
Wie wichtig die Bahau es finden, dass sich die Reisseelen stets in ihrer Nähe aufhalten, ersieht man daraus, dass Bĕlarè die Missernten der letzten Jahre dem Umstande zuschrieb, dass beim Verbrennen [325] seines Hauses durch die Batang-Lupar auch die Reisseelen vertrieben worden waren. Da Geister nach Auffassung der Kajan nicht sprechen können, dürfen auch deren Darsteller kein Wort äussern, da sie sonst Gefahr laufen, tot niederzufallen.
Entsprechend ihrer Vorstellung, dass die mächtigen Geister mit allem, was ihnen selbst schreckenerregend vorkommt, ausgestattet sind, verwandeln sich die jungen Männer in stark behaarte Wesen mit grossen Augen, riesigen Hauern und grossen, mit den Eckzähnen der Panther verzierten Ohren. Eine mit den schönen Schwanzfedern des Rhinozerosvogels geschmückte Kriegsmütze und ein Schwert vervollständigen das Kostüm.
Um die starke Behaarung nachzuahmen, werden grosse Bananenblätter seitlich ausgefranst und mit dem Hauptnerv um den ganzen Körper gewickelt, der auf diese Weise in eine unförmliche grüne Masse verwandelt wird.
Mehr Mühe kostet die Herstellung der grossen Masken aus leichtem, weissem Holz (hudo̱ kājo̱), die besonders bei den Kajan und Long-Glat sehr kunstgemäss und sorgfältig geschnitzt werden. Gewöhnlich stellt jeder junge Mann seine eigene Maske her, aber einige besonders Geschickte legen bisweilen an die der anderen die letzte Hand an. Obwohl die Linien und Flächen der Masken sehr grotesk sind, werden sie doch stets deutlich und symmetrisch ausgeführt; auch die später angebrachte Malerei zeugt von dem Farbensinn, der diesen Stämmen eigen ist. Das Gesicht besteht aus einem einzigen Stück, nur der Unterkiefer wird gesondert angebracht, um ihn während des Tanzes klappernd bewegen zu können. Sowohl im Ober- als im Unterkiefer werden die grossen Hauer mittelst hölzerner Stifte befestigt. Wenn möglich, stellt man die Augen durch Deckel von Spiegeldosen, sonst aber durch Deckel der runden, kupfernen Beteldosen dar.
Die grossen, oft schön geschnitzten Ohren bestehen aus Scheiben, in denen oben künstliche Pantherzähne stecken, während unten, an langen Bändern, welche die ausgereckten Ohrläppchen vorstellen, Ohrgehänge hängen. Die Ohrverzierungen werden nach den veralteten Modellen, die jetzt nur noch als Antiquitäten aufbewahrt werden, verfertigt. Als Bart benützt man, wenn möglich, das aus Celebes eingeführte weisse Ziegenhaar (bok kading), das bei den Bahau als Verzierung für Schwerter und Schwertscheiden sehr beliebt ist. Diejenigen, die Ziegenhaar nicht erschwingen können, begnügen sich mit einem Bart aus den weissen [326] Fasern der Ananasblätter, aus denen auch Zeuge hergestellt werden. An der Maske werden Nasenlöcher oder Öffnungen zwischen Nase und Augen angebracht, die dem Darsteller das Hindurchsehen gestatten.

Landung der Geistermasken.
Werden bei besonderen Gelegenheiten, die Tänze von Priestern aufgeführt, so benützen sie lange, weisse Späne von Fruchtbaumholz, um die Haare darzustellen.
Die Verkleidung fand auf einer weiter oben im Mahakam gelegenen Geröllbank statt, nachdem alle in Ruhe ihr Mahl beendet und die letzten Vorbereitungen für die Maskerade getroffen hatten. In einigen langen Böten, von kleinen Knaben gerudert, kamen die sehr wild aussehenden Gestalten flussabwärts bis zur Landungsstelle gefahren, wo andere Männer damit beschäftigt waren, nach dem Bad ihre schönsten und längsten Lendentücher um die Hüften zu schlingen. Ebensowenig wie die Bahau für sich selbst einen guten Bade- oder Anlegeplatz am Ufer freihalten, indem sie etwa in den Fluss gestürzte Baumstämme aufräumen, hatten sie jetzt für die Landung der Geister, die ihnen zu einer guten Ernte verhelfen sollten, irgend welche Vorbereitungen getroffen. So landete denn die phantastische Gesellschaft zwischen halb verfaulten Baumstämmen und den Erdmassen, die bei dem niedrigen Wasserstand zum Vorschein kamen.
Schweigend bestiegen die Geister das hohe Ufer und begaben sich sogleich auf den freien Platz, der sich zwischen der provisorischen Wohnung des Häuptlings und der unsrigen befand. Hier wurden sie von einer zahlreichen Menge erwartet, die ihre schönsten, mit Stickereien und Figuren verzierten Kleidungsstücke angelegt hatte. Viele Kinder und junge Frauen prunkten auch noch mit schön gearbeiteten Mützen, Armbändern und Halsketten. Ich hatte jetzt Gelegenheit, alles Schöne, was der Stamm an Perlenarbeiten und Stickereien besass, kennen zu lernen; für gewöhnlich werden diese Herrlichkeiten verborgen gehalten.
Um alles besser beobachten zu können, begab ich mich zu Kwing Irang, den ich in seiner Reisscheune mitten unter allen Körben mit Kampfhähnen hockend antraf. Von hier aus, nicht allzu hoch über dem Erdboden, konnten wir den Tanz gut beobachten.

Tanz der Geistermasken.
In einem bestimmten, auf dem Gong angegebenen Rhythmus, von dem, bei Gefahr eines Unglückes für die Teilnehmer, nicht abgewichen werden durfte, stellten sich die grünen Massen in brennender Mittagssonne in einen Kreis und führten unter begleitenden Armbewegungen und Schütteln und Drehen des Hauptes allerhand Schritte [327] aus. Gegen 12 Uhr kamen noch einige verkleidete junge Leute von dem Flüsschen Ikang, um die Zahl der Geister zu verstärken, so dass ihrer dieses Jahr 23 waren. Nachdem sie eine gute halbe Stunde getanzt hatten, wobei ihnen ihre kühle Bedeckung in der Hitze sicher gut zu statten kam, stellten sich alle hinter einander, um die bruwa parei (Seele des Reises) aus fernen Gegenden zu sich zu holen.
Bald darauf begannen die hudo̱ kājo̱ (Verkleidete mit Holzmasken) doch zu ermüden und der Anführer begab sich mit seinem krawit bruwa voran in den Versammlungssaal, der die Menschenmenge kaum zu fassen vermochte. Daher wurde die Kinderschar entfernt und für die grünen Geister in der Mitte ein freier Raum geschaffen, worauf sich die unförmlichen, mit grotesken Masken gekrönten Grashaufen am Boden niederliessen und, nach den Bewegungen der Blätter zu urteilen, auf sehr menschliche Weise nach Luft zu schnappen begannen. Einer der Vermummten hielt es hinter seiner Maske nicht aus und legte sie ab, um zu trinken. Da verliess Kwing Irang seine krähende Gesellschaft und begab sich ebenfalls in den Saal, wo er sich zwischen einigen der ältesten vornehmen Männer niederliess und auch mir einen Platz anbot.
Wahrscheinlich hatte man diesen Augenblick erwartet, denn plötzlich wurde alles still und Kwing Irang benützte die Gelegenheit, um durch den Mund eines der Ältesten den Masken und durch diese dem ganzen Stamme öffentlich zu verkünden, dass wir Weissen wiederum gekommen waren, um längere Zeit unter ihnen zu wohnen, dass wir nichts Böses im Schilde führten und er daher von allen erwartete, dass sie uns helfen und nie hindern würden. Ein gutmütiges Gebrumm oder Gebrüll stieg aus den grünen Haufen hervor und die Masken gaben durch sprechende Kopfbewegungen ihr Einverständnis zu erkennen, das auf uns eine sehr beruhigende Wirkung ausübte.
Dieser feierliche Austausch der Gedanken und Gefühle wurde durch das Gejauchze unterbrochen, das die Kinder draussen beim Erblicken einer langen Reihe von Korbmasken (hudo̱ ădjāt) anhoben. Was uns betraf, so wurden wir weit mehr durch eine folgende Reihe hudo̱ lakeuj, lieblicher junger Mädchen, die in Männerkostüm an der Maskerade teilnahmen, gefesselt.
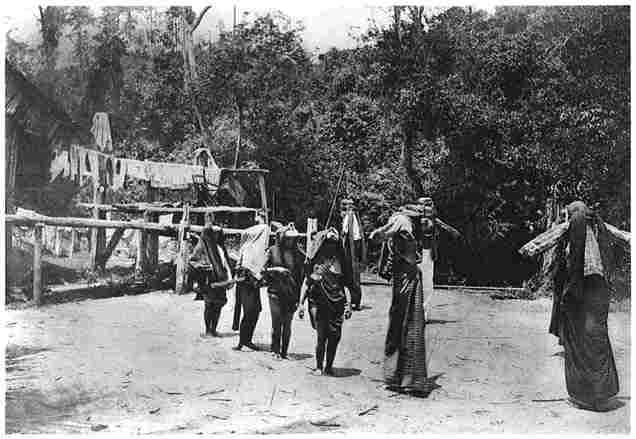
Maskerade der Frauen.
Die hudo̱ ădjāt besteht aus einem Rotangkorb, überzogen mit weissem Zeuge, auf welchem man mittelst einiger Lappen, einiger blinkender Deckel und ein paar Kattunstreifen, an welche Ohrringe gehängt [328] werden, die charakteristischen Merkmale eines Kajankopfes nachahmt. In diesen Korb wird der Kopf zur Hälfte hineingesteckt und der ganze Körper dann mit einer Jacke und grossen Tüchern behängt; durch zwei Bambusstöcke werden die Ärmel der Jacke seitlich in die Höhe gehalten. Diese unförmlichen Gestalten bewegten sich im Tanzschritt über den Platz; aber trotz des Geflüsters, dass hinter diesen Masken die höchsten Damen der Kajanwelt, ja sogar die beiden Frauen von Kwing Irang verborgen waren, konnten sie unser Interesse doch nicht von den jungen Mädchen ablenken, die in dem ihnen ungewohnten Kostüm schüchtern hinter den hudo̱ ădjāt einherschritten.

Frauen in Festkleidung.
Der Gegensatz zwischen den jungen, vollen Gestalten in der kleidsamen, kecken Männertracht und den formlosen Massen war allerdings gross genug. Die jungen Mädchen hatten auf ihre Kleidung mehr Geschmack und Sorgfalt verwandt als die jungen Männer selbst zu tun pflegen. Die Tücher um Lenden und Haupt aus reinem, weissem Kattun oder Baumrinde waren gefällig geschlungen und auch das Schwert und der lange Schal waren geschmackvoll gewählt worden. Bereits 1896 waren mir diese Mädchen, bevor ich sie noch als solche erkannt hatte, durch ihre hübsche Kleidung unter der Menge aufgefallen. Nur einige von ihnen schienen die Vorstellung bereits öfters gegeben zu haben, zeigten sich freier und wagten selbst einen Tanzschritt anzuschlagen; die meisten befanden sich überdies noch in einer ihnen fremder. Umgebung, so dass die Zuschauer sicher mehr Genuss von der Vorstellung hatten als sie selbst. Das Urteil der Frauen über diese Gruppe lautete nicht günstig, auch schienen sich die Gattinnen des Häuptlings unter ihren Körben über ihre jüngeren Gefährtinnen geärgert zu haben, wenigstens versprach uns mittags Uniang Anja, Kwing Irangs zweite Frau, dass sie abends mit einigen Auserwählten in der amin des Häuptlings die Vorstellung wiederholen wollte und zwar wie es sich gehörte.

Als Männer verkleidete Frauen.
Unsere Aufmerksamkeit fand eine plötzliche Ablenkung. Die Menschenmenge stob aus einander und aus dem Walde hinter dem Hause traten sechs zerlumpte Individuen hervor. Zerschlissene Matten umhüllten ihren Körper, auf dem Kopfe trugen sie schmutzige, alte Rotangkappen oder Mützen aus Fell, das bereits die Haare verloren hatte; alte Tragkörbe, hölzerne Speere und übertrieben grosse Pfeilköcher in Form von für Schweinefutter bestimmten Baumbusgefässen an der Seite vervollständigten die Ausrüstung. Nach allen Seiten scheue Blicke werfend schlich die Bande vorsichtig heran und wurde, besonders [329] seitens der Jugend, mit Jubel und Spott begrüsst. Uns wäre die Bedeutung dieser Szene unverständlich gewesen, wenn man uns nicht gesagt hätte, dass man sich gelegentlich der Maskenperiode auch über Menschen und Zustände lustig mache. Hier handelte es sich um eine Verspottung des Lebens der Punan in den Wäldern. Die Punan, die von den Bahau im Grunde sehr gefürchtet werden, bilden nämlich ihrer eigentümlichen Lebensweise wegen einen dankbaren Gegenstand für den Spott. Die Darsteller ernteten daher auch reichen Beifall seitens des Publikums; wahrscheinlich macht man sich bei nächster Gelegenheit über uns Europäer lustig, indem man uns etwa beim Pflanzen- und Steinesammeln oder beim Enthäuten der Vögel darstellt.
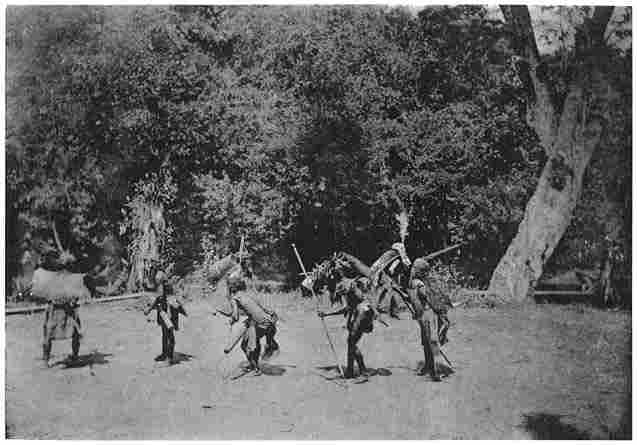
Als Punan verkleidete Kajan.
Hierauf führten kleine Knaben allerhand Vorstellungen auf, die wir nicht gut verstanden, die den Zuschauern aber grossen Spass bereiteten.
Inzwischen hatten sich die hudo̱ kājo̱ in ihren Wohnungen oder, falls sich diese noch nicht hier befanden, in einer verborgenen Ecke mit Hilfe ihrer Angehörigen ihres grünen Geistergewandes und ihrer Masken entkleidet und wollten augenscheinlich die Gelegenheit, mit so vielen zusammenzusein, nicht vorübergehen lassen, ohne sich mit einander im Kreiselspiel, das alle Kajan leidenschaftlich lieben, zu messen. Die gebräuchlichen Kreisel (asing) sind ungefähr 3 dm hoch, haben eine eirunde, seitlich abgeplattete Form und enden oben in einer stumpfen Pyramide, unten in einer stumpfen Spitze. Sie werden aus dem härtesten und schwersten Holze hergestellt, zuerst mit einem Meissel roh bearbeitet und dann mit der Hand beschnitten und oft sorgfältig geglättet.
Der Kreisel wird dadurch in Bewegung gebracht, dass man ihn von oben an mit einer dünnen Schnur, die allmählich dicker wird und an ihrem Ende einen Durchmesser von 3 cm erreicht, umwickelt und diese beim Schleudern des Kreisels an dem verdickten Ende schnell zurückzieht. Die Kreisel, besonders die platteren Formen, lassen, wenn sie von kräftigen Männern geschleudert werden, ein lautes Brummen ertönen.
Am Kreiselspiel beteiligt sich stets eine beliebige Anzahl junger Leute; der erste Spieler schleudert seinen Kreisel mitten auf den freien Platz, der zweite versucht den seinigen derart zu werfen, dass er den ersten verdrängt, selbst aber in Drehung bleibt. Sowohl bei diesem Spiel als auch bei dem der Kinder im allgemeinen habe ich nie einen anderen Zweck erkennen können als Freude am Spiele selbst [330] und an der körperlichen Übung; von einer Preisgewinnung ist nie die Rede, auch wird nie einer mattgesetzt, so dass auch der Ungeübteste so lange mitspielen kann, als er will. Es beteiligten sich 20–30 Männer am Spiel.
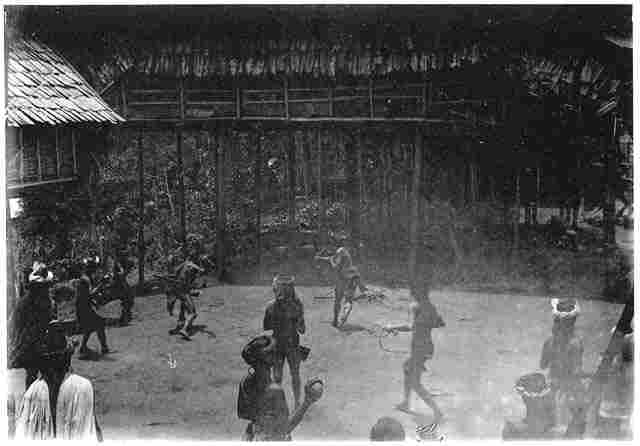
Kreiselspiel.
In dem auf nebenstehender Tafel dargestellten Augenblick hat die rechts im Vordergrund stehende Figur ohne Kopftuch soeben den Kreisel geschleudert, der im Schatten des Hauses, vom Beschauer aus links, unter dem Arm des in Wurfbewegung begriffenen Mannes zu erkennen ist. Dieser sowie zwei andere Männer links im Hintergrunde halten ihre Kreisel in der Hand, bereit sie im nächsten Moment den Vorgängern nachzuwerfen. Weiter rechts ist ein Mann noch gerade in der Wurfbewegung begriffen, hat aber augenscheinlich mit seinem Kreisel das Ziel verfehlt.
Bereits einige Tage vor diesem Wettspiel hatten sich einige Männer nach der Rückkehr vom Reisfeld noch in der Dämmerstunde im Spiel geübt. Das Kreiselspiel wird, wie verschiedene andere, nur gelegentlich des Saatfestes betrieben. Auch noch in der letzten Saatperiode nehmen Erwachsene, meist aber kleine Knaben mit kleinen Kreiseln, das Spiel wieder auf. Auf andere Weise wird das Kreiselspiel auch von den Malaien an der Westküste gepflegt.
Abends erwies sich der Versammlungssaal als viel zu klein, um alle, die das hudo̱ lakeuj der Frauen, unter Uniang Anjas Leitung, ansehen wollten, aufzunehmen, trotzdem die Kajan vom Ikang und viele weiter wohnenden Familien bereits vor Einbruch der Dunkelheit sich auf den Heimweg gemacht hatten. Wir trugen das unsere zum Feste bei, indem wir mit Petroleumlampen den Tanzplatz erleuchteten, der sonst nur durch Harzfackeln spärlich erhellt wird, was vielleicht für die Augen der Kajan, aber nicht für die unseren genügte, um von dem Schauspiel einen richtigen Eindruck zu erhalten. Zum Glück bereitete unsere Extravaganz uns viel Genuss, denn sechs junge Frauen, die nicht nur mit ihrem Äusseren, sondern auch mit ihren Leistungen zu glänzen verstanden, folgten Uniang. Diese hatte zwar bei ihren 30 Jahren, in denen sie oft krank gewesen war, viel an Schönheit eingebüsst, war aber ihrer Rolle als Vortänzerin immer noch würdig; sie führte nicht nur die Tanzschritte, sondern auch die begleitenden Armbewegungen mit Grazie aus. Nach einer bestimmten Melodie, welche auf einer Guitarre (sape̱) gespielt wurde, tanzte Uniang auf echt indische Weise, mit viel Beugungen und ruhigem Bewegen der Gelenke, aber [331] doch weit lebhafter, als es auf Java üblich ist. Die Aufführung wurde von keinem Gesang begleitet.
Der Tanz hatte erst nach dem Abendessen, gegen 4 Uhr, begonnen und dauerte sehr lange, so dass sich viele der Unseren nach den Ermüdungen des Tages bereits vor Ablauf dieses sehr eigenartigen Schauspiels zur Ruhe begaben; nur der Kontrolleur und ich mussten, als die Hauptpersonen, noch Stand halten. Freilich hatte mich Kwing Irang, der mit seinem Söhnchen Hāng bei uns sass, schon während der Vorstellung darauf vorbereitet, dass ich nachher noch an einer Beratung teilnehmen musste, da Li, Häuptling der Ma-Suling und Halbbruder von Kwing, schwer krank war und man mich nur, um das lāli der Kajan nicht zu stören, nicht bereits gerufen hatte. Jetzt, wo die Verbotszeit ihr Ende erreicht hatte, war aber auch keine Zeit mehr zu verlieren und ich sollte am anderen Morgen sogleich mit einem Boot zum Mĕrasè aufbrechen.
Trotz aller Eile fand ich am folgenden Morgen doch noch Zeit, Jung und die Seinigen, die bereits nachts angekommen waren und jetzt, wo unser lāli vorüber war, baldmöglichst an den Kapuas zurückkehren wollten, noch zu empfangen. Ich gab ihnen wegen ihres Lohnes und der Verteilung meiner Böte, die noch am pangkalan Howong im Walde lagen, Briefe an den Kontrolleur von Putus Sibau mit. Die Böte verkaufte ich für 2 bis 3 Dollar das Stück an Liebhaber und belohnte einzelne Häuptlinge noch besonders, indem ich ihnen eines derselben schenkte. Kwings ältester Sohn, Bāng Awăn, hatte alle Mühe, für die Fahrt nach dem Mĕrasè genügend Leute zu finden, weil alle auf ihren Feldern eifrig beschäftigt waren; aber nach dem Essen glückte es ihm doch noch, eine Bemannung für das Boot zu beschaffen, und so fuhr ich denn mit ihm, Midan und meinem Hunde ab. Nach den Berichten, die mir Jung vom Mĕrasè gebracht hatte, musste der Zustand des Kranken hoffnungslos sein; ich hielt es aber doch für geraten, zu ihm zugehen. Auf unserer Fahrt, während welcher die Sonne ununterbrochen auf die Wasserfläche herniederbrannte, passierten wir unter anderen auch die mir von früher her bekannte Niederlassung der Long-Glat, Lulu Njiwung, in der noch lāli nugal herrschte. Bei Batu Sala legten wir an, um die neuesten Nachrichten vom Mĕrasè zu vernehmen, damit wir nicht nach dem Tode des Häuptlings dort ankämen und durch das dann eingetretende lāli dort festgehalten würden; auch wollte ich in Batu [332] Sala den Häuptling Paren und dessen Familie begrüssen. Die Berichte lauteten zwar nicht ermutigend, aber gestorben war Li noch nicht, daher machten wir uns schnell auf die Weiterreise und erreichten um 4 Uhr Napo Liu, die Niederlassung, in der Li als Gemahl der Frau Eipo lebte, die hier Häuptling der Ma-Suling war.

Napo Liu.
Die Niederlassung bestand aus mehreren grossen, langen Häusern und einigen kleineren von malaiischer Bauart und befand sich auf einem grossen, flachen Terrain, das trotz des augenblicklich bedeutenden Wasserstandes doch noch 4 m hoch war und daher von Überschwemmung nur selten zu leiden haben konnte. Mitten in der langen Reihe erhob sich das besonders grosse Haus, das die Häuptlingsfamilie mit ihren Sklaven bewohnte. Während ich den langen mit Einkerbungen versehenen Baumstamm emporkletterte, bemerkte ich, dass das Haus ganz neu war. Seine Wände waren grösstenteils noch nicht bearbeitet und auch Feuerherde und allerhand Vorrichtungen an der Galerie waren noch nicht angebracht worden. Zum Umschauen liess man mir aber keine Zeit, sondern führte mich sogleich in die grosse amin zum Kranken. Dieser lag in einem Raume, der von dem übrigen grossen Gemache durch eine Wand geschieden war. Der früher bereits magere Mann war nun zum Skelett abgemagert und lag mit der für die dunklen Rassen charakteristischen grüngrauen Totenfarbe halb bewusstlos da. Viele Frauen sassen mit gedrücktem Ausdruck um ihn herum, suchten ihm mit kaltem Wasser das Haupt zu kühlen, ihm noch etwas Nahrung beizubringen und ihn durch Zuspruch bei Besinnung zu erhalten. In dem weiten Raum befanden sich viele Menschen, Bahau und Malaien, die alle schweigend Betel kauten, den Bulan, die Häuptlingstochter, umherreichte.
Bereits der erste Eindruck des Kranken flösste mir wenig Hoffnung ein, als ich auch keinen Puls mehr fühlte, wusste ich, dass hier nicht mehr zu helfen war. Hätte man mich trotz der Verbotszeit einige Tage früher gerufen, so wäre die Aussicht auf Rettung viel grösser gewesen; denn die Krankheit, akute Malaria, hatte den für Mittel-Borneo typischen Verlauf genommen. Die Fieberanfälle hatten sich während 14 Tagen wiederholt, bis sich häufige und wässrige Entleerungen des Darmes mit tenesmi einstellten, welche den Zustand des Kranken komplizierten. Während der letzten 4 Tage war der Patient dadurch sehr geschwächt worden, trotzdem das Fieber stark nachgelassen hatte. Wegen des lāli nugal der Kajan hatte man gewartet, mit dem Resultat, dass die [333] Krankheit nun in kürzester Zeit tötlich verlaufen musste. Damit die Schuld an dem Tode nicht mir zugeschoben werden konnte, erklärte ich sofort, nicht mehr helfen zu können. Auf meine Nachfrage erfuhr ich, dass auch hier wieder die Behandlung des Kranken viel zur Verschlimmerung seines Zustandes beigetragen haben musste; man hatte ihm, hauptsächlich gegen die Intestinalkrankheit, Arzneien der Bahau, Malaien und Chinesen eingegeben, von denen jede für sich schon auf einen geschwächten Körper höchst schädlich einwirken musste. Ferner hatte der arme Kranke, als sein Zustand ernst wurde, auch durch den Aberglauben seiner Umgebung entsetzlich zu leiden, da diese ihn durch Zuspruch und selbst durch Anfassen am Einschlafen zu verhindern suchte. Die Bahau tun dies, weil sie annehmen, dass die Seele den Körper sowohl im Schlafe als beim Tode verlässt und beim Einschlafen eines Schwerkranken nicht wieder zurückkehren könne. Selbst heftiger Protest seitens des Kranken bringt die Leute nicht von ihrer Handlungsweise ab. Für einen europäischen Arzt, der froh ist, wenn seine Patienten im Schlafe wieder Ruhe und Stärkung finden, ist es sehr schwer, sich in einem derartigen Fall eines Widerspruches zu enthalten; und doch muss man sich, um nicht selbst Gefahr zu laufen, in hoffnungslosen Fällen hierzu überwinden. Wo indessen begründete Aussicht auf Genesung vorhanden war, habe ich die Verantwortung gegenüber der verblendeten Familie auf mich zu nehmen gewagt.
Obgleich Bo Li bereits viel zu schwach war, um sprechen zu können, und seine Augen auch schon halb gebrochen waren, ermunterte man ihn doch ständig dazu, einen Laut von sich zu geben. Ich verliess daher schnell das traurige Schauspiel, wurde aber draussen auf der Galerie sogleich von Bahau, Malaien und Bakumpai umringt, die alle aus Interesse für den Kranken oder aus Furcht, wegen der nach dem Tode eintretenden Verbotszeit in der Niederlassung eingeschlossen zu werden, sich bei mir erkundigten, ob noch Hoffnung vorhanden sei. Ich konnte weder diesen noch den beiden Söhnen des Häuptlings, Lĕdju und Ibau, die übrigens selbst kaum noch zu hoffen wagten, einen tröstlichen Bericht geben. Die Brüder und einige andere stellten mittelst einiger Planken auf der Galerie eine Erhöhung her, auf der ich mein Klambu aufrichten konnte; auch gaben sie meinem Bedienten Reis und ein Huhn, um mir ein Abendessen herzurichten, und zogen sich dann zu ihrem Vater zurück.

Gruppe der Murung Malaien in Napo Liu.
Ich hatte noch kaum Zeit gehabt, mich durch ein Bad im Fluss [334] nach der Hitze und Ermüdung des Tages zu erfrischen, als man mir meldete, dass Temenggung Itjot, ein malaiischer Häuptling, der mit einer Tochter eines anderen Häuptlings in der gleichen Niederlassung verheiratet war, mir seine Aufwartung machen wolle; auch eine grosse Gesellschaft verwandter Malaien vom oberen Murung, die gekommen waren, um Itjot nach achtjähriger Abwesenheit in sein Geburtsland zurückzuholen, sollte ihn begleiten. Obgleich meine Zusammenkunft mit Itjot 1896 und 1897 sehr harmlos verlaufen war, erschien mir doch eine Begegnung mit einer grossen Gesellschaft Murunger nicht so ganz ungefährlich, da sie ganz aus Anhängern des von der niederländischen Regierung vertriebenen Sultanats prätendenten Gusti Mat Sĕman bestand, die sich jetzt an den oberen Barito geflüchtet hatten. Nach Landessitte kam die ganze Schar, zu meiner Ehre und vielleicht auch zur eigenen Beruhigung, mit schönen Schwertern bewaffnet zu mir. Unsere Begrüssung durch Händeschütteln verlief mit den alten Bekannten freundschaftlich, mit den Neuangekommenen dagegen sehr schüchtern, worauf ich mich, allein mit meinem Hunde, mitten unter 25 Feinden meines Vaterlandes niederliess. Die ganze Gesellschaft, mit Ausnahme derjenigen, die ich von früher her kannte, zeigte sich sehr verlegen, so übernahm ich denn die- Leitung des Gespräches und begann zu erzählen, wie es mit dem Kranken stand, auch erkundigte ich mich nach dem Befinden von Itjots Familie und kam hiermit auf ein Thema, das die meisten interessierte. Itjot kam sogleich auf die Sorgen zu sprechen, die ihm die Ernährung eines Kindes, das seine junge Frau an Stelle des eigenen, verstorbenen, angenommen hatte, verursachte. Das Kind konnte von der Mutter nicht ernährt werden und, da andere Milch nicht vorhanden war, musste das Kind mit weich gekochtem Reis und Bananen ernährt werden, wodurch es krank geworden war. Ich glaubte, hier mehr mit kondensierter Milch als mit Arzneien helfen zu können, und so machte ich denn den Pflegevater mit zwei Büchsen Milch glücklich und versprach, ihm am folgenden Morgen zu zeigen, wie er sie gebrauchen sollte. Meine grosse Freigebigkeit fand durchaus nicht den Beifall meines Bedienten Midan und nur zögernd lieferte er den ganzen Milchvorrat, den ich augenblicklich bei mir hätte, aus. Übrigens verwandelte sich auch bei meinen Landesfeinden mancher scheue Blick in einen verwunderten. Es befanden sich nämlich unter ihnen Fieber- Syphilis- und Kropfkranke, die meine Hilfe sehr nötig hatten. Nun war Itjot zwar von früher [335] her an die Gratisausteilung meiner Arzneien gewöhnt, seine unheimlichen Gefährten jedoch sahen mit Erstaunen, dass ich einigen Kranken umsonst etwas Chinin mitgab und ihnen versprach, mich am anderen Morgen persönlich mit ihnen zu befassen. Heikle politische Punkte gänzlich vermeidend erkundigte ich mich, um auch Itjots Bruder, Raren Na-un zu Worte kommen zu lassen, nach einigen gleichgültigen Angelegenheiten vom Murung und so erhielten diese Menschen, die übrigens durchaus keine bösen Absichten gehabt zu haben schienen, von dem ersten Europäer, dem sie am Mahakam begegneten, keinen schlechten Eindruck. Hiervon überzeugte mich der herzliche Händedruck, den ich von den Vornehmsten beim Abschied empfing; die Niederen wagten eine derartige Vertraulichkeit nicht.

Grabmal des Ma-Suling-Häuptlings Bo Long.
Inzwischen hatte Midan mir das Essen bereitet. Nach dem Mahl machte ich dem sterbenden Bo Li noch einen Besuch und verschwand dann bei Sonnenuntergang hinter meinem Moskitonetz, wo ich sogleich fest einschlief. Ab und zu erwachte ich durch das Hin- und Hergehen der erregten Menschen, die ihren Häuptling sterben sehen wollten, als plötzlich gegen 10 Uhr heftige Schläge auf grosse Gonge in der Galerie mich vor Schreck zitternd auf meiner Matratze auffahren liessen. Aus der amin aja ertönte Weinen und jammern; Bo Li war also verschieden. Ich machte mich bereit, den Lauf der Dinge in meinem Klambu abzuwarten, als ich beim Schein einer Harzfackel zuerst das Gesicht meines Dieners, dann das von Itjot erblickte, die mich aufforderten, mich sogleich mit ihnen nach Itjots Hause zu begeben, da ich hier bei der Erregtheit der Bahau in solchen Augenblicken nicht sicher, in jedem Fall aber auf der Galerie nur hinderlich sein würde. Ich wagte dem Rate nicht zu widerstehen und begab mich, wenn auch zögernd, mit Itjot nach dessen Wohnung. Unterdessen wurde auch in der Galerie durch Schläge auf die Gonge den Geistern von Apu Ke̥sio und den benachbarten Niederlassungen der Tod des Häuptlings verkündet. Neben dem Weinen der Angehörigen ertönte nun auch das Jammern der Klageweiber. Die Männer hatten sogleich nach des Häuptlings Verscheiden ihre Schwerter gezogen und begannen mit ihnen, um die bösen Geister zu verjagen, heftig erregt in der Luft herumzufuchteln oder auf Wände und Pfosten loszuschlagen. Itjot fürchtete, dass bei dieser Gelegenheit mir oder den Meinen zufällig oder absichtlich etwas zustossen konnte, und war hauptsächlich deswegen gekommen mich abzuholen. Es geschieht nämlich ab und zu, dass im [336] Dunkeln nicht nur die Wände des Hauses, sondern auch einer der Anwesenden getroffen wird. Stirbt ein grosser Häuptling, so wird oft seine ganze Wohnung innen durch Schwertschläge beschädigt.
Vor Ermüdung schlief ich auch in Itjots weit abgelegenem Hause gut ein, musste aber am anderen Morgen früh wieder auf sein, um den vielen Patienten zu helfen, die mit allerhand Leiden zu mir kamen und aus meiner Anwesenheit noch Nutzen ziehen wollten. Sie beeilten sich, weil sie unseren frühen Aufbruch fürchteten; darauf erschien auch Bang Awăn, Kwing Irangs Sohn, und meldete, dass wir früh heimkehren mussten, um seinem Vater den Todesfall zu berichten. Die Sache hatte Eile, weil die Leiche nur 4 Tage im Hause bleiben durfte, um dann in einem bereits vorhandenen Prunkgrab (salong) eines anderen Häuptlings beigesetzt zu werden. Da das Haus, indem Bo Li gestorben, noch nicht fertig gebaut, sein lāli also noch nicht abgelaufen war, musste nämlich nach der acht das Begräbnis so bescheiden als möglich vollzogen werden. Kwing Irangs Gegenwart als Bruder war aber erforderlich und daher Eile geraten.
Dass auch Kajan zu eilen im stande sind, erfuhr ich an diesem Tage, da wir um 8 Uhr wegfuhren und ununterbrochen durchrudernd um ½ 11 Uhr abends ankamen. Zum Glück war der Himmel etwas bewölkt und der Tag nicht sehr heiss, so dass ich zum Schluss nur hungerig, fröstelnd und steif am Blu-u anlangte.
Am folgenden Tag beschlossen unsere Dorfbewohner, den Leuten am Mĕrasè zu helfen, indem sie ihnen zur Bewirtung der beim Begräbnis Behilflichen ein Schwein und Reis zur Verfügung stellten. Abends kostete es viel Mühe, um in dieser drückenden Arbeitszeit eine genügende Anzahl junger Leute zur Fahrt zu vereinigen. In den letzten Tagen ging alles bei Sonnenaufgang aufs Feld und nur die Kranken und Alten blieben im Hause zurück.
In diesem gewichtigen Falle fanden sich aber doch schliesslich genügend viel Ruderer ein, und so konnte Kwing Irang mit seinem Sohn Bang Awăn und seinem Mantri Bo Kwai, dem Schweine und dem Reis zum Mĕrasè aufbrechen, um seinem Bruder die letzte Ehre zu erweisen.
Bereits während des lāli nugal hatten wir erfahren, dass es unmöglich war, für alle unsere Unternehmungen Männer als Führer oder Ruderer zu finden. In unserer jetzigen Kajanumgebung war aber von Gefahr keine Rede, daher konnten wir auch sehr gut unter unserem eigenen [337] Geleite einige gewandte Leute wählen, die Bier bei der topographischen Aufnahme zu helfen im stande waren; auch erklärte sich der chinesische Händler, der das Flussgebiet und auch die Namen der Berge kannte, bereit, als Führer zu dienen. Am Tage nach der Abreise von Kwing machte sich denn auch Bier mit einem grossen und zwei kleinen Böten, dem Chinesen und zehn unserer Leute auf den Weg, um den Mahakam vom Howong bis an den Blu-u zu messen.
In Anbetracht, dass sein Geleite den Bahau völlig fremd war, sollte Bier sich vorläufig an den Hauptfluss halten. Die Nebenflüsse konnten später gemessen werden, während wir mit Kwing Irang die dort ansässigen Stämme besuchten.
So wurde es denn still in unserer Umgebung und jeder ging seiner Liebhaberei und Arbeit nach. Barth hatte vollauf damit zu tun, alles, was er auf der Reise und später im täglichen Verkehr mit Adjang und der Bevölkerung aufgezeichnet hatte, zu ordnen. Sein Wörterschatz wuchs ständig, indem er den Unterhandlungen zuhörte, die ich den ganzen Tag über beim Einkaufen unserer Lebensmittel und Ethnographica mit Männern, Frauen und Kindern zu führen hatte. Mit seinem geübten Ohr gelang es ihm, zahlreiche Eigenarten der Busangsprache zu beobachten.
Ich war auch diesmal beim Auspacken meines Vorrates an Perlen und Zeugen sehr vorsichtig gewesen; die Festlichkeiten hatten mir aber eine Vorstellung von allem, was ich zu erlangen suchen musste, gegeben, daher begann ich die Kajan mit einigen hübschen Arten von Perlen und Stoffen zu locken. Sie reagierten auch sofort, indem sie mir Stickereien und Perlenarbeiten brachten, die ich früher fast gar nicht hatte erlangen können. Meine schönen inu be̥ne̱ng (Perlen für Kindertragbretter) erregten besonderes Aufsehen und zu meinem Erstaunen wurden mir sogleich einige jener wertvollen Arbeiten abgetreten, obgleich die Menge Perlen, die ich hierfür zurückgab, nicht viel Beifall fand. Weniger gut gelang es mir, für sehr kleine, bunte Perlen, inu buko̱, fertige Arbeiten zu erlangen, wenigstens wollte man mir die Perlenverzierungen der hohen Festmützen dafür nicht abtreten. Nur für meine silbernen Ohrringe (hisang pẹrăk) und Armbänder aus Elfenbein wollte man sich von den schönen Mützen trennen. Ich hatte aber noch Zeit und musste meinen Preis halten, um des Schönsten und Besten, das die Bevölkerung hervorbrachte, habhaft zu werden, Daher verlief die erste Zeit mit Nachfragen und Unterhandlungen, die [338] erst viel später, oft erst nach Monaten, zu einem Ergebnis führten. Demmeni, der sich bereits früher durch das Reparieren von Schmucksachen und allerhand Hausrat bei den Eingeborenen beliebt und bekannt gemacht hatte, erfreute sich wieder eines grossen Zulaufs. In unserer Wohnung fand er aber für seine Werkstätte keinen Platz, daher kam es uns sehr gelegen, dass der Schmied des Stammes, Awang Kalei, uns seine neben der unsrigen befindliche Wohnung überliess und selbst auf seinem Reisfelde Quartier nahm.
Kwing Irang kehrte unmittelbar nach dem Begräbnis seines Bruders wieder zurück; er hatte auch keine Nacht mehr am Mĕrasè verbringen dürfen, weil die einen Monat dauernde Verbotszeit gleich nach der Bestattung eingetreten war und es bei Strafe hoher Busse keinem, der nicht am Mĕsarè wohnte, in dieser Zeit gestattet war, das Flussgebiet zu verlassen oder zu betreten. Händler, die sich vorübergehend dort aufhielten, hatten sich noch in den letzten Tagen schleunigst davongemacht, um nicht einen Monat Zeit zu verlieren.
Kwing Irangs Familie ging in Trauer bezw. in Halbtrauer, indem sie alle Schmucksachen und schönen Kleider ablegte und besondere Trauerkleider anlegte. Letztere bestanden für Kings Frauen in schlichten Jacken und Röcken, waren aber nicht aus Baumrinde oder hellbraunem Kattun verfertigt. Auf uns Europäer machten die Frauen jetzt, da sie nicht mit Schmucksachen bedeckt waren, einen viel nackteren Eindruck als früher. Kwing Irangs Traueranzug bestand aus einem Lendentuch (bă) von hellbraunem, d.h. weissem, im Morast braungefärbtem Kattun. Handelt es sich um einen Todesfall in der Familie selbst, so tragen die Frauen am Mahakam, wie die am Mendalam, eine tă-ā und eine ärmellose Jacke aus Baumbast oder braunem Kattun und ein in Form einer Kappe um das Haupt gewundenes Tuch (Siehe nebenstehendes Bild).
Wegen der Halbtrauer der Häuptlingsfamilie durften keine Festlichkeiten im Stamme gefeiert werden, bevor am Mĕrasè am Ende der Verbotszeit das erste be̥t lāli lumu (Ablegen der Trauer) durch Opfer stattgefunden hatte.
Am 7. November kehrte Bier sehr befriedigt von seiner ersten Flussmessung zurück, denn es war ihm gelungen, die anfängliche Schwierigkeit, am Ufer selbst einen Beobachtungspunkt zu finden, zu überwinden. Leider wurde seine gute Stimmung nicht von seinen Begleitern geteilt; sowohl der Chinese als die Malaien beklagten sich [339] bei mir über Biers rauhe Behandlung und erklärten, in Zukunft nicht mehr mit ihm allein reisen zu wollen. Bier kehrte nämlich diesen Leuten gegenüber zu stark den Europäer und deutschen Unteroffizier heraus. Die Nachricht berührte mich sehr unangenehm, weil gerade die Malaien bei der Aufnahme am besten helfen konnten und es unter diesen Umständen viel zu gefährlich gewesen wäre, Bier Bahau mitzugeben. Nach einiger Überlegung mit dein Kontrolleur suchten wir Bier begreiflich zu machen, dass ein Europäer sich auch einem Eingeborenen gegenüber nicht alles erlauben dürfe, fanden aber bei dem rauhen Soldaten nicht viel Verständnis und so blieb mir nur die Wahl, die topographische Aufnahme gänzlich aufzugeben und Bier so schnell als möglich an die Küste zu senden oder stets selbst mit ihm zu ziehen, was für mich so viel bedeutete, als meine ethnographischen Studien grösstenteils aufzuopfern. Die Wichtigkeit einer guten Karte von Mittel-Borneo und die Aussicht, gleichzeitig auch auf geologischem Gebiet mehr leisten zu können, brachten mich dazu, letzteres zu wählen. Mein Verdruss steigerte sich noch durch den Bericht der Malaien, dass Bĕlarè jetzt in der Saatzeit nicht mit uns zum Ursprung des Mahakam ziehen könne und dass er auf seine frühere Forderung von 1–2 Reichstalern pro Tag und Person zurückgekommen sei, ein Zeichen, dass Bĕlarè zum Unternehmen des Zuges nicht geneigt war und dass wir unseren Plan vorläufig aufgeben mussten, so gern wir auch die Grenzen gegen Sĕrawak festgestellt hätten.
Der Tod seines Bruders hatte Kwing Irangs Unternehmungsgeist nicht gelähmt; denn gleich nachdem die drückendste Saatperiode vorüber war, erklärte er sich bereit, mit uns den Batu Mili zu besteigen. Da es sich jetzt um einen Zug von mehreren Tagen handelte, nahm ich auch die Jäger und Pflanzensammler mit, damit sie von der Fauna und Flora dieses jungfräulichen Berges eine gesonderte Sammlung anlegten. Bier und ich wollten uns mit der Aufnahme und dem Studium der Formationen dieses Teils des oberen Mahakam beschäftigen. Kwing Irang nahm 17 junge Leute und ich noch die vier Malaien von früher mit.
Um den grossen Umweg über die Reisfelder zu vermeiden, fuhren wir den Mahakam abwärts, bis zum Batu Plöm (plo̤̱m = Splitter), einem grossen Andesitblocke, der im Fluss unmittelbar am Fuss des Abhanges liegt, dem entlang wir auf steilem Pfade schnell bis zu dem eigentlichen, zylinderförmigen Gipfel des Batu Mili hinaufklimmen konnten. [340] Der Batu Plöm besteht aus dem gleichen Gestein wie der Batu Mili und nach der Sage der Kajan ist er auch in der Tat von diesem abgestürzt.
In früherer Zeit, so lautet die Sage, reichte der Batu Mili bis an den Himmel und zwar zum grossen Verdruss der Stämme am Mahakam; denn sobald der Reis unten zu reifen begann, kamen allerhand Tiere vom Himmel auf die Erde herab und frassen die ganze Ernte auf. Daher beschlossen einige Stämme: die Punan, Pnihing, Kajan und Long-Glat, diese Verbindung aufzuheben und den Batu Mili umzuhacken. Sogleich machten sich alle ans Werk, aber nur die Kajan und Long-Glat besassen Beile, die anderen bearbeiteten den damals weichen Stein mit einem Bambusstück. Sie verursachten daher auf dein Stein keine so glatten Flächen wie diejenigen, die mit Beilen arbeiteten, was sich noch heute an ihrer Haut erkennen lässt, denn Punan und Pnihing leiden viel mehr an schuppenbildenden Hautkrankheiten als Kajan und Long-Glat. Es dauerte lange, bis alle ihr Werk beendet hatten, auch lief es nicht ohne Unfall ab; zuerst flog ein Splitter in das Auge eines der vornehmsten Häuptlinge jener Zeit, Bang Ka-āng, der unten am Mahakam stand und das eifrige Arbeiten über ihm beobachtete. Nur mit grosser Mühe gelang es, mittelst eitles sehr harten Stückes Holz den Splitter zu entfernen, der jetzt noch als Batu Plöm in Form eines mächtigen Felsblockes im Mahakam liegt.
Um den Gipfel des Batu Mili in die gewünschte Richtung fallen zu lassen, umwanden ihn die Arbeiter mit einem kolossalen Rotangseil, aber als die Masse zu wanken begann, erschraken sie so gewaltig, dass jeder Stamm sich in seine Böte stürzte und schleunigst in sein Land zurückkehrte, und zwar die Kajan und Long-Glat flussabwärts, die Pnihing flussaufwärts. Die Punan vergassen in ihrer Verwirrung, von ihren Böten Gebrauch zu machen, und flüchteten nur so in die Wälder, in denen sie auch heute noch umherschweifen.
Da niemand das Rotangseil leitete, verwickelte es sich zwischen den Felsen, so dass dieser Teil des Batu Mili mit seinem Fuss im Mahakam schief hängen blieb. Infolge dieser Abdämmung staute sich der Fluss derart, dass alles Land flussaufwärts, bis auf einen Berg, auf den sich alle Menschen flüchteten, unter Wasser gesetzt wurde. Lange Zeit lebten sie dort, bis eines Tages zwei Männer, die in einem grossen Boote auf der Wasserfläche fuhren, durch eine mächtige Liane, wie sie glaubten, aufgehalten wurden. Mit ihren Beilen machten sie sich über die [341] vermeintliche Liane her und es gelang ihnen auch, sie zu durchhacken es war aber das Rotangseil, an dem das abgeschlagene Stück des Batu Mili hing, das nun mit heftigem Aufschlag auf die Erde niederstürzte, auf welcher es noch heute als Batu Lesong (Scheidegebirge zwischen Mahakam und Murung) liegt. Das Wasser des Mahakam strömte nun ab und zwar mit solcher Kraft, dass es die beiden Männer in ihrem Boote bis zum Meere mitführte, wo sie ertranken.
Beim Abströmen des Wassers blieben die Fische in den Fasern des zerrissenen Rotangseiles hängen, wodurch die Bahau das Weben von Netzen lernten; sie stellen jetzt noch ihre Netze stets aus dieser Liane (te̥ngāng oder aka klẹa) her.
Nachdem die Menschen dieses grosse Werk vollführt hatten, fand Bang Ka-āng, dass er sie belohnen müsse, und beschloss daher, den Mahakam, Barito und Kapuas mit Fischen zu bevölkern. Zu diesem Zwecke zog er abwärts, bis unterhalb der Wasserfälle des Mahakam und warf die Fische von dort aus in den Barito und Kapuas, was natürlich nur einem Menschen von seiner Grösse möglich war.
Als er den Fluss weiter hinunter fuhr, begegnete er Menschen, die viel kleiner waren als er. Der Sohn des dortigen Häuptlings spielte mit einem Rotang, der dick wie ein Schenkel war, und machte dem Riesen Bang Ka-āng, um ihn zu erschrecken und aus dem Lande zu vertreiben, weiss, dass sein Vater diesen Rotang als Beinring benütze. “Dann muss Dein Vater sehr gross sein” rief Bang Ka-āng aus “rufe ihn mal her, damit wir sehen, wer der Stärkere ist!”
Der Häuptling liess aber den ganzen Tag auf sich warten und, als er nachts am Ufer erschien, stiess er ein solches Gebrüll aus, dass es Bang Ka-āng nun wirklich angst wurde und er den Fluss hinunter flüchtete; seither hat man nie mehr etwas von ihm vernommen.
Am oberen Mahakam nennt man den Regenbogen “Bang Ka-āngs Lendentuch” (= bă Bang Ka-āng).
Während die Kajan unsere Böte an Land zogen und an den Bäumen festbanden, damit sie bei plötzlich eintretendem Hochwasser nicht fortgeführt wurden, hielten wir mit Kwing Irang auf dem Batu Plöm sitzend einen kleinen Kriegsrat. Da ich wusste, mit welcher inneren Angst der Häuptling die Besteigung unternahm, hatte ich mir vorgenommen, auf alle seine Pläne einzugehen. Kwing schlug vor, dass wir erst bis zur senkrechten Felswand hinaufsteigen und dass meine Malaien und seine Kajan dann Leitern und Stützen an den schwierigsten [342] Stellen anbringen sollten; gegen Abend wollte er dann zuerst den Gipfel ersteigen und dort ein kleines Schwein, ein Huhn und einige Eier opfern, um die über unser Eindringen in ihr Gebiet erzürnten Geister zu besänftigen. Ich hatte gegen diesen, auf kajanischen Aberglauben begründeten Plan nichts einzuwenden und so kletterten wir denn längs des Grates, bei einer durchschnittlichen Steigung von 43°, bis zu der lotrechten Felswand hinauf und gingen links um sie herum bis zu der Stelle, wo der früher von mir benützte Bergrücken die Wand erreichte. Hier fanden wir einen Platz, auf dem der Häuptling mit der Hälfte seiner Leute einige Zelte aufstellen konnte, während die andere Hälfte einen Weg nach oben für uns herrichtete. Gegen Abend war dieser fertig und Kwing Irang begann seinen Aufstieg. Nach dem Bericht der Malaien wurde ihm zuletzt so angst und bange, dass sie ihn nur mit Mühe dazu brachten, den Gipfel völlig zu erklimmen. Nachdem er den Geistern sein Opfer dargebracht hatte, beeilte er sich mit dem Abstieg und war sehr froh, nachts mit heiler Haut wieder bei uns im Zelte sitzen zu können. Die Nacht war regnerisch und stürmisch gewesen, trotzdem machten Bier und ich uns schon in der Morgendämmerung auf den Gipfel auf. Wegen der Leitern war die Besteigung diesmal viel müheloser als früher; innerhalb einer halben Stunde hatten wir die 150 m zurückgelegt.
Auf dem Gipfel erwartete uns eine wunderbare Aussicht. Die Wolken, die nachts die Landschaft am oberen Mahakam bedecken, lagen jetzt unter uns und die Sonne schien herrlich auf die schneeweisse Fläche herab; nach der feuchtkalten Atmosphäre in den Wäldern am Bergabhang berührte uns die hier oben herrschende Wärme aufs angenehmste. Der Himmel war wolkenlos. Wir wurden nicht müde, unsere Blicke über das weite, strahlend weisse Nebelmeer schweifen zu lassen, aus dem einzelne hohe, dunkle Bergspitzen, unbekannt und geheimnisvoll, hervorragten. Noch nie war es uns geglückt, eine so unbeschränkte Aussicht über Mittel-Borneo zu geniessen.
Obgleich wir die Entfernung der hintersten Berge nicht kannten, sagten uns doch einige bekannte Gipfel im Kapuasgebiet, dass sie sehr gross sein musste. Über der Wasserscheide kam der Terata und hinter ihm noch andere Gipfel zum Vorschein. Nach Osten hin zog sich längs des Horizontes ein gipfelreiches Gebirge; es musste das Ober-Kapuas-Kettengebirge sein; seine einzelnen Spitzen und Rücken waren aber nicht zu unterscheiden. Unzweifelhaft setzte sich dieses [343] Gebirge in das Gebiet des oberen Mahakam fort und wahrscheinlich auch noch weiter östlich, was wir vom Lĕkudjang aus nicht hatten sehen können. Auch jetzt wurde uns die Aussicht nach dieser nordöstlichen Richtung durch dicht vor uns liegende, hohe Bergspitzen benommen, nach dem Verschwinden des Nebelmeeres musste sich jedoch der Zusammenhang dieses Berglandes mit dem Ober-Kapuas-Kettengebirge feststellen lassen.
Auch nach Süd-Osten erhoben sich zahlreiche Gipfel aus der Wolkenmasse, während genau nach Süden der Batu Lĕsong mit seinen leicht gewellten Gipfel den Gesichtskreis abschloss.
Die Kajan wurden durch den Anblick, der sich ihnen bot, ganz verwirrt, sie konnten von keinem einzigen Berge den Namen angeben und hatten augenscheinlich noch nie dergleichen gesehen. Für jemand, der die Bahau nicht näher kennt, ist es fast unglaublich, dass ihnen ihre nächste Umgebung so fremd ist. Nur wenige kennen die Namen der benachbarten Berge, auch wissen sie nicht einmal, wo die Berge liegen, die als ihre früheren Wohnplätze in ihren Überlieferungen eine grosse Rolle spielen, wie z.B. der Batu Matjan, der Batu Brok am Ulu Tĕpai u.s.w. Nur die Intelligentesten, die viel gereist sind, wissen besser Bescheid, aber auch nur in den Gegenden, die sie auf ihren Zügen passiert haben.
Wir weilten bereits längere Zeit auf dem Gipfel, als sich im Osten ein Wind erhob und das bis dahin bewegungslose Nebelmeer an der Oberfläche in Aufruhr brachte, indem er in das weisse Federbett tauchte und die Dämpfe in leichten Wolken nach oben warf, wo sie sogleich fortgetrieben wurden. Die gleichmässige, weisse Fläche ballte sich zu einzelnen grossen Wolkenmassen zusammen, die neben einander und um uns herumliegend alles bedeckten; sie boten dem Winde mehr Angriffspunkte, gerieten bald in Bewegung und verdeckten alle niederen Gipfel. Bier hatte bereits zahlreiche Gipfel visiert und so wollten wir nur noch warten, bis das Bergland selbst zum Vorschein kam. Midan brachte uns das ersehnte Frühstück, das er einigen Kajan zu tragen gegeben hatte, nach oben und wir genossen einige Augenblicke der Ruhe. In nordöstlicher Richtung musste viel Gestrüpp entfernt werden, um eine freie Aussicht zu erlangen, denn der Gipfel war nur nach der entgegengesetzten Seite hin gänzlich nackt d.h. nur mit wenigen Flechten bedeckt. Die Kajan waren anfangs, aus Furcht die Geister zu erzürnen, nicht dazu zu bewegen gewesen, ihre Schwerter zum Umhacken der [344] Sträucher zu gebrauchen, so dass meine Malaien die Arbeit allein verrichten mussten. Später entschlossen sich auch einige Kajan zum Mithelfen und so wurde die Arbeit für die Aufnahme zeitig genug erledigt. Die Sträucher bestanden aus ganz anderen Arten als unten am Mahakam. Da sie sich alle in Blüte befanden, lieferten sie für das Herbarium einen schönen Fund. Auch die Sammlung lebender Pflanzen konnten die Pflanzensucher bereichern, denn in den Felsspalten wuchsen harren mit grasartigen Blättern und schöne, grossblütige Rhododendren hingen von den Wänden herab. Es dauerte jedoch einige Zeit, bevor wir einiger Exemplare habhaft werden konnten, weil die Wände bis zum obersten, im Durchschnitt nur 60 Meter breiten Gipfel stets senkrecht blieben.
Nach dem Frühstück fand ich, zwischen dem Gestrüpp unterhalb des Gipfels mich hindurchwindend, verschiedene Pfade, von denen meine Leute behaupteten, dass sie von Wildschweinen herrührten. Es musste also noch ein anderer Zugang zum Gipfel vorhanden sein, denn den von uns gewählten konnten Wildschweine nicht gebrauchen. Schliesslich fand ich wirklich eine Schutthalde, die allerdings eine Neigung von 70° besass, die diesen Tieren aber vielleicht doch als Aufgang dienen konnte.
Erst gegen 9 Uhr kam ein Teil der Berge wieder zum Vorschein, unter anderen auch der Höhenzug, der sich von Ost nach West nördlich vom Batu Mili hinzieht und im Ong Dia am Mĕrasè seinen Abschluss findet. Nach dieser Seite zu fällt der Batu Mili sehr steil ab und ist von dem ebenso steilen Ong Dia durch eine 500 m tiefe Schlucht getrennt.
Gegen halb elf Uhr wurden wir selbst in Wolken gehüllt und konnten uns von der, trotz des heftigen Windes, brennenden Sonne erholen. Lange dauerte die Erholung aber nicht, auch hatte Bier, um an einem Tage die ganze Arbeit zu erledigen, alle seine Zeit nötig. Für mich war der Aufenthalt hier oben sehr lehrreich, da er mir eine Vorstellung vom Relief dieser Gegend gab. Die Sonne liess auch auf grosse Entfernung die Einzelheiten in der Landschaft deutlich hervortreten. So zeigte sich, dass die Nebenflüsse des Mahakam an der Nordseite des Batu Lesong durch Erosion interessante Formen hervorgerufen haben. Der lange, leicht gewellte Rücken des Batu Lĕsong fällt, ausser an den Stellen, wo sich seine Querrücken befinden, senkrecht ab. Als Wasserscheide zwischen Murung und Mahakam musste der Berg einen [345] vorzüglichen Beobachtungspunkt liefern; ich betrachtete ihn daher tagsüber bei verschiedener Beleuchtung, um zu sehen, von wo aus man ihn besteigen konnte. Die Kajan wagten sich nicht so weit fort und die einzelnen Truppen Buschproduktensucher, die sich am oberen Blu-u befanden, hatten von dort aus unmöglich den Gipfel besteigen können. Nach dem Bericht der Leute, führte vom Flusstal des oberen Tjĕhan aus zwar ein Pass über den Batu Lesong, aber er musste in einem Sattel liegen, weil das Gebirge gerade dort zu einer Höhe von 1800 Metern ansteigt; als Beobachtungspunkt war er also sehr ungeeignet. Mehr schien mir ein auf dem Gipfel befindliches Plateau zu versprechen, von dein aus ein langer Querrücken zwischen dem Danum Parei und Dini zum Mahakam herunterläuft. Ich bemerkte mit meinem Fernglas keine tiefen Einschnitte in diesem Rücken, somit konnte er uns wahrscheinlich mit Hilfe seiner Waldbedeckung zum ersehnten Ziele führen. Von dem rechten Nebenfluss des Blu-u, dem Bruni, aus sollte ein Pfad zum Danum Parei führen und von dort aus musste der Querrücken zu erklimmen sein. Da ich keine Hoffnung hatte, am oberen Mahakam bessere Auskunft zu erhalten, beschloss ich, meinen Beobachtungen zu vertrauen und auf diesem Wege die Besteigung des Batu Lĕsong später vorzunehmen.
Sehr erhitzt und ermüdet, aber befriedigt von allem Genossenen und Beobachteten, erreichten wir unser Lager, zur grossen Beruhigung Kwing Irangs, der sich selbst nicht wieder hinaufgewagt und den Geistern unseretwegen nicht getraut hatte.
Völlig beruhigt zeigte sich Kwing Irang jedoch erst am folgenden Morgen, nachdem ich die Nacht ruhig und traumlos geschlafen hatte; er schloss hieraus, dass sich die Geister trotz meiner auf dein Gipfel begangenen Freveltaten, wie das Umhacken des Gestrüpps, nicht an mich heranwagten.
Bier begab sich bereits sehr früh wieder nach oben, um noch, bevor die Nebel sich erhoben, einige Bergspitzen anzupeilen. Unterdessen beschäftigte ich mich unten mit dem Sammeln von Moosarten, die auf dem Gipfel, wahrscheinlich unter dein Einfluss von Sonne und Wind, nicht vorkamen. In dem feuchten Walde unter den hohen Baumkronen fand ich dagegen eine Menge sehr eigenartiger Formen, so dass ich in Begleitung des Pinau Malaien Persat immer weiter um den Fuss des Gipfels herumging, bis ich plötzlich vor dem unteren Ende der Schutthalde stand, welche die Schweine als Aufgang benützten. [346]
Bei meiner Rückkehr ins Lager fand ich Bier schon vor und so konnten denn sogleich unsere Sammlungen und Instrumente verpackt werden.
Doris hatte mit den Seinen nicht viel Glück gehabt, unter den geschossenen Vögeln fand sich keine neue Art; dagegen konnten die Pflanzensucher eine grosse Fracht neuer Pflanzen nach unten befördern.
Trotz aller bösen Prophezeiungen der Kajan war unser Zug somit ohne Unfall verlaufen. Kwing Irang war nicht einmal, wie nach der Besteigung des Batu Kasian im Jahre 1896, erkältet. Damals fasste er seine Erkrankung als eine Strafe der Geister auf; in Wirklichkeit war sie die Folge einer kalten, regnerischen, auf 600 m Höhe verbrachten Nacht. Diesmal hatte ich ihm vorsichtshalber für die Nacht ein flanellenes Sporthemd gegeben, das ihn so gut erwärmt hatte, dass er nun aus Befriedigung über seine heldenhafte Besteigung des Geisterberges bereit war, mich zu einem Weiher zu begleiten, der in der Nähe des Batu Plöm im Walde liegen sollte und in welchem sich die Donnergeister des Batu Mili jede Nacht zu baden pflegten. Leider kam es nicht zu diesem Ausflug.
Obgleich Kwing Irang und seine Leute nur unter meinem Schutz das Unternehmen gewagt hatten und viel mehr Menschen mitgegangen waren als ich nötig hatte, musste ich doch allen den üblichen Lohn von 2.50 fl. in drei Tagen und dem Häuptling 2.50 fl. pro Tag geben. Da es sich hier nur um eine Exkursion von kurzer Dauer handelte, war der Preis erträglich.
Anders verhielt es sich bei unserem Zuge an den Mĕrasè den wir, nachdem die Verbotszeit dort beendet war, unternahmen. Der Zweck unseres Aufenthaltes am Mahakam machte es notwendig, dass wir uns möglichst lange bei den Stämmen aufhielten, und nun meinte Kwing Irang, dass wir es unserer Würde schuldig waren, bei den Ma-Suling mit zahlreichen Böten und Menschen aufzutreten. Ich legte jedoch auf seine einigermassen selbstsüchtige Begründung nicht viel Gewicht, da unser Ansehen bei den Bahau auf etwas anderem als einem grossen Gefolge beruhen musste, und beschloss daher, zur Erforschung des neuen Gebiets alle unsere Sammler und die übrige Gesellschaft und nur eine beschränkte Anzahl Bahau mitzunehmen, die im Grunde doch nur ein von mir bezahltes Geleite Kwing Irangs bildeten. Kwing wollte nämlich die Gelegenheit benützen, um mit seinen Kampfhähnen am Mĕrasè zu glänzen; dabei sollte das zahlreiche [347] Gefolge noch zur Erhöhung seines Ansehens dienen. Infolge der guten Ernte befanden sich nicht nur die Kajan, sondern auch die Hähne in blühendem Zustand und versprachen, die Ehre des Häuptlings gegenüber den Bakumpai oder Barito Malaien, die sich bei Itjot am Mĕrasè aufhielten, gut zu vertreten.
Die Hahnenkämpfe (pe̥tuduk) sind seit zwei Generationen bei allen Bahau am Mahakam durch die Malaien von Kutei eingeführt worden. Die Malaien betreiben die Hahnenkämpfe. nur als Hazardspiel, bei dein die Kraft und Gewandtheit der mit eisernen Sporen (tadji) bewaffneten Hähne nur insofern Interesse einflössen, als sie den Gewinn oder Verlust eines hohen Einsatzes oder einer Wette bestimmen. Den gleichen Charakter tragen die Hahnenkämpfe auch bei den Bahau unterhalb der Wasserfälle, hauptsächlich bei den Häuptlingen Kanu Jok und Si Brit oder Raden Mas, die, als sie vom Sultan jahrelang in Tengaron zurückgehalten wurden, dort malaiische Gewohnheiten annahmen. Auch unter den Häuptlingen oberhalb der Wasserfälle nimmt die Überzeugung immer mehr zu, dass sie es ihrer Würde schuldig sind, Kampfhähne zu halten; selbst mancher ihrer jungen Untertanen besitzt einen Hahn. Nur ein Häuptling von der hohen Stellung Kwing Irangs hält sich eine grössere Anzahl Hähne; die übrigen finden es zu lästig, die Tiere so lange zu füttern und durch Baden, Massieren und Üben zum Kampfe vorzubereiten. Unter den Pnihing fand ich nur bei Bĕlarè einen Hahn, der in einem Korbe in der Galerie hing. Er verkaufte seine Hähne aber lieber, als dass er sie selbst kämpfen liess.
Kwing Irang kaufte seine Hähne in der Regel von seinen Freien, die die Tiere teilweise bereits selbst dressiert hatten. Die ausgebreitete Hühnerzucht der panjin verfolgte ursprünglich den Zweck, Opfertiere zu liefern; seit Einführung der Hahnenkämpfe wird sie aber in noch grösserem Massstabe betrieben.
Eine bestimmte Rasse wird nicht gezogen; in früheren Jahren hatten jedoch die Malaien vom Kapuas und unteren Mahakam dem Häuptling einige besonders grosse Exemplare von Kampfhähnen mitgebracht und von diesen stammen seine jetzigen, grossen Hähne ab.
Beim Abschied im Jahre 1897 hatte Kwing Irang auch mich gebeten, beim nächsten Besuch Hähne mitzubringen. Der eifrige Betrieb der Hühnerzucht kam uns sehr zustatten, da er uns ständig mit Hühnern und Eiern versorgte. Die Kampfhähne unterscheiden sich von den [348] überall sonst auf Borneo vorkommenden Hähnen nur durch ihre Grösse; besondere Rassenmerkmale besitzen sie nicht.
Die Kämme werden den Hähnen kurz abgeschnitten und auch die Sporen werden meist mit einem Stück Blech abgesägt und zwar so, dass keine Blutung entsteht. Man tut dies, damit sich die Hähne bei Übungsgefechten keinen Schaden zufügen können.
Bei ernsten Gefechten werden den Tieren ungefähr 7 bis 8 cm lange, scharf geschliffene Sporen (tădji) an die Unterseite des Fusses gebunden. Der Sporn wird stets nur an einem Fuss befestigt; er läuft entweder gradlinig oder gebogen oder gewunden in eine Spitze aus.
Die Sporen werden von bestimmten Personen, die die Kunst an der Küste gelernt haben, geschliffen und zwar aus Rasiermessern, Tischmessern u.a., welche von Malaien eingeführt werden. Kwing Irang und sein Sohn Bang hatten es im Schleifen besonders weit gebracht; ihre Sporen waren so fein bearbeitet, dass sie tadelloser auch aus einer europäischen Werkstatt nicht hätten hervorgehen können.
Das Schleifen geschieht auf Drehscheiben von verschiedener Grösse und Feinheit, die auf einem einfachen Gestell ruhen und von einem Knaben mittelst einer hin- und hergezogenen Schnur in Bewegung gesetzt werden. Auch diese Drehscheiben sind von den Malaien übernommen worden.
Kwing Irang besass, je nach der Beschaffenheit seines Reisvorrats und der Aussicht auf künftige Gefechte, zwischen 5 und 30 Hähnen, von denen jeder gesondert in einem aus Rotang geflochtenen Korbe unter dem Dache seiner Wohnung hing oder bei den zuverlässigsten seiner Sklaven einquartiert war.
Die Hähne werden morgens und abends ausschliesslich mit ungespelztem Reis gefüttert; sie bekommen wenig zu trinken und gehen nur dann frei herum, wenn der Häuptling sich mit ihnen abends beschäftigt, mit ihren Klauen Gymnastik treibt und die Tiere miteinander kämpfen lässt. Die Hähne werden in der Regel täglich im Fluss gebadet und nass wieder in den Korb gesetzt.
Wahrscheinlich, würde man auf die körperliche Entwicklung der Hähne noch grössere Sorgfalt verwenden, wenn nicht, besonders bei den Bahau, die Farbe und Anordnung der Federn bei der Beurteilung der Tauglichkeit eines Tieres eine so grosse Rolle spielten. Es werden zwar von der Gegenpartei auch die Entwicklung der Muskeln und die Körpergrösse in Betracht gezogen, aber die Farbe der Federn erscheint [349] doch ebenso wichtig. Daher werden, um den Wert der Hähne herabzusetzen, häufig vor den Kämpfen einige Federn von besonders guter Bedeutung ausgezogen.
Bei den Hahnenkämpfen gewinnt derjenige Hahn den Sieg, der den anderen tötet oder in die Flucht jagt. Man beginnt die Tiere zu reizen, indem man dem einen den Kopf festhält und das andere hineinhacken lässt, bis man aus der Heftigkeit der Anfälle ersieht, dass die Tiere genügend in Wut geraten sind. Dann setzt man die Hähne in einem Abstand von 4–5 m auf den Boden und lässt sie gleichzeitig auf einander los. In der Regel laufen sie auf einander zu, fliegen an einander auf und suchen sich mit ihren Sporen zu verwunden. Bisweilen ist keiner der Hähne kampflustig; die Wette bleibt dann unentschieden. Dies ist auch der Fall, wenn beide Tiere gleichzeitig an ihren Funden sterben, oder wenn der Sieger den Besiegten, der ihm zugetragen wird, nicht mehr hacken will, zu hacken wagt oder wegen Ermüdung oder Blutverlust nicht mehr zu hacken im stande ist. Können beide Hähne nicht mehr weiterkämpfen, so gewinnt ebenfalls keine der Parteien.
Die Wunden, die die Tiere einander beibringen, sind oft sogleich tötlich. Dringt der eiserne Sporn in den Leib, so wird dieser nicht selten 67 cm weit aufgerissen, der Hals wird bisweilen mit einem Mal gänzlich durchgeschnitten. Öfters kann ein Hahn seinen Sporn, wenn er in einem Knochen festsitzt, nicht befreien; man wartet dann eine Zeitlang, nimmt die Tiere dann auf und sieht den Kampf, wenn beide Tiere noch leben, als unentschieden an. Es kommt vor, dass die Tiere nur schwach verwundet sind oder hauptsächlich Fleischwunden haben. Merkwürdiger Weise verstehen die Bahau derartige Wunden mit Nadel und Faden geschickt zu nähen und zu heilen, während sie noch nicht auf den Gedanken gekommen sind, die Wunden bei Menschen auf die gleiche Art zu behandeln. Wahrscheinlich haben sie mit der Sitte der Hahnenkämpfe zugleich die der Wundbehandlung von den Malaien übernommen. Die Kajan verteidigten mir gegenüber das grausame Gefecht mit den Sporen damit, dass auf diese Weise dem Leiden der Hähne schnell ein Ende gemacht würde, während sie ohne Sporen so lange kämpften, bis sie vor Erschöpfung oft tot niederfielen.
Bei den panjin werden die Hahnenkämpfe nur als Zeitvertreib, den sich nur die Wohlhabenden und auch diese nur in bescheidenem Masse [350] erlauben dürfen, aufgefasst. Nach vollbrachtem Tagewerk lassen die jungen Leute abends öfters ihre Hähne miteinander kämpfen, aber nur sehr selten mit Sporen und um einen Gewinn; auf Wetten lassen sie sich überhaupt nicht ein. Den Einsatz bildet eine alte Perle, ein Beil oder ein Schwert. Verheiratete Leute beteiligen sich nur ausnahmsweise an diesem Vergnügen, das in dieser Form durchaus unschuldig ist. Lassen sich dagegen die Häuptlinge auf ihren Reisen flussabwärts mit Malaien oder Barito und Kahájan Dajak in Wettkämpfe ein, so wird der Einsatz stets so hoch wie möglich gewählt.
Die Sitte verlangt, dass die Stammesgenossen auf den Hahn ihres eigenen Häuptlings setzen. Kwing Irangs Einsatz variierte zwischen 5 und 40 fl.; sein Gefolge wettete 1 bis 2.50 fl. pro Person, so dass stets noch 50 bis 60 fl. hinzukamen und bisweilen 100 fl. auf einen Hahn gesetzt wurden. Bang Jok und die Malaien setzten oft noch grössere Summen auf ihre Hähne; Kwing Irang tat es nur bei einigen besonderen Tieren.
Auch bei den Hahnenkämpfen der Bahau spielen nicht mir die Geister mit ihren Vorzeichen, sondern auch allerlei abergläubische Vorstellungen eine wichtige Rolle. Begiebt sich Kwing Irang z.B. mit seinen Hähnen zu einem anderen Häuptling, so fassen die Kajan diesen Zug als einen wirklichen Kriegszug auf und suchen alles zu vermeiden, was der Männlichkeit und Tapferkeit der Hähne schaden könnte. Daher war Kwing Irang bei unserer Reise zur Küste im Jahre 1897 durchaus dagegen, dass Frauen mit uns reisten, weil diese auf seine Kampfhähne einen nachteiligen Einfluss ausüben konnten. Als eine Frau schliesslich doch mitzog, lagerte sich Kwing Irang mit seinen Hähnen stets in möglichst grosser Entfernung von ihr. Nach Ansicht der Bahau wird nicht nur die Kraft der Hähne, sondern auch die der Männer durch die Berührung mit etwas Weiblichem beeinträchtigt. Die Kajanmänner vermeiden es daher, einen Webstuhl oder getragene Frauenkleider anzurühren; tun sie dies, so werden sie “dawi”, d.h. schwach und haben auf der Jagd, beim Fischfang und im Kriege keinen Erfolg. [351]
Kapitel XVI
Besuch bei den Ma-Suling am Mĕrasè—In Batu Sala, Napo Liu und Lullt Sirāng—Behandlung von Kranken, Einkauf von Löten und Ethnographica—Besteigung des Batu Situn—Beobachtungsposten auf einem Baumgipfel—Rückhehr nach Lulu Sirāng—Symbolische Heiratserklärung—Hochzeitsgebräuche—Ehegesetze—Heimkehr nach dem Blu-u—Besuch hei den Pnihing am Tjĕhan—In Long ’Kup—Besteigung des Liang Baring—Bei den I’nihing am Paketè—Begräbnisstätte der Pnihing—Hadji Umar—Zurücksendung einer Batang-Lupar Gesellschaft Beratung wegen des Haushaus—Besuch von Hinan Lirung.
Am 20. November konnten wir endlich unseren lang geplanten Besuch bei den Ma-Suling am Mĕrasè zur Ausführung bringen. Früh morgens fuhren wir in zwei grossen Böten ab; in dem unsrigen befanden sich ausser uns Europäern, dem Chinesen Mi-Au-Tong und unseren Malaien nur noch zwei Kajan als Steuermänner, da diese das Fahrwasser am besten kannten. Die beiden jungen Leute hatten mich bereits auf meiner früheren Reise öfters begleitet. Bald nach unserer Abfahrt hörten wir das Brummen eines Rehs, das, als schlechtes Vorzeichen, die Kajan zur Rückkehr und zum Aufschieben eines Unternehmens auf acht Tage zwingt. Ich tat, als ob ich nichts hörte und, als meine Steuermänner unruhig wurden und mich fragten, was ich zu tun gedächte, sagte ich einfach: “weiterrudern”, worüber der Chinese in herzliches Lachen ausbrach. Der eine Steuermann, Owat, der mit mir auch zum ersten Mal den Batu Mili bestiegen hatte, war mit meiner Antwort augenscheinlich sehr zufrieden, denn er begann mit seinem Ruder kräftig auszuholen und so blieb dem zweiten Steuermann nichts übrig, als dem Beispiel des ersten zu folgen. Gleich darauf holte uns das zweite Boot ein, in dem sich Kwing Irang mit seinem Sohne Bang, seinen Kajan und den Kampfhähnen befand. Sie hörten in nächster Nähe vor uns den Ruf des hisit auf ihrer rechten Seite; der Vogel prophezeite ihnen also eine glückliche Reise. Der adat gemäss musste Kwing Irang landen und eine Zigarette rauchen. [352]
Meine beiden Kajan hüteten sich, über unser Vorzeichen ein Wort zu sagen, und rauchten mit ernsten Gesichtern ebenfalls ihre Zigaretten. Darauf setzten wir unsere Fahrt schnell fort. Wir machten weder in Lulu Njiwung noch in anderen kleinen Niederlassungen Halt, sondern fuhren direkt bis Batu Sala, um mit dessen Bewohnern die Bekanntschaft zu erneuern und Barth den Häuptlingen vorzustellen. Leider befand sich der Häuptling Paren mit seiner Frau in Long Tĕpai und wir wurden nur von seinem Bruder Bang in der Galerie empfangen. Zwischen ihm und Kwing Irang auf dem Boden sitzend, den Rücken an die schiefe Aussenwand gelehnt, begann ich über alles, was sie seit meiner Abwesenheit erlebt hatten und über die Ernteaussichten zu sprechen. Die Gegenwart des Kontrolleurs, der an der anderen Seite Kwings sass, schien den ängstlichen Bang einzuschüchtern, ich benützte daher einen günstigen Augenblick, um die beiden einander vorzustellen und sprach dann über gleichgültige Dinge weiter. Als sich nach einiger Zeit auch der Kontrolleur an der interessanten Unterhaltung beteiligte, hielt es Kwing Irang fürangebracht, mich zu seinem Schwiegervater Bo Djo zu führen, der Häuptling eines kleinen, bei den Long-Glat lebenden Stammes ist. Ich hatte den alten Mann bereits im Jahre 1897 behandelt; jetzt hatte er wiederum meine Hilfe nötig, da er an Bronchitis und Malaria litt. Er äusserte seine Freude über mein Kommen, erkundigte sich nach seiner Tochter Uniang Anja und deren Söhnchen Hāng und wollte wissen, warum sie nicht mitgekommen waren. Ich wagte ihm nicht zu sagen, dass seine Tochter unserer Kampfhähne wegen nicht hatte mitreisen dürfen. Kwing Irang, den Kranke unangenehm berührten, entfernte sich und ich betrachtete nun mit Musse meine Umgebung, nachdem ich dem alten Manne versprochen hatte, ihn am folgenden Morgen ärztlich zu behandeln. In dieser von alters her wohlhabenden Niederlassung befanden sich viele schöne, alte Gegenstände und ich begann sogleich die hohe, mit Perlen verzierte Mütze von Bo Djos Tochter, die dem Hause vorstand, zu rühmen; auch erkundigte ich mich, wer ihr den hübschen Rock gestickt hatte. Mein Interesse fand grossen Beifall und so liess man mich auch noch andere schöne Dinge sehen. Auf einige Gegenstände machte ich, um vorläufige Unterhandlungen einzuleiten, ein Angebot. Bei meiner Rückkehr ins grosse Haus begegnete ich verschiedenen Bekannten von früher und begab mich daher in guter Stimmung nach unserer Galerie vor der Häuptlingswohnung, wo man [353] alles für eine Mahlzeit und die Nacht vorbereitet hatte und Barth noch immer in eine Unterhaltung mit Bang vertieft sass.
Am folgenden Tage gab es für mich noch so viel Arbeit im Dorfe, dass ich froh war, als uns ein heftiger Regen des Morgens an der Weiterreise verhinderte; ich hatte nun Zeit, mich mit den zahlreichen Kropf- Fieber- und Lueskranken zu beschäftigen und ihnen Arzneien auszuteilen, die ich in grösserer Menge mitgenommen hatte. Als der Regen nach dem Essen aufhörte, brachen wir, mit dein Versprechen wiederzukommen, zum Mĕrasè auf. Die Bevölkerung hatte nun Zeit, über ihre erste Begegnung mit dein gefürchteten Regierungsbeamten nachzudenken und sich über seine Anwesenheit zu beruhigen. Wegen des hohen Wasserstandes und der Schwere unserer Böte erreichten wir erst nach vierstündiger Fahrt Napo Liu, die Niederlassung der Ma-Suling, in der Bo Li gestorben war. Auf Kwings Rat landeten wir nicht bei des Häuptlings Hause, da Lĕdju Lis Familie noch Halbtrauer trug, sondern bei Tĕmenggung Itjot, der uns schon erwartet zu haben schien. Wenigstens empfingen uns einige hübsch gekleidete Malaien vor der Haustreppe, die zu seinem Badehäuschen führte; sie begrüssten uns und forderten uns auf, ihnen nach Itjots Galerie zu folgen, wo wir eine grosse Gesellschaft Bakumpai, Malaien vom Barito, antrafen. Ich kannte die meisten von meinem vorigen Besuch her, es waren aber noch neue Buschproduktensucher vom Bĕlatung, die bei den Ma-Suling Reis einkaufen wollten, hinzugekommen. Die Gesichter, die uns umringten, waren nichts weniger als sympathisch, aber wir mussten sie ertragen, da der Häuptling uns als Fremde in seiner Wohnung nicht aufnehmen durfte. Neben Itjots Wohnung befand sich eine andere, deren Bewohner augenblicklich auf dem Reisfelde lebten, in diese hielten wir nun unseren Einzug.
Während unseres Besuches bei Lĕdju erzählte er uns, dass die neuangekommenen Malaien einen Gong als Bussgeld hatten geben müssen, weil sie die Niederlassung vor Ablauf der Trauerzeit betreten hatten. Eigentlich waren auch wir zu einer Busse verpflichtet, aber Kwing Irang erklärte Ero, der Wittwe von Bo Li, dass wir keine Fremden seien, da wir mit den Kajan zusammenwohnten; so kamen wir mit einem Packen Perlen davon. Die ganze Familie ging noch in Trauer; die Frauen trugen im Hause eine hellbraune tă-ā, die nur bis an die Kniee reichte; die jungen Söhne waren nur mit einem hellbraunen Lendentuch bekleidet. [354]
Die Gesellschaft Bakumpai war sehr nach Kwing Irangs Sinn; den ganzen folgenden Tag über wurde an nichts anderes als an Hahnenkämpfe gedacht. Die zwei Parteien sassen einander gegenüber und beurteilten gegenseitig ihre Hähne nach der Farbe und Anordnung der Federn, nach der Kraft und dem Temperament. Der gutmütige, vorsichtige Kwing war den die Aufregung des Spiels liebenden Malaien viel zu schwerfällig; die Unterhandlungen schienen ihn auch mehr zu interessieren als der eigentliche Kampf, so dass die Geduld seiner Gegenpartei auf eine harte Probe gestellt wurde. Wahrscheinlich liessen sie sich hierdurch zu Unvorsichtigkeiten verleiten, denn Kwing gewann 4 Mal nach einander; da er sein Glück auch noch am folgenden Tag versuchen wollte, benützte er einen angekündigten Besuch des Häuptlings Bo Lea aus Long Tĕpai zum Vorwand, um länger zu bleiben.
Inzwischen hatte ich meinen Tag nicht minder gut verwandt, indem ich die Gelegenheit, wenn man mich als Arzt in eine Wohnung rief, dazu benützt hatte, ein Gespräch anzuknüpfen und über allerhand schöne Gegenstände, unter anderem auch über eine sehr alte Perlenverzierung für ein Kindertragbrett (tāp be̥ne̱ng) und eine Jacke mit einem aus bunter Knüpfarbeit versehenen Rand, zu unterhandeln. Den Eigentümern, die einen sehr hohen Preis von mir forderten, gab ich bis zu meiner Rückkehr von oben Bedenkzeit.
Zugleich sah ich mich nach grossen Böten um, die ich für unsere Fahrt zur Küste nötig hatte. Auf der vorigen Reise hatte ich von Paren, dem Pnihinghäuptling am Tjĕhan, ein sehr schönes Boot gekauft, in diesem Jahre hatte man in seiner Niederlassung aber nur kleine Böte hergestellt, so dass ich diesmal auf die Ma-Suling rechnete. Unter Itjots Hause fand ich nur schmale, schlechte Exemplare, für die die Besitzer morgens einen sehr hohen Preis verlangten, abends aber bereits 50% abliessen. Wie man mir erzählte, sollten in der grossen Niederlassung weiter oben am Mĕrasè schöne Böte zu haben sein, daher beschloss ich, mich dorthin zu begeben.
Da wir noch mancherlei Pläne auszuführen hatten und die Anwesenheit der vielen Malaien unter den Bahau uns unangenehm berührte, liessen wir Kwing Irang bei seinen Hähnen und fuhren selbst mit unseren Leuten und einigen Kajan den Mĕrasè hinauf. Ich wollte das niedrige Fahrwasser benützen, um im Flussbett geologische Untersuchungen anzustellen, und nahm daher in einem kleinen Boot mit wenigen Ruderern Platz, die mich schnell von einem Ufer zum anderen [355] bringen konnten. Festes Gestein, das nicht zu sehr verwittert war, bemerkte ich nur anfangs, weiter aufwärts war alles Gestein mit einer dicken Erdschicht bedeckt, auf der nur Gestrüpp wuchs, da die Ma-Suling während ihres langdauernden Aufenthaltes am Mĕrasè den ursprünglichen Wald längs des ganzen Flusses ausgerodet hatten. Nach vierstündiger Fahrt machte uns Demmeni auf das Grabmal des früheren Häuptlings Bo Long aufmerksam, das er auf der vorigen Reise photographiert hatte.
Bald darauf gelangten wir an eine Stelle des Ufers, an der alte verfaulte Pfähle und eine stattliche Reihe der am oberen Mahakam seltenen Kokospalmen und andere sehr alte Fruchtbäume als Zeugen einer früheren Niederlassung der Ma-Suling übriggeblieben waren. Der Ort schien jetzt nur von Wild besucht zu werden, denn zwischen den hoch aufgeschossenen Pflanzen zeigte der weiche, humusreiche Boden zahlreiche Spuren von Wildschweinen, Hirschen und wilden Rindern, die sich in grossen Herden, um zu grasen und Früchte zu essen, hierher zu begeben schienen. Das Gehen auf dem aufgewühlten Boden war sehr unbequem, aber Demmeni und Barth drangen doch so weit vor, dass sie eine Hütte mit vor Alter halb eingestürzten Wänden entdeckten, in der eine grosse Menge Schädel aufbewahrt lagen. Wir hörten später, dass die Schädel aus dem alten Hause stammten und dass die Ma-Suling sie aus abergläubischer Furcht nicht in das neue Haus herüberzubringen wagten. Auf ihre Bitte musste Bĕlarè später mit seinen Pnihing das gefährliche Werk für sie ausführen. Als Lohn traten sie ihm die Hälfte der Trophäen ab, mit denen er seine Galerie schmückte.
Leider durften wir die Kokosnüsse und anderen Früchte, nach denen uns stark gelüstete, nicht anrühren, da Lĕdju Li sie wegen des Todes seines Vaters, der diese Fruchtbäume gepflanzt hatte, für buling oder lāli erklärt hatte. Nach einiger Zeit sahen wir auf einer sehr ebenen Fläche längs des Mĕrasè die Niederlassung Lulu Sirāng hervortreten, in der die beiden Brüder Obet Dĕwong und Bo Ngow als Häuptlinge herrschten.
Wir wurden von den Brüdern ebenso freundlich wie in Napo Liu empfangen, was uns um so angenehmer berührte, als sie sehr gut wussten, dass wir in politischen Angelegenheiten kamen. Zwar waren die Häuser auch hier noch nicht ganz vollendet, aber die grosse Galerie Obet Dĕwongs bot uns einen guten Wohnraum. [356]
Während unser Gepäck und unsere Schlafstätte geordnet wurden, begab ich mich zur Häuptlingsfamilie, deren Kinder alle fieberkrank waren. Die Ältesten standen dermassen unter dem Eindruck des weissen Doktors, dass sie das bittere Chinin ohne viel Widerstreben hinunterwürgten; einem kleinen Knaben dagegen konnte ich die Arznei nur in Pillen mit etwas Zuckerrohrsaft beibringen.
Am jenseitigen Ufer lag ein freistehender Hügel von 180 m Höhe, der Batu Marong, der uns einen schönen Überblick über die Umgebung versprach; ich bestieg ihn daher noch am selben Abend, um von dort aus mit Bier über die Aufnahme des Mĕrasè zu beraten. Ein steiler, halb wieder verwachsener Pfad führte uns auf den Gipfel, auf dem nur zwei Bäume und einige Sträucher standen, so dass wir bald eine Aussicht auf die von der Abendsonne beleuchtete Landschaft erhielten.
Wir fanden für die Hartnäckigkeit, mit der die Ma-Suling am Mĕrasè wohnen bleiben, darin eine Erklärung, dass der Fluss durch ein besonders breites und ebenes Tal strömt, das für den Reisbau sehr geeignet sein muss. Hiervon zeugte der Pflanzenwuchs, denn das dunkle, wellige Grün des Urwaldes war erst in einigem Abstand an den Bergabhängen zu sehen, während die helleren, ebeneren grünen Massen des jungen Waldes und der Strauchvegetation die Stellen andeuteten, welche die Ma-Suling einst bereits bebaut hatten. Von alang-alang und Gras, die an anderen Orten so bald auf kultiviertem Boden auftreten, bemerkten wir nichts.
Die Landschaft entzückte uns so sehr, dass es einige Zeit dauerte, bis wir über die topographische Aufnahme ernstlich zu beraten anfingen. Nach Norden hin, wo sich das hohe, steile Kalkgebirge, in dem der Sĕrata, Mĕrasè, Tĕpai und Nijān ihren Ursprung nehmen, mit seinen malerischen Formen erhob, war der Blick besonders anziehend. Die mächtigen, hellen Wände sind ihrer Steilheit wegen nicht bewachsen und heben sich daher von dem Grün ringsherum schön ab. Wir waren hier von den höchsten, spitzen Gipfeln des Kalkgebirges, dem Batu Matjan und Batu Brok, die nach beiden Seiten hin nur allmählich in vielgipflige Rücken auslaufen, nicht weit entfernt.
Ausser von diesen Bergen wurde die Aussicht nicht beeinträchtigt, so dass sich dieser Hügel für Bier als Beobachtungspunkt, von dem er die nächste Umgebung und verschiedene Berge anvisieren konnte, ausgezeichnet eignete. Von dem Quellgebiet des Mahakam, das im [357] Norden liegen musste, konnten wir uns von hier aus keine Vorstellung machen, doch schien dies uns von einem alleinstehenden, hohen Berge am oberen Mĕrasè aus möglich zu sein, daher beschlossen wir, ihn zu besteigen. Vielleicht konnten wir von diesem aus auch den Batu Tibang entdecken, auf dessen Abhängen die Hauptflüsse des Stammlandes der Bahau und Kĕnja entspringen und der daher als der Mittelpunkt der Welt angesehen wird. Wir hatten uns bereits vom Lĕkudjang und Batu Mili aus vergeblich nach dem Batu Tibang umgesehen, der uns auch als Grenzzeichen zwischen englischem und niederländischem Gebiet von Wichtigkeit erschien; ebenso hatten wir vergeblich versucht, Bĕlarè zu einem Zuge nach dem ersehnten Berge zu bewegen. Auf eine zuverlässige Auskunft seitens der Ma-Suling konnten wir nicht rechnen, da diese selbst für die ins Auge fallenden Gipfel des hohen Kalkgebirges, das sie täglich vor sich sehen, keine besonderen Namen besitzen und sich von dem Verhältnis dieser Berge zu denen am oberen Sĕrata, Tĕpai u.s.w. keine Vorstellung machen können. Sie wussten nur; dass der Berg, den wir besteigen wollten, Situn heisst und, wie beinahe alle alleinstehenden Berge, von gefürchteten Geistern bewohnt wird. Während wir uns abends in weitem Kreise sitzend unterhielten, erzählten uns einige Siang Dajak vom Barito, die hier für die Zeit, wo sie im Tal des Mĕrasè Guttapercha suchten, verheiratet waren, etwas Näheres über das Gebiet am oberen Mĕrasè, in dem sie an äusserst steilen Bergabhängen gearbeitet hatten. Eine genauere Vorstellung von den Flusstälern in dieser Gegend hatten jedoch auch sie nicht.
Die Ma-Suling kannten zwar einen Weg, der auf den Situn führte, aber dieser begann am Tasan, einem kleinen Nebenfluss des Mĕrasè, den Lĕdju Li wegen des Todes seines Vaters für buling oder lāli erklärt hatte; somit hatten wir wenig Hoffnung, diesen günstigen Aussichtspunkt zu erreichen.
Am folgenden Tag traf Kwing Irang mit den Seinen bei uns ein und versprach, mit Lĕdju, sobald dieser nach Lulu Sirāng kommen würde, über die Angelegenheit zu reden. Nach einigem Zögern war auch Obet Dĕwong bereit, uns zu begleiten, und Kwing Irang wollte uns für den Zug seinen besten Ratgeber Sorong und acht Kajan zur Verfügung stellen.
Die Häuptlinge hatten noch ein besonderes Interesse an dieser Exkursion; nach der Überlieferung stammen nämlich alle Pflanzen, die man bei religiösen Zeremonien auf dem Reisfelde gebraucht und [358] mit dem Reis gleichzeitig baut, von diesem Berge Situn und sollten dort noch wild vorkommen. Es erwies sich, dass dies nicht der Fall war, aber immerhin lehrte uns diese Überlieferung, dass auch die Kajan einst in diesen Gebieten gewohnt haben müssen. Wir erfuhren später, dass zwei der höchsten Gipfel, deren Namen wir damals noch nicht kannten, zum Batu Matjan gehörten, von dem mir Kwing Irang bereits früher berichtet hatte, dass sein Stamm einst auf ihm gelebt und Reisfelder angelegt habe. Er hatte sich den Batu Matjan aber eher als Hochfläche gedacht.
Während wir in den folgenden Tagen auf Lĕdju warteten, nahm Bier die Umgebung auf und ich beschäftigte mich mit den Bewohnern des langen Hauses, die stark am Malaria litten. Zu meiner Freude konnte ich viele, auch die Kinder des Häuptlings, von ihrer Krankheit heilen.
Ich erlaubte diesen, sich ein hübsches Stück Zeug oder Ohrringe als Geschenk auszusuchen, und erfreute auch die Eltern mit einem Gegenstand, den sie sich wünschten. Bo Ngow hatte glücklicher Weise weniger Kinder und auch seine Frau lebte nicht mehr, so dass er an meine Vorräte geringere Ansprüche stellte; allerdings wurde dieser Vorteil durch seine sehr hübsche und sympathische Tochter teilweise wieder aufgehoben.
Indem ich mit so vielen in Berührung kam, bot sich mir eine gute Gelegenheit, Ethnographica zu sehen und einzukaufen, und, da ich nicht mehr besonders sparsam zu sein brauchte, erwarb ich manche schönen Perlenarbeiten, Matten, Röcke u.s.w. In verborgenen Winkeln am Feuerherde entdeckte ich auch noch einige alte, irdene Töpfe (taring tanah), wie sie früher am Mahakam gebrannt wurden. Zum Erstaunen der Hausbewohner kaufte ich diese Zeugen einer verschwundenen Industrie, auch wenn sie einen Riss hatten; da ich in Salz, Perlen und Zeug einen hohen Preis für sie bezahlte, habe ich wahrscheinlich alle erworben, die noch vorhanden waren.
Den beiden Häuptlingen konnte ich noch anders als durch Geschenke einen Gefallen erweisen. Sie hatten nämlich in diesem Jahre jeder ein sehr grosses Boot gebaut, um es an den Sultan von Kutei zu verkaufen, der sie gut bezahlte, da Böte von dieser Grösse unterhalb der Wasserfälle nicht mehr gebaut werden. In Gesellschaft von Kwing Irang und Sorong besichtigte ich die Böte, von denen jedes 21 m lang und 4–5 Fuss breit war. Das eine Boot war etwas dünner, aber [359] dafür tiefer als das andere; aber beide entsprachen vollständig unserem Zweck und so kaufte ich sie für den geforderten Preis von 100 fl. das Stück. Den gleichen Preis hatte ich auch einige Jahre vorher den Pnihing für ein ähnliches Boot bezahlt.
Inzwischen zeigte es sich, dass Lĕdju sich mit seiner Ankunft bei uns nicht beeilte, auch brachten andere die Nachricht, dass er wegen des Todes eines Kindes in einer Sklavenfamilie die Trauer noch nicht gänzlich abgelegt hatte, so dass die Aussicht, ihn hier zu sehen, nicht gross war Kwing, der hier keine Gegenpartei für seine Kampfhähne fand, sehnte sich danach, wieder hinunter zu ziehen und, da es hier oben auch für den Kontrolleur nicht viel zu tun gab, sollte er Kwing begleiten. Am 26. Januar reisten beide ab. Sicherheitshalber gab ich ihnen alle Schutzsoldaten nach Napo Liu mit, wo die Gesellschaft auf mich warten sollte. Sorong und die Seinen blieben zurück, um uns unter Obet Dĕwongs Führung nach dem Situn zu geleiten. Der Zug wurde unter Kwing Irangs Verantwortung unternommen, der meinte, dass ihm, da Lĕdju nicht gekommen war, um das lāli des Tasan aufzuheben, als ältestem Familienglied das Recht zustand, uns gegen eine Busse an Lĕdju den Fluss hinauffahren zu lassen. Wegen des hohen Wasserstandes war an diesem Tage jedoch an eine Fahrt nicht zu denken, auch hatte ich noch keine Zeit, da man mir nun auch von den Reisfeldern Kranke zur Behandlung brachte und ich Chinin mit einer Gebrauchsanweisung austeilen und den Lueskranken eine Jodkalilösung in Flaschen zubereiten musste. Einige Dorfbewohner setzten noch vor meiner Abreise die anfangs geforderten hohen Preise für Ethnographica herab und so hatte ich so viel zu tun, dass ich mich geduldig auf die Versicherung, dass der Mĕrasè schnell fallen würde, verliess.
Trotz des hohen Lohnes, den ich ausgesetzt hatte, konnte Obet Dĕwong am anderen Morgen nur mit Mühe acht Mann dazu bewegen, ihre Arbeit unseres Zuges wegen zu unterbrechen; daher waren wir erst um 9 Uhr reisefertig. Unsere Pflanzensucher begleiteten uns mit ihren Tragkörben: sie hatten in den letzten Tagen bereits in der Umgebung prächtige Pflanzen gefunden, auf dem Batu Marong unter anderen eine Aroïdee, deren grosse Blätter wie aus dunkelbraunem Sammet geschnitten aussahen.
Ausser den Hütten auf den Reisfeldern weiter oben sahen wir nur noch eine kleine Niederlassung oberhalb der Mündung des Asa, der [360] in einem sehr breiten Tal längs der senkrechten, nördlichen Wand des Ong Dia strömt. Das Tal wird nach Westen durch die Verlängerung des Ong Dia Rückens abgeschlossen, der sich in nördlicher Richtung bis zum Kalkgebirge Batu Matjan hinzieht.

Rotang mit symbolischen Zeichen zur Absperrung eines Flusses.
Nach zweistündiger Fahrt erreichten wir die Stelle, wo der Tasan von Norden her in den Mĕrasè mündet, der hier um den südlichen Abhang des Batu Situn eine Biegung macht. Etwas weiter oberhalb der Mündung fuhren wir unter dem Rotang hindurch, den Lĕdju Li als Verbotszeichen quer über den Fluss hatte spannen lassen.
Die Flussgeister schienen uns unsere Freveltat nicht übel zu nehmen, denn einer der Ma-Suling entdeckte an einer verbreiterten Stelle, wo das Wasser ruhig strömte, einen grossen Fisch. Das Boot näherte sich lautlos dem Tier und es gelang dem vorderen Steuermann, den Fisch mit seiner Lanze zu spiessen. Das Schlachtopfer wehrte sich zappelnd und tauchte unter, trieb aber, durch den Blutverlust geschwächt, bald wieder an der Oberfläche und wurde mit Jubel in das Boot gezogen.
Weiter oben drängt sich der hier nur 7 m breite Tasan zwischen zwei senkrechten Kalkfelsen hindurch, deren Wände mit Algen, Moos, Farren und anderen Pflanzen feuchter Standorte dicht bewachsen sind.
In früherer Zeit durften die Bewohner dieser Gegenden den Tasan nur bis zu dieser lobang be̥lare̱ (Höhle eines Donnergeistes) hinauffahren; erst seit kurzem wagen sie sich weiter aufwärts. Auch jetzt fuhren wir unter feierlichem Schweigen an dieser Stelle vorüber.
An dem kleinen Fluss Tĕrè weiter aufwärts zogen die Ma-Suling die Böte in den Uferwald, während Sorong mit den Seinen den gleichmässig ansteigenden Rücken hinaufging, um nötigenfalls einen Weg durchhauen zu lassen. Ich folgte ihm langsam mit Obet Dĕwong. Der schwere und bejahrte Mann folgte nur mit Anstrengung, obgleich der Rücken nicht steil und sehr breit war; da Obet in jungen Jahren ein bekannter Jäger gewesen war, gab er sich jetzt alle Mühe, nicht zurückzubleiben.
Bereits bald nach Mittag erreichten wir, auf einer Höhe von 800 m, den Sattel, der unter dem eigentlichen Gipfel lag, und beschlossen, hier unser Lager aufzuschlagen, da wir weiter oben kein Trinkwasser finden würden.
Sorong hatte mit seinen Leuten bereits den Platz zwischen den grossen Bäumen vom Unterholz befreit. Nachdem die Hütte zusammengestellt worden war, blieb noch genügend Zeit übrig, um den eigentlichen Gipfel auszukundschaften. [361]
Dieselben Männer gingen wiederum voraus; wir holten sie aber bald ein, da sie weiter oben in die Rotang- und Moosregion gerieten. Auch die dornigen Stämme der Sagopalmen hielten uns fest, so dass es kaum möglich war, ohne Kleiderrisse und Hautwunden davonzukommen, und so manchmal musste der Pfad durch diese triefende, dunkle Pflanzenmasse gebahnt werden. Für Nashorne schien diese Gegend sehr geeignet zu sein, denn wir bemerkten zahlreiche Spuren von ihnen, auch jagten unsere Leute ein Exemplar auf. In einer flöhe von 1000 m ü.d.M. war alles so dick mit Moos bedeckt, dass wir weder rechts noch links sehen konnten, dazu fiel der Gipfel mit steiler Wand nach unten ab. Es musste noch ein zweiter, höherer Gipfel vorhanden sein, aber bevor wir ihn besteigen konnten, musste Obet Dĕwong den Geistern erklären, wer wir waren, und was wir hier wollten. Hierzu holte er ein mitgenommenes Ei hervor, klemmte es zwischen die 3 Zinken eines an der Spitze gespaltenen Stockes, den er in den Boden gesteckt hatte, und rief darauf die Geister, die auf dem Situn und auch die, die auf dem Batu Pala am oberen Tasan wohnten, an. Er berichtete ihnen, dass er, der Häuptling von Lulu Sirāng, gekommen war, um Kajan vom oberen Mahakam und weisse Fremde, Niederländer, von jenseits des Meeres, welche die Umgegeng besichtigen wollten und durchaus nichts Böses gegen die Geister im Schilde führten, zu geleiten.
Gänzlich beruhigt kletterten wir nun längs eines steilen Abhanges über glatte, moosbedeckte Steine ungefähr 50 m weit hinunter und begannen dann, den eigentlichen Gipfel, der gut 1100 m hoch war, zu besteigen. Auf dem schmalen Gipfel standen wir aber vollständig zwischen hohen Bäumen ohne jede Aussicht; daher musste entweder der Wald gänzlich gefällt werden, woran fast nicht zu denken war, oder auf einem der höchsten Bäume ein Beobachtungsposten gebaut werden. Wohl oder übel entschlossen wir uns zu letzterem und trugen unseren Bahau auf, von einem der schweren Bäume mit breiter Krone die Äste teilweise zu entfernen, so dass auf den übrigbleibenden ein festes Gerüst (lăsān) aus Holz gebaut werden konnte, auf dem unsere Instrumente aufgestellt werden sollten. Auch musste für uns eine Leiter hergestellt werden. Dieser ihnen gänzlich neue Auftrag schien meine Leute zu reizen, vielleicht hatten sie auch erwartet, dass sie den ganzen Wald fällen sollten. Sie machten sich daher eifrig ans Werk und stellten das Gerüst bereits abends fertig. Frierend, durchnässt und sehr ermüdet kehrten wir nach unserem Lager zurück, in dem Midan [362] uns mit einer Tasse warmer Chokolade empfing. Ein Wechsel der Kleidung stellte unser Wohlbehagen bald wieder her und gleich nach Sonnenuntergang begaben wir uns zur Ruhe.
Das Thermometer zeigte morgens zwar noch 18° C., aber das Aufstehen in der nasskalten Umgebung im dichten Nebel war doch nichts weniger als angenehm. Eiligst begaben wir uns auf den Gipfel, in der Hoffnung, über den Wolken eine ebenso freie Aussicht wie am ersten Morgen auf dem Batu Mili zu geniessen. Es zeigte sich aber, dass der Gipfel unseres Baumes nicht frei stand, sondern dass einige Bäume, die die Aussicht benahmen, gefällt werden mussten. Da unser Baum der höchste war, brauchten nur wenige Exemplare entfernt zu werden.
Zur Erwärmung begann ich auf- und niederzuklettern und Moose und Erdorchideen, die mit ihren prächtig gefärbten und gezeichneten Blättern in Felslöchern verborgen sassen, zu suchen. Gesteine konnte ich nicht sammeln, da alle Stücke an der Oberfläche durch und durch verwittert und nicht mehr zu unterscheiden waren. Nur da, wo ein grosser Block vom Abhang abgestürzt war und die Wand lotrecht aufstieg, konnten wir später mit dem Schmiedehammer einige gute Stücke abschlagen.
Als die Wolken unter und um unseren Gipfel nach 10 Uhr sich zu erheben anfingen, stellten wir unsere Instrumente auf. Obgleich das Wetter nicht sehr günstig war, traten im Laufe des Tages doch die ganze Umgebung und auch die Gebirge in der Ferne der Reihe nach hervor. Es zeigte sich, dass das Kalkgebirge im Norden und Westen zahlreiche Gipfel besitzt und von engen, tiefen Schluchten durchschnitten wird. Aus einer dieser Schluchten kam der Mĕrasè zum Vorschein, was die Berichte der Buschproduktensucher bestätigte. Nach Osten, dem Quellgebiet des Tĕpai und Nijān zu, geht das Gebirge in plateauförmige Ketten über, deren weisse, senkrechte Wände denen des Batu Brok und Matjan vollständig gleichen und daher ebenfalls aus Kalk bestehen können. Im Gebiet des oberen Tasan wies man uns einen derartigen, oben flachen Berg als den Batu Pala an, auf dem sich der Stamm der Batu Pala einst ein Jahr lang gegen die Anfälle der Long-Glat unter Lĕdju Aja verteidigt hatte.
Im übrigen ging aus den Aussagen der Ma-Suling nichts Sicheres hervor und selbst Obet Dĕwong der sehr wohl wusste, wie viel uns daran gelegen war, den Batu Tibang zu finden, zeigte uns einen der [363] Gipfel des Kalkgebirges als den gesuchten Berg. Ich war anfangs geneigt, ihm zu glauben, als aber später am Nachmittag in grosser Entfernung hinter diesem Gipfel das Scheidegebirge mit dem Kajanfluss hervortrat, das mit dem Batu Tibang in Zusammenhang stehen musste, sah ich, dass Obets Dĕwongs Behauptung falsch war und verwies ihm diese Art uns zufrieden zu stellen. Das 1800–2000 m hohe Kalkgebirge verbarg uns das dahinter liegende Gebirge und somit wahrscheinlich auch den Batu Tibang. Das ganze Gebiet des oberen Mahakam jedoch lag schöner als je vor uns. Der ganze südliche Teil bis zum Batu Lĕsong trat gut hervor, ebenso der Gipfel des Batu Mili über dem Rücken des Ong Dia, während nach Osten der Batu Ajo, Nijān u.s.w. scharf sichtbar wurden. Es gelang Bier, die erforderlichen Peilungen und Skizzen bis zum Abend zu beenden, so dass wir unsere Zelte am folgenden Morgen abbrechen konnten und so früh unten anlangten, dass der ganze Teil des Flusses vom Situn bis Lulu Sirāng noch gemessen werden konnte. Ich war mit den gesammelten Pflanzen und Gesteinen vorausgegangen und hatte auch noch die Geröllbänke des oberen Mĕrasè und Tasan untersucht, kam aber dennoch mit Obet Dĕwong, den die Exkursion sehr angegriffen hatte, noch zeitig nach Hause. Aus Furcht, dass ich am anderen Morgen früh aufbrechen würde, stellten sich eine Menge Leute mit Hühnern, Früchten, taring tanah und anderen Dingen ein, um hierfür Arzneien oder hübsches Zeug für Röcke oder Perlen einzutauschen. Ich war aber zu müde zum Handeln und versicherte ihnen nur, dass ich mich noch vor meiner Abreise mit ihnen allen befassen würde.
Um seine Aufnahme noch bis zur Mündung des Mĕrasè fortsetzen zu können, machte sich Bier am anderen Morgen als erster auf den Weg. Ich hatte noch viele Stunden damit zu tun, Flaschen mit Jodkalilösung zu füllen, Chininpulver und Pillen auszuteilen und meine schönen Stoffe sehen zu lassen.
Man gönnte mir kaum Zeit zum Essen, doch gelang es mir, noch vormittags abzureisen. Zu meiner Beruhigung fühlte sich Obet Dĕwong nach einer gut verbrachten Nacht wieder wohler. Ich hinterliess ihre gegen seine Fieberanfälle Chininpulver, dagegen versprach er, die beiden Böte, nachdem sie mit Brettern (rambing) versehen worden waren, nach dem Blu-u zu senden.
Die Dorfbewohner sahen uns ungern abfahren, aber ich hatte ihnen fast alle meine Arzneien ausgeteilt, in meinen Tauschartikeln war [364] hauptsächlich durch das Einkaufen von Ethnographica eine grosse Lücke entstanden, und so blieb ihnen wenig mehr zu wünschen übrig. Die Strömung brachte uns bald nach unten und in 3½ Stunden kamen wir in Napo Liu an.

Holzstapel als symbolische Heiratserklärung bei den Long-Glat.
Lĕdju Li hatte ich für die Verletzung des lāli auf dem Tasan eine Busse zu bezahlen; die Angelegenheit wurde jedoch unter Kwing Irangs Leitung schnell geregelt. Weit mehr Unterhandlungen kostete mir eine alte, schöne Perlenverzierung für ein Kindertragbrett (tap be̥ne̱ng) mit zwei Menschenfiguren und einem Tigerkopf. Fast der ganze Stamm entrüstete sich darüber, dass ein so altes Stück die Niederlassung verlassen sollte, aber die Tochter der Besitzerin liess sich durch meine schönen Elfenbeinarmbänder zum Verkauf der Perlenarbeit verleiten. Die bereits erwähnte, schöne Jacke mit dein Rand aus Knüpfarbeit wurde mir nun ebenfalls verkauft, so dass ich von unserem Besuch in Mĕrasè sehr befriedigt war.
Wir sehnten uns alle nach Hause zurück und nahmen daher am 13. Tage nach unserer Abreise vom Blu-u von Napo Liu Abschied und erreichten wiederum gegen Mittag Batu Sala, wo wir die Nacht als Gäste des Häuptlings, der inzwischen zurückgekehrt war, verbringen sollten. Den Rest des Tages verwendete ich noch dazu, schöne Schwerter, hölzerne Tätowiermodelle (klinge̱ te̥dak) und Perlenmützen einzukaufen, deren Besitzer inzwischen Zeit gehabt hatten, sich mein früheres Angebot zu überlegen. Wir erfuhren hier wiederum, welch einen grossen Wert das Einkaufen von Ethnographica für den Umgang mit den Eingeborenen besitzt. Der Häuptling und seine Frau waren uns nämlich sehr freundlich entgegengekommen, hatten uns aber zu verstehen gegeben, dass sie kein Geschenk von uns annehmen wollten, dagegen gern bereit wären, uns irgend welche Gegenstände zu verkaufen. Ich begriff, dass mir der Kauf teuer zu stehen kommen würde, erhielt aber von dem Häuptling für 25 fl. einen Korb (ingan dawan) mit Perlenverzierung zum Aufbewahren von Gegenständen, wie er sonst von den Kajan nicht verkauft werden durfte, und von seiner Frau für 15 fl. einen hübsch gestickten Rock. Der Bruder Bang verkaufte mir ein Schwert mit schöner Einlegearbeit. So waren auch hier wieder alle Parteien zufrieden gestellt.
Ein glücklicher Zufall liess uns unter dem Hause der Long-Glat eine Heiratserklärung eines jungen Mannes entdecken. Sie bestand in einem Holzstapel, der den Raum zwischen dem Brettersteg unter dem Hause [365] und der Wohnung der Auserkorenen vollständig füllte Das Holz war als Brennholz von ungefähr 70 cm Länge gehackt und zwischen zwei Stützbalken der Wohnung aufgestapelt worden. Zwischen das Brennholz waren 5 Stücke eines Baumstammes gelegt, an deren abgeplatteten, hervorragenden Enden die Versorgung der Frau durch den Mann sinnbildlich dargestellt worden war. Die Symbole bestanden in einem Beil (ase̱), als Versprechen, Holz hacken zu wollen, einer Hacke (be̱kong), als Versprechen, das Holz fein bearbeiten zu wollen, wie es beim Bau der Böte notwendig ist, und drei verschiedenen Tellern (uwit), einem grossen und zwei kleineren, als Versprechen, für Reis (honen) und Zuspeisen (udjo̱) sorgen zu wollen. Neben dem Holzstapel legt der Mann eventuell auch noch Geschenke nieder. Es glückte Demmeni, einige gute Aufnahmen von dem Stapel zu machen und einiges über die Hochzeitsgebräuche bei den Mahakamstämmen zu erfahren.
Die Gebräuche sind bei den verschiedenen Stämmen und auch, je nachdem es sich um Häuptlinge, Freie oder Sklaven handelt, verschieden. Im allgemeinen wird eine Heirat zwischen Häuptlingen auf die gleiche Weise wie zwischen Freien vollzogen; nur die Sklaven heiraten ohne Zeremonien, doch gilt der Ehebund bei ihnen für ebenso fest als bei den anderen. Die Häuptlinge der Long-Glat richten den Holzstapel nicht unter, sondern vor dem Hause der Geliebten auf und fügen zu den üblichen Symbolen einer Heiratserklärung auch noch schöne Geschenke für die Braut. Von dieser Sitte weichen die Mahakam Kajan insofern ab, als der junge Mann den Stapel in der Wohnung auf dem Gestell, das über dein Herde zur Aufbewahrung von Brennholz dient, errichtet.
Tritt bei den Freien ein junger Mann mit einem jungen Mädchen in den Ehebund, so wird er von seinen Freunden unter Beckenschlag in das Haus der Braut geleitet; die Hochzeitsgeschenke werden gleich mitgebracht. Wie am Mendalam zieht auch am Mahakam der junge Ehemann zuerst ins Haus seiner Schwiegereltern. Folgt dagegen ausnahmsweise die junge Frau dem Manne, so wird sie von ihren Freundinnen zu ihm geleitet. Nach der Ankunft setzen sich beide neben einander auf den Boden, der Mann links, die Frau rechts, und essen einige gekochte Reiskörner, die auf einem Bananenblatt rechts von ihnen liegen; der Mann macht dabei den Anfang. Diese Zeremonie wird mit “be̥ke̥sow” bezeichnet und leitet nur eine vorläufige Ehe ein, während welcher das Paar verschiedenen Verbotsbestimmungen unterworfen [366] ist, die erst beim folgenden Neujahrsfest aufgehoben (be̥t lāli oder be̥t pawe̱) werden. Einer der ältesten im Stamme, der nicht immer ein Priester zu sein braucht, tritt dann vor das Paar, ruft die Geister und die Seelen verstorbener Familienglieder an und berichtet ihnen, dass die Heirat vollzogen wird; ferner macht er die Jungvermählten auf ihre künftigen Pflichten aufmerksam. Dann schlachten Mann und Frau je einen Hahn, um aus der Beschaffenheit seiner Leber die Gesinnung der Geister zu erkennen. Der Teil, dessen Hahn die besten Vorzeichen aufweist, verspricht am meisten zur Wohlfahrt der Familie beizutragen.
Die Jungverheirateten dürfen drei Tage lang die amin nicht verlassen und nur Reis, der in einem Bambusgefäss gekocht worden ist, essen. Das Fleisch wilder oder zahmer Schweine und mit tuba gefangene Fische sind ihnen zu essen verboten. Nach Ablauf der drei Tage gehen beide in ihren schönsten Kleidern acht (heilige Zahl) Mal zum Flusse. Der bewaffnete Mann rodet mit seinem Schwerte etwas Gestrüpp aus, während die Frau mit einer besonderen Schaufel (uing) etwas jätet. Gehören sowohl Mann als Frau einer Häuptlingsfamilie an, so müssen sie den Weg zum Flusse 2 × 8 Mal zurücklegen und stets wieder die gleiche symbolische Feldarbeit verrichten. Dann gilt der Bund als endgültig geschlossen.
Die Frau bringt kein Heiratsgut mit; selbst ihre Schmucksachen gehen nach ihrem Tode, falls keine erbberechtigten Kinder vorhanden sind, an ihre Familie zurück; der Mann dagegen giebt den Eltern der Frau ein Geschenk (tendjai). Für Häuptlinge besteht das tendjai in Gongen, Schwertern, Wurfnetzen u.s.w., die von den Freien geliefert werden, falls der Häuptling standesgemäss heiratet. Die Geschenke der Freien dürfen nur in Schwertern oder Kattun bestehen. Festmahlzeiten sind bei einer Heirat nicht gebräuchlich.
Findet eine Scheidung auf friedlichem Wege statt, so giebt man einander eine uto̤̱k, d.i. eine vollständige Kleiderausstattung; die Geschiedenen dürfen dann sogleich wieder eine neue Ehe schliessen. Solange die uto̤̱k noch nicht gegeben ist, wird eine neue Heirat als Ehebruch betrachtet und als solcher mit einer schweren Busse (ke̥be̥how), welche dem beleidigten Teil entrichtet werden muss, bestraft. Trennen sich Eheleute ohne uto̤̱k, so dürfen sie sich nicht wieder verheiraten.
Bei Ehebruch muss der schuldige Teil dem anderen und eventuell [367] auch einem beleidigten Manne resp. einer beleidigten Frau eine Busse ausbezahlen. Das gleiche gilt auch für Sklaven.
Eheliche Treue wird auch dann geheischt, wenn der Mann langdauernde Reisen unternimmt.
Ein Ehebruch wird, nach Auffassung der Bahau, von den Geistern durch Missernten und andere Unglücksfälle an dem ganzen Stamme gerächt, daher sucht man dessen schlimme Folgen von den übrigen Stammesgliedern abzuwenden. Die Schuldigen werden mit Schweinen, Hühnern, 2 × 8 Eiern und all ihrem Hab und Gut auf eine Geröllbank im Flusse ausgesetzt, um den schlechten Einfluss, der von ihnen ausgeht, aufzuheben (= be̥t dawi). Die Priesterinnen bestreichen das Eigentum der Schuldigen mit dem Blut der Schweine und Hühner, um es unschädlich zu machen.
Die Ehebrecher selbst lässt man mit 2 × 8 Eiern auf einem Floss von der Strömung abwärts treiben. Sie retten sich, indem sie ins Nasser springen und ans Land schwimmen. Wahrscheinlich war dies früher nicht gestattet, wenigstens “erden sie jetzt noch von der Jugend mit langen Grashalmen, die Lanzen vorstellen sollen, beworfen.
Derartige Fälle kommen selten vor oder werden wenigstens selten behandelt; der letzte soll sich bei den Kajan vor 10 Jahren zugetragen haben.
Die Bahau gehen teils Vernunfts- teils Liebesheiraten ein. Im ersten Fall wird ein junger Mann mit einem kleinen, noch gänzlich unerwachsenen Mädchen verlobt und zieht bisweilen dann schon ins Haus der künftigen Schwiegereltern. Wenn dem Mädchen später der auserkorene Bräutigam nicht gefällt, was häufig geschieht, setzt sie bei ihrer Familie oft eine Heirat mit einem anderen, selbstgewählten Manne durch. Sie entwickeln hierbei so viel Energie und Ausdauer, dass sie, selbst wenn sie sich in einen Sklaven verliebt haben, den Sieg davontragen. Ich erlebte zwei derartige Fälle bei den Mahakam Kajan, bei denen die Kluft zwischen Freien und Sklaven überdies viel grösser ist als bei anderen Stämmen.
Am z. Dezember nahmen wir von Batu Sala Abschied und erreichten noch am gleichen Tage Lulu Njiwung, dessen Häuptling Ding Ngow so schüchtern war, dass er in unserer Gegenwart kaum zu sprechen wagte. Wir mussten hier des hohen Wasserstandes wegen zwei Tage bleiben. Ein Teil der Niederlassung war uns verschlossen, da man im langen Hause der Ma-Tuwān lāli nugal feierte; die Bewohner der anderen [368] Häuser begaben sich morgens sehr früh aufs Reisfeld und kehrten erst abends wieder zurück. Wir hatten somit wenig Gelegenheit, die Bevölkerung kennen zu lernen und Ethnographica einzukaufen.
Besonders unangenehm war mir der Umstand, dass mich viele Kranke um Arzneien baten und man mich zu bewegen suchte, noch so lange zu bleiben, bis man mir auch die Kranken von den Reisfeldern ins Haus gebracht habe. Denn meine Arzneien waren grösstenteils verbraucht und mit dein Rest musste ich sehr sparsam umgehen. Es blieb mir daher nichts übrig, als den Leuten zu versprechen, ihnen am Blu-u, der nicht weit entfernt war, Arzneien austeilen zu wollen. Viele von ihnen machten denn auch wirklich nach Ablauf der drückendsten Feldarbeit von meiner Aufforderung Gebrauch.
Den 16ten Tag nach unserer Abreise setzten wir unsere Fahrt bei fallendem Wasser fort und erreichten wohlbehalten unsere Niederlassung am Blu-u. Alles sah dort so aus, wie wir es verlassen hatten. Unsere Kisten mit kostbaren Tauschartikeln, die der Häuptling in seiner Wohnung unter dem Schutz seiner Frauen aufbewahrt hatte, brachten wir in unser Haus zurück und sassen dann abends wieder sehr befriedigt unter unserem festen, ruhigen Dache.
Unser stilles Leben dauerte nicht lange, denn Kwing Irang äusserte den Wunsch, uns nun auch baldmöglichst in den verschiedenen Pnihingniederlassungen einzuführen. Er hielt es nämlich für wünschenswert, dass der Kontrolleur auch diesen Stamm näher kennen lernte, auch wollte er nicht, dass sich die Pnihing durch unser Fortbleiben zurückgesetzt fühlten. Für später hatte Kwing allerhand grosse Pläne, die ihn ans Haus fesselten, daher wollte er den Besuch so schnell als möglich ins Werk setzen. Unsere Europäer und die Pflanzensucher sollten sich an der Reise beteiligen, Doris und die Seinen dagegen sollten zu Hause bleiben, da unser unstätes Leben für ein Sammeln auf zoologischem Gebiete nicht geeignet war, wie wir während unseres Zuges nach dem Mĕrasè erfahren hatten. Wir hatten nun ein Boot weniger nötig, was den Kajan durchaus nicht gefiel, da die jungen Leute, die nicht mit nach dem Mĕrasè gezogen waren, gehofft hatten, nun auf der Reise zu den Pnihing auf angenehme Weise viel Geld zu verdienen.
Als wir uns mit unserem Gepäck am 10. Dez. in 4 Böte verteilen wollten, stellte sich heraus, dass sich zu viele reiselustige Kajan eingefunden hatten. Der Häuptling hatte sie augenscheinlich zum Zurückbleiben nicht überreden können oder wollen, und so musste ich [369] bei unserer Abreise, als alles bereits gepackt war, noch selbst drei Männer zwingen, ihre Tragkörbe, Speere und Schilde aus den Böten zu holen, die für so viele Leute nicht genügend Platz boten. Kwing gab zu unserer Freude den Wunsch zu erkennen, dass der Kontrolleur die Fahrt in seinem Bote machen sollte und, da auch der Wasserstand sehr tief war, zogen wir alle wohlgemut flussaufwärts. Für den Häuptling bildete diese Fahrt eine wahre Vergnügungsreise, denn seit meinem vorigen Besuch hatte er die Tochter eines Häuptlings in Long ’Kup geheiratet, die er wegen seiner kleinen provisorischen Wohnung, in der sich bereits seine beiden anderen Frauen befanden, nicht bei sich aufnehmen konnte. Seine älteste Frau Hiāng gestattete ihm nur selten, zu den Pnihing zu fahren, und so bot ihm unsere Reise einen erwünschten Ausweg. Wir konnten nun nicht umhin, in Long ’Kup zu übernachten und zwar in der Galerie von Kwings Schwiegervater.
Die Häuptlingsfrauen zeigten sich für die schönen Perlen und Stoffe, die ich ihnen mitgebracht hatte, sehr empfänglich; die Männer dagegen hatten auch hier ihre eigenen Anschauungen über Geschenke und wollten keine hübschen Sachen, wohl aber Arzneien von mir annehmen.
Wir waren so früh angekommen, dass ich noch Zeit gehabt hätte, mit vielen Bekanntschaft zu machen und Verschiedenes einzukaufen. Leider blieb die Galerie leer, trotzdem ich früher bereits mehrmals hier gewesen war; man schien sich vor uns also doch noch zu fürchten. Kwing Irang konnte sich von seiner jungen Frau nicht trennen und unsere Kajan hatten sich zu ihren Bekannten begeben. Da keiner von uns Pnihingisch sprach, war eine Unterhaltung mit den Hausbewohnern unmöglich, und ich beschloss daher, mit dem alterprobten Mittel, der Austeilung von Geschenken, eine Verständigung zwischen uns anzubahnen.
Mit vieler Mühe suchte ich zwei kleine Mädchen, die uns aus der Ferne verlegen anstarrten, dazu zu bewegen, sich uns zu nähern und aus einer Dose einen bunten Fingerring hervorzuholen. Durch die blitzenden Kleinodien angelockt zogen sie einander halb ängstlich, halb lachend an den Röcken vorwärts. Zögernd streckte jede ihr Ärmchen aus, ergriff einen Ring und eilte nach Hause, um ihren Schatz zu zeigen. Bald darauf geriet die ganze Frauenwelt in Bewegung und stellte sich mit ihren Kindern in dichter Reihe um mich herum. Eine [370] Dose voll Fingerringe nach der anderen verschwand, wobei die Frauen den Kindern stets den Vorrang liessen. Um die Austeilung der kleinen Geschenke, die wegen unserer Unkenntnis der Sprache recht einförmig verlief, etwas zu beleben, versteckte ich die Perlen, Nadeln oder Ringe in meiner Hand oder hielt diese so fest, dass jede nur mit einer kleinen Anstrengung zu ihrem Geschenk gelangen konnte. Die Zuschauer amüsierten sich herrlich über die Bemühungen derjenigen, die an der Reihe war. Einige wurden verlegen, aber keine wurde böse. Bald wurde unsere Umgebung so vertraulich, dass einige die wenigen Worte Busang, die sie kannten, zu sprechen wagten. Mit hübschem, geblümtem Zeug, Perlenketten und dergl. suchte ich die Frauen zu bewegen, mir einiges von ihrem Hausrat und ihren Kleidungsstücken zu verkaufen und war mit meinen vorläufigen Unterhandlungen sehr zufrieden. Schnitzarbeiten und andere Kunstartikel konnte ich nicht erhalten, weil die Pnihing nichts derartiges herstellen, wohl aber einige Röcke mit hübschen -Rändern, einige Hüte und, was uns ebenfalls sehr willkommen war, eine grosse Menge Reis, Hühner und Früchte. Böte, deren ich immer noch nicht genug hatte, konnte ich hier nicht kaufen, doch sollten sie in der Pnihingniederlassung am Tjĕhan zu haben sein.

Der Liang Karing an der Mündung des Tjĕhan.
An der Mündung des Tjĕhan in den Mahakam liegt der Liang Karing, dessen schöne weisse Kalkfelsen die Landschaft beleben. In der Hoffnung, von diesem Berge aus eine gute Übersicht über diesen Teil des oberen Mahakam zu erhalten, beschlossen wir, in dem an der Mündung- gelegenen Pnihinghause zu übernachten. Morgens früh brachen wir von Long ’Kup auf und erreichten zuerst Bĕlarès Niederlassung, an der wir nicht Halt machten, da die Pnihing augenblicklich auf ihren Reisfeldern wohnten und der Häuptling sich mit einigen Männern auf der Jagd am oberen Mahakam befand. Schon seit Jahren zog Bĕlarè, sobald er die Zeit dazu fand, für viele Wochen in den Wald und lebte dort fast gänzlich von dem, was der Wald ihm lieferte.
Um 12 Uhr legten unsere Böte bei der Niederlassung am Tjĕhan an. Die Hausbewohner erklärten, keinen Weg auf den Liang Karing zu kennen und, da ich ihre Abneigung gegen Besteigungen dieser Berge kannte, schickte ich Maring Kwai, einen jungen Mann, der bereits im Jahre 1897 mit meinem Pflanzensucher Djahéri einen Gipfel des Liang Karing bestiegen hatte, und Suka, der für dergleichen Exkursionen [371] am geeignetsten war, aus, um einen Weg zu suchen, der auch für Bier und mich brauchbar war. Inzwischen erfreuten wir uns zum ersten Mal wieder an einer guten Mahlzeit und erhielten bald darauf die willkommene Nachricht, dass man den Gipfel des Berges von der einen Seite aus erreichen könne. Suka hatte Maring nur mit grosser Anstrengung auf dem früheren Pfade nach oben folgen können, aber sie hatten vom Gipfel aus für den Abstieg einen besseren Weg gefunden.
Um keine Zeit zu verlieren, brach ich mit Bier und den Pflanzensuchern sogleich auf. Wir setzten über den Fluss und standen bald darauf vor den senkrechten Kalkwänden des Liang Karing. Auf der rechten Seite bemerkte ich am Fuss des Berges grosse Höhlen, in denen die Pnihing ihre Toten beisetzen; ich hielt es jedoch nicht für ratsam, die Leute am Tjĕhan durch meine Neugierde zu beunruhigen und schlug, um den gefundenen Weg zu erreichen, die entgegengesetzte Richtung ein.
Die hier schwach geneigten Sandsteinschichten heben sich deutlich von dem anschliessenden Kalkgestein ab, in gleicher Weise wie dies bei den Kalkkegeln am Bulit der Fall ist. Da es mir nicht glückte, Fossilien zu finden, kann das Alter dieser Schichten vorläufig nicht bestimmt werden. Weiter aufwärts gelangten wir an die Stelle, von der aus die Besteigung beginnen konnte. Die Felswände waren hier zwar ebenso steil als an der anderen Seite, aber ein Kamin, der unten gänzlich mit abgestürzten, von Moos und Algen bedeckten Kalkblöcken angefüllt war, machte einen Aufstieg möglich. Mit Händen und Füssen kletterten wir an einer Seite, wo das Kalkgestein scharfe Vorsprünge und Vertiefungen zeigte, an der lotrechten Wand empor und erreichten die Stelle, an der sich die Wände in einem Bogen dem Gipfel zuneigten.
Die scharfen Spitzen und Kanten des Gesteins drangen durch unsere nassen Stiefelsohlen hindurch; wie die unbeschuhten Füsse der Eingeborenen Stand hielten, erschien uns unbegreiflich. Auch oberhalb der Wände war der Berg noch so steil, dass wir nur mit Hilfe des Gestrüppes, das hier wuchs, vorwärts kamen. In noch höherem Masse als der schlechte Weg hielt mich jedoch die interessante Vegetation auf; in den mit Moos und Algen dicht bewachsenen Spalten und Höhlen der Kalkfelsen hatten nämlich Begonien und Erdorchideen eine Farbenpracht ihrer Blätter entwickelt, wie ich sie noch nirgends beobachtet [372] hatte. Auf den langen, spitzen Blättern der Begonien wechselten Gold und Silber mit prächtigem Rot, Braun und Violett, während die marmorierten Blätter der Erdorchideen ein mit dem Alter wechselndes Farbenspiel zeigten. Die Pflanzensucher hielten eine reiche Ernte, was um so erwünschter war, als die auf der vorigen Reise gesammelten Pflanzen während des langen Aufenthaltes bei den Kajan umgekommen waren. In kurzer Zeit erreichten wir den Gipfel des Berges, der nur spärlich mit Gestrüpp und krautartigen Pflanzen bedeckt und durch den Regen stark zerklüftet und erodiert war. Bier machte sich sogleich an die Arbeit und bedauerte nur, dass zahlreiche, höhere Berge die Aussicht beeinträchtigten. Die auf das hohe Kalkgebirge Batu Matjan im Norden, den Batu Lĕsong im Süden und viele andere Punkte in der Umgebung ausgeführten Peilungen machten jedoch auch diese Exkursion wertvoll. Abends kehrten wir steif und nass ins Dorf zurück, wo Barth und Demmeni die Zeit in Gesellschaft vor. Kwing Irang, dessen ältestem Sohn und dem freundlichen Häuptling Bo Anjè und dessen Frau verbracht hatten. Unter dem angenehmen Eindruck dieser Unterhaltung bot man uns eine reiche Mahlzeit mit Huhn, Eiern und Früchten an. Um 7 Uhr abends lagen wir bereits in tiefem Schlaf. Unserer Gesellschaft schien es hier sehr gut zu gefallen, ich dagegen wollte lieber so früh als möglich weiter reisen. Die Fahrt hatte aber bei dem niedrigen Wasserstande und der Grösse des einen Bootes ihre Schwierigkeiten, daher langten wir erst um ½ 3 Uhr bei der mir von früher her bekannten Niederlassung der Pmhing am Pakatè, einem kleinen Nebenfluss des Tjĕhan, an. Demmeni hatte auf der Fahrt eine gute Aufnahme des Kiham Tukar Anang machen können, eines Wasserfalles, der durch im Flussbette liegende Kalkblöcke gebildet wird.
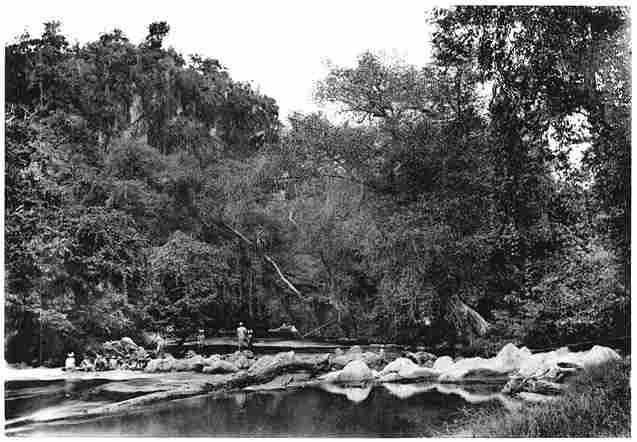
Aufwärtsziehen der Böte im Kiham Tukar Anang.
Wie die anderen grossen Niederlassungen der Pnihing steht auch die am Pakatè unter mehreren Häuptlingen, von denen jeder über seiner Wohnung ein erhöhtes Dach und vor ihr eine verbreiterte Galerie besitzt, so dass das Dach der Pnihing nicht wie dasjenige anderer Bahauhäuser eine nur einmal, sondern eine mehrfach unterbrochene Linie aufweist. Einer dieser Häuptlinge ist stets der angesehenste, hier war es Paren. Wir Europäer hielten in seiner Galerie Einzug, während die Malaien beim Häuptling Bang einquartiert wurden. Da sich beinahe alle Hausbewohner auf den Reisfeldern aufhielten, hatten wir Zeit, zuerst an unsere eigenen Angelegenheiten zu denken, unter [373] denen der Einkauf von grossen Böten und Ethnographica die wichtigsten bildeten. Das grosse Boot des Häuptlings Paren, das bei meinem früheren Besuch noch im Walde lag, erwies sich als lang, aber als viel zu schmal, um stark beladen werden zu können; daher kam ich mit Kwing Irang überein, anstatt dieses einen Bootes zwei kleinere zu suchen. Es glückte ihm auch, zwei passende Böte zu finden, die ich abends nach der Rückkehr des Besitzers von der Feldarbeit für Zeug und Geld erwarb.
Ich hatte die Leute bereits das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht, dass ich gern allerhand Gegenstände kaufen wollte, nun schienen sie sich über die Dinge, die sie missen konnten, inzwischen klar geworden zu sein; denn anderen Tages kamen sie mit hübschen Röcken, Schwanzfedern des Rhinozerosvogels und auch mit Reis und Früchten an, so dass ich meine Tauschartikel stark angreifen musste. Zum grossen Erstaunen ihrer Besitzer kaufte ich auch einige eigenartig geschnitzte Türschwellen. Die Nachfrage nach Chinin und Jodkali war auffallend gross; letzteres war besonders nötig, da die Pnihing an Kröpfen leiden. Es tat mir leid, dass die Tochter des Häuptlings Bang, die einen kindskopfgrossen Kropf besass, den Gebrauch der Jodkalilösung, die ich ihr das vorige Mal in drei Weinflaschen übergeben hatte, nicht fortgesetzt hatte. Da ein langdauernder Gebrauch von Jodkali den Umfang kleinerer oder grösserer Kröpfe stark vermindert, hätte es mich interessiert zu beobachten, ob auch bei dieser bedeutenden Hypertrophie eine Wirkung eingetreten wäre. Die Familie hatte ihrem Gedächtnis in bezug auf meine Vorschrift nicht vertraut und das Mittel daher nicht weiter gebraucht. Dass man an der Arznei nicht zweifelte, bewies der grosse Zulauf der Leute mit gut gereinigten Weinflaschen, welche ich mit der Lösung füllen sollte. Da es heftig regnete und die Wolken so niedrig hingen, dass an ein Ausgehen, um von irgend einem Punkte eine Übersicht zu erhalten, nicht zu denken war, konnte ich alle Wünsche meiner Patienten, die zum grössten heil weiblichen Geschlechtes waren, erfüllen.
Als der Himmel sich etwas aufhellte, begaben wir uns auf einen neben dem Hause gelegenen 100 m hohen Hügelrücken, auf dem die Pnihing den Wald für die Anlage eines Reisfeldes gefällt hatten. Der Hügel bot uns einen schönen Aussichtspunkt, der steile und gewundene Pfad, der über halb verfaulte Baumstämme und Äste und zwischen nassem Gestrüpp hindurch führte, war aber nichts weniger als bequem. [374] Auf dem Gipfel angelangt dauerte es noch einige Zeit, bis die Wolken sich genügend verteilten, um uns eine beschränkte Aussicht auf den Batu Lesong und das Gebirge am Ulu Sĕrata zu gewähren. In der Nähe war kein höherer Gipfel vorhanden, der uns eine umfangreichere Aussicht gewähren konnte, daher beschlossen wir, unseren Aufenthalt am Tjehan abzukürzen. Bier sollte am folgenden Tage den Tjĕhan so weit als möglich hinauffahren und den Fluss dann bis zu seiner Mündung messen. Wir wurden aber noch einen Tag lang durch allerhand Geschäfte aufgehalten, hauptsächlich auch durch die zahlreichen Pflanzen, welche unsere Pflanzensucher gesammelt hatten. Der von uns bestiegene Hügelrücken bot ebenfalls eine reiche Flora; besonders auffallend waren die zahlreichen Arten der Farren. Einige besassen höchst seltsame Blätter, z.B. grasförmige, oder vollständig viereckige, oder in Form von Eichenblättern; die meisten zeigten die dunkle, stahlblaue Farbe der echten Urwaldpflanzen. Die Exemplare wurden an Ort und Stelle in kleine Körbe gepflanzt, die ich zu diesem Zwecke mitgebracht hatte, sie füllten nicht weniger als 7 grosse Körbe; ausserdem hatte Amja, der sich hauptsächlich mit dem Herbarium beschäftigte, noch von diesen und anderen Arten eine grosse Menge getrocknet.

Niederlassung der Pnihing am Long Pakatè.
Den dritten Tag unseres Aufenthaltes widmete ich gänzlich den Hausbewohnern, indem ich bereits früh morgens mit einer allgemeinen Austeilung von Fingerringen begann, die ich ihnen früher versprochen hatte. Obgleich die Frauen bereits das vorige Mal zahlreiche Fingerringe von mir gekauft oder erhalten hatten und diese Zierrate an den Händen der stets arbeitenden Frauen sich als sehr undauerhaft erwiesen hatten, schien sich die Lust nach ihrem Besitze nicht vermindert zu haben; denn die Frauen eilten aus der ganzen Niederlassung herbei und belagerten uns in dichten Haufen. Da hier viele Frauen und Töchter von Häuptlingen anwesend waren, denen ich nicht allen besondere Geschenke geben konnte, erwies ich ihrer Würde die nötige Aufmerksamkeit, indem ich ihnen gestattete, nicht nur einen, sondern mehrere Fingerringe selbst zu wählen. Dieses Vorrecht, schien in der Tat viel Anerkennung zu finden.

Mit Figuren verzierter Stein im Tjĕhan.
Unter den Anwesenden vermisste ich ein auffallend hübsches Mädchen, das, wie ich erfuhr, die Tochter des Häuptlings Bang war. Vor Sorge um ihren Mann, den Malaien Si Hebar, der vor langer Zeit mit dem Versprechen bald zurückzukehren nach dein Busang gezogen war, um [375] dort Buschprodukte zu sammeln und nichts von sich hatte hören lassen, war die Frau nicht dazu zu bewegen gewesen, in unsrer heiteren Gesellschaft zu erscheinen.

Mit Figuren verzierter Stein im Tjĕhan.
Dieser Si Hebar war einst, als er es in den trostlosen Wäldern am Busang nicht mehr hatte aushalten können, zu den Mahakamstämmen gezogen, bei denen er allen Mädchen die Köpfe verdrehte. Erst lebte er eine Zeitlang mit Lirung, der Tochter des Häuptlings am Howong. Amun Lirung und seine energische Gattin waren aber über diese Freundschaft durchaus nicht entzückt und, da Lirung, wie wir uns in Long ’Kup, wo sie jetzt mit Tingang Kohi verheiratet ist, überzeugen konnten, kein anziehendes Äusseres besass, war er zu den Pnihing am Pakatè gezogen. Bangs Tochter, die mir schon auf der vorigen Reise ihrer Schönheit wegen aufgefallen war, hatte es dem malaiischen Don Juan angetan, er freite um sie, ohne auf die Gefahr, die ihm vom Howong her drohte, zu achten. Dass ihr Geliebter sie verlassen und wo anders Trost gefunden hatte, konnte Lirung aber nicht verwinden. Sie sehnte sich nach Rache und trug drei Männern der Bukat, die neben der Niederlassung ihres Vaters wohnten, auf, dem Si Hebar im Walde nachzustellen und ihr seinen Kopf zu bringen. Das Schlachtopfer schien indessen etwas Ähnliches von der früheren Geliebten erwartet zu haben, denn er begab sich mir mit grosser Vorsicht ausserhalb des Hauses und die Bukat mussten ohne sein treuloses Haupt nach dem Howong zurückkehren. Lirung geriet über das Missglücken ihres Racheplans in Wut und warf den Bukat vor, dass sie keine Männer seien, dass sie Frauenröcke zu tragen verdienten und dass sie eine solche Männerarbeit mit besserem Erfolge ausgeführt hätte. Tief beschämt kehrten die Bukat in den Wald zurück und schlugen, um Lirung ihre Männlichkeit zu beweisen, zwei Sĕputan vom Kaso die Köpfe ab. Si Hebar aber hatte seinen Aufenthalt am Pakatè auf die Dauer wohl nicht für sicher gehalten und daher sein Nomadenleben am Busang wieder aufgenommen.
Seine verlassene Frau konnte ihre Neugierde, als das Kichern und Jubeln der Menge bei der Austeilung immer lauter wurde, schliesslich doch nicht bezwingen und erschien plötzlich in unserem Kreise. Sie hatte die Kleidung der Pnihingfrauen gegen ein dunkles, malaiisches Gewand vertauscht, was ihre Erscheinung sehr beeinträchtigte; da sie in den letzten zwei Jahren auch noch ihre Jugendfrische eingebüsst hatte, war sie lange nicht mehr so anziehend wie früher. Für ein hübsches [376] Stück Zeug zeigte sie trotz ihres Kummers immer noch Interesse und, nachdem sie es einmal angenommen, bat sie mich sogleich auch um einen Ring mit einem besonders grossen Stein.
Zum Schluss entspann sich unter uns ein lebhafter Hühnerhandel. Die Hühner, die die Kajan zum Verkauf für uns zur Verfügung hatten, erreichten nämlich ihr Ende und, um nicht gleich auf allerhand Surrogate angewiesen zu sein, versuchte ich hier Hühner einzukaufen. Während die Kajan uns meistens Hennen zu essen gaben, weil sie von den jungen Hähnen eventuelle Kampfhähne erwarteten, verkauften uns die Pnihing lieber die Hähne, da sie die eierlegenden Hühner höher schätzten. Die Hähne waren kaum in unserem Besitz, als die Kajan sie mit viel Aufmerksamkeit betrachteten und betasteten, mit dem Resultat, dass ihrer drei aus Midans Händen gerettet wurden mit dem Versprechen, sie zu Hause durch andere zu ersetzen. Obwohl überzeugt, dass der Tusch nicht zu meinem Vorteil ausschlagen würde, gab ich ihrem Wunsche doch gerne nach.
Nach diesem letzten, ruhigen Tage wollte ich anderen Morgens früh aufbrechen, musste aber die Leute, um die Böte zu Wasser zu lassen und das Gepäck einzuladen, stark antreiben. Bevor wir nämlich nach dem Blu-u zurückkehrten, sollte unterwegs noch manches vorgenommen werden. Am meisten interessierte uns ein Besuch, den wir einem Begräbnisplatz der Pnihing am Fuss des Liang Nanja machen wollten. Kwing Irang hatte uns schon auf der vorigen Reise hierhergeführt, weil er unser Interesse für dergleichen kannte, und wohl auch, um uns von dem Begräbnisplatz der Kajan fernzuhalten. Nun schlug er uns selbst vor, unser Essen auf der Geröllbank unterhalb des Kiham Tukar Anang am Fusse der Kalkberge zu kochen.
Zum Glück waren keine Pnihing unter uns und, ohne den Kajan viel zu sagen, bahnten Demmeni und ich uns einen Weg durch den Waldesrand und fanden denn auch den Pfad, der uns über einige Felsblöcke zur weissen Wand führte, die, soviel wir durch den Wald sehen konnten, So m hoch gerade aufstieg und dann ein überhängendes Gewölbe bildete. Im Walde rührte sich kein Blatt und die senkrecht über uns stehende Sonne warf grelle Lichter und dunkle Schlagschatten auf die wild umherliegenden Felsblöcke, die augenscheinlich von dem hohen Gewölbe einst abgestürzt waren. Während wir noch darüber in Unsicherheit waren, welchen Weg wir in diesem Chaos einschlagen sollten, erschienen zwei unserer jungen Kajan und machten uns hinter [377] einem Felsvorsprung auf neun Särge. aus ausgehöhlten Baumstämmen aufmerksam, die zwischen dem Fuss der Wand und einem grossen Kalkblock in drei Reihen übereinander gestapelt standen. Die Särge mussten bereits alt sein, denn durch den eingesunkenen Boden des einen kam ein Schädel zum Vorschein.
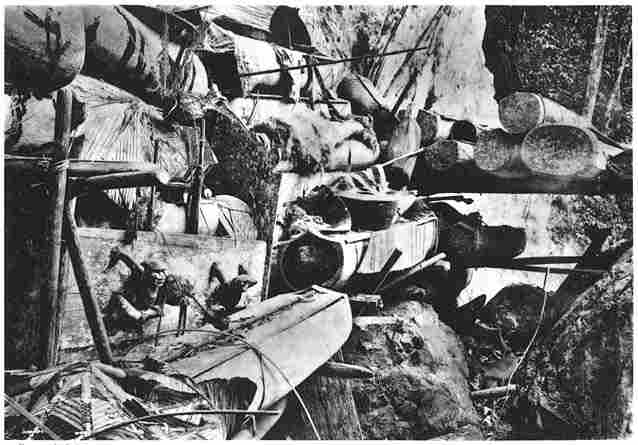
Särge der Pnihing.
Einer der Kajan erstieg, um besser sehen zu können, einen höher gelegenen Punkt und winkte uns, ihm zu folgen. Wir überblickten nun den ganzen Fuss der Felswand, an der sich in langer Reihe. Gruppen von Särgen befanden, die mit den danebenstehenden Waffen und Kleidungsstücken im grellen Sonnenlicht einen unheimlichen Eindruck auf uns machten; dazu fürchteten wir uns, von Pnihing überrascht zu werden. Still begaben wir uns nach der anderen Seite der Felswand, die uns einen geeigneten Standpunkt zur Aufstellung unseres photographischen Apparates versprach. Den beiden Kajan war es ebenfalls unheimlich zu Mute, sie folgten uns aber doch stillschweigend.
Von der anderen Seite konnten wir alles gut übersehen: die Särge, welche von der überhängenden Wand vor Regen beschützt wurden, standen über und rieben einander um grosse, viereckige Kisten herum, in denen sich durch einander alle Dinge befanden, welche den Toten für das Leben im Jenseits mitgegeben werden, wie Tragkörbe, Hüte, Schilde und Waffen; daneben dienten mit der Spitze nach oben in die Erde gesteckte Speere zum Aufhängen von Kriegsmänteln und Hüten.
Die Särge waren unverziert und bestanden nur aus ausgehöhlten Baumstämmen, die mit einem Brett oder Schild lose bedeckt waren. Dagegen trugen alle Kisten mit den Gegenständen farbige Malereien, hauptsächlich Masken böser Geister; eine Kiste zeigte an einer Seitenwand ein Relief von 3 dm grossen, bunt bemalten Menschenfiguren..
Demmeni und ich fühlten uns durch dieses stille, grellbeleuchtete Schauspiel unter der hohen, weissen Wand mit dem finsteren Urwald ringsherum wie von einem Traume befangen. Während wir alles für eine Aufnahme vorbereiteten, erschien zu unserem Schreck plötzlich ein Hund vor uns, der uns sogleich eine Gesellschaft Pnihing vermuten liess. Das Tier sah so abgezehrt aus, dass es augenscheinlich bereits lange Zeit umhergeschweift war; die Kajan erzählten uns, dass die Pnihing ihre Hunde, wenn sie bissig und daher Kindern gefährlich wurden, bisweilen verstiessen. Unsere Gemütsverfassung wurde dadurch aber nicht ruhiger, daher beeilten wir uns mit der Aufnahme. Unsere [378] Begleiter dagegen wurden so mutig, dass der eine sich bereit erklärte, einen Speer für unsere Sammlung fortzunehmen. Den Ruf eines Grabschänders wollte ich mir in dieser Gegend jedoch nicht erwerben und verbot daher den Raub.
Bei unserer Rückkehr zu den Böten fragte mich Kwing Irang, warum wir nicht einige Schädel mitgenommen hätten. Die Kajan selbst wären für eine derartige Schändung ihrer Toten im stande gewesen, uns zu töten. So bestehen zwischen diesen Stämmen stets Missgunst und der Wunsch, einander etwas Unangenehmes zuzufügen.
Inzwischen hatten die Kajan und Malaien ihr Essen gekocht und nach einer eiligen Mahlzeit bestiegen wir wieder unsere Böte und erreichten noch früh genug die Niederlassung an der Tjĕhanmündung, um noch Hühner und Früchte einzukaufen und zu sehen, ob der Häuptling sein Versprechen, uns Schwanzfedern des Rhinozerosvogels zu besorgen, gehalten hatte. Diese Federn sind nämlich bei den Kajan sehr kostbar und eigentlich auch nicht käuflich, aber die Pnihing, die so viele Jägerstämme unter und um sich haben, waren eher geneigt, sie uns abzutreten. Ich erhielt nun auch eine genügende Anzahl Federn, um die Holzmasken vom Saatfest, die ich ohne Kriegsmützen und Federn hatte kaufen müssen, mit ihnen zu schmücken.
In der Nähe der Mündung trafen wir Bier mit seinen Leuten und blieben noch so lange beisammen, bis wir zu gleicher Zeit abfahren konnten. Um nicht die Niederlassung von Bĕlarè zu übergehen, sollten wir auf Kwing Irangs Rat dort anlegen, obwohl Bĕlarè und Kaharon sich immer noch auf der Jagd am oberen Mahakam befanden.
Wir sahen zwar nur wenige Personen, aber für Kwing Irang und die Seinen war der Besuch doch von Wert, denn sie benützten die günstige Gelegenheit, um Bĕlarès Wohnung und Vorgalerie zu messen, damit sie das neue Haus Kwing Irangs, mit Rücksicht auf seine höhere Geburt, entsprechend grösser bauen konnten. Ich begriff anfangs nicht, was sie eigentlich wollten; sie nahmen eine Stange, verkürzten sie auf Armweite und massen dann sehr genau die Dimensionen der Dielen von Wohngemach und Galerie. Da in der letzten Zeit öfters davon die Rede gewesen war, dass man nach Ablauf der drückendsten Saatzeit mit dem Hausbau beginnen wollte, merkte ich, dass sie nun wirklich für ein würdiges Heim für Kwing Irang sorgen wollten. Ihre Beratungen dauerten mir aber zu lange und, da Kwing ohnehin in Long ’Kup übernachten wollte, wir dagegen nicht, über [379] liess ich sie ihren Angelegenheiten und fuhr weiter nach dem Blu-u, wo wir, mit Erfahrungen, Ethnographica, Pflanzen und Böten bereichert, sehr befriedigt anlangten.
Einige Tage darauf erhielten wir durch die Ankunft des Malaien Hadji Umar ganz unerwartet Nachrichten von der Aussenwelt. Umar stammte vom unteren Kapuas her, hielt sich aber seit zehn Jahren als Anführer einer Gesellschaft Buschproduktensucher am oberen Murung und oberen Mahakam auf und genoss sowohl bei seinen Landsleuten als bei den Bahau einen guten Ruf. Ich hatte gehofft, von der Unterstützung dieses Mannes, dessen gute Gesinnung der niederländischen Regierung gegenüber ich kannte und der im Jahre 1897 bei einer Begegnung in Udju Tĕpu einen günstigen Eindruck auf mich gemacht hatte, Gebrauch machen zu können. Wie wir bereits in Putus Sibau gehört hatten, befand sich aber Umar, bei unserer Ankunft am oberen Mahakam, noch an dessen Mittellauf, daher liessen wir den Assistent-Residenten von Samarinda bitten, uns Umar entgegenzusenden. Dieser hatte sich aber nur auf einen Brief des Assistent-Residenten hin nicht flussaufwärts begeben wollen, sondern war, um Näheres zu erfahren, erst nach der Mündung des Mahakam gereist und hatte auch in Tengaron, dem Sitz des Sultans von Kutei, Halt gemacht. Hierdurch erhielten wir so schnell, als überhaupt möglich war, Briefe und Pakete von der Küste. Eine grosse Freude bereitete uns auch ein Packen drei Monate alter europäischer Zeitungen, welche die “Societeit” von Samarinda uns zur Verfügung gestellt hatte. Nachdem wir unsere Neugierde befriedigt hatten, lieferten die Zeitungen noch ein ausgezeichnetes Material zum Einpacken von Vögeln, Säugetierhäuten und Ethnographica.
Von dem grössten Interesse war uns aber Hadji Umar selbst, weil er die Verhältnisse unter den Bahau am besten kannte und weil er uns über die Gesinnung der Long-Glat weiter unten am Flusse am zuverlässigsten Auskunft geben konnte.
Der Malaie zeigte sich anfangs aber nicht sehr gesprächig und zwar nicht nur uns, sondern auch Kwing Irang gegenüber, denn als dieser wie gewöhnlich abends mit den jungen Leuten die Hähne kämpfen liess und Umar ebenfalls in den Kreis trat, grüsste er den Häuptling nur von Weitem. Man hätte glauben können, dass die beiden einander nicht kannten oder dass sie sich täglich sprachen, so wenig Beachtung schenkten sie einander; dabei hatte Umar früher Jahre lang bei Kwing [380] gewohnt und war nun lange fort gewesen, zudem wollten sich beide gewiss gern über die politische Bedeutung unserer Expedition aussprechen. Augenscheinlich hatte Umar, als er dem Häuptling abends einen offiziellen Besuch machte, mit diesem überlegt, wie er sich uns gegenüber in Zukunft verhalten sollte, denn am folgenden Morgen hatte sein Gesicht einen weniger ernsten Ausdruck, auch gab er uns im Laufe des Gesprächs eine deutliche Vorstellung von der Stimmung der Niederlassungen unterhalb der Wasserfälle. Nachdem ihm der politische Zweck unserer Reise eingeleuchtet hatte, zeigte er sich geneigt, sich gegen einen Gehalt von 50 fl. monatlich unserer Expedition anzuschliessen. Umar war mit vier Malaien heraufgekommen, wir hofften daher, auch an diesen vier an das Waldleben gewöhnten Menschen gelegentlich eine gute Stütze zu finden. Umar zog vorläufig in das Haus eines Glaubensgenossen, der mit einer kleinen Gesellschaft Mohammedaner am jenseitigen Ufer wohnte. Durch seine Friedensliebe und Gutmütigkeit hatte Kwing Irang bereits seit dem Beginn seiner Häuptlingschaft eine ganze kleine Kolonie von Malaien herangelockt, die sich aber von den Kajan stets in einigem Abstand hielten. Als der Stamm sich noch weiter oben am Blu-u aufhielt, wohnten die Malaien bereits am Mahakam unter Aufsicht eines Bandjaresen vom oberen Murung, namens Utas, der mit einer Nichte von Kwing Irang, Lirung, verheiratet war. Utas lebte teils auf Kosten seiner Frau, teils verdiente er selbst etwas durch Handel und Handwerkerarbeit, wie z.B. durch Herstellen silberner Ohrringe aus Münzen, durch Reparieren von Kupfersachen u.s.w.; ausserdem übte er das Amt eines Arztes und nötigenfalls auch eines Bahaupriesters aus. Er verbrachte seine Zeit abwechselnd bei Lirung am Mahakam und auf sogenannten Handelsreisen am Murung, wo er in Wirklichkeit bei seiner zweiten Frau und seinen Kindern lebte.
Auch jetzt noch nehmen sich die meisten Malaien für längere oder kürzere Zeit Frauen aus dem Kajanstamme. Ausser diesen einigermassen stabilen Familien befindet sich in der Kolonie stets eine grosse Menge Gäste, Händler und Buschproduktensucher, die sich hier nur vorübergehend aufhalten. Zur Zeit des Hadji Urar war der Zufluss an Fremden viel grösser gewesen, aber, seitdem die Guttaperchabäume im Tal des Blu-u ausgerodet worden waren, hatte sich die grosse Menge der Buschproduktensucher am oberen Mahakam um Temenggung Itjot geschart. [381]
Die Niederlassung der Malaien hiess, ihrer Lage an der Mündung des Bulèng nach, Long Bulèng. Da Hadji Umar seine Familie vorläufig noch in Long Tĕpai gelassen hatte, kehrte er nach zwei Tagen dorthin zurück mit dem Versprechen, in fünf Tagen wieder zurück zu sein. Aus meinem Gespräch mit ihm merkte ich, dass die Häuptlinge am Unterlauf gern etwas Näheres über unsere Pläne hören wollten und dass es hauptsächlich für Bang Jok, der in den letzten Jahren zahlreiche Kopfjagden hatte ausführen lassen, eine grosse Beruhigung sein musste, dass wir uns mit dem, was geschehen war, nicht mehr befassen wollten.
Am selben Tage hatten wir noch Gelegenheit, den Kajan zu zeigen, wie wünschenswert unsere Gegenwart für sie war. Eine Gesellschaft Batang-Lupar aus Sĕrawak kam nämlich den Mahakam heruntergefahren mit der Absicht, die Fahrt noch weiter fortzusetzen. Eine derartige kleine Gesellschaft ist aber, wenn sie nicht einen bestimmten Zweck ihrer Reise angeben kann, stets verdächtig, insbesondere in diesem Fall, da aus Sĕrawak Gerüchte über eine drohende Kopfjagd als Strafe für einen an fünf Landsleuten am Boh verübten Mord im Umlauf waren. Der Mord war durch Punan im Auftrage von Bang Jok ausgeführt worden, der das Stehlen von Buschprodukten in seinem Gebiet mit scheelen Augen angesehen und zuletzt seine Zuflucht zu einer so scharfen Massregel genommen hatte.
Augenscheinlich hatten die Pnihing die Gesellschaft Batang-Lupar nicht aufzuhalten gewagt; da die Kajan sich auch nicht energischer zeigten, mussten wir die Sache in die Hand nehmen. Als gesellschaftlich gebildete Menschen kamen die Untertanen des Radja Brooke zu dem Kontrolleur, um ihn wegen ihrer weiteren Fahrt auf dem Flusse um seine Zustimmung zu bitten. Aber Barth verweigerte ihnen diese, weil er in einem friedlichen, in malaiischer Sprache geführten Gespräche nicht erfahren konnte, von wo die Leute herkamen und was sie am Mahakam eigentlich wollten. Zum Erstaunen der Kajan fuhren die Batang-Lupar ohne Widerspruch einfach den Fluss wieder aufwärts.
Unsere Kajanfreunde hatten sich durch dieses Begebnis wieder einmal von unserer Macht und unserem Einfluss überzeugen können, was um so erwünschter war, als unsere und der Kajan Pläne zu kollidieren drohten. Während sie sich von dem grössten Unternehmen, das in einem Stamme vorkommt, dem Bau der Häuptlingswohnung, vollständig beherrschen liessen, wollte ich noch den Batu Lĕsong besteigen [382] und dann so schnell als möglich flussabwärts fahren, um noch die Verhältnisse bei den Long-Glat kennen zu lernen.
Am 20. Dezember fand zur Beratung verschiedener Angelegenheiten eine Zusammenkunft statt, an der nicht nur die vornehmsten Männer unserer Niederlassung, sondern auch Bang Lawing, der Häuptling der Kajan am Ikang, Teil nahmen.
Aus Mangel an Besserem musste die Galerie, an die unser Haus gebaut war, und in der Midan seine Küche eingerichtet hatte und Doris die Vögel und Säugetiere abhäutete, als Versammlungssaal dienen. Viele, denen diese Beschäftigungen noch so gut wie unbekannt waren, zeigten für das, was meine Leute vornahmen, mehr Interesse als für das, was verhandelt wurde. In der Theorie durfte sich zwar jeder frei äussern und mitstimmen, aber in Wirklichkeit waren es doch hauptsächlich die alten, angesehenen Männer, welche die Beschlüsse fassten. Da beim Hausbau hauptsächlich den Priestern, als den Kennern der Vorzeichen, Gehör geschenkt werden musste, schwiegen die anderen von selbst. Übrigens ist es bei den Kajan am Mahakam allgemein Sitte, dass bei dergleichen Versammlungen die jungen Leute zu allem, was die Alten wollen, Ja und Amen sagen. Die Versammlung dauerte trotz der Hitze in dem kleinen Raum von morgens 9 Uhr bis zum Abend, wobei stets neue Leute, die sich für die Angelegenheit interessierten, zuhören kamen und jeder tat, was er wollte. In diesem Fall war die Freiheit des Einzelnen, wegen der Enge des Raumes, in dem jeder nur einen Sitzplatz einnehmen durfte, beschränkt, so dass er nicht, wie wo anders, sein Netz weben, einen Korb flechten, eine Schnur drehen konnte. Aus diesem Grunde waren die Teilnehmer wohl auch für einen schnellen Verlauf der Beratungen, denn obwohl es sich um ernste Dinge handelte, waren die Beschlüsse abends bereits gefasst; nach einigen Tagen sollte mit dem Hausbau begonnen werden, ferner wurde bestimmt, wieviel jede Familie nach der acht an Baumaterial zu liefern hatte; meine Pläne wurden zwar besprochen, doch fand man, dass sie keine Eile hatten; die Besteigung des Batu Lesong wurde allgemein als ein zweckloses, sehr gewagtes Unternehmen aufgefasst und für unsere Reise zur Küste hatten sie wegen des Hausbaus, der den ganzen Stamm in Beschlag nahm, weder Lust noch Verständnis.
Eine weitere Angelegenheit, die sich auf den ganzen Stamm bezog, wagte man, aus Furcht, den Betreffenden zu kränken oder zu reizen, [383] nicht öffentlich zu beraten. Es handelte sich nämlich um einen Gast des Stammes, einen Dajak aus Sĕrawak, namens Banjin, der den Dorfbewohnern immer mehr zur Last fiel.
Der Mann war von einer Gesellschaft Dajak aus Sĕrawak, die sich vor einigen Monaten eine Zeitlang am Mahakam auf hielt, zurückgeblieben und man hatte ihm, da er sich allerhand Airs zu geben verstand, selbst ein Kajanmädchen zu heiraten gestattet. Banjin, hatte sofort gemerkt, welch einen Eindruck er auf seine Umgebung machte und dass diese sich leicht einschüchtern liess. Wenigstens begann er, seine Frau schlecht zu behandeln, fremdes Eigentum zu gebrauchen, von den Leuten alles, was er nötig hatte, zu fordern, die Frauen zu belästigen, kurzum, er betrug sich so, wie es seiner wilden Laune im Augenblick passte. Damit ihm die Kajan nichts anzutun wagten, drohte er ihnen mit der Rache des Radja von Sĕrawak, so das Kwing Irang seinen Leuten riet, noch Geduld mit dem Subjekt zu üben. Da Bang Lawing vom Ikang augenblicklich anwesend war, wurde diese Staatsangelegenheit von den beiden Häuptlingen im Geheimen behandelt, denn als ich mich am folgenden Morgen in der Frühe als Arzt nach Kwing Irangs Wohnung begab, um mich nach dem Befinden einer seiner Frauen zu erkundigen, fand ich dort die beiden Häuptlinge, einige der vornehmsten Alten des Stammes und Banjin versammelt. Ich hatte Banjins Geschichte, da sie sich auf den Reisfeldern abspielte, erst vor wenigen Tagen erfahren und es interessierte mich zu sehen, was sie mit dem Individuum anfangen würden. Ich durfte der Beratung beiwohnen und setzte mich daher zu den übrigen. Der Schuldige hatte bereits bei meinem Eintritt seine hochfahrende, aggressive Haltung aufgegeben und war an die Wand gelehnt in sich zusammengesunken. Man wagte in meiner Gegenwart nicht, mit der Sache deutlich ans Licht zu kommen, und aus Banjins früherer Haltung schloss ich, dass man auch nicht energisch gegen ihn aufgetreten war. Kwing Irang wagte kaum zu erwähnen, welch eine Angst und Unruhe dieser junge Taugenichts bei seinem Schwiegervater anstiftete, und sprach noch von einem Vergleich, obgleich sich der ganze Stamm nach der Abfahrt dieses Gastes sehnte.
Trotz der offenbaren Verlegenheit des Schuldigen hatte Kwing nicht den Mut, ihm zu sagen, dass er sich entfernen müsse. Daher mischte ich mich in die Angelegenheit und erklärte dem Manne kurz und bündig, dass er, als eine Plage des ganzen Stammes, sich mit der [384] ersten Gelegenheit zu den Pnihing und von dort weiter nach Sĕrawak zu begeben habe. Der Mann wagte mit keinem Wort zu widersprechen und da machte Kwing Irang den Vorschlag, dass er, bis sich eine Reisegelegenheit für ihn finde, bei den Familien seiner Sklaven auf dem Reisfelde wohnen sollte. Der Verstossene verschwand sogleich und mit ihm auch der Druck, der auf den Angesehensten des Stammes gelastet hatte. Abends führten drei Männer Banjin in einem Boot nach dem Reisfeld, wo sich die Menschen seiner Drohungen wegen sehr vor ihm fürchteten. Die Männer baten mich daher dringend um Erlaubnis, den Mann binden und sich wehren zu dürfen, falls er auf Frauen und Kinder einen Anschlag machen sollte. Dagegen hatte ich natürlich nichts einzuwenden. Infolgedessen hielten zwei Männer die Nacht über bei Banjin Wacht, der sich übrigens eines friedlichen Schlummers erfreute.
Noch am gleichen Tage bot sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, um den lästigen Gesellen los zu werden. Es erschien nämlich die energische Hinan Lirung vom Howong und stellte nochmals an meinen und der Kajan Reisvorrat ihre Ansprüche. Sie war schon früher einmal mit einigen Männern bei mir erschienen und hatte das Salz gebracht, das ich nach dem Zug über die Wasserscheide im Walde hatte zurücklassen müssen, und war dann mit ihrem Lohn an Reis, Salz und Zeug reich beladen zurückgekehrt. Nun kam sie zum zweiten Mal unter dein Vorwand, dass sie oben keinen Reis mehr habe.
Die Sorge für ihre Stammesgenossen war mit Recht ihr anvertraut, denn, während ihr Mann Amun Lirung den Ruf eines Schwätzers besass, fürchtete man sich vor Hinan Lirung. Auch Kwing Irang kam ihr mit wenig Sympathie entgegen, dessenungeachtet gelang es ihr bereits abends, auf Schuld und für eine kleine Menge schwarzen Kattuns, den sie von mir erhalten hatte, eine grosse Menge Reis von ihm zu erpressen. Auch bot sich mir nochmals Gelegenheit, mich von der Unerschrockenheit und Gewandtheit meiner kleinen, untersetzen Freundin zu überzeugen. Sie erzählte mir nämlich, dass sie selbst am oberen Howong einige Batang-Lupar, die bei den Bukat Buschprodukte sammelten, aufgesucht und, wie wir es ihr das vorige Mal aufgetragen, über die Grenze zurückgeschickt hatte. Somit hatte sie sich als würdige Mutter ihrer Tochter Lirung gezeigt, die in ihrer Liebesgeschichte gegen Si Hebar mit so vieler Energie aufgetreten war. Hinan Lirung erwarb sich nun ein zweites Verdienst, indem sie auch den Banjin gern [385] expedieren wollte. Sie hatte für den Mann sogar schon eine weitere Reisegelegenheit gefunden, nämlich die Batang-Lupar, die wir weggeschickt hatten und die sich noch immer bei den Pnihing am Howong aufhielten. Hinan hatte nun zwar für ihre Heldenhaftigkeit eine Belohnung verdient, doch stellte sie immerhin durch ihre energischen Anfälle auf unseren Reis und unsere Tauschartikel an unsere Widerstandskraft allzu grosse Anforderungen. Selbst die Behauptung der jungen Kajan, dass die alte Frau aus persönlicher Sympathie zu mir so häufig angefahren kam, erleichterte mir nicht die Anstrengung, die sie mir verursachte. In unserer schwachen, indolenten Umgebung bot Lirungs ausgesprochene Persönlichkeit jedoch eine Abwechslung und, als wir abends nicht allzu grosse Mengen Reis, Zeug, Perlen und Salz in ihrem Boote verschwinden sahen, drückten wir ihr zum Abschied herzlich die Hand und legten ihr die Sorge für Banjin und die anderen Batang-Lupar nochmals ans Herz. Wahrscheinlich expedierte sie später die Gesellschaft persönlich weiter, wenigstens hörten wir nichts mehr von ihnen. [386]
Kapitel XVII
Bau des Häuptlingshauses—Besteigung des Batu Lĕsong—Ermordung einer Sklavin—Schutzleistung gegen Batang-Lupar Banden—Anwerbung netter Leute—Krankenbesuch am Mĕrasè—Reisevorbereitungen—Bang Joks politische Stellung—Kwing Irangs Einzug ins neue Haus—Allerhand Schwierigkeiten—wiederholtes Vorzeichensuchen—Tod eines kleinen Mädchen, Ankunft Akam Igaus—Neue Reisehindernisse.
Mit dem Bau von Kwing Irangs neuem Hause brach für die Kajan eine wichtige Periode an, da jede Familie verpflichtet ist, sich durch Beschaffung von Material und durch Arbeitsleitung an dem grossen Werk zu beteiligen. Auch wir interessierten uns lebhaft für das neue Haus, das in grossem Massstab ausgeführt werden sollte und uns daher von dem, was die Bahau auf diesem Gebiete zu leisten im stande sind, eine Vorstellung geben konnte. Ausserdem bot uns der Bau Gelegenheit, zahlreiche religiöse Gebräuche, von denen wir sonst nichts erfahren hätten, kennen zu lernen.
Von besonderer Wichtigkeit war aber für uns die Tatsache, dass unser Zug nach der Ostküste fast gänzlich von diesem grossen Unternehmen der Kajan abhing; denn ohne deren Hilfe konnten wir kaum die Reise ausführen, auch war es vom politischen Gesichtspunkte aus beinahe eine Notwendigkeit, dass Kwing Irang uns selbst zur Küste geleitete. Bevor aber der Hausbau nicht bis zu einem gewissen Punkt gediehen war, konnte sich der Häuptling mit einer grossen Anzahl von Männern unmöglich auf Reisen begeben; somit betrachtete ich den Gang der Arbeit einerseits mit Interesse, suchte aber anderseits allen meinen Einfluss geltend zu machen, um Kwing Irang zu unterstützen, wenn die Leute nicht den gewünschten Eifer zeigten und lieber ihren eigenen Geschäften nachgingen.
In einem späteren Kapitel sollen der Hausbau und die mit ihm verbundenen Festlichkeiten und religiösen Zeremonien ausführlich beschrieben werden; hier möge nur das, was auf unser tägliches Leben Bezug hatte, erwähnt werden. [387]
Demmeni traf alle Massregeln, um die wichtigsten Perioden beim Bau des Hauses durch photographische Aufnahmen zu fixieren, wobei er gleich Anfangs mit der Schwierigkeit rechnen musste, eine Szene bei Nacht aufzunehmen. Die Kajan achten nämlich auch beim Hausbau streng auf die Vorzeichen und trafen daher wie beim Reisbau, um einem eventuellen ungünstigen Bescheid zu entgehen, die Vorsichtsmassregel, die Arbeitsperiode nachts einzuleiten, da die wahrsagenden Vögel dann schlafen. Demmeni bereitete alles für eine Aufnahme bei Blitzlicht in freier Luft vor, aber die Natur half ihm mit einem heftigen Regenguss über diese Schwierigkeiten hinweg. Die Zeremonie musste auf den Tag verschoben werden und wir brauchten die Kajan nun nicht mit unseren künstlichen Blitzen zu erschrecken.
Bereits am vorhergehenden Tage waren Frauen und Kinder eifrig damit beschäftigt gewesen, Klebreis in Form dreieckiger Päckchen in Palmblätter zu wickeln und im Freien in grossen Kesseln zu kochen. Den Reis lieferten zum grösseren Teil der Häuptling, zum kleineren die Freien, dafür hatten diese aber beim Stampfen geholfen. Andere begaben sich auf den Fischfang, da der Häuptling allen Mitarbeitern Fische als Zuspeise anbieten musste.
Abends versammelten sich die vornehmsten Alten, um mit Hilfe von Rotang den Platz zu vermessen, auf dem das Haus stehen sollte. Sie hatten sich von den Dimensionen des Hauses einen Plan entworfen und begannen nun, indem sie mit ausgestreckten Armen ein Stück Rotang massen, die Länge und Breite des Hauses zu bestimmen. Ihr einem Faden entsprechendes Mass wird de̥pă genannt.
Schwieriger war es, mit dem Rotang ein richtiges Rechteck zu bilden. Hätte ein Sachverständiger die Führung übernommen, so wäre das Kunststück vielleicht geglückt, da nun aber acht oder zehn Männer mithelfen wollten und jeder seine Meinung geltend machte, misslang das Experiment und das Rechteck wurde immer wieder schief. Schliesslich rief man Demmeni als Autorität im Gebiete der Baukunst zu Hilfe und, da alle auf ihn hörten, erhielt man bald das gewünschte Rechteck, auf dem die Pfähle verteilt werden sollten. Hierauf ging man an die Verteilung der Seiten und gab durch in den Boden gesteckte Stöcke an, wo die Pfähle eingerammt werden mussten.
Das Haus sollte 23 m breit werden, d.h. gleich breit wie der Rücken, auf dem die Niederlassung gebaut werden sollte. Es sollte ferner an das provisorische Häuptlingshaus anschliessen und sich bis [388] zu dem langen Versammlungssaal, in dessen Verlängerung man unser Haus gebaut hatte, ausdehnen. Halbwegs hatten wir bereits beschlossen, dass Midan und Doris, deren Küche und Werkstätte sich an den beiden äussersten Enden des Saales befanden, ausziehen sollten, wir waren aber doch überrascht, als bereits am selben Tage nach der religiösen Zeremonie, welche das Einrammen des ersten Pfahles begleitete, einige junge Männer auf das Dach kletterten und über Midan, der gerade unser Essen kochte, das Dach abzubrechen begannen. Sie liessen sich aber überreden, erst in der Mitte zu beginnen, so dass Doris Zeit hatte, seine Werkstätte mit Hilfe einiger Kajan und unserer Malaien in die Wohnung der Malaien an der Mündung des Blu-u überzuführen; auch kamen wir überein, dass Doris’ Werkstätte als Küche für Midan reserviert werden sollte.
Dank den vielen hilfreichen Händen wurde der Saal binnen weniger Stunden seines Daches beraubt, die Dielenbalken abgenommen und die Pfähle mittelst eines Querbalkens, den man mit Rotang horizontal an ihnen befestigt hatte und an dem alle gleichzeitig zogen, aus dem Boden gehoben; darauf wurde in dem Teile, in dem sich in Zukunft die Küche befinden sollte, eine Seitenwand aus Baumrinde angebracht. Als wir gegen Mittag, erfüllt von dem interessanten Schauspiel, das die Aufrichtung des Hauptpfahles durch die Männer und Frauen des ganzen Stammes geboten hatte, in unsere Wohnung zurückkehrten, sah alles wieder so aus, als ob hier nie ein Saal gestanden hätte.
Während der Monate Dezember und Januar beteiligte sich täglich eine grössere oder geringere Anzahl Männer am Hausbau; die Frauen arbeiteten nach dem ersten Tage nicht mehr mit, aber jede Familie stellte so viele jungen Männer zur Arbeit, als sie bei der Feldarbeit entbehren konnte. Die panjin saju waren im Hilfeleisten am eifrigsten, von den übrigen Familien konnte der Häuptling mit seinen Mantri nur mit Mühe genügende Unterstützung erhalten. Sowohl aus diesem Grunde als auch damit nicht einzelne bevorzugt würden, wollte Kwing Irang nicht, dass einige Leute bei uns für Geld arbeiteten. Daher war es unmöglich, für längere Zeit eine grössere Anzahl Männer zu vereinigen, und voraussichtlich trat hierin sowohl während des Hausbaus als während der folgenden Reisernte keine Änderung ein. Ich war daher darauf bedacht, meine Zeit, ausser durch ethnographische Studien, auch noch auf andere Weise nützlich zu verwenden.
Ende Dezember war es Hadji Umar geglückt, mit seiner Familie [389] von Long Tĕpai nach Long Bulèng überzusiedeln, wo er sich beim Malaien Utas einquartierte. Ausser seiner Familie hatte Umar ungefähr acht seiner besten Buschproduktensucher bei sich, Malaien und Dajak, die sich teils als seine Schuldner, teils als seine Geschäftsteilnehmer seit Jahren mit ihm im Urwalde aufhielten. Sie wären gern in meinen festen Dienst getreten, aber ich hatte für sie keine ständige Arbeit, auch vertraute ich ihnen nicht ganz. Dagegen konnten sie mir bei der geplanten Besteigung des Batu Lĕsong sehr gut als Kuli und Ruderer dienen, ich hatte dann nur wenige Kajan nötig. Da auch die Kajan noch nie dieses Grenzgebirge mit dem Stromgebiet des Barito bestiegen hatten und wir unserem eigenen, auf dem Batu Mili entworfenen Plane folgen wollten, konnten uns diese kräftigen Fremden ebenso gut Hilfe leisten.
Die Kajan schienen gehofft zu haben, dass ich ohne ihren Beistand auf den Zug nach dem Batu Lĕsong verzichten würde. Sie fürchteten nämlich, dass mir in diesen ihnen unbekannten und daher unheimlichen Gebieten, in denen die Baritostämme Buschprodukte suchten, etwas zustossen könnte.
Kaum hatten die Kajan daher gehört, dass die Malaien mich begleiten sollten, als verschiedene einflussreiche Männer zu mir kamen, mich auf die grossen Gefahren aufmerksam machten, und mich von meinem Plane abzubringen suchten. Zuverlässige Auskunft über diese Gegend konnte ich nicht erhalten, sie suchten mich im Gegenteil durch allerhand falsche Berichte einzuschüchtern und wankend zu machen.
Um so wenig Männer als möglich mitzunehmen, beschloss ich, den Zug nur mit Bier zu unternehmen und Demmeni und Doris zurückzulassen. Sĕkarang und Amja dagegen sollten mich begleiten; die Aussicht, eine wertvolle Sammlung Gebirgspflanzen anlegen zu können, war zu lockend, um sie zu Hause zu lassen.
Als Kwing Irang merkte, dass ich ernstliche Vorbereitungen traf, machte er aus der Not eine Tugend, indem er das Seine dazu beitrug, um mich wohlbehalten heimkehren zu lassen. Er trug Sorong auf, mich zu begleiten, und trat mir ausserdem fünf der gewandtesten jungen Männer ab.
Glücklicher Weise kannte Sorong wenigstens den Weg bis zu dem Bergrücken, der zwischen dem Blu-u und Danum Parei auf den Batu Lesong führt. Am 16. Januar brachen wir 24 Mann stark in dreien meiner kleinen Böte auf. [390]
Die letzten Tage vor unserer Abreise waren recht trocken gewesen, so dass der Blu-u gerade genügend viel Wasser enthielt, um am ersten Tage bis an den Ort zu gelangen, wo an seinem Seitenfluss, dem Bruni, die verlassenen Reisfelder aufhören und der jungfräuliche Wald mit seinen Riesenstämmen über dem kleinen Flusse ein schattenreiches Dach bildet. Nachts fiel das Wasser noch mehr, so dass die Böte über die Stromschnellen bei den Geröllbänken mehr gezogen als gerudert werden mussten. Wir Europäer zogen es vor, zu Fuss längs des Ufers zu folgen, hatten aber den Fluss hie und da zu durchqueren. Gegen Mittag mussten immer wieder Steine auf die Seite geworfen werden, um den Böten einen Durchgang zu verschaffen. Erst am folgenden Tage erreichten wir auf die gleiche Weise Long Dungo, den Punkt, wo der Landweg zum Danum Parei beginnt. Hier mussten wir einen Teil des Reises, den wir mit Rücksicht auf die unbestimmte Dauer der Reise in grossen Mengen mitgeführt hatten, zurücklassen. Sollte die Besteigung lange Zeit erfordern, so konnte dieser Vorrat stets abgeholt werden.
Meine Kuli schienen den Rest des Tages gern hier verbringen zu wollen, aber ich kannte die Schwierigkeiten nicht, denen wir weiter oben begegnen würden, und liess, um keine Zeit zu verlieren, die Leute ihre Tragsäcke in Ordnung bringen.
Von der Landzunge an, welche von dem Bruni und einem seiner Nebenflüsse gebildet wird, bestiegen wir zuerst einen sehr steilen und dann immer flacher werdenden Rücken, der direkt auf die Wasserscheide zwischen Blu-u und Danum Parei hinaufführte. Gegen 3 Uhr gelangten wir auf einem alten Pfade der Buschproduktensucher so weit aufwärts, dass wir aus Furcht, auf dieser Höhe kein Wassermehr zu finden, Halt machen mussten.
Auf den Charakter des grossen Bergrückens begierig setzten wir am folgenden Morgen unseren Marsch fort und erreichten ohne andere Schwierigkeiten, als die Überwindung einiger steiler Partieen, gegen
Uhr eine flache Verbreiterung des Rückens, die nach Sorong den höchsten Punkt auf dem Wege zum Danum Parei vorstellte.
Der hohe Wald, der uns auch hier wieder umgab, benahm jede Aussicht; so blieb uns nichts anderes übrig, als die südliche Richtung einzuschlagen, um auf diese Weise auf den Rücken zu gelangen, der uns auf den Batu Lĕsong führen sollte. Wir befanden uns anfangs plötzlich zwei Mal vor steilen Abhängen, die nach unten in das Tal [391] des Bruni führten, aber einige als Kundschafter ausgesandte Leute brachten uns bald wieder auf die richtige Spur. Der gefundene Rücken war oben 4 bis 10 m breit und wir folgten ihm auf einem für Urwaldverhältnisse sehr befriedigenden Pfade. Da er nie oder nur äusserst selten von Menschen betreten wurde, konnte er nur von Hirschen, Schweinen und Rhinozerossen, die von dem einen Gebiet ins andre zogen, herrühren. Der Pfad führte uns bis dicht an den Batu Lĕsong und nur ab und zu war ein Schwerthieb erforderlich, um Rotang oder Reisig aufzuräumen.
Vom Batu Mili und Batu Situn aus gesehen zeigte der Querrücken, auf dem wir uns befanden, drei aufeinander folgende Erhebungen, deren Höhe nach unten zu allmählich abnahm. Der höchste, der uns als Beobachtungspunkt dienen sollte, lag auf dem Batu Lesong selbst.
Nachmittags erstiegen wir die, von uns aus gesehen, erste, 75 m hohe Erhebung und trafen hier bereits auf einer Höhe von 950 m ü.d.M. die Moosvegetation. Die niedrigen Bäume, die hier den wichtigsten Teil des Pflanzenwuchses ausmachten, waren infolge ihrer Moosbekleidung zu ihrer vier- bis fünffachen Dicke angeschwollen und zwischen ihnen hingen an den Schlingpflanzen wahre Wände von Moos, so dass man in den Zwischenräumen die Töne gedämpft wie in einem geschlossenen Raume hörte.
Hier ruhte ich mit dreien meiner Leute aus und beschloss, auf die übrigen zu warten, die, mit einer Last von etwa 25 kg beladen, nicht so schnell folgen konnten. Es dauerte einige Stunden, bis der letzte Mann bei uns eintraf, und wir mussten nun an unser Nachtlager denken, das wir in dem Sattel zwischen den beiden ersten Erhebungen aufschlugen. Einen kalten Wind abgerechnet störte uns nichts in unserem tiefen Schlaf, denn selbst die zahlreichen Heimchen und Zikaden, die den Wald weiter unten Tag und Nacht mit ihrem Gezirp erfüllten, waren hier entweder nicht vorhanden oder schwiegen. Wahrscheinlich war ersteres der Fall, denn die sonst stets anwesenden Arten der Morgenund Abendzikaden, die sich nur bei Sonnenaufgang und Untergang hören lassen, waren hier durch andere Arten vertreten. Im Laufe des Nachmittags zog Sorong mit einigen Männern noch aus, einen weiteren Weg zu suchen, und kam mit dem Bericht zurück, dass es am geratensten sei, westlich um den Fuss der zweiten Erhebung statt über deren Gipfel zu gehen. Die sehr steilen, hier und da kahlen Wände sahen in der Tat wenig anziehend aus, daher gingen wir am [392] folgenden Morgen auf gleicher Höhe durch einen sumpfigen Wald weiter. Unseren Kajan lief das Wasser im Munde zusammen beim Anblick der zahlreichen Spuren von Wildschweinen und Nashornen. Nach Sorongs Angabe hatten wir einen kleinen Nebenfluss des Blu-u zu durchschreiten und dann einen Gipfel zu besteigen, den er zwischen den Bäumen glaubte durchschimmern gesehen zu haben.
Von unten heraufziehende Wolken umhüllten uns und der freundliche Sonnenschein, der den dunklen, ewig triefenden Wald etwas belebte, verschwand. Wir zogen über eine Menge abgestürzte, scharf kantige Sandsteinblöcke, die nass und mit Moos bewachsen waren und dem Fuss nirgends einen festen Stützpunkt boten. Bald wurde Arm oder Fuss von den Schlingen und Haken der Lianen festgehalten, bald schlugen uns dornige Rotangranken ins Gesicht, so dass wir unter diesen Umständen an zwei Augen lange nicht genug hatten. Unsere Träger bewegten sich von dem einen Felsblock zum anderen, indem sie sich überall mit Händen und Füssen festklammerten; ihr Schweigen bewies den Eindruck, den diese Umgebung auf sie machte. Später überfiel uns ein kalter Regenguss, der die Nässe unserer Kleider zwar nicht mehr steigern konnte, uns seiner Kälte wegen aber sehr unangenehm berührte. Als wir nach einer Kletterei von einigen Stunden an der Richtigkeit von Sorongs Angaben zu zweifeln begannen, suchten wir uns unter einigen überhängenden Felsblöcken einen trockenen Platz und sandten zwei Malaien vom Mĕlawi auf Kundschaft aus.
Die Rast war uns zwar sehr angenehm, aber das Warten erschien uns schliesslich doch etwas lange, auch brachten uns die Malaien nicht einmal sehr ermutigenden Bericht. Zwar hatten sie den Gipfel gefunden, aber sie zweifelten daran, dass er der richtige war, ausserdem wurde der Weg züi ihm nicht besser. Also ging es zwischen Felsblöcken, Sträuchern und Lianen vorwärts, bis wir an ein trockenes Flussbett gelangten, das nur bei heftigem Regen Wasser zu führen schien. Jetzt bildete es nur einen nackten Einschnitt in der Bergwand, mit verwitterten Wänden und gefüllt mit losem Gestein verschiedenster Grösse. Das Gehen war beschwerlich, aber die ungewohnte Freiheit der Bewegung wirkte ermunternd, daher betraten wir mutig, einer hinter dem anderen, den Pfad, der mit 30° Steigung aufwärts führte.
Das Flussbett wurde bald so steil, dass die Vordersten nicht mehr gehen, sondern an den Wänden hinaufklettern mussten. Die Hinteren [393] suchten ihr Heil sehr bald im Walde, denn die von ihren Vorgängern losgelösten Steine wurden ihnen zu gefährlich. Wir beschuhten Europäer brachten auffallender Weise viel mehr Steine ins Rollen als die barfüssigen Eingeborenen, die noch dazu eine Last zu tragen hatten. Die Biegsamkeit und das Gefühl in ihren Fusssohlen bieten ihnen beim Gehen einen grossen Vorteil, daher verwickeln sie ihre Füsse auch so selten in den Schlingen der Lianen, aus denen man sich oft schwerer als aus Schnüren derselben Dicke befreien kann.
Bald befanden wir uns vor einem Kamin, dessen Wände zu verwittert waren, um an ihnen hinaufklettern zu können. Unsere braunen Gefährten kamen uns wieder zu Hilfe, steckten einige dicke Stöcke zu beiden Seiten in den Boden und geleiteten uns so zu dem zuverlässigeren Waldboden. 100 m höher gelangten wir auf einen schmalen Sattel, der auf der anderen Seite ebenso steil abfiel und somit wieder eine Untersuchung verlangte.
Links von uns erhob sich eine hohe, steile, dicht bewachsene Felswand und rechts ein nur 40 m hoher Hügel, der uns voraussichtlich über die nächste Umgebung einen Überblick geben konnte. Indem wir uns durch moosbedecktes Gestrüpp hindurchwanden und mit Hilfe von Leitern schwierigere Stellen passierten, erreichten wir die Spitze, die mit dichtem Grün von Rhododendren und seltsamen Nepenthes bedeckt war. Eine Aussicht war aber nicht vorhanden, denn unmittelbar über uns umhüllte eine dicke Wolkenlage alle höheren Gipfel.
Vor Nässe triefend und vor Kälte zitternd beschlossen wir, bis zum folgenden Tage zu warten, und kehrten auf den Sattel zurück, wo uns die Kajan mit einigen geraden, dünnen Hölzern bald das Gerüst für eine Hütte zusammenstellten, die wir mit einigen Segeltüchern vervollständigten.
Ein Kleiderwechsel brachte uns bald ein behagliches Gefühl; leider musste das Wasser auf dieser Höhe weither geholt werden und wir daher lange auf einen warmen Trunk warten. Die Malaien erstiegen noch den Gipfel links von unserem Sattel und bemerkten, dass er der zweite Gipfel war, um dessen Fuss wir tagsüber gezogen waren, und dass der dritte Gipfel noch hinter diesem lag. Es zeigte sich zugleich, dass diese beiden Gipfel durch eine so tiefe und steile Schlucht getrennt waren, dass an ein Hinüberkommen nicht zu denken war. Obgleich der gefundene seitliche kleine Gipfel nicht der gewünschte war, hatten wir doch durch unseren Zug nach rechts, der Bergwand [394] entlang, nichts verloren, es kam jetzt nur darauf an, längs der Bergwand eine Möglichkeit zu finden, um den letzten Gipfel zu besteigen. Diese Aufgabe überliessen wir am folgenden Tage den Malaien und suchten uns inzwischen mit Lesen und Aufzeichnen so angenehm als möglich zu unterhalten. Die Verhältnisse waren nicht gerade gemütlich; das Thermometer, das nachts auf + 14° C. gefallen war, stieg auch am Tage nicht über + 17° C.; von unserer Hütte aus traten wir sogleich auf durchnässtes, plattgetretenes Moos und, obwohl unser Lager sich auf einem nur wenige Meter breiten Sattel mit sehr steilen Wänden befand, benahm uns das umgebende Gestrüpp doch jede Aussicht. Erst gegen 3 Uhr kam der erste Kundschafter, zum Glück mit gutem Bericht, zurück. Der dritte Gipfel konnte bestiegen werden, sie hatten sogar zum grössten Teil bereits einen Weg gehauen, ausserdem hatten sie Trinkwasser gefunden.
Am anderen Tage glückte es uns, in 1½ Stunden den Aussichtspunkt, einen sehr schmalen, langen, mit Bäumen dicht bestandenen Gipfel, zu erreichen. Die Bäume waren durch Gestrüpp und dicke Moosbedeckung zu einem Ganzen verbunden und wir konnten uns nur kriechend und kletternd hindurcharbeiten. In einer durch Mooswände gebildeten Kammer liessen wir unsere Zelte aufschlagen, sahen aber zum Leidwesen des Topographen keine Möglichkeit, einen Standplatz auf festem Untergrund für ihn zu schaffen. Hierfür hätten auf dem ganzen Gipfel und teilweise an den Abhängen Bäume gefällt werden müssen, eine Arbeit, die wegen der Härte des Gebirgsholzes nicht ausgeführt werden konnte. Wir suchten daher, wie auf dein Batu Situn, einige beieinander stehende Bäume aus, liessen ihre Kronen bekappen und zwischen ihren Ästen eine Plattform anbringen, über welche ein Dach aus Segeltuch gespannt wurde. Ein besserer Beobachtungsposten war unter den gegebenen Umständen kaum zu erlangen. Trotzdem mussten, um eine freie Aussicht zu erlangen, noch viele hohen Bäume gefällt werden; für die Pflanzensucher bot sich hier eine günstige Sammelgelegenheit, da in dieser Regenzeit alle Bäume Blüten oder Früchte trugen.
Durch seine Höhe von 1690 m ü.d.M. gewährte uns der Gipfel einen Überblick über einen grossen Teil von Mittel-Borneo; die höchsten Bergspitzen wurden zwischen dem oberen Mĕlawi und oberen Kajan sichtbar.
An diesem Tage sahen wir jedoch wenig hiervon, denn nach dem [395] Sonnenschein des Morgens umhüllten uns gegen 11 Uhr die Wolken von unten her. Darauf regnete es ein wenig und abends verursachte die untergehende Sonne einen so eigenartigen bläulichen Dunst über der ganzen Landschaft, dass sie nur in grossen Zügen erkennbar war. Wir setzten unsere Hoffnung auf den folgenden Morgen, aber in der Nacht trat Regen ein, der bis 8 Uhr morgens anhielt. Obgleich der 200 m lange Weg zu unserem Observatorium nicht verlockend erschien und das Thermometer nur + 12° C. zeigte, konnte ich meine Ungeduld doch nicht länger bezwingen und stand bald nach unserem Frühstück fröstelnd auf der Plattform. Hier heulte der mit feinem Regen beladene Wind in den Baumgipfeln und trieb von Süden her halb durchsichtige Wolkenmassen aus dem Murungtal über den Batu Lĕsong, während nach Osten hin ein bleifarbiger Wolkenschleier jeden Ausblick benahm. Unsere Malaien waren nur mit Mühe zum weiteren Fällen der Bäume zu bewegen und einige Exemplare blieben bis zur Ankunft der Kajan stehen, die im Sattel übernachtet hatten und ausser ihren starken Armen auch gute Beile mitbrachten. Noch am gleichen Tage wurde der Gipfel so weit als nötig frei, aber weder der Abend noch der folgende Morgen gewährten irgend welche Aussicht. Unter diesen Umständen wussten wir nichts Besseres vorzunehmen, als in unsere Klambu zu flüchten.
Inzwischen hatten unsere Pflanzensucher mit grossem Erfolg gearbeitet und wollten allmählich den Rückzug antreten, um auch die Pflanzenwelt weiter unten zu untersuchen. Als Schutz und Hilfe gab ich ihnen einige Malaien mit, bemerkte aber später, dass bis auf zwei alle mitgegangen waren. Zum Glück blieben uns die Kajan übrig, die am vierten Tag alle nach oben kamen, um die letzte Nacht vor unserer Abreise oben zu verbringen. An diesem Morgen schien nämlich zum ersten Mal die Sonne und sie wussten, dass der Tag uns eine genügende Aussicht bieten würde. Sie erwarteten mit Ungeduld unseren Aufbruch, begreiflicher Weise, denn der eine hatte ein Lendentuch, der andere ein Kopftuch oder eine Jacke verbrannt, weil er nachts der Kälte wegen zu nah beim Feuer geschlafen hatte.
Der hohe Punkt des Batu Lĕsong, auf dem wir uns eben befanden, bot uns zuerst einen interessanten Blick auf die Gipfelfläche dieses Gebirges. Diese neigt sich mit nur 8° nach Süden, wird höchstens einen Kilometer breit und erstreckt sich ununterbrochen über die ganze Kette. Nur da, wo die zwischen den Nebenflüssen des Mahakam laufenden [396] Seitenketten von der Hauptkette abzweigen, erhebt sich ein Gipfel, wie derjenige, auf dem wir uns eben befanden. Die Kajan nannten den Gipfel, der sich zwischen dem Blu-u und Ikang erhebt, Batu Tokong und behaupteten, dass auf seiner Südseite der Busang entspringe und an dem südlichen Abhang unseres Gipfels der Lito, ein Nebenfluss des Bĕlatung. Die Gipfelfläche sowie die ganze Landschaft sind vollständig mit ununterbrochenem Urwald bedeckt, aus dem nur die senkrechten hellen Wände des Batu Lĕsong an der Nord- und Südseite scharf hervortreten.
Die langen Nebenketten, die sich nach Norden zum Mahakam hinziehen, fehlen nach Süden, im Tal des Murung; hier sieht man nur breite, wenige Kilometer lange Ausläufer, die zum Flusstal hin senkrecht abfallen.
In kurzem Abstand vom Batu Lĕsong und parallel mit diesem erhebt sich im Süden ein anderer Rücken, der den Busang zwingt, längs des südlichen Fusses des Batu Lĕsong nach Westen zu fliessen; den Namen dieses Rückens und etwas Näheres über ihn konnte ich nicht erfahren. Wegen der allgemeinen Waldbedeckung konnten wir die einzelnen Gebirge am oberen Murung auf grösseren Abstand nicht gut unterscheiden. Nur der Batu Ajo im Osten trat seiner ganzen Länge nach deutlich hervor; sein Gipfel besteht ebenfalls aus einer schmalen, waldbedeckten Fläche, nur ist er niedriger als der des Batu Lĕsong. Besonders auffallend war das Bergmassiv des Bomban im Gebiet des Murung, das sich als schmales, kegelförmiges Gebirge von 1900–2000 m Höhe hinter den vorgelagerten, nicht über 1000 m hohen Ketten erhebt. Ich konnte nun die eigenartigen Terrassenbildungen unseres Sandsteingebirges, die mir vom Batu Mili aus aufgefallen waren, von einem anderen Standpunkte aus betrachten. Die 20 bis 100 m mächtigen Sandsteinlagen aus denen dieses Gebirge besteht, sind im Lauf der Zeit so erodiert worden, dass nach Norden niedrigere Terrassen mit der gleichen schwachen Neigung, wie der Hauptrücken, gebildet sind und zwar ist die Terrassenbildung an der Westseite der Querrücken stärker ausgeprägt als an der Ostseite.
Die Nordseite des Batu Lĕsong zeigt eine eigentümliche Zickzacklinie, in deren einspringenden winkeln je ein Fluss seinen Ursprung nimmt.
Die Berge im Tal des Blu-u machten, da sie ganz mit Wald bedeckt sind, von dieser grossen Höhe aus keinen Eindruck; nur der [397] Kasian und der Mili stachen mit ihren hellen Wänden von dem dunklen Hintergrunde ab. Grossartig war der Blick auf das Kettengebirge am oberen Mahakam mit seiner Fortsetzung längs des Kajanflusses. Einzelne Ketten oder Gipfel waren nicht zu erkennen; es zeigte sich aber, dass von diesem Gebirge Querrücken in die Täler des Oga und Boh, in gleicher Weise wie vom Batu Lĕsong zum Mahakam, verliefen.
Nachmittags, als die Sonne im Sinken begriffen war, erfuhren wir aufs neue, wie sehr die Aussicht nicht nur durch die Wolken, sondern auch durch die Sonne beeinträchtigt werden kann; denn Bier konnte nur mit Mühe einige Gipfel im Norden visieren, da ein bläulichgrauer Dunst die ganze Landschaft einhüllte. Das erhaltene Resultat war aber befriedigend, daher beschlossen wir, diesen ungastlichen Ort am folgenden Morgen zu verlassen.
Die Verteilung unseres Gepäcks unter die noch übriggebliebenen Kajan und Malaien kostete nicht viel Mühe, da unsere Lebensmittel fast erschöpft waren, und so machten wir uns am 26. januarleichten Herzens auf den Rückweg: Unsere Kuli hatten den Weg durch Mooswände und Gestrüpp bedeutend verbreitert und verbessert, daher kamen wir, obgleich die Kletterpartie nach unten doch nass und unangenehm war, schnell vorwärts und erreichten noch vormittags den Lagerplatz vor dem ersten Gipfel, an dem wir alle unsere Leute versammelt fanden.
Sĕkarang hatte seine Zeit besonders gut benützt und während des letzten Tages einen wahren Garten von schönen und seltenen Pflanzen zusammengebracht. Das Herbarium war besonders durch eine grosse Anzahl neuer Baumarten bereichert worden. Alles Material musste lebend mitgenommen und zu Hause bearbeitet werden, da in dieser vor Nässe triefenden Umgebung an ein Trocknen nicht zu denken war.
Unsere Arbeit war nun erledigt und eine schnelle Heimreise wünschenswert, daher dachte ich abends über die Möglichkeit nach, den Mahakam in einem Tage zu erreichen. Der Abstieg musste bequemer sein als der Aufstieg und, da die Flüsse durch den Regen der letzten Tage geschwellt sein mussten, erschien mir die Sache nicht sehr schwierig. Mein Vorschlag fand seitens der Träger geringen Beifall, obgleich diese im Grunde auch lieber zu Hause als in dem nassen Urwald sassen. Sie fürchteten augenscheinlich, einen geringeren Lohn zu erhalten, daher versprach ich ihnen sogleich nicht nur den vollen [398] Lohn, sondern auch eine Extrabelohnung, weil der Zug dank der Anstrengung der Leute in kürzerer Zeit vollführt worden war, als ich erwartet hatte.
Am folgenden Morgen verteilten wir die Pflanzensammlung unter die Träger und brachen nach dem Essen auf. Ich vermutete, dass meine Reisegesellschaft es doch noch versuchen würde, erst in zwei Taren aber dafür langsam nach Hause zu gelangen, und beschloss daher, vorauszugehen, um die Leute zum Nachfolgen zu zwingen.
Als alle zum Abmarsch bereit waren, machte ich mich in Gesellschaft von Sorong, der nur sein eigenes Gepäck zu tragen hatte, auf den Weg. Mit unserem schnellen Schritt erreichten wir in 3½ Stunden unseren Lagerplatz auf dem Rücken, der zum Bruni hinunterlief. Sorong erklärte, der Ruhe bedürftig zu sein, und konnte auch nach einiger Zeit nur mühsam vorwärts, so dass uns die fünf jungen Kajan einholten. Durch unser ständiges Vorausgehen und durch die Nähe des Flusses gereizt stürmten sie ohne stillzuhalten an uns vorüber. Ich liess Sorong zurück und folgte den fünf, musste aber sehr schnell gehen, um mit ihnen Schritt zu halten. In kurzer Zeit erreichten wir den Bruni, der inzwischen stark geschwollen war. Als wir den Fluss durchquerten, sanken wir tief ins Wasser ein; das Bad, das erste nach unserer Abreise, erfrischte uns herrlich, auch liess uns die Aussicht, mit unseren Böten ohne Schwierigkeit nach Hause zu gelangen, unsere Müdigkeit und die Steifheit unserer Gliedmassen vergessen. Innerhalb einer Stunde waren alle vereinigt, die Böte aus dem Walde geholt und zu Wasser gelassen worden. Das Einladen des Gepäckes ging schnell von statten und darauf ging es erst den Bruni dann den ebenfalls geschwollenen Blu-u hinunter. Noch vor Sonnenuntergang landeten wir bei unserer Wohnung, zur grossen Verwunderung der Dorfbewohner, die uns noch lange nicht zurück erwartet und einen Erfolg unseres Zuges nicht für wahrscheinlich gehalten hatten. Mühsam stieg ich den 30 m hohen Uferwall hinauf und merkte noch nach Tagen, dass ein derartiger Zug viele Anspannung erfordert.
Alle unter der Aufsicht des Kontrolleurs zurückgebliebenen Leute befanden sich wohl, waren aber, wie die ganze Niederlassung, über einen brutalen Mord, der in den letzten Tagen verübt worden war, erregt.
Utas, der malaiische Gatte Lirungs, die in Long Bulèng wohnte, war gleich nach unserer Abreise von einem Handelszug nach dem [399] oberen Murung zurückgekehrt und hatte unter seinen verschiedenen Handelsartikeln auch eine Sklavin mitgebracht. Wenige Tage vorher hatte Lasa, der Sohn des Ma-Suling Häuptlings Tĕkwan, als er seine Tante Lirung besuchte, die Sklavin aus dem Hause gelockt, mit zwei jungen Kajan in ein Boot gesetzt und war mit ihr flussabwärts gefahren. Als auf halbem Wege von seinem Hause alle auf einer Geröllbank ausgestiegen waren, um zu baden, fiel Lasa plötzlich die alte Frau an und ermordete sie. So schien sich die Geschichte, von allen wahren und unwahren Ergänzungen abgesehen, wirklich zugetragen zu haben.
Die Tat war sowohl Kwing Irang als uns gegenüber eine sehr freche; denn Lasa gehörte durch seine Mutter Uniang, eine Schwester von Lirung, zum Kajanstamm und, da die alte Frau bereits in Lirungs Hause gegessen hatte, war, nach Auffassung der Kajan, in ihr eine Stammesgenossin ermordet worden. Ein derartiges Verbrechen wird von den Bahau viel schärfer verurteilt, als wenn es sich um die Ermordung eines Fremden, wenn auch eines Angehörigen eines benachbarten Stammes, handelt.
Kwing Irang geriet durch diese Angelegenheit in grosse Verlegenheit, denn er hatte sie noch nicht mit dem Kontrolleur besprochen und für uns war es schwierig, aktiv aufzutreten, besonders deswegen, weil der wahre Sachverhalt, der widersprechenden Berichte wegen, durchaus nicht klar schien.
Zuerst hörten wir, Kwing Irang habe die beiden Kajan, deren Unschuld an dem Mord sich übrigens bald erwies, zur Strafe nach Long Bulèng geschickt, um dort zu arbeiten, und gleich darauf erklärte der Häuptling dem Kontrolleur, er habe die Absicht, seinem Enkel (Sohn seiner Nichte) die Strafe für Mord im eigenen Stamme aufzuerlegen. Da die betreffende Strafe in solch einem Fall bei allen Bahau in der Auferlegung einer Busse besteht, mussten wir uns mit seiner Absicht zufrieden geben.
Bald darauf, am a. Februar, kamen Tĕkwan und Uniang, die Eltern des Mörders, in grosser Gesellschaft heraufgefahren, um über den Vorfall zu unterhandeln. Sie durften jedoch das Haus des Kajanstammes nicht betreten, da nach einem derartigen Mord niemand mit dem Mörder oder mit dessen Familie, aus Furcht krank zu werden (einen dicken Bauch zu erhalten), in Berührung kommen will, selbst nachdem bereits eine Busse auferlegt worden ist. Erst nachdem der [400] Mörder oder seine Familie dem Häuptling ein Schwert, ein Stück Zeug und einige Hühner übergeben haben und diese mit dem Schwerte getötet worden sind, fürchtet man sich nicht mehr, durch eine Begegnung mit dem Mörder den Zorn der Geister zu erregen.
Bevor die Hühner geopfert werden, suchen so viele Leute als möglich die Tiere zu beissen, damit die Geister an dem auf die Tiere übertragenen Geruch die Teilnahme aller am Opfer erkennen können und die Blutschuld ihres Stammesgenossen nicht auch an ihnen zu rächen suchen.
Darauf legte Kwing Irang in einer Zusammenkunft den Eltern des Mörders eine Busse von 1000 Reichstalern auf. Den gleichen Betrag hatte er dem Radja von Sĕrawak bezahlen müssen, nachdem er selbst einen Chinesen getötet hatte, auch hatte er einst von einigen Murungern für den Tod dreier seiner Stammesgenossen die gleiche Summe gefordert. Um diese Busse zu entrichten, war Tĕmĕnggung Itjot damals mit einem Sklaven und allerhand Waren nach dem oberen Mahakam gezogen.
Viel später erst kämen wir zur Überzeugung, dass die Sache sich so zugetragen haben musste, dass Lasa dem Utas, als dieser sich lange vor unserer Ankunft nach dem Murung begab, aufgetragen hatte, ihm für das Geld oder die Artikel, welche er ihm mitgab, einen Sklaven oder eine Sklavin zu kaufen. Als Häuptlingssohn fühlte sich nämlich Lasa, um für voll angesehen zu werden, verpflichtet, einen Menschen zu töten. Da bei den Bahau selbst Sklaven nicht verkauft werden und ihm zu einer Kopfjagd Lust oder Gelegenheit fehlte, ergriff er dieses Mittel, um den Anforderungen seiner männlichen Ehre zu genügen; denn, wie an anderem Ort bereits gesagt ist, gilt selbst das Töten einer alten Sklavin bei den Bahau als Zeichen von Mut. Augenscheinlich wollte er sein Geld nicht verlieren und tötete daher die Sklavin, trotzdem wir uns bei Kwing Irang aufhielten. Dabei beging er die Unvorsichtigkeit, die Sklavin zu töten, nachdem sie sich bei den Kajan bereits niedergelassen und gegessen hatte. Aus Furcht, dass wir den Malaien Utas, der in dieser Angelegenheit eine zweifelhafte Rolle gespielt hatte, zur Verantwortung ziehen würden, hielt man uns den wahren Sachverhalt so lange verborgen; vielleicht war er auch nur wenigen bekannt. Auch Lasa schien sich nicht sicher zu fühlen, denn er war sofort nach den Reisfeldern der Ma-Suling, die hoch oben am Mĕrasè lagen, geflohen. [401]
Kaum hatte sich die Aufregung über diesen Mord etwas gelegt, als Berichte aus Long Tĕpai eintrafen, welche die Bevölkerung noch weit mehr beunruhigten. Bald nach unserer Rückkehr vom Batu Lĕsong war Hadji Umar nämlich in Handelsangelegenheiten nach Long Tĕpai gezogen und kehrte am 7. Februar mit der Nachricht zurück, dass er die Bewohner von Long Tĕpai in grosser Aufregung verlassen habe, weil sechs Siang vom Murung, die am oberen Tĕpai Guttapercha suchten, auf Batang-Lupar Dajak gestossen waren, die den Wald unberechtigter Weise ausbeuteten. Die Siang waren mit Erlaubnis des Häuptlings Bo Lea von Long Tĕpai den Fluss bis zu seinem Ursprung hinaufgefahren und hatten in dem für gewöhnlich gänzlich unbewohnten Gebiete hacken gehört. Als sie vorsichtig heranschlichen, sahen sie zwei Männer, die im Begriff waren, eine Sagopalme zu fällen. Durch einen kleinen Hund, der fortlief, aufmerksam gemacht begannen die Männer, dem Berichte nach, mit vergifteten Pfeilen auf die Siang zu schiessen, ohne sie zu treffen, worauf diese mit Gewehrschüssen antworteten. Die beiden Männer ergriffen die Flucht, wurden aber von den Siang verfolgt, die schliesslich auf eine nach Art der Batang-Lupar gebaute Hütte stiessen, die mindestens 30 Personen beherbergen konnte.
Die Bande schien in grosser Eile geflohen zu sein, denn sie hatte Schwerter, Kochtöpfe und eine grosse Menge Guttapercha zurückgelassen. Die Siang, die sich in dieser Umgebung nicht sicher fühlten, kehrten nach Long Tĕpai zurück und nahmen als Beweis für ihr Erlebnis Guttapercha und allerhand Gegenstände mit. Die zweifellose Nähe der Batang-Lupar, vor denen man am oberen Mahakam stets Furcht empfindet, rief bei den Bewohnern von Long Tĕpai einen solchen Schrecken hervor, dass sie sich sofort rüsteten, um auf den Feind loszugehen. Man beschloss jedoch, bevor man zur Tat schritt, sei es auf Anraten Hadji Umars, sei es, weil die Häuptlinge selbst es für sicherer hielten, die Angelegenheit erst mir und Barth vorzulegen. Daher kam Umar uns melden, dass am folgenden Tage Bo Tijung, der älteste, vornehmste und einflussreichste Mann von Long Tĕpai, zu uns kommen werde, um die Sache mit uns zu beraten. Dieser Vertrauensbeweis der Long-Glat, deren Gesinnung uns gegenüber bisher stets zweifelhaft gewesen war, gewährte uns eine grosse Genugtuung, auch freuten wir uns, den Bahau beweisen zu können, dass wir ihnen bei gegebener Gelegenheit ernstlich beistehen wollten. Wir überlegten [402] daher, was in dieser Angelegenheit weiter zu tun sei. Da die Bahau die Batang-Lupar als Kopfjäger sehr fürchteten und die Long-Glat in der Tat allen Grund dazu hatten, weil sie den am Oga an den fünf Batang-Lupar verübten Mord noch nicht gesühnt hatten, war es äusserst wahrscheinlich, dass sie bei einer eventuellen Begegnung sogleich auf ihre Feinde schiessen würden. Hierdurch wären gegenseitige Racheakte und vermehrte Unruhe im Lande veranlasst worden; wir mussten daher trachten, die ganze Bewegung in Händen zu behalten.
Ob sich nur diese kleine Bande Sĕrawakischer Dajak in der Umgegend aufhielt, oder ob sie zu einer viel grösserem gehörte, war gänzlich unbekannt. Als Folge des vor zwei Jahren von den Long-Glat verübten Mordes hatten bereits zahlreiche Gerüchte von Rachezügen seitens der Butang-Lupar, die schon unternommen waren oder erst unternommen werden sollten, die Runde gemacht, und es war daher sehr wohl möglich, dass die entdeckten Buschproduktensucher in der Tat darauf aus waren, sich an den Long-Glat von Long-Tĕpai oder anderen Niederlassungen zu rächen.
Bevor wir über die Anzahl und den Aufenthaltsort der Feinde nähere Auskunft erlangt hatten, konnten wir keine wichtige Massregel ergreifen. Dass die Bahau aber in der Aufregung des Augenblicks zu ruhiger Überlegung und Geduld nicht fähig waren, merkten wir am folgenden Tage, als Bo Tijung mit zwei Böten bei uns landete und nach einem kurzen Besuch bei Kwing Irang uns sogleich seine Aufwartung machte. Sein Bericht stimmte mit dem von Hadji Umar überein, auch hatte er als Beweisstück Guttapercha mitgebracht. Die Batang-Lupar bereiten nämlich die Guttapercha auf eine besondere Art und Weise, die nicht zu verkennen ist. Erstens vermengen sie die Guttapercha stark mit Baumrinde, so dass sie eine schwammige Masse bildet, zweitens formen sie aus ihr viereckige, platte Kuchen, die ungefähr 3 × 5 dm gross und 1 dm dick sind. Die Bahau dagegen, besonders die Siang, vermengen die Guttapercha viel weniger und geben ihr eher eine zylindrische Form.
Bo Tijung hatte eigentlich gehofft, unsere Zustimmung zu erhalten, um mit allen kriegstüchtigen Männern sogleich auf die Batang-Lupar Jagd zu machen, und wollte daher anfangs ernsten Überlegungen kein Gehör schenken. Schliesslich konnte er aber unseren Einwand gegenüber, dass man über Anzahl der Feinde und den Ort, an dem sie zu finden waren, wenig wusste, nicht taub bleiben, auch schätzte er unser [403] Versprechen, mit unseren gut bewaffneten Schutzsoldaten sicher Hilfe leisten zu wollen, sehr hoch. Aus unserem Gespräche, dem bald auch Kwing Irang, Hadji Umar und viele andere beiwohnten, glaubte Bo Tijung herauszuhören, dass wir das Mitnehmen der Guttapercha tadelten, und benützte die Gelegenheit, um seiner inneren Unzufriedenheit über den Lauf der Dinge Luft zu machen. Er äusserte sich heftig über das vermeinte Unrecht, die Guttapercha, die im eigenen Gebiet gestohlen worden war, nicht haben mitnehmen zu dürfen. Hadji Umar machte ihm bald klar, dass wir durchaus nicht dieser Ansicht waren, dass wir in dieser Angelegenheit nur vorsichtig zu Werke gehen wollten.
Die Unterredung mit Bo Tijung zeigte uns, dass, falls wir die Leitung der Dinge behalten wollten, die Gegenwart eines von uns in Long Tĕpai unumgänglich notwendig war, da selbst die Klügsten der Long-Glat kaum noch zu halten waren.
Nach dieser vorläufigen Beratung kam ich mit dem Kontrolleur überein, dass wir jetzt, wo die Mahakamstämme uns so günstig gesinnt waren und selbst Angelegenheiten, die sie so nahe angingen, mit uns berieten, eine Teilung unserer Gesellschaft riskieren konnten, und so beschlossen wir, dass Barth mit allen bewaffneten Malaien nach Long Tĕpai ziehen sollte, um dort nach Umständen zu handeln, und dass Hadji Umar, der die dortigen Verhältnisse und Menschen am besten kannte, ihn begleiten sollte. Barth sollte so lange in Long Tĕpai bleiben, bis ich mit Kwing Irang bei ihm eintraf, um dann gemeinschaftlich die Reise nach der Küste fortzusetzen.
Auf die Frage, wann er mit uns würde abreisen können, antwortete Kwing Irang nur: “so bald als möglich,” ohne einen bestimmten Termin anzugeben.
Am 9. Februar teilte sich unsere Gesellschaft tatsächlich und Barth fuhr mit den Seinen, zur grossen Zufriedenheit Bo Tijungs, flussabwärts.
In Long Tĕpai fand er alle bereit, sogleich einen Kriegszug nach dem oberen Tĕpai zu unternehmen; doch brachte er die Leute dazu, sich vorläufig darauf zu beschränken, unter Leitung einiger unserer besten Schutzsoldaten auf Kundschaft auszuziehen und zwar in so grosser Anzahl, dass man auch stärkeren Banden Widerstand leisten konnte.
Die Expedition brachte die Nachricht zurück, dass die Batang-Lupar, die in der Hütte gewohnt hatten, wahrscheinlich keiner grösseren Bande angehörten und so eilig geflohen waren, dass sie ihr [404] Hab und Gut hatten zurücklassen müssen. Nachdem die Gesellschaft einige Tage in der Batang-Lupar Hütte gewohnt hatte, zog sie mit allen transportablen Gegenständen nach Long Tĕpai zurück und beruhigte die Dorfbewohner. Beinahe hätte sich auf dem Zuge ein Unglück zugetragen, da einer von Hadji Umars Begleitern, ein zum Heidentum übergetretener Malaie aus Sĕrawak, gleichfalls namens Umar, plötzlich sein Gewehr auf Njok, den ältesten Sohn von Bo Lea, angelegt hatte. Wenn einer unserer Schutzsoldaten das Gewehr nicht in die Höhe geschlagen hätte, wäre Njok sicher niedergeschossen worden. Der Mann war sogleich in den Wald geflohen und hatte sich nicht mehr sehen lassen. Acht Tage darauf erfuhren wir, dass Umar erschöpft in Long Bulèng angelangt war. Später beging er Ähnliches am Sĕrata und verursachte schliesslich auch bei den Kajan grosse Aufregung, indem er fünf junge Malaien verwundete und einen Dajak tötete. Jetzt sahen selbst die Kajan ein, dass der Mann an Verfolgungswahnsinn litt. Kwing Irang hatte mir nicht glauben wollen, als ich den Mann für geisteskrank erklärte und ihm nach dem Begebnis in Tĕpai riet, das gefährliche Individuum nach Sĕrawak zurückzusenden. Mit vieler Mühe gelang es den Kajan, den Mann, der sich im Walde versteckt hielt, zu töten.
Nun folgte für mich eine sehr ruhige Zeit, in der ich nur für den täglichen Unterhalt meiner Leute zu sorgen, meine ethnographische Sammlung zu vergrössern und die Lebensverhältnisse der Kajan zu studieren hatte. Der Bau von Kwing Irangs Haus bildete für mich den Mittelpunkt des Interesses.
Auf Andringen von Kwing Irang und seinen Mantri beteiligten sich einige Monate hindurch beinahe täglich einige Männer an der Arbeit, aber der Bau schritt doch lange nicht so schnell vorwärts, als der Häuptling und ich es wünschten. Kwing hatte mir bereits öfters mitgeteilt, dass, so lange er sein neues Haus noch nicht bezogen hatte, von einer Reise zur Küste keine Rede sein konnte. Jetzt, wo meine Gegenwart aus politischem Interesse bei den Long-Glat viel notwendiger war als bei den Kajan, wurde meine Ungeduld, das Haus endlich fertig dastehen zu sehen, begreiflicher Weise immer grösser. Und doch wollte ich die Reise ohne Kwing Irang lieber nicht fortsetzen, da seine Anwesenheit für den Eindruck auf die weiter unten wohnenden Stämme von zu grosser Bedeutung war. Von diesem Gesichtspunkte aus war es sehr günstig, dass der Kontrolleur schon jetzt [405] die Möglichkeit hatte, sich bei den Long-Glat einzuleben; die Berichte, die er ständig nach oben sandte, lauteten auch sehr befriedigend.
Immer wieder wies ich die Kajan auf ihre Pflicht, sich mit aller Kraft dem Hausbau zu widmen. Es wurden selbst zweimal des Abends Versammlungen abgehalten, in denen ich mit allem Einfluss, den ich besass, für den Bau des Hauses eintrat; der Häuptling konnte nämlich keine Arbeiter mehr finden, da die Leute mit dem Bau ihrer eigenen Wohnung beschäftigt waren. Zu meiner Genugtuung wurden meine Vorstellungen wirklich beherzigt und der Hausbau schritt, im Vergleich mit der sonstigen Arbeitsweise der Bahau, schnell vorwärts. Die Kajan waren hiervon so überzeugt, dass sie mir sagten, das Haus sollte später stets: “uma tuan Doktor” (Haus des Herrn Doktor) heissen. Nichtsdestoweniger schienen mir die Tage kein Ende nehmen zu wollen.
Bier hatte seine Aufnahmen in Zeichnung gebracht und es wurde für ihn Zeit, seine Arbeit an einem anderen Ort fortzusetzen. Da auch der Kontrolleur in Long Tĕpai nur fünf Schutzsoldaten bei sich hatte, schien es mir notwendig, uns unabhängig von den Bahau Hilfskräfte zu verschaffen, die mir auch, nachdem ich den Kontrolleur bis nach Samarinda begleitet hatte, bei meiner Rückkehr ins Innere von Nutzen sein konnten. Ich nahm daher sogleich die besten Elemente von Hadji Umars Gesellschaft und ausserdem auch noch einige andere Malaien aus unserer Nachbarschaft in meinen Dienst. Die Leute waren froh, dass sie nun, wo die Kajan nicht mithalten konnten, von der Gelegenheit, einen guten Lohn zu verdienen, profitieren konnten. Es wurde mir um so leichter, Personal zu finden, als keinem von uns bisher ein Unglück zugestossen war und ich durch meine ärztliche Praxis das Vertrauen aller genoss. Im Hinblick auf meinen späteren Besuch bei den Kĕnja war ich auf Leute des gleichen Landes angewiesen, da ich erfahren hatte, dass nur ein kleiner Teil meines jetzigen Geleites dafür geeignet war oder geneigt sein würde, noch ein zweites Jahr bei mir zu bleiben. Unter den javanischen Leuten waren mehrere, die mir von keinem Nutzen sein konnten und die ich daher nach Java zurückschicken wollte, während die Malaien von der “Wester-Afdeeling” von Borneo, sowohl die Schutzsoldaten als die Melawie Malaien, sich zu sehr nach ihren Familien sehnten, um noch weiter mitgehen zu wollen. Indem ich von den Javanern, die in letzter Zeit ein sehr faules Leben geführt hatten, alle entbehrlichen Leute wählte, gelang es mir, [406] Bier für drei Böte eine Bemannung zu verschaffen, mit der er den Mahakam vom Blu-u bis Long Tĕpai weiter aufnehmen konnte; von dort aus sollte er mit Hilfe der Long-Glat, die ihm der Kontrolleur zu verschaffen suchen musste, weiterarbeiten.
Des hohen Wasserstandes wegen musste Bier lange Zeit mit seiner Aufnahme warten und noch vor seiner Abreise fanden unsere Gedanken eine plötzliche Ablenkung.
A m Morgen des 23. Februar erschien Kuntji, ein Malaie, der bei den Ma-Suling am Mĕrasè lebte, mit einer Anzahl Leute aus Lulu Sirāng und meldete, dass der Häuptling Obet Dĕwong seit einiger Zeit wieder so ernstlich krank war, dass er meine Hilfe sogleich nötig hatte. Die Nachricht berührte mich äusserst unangenehm, denn man schrieb die Krankheit natürlich, diesmal zum Teil mit Recht, unserer Exkursion auf den Batu Situn zu, auch konnten nun die Ma-Suling, die bereits grosse Vorbereitungen getroffen hatten, um unter meinem Schutz die Gebiete unterhalb der Wasserfälle und die dortigen Märkte zu besuchen, nicht mit uns reisen. Da es sich bald herausstellte, dass es dem Häuptling lange Zeit gut gegangen war, dass er aber durch grosse Unvorsichtigkeit, wie durch langes Stehen in kaltem Flusswasser beim Fischen und durch Hacken von Rotang und Brettern für Böte, einen Rückfall bekommen hatte, wollte ich mich in der ersten Aufwallung nicht weiter mit ihm befassen. Ausserdem war die Reise nach Lulu Sirāng wegen des Hochwassers im Mahakam und Mĕrasè gefährlich und so schwierig, dass wir kaum Aussicht hatten, die Niederlassung noch am gleichen Tage zu erreichen. Bei ruhiger Überlegung sagte ich mir jedoch, dass der Tod des Häuptlings einen sehr unangenehmen Eindruck hinterlassen würde, den meine Weigerung, ihm zu helfen, nur verschlimmern konnte. Auch fiel mir ein, dass wir möglicherweise einen Teil der Reise über Land zurücklegen konnten, denn ich hatte vom Batu Marong aus gesehen, dass die Gegend zwischen dem Mahakam und Lulu Surāng zwar mit Urwald vollständig bedeckt, aber eben war. Da an beiden Enden dieser Ebene, am Mahakam und am Mĕrasè, Ma-Suling wohnten, führten vielleicht Pfade durch den Wald.
Bei näherer Erkundigung bestätigte sich meine Vermutung; wir konnten uns somit die Fahrt auf dem Mĕrasè ersparen und hatten dazu Aussicht, unser Ziel schneller zu erreichen.
Eine halbe Stunde darauf sass ich mit Midan, meinem Hunde und [407] den notwendigen Arzneien im Bote der Ma-Suling, das von der heftigen Strömung mit grosser Geschwindigkeit flussabwärts geführt wurde. Bier, der am gleichen Tage mit der Aufnahme hatte anfangen wollen, musste die Arbeit wieder aufschieben; auch sollte er in den folgenden Tagen nach Gutdünken handeln.
Bereits um 11 Uhr hatten wir Lulu Njiwung passiert, waren zwischen zahlreichen kleinen Inseln hindurchgefahren und landeten oberhalb der Mündung des Mĕrasè bei der Niederlassung des Ma-Suling-Häuptlings Tĕkwan. Hier stieg ich aus und sandte einige Ma-Suling nach oben, um Führer zu holen, da ich selbst noch viel zu sehr unter dem Eindruck des von Lasa verübten Mordes stand, um dessen Elternhaus betreten zu wollen. Diejenigen, die den Weg nach Lulu Sirāng kannten, wohnten auf ihren Reisfeldern, an denen wir vorüber mussten. Zwei junge Ma-Suling aus unserem Boot, mein Diener und mein Hund sollten mich begleiten, während der Malaie Kuntji, der nicht mit uns zu gehen wagte, und die vier anderen Ma-Suling versuchen sollten, den Mĕrasè hinaufzufahren.
Als es bald darauf zu regnen begann, wurden die im übrigen gut unterhaltenen Wege, die zu den Reisfeldern führten, sehr glatt, besonders an viel betretenen Stellen und auf Hügeln.
Nach einer Stunde schlugen wir Seitenwege ein, die zwar viel unebener waren, dem Fusse aber besseren Halt boten. Nach kurzer Zeit erreichten wir die Hütte (le̥po̱ luma) auf dem Reisfelde, dessen Besitzer uns als Führer dienen sollte. Der Mann behauptete jedoch, nicht fort zu können, und gab uns zwei andere an, die zur Begleitung bereit sein würden.
Auf einigen kaum erkennbaren Pfaden und durch einige Bäche hindurch gelangten wir zu anderen Ladanghäusern, in denen wir zwei Männer fanden, die in der Tat mitgehen wollten.
Von den Reisfeldern führte der Weg in den Wald längs flachen, sandigen Flussbetten, in denen das Waten zwar nicht mühsam, aber beim strömenden Regen auch nicht ermunternd war.
Wir folgten dem letzten Flussbett, das immer steiniger wurde, bis zum Ursprung; hier mussten wir die Ebene verlassen und mehrere hohe Hügel passieren. Die nassen Lehmpfade, die steil nach oben führten, stellten an unsere Beine und Lungen starke Ansprüche, aber auf den Gipfeln der Hügel angekommen fanden wir wirklich gute und nicht glatte Pfade, denen wir stundenlang folgen konnten. Erst bei Einbruch [408] der Dunkelheit stiegen wir abwärts und folgten sehr ermüdet den Pfaden, die durch die Reisfelder der Ma-Suling von Obet Dĕwongs Dorfe führten. Unglücklicher Weise bestanden diese Pfade grösstenteils aus freiliegenden, dünnen Baumstämmen, von denen je zwei oder drei auf Querbalken neben einander einen Fuss über dem Erdboden ruhten. Strauchelnd, gleitend und fallend bewegten wir uns langsam vorwärts und waren am Ende erstaunt, ohne Arm- und Beinbruch davongekommen zu sein. In einem Ladanghause, in dem Licht brannte, wollten wir uns mit Fackeln versehen, aber die Leiter war hinaufgezogen und, als wir uns dem Hause näherten, löschten die Bewohner das Licht aus und gaben keine Antwort. Unsere Führer erklärten, dass es viel zu gefährlich sei, an andere Hütten zu klopfen, da die Leute sich nachts fürchteten und auf uns schiessen konnten.
So gingen wir denn weiter und erreichten, bevor es ganz dunkel wurde, die Hütte von Verwandten der beiden Ma-Suling von Obet Dĕwong. Nachdem wir hier eine halbe Stunde Rast gehalten hatten, suchten wir mit Hilfe von Harzfackeln in der stockdunklen Nacht weiter zu kommen. Zum Glück befanden wir uns nicht mehr weit von der Niederlassung entfernt, wir mussten nur noch einem kleinen Flusse folgen und dann zum Teil über den Marong hinüber.
Zwischen Wasser und Erde machten wir bereits seit langem keinen Unterschied mehr, daher empfanden wir es auch nicht als besonders unangenehm, dass wir durch einen kleinen, aber sehr geschwollenen Fluss mit moderigem Grunde waten mussten und dass das Wasser uns bis an die Brust reichte.
Die schmale Schlucht zwischen den hohen, dicht bewachsenen Ufern wurde von dem flackernden Schein unserer Fackeln phantastisch beleuchtet. Hinderten uns unter Wasser liegende Äste und Baumstämme am Vorwärtsgehen, so fanden wir am Ufergras und an den Zweigen einen Halt. Mein Hund suchte sich zwischen dem Ufergebüsch heulend seinen Weg, da er gegen die heftige Strömung nicht schwimmen konnte. Der Fluss wurde immer flacher und nach einer halben Stunde verliessen wir das Bette, um den Batu Marong so weit zu besteigen, dass wir auf die andere Seite hinübergelangen konnten. Dort sahen wir den Mĕrasè plötzlich zu unseren Füssen und jenseits des Ufers stand das Haus von Obet Dĕwong. Als habe man uns erwartet, erschienen auf unser Rufen sogleich einige Männer, die uns über den in der Tat sehr geschwollenen Fluss ruderten. [409]
Obgleich mein äusserer Mensch durchaus nicht in eine Häuptlingswohnung passte, führte man mich doch sogleich zu Obet Dĕwong, der über mein Kommen sehr erfreut war. Man hatte mich nicht umsonst gerufen; der grosse Mann lag völlig apathisch mit halbgebrochenen Augen da; seine Zunge war trocken und schwarz, auch sprach er nur mit Anstrengung.
Da er täglich um die Mittagszeit einen Fieberanfall bekam, hielt ich es für geraten, ihm nicht vor dem folgenden Morgen Chinin zu geben, ihn augenblicklich durch Kognak mit Wasser zu beleben und dann, da sein Puls es zuliess, mittelst Morphium schlafen zu lassen. Den Kognak musste ich stark verdünnen, da die Kehle der Bahau, die fast nichts anderes als Wasser kennt, für Alkoholica sehr empfindlich ist. Die Wirkung war eine befriedigende, denn bevor ich mich von meiner Übermüdung so weit hergestellt hatte, dass ich an Essen und Schlafen denken konnte, hatte sich der Patient, zur grossen Freude seiner Umgebung, bereits etwas erholt. Nach meiner Mahlzeit von Huhn und Reis gab ich dem Häuptling ein Morphiumpulver, worauf er in ruhigen Schlaf fiel.
Wahrscheinlich schlief mein Patient besser als ich, denn obgleich es Kuntji gelungen war, bald nach uns anzukommen und er mein Bettzeug mitgebracht hatte, schlief ich nur schwer ein und erwachte mit einem heftigen Brustkrampf. Gegen Ende der Nacht legte sich der Krampf und am folgenden Morgen gab es so viel zu tun, dass ich auf mich selbst nicht mehr achten konnte. In aller Frühe gab ich Obet Dĕwong seine Dosis Chinin, die er bereitwillig einnahm, mit dem Erfolge, dass der Fieberanfall an diesem Tage ausblieb. Darauf strömten wiederum Kranke herbei, die mich um Chinin, hauptsächlich aber um Jodkali baten, dessen gute Wirkung sie seit meinem letzten Besuche, wo ich ihnen dieses Mittel in grösserer Menge verteilt hatte, aus Erfahrung kannten. Unter anderem erfuhr ich von den Leuten, dass viele es lebhaft bedauerten, wegen der Krankheit des Häuptlings nicht mit mir zur Küste reisen zu können. Zwar glaubte der Häuptling immer noch an seine baldige Genesung und an eine Teilnahme an der Reise, aber ich nahm mir vor, ihm wegen seines Leichtsinns in bezug auf seinen augenblicklichen Zustand und in Anbetracht seiner hohen Jahre, auch für die Zukunft Vorstellungen zu machen.
Die vorgenommene Unterredung fand bereits abends statt, auch teilte ich dem Kranken mit, dass ich noch den folgenden Tag bei ihm [410] bleiben wollte, um ihm selbst die Arznei zu verabreichen. Die Chinindosis, die er morgens und abends regelmässig einnahm, und die rationelle Ernährung taten dem Manne sichtlich gut. Am Abend vor meiner Abreise erklärte ich Obet nochmals, dass ich ihn bestimmt nicht auf die Reise mitnehmen würde und dass er sich noch lange nach seiner Genesung in Acht nehmen müsse, um einen Rückfall, der für ihn sehr gefährlich werden konnte, zu vermeiden. Dank den zurückgelassenen Arzneien genas der Patient vollkommen, als er aber später hörte, dass es mit meiner Abreise Ernst wurde und dass die Kajan mich begleiten sollten, zog er doch wieder in den Wald, um seine Böte rüsten zu lassen. Trotz einer Erkältung, die er sich hierbei zuzog, ging er wieder fischen und wurde schliesslich von einem so heftigen Fieberanfall gepackt, dass er nach drei Tagen starb.
Bei meiner Abreise am 26. Februar wiegte ich mich jedoch noch in der Illusion, dass ich den Häuptling gerettet hatte, und zu meiner angenehmen Überraschung erklärten sich diesmal sechs Mann ohne Widerrede bereit, mich nach Long Blu-u zurückzubringen. An Napo Liu liess man mich nicht ohne Weiteres vorbeifahren, sowohl bei Lĕdju Li als bei Tĕmĕnggung Itjot musste ich viele Kranke behandeln; da der Mahakam überdies noch sehr geschwollen war, wurde es Abend, bevor wir unterhalb der Niederlassung von Tĕkwan ankamen. Hier herrschte lāli parei (Verbotszeit beim Beginn der Ernte), weswegen wir nicht im Dorfe übernachten durften, was mir sehr angenehm war. Als Nachtquartier fanden wir eine leerstehende, kleine Reisscheune, in welcher meine Leute mir das Klambu aufschlugen und sich dann unter demselben neben einander schlafen legten. Glücklicher Weise regnete es am folgenden Morgen nicht, so dass wir mit frischem Mut den Kampf mit der Strömung wieder beginnen konnten. Einige Stellen liessen sich nur mit grosser Anstrengung überwinden, da der Mahakam nachts leider wieder gestiegen war. Als wir zwischen den Inseln hindurch auf gänzlich neuen Wegen fuhren, trafen wir auf einem derselben Bier mit seiner Gesellschaft, der nicht länger auf einen günstigen Wasserstand hatte warten wollen und nun, so gilt es eben ging, für seine Peilungen passende Standorte zu finden suchte. Er erzählte, dass uns einige Schutzsoldaten eine Postsendung aus Long Tĕpai mitgebracht hatten, die ich ihm zum Trost zukommen zu lassen versprach.
Zu Hause angekommen fand ich alles in Ordnung, nur war ich sehr enttäuscht, dass das Dach des neuen Hauses noch immer nicht ganz [411] gedeckt war und dass noch neue Dachschindeln gemacht werden sollten, so dass wir sicher bis zum folgenden Monat warten mussten, bevor an eine Abreise zu denken war.
Anfang März beauftragte ich die Pflanzensucher, die Pflanzen, die bis dahin frei in Bambuskörben gestanden hatten, in Kisten zu setzen. Die Malaien und Javaner sollten inzwischen unsere Böte mit neuen Rändern versehen und die alten mit Rotang festbinden.
Die Kajan ersahen hieraus, dass ich ernsthaft an die Reise dachte und dass ich nicht die Absicht hatte, wie im Jahre 1897, ihre Ernte abzuwarten. Durch das späte Säen, den Bau des Häuptlingshauses und vieler kleinerer Häuser, sowie durch den vielen Regen, der den Reis nicht reifen liess, war die der Ernte vorangehende Verbotszeit bei den Kajan erst Anfang März abgelaufen. Ich hoffte nun bald zu vernehmen, dass man sich auf die Vogelschau begeben würde, stattdessen erzählten mir einige Knaben im Geheimen, dass man auch noch für die Seitenwände des Hauses Eisenholzschindeln herstellen wollte. Ich war zu sehr daran gewöhnt, durch Umwege hinter die Wahrheit zu kommen, um den Knaben keinen Glauben zu schenken, und rechnete daher sogleich mit einer neuen Verzögerung unserer Abreise. Meine Vermutung erwies sich als richtig, nur beruhte die Verzögerung nicht auf der Herstellung von Schindeln.
Die Hauptsache war, dass wir aus der Zeit, die wir notgedrungen bei den Bahau verbringen mussten, so viel Vorteil als möglich zu ziehen suchten.
Der Kontrolleur hatte bereits einen Monat bei den Long-Glat in Long Tĕpai verbracht und somit genügend Zeit gehabt, um die Bevölkerung kennen zu lernen; er selbst war übrigens derselben Meinung. Da Bier sich nun auch mit seiner Gesellschaft dem Kontrolleur angeschlossen hatte, waren beide stark genug, um sich in eine Umgebung zu wagen, von deren friedfertiger Gesinnung wir nicht so ganz überzeugt waren. In dieser Überlegung schlug ich Barth vor, bei günstigem Wasserstand bis Long Dĕho hinunterzufahren, zudem lauteten die Berichte von dort derart, dass ein längerer Aufenthalt unserer Gesellschaft oder eines Teiles derselben dort sehr wünschenwert war. Der Häuptling von Long Dĕho, Bang Jok, war von unterhalb der Wasserfälle gebürtig und hatte sich mit seinem Stamm erst im Jahre 1893, als er sich in seiner früheren Niederlassung Lirung Tika wegen der Bedrohungen des Sultans nicht mehr sicher fühlte, ober [412] halb der Gastlichen Wasserfälle, des Kiham Halo und Kiham Udang, niedergelassen. Seit der Zeit hatte er allen Versuchen einer Annäherung seitens des Sultans widerstand geboten und war auch nie wieder nach Tengaron gefahren. Doch kam er der Aufforderung des Sultans, die 1895 durch den vornehmen Gesandten Pangéran Tĕmĕnggung an ihn erging, gegen die Banden Buschproduktensucher aus dem Baritogebiet aufzutreten, nach. Diese Leute brachten nämlich einen grossen Teil der Guttapercha, die sie im Gebiet des mittleren Mahakam sammelten, nach dem Barito hinüber, wodurch sie den Sultan um einen Teil des Ausfuhrzolles von 10%, den er an der Mahakammündung erhebt, schädigten. Bang Jok war nicht im stande, gegen diese starken, gut bewaffneten Banden aufzutreten, und liess daher gelegentlich kleinere Gesellschaften durch seine Untergebenen berauben und töten. Auf diese Weise hatte er direkt und indirekt zu mehreren in den letzten Jahren verübten Morden Veranlassung gegeben und sah daher, aus Furcht vor Strafe, einer Begegnung mit uns Niederländern ungern entgegen.
Da wir wussten, dass Bang Jok alle diese Morde auf des Sultans Rat ausgeführt hatte, und wir übrigens auch nicht das Recht hatten, gegen in früheren Jahren begangene Taten aufzutreten, beabsichtigten wir, auf diese Angelegenheit gar nicht einzugehen. Die Regierung von Kutei jedoch, die unsere wachsende Macht unter den Bahau mit scheelen Augen ansah, benützte Bang Joks Furcht vor uns als wichtigsten Hebel, um zu verhindern, dass auch dieser Häuptling auf unsere Seite trat. Ein gewisser Hadji Udjon hielt sich bereits seit Monaten als Gesandter des Sultans bei Bang Jok auf, um ihn dazu zu bewegen, noch vor unserer Ankunft nach Tengaron hinunterzufahren, von wo aus man ihm allerhand schöne Versprechungen machte. Diese Umstände liessen uns lange Zeit über den Empfang, der uns in Long Dĕho zu Teil werden würde, in Unsicherheit, und nur die gute Gesinnung der Long-Glat von Long Tĕpai, naher Verwandter derer von Long Dĕho, hatte uns einigermassen beruhigt. Ich hielt es daher für notwendig, dass der Kontrolleur ein starkes Geleite bei sich hatte, bevor er sich über die westlichen Wasserfälle nach Long Dĕho wagte, und wäre am liebsten selbst mit ihm gezogen, wenn ich nicht durchaus auf Kwing Irang hätte warten müssen, besonders jetzt, wo auch die Ma-Suling sich an der Reise nicht beteiligten und wir auch nur mit Hilfe der Kajan alles Gepäck nach der Küste schaffen konnten.
Bevor sich der Kontrolleur in Bewegung setzen konnte, verstrich [413] jedoch noch eine geraume Zeit. Bier hatte seine Aufnahme noch kaum bis zur Mündung des Mĕrasè ausgeführt, als ihm Barth trotz des hohen Wasserstandes mit einigen Long-Glat entgegen fuhr, um ihm die Möglichkeit zu geben, auch den Pahngè zu messen, der einen wichtigen Handelsweg nach dem Bĕlatung im Gebiet des Murung bildet. Dies glückte denn auch, obgleich die Wasserscheide nicht erstiegen und nur der Fluss selbst aufgenommen wurde. Mit Hilfe der Long-Glat mass Bier später in gleicher Weise auch den Tĕpai. So lange aber das Wasser in Long Tĕpai nicht bis zu einem bestimmten Zeichen an einem Felsen im Fluss fiel, war an ein Überschreiten der Wasserfälle nicht zu denken.
Die zwei letzten Monate waren, wegen der Einsamkeit und des Mangels an ernster Arbeit, die sowohl unter der Aussicht auf unsere baldige Abreise als unter unserer Sehnsucht nach dieser litt, sehr unangenehm gewesen; an unseren Sammlungen wurde nicht mehr eifrig gearbeitet, denn für Exkursionen konnten wir von den Kajan, die mit der Ernte beschäftigt waren, keine Unterstützung erhalten und die Ethnographica hatte ich alle eingekauft, bis auf einige besonders schöne Stücke, derentwegen ich bereits seit Monaten mit den Besitzern unterhandelte, ohne dass vorläufig ein Resultat zu erwarten war. Ich verschob diese Käufe bis zu meiner Rückkehr von der Reise zur Küste.
Auch meine Kranken liessen mich im Stich, in dieser günstigen Jahreszeit kamen nur selten Malariafälle vor und die chronischen Krankheiten hatte ich so weit als möglich geheilt oder den Patienten die Mittel zu weiterer Selbstbehandlung gegeben.
Überdies sah es in unserer Wohnung ungemütlich aus, denn die vielen Ethnographica und Vögel waren, sobald man Kisten für sie hergestellt hatte, eingepackt worden. Alle diese Umstände liessen uns den langsamen Fortschritt der Reisevorbereitungen seitens der Kajan noch unangenehmer empfinden.
Nachdem der Häuptling Anfang März das lāli parei noch in seiner kleinen Wohnung gefeiert hatte, fand der Einzug in das neue, noch nicht ganz fertige, aber doch regendichte Haus statt, worauf zwei Tage me̥lo̱ und dann die Aufhebung der Verbotsbestimmungen (be̥t lāli) für das Haus folgten. Der ganze Stamm beteiligte sich an den Festlichkeiten, die uns für einige Tage Abwechselung boten. Leider folgte hierauf wieder ein unvermeidliches achttägiges me̥lo̱ und dann erst begann man das grosse Häuptlingsboot in Ordnung zu bringen. Erst mussten aber noch [414] Ränder (apin) im Walde gesucht werden, was keine Kleinigkeit war, da die Länge des Bootes 18 m und die Breite 1,2 m betrug. Diese Arbeit wurde aber, als sich die Kajan einmal ernsthaft aufrafften, über Erwarten schnell ausgeführt und in einem Tage waren auch die Bretter an das Fahrzeug gebunden worden. Zwar wusste ich, dass viele Leute ihren Reis für die Fahrt zubereitet hatten, aber da seither viele Monate verstrichen waren, hatten diese Vorbereitungen kaum noch einen Wert. Selbst die Erklärung eines Mantri, dass ich es hoch anschlagen müsse, dass Kwing Irang doch mit mir ging, obgleich sich ein Bahauhäuptling, wenn er eben sein Haus bezogen hat und dieses auch noch nicht vollendet ist, nicht auf die Reise begeben dürfte, verbesserte meine Stimmung nicht sonderlich.
Selbst am 10. März beanspruchte Kwing noch meine Hilfe, weil er selbst keine genügende Anzahl Menschen zusammen bringen konnte, um in seiner Vorgalerie eine Diele legen zu lassen. Diese bestand aus zahlreichen, schweren Brettern des Tenkawangbaumes, der trotz seiner Nützlichkeit hierfür in grosser Zahl geopfert wurde. Die Bretter waren ungefähr 1 dm dick und 5–7 dm breit bei einer Länge von ungefähr 10 m. Aus einem grossen Baum wurden zwei Bretter hergestellt und zwar vereinigten sich stets zwei Familien, ein bearbeitetes Brett zu liefern.
Um diese Bretter an Ort und Stelle, drei Meter hoch über den Erdboden, zu heben, waren mehr Männer als die sechs oder acht, die ständig am Hause arbeiteten, erforderlich, aber da alle eifrig auf ihren Feldern beschäftigt waren, bat mich Kwing Irang, noch einmal die Leitung einer Versammlung übernehmen zu wollen, in der den Familienhäuptern nochmals eingeschärft werden sollte, dass sie ihrem Häuptling und mir gegenüber verpflichtet waren, wiederum Hilfe zu leisten.
A m folgenden Tage wurden in der Tat alle bereits vorhandenen Bretter an ihren Platz gelegt, aber es erwies sich, dass noch so viele Familien die Lieferung ihrer Planke bis nach der Ernte oder nach dem Bau ihrer eigenen Wohnung verschoben hatten, dass noch ungefähr die Hälfte der 13 × 28 m grossen Oberfläche ungedeckt blieb. Hierfür gebrauchte jedoch Kwing die noch nicht benützten Bretter der Mittelwand, die man vorläufig aus altem Material hergestellt hatte und die man erst nach der Rückkehr von der Küste vollenden wollte.
Unter diesen Beschäftigungen trat der z B. März ein, bis Sorong mit vier Mann auf die Vorzeichensuche ging. Nach der Meinung der meisten Kajan geschah dies viel zu früh, aber Kwing Irang tat alles, [415] was er konnte, um die Reise zu beschleunigen, ohne die adat und seine eigenen Interessen allzu sehr zu benachteiligen. Vom 24sten bis zum 28sten durfte nämlich nichts Besonderes ausgeführt werden, da der Mond in dieser Zeit, wo er am vollsten ist, “schlechter Mond” (bulan djă-ăk) genannt wird. Die Kajan bauen in dieser Zeit keine Häuser und Böte und gehen auch nicht auf die Vorzeichensuche. Dass Sorong sich so früh aufgemacht hatte, half leider nichts, denn am 30. März kam er mit der traurigen Nachricht zurück, dass Obet Dĕwong nun doch, nach einem Ausflug in den Wald, gestorben war. Durch einen derartigen Todesfall verlieren die gefundenen Vorzeichen ihren Wert und es müssen später wieder neue gesucht werden.
Noch am gleichen Tage kam von den Pnihing aus Long ’Kup die Nachricht, dass Paren, der kleine Sohn, den Kwing dort von seiner jüngsten Frau hatte, seit einigen Tagen an Fieber litt und dass man den Vater erwarte. Mit dem Versprechen bald zurückzukehren begab sich Kwing noch am selben Nachmittag nach Long ’Kup.
Als Kwing in den ersten Tagen nicht zurückkehrte, ging Sorong in zwei Böten wiederum auf die Vorzeichensuche.
Da der Häuptling im Fall des Todes seines Sohnes überhaupt nicht hätte reisen dürfen, begann ich mich zu beunruhigen und fuhr am 2. April selbst nach Long ’Kup, um zu sehen, wie die Sachen standen und ob ich helfen konnte. Bei meiner Ankunft war man gerade damit beschäftigt, Kwings Gepäck für die Rückreise in die Böte zu laden; auch war im Zustand des Knaben eine Besserung eingetreten. Es zeigte sich, dass man ein grosses Beschwörungs- und Genesungsopfer (e̥nah abei) gebracht hatte und dass die Kajan von dem herrlichen Klebreis mit Schweinefleisch, den sie genossen hatten, noch ganz erfüllt waren. Von dem Rest der schönen Opfergerichte sollte ich nun durchaus auch noch etwas geniessen. Ich liess mich nicht lange nötigen und zwar nicht nur, um meinen Gastherren eine Freude zu bereiten, denn auf meinem Tisch war in letzter Zeit so selten Fleisch erschienen, dass ich das fette Schweinefleisch, trotzdem es ohne Salz gekocht war, gierig verzehrte.
Am gleichen Abend waren wir wieder in Long Blu-u zurück, wo ich zu meinem Verdruss hören musste, dass ein neunjähriges Mädchen, das die Eltern allein zu Hause gelassen hatten, plötzlich erkrankt und gestorben war. Wahrscheinlich hätte ich dem Kinde nicht helfen können und die Kajan trösteten sich mit der Annahme, dass das Kind vielleicht über irgend ein Tier gelacht und daher von den Donnergeistern [416] getötet worden war. Mir schien eine Vergiftung vorzuliegen, ich hielt es aber für geraten, meine Vermutung nicht auszusprechen, da sich sonst alle vor Vergiftung gefürchtet hätten.
Infolge des Todesfalles durfte man, solange das Kind nicht bestattet war, weder an den Böten noch an der Reiseausrüstung arbeiten, auch liess Kwing Irang den Sorong, der bereits einen günstigen Vogel gesehen hatte, zurückrufen, da die Vogelschau in diesem Fall lāli war. Der Häuptling beredete zwar die Eltern der Verstorbenen, die Leiche in einer Felsenhöhle (liang) beizusetzen und ihr nicht erst, wie man anfangs beabsichtigt hatte, eine Hütte zu bauen, was lange gedauert hätte; aber immerhin verloren wir durch diesen Todesfall wieder zwei Tage.
Darauf begannen Kwing und sein Sohn Bang wirklich eifrig an ihren Böten zu arbeiten und viele Freie folgten ihrem Beispiel; zugleich wurde Sorong wiederum auf die Vogelschau geschickt, die ihn allmählich zu langweilen begann. Sorong war nämlich ein in der Jugend geraubter Kahájan Dajak, der dem Glauben der Bahau, obgleich er beim Häuptling eine bevorrechtete Stellung genoss, nicht viel Wert beilegte; nur äusserte er hierüber nie seine Meinung.
Am 10. April langte Akam Igau mit den Seinen unerwartet bei uns an. Sie hatten alle diese Monate bei ihren Verwandten am Tawang verbracht und wegen des hohen Wasserstandes im Makaham eine mühevolle und lange Rückreise gehabt. Nachdem sie die Wasserfälle passiert hatten, waren sie gezwungen gewesen, noch sechs Nächte in Long Tĕpai zu verbringen., weil man dort wegen des Baues eines neuen Hauses auf die Vogelschau ausgegangen war.
Die Mendalam Kajan brachten die Nachricht, dass der Kontrolleur und Bier bereits nach Long Dĕho gereist waren, aber dass sich Bang Jok einen Tag vor ihrer Ankunft nach Udju Halang begeben habe, wo seine Schwester gestorben war. Obgleich letzteres sicher der Fall war, schien mir Bang Joks Abreise im letzten Augenblick doch nur ein Vorwand zu sein. Also war es in Kutei doch gelungen, diesen bedeutenden Häuptling vor uns derart in Schrecken zu versetzen, dass er seine eigene Furcht vor Kutei dabei vergass. Bang Joks wurde auch sogleich von dem Sultan mit einem Dampfboot von Udju Halang nach Tengaron abgeholt, wo wir ihn später trafen.
Die Mendalam Kajan wollten sogleich weiterreisen, ich konnte sie daher nur mit Mühe dazu bewegen, noch einen Tag zu warten, um unsere Briefe mitzunehmen. Da Kwing in seinem neuen Hause noch [417] keine Gäste empfangen durfte, übernachteten sie in Long Bulèng. Am anderen Tag kam Sorong endlich melden, dass die wichtigsten Vögel ihre Zustimmung zur Reise gegeben hatten. In einem Gespräch mit dem Häuptling äusserte dieser den Wunsch, mit allen Kajan, die mitgehen sollten, ein me̥lo̱ njaho̱ von zwei Tagen abzuhalten; danach sollte man mein Gepäck in die Böte laden. Nach dem monatelangen Warten kostete es mich einige Selbstüberwindung, meine Zustimmung zu geben, aber da Kwing Irang die Sache für wichtig hielt, willigte ich ein. Zwei Tage darauf wurden morgens alle Böte zu Wasser gelassen und mit Reis, Guttapercha etc. beladen. Zwischen meinen seit so langer Zeit schon gepackten Sachen sitzend beobachtete ich von meiner Wohnung aus mit grosser Befriedigung die Emsigkeit der Kajan, als ich diese plötzlich in grosser Hast alles Gepäck wieder den hohen Uferwall herauftragen sah; selbst die Frauen halfen mit, um schneller fertig zu werden. Ihre Handlungsweise erschien mir unerklärlich, aber gleich darauf teilte man mir im Namen von Kwing Irang mit, dass von einer Abreise keine Rede sein könne, weil einer ihrer wahrsagenden Vögel, noch dazu der hisit, erst über das Haus und dann sogar durch das Dach ins Haus geflogen sei. Für den Anfang einer Reise war dies ein äusserst ungünstiges Zeichen, daher musste nach einem me̥lo̱ njaho̱ von vier Tagen von neuem auf die Vogelschau gegangen werden. Nach dieser Zeit war aber der Monat so weit vorgeschritten, dass man zufolge der adat keine grosse Reise mehr unternehmen durfte, sondern bis zum nächsten Neumond (bulan pusit) warten musste. Das hiess aber meiner Geduld zu viel zumuten und ich erklärte Kwing, dass ich mich von Akam Igau, der mit seinen Leuten noch nicht abgereist war, nach Long Tĕpai werde bringen lassen, um dort auf ihn zu warten oder mit Hilfe der Long-Glat weiter nach Long Dĕho zu gehen.
Kwing zeigte sich zwar mit meinem Plane einverstanden, nur billigte er nicht die Begleitung der Mendalam Kajan und versicherte, dass seine eigenen Leute mich nach Long Tĕpai bringen würden, unter Anführung des alten, halb blinden Priesters Bo Jok, der die Long-Glat über den Stand der Dinge aufklären sollte.
Kwings Vorschlag passte mir um so besser, als Akam Igau sich nicht gern noch länger aufgehalten hätte. Er trat denn auch wirklich am 12. April seine Heimreise an, nachdem wir seine ganze Gesellschaft mit Salz versorgt hatten. [418]
Kapitel XVIII.
Äusseres der Bahau—Körperbau—Sinnesorgane—Charakter—Eigentümlichkeiten ihrer Konstitution—Krankheiten der Bahau: Malaria, venerische Krankheiten, Intestinalkrankheiten, Rheumatismus, Kropf, Infektionskrankheiten verschiedener Art, Augenkrankheiten, parasitäre Hautkrankheiten—Wert einer ärztlichen Praxis unter den hingeborenen—Vorstellungen der Bahau von ihrem Körper, ihrem Geist, dem Schlaf und den Krankheiten—Heilmethoden der Priester—Diätetische Mittel—Befolgung ärztlicher Vorschriften—Arzneien der Eingeborenen—Massage, Dampfbäder.
Aus der geringen Bevölkerungsdichte von Mittel-Borneo geht bereits hervor, dass hier Zustände herrschen müssen, die einer normalen Vermehrung der Menschen entgegenwirken. Die schädlichen Faktoren, die hier in Betracht kommen, sind erstens in den Verhältnissen der Umgebung selbst zu suchen, zweitens in dem Umstand, dass sich die Bevölkerung vor den nachteiligen Einflüssen dieser Umgebung nicht zu schützen weiss. Üble Gewohnheiten der Stämme, wie Kopfjägerei und Unsittlichkeit, schädigen eine Vermehrung in weit geringerem Grade.
Die Entwicklung der Bahau und Kĕnja ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass sie Krankheiten mit eigenen, wirksamen Mitteln bekämpfen können; bemerkenswert ist dagegen, dass sowohl bei Bahau als bei Kĕnja in hohem Masse die Vorstellung herrscht, dass sich Krankheiten durch diätetische Mittel bekämpfen lassen. Die Konstitution der Bahau unterstüzt sie im Kampfe gegen Krankheiten nur wenig, daher haben sie unter diesen während ihres ganzen Lebens mehr oder weniger zu leiden. Vor allem sind es Malaria und venerische Krankheiten, Syphilis und Gonorrhoe, welche die Lebenskraft der Eingeborenen untergraben. Die Malaria wirkt schwächend auf den Organismus, die venerischen Krankheiten verhindern ausserdem eine stärkere Vermehrung.
Die Bewohner von Mittel-Borneo sind mittelgross und schmächtig von Gestalt, doch kommen auch schön gebaute Körper bei ihnen vor, [419] überdies werden sie nicht durch Rhachitis und Tuberkulose verunstaltet. Sie gehören zu einer Rasse mit schwarzem, glattem Haupthaar und mittelmässiger bis schwacher Körperbehaarung. Obgleich einzelne Personen auch welliges, bisweilen sogar krauses Haar besitzen und das Braun der Haut auch sehr dunkel sein kann, habe ich auch unter den Jägerstämmen im Innern der Insel nie Menschen mit Spuren des Negertypus gesehen oder von ihnen sprechen hören.
Trotz ihres schmächtigen Körperbaues besitzen die Bahau gut entwickelte Muskeln, mit geringer Neigung zu Fettbildung, sowohl unter der Haut als an einzelnen Körperstellen. Wirklich fette Individuen sah ich nie; die entstellenden Schmerbäuche, die bei Europäern vorkommen, fehlen bei ihnen gänzlich. Auch findet man nur selten Personen mit Muskeln, die von einer Fettschicht verdeckt sind; am ehesten kommt dies bei erwachsenen jungen Frauen vor.
Die Gesichtsform ist oval, häufig rund mit wenig vortretenden Backenknochen. Die Augenspalten, aus denen lebhafte, dunkelbraune Augen hervorschauen, sind nur schwach geöffnet; Personen mit nach Mongolenart schräg noch aussen verlaufenden Augenspalten sieht man nur selten, die meisten bemerkte ich unter den Kĕnjastämmen von Apu Kajan. Eine Hautfalte über dem inneren Augenwinkel fehlt gänzlich.
Die im allgemeinen platte Nase ist gerade; ihre Flügel sind nicht besonders breit. Individuen mit eingestülpter oder mit stark gebogener Nase kommen ebenfalls vor.
Der Mund ist nicht auffallend gross; es giebt selbst Frauen mit hübschem, kleinem Mund; auch sind die Lippen nie sehr dick.
Die Bahau besitzen von Natur ein sehr gut entwickeltes Gebiss, sie misshandeln es aber durch das in letzter Zeit Mode gewordene Absägen, Ausfeilen, und Durchbohren der Zähne. Caries und Missbildungen, die durch Syphilis verursacht werden, sind häufig.
Über die Gliedmassen ist nur zu bemerken, dass sie zum Körper in guten Proportionen stehen; die Arme sind verhältnissmässig etwas länger als bei den Europäern. Die schön gebildete, aber nicht schwere Muskulatur weist mehr auf Geschmeidigkeit und Gewandtheit als auf grosse Kraft.
Hände und Füsse sind stets klein und wohlgebildet, leiden aber viel durch harte Feldarbeit, Verwundung und Krankheit, so dass man bei älteren Leuten häufig Missbildungen antrifft. Bemerkenswert ist der grosse Zwischenraum, der häufig zwischen der ersten und zweiten [420] Zehe vorkommt. Der Winkel, den diese beiden Zehen bilden, kann bis zu 60° betragen.
Die Haut der Baliau und Kĕnja ist in der Jugend meist eher hellgelb als braun, besonders ist dies bei Kindern, die der Sonne noch nicht ausgesetzt gewesen, und bei jungen Mädchen, die sich bei der Feldarbeit durch Kleider vor Sonnenbrand schützen, der Fall. Ganz allgemein wird die spätere dunkle Hautfarbe der Eingeborenen durch die Sonne bewirkt; ständig bedeckte Körperteile, wie die Lendengegend der Männer und die Beckengegend der Frauen, behalten daher stets ihren hellen Ton.
Trotz ihrer teilweisen Bedeckung ist die Haut der Eingeborenen in Wirklichkeit doch allen Einflüssen der Witterung ausgesetzt, wodurch sie ein grosses Widerstandsvermögen erlangt hat. Chronische Hautentzündungen sieht man bei den Baliau nur selten, obgleich sie in Wald und Feld zahlreichen Verwundungen ausgesetzt sind; nicht spezifische Beingeschwüre, wie sie in Europa vorkommen, sind bei ihnen ganz unbekannt. Solange die Haut noch nicht von parasitären Hautkrankheiten betroffen ist, erträgt sie lange Zeit Druck und Reibung, ohne darauf anders als mit leichter Rötung zu reagieren. Auffallend resistent zeigt sich die Haut der Frauen dem Einfluss der Gravidität und der Lactation gegenüber. Die Frauen der Ot-Danum und Kantu am Kapuri besitzen diese Widerstandsfähigkeit in noch höherem Masse, aber auch bei den Frauen der Baliau und Kĕnja beobachtete ich selbst bei hochgradiger Schwangerschaft nur selten Striae; auch erhalten die Frauen ihre früheren Formen nach der Entbindung vollständig wieder zurück. Ebenso lassen die Brüste oft nur an den Warzen erkennen, dass eine Frau bereits genährt hat. Bei meinem ersten Aufenthalt bei den Ot-Danum bewunderte ich die schöne Gestalt einer jungen Frau, welche ihre zwei verschiedenaltrigen Kinder gleichzeitig nährte. Am Mahakam hatte ich einst eine junge Frau, die ich ärztlich behandelte, lange Zeit für kinderlos gehalten, bis sie eines Tages mit einer dreijährigen Tochter bei mir erschien und mir erzählte, dass sie ein zweites Kind bereits verloren habe. Selbst wiederholte Schwangerschaften hinterlassen bei den meisten Frauen wenig Spuren, sowohl auf der Haut als in den Körperformen.
Dass die Bahau eine viel geringere momentane Muskelkraft als die Europäer entwickeln, ist um so auffälliger, als sie von klein auf an Feldarbeit und Jagd gewöhnt sind und keine Lasttiere besitzen, so [421] dass sie auch im Tragen ständig Geübt sind. Sie können z.B. nicht so schwere Gewichte, wie ein ungeübter, mittelstarker Europäer heben; auch tragen sie bei grösseren Entfernungen und schlechten Wegen nicht gern über 20–25 kg schwere Lasten auf dem Rücken. Bemerkenswert ist ferner, dass die Kräfte und die Ausdauer bereits bei 30–35 jährigen Männern abnehmen, daher überlassen diese alle schwerere Arbeit auf der Reise gern den 20 jährigen jungen Leuten.
Die Sinne sind bei der Bevölkerung von Mittel-Borneo im allgemeinen gut entwickelt. Beobachtungen hierüber werden dadurch erschwert, dass Krankheiten häufig das Seh- und Empfindungsvermögen beeinträchtigen. Da nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung Augen besitzt, die weder in jugendlichem noch in späterem Alter einmal längere Zeit krank gewesen sind und hiervon an der Cornea oder Conjunctiva noch Spuren aufweisen, findet man bei ihnen begreiflicher Weise kein besonders scharf entwickeltes Sehvermögen. Überdies haben die Eingeborenen zwischen und in ihren Wäldern gar keine Gelegenheit, sich im Fernsehen zu üben und ihre Sehschärfe hierdurch zu entwickeln.
Der Farbensinn lässt bei den Bahau nichts zu wünschen übrig; dafür spricht in erster Linie ihr feines Gefühl für Farbenharmonie, das sich in ihren schönen Perlenarbeiten äussert, ferner, dass ihre Sprache nicht nur für alle verschiedenen Farben, sondern auch für deren Nuancen besondere Bezeichnungen besitzt. Diese weichen in mancher Hinsicht von denen der Europäer ab. So heisst in der Busang Sprache schwarz “tope totoreg” = verbranntes Blau; “tom gĕnang” = dunkelblau; “kro̱tang” = hellblau, von dem sie an Perlen verschiedene Arten unterscheiden, je nach dem Zweck, für den sie diese benützen, z.B.: “kro̱tang lawong” = hellblau für Kopfbänder. Gelb heisst “nje̥hāng” und hell rehbraun “nje̥hāng te̥bli (gelbrot)”, dunkel rehbraun und dunkelrot werden beide “li” genannt. Weiss = puti; grün = nohom.
Das Tastvermögen der normalen Haut ist bei den Bahau, vielleicht wegen der dicken Epidermis, minder ausgebildet als bei Europäern. Ihre blosse Haut hat für gewöhnlich eine niedrigere Temperatur als die der Weissen, daher vertragen sie bei andauernder Anspannung und Hitze nur schlecht eine stärkere Blutzufuhr und Transpiration und nehmen jede Gelegenheit wahr, um sich zu baden.
Auf Kitzel reagiert ihre ganze Haut weniger stark als die der Europäer, während ihre Handflächen und Fusssohlen wegen der Dicke der Schwielen für Kitzel ganz unempfindlich sind. [422]
Die Bahau besitzen ein gut entwickeltes Gehör; an ihre reit primitiven Mitteln hergestellten Musikinstrumente, wie Flöte und kle̥di, machen sie, was Reinheit des Tones anlangt, grosse Ansprüche. Ihre Lieder erscheinen auch einem europäischen Ohr melodisch. Ihre Gonge tönen uns zu laut, aber auch bei diesen bestimmt hauptsächlich die Reinheit des Tones den Wert des Instruments.
Ob der Geruchssinn bei den Bahau feiner ausgebildet ist als bei den Europäern, wage ich weder aus der Tatsache, dass sie für unangenehme Gerüche, wie die von Leichen und Unrat, sehr empfindlich sind, noch daraus, dass sie bei unbekannten Waldfrüchten nach dem Geruch bestimmen, ob sie giftig oder nicht giftig sind, zu entscheiden; denn die erste Eigenschaft steht mit ihrer allgemeinen psychischen Überempfindlichkeit in Zusammenhang und die zweite beruht wahrscheinlich hauptsächlich auf Erfahrung und Übung.
Die wohlriechenden Gräser, Blätter und Blüten, mit denen sich junge Männer und Mädchen für einander schmücken, duften nach unserem Geschmack nicht immer angenehm; die jungen Leute müssen eben mit den Erzeugnissen ihrer Umgebung vorlieb nehmen. Die Bahau schätzen aber auch europäische Parfümerieen, die bei ihnen in schlechtester Qualität von den Malaien eingeführt werden. Dass auch die Nasen der Bahau für die verschiedenen Sorten unserer Parfümerieen ein scharfes Unterscheidungsvermögen besitzen, erfuhr ich einst am Mendalam, als ich Paja, Akam Igaus Tochter, eine Flasche Eau de Cologne N°. 4711 schenkte. Ihre Freundin, die sich gleich darauf ebenfalls eine Flasche erbat, suchte ich mit etwas gewöhnlicher Wasch-Eau de Cologne abzufertigen; nachdem die beiden aber zu Hause gemeinsam den Inhalt ihrer Flaschen geprüft und verglichen hatten, kam die Freundin gleich wieder zurück und erklärte, dass ihre Eau de Cologne schlechter sei als die von Paja.
Die Bahau sind sehr sensible Naturen und daher Gemütsbewegungen aller Art sehr zugänglich. Auch bei freudigen Erregungen steigen ihnen Tränen in die Augen; einst sah ich eine Frau sogar beim Anhören eines Grammophons weinen.
Schmerzen können sie nur sehr schwer ertragen, daher haben sie auch mit jedem Leidenden, besonders wenn er zur Familie gehört, grosses Mitleid. Sobald ein Kind oder ein Erwachsener auch nur scheinbar ernstlich krank ist, nehmen alle Angehörigen an seinen Leiden so lebhaften Anteil, dass sie ihre Arbeit auf dem Felde und [423] im Hause ruhen lassen und bei dem Kranken bleiben, auch wenn sie nicht helfen können. Dies geschieht recht häufig, da die Bahau auch bei unbedeutenden Leiden gleich nachgeben. Man muss daher im Verkehr mit den Eingeborenen vor allem ihrer grossen Sensibilität Rechnung tragen.
Wie leicht sie aus Überempfindlichkeit und heftiger Gemütsbewegung bisweilen den Kopf verlieren können, mögen folgende Beispiele zeigen. Als sich Kwing Irang einst mit einem junge Manne, namens Arān, im Walde befand, wurde er durch ein herabfallendes Stück Holz getroffen und begann ernstlich zu bluten. Obgleich die beiden sich dicht beim Hause in einem wohlbekannten Walde befanden, verirrte sich Arān, der Hilfe suchen ging, doch zwei Mal und verlor dazu seinen Speer. Der Unfall, an dem er durchaus nicht Schuld war, ging ihm so nahe, dass man ihn später nur mit Mühe dazu bringen konnte, ins Haus zurückzukehren. Er beruhigte sich erst am folgenden Tage, nachdem er sich gut ausgeschlafen hatte.
Nachdem Bang Lawing, der jetzige Häuptling der Mahakam Kajan, die Leiche seiner Mutter in Batu Baung beigesetzt hatte, trennte er sich von der Gesellschaft und lief stundenlang durch den pfadlosen Wald nach Hause, statt mit den anderen den Fluss hinabzufahren. Später konnte er nicht angeben, wie er nach Hause gelangt war.
Empfinden die Bahau Scham, so erröten sie oft bis tief auf die Brust. Auch kann man sie vor ihrer Umgebung leicht in Verlegenheit (hae̱) bringen. Ich benützte diese Eigenschaft bei Mann und Frau öfters, um sie zum Halten ihres Versprechens und zur Pflichterfüllung zu bringen. Auf diesem feinen Empfinden, das sich in der Furcht vor der öffentlichen Meinung äussert, ist auch die adat der Bahau hauptsächlich begründet.
Sie besitzen einen ruhig heiteren und wenig zu heftigen Äusserungen geneigten Charakter; sie lieben den Scherz und die Fröhlichkeit und singen und tanzen daher gern miteinander; auch ältere Männer nehmen an den Kriegstänzen Teil und an Festtagen sieht man auch alte Frauen mit den jungen tanzen und singen. Zwar beängstigt sie der Glaube an die Existenz zahlreicher, sehr böser Geister, er drückt sie aber nicht nieder. Man hört sie auch zu Hause häufiger lachen als weinen. Da sie selbst nie heftig werden, flösst ihnen die Heftigkeit anderer Angst ein.
Die Bewohner Borneos zeigen in Bezug auf ihre Konstitution einigt: Eigentümlichkeiten, die sich aus der Wirkung ihres Klimas auf viele [424] Generationen begreifen lassen. Diese Eigentümlichkeiten äussern sich in der Art und Weise, wie sie auf verschiedene Arzneien reagieren, ferner in der grossen Vitalität ihrer Gewebe bei Verwundungen. Die Behandlung von Malariakranken zeigte mir, dass Chinin eine sehr schnelle Wirkung bei ihnen hervorruft. Auch in den ernstesten Fällen bin ich nur selten gezwungen gewesen, mehr als 1 gr Chinin per Tag und per Mal zu erteilen und selbst bei stark chronischen Malariakranken rief diese Dosis in wenigen Tagen eine Besserung hervor. Auf meiner ersten Reise beschränkte ich mich vorsichtshalber auf ½ bis ¾ gr per Tag, als ich aber später keine nachteiligen Folgen bemerkte, gab ich Erwachsenen stets 1 gr per Tag. Um den gleichen Effekt bei Europäern zu erzielen fand ich während des Feldzuges auf der Insel Lombok selbst 3 gr per Mal nicht immer genügend.
Hieraus ersieht man, dass die Konstitution der Dajak bei der Bekämpfung einer Infektion viel stärker mitwirkt als bei Europäern. Die Beobachtung von Prof. R. Koch auf Neu-Guinea, dass erwachsene Eingeborene gegen eine Malariainfektion immun werden und dass diese nur auf Kinder einwirke, stimmt mit der meinigen also teilweise überein. Das Verhalten der Dajak spricht gegen eine vollkommene Immunität der Erwachsenen gegen Malariainfektion. Wie weiter unten ausgeführt werden wird, konnte ich mich bereits in Sambas davon überzeugen, dass beinahe sämtliche Kinder unter i o Jahren eine geschwollene Malariamilz zeigten, welche bei Erwachsenen zwar seltener aber ebenfalls zu finden war. Schon das häufige Vorkommen akuter und chronischer Malaria bei Erwachsenen spricht gegen vollständige Immunität. Dass bei den Dajak in akuten und chronischen Fällen eine geringe Dosis Chinin bereits eine so starke Wirkung erzielt, weist jedoch auf eine partielle Immunität, die sie sich vielleicht durch die in der Kindheit bestandenen Malariaanfälle erworben haben. Hierauf deutet auch die Tatsache, dass ich unter mehreren Tausend Patienten keinen einzigen mit perniziösen Erscheinungen, wie Coma, schweren Icterus, Nervenanfällen u.s.w. auf Malariaanfälle reagieren sah.
Die Wundheilung tritt bei den Bahau, wie schon erwähnt, schneller und vollkommener als bei Europäern ein; hiervon konnte ich mich häufig überzeugen:
Einst brachte man mir einen Dajak, dem von einem Dorfgenossen, der ihn auf der Jagd für ein Wildschwein angesehen hatte, die Tibia auf 4 cm Länge in Splitter zerschossen worden war. Als man [425] mir den Mann am achten Tage nach dem Unfall brachte, war die ganze grosse Wunde in eine septisch infizierte Eiterhöhle verwandelt, in welche die zersplitterten Enden der Tibia hineinragten; die Kugel, die ich unter der Haut an der anderen Seite hindurchfühlte, entfernte ich mittelst eines Hautschnittes. Eine gründliche Desinfektion, die Fortnahme der losen Knochensplitter, eine Drainage und Applikation von Schienen zur Immobilisierung genügten, um den Mann innerhalb kurzer Zeit körperlich wieder herzustellen und das Bein, mit Verkürzung um 1 cm, durch Bildung eines grossen Callus, wieder brauchbar zu machen. Nach einem Jahr war von einer Funktionsstörung nichts mehr zu spüren.
Bei meinem ersten Besuch in Tandjong Karang hinterliess ich dort eine zwölfjährige Patientin, die, nach einem syphilitischen Ulcus an der Kniekehle, der einen Durchschnitt von 10 cm und 2 cm Tiefe zeigte, eine gut granulierte Wunde zurückbehalten hatte. Ich hatte dem Mädchen eine Jodkalilösung zu weiterem Gebrauch übergeben und glaubte sie, als ich mich bei meinem zweiten Besuch, 1½ Jahre später, nach ihr erkundigte, als ein Mädchen mit einem krummen Bein charakterisieren zu müssen. Keiner kannte jedoch ein solches Mädchen. Zu meinem Erstaunen sah ich die Kleine später mit einem ganz geraden, gut beweglichen Bein umhergehen, obgleich die ganze Kniekehle mit Narben bedeckt war. Bei einem europäischen Kinde wäre das Resultat ein ganz anderes gewesen, die Narbenbildung hätte zweifellos eine Kontraktur zur Folge gehabt.
Bald nach Beginn einer Praxis unter den Stämmen von Mittel-Borneo wird man gewahr, dass einzelne Krankheitsgruppen bei ihnen alle übrigen in den Hintergrund drängen; es sind dies: Malaria, venerische Krankheiten (Syphilis und Gonorrhoe) und parasitäre Hautkrankheiten, welch letztere auch auf den anderen Inseln des indischen Archipels verbreitet sind. Eingeschleppte Infektionskrankheiten, wie Pocken und asiatische Cholera, treten bei diesen in grosser Abgeschiedenheit wohnenden Stämmen nur selten in das allgemeine Krankheitsbild.
Unter den Bahau, die ein 250 m ü.d.M. gelegenes Bergland bewohnen, bestehen weitaus die meisten Patienten, die einem täglich zur Behandlung zugeführt werden, aus Malariakranken. Diese Erscheinung erklärt sich daraus, dass streng genommen alle auf den Körper einwirkenden schädlichen Einflüsse das labile Gleichgewicht, in welchem sich viele Personen zeitweilig oder dauernd der Malariainfektion gegen [426] über befinden, zerstören können. Da die Faktoren, welche ein Ausbrechen der Malaria veranlassen, sehr mannigfaltig und zahlreich sind, ist das häufige Auftreten dieser Krankheit bei den Dajak begreiflich. Nach meiner Erfahrung wird die Malaria hauptsächlich durch folgende Ursachen hervorgerufen: Übermüdung, kaltes Baden, Indigestion, Erkältungen mit Rheumatismus und Husten, Verwundungen, ferner durch andere Infektionen, wie Influenza und Anthrax. Einen Beweis dafür, dass die genannten Faktoren wirklich ein Ausbrechen des Fiebers veranlassen, indem sie den Körper schwächen und dadurch für Malariainfektion empfänglich machen, fand ich darin, dass es mir stets glückte, das Fieber mit einer temporären Dosis Chinin bleibend zu vertreiben, während die ursprünglichen Krankheiten wie Indigestion, Influenza u.s.w. unabhängig von der Malaria ihren normalen Verlauf nahmen. Dass kaltes Baden, besonders nach Erhitzung, sowohl bei Bahau und Javanern als bei Europäern, innerhalb 6 Stunden einen Malariaanfall zur Folge hat, beobachtete ich zu wiederholten Malen.
Einen anschaulichen Eindruck vom schwächenden Einfluss der Malaria auf die Bevölkerung erhielt ich bei einer Untersuchung ihres Verbreitungsbezirkes im Sultanat von Sambas an der Westküste Borneos, wo ich 3 Jahre als Arzt tätig gewesen bin. Die Abwesenheit der Malaria in den Morastgegenden längs der grossen Flüsse auch bei intensiver Bodenkultur, wie Anlagen von Plantagen, und ihre Anwesenheit in einigen dichtbei auf Sandboden gelegenen Dörfern hatte damals meine Aufmerksamkeit erregt. Die Reisen, die ich zum Zweck von Impfinspektionen unternehmen musste, führten mich in die verschiedensten Teile des Sultanates und gaben mir Gelegenheit, ungefähr 3000 Kinder unter 10 Jahren zu untersuchen. Das Resultat dieser Beobachtungen war, dass alle Kinder aus den Hügel- und Gebirgsgegenden Milz- und Lebertumoren, in diesem Fall ein Zeichen chronischer Malariainfektion, besassen, während die aus den Morastebenen auf Meereshöhe nur da, wo der Boden sandhaltig war, wie in der Dünengegend nördlich von Sambas und am Fuss alteinstehender, aus den Morästen hervorragender Berge, eine vergrösserte Milz zeigten. Die gleichen Beobachtungen sind übrigens bereits an anderen Orten gemacht worden, es ist z.B. bekannt, dass die Morastgegenden bei Pontianak und Bandjarmasin auf Borneo und bei Palembang auf Sumatra viel weniger durch Malaria zu leiden haben als die Hügel- und Gebirgsländer derselben Inseln. [427]
Der gleiche Unterschied machte sich auch im Aussehen der Bevölkerung bemerkbar, sobald ich Gelegenheit hatte, diejenige in Gegenden, welche von Malaria infiziert waren, mit einer anderen in nichtinfizierter Gegend unter im übrigen gleichen Umständen zu vergleichen. Am meisten fiel mir dies am Tĕbĕrau, einem Nebenfluss des kleinen Sambas, unweit der Hauptstadt Sambas auf, wo zwei von Malaien bewohnte Dörfer keine Stunde von einander entfernt liegen; das eine befindet sich auf einem Morast, das andere auf einer 40 m hohen Hügelreihe. Unter 12 Kindern des ersten Dorfes hatte 1, unter 25 des zweiten hatten 20 eine harte Milz, die unter dem Rippenbogen hervortrat. Letztere hatten ausserdem, wie ihre Eltern, eine schwächliche Konstitution und ein kränkliches Aussehen, im Gegensatz zum frischen, kräftigen Aussehen ihrer Nachbarn im Morastdorfe.1
Übereinstimmend mit diesen Beobachtungen lieferten die Statistiken des Sultans von Sambas für die Bewohner der Ebene gegenüber denen der Hügel eine mittlere Lebensdauer im Verhältnis 3 : 2—ein sprechender Beweis für den schädigenden Einfluss der Malaria auf die Lebenskraft der Bevölkerung. Dass die gleichen Verhältnisse auch in Mittel-Borneo herrschen, davon habe ich mich während eines beinahe 5 jährigen Aufenthaltes inmitten der dortigen Bevölkerung, bei der ich zahllose Malariafälle akuter und chronischer Art zu behandeln hatte, überzeugen können. Bei den dort herrschenden Zuständen sind die meisten Personen während einer längeren oder kürzeren Lebensperiode fieberkrank, was auch auf die noch ungeborenen Nachkommen von schwächendem Einfluss sein muss.
Die verbreitetste Form, unter welcher die Malaria bei den Bahau auftritt, ist die der Quotidiana intermittens, welche über kurz oder lang in die der Quotidiana remittens übergeht. Viel seltener sind Fälle, welche zur Continua gehören. Auch gab nur eine kleine Minderheit meiner Patienten an, dass sie jeden 2ten Tag einen Fieberanfall zu überstehen hatte.
Charakteristisch für die Malaria der Bahau ist, dass die Kranken nach einem Anfall nicht transpirieren, selbst wenn eine deutliche Intermission eingetreten war. Erst wenn der Anfall durch Chinin vollständig gehoben worden, tritt Transpiration als Zeichen endgültiger Besserung ein. Sie selbst wissen das auch sehr gut. Durch Malaria [428] verursachte plötzliche Todesfälle habe ich nicht beobachtet; ebensowenig Fälle sehr perniziöser Art; die Malaria trägt in Mittel-Borneo stets den Charakter eines subakuten oder chronischen Leidens.
Bei kleinen Kindern geht die letzte Malariaperiode in der Regel in eine Continua mit oder ohne Diarrhoe über; bei älteren Personen treten gegen das Ende hauptsächlich Erbrechen und Diarrhoe auf, wobei die Patienten bei geringer Temperaturerhöhung schnell abnehmen und sterben. In der Regel sind die Kranken im Beginn dieses Stadiums durch vorsichtiges Verabfolgen von Laudanum und dann von Chinin noch zu retten.
Als günstigsten Zeitpunkt für den täglichen Gebrauch einer Dosis Chinin erwies sich der, in welchem sich der Patient am wohlsten fühlte und seine Temperatur am niedrigsten war. Eine Verabreichung mehrerer Dosen Chinin per Tag in Fällen einer undeutlichen Intermission hatte selten guten Erfolg.
Fälle von Malaria larvata beobachtete ich zwei Mal in Form von periodisch auftretender Diarrhoe, die auch nach monatelanger Dauer durch Chinin in kurzer Zeit kuriert werden konnte. Einmal wurde ein junger Mann, der monatelang zu ängstlich gewesen war, um sich mir zu nähern, durch jeden Abend wiederkehrende Augenblutungen zu mir getrieben. Da man ihm Blindheit prophezeit hatte, entschloss er sich, wenn auch voller Angst, zu mir zu kommen. Durch die Periodizität der Blutungen aufmerksam geworden, gab ich ihm 6 Stunden vor dem gewöhnlichen Eintritt der Blutungen 1 gr Chinin ein mit dem Resultat, dass die Blutungen auf hörten.
Als Beispiele für den Verlauf und die Behandlung typischer Malariafälle unter den Bahau mögen die folgenden dienen:
Auf meiner ersten Reise brachte man mir einen 11 jährigen Ulu-Ajar Dajak, der das Jahr vorher so krank gewesen war, dass er sich nicht mehr erheben konnte. Obgleich er augenblicklich nicht mehr so schwach war, litt er doch sehr durch asthmatische Anfälle und schmerzhaften Husten. Sein Körper war mager und unentwickelt, und zur Arbeit war er nicht fähig. Sein Thorax war der eines Emphysematikers, auch litt er stark an Dyspnoe. Der obere Brustteil war stark erweitert und bei jedem Atemzuge kontrahierten sich die beiden Sternocleido-mastoidei und verursachten dabei ein Hervortreten ihrer Wülste unter der Haut. Die Herzdämpfung hatte sich bis auf die linke Seite des Sternum beschränkt. Bei der Auskultation war überall [429] ein Röcheln zu vernehmen, das eine Entzündung der Bronchien anzeigte. In der Herzgegend war kein anormales Geräusch hörbar, nur das diastolische Geräusch der Lungenarterie war lauter als gewöhnlich. Die vergrösserte Milz reichte bis auf 4½ cm unterhalb der Rippen herab, die Leber bis auf 5½ cm. Anfangs erschien es mir sehr schwierig, die Störungen der Respirationsorgane zu beseitigen, auch fürchtete ich, das Vertrauen der Eingeborenen, nach deren Ansicht die Medizin alles und so schnell als möglich heilen muss, zu verlieren. In Anbetracht der Hypertrophie der Bauchorgane beschloss ich jedoch, meinem Kranken 1½ gr Chinin einzugeben, eine Quantität, die bitter genug war, um eine suggestive Wirkung auszuüben. Zu seinem Besten trieb den Knaben die Neugier jeden Morgen nach meiner Hütte und so konnte ich ihm täglich seine Dosis verabfolgen.
Nach 10 Tagen erzählte der Knabe, dass die Atmungsbeschwerden sich gebessert hätten, auch konnte ich mich selbst von dem günstigen Einfluss der Behandlung überzeugen. Die Milz war nicht mehr fühlbar; die Leber hatte sich bis auf Fingersbreite unterhalb des Rippenbogens zurückgezogen; die Auskultation ergab nur hie und da ein schwaches Rasseln.
In der folgenden Periode erhielt der Patient seine Arznei nur in grossen Zwischenräumen; aber seine Lebenskräfte hatten bereits die Oberhand gewonnen, so dass er körperlich vollständig wiederhergestellt wurde. Nach einigen Wochen war auch die Erweiterung des Thorax verschwunden, das Spiel der Sterno-mastoide war beim Atmen nicht mehr sichtbar; die Herzdämpfung war wieder normal und auch die Auskultation ergab nichts Krankhaftes. Nur die asthmatischen Anfälle nachts hatten in dieser Periode noch nicht völlig aufgehört.
Einen anderen interessanten Malariafall bot mir ein 8 jähriger Knabe, der mir durch das enorme Volumen seines Bauches aufgefallen war. Die Haut des Abdomens war infolge der starken Ausdehnung glänzend geworden und der Leibesumfang betrug 78 cm. Die Anamnese ergab nur einige Fieberanfälle. Der Knabe klagte augenblicklich nur über Atemnot, die ihm Arbeit und Spiel unmöglich machte.
Die Untersuchung ergab eine Milz von erstaunlicher Grösse und Härte, die nach vorn bis zum Nabel, nach unten bis zu 20 cm unterhalb des Rippenbogens reichte. Auch die Leber war hart und 11 cm tiefer als gewöhnlich fühlbar; der obere Teil des Herzens hatte die normale Stellung verloren und seine Spitze schlug im 3ten Intercostalraume. [430]
Am 4. März begann ich, dem Patienten 1/4 gr Chinin einzugeben; ich hatte aber wenig Hoffnung, dass meine Behandlung auf derartig degenerierte Organe einen genügenden Einfluss haben könnte. Der kleine Wilde besass indessen mehr Ausdauer als die meisten zivilisierten Leute und kam während eines Monats täglich, um seine bittere Arznei zu schlucken.
Am 4. April fühlte er sich selbst gesund; seine Milz war bis auf 5 cm weiter nach oben eingeschrumpft; die Leber war kaum noch unterhalb der Rippen fühlbar; das Herz schlug im 4ten Intercostalraume.
Bei meiner Abreise am 28. April war die Milz als sehr harte, glatte Geschwulst nur noch 9 cm unterhalb der Rippen fühlbar; die Leber war kaum bemerkbar und der Leibesumfang war auf 63 cm zurückgegangen. Der Knabe fühlte sich ebenso wohl und munter wie seine Kameraden und arbeitete schon seit einiger Zeit auf dem Felde.
Ein 3ter Fall betraf einen ebenfalls 8 jährigen Patienten, der körperlich sehr zurückgeblieben war. Auch dieser Knabe hatte früher öfters Fieberanfälle durchgemacht; augenblicklich litt er jedoch hauptsächlich an Dyspnoe. Sein Bauch war geschwollen; die Milz bis 4 cm unterhalb der Rippen fühlbar und die Leber reichte 3 cm weit herab. Während 14 Tage erhielt auch dieser Kranke täglich 1/4 gr Chinin, worauf seine Organe den normalen Umfang zurückgewannen und seine Gesundheit vollständig wiederhergestellt wurde.
Ein 18 jähriger Mann litt bereits seit 3 Monaten ständig an Fieberanfällen, so dass er fast nicht mehr gehen konnte. Er weigerte sich anfangs, die bittere Medizin zu nehmen und während einiger Wochen sah ich ihn täglich magerer werden. Als er endlich doch erschien, konstatierte ich bei ihm eine Leber, die bis auf 4 cm unterhalb der Rippen herabreichte. Nach einem neuen Anfall gab ich ihm in zwei Malen 1 gr Chinin und am folgenden Tage die gleiche Dosis. Die Anfälle hörten auf, aber in Anbetracht der langen Dauer seiner Krankheit erschien mir eine völlige Wiederherstellung unwahrscheinlich, als er mir am dritten Tage selbst eine weitere Behandlung für unnütz erklärte. Zu meinem Erstaunen war in der Tat eine rapide Besserung in seinem Zustande eingetreten; noch vor meiner Abreise erhielt er seine frühere Gesundheit völlig wieder zurück.
In Sambas war einst der Malaie, der mir auf allen Inspektionsreisen als Führer diente, von der Malaria ergriffen worden. Seine Familie rief mich erst nach einigen Tagen, als der Alte bereits dem [431] Sterben nahe war, zu Hilfe. Mit vieler Mühe gelang es mir, ihm in einem fieberfreien Augenblick eine Lösung von 1 gr Chinin beizubringen. Am anderen Tage sass der Patient bereits auf seiner Matratze. Obgleich seine Wiederherstellung nur langsam von statten ging, gelang sie doch vollständig; nur behielt die Milz in diesem Fall stets das vergrösserte Volumen. Der Mann hatte sein Leben lang als Führer durch das ganze Sultanat gedient und dabei stets an Fieber gelitten.
Nach der Malaria haben die venerischen Krankheiten auf das Wohlergehen der Stämme von Mittel-Borneo den verderblichsten Einfluss.
Obgleich ich unter den Eingeborenen am oberen Kapuri und oberen Mahakam Syphilis und Gonorrhoe in hohem Masse verbreitet fand, gelang es mir doch nicht, das dritte Leiden, Ulcus urolle, welches mir wegen der lokalen Schäden, die es verursachen kann, in Laufe einer jahrelangen Praxis nicht hätte verborgen bleiben können, zu konstatieren.
Patienten mit syphilitischen Infektionen stellten sich dagegen täglich bei mir ein und zwar ausschliesslich solche mit der tertiären Form von Haut- und Knochenkrankheiten. Trotzdem ich meine auf Syphilis behandelten Patienten nach Hunderten zählen kann, erinnere ich mich nicht, jemals eine primäre Affektion oder ausschliesslich sekundäre Erscheinungen beobachtet zu haben. Unter den Folgeerscheinungen der Infektion fehlten bei den Patienten sekundäre Kehlleiden, Roseola, papulöse und andere sekundäre Exanthemen, sowie Alopecia syphilitica. Condylomen an Mund und Anus waren bei Erwachsenen sehr selten, eher noch bei kleinen Kindern zu finden. Zweifellose Fälle visceraler Syphilis kamen ebenfalls selten in meine Behandlung. Sicher findet sich also unter den Bahau die Form der Syphilis vor, welche man mangels eines besseren Namens “endemische Syphilis” nennt. Diese Form der Syphilis fand ich bei den Ulu-Ajar Dajak südlich vom oberen Kapuas und nördlich von ihnen bei den Kajan; bei den Kajan am oberen Mahakam war sogar jede Familie mit ihr behaftet. Durch Annahme einer ausschliesslich erblichen Verbreitung bei den letzteren liesse sich hier das Auftreten der tertiären Erscheinungen als hereditäre Syphilis erklären, ihr weniger häufiges Vorkommen bei den benachbarten Stämmen jedoch macht diese Erklärung wieder zweifelhaft; übrigens hielt ich mich bei diesen Stämmen nicht lange genug auf, als dass mir nicht viele Fälle entgangen sein könnten.
Völlig unerklärt blieben aber nach dieser Auffassung die Syphilisfälle, wie sie sich unter den Kĕnjastämmen zeigten. Diese Fälle trugen, [432] abgesehen davon, dass ihr Einfluss auf die Knochen weniger verderblich schien, den gleichen Charakter wie am Mahakam, ihre Verbreitung war aber eine minder allgemeine, auch sah ich keine weiteren Krankheitserscheinungen bei den Familiengliedern, so dass von einer Verbreitung durch Vererbung keine Rede sein konnte. Man muss daher annehmen, dass sich die Syphilis unter den Bahau- und Kĕnjastämmen von Person auf Person übertragen lässt, ohne dass sie vorher primäre oder die gewöhnlichen sekundären Affektionen veranlasst.
Diese eigenartige Erscheinungsform der Syphilis in Mittel-Borneo stimmt überein mit dem, was über Tety von Madagaskar, Radesyge von Norwegen, Spirokolon während der Zeit der griechischen Freiheitskriege 1820–1825, Belegh in Arabien (Palgrave) und die endemische Syphilis in Litauen und Istrien bekannt ist. Dass es sich bei den Bahau in der Tat um Syphilis handelte, bewiesen nicht nur die verschiedensten Erscheinungsformen, sondern auch die Wirkungen einer therapeutischen Behandlung mit Jodkali- und Quecksilberpräparaten. Gleichwie man bei obengenannten Endemieen oft nur an eine Übertragung durch aussengeschlechtlichen Verkehr denken konnte, wird man auch für die Syphilis der Bahau und Kĕnja die gleichen Ursachen anzunehmen gezwungen.
Das Lebensalter, in welchem luetische Anzeichen auftreten, giebt durchaus keine Anhaltspunkte für die hereditäre oder nicht hereditäre Natur der Krankheit. Viele von luetischen Müttern geborene Kinder gaben in den ersten Wochen durch Condylome, Nasen- und Ohrkrankheiten und Ulcera der Haut den Beweis, infiziert worden zu sein; dagegen zeigten sich 20–30 Jahre alte Individuen mit tertiär luetischen Erscheinungen, die eben auftraten, ohne dass die Anamnese oder Spuren auf der Haut eine frühere Infektion anzeigten.
Die Syphilis äussert sich bei den Bahau am häufigsten als “pră huwat” (pra = Schmerz, huwat = Körper), Schmerzen in den Gliedern, besonders in Armen und Beinen. Diese Erscheinung geht einem lokalen Ausbruch der Krankheit voraus, bleibt nach einer Behandlung bisweilen noch bestehen und tritt bei Kindern und Erwachsenen gleich stark auf. Die Gliederschmerzen sind oft von einem kachektischen Aussehen des Patienten begleitet. Bisweilen ist nur ein Glied, bisweilen sind alle Glieder geschwollen, häufig aber auch keines. Meist ist das Kniegelenk angegriffen, dabei tritt Schwellung der Bänder auf; Hydrops zeigt sich nicht häufig. [433]
Führt die Schwellung auch zu Geschwürbildungen, was selten der Fall ist, so veranlasst sie langdauernde Fisteln; doch können durch Zerfall und Neubildung von Knochen grosse Veränderungen mit Subluxation stattfinden.
In einem einzigen Falle beobachtete ich bei einem Manne Jahre andauernde Gliederschmerzen ohne begleitende lokale Abweichungen; der Patient sah etwas kachektisch aus und war arbeitsunfähig, empfand aber nach Gebrauch von Jodkali eine baldige Besserung seines Leidens.
Die übrigen Erscheinungen allgemeiner Art: Schlaf- und Appetitlosigkeit, Abmagerung und Schwäche müssen als Folgen der lokalen Leiden aufgefasst werden. Übrigens fiel es mir auf, wie wenig Einfluss eine oft jahrelange Anwesenheit einer ausgedehnten Entzündung auf das Allgemeinbefinden der Patienten übte.
Die Lokalsymptome bestanden hauptsächlich in tubero-ulzerösen Hautand Knochenentzündungen, derselben Art wie bei Europäern, nur veranlassen sie bei den Bahau wegen der äusserst mangelhaften Behandlung, die sie erfahren, bisweilen wahre Verwüstungen. Die Bahau nennen diese Krankheit “bāk” und die Körperschmerzen “laui.”
Vor allem werden die Knochen der Nase und des Palatum darum bei ihnen angegriffen und zwar mit der gewöhnlichen Folge von Ozaena, Sattelnase und Kommunikation der Nasen- und Mundhöhle. In höherem oder geringerem Grade werden auch alle übrigen Knochen der Sitz osteo-periostaler Entzündungen. Bemerkenswert ist die leichte Verletzbarkeit des Gebisses, das oft so stark von Caries angegriffen wird, dass Männer und Frauen bereits in jugendlichem Alter einen Teil ihrer Zähne verloren haben. Einige sind bereits mit 30 Jahren völlig zahnlos. Hutchingsonsche Zähne konnte ich bei Erwachsenen, da sie ihre Zähne absägen, nicht konstatieren, wohl aber bei der ersten Dentition der Kinder.
Unter den zahlreichen in Borneo herrschenden Augenkrankheiten bemerkte ich nur höchst selten luetische Keratitis und Iritis. Ob das sehr häufige Vorkommen von Star einer luetischen Infektion zugeschrieben werden muss, konnte ich, da sich mir keine Gelegenheit zur Behandlung prägnanter Fälle bot, nicht weiter untersuchen.
Häufig machte sich Syphilis an den Knochen des Thorax bemerkbar, wo sie hauptsächlich periostale Wucherungen, Gummata, veranlasste, welche bisweilen in Erweichungen übergingen und unter der Haut kalte Abszesse bildeten oder auch aufbrachen und dann ausgedehnte [434] Ulzerationen bewirkten. Auch oberflächliche Ulzera der Haut kommen vor, z.B. an den Mammae. Zu den verbreitetsten Gummata gehören die der obersten Extremitäten, welche osteo-periostal, intramuskulär und in der Haut selbst vorkommen. Während die periostalen Entzündungen fusiforme Geschwülste veranlassen, zeigen die Ulzera der Haut den typischen kraterförmigen Bau der ulzerierenden Gummata mit grauem Boden und der gleichen Neigung zu halbmondförmiger Ausbreitung wie bei der europäischen Lues. Durch ihren Übergang auf Muskeln und Bänder verursachen diese Ulzera im Lauf der Jahre oft tiefgreifende Zerstörungen, die nach spontaner oder durch Behandlung bewirkter Genesung, je nach ihrer Stellung, durch Schrumpfen und Zerstören der Bänder Kontrakturen der Gliedmassen und durch Verkürzung der Muskeln Kontrakturen der Hände und Finger nach sich ziehen.
An den unteren Extremitäten lokalisierten sich weitaus die meisten Affektionen am Unterschenkel und zwar an der Tibia, welche öfters durch aktuelle oder bereits überstandene Periostitis bewirkte Verbildungen aufweist. Durch Fehlen geeigneter Behandlung dauert dieser Prozess oft Jahre und geht dann auf Haut, Zellgewebe und Muskeln über und bildet, falls Genesung eintritt, eine Gewebemasse, in der das subkutane Zellgewebe und die Haut durch Narbengewebe ersetzt sind und die Muskeln, gleichwie an den Armen, atrophiert und verkürzt sind, so dass der Fuss einen verkehrten Stand einnimmt und die Zehen nach oben und rückwärts gezogen werden.
Luetische Orchitis habe ich niemals gesehen; vielleicht begaben sich die betreffenden Kranken aus Schamgefühl nicht in meine Behandlung.
Selten ist es mir geglückt, viszerale luetische Leiden mit Sicherheit zu diagnostizieren. Syphilitische Degeneration der Leber, wobei diese vergrössert, resistent, höckerig und empfindlich wird, beobachtete ich mehrmals. Nervenleiden, die auf Syphilis zurückzuführen waren, begegnete ich nie, ebensowenig Tabetikern.
Von den gewöhnlichen tertiären Hautausschlägen kamen mir nur wenige Formen unter die Augen. In einem einzigen Falle von Rupia syphilitica, in welchem Jodkalium wirkungslos blieb, hatte innerlicher Gebrauch von Quecksilberpräparaten baldige Genesung zur Folge.
Die hereditäre Syphilis äussert sich bei Säuglingen in etwas anderer Form. Diese leiden meist an Condylomen in und am Munde und am Anus, luetischer Rhinitis, Otorrhoe und später an Missbildungen der [435] Zähne. Letztere zeigen nicht selten die Hutchinsonsche Form und bieten der Caries, die sich in den Vertiefungen ihrer Oberfläche festsetzt, einen besonders günstigen Angriffspunkt; daher bröckeln bereits bei sehr kleinen Kindern die Schneidezähne ab. Die Condylomen um den Mund veranlassen durch Verwahrlosung häufig so tiefe Ulzerationen, dass viele das ganze Leben hindurch’ davon Narben behalten. Entstehen derartige Leiden einige Monate nach der Geburt des Kindes, so ziehen sie, wie auch gleichartige Knochenentzündungen, das Allgemeinbefinden des Kindes nicht ernstlich in Mitleidenschaft. Die kleinen Patienten scheinen auch nur wenig oder gar keinen Schmerz zu empfinden und, da kein Fieber eintritt, bleiben Esslust und Schlaf erhalten. Auch bei den Kindern der Bahau ist der supra-epiphysäre Knorpel an den langen Knochen häufig der Sitz des syphilitischen Prozesses; der der Handknochen erinnert dann an eine Spina ventosa, der der Extremitäten an eine Gelenkentzündung. Die trotz starker Schwellung oft ungehinderte Beweglichkeit der Gelenke bringt einen jedoch bald auf die richtige Spur.
Während Ulcus molle, wie erwähnt, bei den Bahau nicht vorkommt, ist Gonorrhoe stark verbreitet. Unter den verhängnisvollen Folgen dieser Krankheit leidet besonders die Bevölkerung am oberen Kapuas, und zwar weniger die Männer als die Frauen, die häufig über nach der Heirat aufgetretene Leucorrhoe und Metroraghia mit schmerzhaften Menses klagten. Auch beobachtete ich heftige Conjunctivitides, welche sich hierauf zurückführen liessen.
Am oberen Mahakam ist Gonorrhoe minder allgemein verbreitet, auch fand ich bei den Männern keine ernsteren Komplikationen.
Von einer Malariainfektion unabhängige Intestinalleiden ernster Art treten bei den Bahau selten auf. Obgleich ihre Nahrungsmittel, besonders von Kindern, in oft schwer verdaulicher Form genossen werden, sah ich doch selten Fälle von chronischen Bauchleiden. Die wichtigsten vegetabilischen Nahrungsmittel, Reis und Bataten, werden gar gekocht verzehrt; Kinder essen sie jedoch auch roh; auch haben sie noch häufiger als die Erwachsenen die Gewohnheit, alle Fruchtkerne, die kleiner als Pflaumenkerne sind, mit hinunter zu schlucken. Stellen sich schlechte Folgen ein, so übt ein Eccoproctikum oft eine sehr gute Wirkung aus. Derartige Mittel sind auch in der Zeit von Reismangel sehr heilsam, wo neben allerlei Surrogaten, wie Blättern, bei den Mahakamstämmen [436] hauptsächlich der wilde Sago als allgemeines Nahrungsmittel benützt wird. Da der feuchte Sago schnell verdirbt, treten in dieser Zeit zahlreiche Fälle akuter Darmleiden auf und, da ausserdem das Allgemeinbefinden durch Nahrungsmangel stark leidet, sind viele Krankheitsfälle dann schwer zu kurieren.
Derartige Darmkrankheiten werden, wie viele andere, häufig durch Malaria kompliziert; in solchen Fällen erreicht man anfangs mehr mit Chinin als mit Calomel. Eine junge Frau hatte einst infolge Coprostase dermassen durch heftige Krämpfe und Schlaf- und Appetitlosigkeit gelitten, dass sie monatelang entkräftet darniederlag und zum Skelett abmagerte. Ihre Familie, die bereits alle verfügbaren Mittel der Bahau, Malaien und Chinesen vergebens angewandt und die Kranke bereits aufgegeben hatte, war nicht wenig erstaunt, als diese infolge kurze Zeit durchgeführter Evakuierung genas und zu Kräften kam.
Unter den Intestinalwürmern sind Ascariden die häufigsten; sie scheinen jedoch keine ernstlichen Störungen zu veranlassen.
Die Bahau sind ihrem rauhen Bergklima gegenüber auffallend empfindlich. Ihre schwache Kleidung schützt sie von Kind an in nur sehr geringem Masse vor dem Witterungswechsel. So lange warmes Wetter herrscht, merkt man bei ihnen von rheumatischen Leiden nur wenig, sobald aber Regen und Wind eintreten, vor denen sie in ihren Häusern nur geringen Schutz finden, und vor allem, wenn sie in den nasskalten Gebirgswäldern zu leben gezwungen sind, treten bei ihnen Lungenkatarrhe und Gliederschmerzen leichter als bei den gut bekleideten Europäern auf. Dazu stellt sich dann bald Malaria ein, welche das Leiden verschlimmert.
Unter den weiteren internen Krankheiten der Bahau ist noch der Kropf (im Busang ko̱n) zu erwähnen, der bei dem einen Stamme mehr bei dem anderen minder verbreitet ist, bei keinem jedoch gänzlich fehlt. Bei den Frauen ist eine, wie es scheint, stets gleichmässig hypertrophierte Schilddrüse ganz allgemein zu finden. Zwischen diesen leicht hypertrophierten Schilddrüsen und weit nach aussen hervorstehenden Kröpfen findet man alle Übergänge. Bei den grösseren Formen ist die Hypertrophie nur selten gleichmässig, in der Regel überragt die eine Hälfte bei weitem die andere. Eine cystoide Degeneration der Schilddrüse habe ich selten konstatieren können. In wie weit diese Krankheit an der Entstehung der in Mittel-Borneo häufig vorkommenden psychisch und physisch schlecht entwickelten Individuen Schuld trägt; [437] lässt sich bei den Bahau, bei denen Syphilis so hochgradig verbreitet ist, nicht feststellen.
Diese Hypertrophieen liessen sich leicht behandeln und oft habe ich mir mittels 1 gr Jodkalilösung, welche ich Erwachsenen per Tag erteilte, die Gunst der Frauen erworben, die die Schlankheit ihrer Hälse mit grosser Befriedigung wiederkehren sahen. Durch anhaltenden Jodkaligebrauch nahmen auch bedeutende Kröpfe an Umfang ab.
Auch bei Männern kamen einige ernstere Fälle von Kröpfen vor, doch im Ganzen weit seltener als bei Frauen.
Während alle erwähnten Krankheiten an der geringen Bevölkerungsdichte von Mittel-Borneo zum grossen Teil die Schuld tragen, übt die Abwesenheit verschiedener anderer, für gewöhnlich verbreiteter Leiden wiederum einen günstigen Einfluss auf die Vermehrung der Bewohner. So habe ich während meiner langjährigen Praxis unter den Bahaustämmen nie einen Fall von Tuberkulose, sei es der Lungen, Haut oder Knochen, konstatieren können. Unter den Dajak, welche sich viel an der Küste aufhalten, glaube ich, ein einziges Mal Lungentuberkulose beobachtet zu haben.
Ferner glaube ich, mit Sicherheit die Abwesenheit von Rhachitis feststellen zu können, da diese mir unter den Tausenden fast nackten Gestalten, welche ich stets zu beobachten Gelegenheit hatte, sicher nicht entgangen wäre. Auch die typischen Verkrümmungen, die als Folge dieser Krankheit auftreten, habe ich bei den gut gebauten Bahau nie bemerkt.
Auch bin ich von der Abwesenheit oder dem sehr seltenen Vorkommen von malignen Tumoren, Sarkom und Karzinom überzeugt. Ein einziges Mal erinnerte mich eine luetische Neubildung an Sarkom oder Karzinom, aber die günstige Wirkung von Jodkali benahm bald alle Zweifel. Dagegen kamen Fibrome, besonders Keloide der Narben, häufig vor. Ebenso konstatierte ich zwei Mal an den Erscheinungen und durch objektive Untersuchung Fibroide des Uterus.
Ansteckende Krankheiten ernster Art kamen während meines Aufenthaltes unter den Eingeborenen nicht vor; ihre Niederlassungen liegen in grossen Abständen von einander und von der Küste entfernt, so dass die Möglichkeit einer Übertragung von Infektionen gering ist. Aus Berichten über eine Choleraepidemie, die in früheren Jahren bei ihnen geherrscht hatte, konnte ich ersehen, dass wenn einmal eine sehr ansteckende Krankheit in ein Bahaudorf eingeschleppt wird, ein grosser [438] Teil der Bewohner ihr zum Opfer fällt. Dies ist hauptsächlich den bei ihnen herrschenden hygienischen Zuständen zuzuschreiben, ferner auch dem Umstand, dass ihnen jeder Begriff vom Wesen dieser Krankheiten fehlt.
In der Regel verhindert man ein völliges Aussterben des Dorfes dadurch, dass alle Bewohner ausziehen und familienweise weit getrennt von einander im Walde wohnen. Dörfer, die von der Krankheit noch nicht ergriffen worden sind, erklären sich für lāli und schliessen sich dadurch von den anderen Dörfern völlig ab. Die Kĕnja am oberen Kajan erzählten mir, dass eine Pockenepidemie, die in einem ihrer grössten Stämme einst herrschte, eine enorme Sterblichkeit verursacht habe.
Beriberi, die unter den malaiischen und dajakischen Buschproduktensuchern sehr häufig vorkommt, herrscht bei der ansässigen Bahaubevölkerung derselben Gegend nur selten. Bemerkenswert ist, dass die Hühner in den Niederlassungen am mittleren Mahakam sehr unter Beriberi-ähnlichen Lähmungserscheinungen leiden und häufig auch daran sterben.
Von der Influenza haben wir auf unseren Reisen mehrmals zu leiden gehabt. Als Kwing Irang uns 1897 vom Blu-u zum unteren Mahakam geleitete, wurden wir Europäer bei unserer Ankunft in Udju Tĕpu innerhalb zehn Tage alle von einem rhino-pharyngialen Katarrh befallen. Bei Berchtold trat noch Fieber hinzu; im übrigen waren die Erscheinungen nicht besorgniserregend. Von ungefähr 100 unserer Kajan entging beinahe keiner der Influenza. Wie gewöhnlich komplizierte sich ihre Krankheit durch Hinzutritt von Malaria, die allerdings mit Chinin vertrieben werden konnte, aber der Katarrh und die Kopfschmerzen hielten viele Tage an. Die Bewohner von Tĕpu waren bei unserer Ankunft zwar gesund, waren aber zwei Monate vorher von der Influenza heimgesucht worden.
Auf unserer letzten Reise 1899 hatten wir weder in Tĕpu noch am unteren Mahakam von der Influenza zu leiden; doch erkrankte ich mit meinen Malaien und Kajan im April 1900 in Long Dĕho ernstlich an Influenza. Die Bewohner selbst hatten sich von der Influenza, welche durch Ma-Suling und Dajak vom unteren Mahakam eingeschleppt worden war, noch kaum erholt. Einige der unseren litten ausserdem schwer an Malaria, z.B. der Malaie Lalau, und der Husten dauerte über 3 Wochen. Selbst unsere Hunde begannen zu husten. [439]
Als Kwing Irang später mit den Seinen Demmeni und unser Gepäck den Mahakam hinunter nach Long Dĕho geleitete und sich dort längere Zeit aufhalten musste, wurden alle seine jungen Leute influenzakrank. Die Böte, welche von Long Dĕho flussaufwärts gingen, brachten die Infektion auch den Stämmen oberhalb der Wasserfälle; jedoch starben nur Alte und Kranke an der Influenza. Die Eingeborenen fürchten sich vor der Ankunft Fremder, weil diese ihrer Meinung nach die “be̥nge̥n,” die bösen Geister, welche die Erkältungskrankheiten verursachen, mitbringen.
Jeder Reisende, der zum ersten Mal mit den Dajak in Berührung kommt, ist von dem unangenehmen Anblick, den ihre Hautkrankheiten auf dem Körper hervorrufen, betroffen. Vor allem ist es die Schuppenbildung der blossen Haut, welche dem Patienten ein so abschreckendes Aussehen verleiht.
Es lassen sich 4 verschiedene Schuppenkrankheiten unterscheiden: Pityriasis versicolor, Tinea circinata, Tinea imbricata und Tinea albigena, von denen die beiden ersteren, oder doch sehr nahe verwandte Krankheiten, auch in Europa vorkommen. Diese 4 Hautkrankheiten, welche vor allen anderen in Borneo vorherrschen, werden durch verschiedene Arten in der Haut lebender Pilze hervorgerufen.
Favus, der anderswo oft sehr verbreitet ist, beobachtete ich nie bei den Bahau.
Pityriasis versicolor (panu der Malaien; lităk der Bahau) äussert sich in Form heller, etwas erhabener Flecke, welche durch eine Infiltration der Epidermis, durch welche die darunterliegende Pigmentschicht weniger sichtbar wird, verursacht werden. Auf der pigmentlosen Haut der Europäer macht sich die Infektion durch hellbraune Flecken bemerkbar.
Die Grösse der Flecken, welche panu oder lităk verursacht, variiert zwischen der eines Stecknadelkopfes und einer Handfläche. Die Infektion nimmt sehr verschiedene Dimensionen an; da sie bei den Bahau nur beim Transpirieren Jucken verursacht, wird sie nur selten behandelt und verbreitet sich daher oft über den grössten Teil des Körpers.
Tinea circinata (kurab der Malaien: ki urip der Bahau) stimmt äusserlich am meisten mit Herpes tonsurans überein und zeigt sich in Form runder Flecke, sehr verschiedener Grösse, welche alle aus einem Bläschen, um welches sich konzentrisch gleichartige Bläschen [440] gebildet haben, hervorgegangen sind. Durch Vertrocknen und Springen der Bläschen entsteht Schuppenbildung, hauptsächlich an der Peripherie. Tinea circinata befällt vorzugsweise die Stellen, wo die Epidermis am wenigsten resistent ist. Dass die Krankheit auch die Haare ergriff und dadurch eine teilweise Kahlheit herbeiführte, beobachtete ich weder unter den Bahau noch unter den Kĕnja.

Achtjähriger Kajan mit Tinea imbricata bedeckt.
Tinea imbricata (lusung der Malaien; ki lān der Bahau), äussert sich wie die vorige Infektion zuerst in kleinen Bläschen mit rotem Hof und vergrössert sich auch auf gleiche Weise, was sich besonders auf der zarten Haut der Bahaukinder und auf der der Europäer gut verfolgen lässt. Während jedoch die Haut im Zentrum des Infektionskreises bei Tinea circinata nur wenig Spuren der Entzündung mehr aufweist, entsteht hier bei Tinea imbricata eine zweite Eruption, die sich in zahlreichen, gleich weit entfernten, oft sehr zierlich gebogenen Linien bemerkbar macht. Die Linien zeigen sich auf der Haut durch Schuppenbildung. Die Schuppen können, besonders an Stellen mit dicker Epidermis, bis zu 2 cm lang und 5 mm breit werden. Da die Bahau von dieser Hautkrankheit oft ganz bedeckt sind, machen sie aus der Ferne eher einen weissen als einen braunen Eindruck; in der Nähe erscheinen sie wie mit Mehl bestreut.
Im Gegensatz zu Tinea circinata bildet sich Tinea imbricata hauptsächlich an den Hautstellen mit der dicksten Epidermis, so dass Gesäss und Aussenseite von Armen und Beinen zuerst ergriffen werden, während die Achselhöhlen, die Falten unter den Brüsten und die Leistengegend zuletzt oder auch gar nicht infiziert werden, selbst wenn der ganze übrige Körper, ausser Handflächen und Fussstehlen, welche niemals angegriffen werden, mit der Krankheit bedeckt ist. Verschont bleiben ausserdem die Nägel an Händen und Füssen und die Haare. Auch T. imbricata wird durch einen Pilz, den Manson entdeckte, verursacht. Im Jahre 1897 gelang es mir in Batavia, diesen Pilz zu züchten.2
Bei vielen Patienten fiel mir die starke Neigung dieser Hautkrankheit zu symmetrischer Verbreitung auf, die sich selbst dann noch zeigt, wenn die Krankheit bereits 20–30 Jahre bestanden hat. Da auch Tinea circinata und Pityriasis versicolor bei den Bahau die gleiche Eigentümlichkeit zeigen und alle durch einen Pilz verursacht werden, können die Erscheinungen dieser Hautkrankheiten keinem nervösen Ein [441] floss zugeschrieben werden. Es kommt mir viel wahrscheinlicher vor, dass die ständig unbedeckte Haut der Bahau ihre Epidermis und ihre Schweiss- und Fettdrüsen, besonders am oberen Körperteil, viel besser entwickeln kann als die einer stets gleichmässigen Temperatur ausgesetzte Haut der bekleideten Europäer. Da die Dicke der Epidermis und die Fett- und Schweisssekretion, die für den Ort der Entwicklung des Pilzes massgebend sind, sich an verschiedenen Stellen der Haut verschieden, an symmetrischen Körperteilen jedoch gleich verhalten, bewirken sie ein symmetrisches Auftreten dieser Krankheiten.
Nach langer Dauer von Tinea imbricata nimmt das Pigment unter der infizierten Haut zu, so dass diese nach der Genesung rossfarbig wird. Eine europäische Haut zeigt bereits nach kurzer Krankheitsdauer eine deutliche Pigmentansammlung. In sehr verwahrlosten Fällen von lusung erscheint die Haut bereits vor Eintritt der Genesung blauschwarz.
Bei Anwesenheit anderer Krankheiten kann eine vorgeschrittene lusung, wie ich es bei Malaria und Rupia syphilitica beobachtete, plötzlich heilen.
Tinea albigena (ki-ow der Bahau) zeigt in hohem Masse, wie sehr das Vorkommen pathogener Pilze an besondere Eigenschaften der Haut gebunden ist; sie setzt sich nämlich anfangs nur in den bei den Eingeborenen sehr dicken oberen Hautschichten der Handflächen und Fusssohlen fest. Erst nach langem Bestehen greift der Pilz auch die Nägel und die angrenzende Haut der Hand- und Fussrücken an. Am auffallendsten sind die Veränderungen, welche der Pilz in dem Rete Malpighii, in dem sich die braunen Pigmente hauptsächlich befinden, zustande bringt. Ohne dass, oberflächlich gesehen, mit der Hauternsthafte anatomische Änderungen vor sich gehen, verschwindet das Pigment vollständig und regeneriert sich nach Genesung der Hautkrankheit nicht mehr, so dass Handflächen und Fusssohlen, so wie andere infizierte Stellen, ganz weiss erscheinen. Nur ein einziges Mal sah ich auch auf Brust und Stirn dergleichen pigmentlose Flecken mit noch vorhandener Hautentzündung vorkommen.
Der Charakter der anatomischen Veränderungen, welche der Pilz hervorruft, hängt grössten Teils von der Dicke der Epidermis, unter welcher er sich entwickelt, ab. Auch diese Krankheit beginnt mit einer roten, juckenden Schwellung, in deren Mitte sich eine kleine, mit heller Flüssigkeit gefüllte Blase befindet. Ist die Epidermis dünn, wie bei [442] Kindern, so springt sie, ist sie aber dick, wie bei den erwachsenen Eingeborenen, so wird sie losgelöst und platzt erst dann, wenn die Blase einen grösseren Umfang erreicht hat. In ernsteren Fällen wird der grösste Teil der Epidermis an den Fusssohlen abgestossen; in weniger ernsten und in solchen, die, wie es öfters geschieht, in ein chronisches Stadium übergehen, ist die Epidermis bisweilen verdickt und trocken und veranlasst beim Gehen die in Indien sehr berüchtigten Risse, oder sie ist dünn und ungleich gebildet, so dass Hände und Füsse beim Gebrauch schmerzen.

Symmetrisch verbreitete Tinea imbricata bei einer jungen Kajanfrau am oberen Mahakam.
Diese Hautkrankheit ist bisher noch nicht beschrieben und wegen der pigmentlosen Stellen, die sie nach der Genesung auf der Haut zurücklässt, sicher oft mit Vitiligo verwechselt worden; sie ist im ganzen indischen Archipel verbreitet und kommt hie und da auch bei Europäern vor. Wegen ebengenannter Eigenschaft nannte ich diese Pilzkrankheit: Tinea albigena; ich entdeckte den Pilz in einem subakuten Falle in den Schuppen der Fusssohle. Wie der Pilz von Tinea imbricata zeigt sich auch dieser hauptsächlich in Form langer Mycelfäden, bildet aber ein viel undichteres Netzwerk als ersterer. Dieser Pilz scheint auf die gleiche Weise, wie der von Tinea imbricata, kultiviert werden zu können.

Symmetrisch verbreitete Tinea imbricata bei einer jungen Kajanfrau am oberen Mahakam.
Die genannten vier parasitären Hautkrankheiten der Bahau besitzen alle die gemeinsame Eigenschaft, dass sie mit parasiticiden Mitteln schnell zu kurieren sind. Die Genesungsdauer hängt, in noch höherem Masse als von der Krankheit selbst, von der Dicke der Epidermis an der betreffenden Stelle, auf welche das Medikament einwirken muss, ab. Um das Eindringen der wirksamen Bestandteile in die tieferen Hautschichten zu befördern, benützte ich wässerige Lösungen antiseptischer Mittel, z.B. Sublimat oder eine Chrysarobinlösung in Äther und Alkohol, welche ich mittelst Mackintosch am Verdunsten verhinderte. Die besten Erfahrungen machte ich jedoch beim Behandeln der Eingeborenen mit Jodtinktur, die wegen der Flüchtigkeit des Jod tiefer als die beiden anderen in die Haut eindringt. Eine wiederholte Anwendung dieser Mittel hat stets eine bedeutende Besserung und häufig auch eine völlige Genesung, selbst nach jahrelangem Bestehen der Krankheit, zur Folge. Da, wo das Corium und das Rete Malpighii blossliegen, sind parasiticide Salben von guter Wirkung.
Ausser den ebengenannten Hautkrankheiten kommen unter den Bahau noch Scabies und Frambösia vor; letztere greift hauptsächlich Kinder an. Nach der Genesung behalten die Patienten oft längere Zeit [443] hindurch heftige Gliederschmerzen, die jedoch nicht, wie die durch Syphilis verursachten, nach Gebrauch von Jodkalium weichen.
An Augenkrankheiten kommen unter den Bahau hauptsächlich der Star und granulöse Augenentzündungen vor. Diese sind stark verbreitet, und obwohl sie nur bei langer Dauer von ernsthaften Läsionen der Cornea begleitet sind, findet man bei Erwachsenen doch stets Spuren einer noch vorhandenen oder bereits überwundenen Entzündung der Conjunctiva, die das Sehen häufig stark beeinträchtigt. In den ernstesten Fällen, die ich bei Frauen beobachtete, kam es zu einer vollständigen Obliteration der obersten und untersten Bindehaut, so dass ein Schliessen des Auges verhindert wurde; die Cornea war in diesen Fällen so angegriffen, dass das Gesicht bedeutend geschwächt wurde. Doch beobachtete ich nur zwei Frauen, die nach einer über zwanzig Jahre andauernden Augenentzündung dadurch, dass die Hornhaut sich in eine gelblich weisse Membran verändert hatte, vollständig erblindet waren.
Der Star tritt sowohl am Kapuas als am Mahakam bereits bei jungen Leuten auffallend häufig auf. Ob hiermit andere verbreitete Krankheiten im Zusammenhang stehen, habe ich nicht ermitteln können.
Durch meine ärztliche Praxis unter den Eingeborenen hatte ich mir so viel Einfluss bei ihnen erworben, dass ich nicht zu viel sage, wenn ich behaupte, dass meine zweimalige Durchquerung Borneos und der Besuch bei den Kĕnja ohne meine Tätigkeit als Arzt nicht ausführbar gewesen wären.
Da die Eingeborenen selbst keine oder doch nur fast wertlose Mittel gegen Malaria und Syphilis besitzen und diese daher auch in leichten Fällen oft tätlich verlaufen, grenzt die Wirkung, welche Chinin, Jodkali und Quecksilberpräparate hervorrufen, in den Augen der Bevölkerung an das Wunderbare. Berücksichtigt man auch die Wirkung der Narkotika, die den Schmerz momentan benehmen, so erscheint es begreiflich, dass die Eingeborenen sich glücklich schätzten, einen weissen Wunderdoktor in ihrer Mitte zu haben.
Wegen ihrer Scheu vor allem Unbekannten fürchteten die Eingeborenen auch anfangs einen möglichen schlechten Ausgang der Kur. Daher war es, besonders in der ersten Zeit, geboten, durch Narkotika, verbunden mit den betreffenden Heilmitteln, auf das subjektive Empfinden der Patienten einzuwirken. Da Chinin und Jodkali einen [444] nicht oft im Stich liessen, machten sie während des Verlaufs der Krankheit einen sehr erwünschten Effekt.
Die Konstitution meiner Patienten kam mir oft zu Hilfe; ausserdem achtete ich darauf, keine zu weit vorgeschrittene Krankheit anders als mit der Vorausbemerkung, dass meine Hilfe vielleicht nicht mehr ausreichend sein würde, zu behandeln. Nachdem ich gemerkt hatte, dass auch weit vorgeschrittene Krankheiten bei vorsichtiger Behandlung eine gute Wendung nehmen konnten, stieg mein Selbstvertrauen und später brauchte ich nur selten einen Kranken für unheilbar zu erklären.
Betrachten wir nun, was die Bahau selbst über ihren Körper denken und wie sie ihre Krankheiten bekämpfen, so stossen wir auf die seltsamsten Vorstellungen. Dass diese mehr auf Phantasie als Beobachtung beruhen, sehen wir daraus, dass sie auch von dem, was sie äusserlich an ihrem Körper wahrnehmen, nur unklare Begriffe haben. Bei meiner Ankunft waren ihnen Herz- und Pulsschlag noch nicht bekannt, erst nachdem ich einige Monate. unter ihnen praktiziert hatte, erfuhren sie, dass sie einen Puls hatten, an dem ich häufig den Grad ihrer Krankheit beurteilen konnte. Da sie im übrigen gut zu beobachten im stande sind, kann man hieraus schliessen, dass Herzleiden nur selten bei ihnen vorkommen. Ausser einigen auf Beriberi beruhenden Fällen von Herzleiden erinnere ich mich tatsächlich keine anderen konstatiert zu haben.
Die Schläge der Arteria abdominalis, die sie beim Betasten ihres Leibes im Fall von Bauchschmerz fühlten, wirkten auf sie sehr beunruhigend. Immer und immer wieder wurde ich gefragt, ob das Klopfen nicht die Ursache des Leidens sei. Als ich die Gesunden sich auf den Rücken legen und auch sie das Klopfen der Arteria abdominalis fühlen liess, gerieten sie in grosses Erstaunen. Dagegen wissen alle Stämme, dass sie als Folge der Malaria eine harte Geschwulst an der linken Seite besitzen. Daher nennen die Dajak von Sambas die Malaria: de̥mom batu = Fieber mit dem Stein; die Kajan am Mendalam nennen die geschwollene Milz: kālong pră = Krankheitszeichen; die Kajan am Mahakam bezeichnen die Milz als ong ẹrăm = Krankheitskörper.
Von der Dauer einer normalen Schwangerschaft haben die Bahau nur eine sehr mangelhafte Vorstellung; sie nehmen an, dass sie nur 4–5 Monate dauert, d.h. so lange, als sie die äusseren Veränderungen an der Frau wahrnehmen können. Da mir diese Unwissenheit [445] kaum glaublich erschien, stellte ich in verschiedenen Gegenden hierüber Nachforschungen an, aus denen ich merkte, dass die vielen Fehl- und Frühgeburten sowie die sehr verbreiteten Geschlechtskrankheiten der Frauen das ihre zu dieser falschen Auffassung beigetragen haben. Dass zur Zeugung Testikel erforderlich sind, wissen die Eingeborenen ebenfalls nicht, denn sie halten ihre kastrierten Jagdhunde, denen die Weibchen nicht vollständig gleichgültig sind, für zeugungsfähig.
Alles Weisse, was sie am toten Körper bemerken, wie Nerven, Sehnen und Blutgefässe, nennen die Bahau “huwat”, auch nehmen sie an, dass in diesen die Kraft sitzt. Dass die Arterien der lebenden Menschen Blut enthalten, ist ihnen nicht bekannt.
Von dem Verstande und dessen Sitz machen sich die Bahau eigenartige Vorstellungen, die ich ganz zufällig kennen lernte.
Als ich mich auf meiner zweiten Reise einige Tage in Long Tĕpai aufhalten musste, suchte ich morgens nach meiner Ankunft einen alten Patienten, den Häuptling Bo Ibau auf. Der dürre Sonderling mit der Habichtsnase sass in seiner Kammer und schnitzte einen Schwertgriff aus Hirschhorn. Er war in früheren Jahren der beste Schnitzkünstler im Dorfe gewesen, hatte aber seiner. Augen wegen die Arbeit lange Zeit ruhen lassen müssen. Ich traf ihn in guter Stimmung, da er mit Hilfe der Brille, die ich ihm geschenkt hatte, wieder in der Nähe sehen und daher die geliebte Schnitzarbeit wieder aufnehmen konnte. Ibau klagte, dass die jungen Leute heutzutage nur schlechte Arbeit lieferten und fügte hinzu: “sie haben nichts in ihrem Bauche (djian hipun nun nun halam butit).” Ich glaubte ihn anfangs nicht gut zu verstehen und liess ihn die Worte wiederholen; allmählich merkte ich aber, dass mein alter Freund in der Tat mit dem Bauche zu denken glaubte. Auch erfuhr ich später, dass alle Bahau und Kĕnja derselben Meinung sind.
Den Schlaf fassen die Bahau als den Zustand auf, in dem eine ihrer beiden Seelen, die bruwa, den Körper zeitlich verlässt. Der Traum entsteht entweder dadurch, dass die Seele das Geträumte wirklich erlebt, oder dass die Geister dem Schläfer etwas zuflüstern. Die Träume der Priester sind besonders bedeutungsvoll. Von der Wohltat eines erquickenden Schlafes für Kranke haben sie keine Ahnung; wenn einer ernstlich krank ist, verhindern sie ihn durch Schreien und Schütteln am Einschlafen, selbst wenn der Kranke den Schlaf sehnlichst wünscht (Siehe pag. 333). [446]
Ihrer Schöpfungsgeschichte (pag. 129) zufolge sind die Bahau aus unbelebter Materie und zwar aus Baumrinde hervorgegangen. Das Leben wird erst durch die beiden Seelen “bruwa” und “ton luwa” in den Körper gebracht (Näheres Kap. V).
Alles, was die bruwa zum Entfliehen bringt, verursacht Krankheit. Da die bruwa auf die gleiche Weise wie der Mensch denkt und empfindet, kann sie durch alles, was diesen erschreckt, vertrieben werden, wodurch der Körper krank wird. Die Priester suchen daher, um einen Kranken zu heilen, dessen entflohene Seele in den Körper zurückzulocken. Auf dieser Vorstellung basieren im Grunde alle Heilmethoden der Priester. Das Einfangen der Seele geschieht mit Hilfe der guten Geister aus dem Apu Lagan, der Vermittler zwischen Hauptgöttern und Menschen.
Zum Glück sind sie in ihrem Vertrauen auf die Hilfe der Geister nicht so blind gewesen, dass sie den günstigen oder ungünstigen Einfluss einiger Faktoren auf den Verlauf einer Krankheit nicht selbst bemerkten. Hieraus hat sich bei ihnen ein sehr kompliziertes diätetisches System entwickelt, das neben den Beschwörungen der dājung bei jeder Krankheit angewandt wird.
Im allgemeinen sucht man die Krankheit dadurch zu bekämpfen, dass man sich verschiedener Speisen, des Badens, schwerer Arbeit etc. enthält. Für die verschiedenen Leiden bestehen auch verschiedene Vorschriften, die man gegenwärtig unmöglich als Bussen auffassen kann; sie sind teilweise auch so treffend gewählt, dass sie auf persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen beruhen müssen. Bei den Kajan am Mendalam gelten folgende Vorschriften:
Verboten ist bei Diarrhoe: harter Reis, Zuckerrohrsaft, Bananen, Klebreis, gekochte Bananen, kaltes Wasser, einige Arten Fische, Baden bei hohem d.h. kaltem Wasser; erlaubt sind: weich gekochter Reis und gute Fische.
Verboten ist bei Fieber: kaltes Wasser, Zuckerrohrsaft, Zucker, Gebäck und Baden bei Hochwasser.
Verboten ist bei Husten: ke̥ladi, Zucker, Zuckerrohrsaft, gerösteter Klebreis, Gurken, Rauchen, Betelkauen und schwere Arbeit.
Bei einer Knieentzündung verbietet man: Laufen, Treppensteigen, trockenen und hart gekochten Reis, gedörrten Fisch, Schweinefleisch, Eier, Salz und essbare Baumblätter.
Berücksichtigt man, dass derartige Verordnungen bei den Malaien [447] auf Borneo nur in sehr rudimentärer Form vorhanden und dass ein grosser Teil dieser Vorschriften auch nach der Auffassung europäischer Ärzte wirklich zweckmässig sind, so erscheinen sie uns für die Bahau um so anerkennenswerter. Überdies sind diese diätetischen Vorschriften in den Verhältnissen, in welchen die Dajak leben, beim Fehlen eigentlicher Heilmittel und bei der kräftigeren Konstitution ihrer Kranken viel wichtiger als bei den Europäern und deren günstigeren Lebensumständen.
Auch für Hautkrankheiten werden zahlreiche Verhaltungsmassregeln angegeben und, da man für diese auch noch wirksame Arzneien besitzt, sind die Bahau ebensogut als europäische Ärzte im stande, ihre parasitären Hautkrankheiten zu kurieren. Bei einer derartigen Kur darf nicht gebadet, nicht transpiriert und nicht gekratzt werden; auch darf der Patient keine Süssigkeiten, keinen jungen Bambus, ke̥ladi, Farrenspitzen, Salz, Schweinefleisch, spanischen Pfeffer und Mehl geniessen. Da die Heilmittel in Lösung auf die Haut gestrichen werden, sind die 3 ersten Vorschriften rationell; das Verbot der Speisen jedoch ist nachteilig, da es die ohnehin schon lästige Kur so sehr erschwert, dass nur sehr wenige sich ihr mit genügender Ausdauer unterwerfen. Der Erfolg ihrer Heilmittel ist häufig nur ein zeitweiliger, weil sie von der kontagiösen Natur dieser Krankheiten keinen Begriff haben und sich mit ihren eigenen Kleidern, Liegmatten etc. immer wieder von neuem infizieren.
Die Verbotsbestimmungen bei Krankheiten kommen den Eingeborenen so selbstverständlich vor, dass sie mich, wenn ich ihnen eine Arznei gab, sogleich fragten, was lāli, verboten, sei. Meine Vorschriften, welcher Art sie auch waren, wurden stets treu befolgt. Oft verbot ich das eine oder andere nur, um das Vertrauen in meine Arzneien nicht wankend zu machen. Von besonderer Bedeutung war dies in einigen Fällen, wo die Befolgung diätetischer Vorschriften von grösserer Wichtigkeit als das Einnehmen von Arzneien war; bei sehr kleinen Kindern konnte ich oft nur auf diese Weise eingreifen.
Während meines zweiten Aufenthaltes am Mendalam kamen dort innerhalb dreier Tage 3 Fälle sehr akuter choleraähnlicher Bauchkrankheit vor. Der erste, in Tandjong Kuda, verlief tätlich, ohne dass ich den Kranken sah. Am folgenden Tage erkrankte in meiner Nachbarschaft eine Frau mit allen Choleraerscheinungen, doch half ich ihr mit einer starken Dosis Landanum den Anfall überstehen. Ein oder [448] zwei Tage darauf rief man mich zu einem Manne in Tandjong Kuda, der an der gleichen Krankheit litt. Auch bei ihm hatte Laudanum eine ausgezeichnete Wirkung, nur war ich gezwungen, ihn seinem Schicksal zu überlassen mit dem Resultat, dass er 2 Tage später infolge des Genusses verschiedener gekochter Baumblätter einen Rückfall bekam und starb. Da diese Fälle der Cholera sehr ähnlich waren, glaubte ich die Umgebung am besten durch Regelung des Trinkwassergebrauchs zu schützen. Ich liess daher mit Hilfe der beiden Häuptlinge Akam Igau und Tigang durch die dājung eine grosse Beschwörung abhalten, verbot für 4 Tage das Trinken ungekochten Wassers und. warnte sie vor den Flussbädern, die übrigens in dem schnell strömenden Wasser von geringerer Bedeutung waren. Auch unreife Früchte setzte ich auf die Verbotsliste und hatte die Freude zu sehen, dass man sich sowohl in Tandjong Kuda als in Tandjong Karang an die Vorschriften hielt und keine weiteren Krankheitsfälle mehr vorkamen.
Der wichtigste Teil der Beschwörung bestand darin, dass man die bösen Geister, als die Urheber der Krankheit, daran verhinderte, längs den Bretterstegen, welche vom Fluss zum Hause führten, zu den Bewohnern zu gelangen. Zu diesem Zwecke spannte man längs des Ufers vor dem Hause und auch seitlich ungefähr 1 m über dem Boden Rotangseile, an welche in Abständen von 2 m zur Abwehr böser Geister Blätter von daun long gehängt wurden. An den Stellen, wo das Seil die Wege zum Hause kreuzte, richtete man zu beiden Seiten roh gearbeitete Figuren, eine weibliche und eine männliche, auf. Die Figuren besassen übertrieben grosse Genitalien; der Mann eine nach Kajansitte perforierte glans penis mit hölzernem Stifte; überdies waren sie mit hölzernen Speeren, Schwertern und Schilden als weiteren Abschreckungsmitteln bewaffnet. Zu meiner Beruhigung willigten die Familiengehörigen darein, Kleidungsstücke und Liegmatten der Verstorbenen zu vernichten. Da die adat ihnen das Verbrennen dieser Gegenstände verbietet, warfen sie diese, ohne mein Wissen, in den Fluss.
Die einzigen nennenswerten Arzneien der Kajan werden gegen Hautkrankheiten angewandt; zwei derselben sind in der Tat sehr wirksam:
1. oro̱ko̤̱p, Blätter von Cassia alata, die auch sonst im Archipel häufig gegen Hautkrankheiten benützt werden.
2. nje̥ro̱bw bulan (im Busang) = minjak pe̥landjau (im Malaiischen), ein schwarzes, nach Teer riechendes Öl, das aus dem schwarzen Kernholz [449] eines gleichnamigen Baumes fliesst, der nur auf Borneo einheimisch zu sein scheint. Beim Stehen scheidet das Öl eine halbflüssige Masse ab, die tanah pe̥landjau genannt wird.
Auf die Haut gebracht verursacht diese tanah pe̥landjau eine Entzündung. Als man diese Masse einst unvermischt auf die Leibeshaut eines Kindes strich, wurde diese so völlig zerstört, dass eine tiefe Wunde entstand. Für den Gebrauch muss das Mittel mit Zuckerrohrsaft vermischt werden. Ein Individuum, das von Kopf bis zu Fuss mit lusung bedeckt ist, kann in 14–20 Tagen genesen, falls es sich tüchtig mit tanah pe̥landjau einreibt und das Baden vermeidet.
Die Kajan reiben sich täglich mit ọro̱ko̤̱p ein, wodurch sie allmählich ihren lusung und in viel kürzerer Zeit ihren kurab vertreiben.
Ein sehr wirksames, für die Kajan aber sehr kostbares Mittel ist Petroleum, das, auf die erkrankte Haut gestrichen, binnen 8 Tagen eine Heilung herbeiführt.
Als weitere Behandlungsweisen von Entzündungen und Schmerzen sind bei den Kajan Schröpfen, Tätowieren und Massieren üblich. Die beiden ersten werden besonders bei schmerzhaften Entzündungsgeschwülsten angewandt. Man entzieht das Blut, indem man mit einem spitzen Messer eine grosse Zahl kurzer Einschnitte ausführt und die Blutung von selbst aufhören lässt. Blutstillende Mittel lernte ich nicht kennen. Die Ausführung kleiner Tätowierfiguren auf die entzündete Stelle wirkt wahrscheinlich in gleicher Weise wie die Blutentziehung.
Bei Leib- und Rückenschmerzen wendet man vor allem Massage an, die mehr in Kneten als in Reiben besteht. Mit der Massage und dem Blutentziehen befassen sich hauptsächlich die dājung, die es in ihrer Kunst bisweilen weit bringen.
Für Wunden kennen die Bahau keine Mittel- sie halten sie nur mit Wasser und Kapok rein. Da sie ernste Blutungen nicht zu stillen verstehen, gehen die Leute häufig an kleinen Wunden, z.B. auf dem Fussrücken, zu Grunde. Dagegen verstehen sie zerrissene Ohrläppchen wieder aneinander wachsen zu lassen (Siehe pag. 140).
Bei Entbindungen wird der Leib der Kreissenden mit den Händen geknetet; andere Behandlungsweisen sind unbekannt. Heftige Blutungen verlaufen, wenn sie nicht von selbst aufhören, tätlich.
Die Bahau wenden auch Dampfbäder an. Sie füllen ein Gefäss mit heissem Wasser, fügen einige Blätter hinzu und setzen den Kranken, den sie mit Decken umwickeln, einige Zeit den heissen Dämpfen aus. [450]
1 Siehe: Janus. Arch. Internat. p. l’Histoire de la Médecine et la Géographie Méd. 1898.
2 Archiv für Derm. u. Syph. 1898.
Kapitel XIX.
Allgemeines über Tätowierung—Unterscheidung dreier Gruppen—Vorschriften für Tätowierkünstlerinnen und Patienten—Tätowiergerätschaften—Ausführung und Folgen der Operation—Methoden der Tätowierung bei den verschiedenen Stämmen und Ständen—Seeentätowierung—Tätowierung der Kajan am Mendalam—Tätowiermuster—Tätowierung bei den Mahakamstämmen und den Kĕnja.
Die Tätowierungen der Dajak dienten ursprünglich wahrscheinlich als Körperverzierungen, gegenwärtig hat aber die Sitte des Tätowierens bei allen Stämmen so tief Wurzel gefasst, dass man sie als einen Brauch ansehen muss, dem zwar keine religiöse Bedeutung zukommt, der aber mit dem Lebenslauf des Individuums eng verknüpft ist.
Die Art der Tätowierung ist in Mittel-Borneo für die verschiedenen Stammgruppen, für die einzelnen Stämme und für Mann und Frau charakteristisch; auch sind die Anlässe, aus welchen tätowiert wird, bei beiden Geschlechtern verschieden. Bei den Männern kann man die Tätowierung im allgemeinen als einen Beweis betrachten, dass sie an gefahrvollen Unternehmungen teilgenommen haben, während sie bei den Frauen, beispielsweise bei denen der Long-Glat, die Einleitung einer neuen Lebensperiode bedeutet.
Die Long-Glat beginnen damit, den Mädchen, sobald sie acht Jahre alt sind, auf den Rückseiten der Finger an verschiedenen Stellen kleine Figuren zu tätowieren; bei Eintritt der Menses wird die Rückseite der Finger vollständig tätowiert und im Lauf der folgenden Jahre wird fortgefahren, bis der ganze Handrücken bis zum Puls seine Verzierung erhalten hat; auf die gleiche Weise wird mit dem Fussrücken verfahren. Mit 18 bis 20 Jahren lassen sich die Frauen die Vorderseite der Schenkel und in späterem Alter, oder wenn sie mehrere Kinder gehabt haben, auch die Hinterseite der Schenkel tätowieren.

Tätowieren einer Hand bei den Kajan am oberen Mahakam.
Während die Männer die Tätowiermarter gern auf sich nehmen, um nachher als tapfere Männer gekennzeichnet zu sein, wird die Sitte des Tätowierens bei den Frauen durch den Glauben unterstützt, dass den vollständig [451] tätowierten Frauen im Jenseits gestattet wird, im Flusse Te̥lang Djulan zu baden und dadurch in unmittelbare Nähe der Perlen zu gelangen, die sich auf seinem Grunde befinden; die unvollständig Tätowierten dagegen müssen am Ufer stehen bleiben und die gänzlich Untätowierten dürfen sich dem Flusse überhaupt nicht nähern. Dieser Glaube, den ich am oberen Mahakam und bei den Kĕnja angetroffen habe, erleichtert den Frauen die entsetzlichen Schmerzen, die ihnen der Prozess des Tätowierens verursacht.
Zur Unterscheidung verwandter Stämme ist die Tätowierung der Frauen geeigneter als die der Männer, da diese sich auf ihren Reisen oft mit den charakteristischen Zeichen ihrer Gastherren schmücken, während die im Stamme bleibenden Frauen meist die ihm eigenen Muster tragen. Ein Eingeweihter kann an den Tätowierungen der Männer erkennen, welche Stämme sie besucht haben; weitgereiste Leute zeigen die Charakteristika der Stämme am Mahakam, Batang-Rèdjang, der Taman Dajak, Punan u.s.w.
In Mittel-Borneo lassen sich hinsichtlich des Tätowierverfahrens und hinsichtlich der angewandten Muster drei Gruppen von Stämmen unterscheiden, die wahrscheinlich mit ihrer geschichtlichen Trennung in den letzten Jahrhunderten in Zusammenhang stehen.
1. Gruppe der Bahau, Kĕnja und Punan.
2. Gruppe der Bukat und Bĕkĕtan.
3. Gruppe der Stämme vom Barito und Mĕlawi und der Ulu-Ajar vom Mandai.
Die erste Gruppe trägt Tätowierungen, welche aus dunkelblauen Linien bestehen; die Frauen verzieren Unterarme, Hände, Schenkel und Füsse, die Männer Schultern, Arme und Brust. Der Daumen der linken Hand und die Schenkel dürfen nur bei sehr tapferen Männern tätowiert werden.
Die Männer der zweiten Gruppe tätowieren den ganzen Körper vom Unterkiefer bis zu den Knöcheln mit grossen, dunkelblauen Flächen, aus denen die eigentlichen Figuren in der natürlichen Hautfarbe hervortreten.
Hat sich ein Bukatjüngling auf einem Kriegszuge oder bei einer anderen Gelegenheit ausgezeichnet, so wird ihm zuerst auf die Brust eine dreieckige Fläche tätowiert, darnach werden die Schultern, der Nacken, die ganzen Arme, der Rücken und der Unterkiefer auf die gleiche Weise behandelt; später wird oben an den Waden noch eine [452] viereckige Fläche angebracht. Nach weiteren Heldentaten dürfen sie sich, ausser an der Innenseite, das ganze Bein tätowieren lassen.

Frau der Long-Glat mit vollständiger Tätowierung.
Bei der dritten Gruppe beginnen die Männer damit, sich grössere oder kleinere Scheiben auf die Waden, unterhalb der Kniekehlen, tätowieren zu lassen; später werden, im Gegensatz zu den Kajan und Punan, die isolierte Figuren tragen, die Arme, der Rümpf und der Hals vollständig mit zusammenhängenden Figuren aus dunkelblauen Linien bedeckt. Die Frauen verzieren hauptsächlich die Kniee, Unterbeine und Hände.
Die eben erwähnten drei Gruppen unterscheiden sich in Bezug auf die Ausführung der Tätowierung darin, dass die zweite und dritte aus freier Hand tätowiert, während die Künstlerinnen der ersten Gruppe die anzubringenden Figuren erst in Relief auf kleine Bretter (klinge̱ te̥dăk = Tätowierbrettchen) schneiden lassen, diese mit Russ bestreichen, auf die Haut abdrücken und auf den erhaltenen Linien dann Damararuss unter die Haut treiben.

Dahei Kwing, achtzehnjährige Kajanfrau vom oberen Mahakam mit tätowierten Händen.
Alle drei Gruppen tätowieren mit Russ, der eine Blaufärbung der Haut bewirkt, nur die dritte Gruppe gebraucht auch rote Farbe.
Bei den beiden ersten Gruppen wird die Tätowierkunst von Frauen ausgeübt, bei der dritten von Männern. Doch hat die adat unter den Bahau und Kĕnja den Tätowierkünstlerinnen, in gleicher Weise wie den Schmiede- und Schnitzkünstlern, durch verschiedene Verbotsbestimmungen Schranken gesetzt. Da jede Tätowierkünstlerin unter dem Schutze eines besonderen Geistes steht, muss sie ihrem Schutzpatron allerhand Opfer bringen. Sie darf z.B. verschiedene Arten Fische und Blätter nicht essen, auch muss sie für jeden neuen Klienten eine me̥lă veranstalten, bei der sie ihrem Geiste in ihrem Korbe mit Tätowiergerätschaften alte Perlen und kawit anbietet.

Junger Bukathäuptling mit Brust- und Armtätowierung.
Solange die Künstlerinnen kleine Kinder haben, dürfen sie ihr Amt nicht ausüben. Den höchsten Lohn, einen Gong, dürfen sie erst nach 20 jähriger Amtstätigkeit fordern. Vor dieser Zeit müssen sie sich mit bescheideneren Löhnen, die in Perlen und Zeugen bestehen, begnügen. Sobald eine Künstlerin eine der genannten Vorschriften vernachlässigt, dunkeln ihre Linien nicht nach oder sie wird krank und stirbt.
Der Tätowierberuf ist insofern erblich, als eine junge, Frau die beste Gelegenheit hat, die Kunst von einem älteren Familiengliede zu erlernen.
Bisweilen bilden sich die Frauen, um von einer Krankheit zu genesen, zu Tätowierkünstlerinnen aus. Bleibt nämlich eine ärztliche Behandlung [453] seitens einer Priesterin erfolglos, so rät man der Kranken, sich durch einen Schutzgeist vom Abu Lagan zur Künstlerin inspirieren zu lassen, um gleichzeitig mit dessen Hilfe die verlorene Gesundheit wiederzufinden. Die Frauen können sich aus diesem Anlass nur zu Priesterinnen oder zu Tätowierkünstlerinnen, die Männer auch zu Schmieden und Hirschhornschnitzern beseelen lassen.
So erlebte ich selbst, dass Uniang Anja, die zweite Frau von Kwing Irang, als sie von den Folgen eines Abortus nicht genesen konnte, sich von einer anderen Priesterin mit einem Geist der Tätowierkunst beseelen liess, nachdem sie früher bereits, für eine andere Krankheit, einen Geist der dājung hatte herbeirufen lassen.
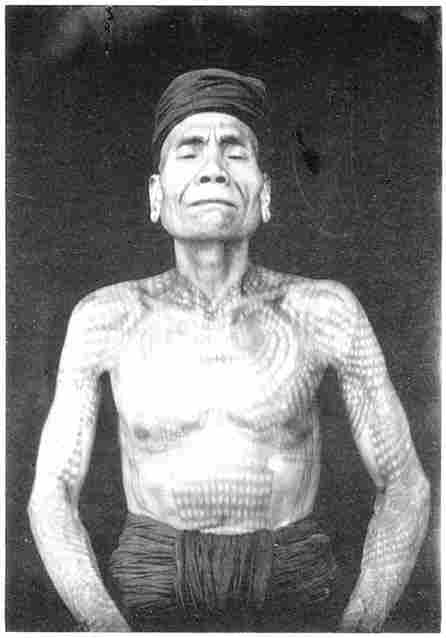
Tätowierter Dajak vom Kahájan.
Die Frauen der Bahau und Kĕnja dürfen sich nur zu bestimmten Zeiten tätowieren lassen, da für die Dauer der Tätowierperiode die ganze Familie Verbotsbestimmungen unterworfen ist. Meistens wird nach der Reissaat, in der Jäteperiode, tätowiert, da für dergleichen dann am meisten Zeit vorhanden ist.
Bei den Kajan am Mendalam ist in der Saatzeit das Blutvergiessen verboten, daher auch das Tätowieren.
Befindet sich eine Leiche im Hause, so muss das Tätowierverfahren bis nach dem Begräbnis verschoben werden.
Zwei weitere Gründe, die eine schnelle und vollständige Ausführung der Tätowierung verhindern, bestehen, besonders bei den Mädchen, in der Furcht vor Schmerz und in dem Unvermögen, die für eine vollständige Tätowierung erforderliche Summe von 25–30 fl. aufzubringen. Die Prozedur wird ferner auch durch böse Träume, wie z.B. von Hochwasser, das starke Blutung bedeutet, aufgehalten oder vollständig unterbrochen, so dass man häufig unvollständig oder gar nicht tätowierten Frauen begegnet.
Eine Frau der Long-Glat muss an jedem Tage, an dem sie tätowiert wird, als Zuspeise für die Künstlerin ein schwarzes Huhn schlachten. Für die Männer sind die erwähnten Hinderungsgründe von weit geringerer Bedeutung, da ihre Tätowierung eine viel unvollständigere ist.
Bei den Kĕnja darf die Operation nicht im Hause, sondern nur in eigens zu diesem Zwecke erbauten Hütten stattfinden. Die männlichen Familienglieder müssen sich während der Tätowierperiode in Baumbast kleiden, auch müssen sie die ganze Zeit über im Hause anwesend sein. Befinden sich die Männer auf Reisen, so darf kein weibliches Familienglied tätowiert werden. [454]
Beim Kĕnjastamm der Uma-Tow darf nur dann tätowiert werden, wenn sich gleichzeitig auch die Tochter eines vornehmen Häuptlings behandeln lässt. Ist diese aber, etwa infolge eines Trauerfalls, verhindert, sich der Operation zu unterwerfen, so dürfen sich die Mädchen des ganzen Stammes nicht tätowieren lassen.
Die Ulu-Ajar Dajak benützen zum Tätowieren ein Instrument, das aus einer 10 cm langen und 1 cm breiten Kupferplatte besteht, die vorn rechtwinklig gebogen in einen scharfen Zahn endigt. Der Zahn wird in die nicht gespannte Haut getrieben, indem man mit einem kleinen Holzstück leicht auf die Kupferplatte klopft.
Die Bahau- und Kĕnjafrauen tätowieren mit einem rechteckig gebogenen Holzstück (ulang brāng), in welches 2 bis 3 kupferne Nadeln mittelst Guttapercha befestigt sind (Siehe Tafel: Pfeilköcher, Giftbrett u.s.w. Fig. u). Sowohl dieser Nadelhalter als auch der mit Baumwolle umwundene hölzerne Klopfer (tukul ulang, Fig. v) sind oft mit schönen Schnitzereien verziert. Die Künstlerin verfährt folgendermassen: Nachdem sie die Tätowiermuster mit dem gebräuchlichen Färbemittel, einem Gemenge von Wasser und Russ des weissen Damaraharzes, auf die Haut gedrückt hat, taucht sie die Nadeln in ein Gefäss (bungan te̥dăk, Fig. t) mit derselben Flüssigkeit und treibt mit diesen Nadeln die Kohlenteilchen unter die Haut, indem sie mit dem Klopfer auf den Nadelhalter schlägt. Dieser ruht, um besser regiert werden zu können, mit dem Stiel auf einem Kissen. Die Operation veranlasst anfangs eine unbedeutende Blutung, nur da, wo dickere Linien ein wiederholtes Eindringen der Nadeln erfordern, mischen sich einige Blutstropfen mit dem überschüssigen Färbemittel und werden von einer Gehilfin entfernt. Die Patientin sitzt oder liegt während der Operation am Boden, die Künstlerin und deren Assistentin nehmen einander gegenüber, zu beiden Seiten des zu bearbeitenden Teiles, Platz und halten mit den Zehen die Haut gespannt (Siehe nebenst. Tafel).
Werden empfindliche Körperteile tätowiert, so krümmen sich die Mädchen vor Schmerz und weinen; oft haben sie auch später noch viel durch eine hinzugetretene Entzündung zu leiden. Eine vollständige Schenkeltätowierung kann am Mendalam in drei Tagen beendet werden; der zweite Schenkel wird erst, nachdem der erste geheilt ist, vorgenommen. Die Gliedmassen werden in folgender Reihenfolge tätowiert: Hand, Fuss, Unterarm und Schenkel. Der ganze Prozess dauert unter Umständen zwei Jahre. [455]
Obgleich die Kajan viel geschickter und mit geringerem Blutverlust als die Ulu-Ajar Dajak tätowieren, tritt an den operierten Stellen doch stets eine kleinere oder grössere Schwellung auf; häufig auch eine ernsthafte Entzündung. Verschwindet diese bald, so erhält man später dunkle, scharfe Linien, tritt dagegen eine Ulzeration mit starker Narbenbildung auf, so verliert die Zeichnung viel an Deutlichkeit und verschwindet sogar, wenn ein Keloid entsteht, vollständig, denn das Keloid verdeckt die Figur und die Ulzeration verursacht ein Ausstossen der Kohlenteilchen. Nachdem die Entzündung und eventuell die Ulzeration geschwunden sind, werden die dunklen Linien der Figuren durch das junge Narbengewebe verdeckt und erscheinen dadurch blass, ausserdem tritt dieses aus der Umgebung reliefartig hervor. Nach dem Einschrumpfen des Narbengewebes werden die Farben wieder gut sichtbar. Dank dem sorgfältigen Verfahren der Kajan bemerkt man auch auf stark tätowierten Schenkeln und Armen nur wenig Narbengewebe. Haben die Figuren dennoch zu stark durch die Entzündung gelitten, so lassen manche sie durch die Künstlerin überarbeiten.
An die reiche Tätowierung der Frauen knüpft sich der Glaube, dass man einst nach ihrem Tode ihre Knochen an der Imprägnierung mit schwarzen Kohlenteilchen wird unterscheiden können. Am Mahakam, ursprünglich wohl auch am Mendalam, herrscht nämlich zum Teil noch die Sitte, dass die Knochen der Verstorbenen nach einigen Jahren von ihren Angehörigen gesammelt und in einer Urne in Grabhöhlen niedergelegt werden.
Die Tätowierungen sind nicht nur für die verschiedenen Stämme, sondern auch für die verschiedenen Stände innerhalb eines Stammes charakteristisch. Übrigens ist die Sitte des Tätowierens, wie jede andere Mode, der Veränderung unterworfen und zwar hauptsächlich deswegen, weil auch bei den Bahau die Niederen mit den Höheren zu wetteifern streben und die Tätowierung der Häuptlinge erst von den Freien und dann von den Sklaven nachgeahmt wird. Derartige Nachahmungen finden auch unter den Stämmen statt; so haben die früher mächtigen Long-Glat ihre Tätowiermethode bei den anderen Mahakamstämmen eingeführt. In den 30–40 letzten Jahren ist sowohl am Kapuas als am Mahakam bei den niederen Ständen die alte Art der Tätowierung durch die neue verdrängt worden.
In früheren Jahren trugen am Mendalam, wie Akam Igau sich noch erinnerte, nur die Häuptlingsfrauen Schenkelverzierungen; bei den gewöhnlichen [456] Frauen war damals nur eine gleichmässig schwarze Bedeckung der Unterschenkel und Füsse gebräuchlich, wobei nur einige schmale Linien von natürlicher Hautfarbe als Umgrenzung rautenförmiger Flächen freigelassen wurden. Man bezeichnet diese Art der Tätowierung als te̥dăk danau = Seeentätowierung. Ich sah nur noch ein sehr altes Mütterchen auf diese Weise verziert.

Tätowiermuster der Mendalam Kajan.
Nach Auffassung der Kajan ist die Tätowierkunst auch den Tieren nicht ganz unbekannt, denn es beschlossen einst die Krähe von Borneo und der Argusfasan, sich gegenseitig ihr früher sehr schlichtes Gefieder zu verzieren. Die kluge Krähe, die sich sehr gut auf das Tätowieren verstand, machte sich sogleich ernsthaft ans Merk und es gelang ihr auch nach angestrengter Arbeit, ihren Freund prachtvoll zu schmücken. Darauf bemühte sich der Argusfasan, der Krähe den gleichen Dienst zu erweisen. Der Fasan ist aber ein dummer Vogel, auch merkte er bald, dass er der Arbeit nicht gewachsen war, daher nahm er die ganze schwarze Farbe und verteilte sie gleichmässig auf das Gefieder seines Freundes; seit der Zeit tragen sie beide ein so verschiedenes Gewand.
Bei sämtlichen Bahau am Mendalam trifft man die gleiche Art der Tätowierung. Die Männer schmücken sich der Reihe nach Schultern, Brust, Ober- und Unterarm mit Rosetten und stilisierten Hundeköpfen. Die Schulterrosette erhält der junge Mann, bevor er noch an einem grossen Handelszuge oder an einer Kopfjagd teilgenommen hat, für die übrigen Verzierungen wird aber eine derartige Gelegenheit abgewartet und, da die Tätowierungen in der Regel während des Zuges ausgeführt werden, wählt man für sie die typischen Muster der besuchten Stämme. Dieser Brauch wird aber nicht streng eingehalten; will ein junger Mann sich auch ohne Verdienste, aus Eitelkeit, tätowieren lassen, so steht ihm nichts im Wege.
Die Häuptlinge lassen sich viel weniger und seltener als die freien Kajan und Sklaven tätowieren; sie tragen selten mehr als eine Schulterrosette.
Die Tätowierung des linken Daumens und eine Schenkelverzierung werden den sehr tapferen Männern vorbehalten; am Mendalam war niemand vorhanden, der letztere besass, und eine Tätowierung des linken Daumens trug nur Akam Lasa, der Häuptling der Ma-Suling. Dass einige vielgereiste Männer, wie Akam Igau, keine Tätowierungen [457] besitzen, ist dem Einfluss der Malaien zuzuschreiben, der am Mendalam bereits so bedeutend ist, dass, wie früher erwähnt, Akam Igau seinem ältesten Sohne in Bunut eine malaiische Erziehung hatte geben lassen.
Auch die Männer werden von Frauen tätowiert. Tandjong Karang besass zwei sehr gute Tätowierkünstlerinnen. Eine andre, Unjang Pon, war 1894 von Lulu Njiwung am Mahakam nach dem Mendalam gereist. Da sie schöne klinge̱ te̥dăk im Mahakamstil besass, liessen sich viele junge Leute von ihr tätowieren.
Die Tätowiermuster werden von den jungen Leuten selbst oder von deren Freunden verfertigt; die Muster der Künstlerin entsprechen nur selten vollständig dem Geschmack des Publikums. Wie bereits gesagt, werden die Muster auf kleinen Brettern in Relief geschnitten, eine Arbeit, die ausschliesslich Sache der Männer ist (Siehe Tafel: Tätowierung A. Fig. a-n). Nur selten werden die Figuren à jour geschnitten (Fig. o und p). Fig. a stellt eine einfache Schulterrosette vor; bei der Schulterverzierung b kommt die Rosettenform nur in der Mitte zum Ausdruck.
Betrachten wir, um die Motive der Muster besser zu verstehen, zuerst Fig. d und e, die, gleich b, c und f, “aso̱” genannt werden. Aso̱ bedeutet Hund. In den betreffenden Figuren ist der Kopf des Tieres in zierliche Arabesken verwandelt worden. Bei diesen Stilisierungen bleiben das Auge, die beiden Kiefer und zwischen diesen öfters die Zunge am längsten erhalten. Die Kiefer lassen sich häufig an den Zähnen erkennen (Fig. e, 2 und 3 und Fig. f, bei 2, nicht mehr bei d). In d stellt 1 das Auge in der gewöhnlichen, mehr oder weniger verzierten, runden Form dar. Den runden Fleck in der Mitte könnte man als Pupille auffassen. Das Auge ist mit verschiedenen Verzierungen umgeben, von denen die Kiefer 2 und 3 und die kleine Zunge 4 charakteristisch sind. Kiefer 2 verläuft in zierlichen Windungen, während Kiefer 3 in einen schlichten Bogen endet. In etwas veränderter Form findet man das Auge, die Kiefer und die Zunge in den Figuren b, c, o und p wieder.
In Fig. c geht die Phantasie des Künstlers noch einen Schritt weiter; die Figur ist hier aus der Vereinigung zweier Köpfe entstanden, von denen an der einen Seite die zwei Kiefer 2 und 4 und die Zunge 1, an der anderen die Kiefer 3 und 6 und die Zunge 7 noch zu erkennen sind. Bemerkenswert ist das Verbindungsstück 5, weil es das gemeinschaftliche Auge beider Köpfe darstellt. Wie [458] an einem anderen Ort gezeigt werden soll, dient in der Ornamentik der Bahau das Auge, da es am strengsten bewahrt wird, als bestes Kennzeichen für ein Kopfmotiv; daher ist es ratsam, das Auge bei der Zergliederung der Motive als Ausgangspunkt zu wählen. Die Schulterrosette a lässt sich somit der Reihe nach von den stilisierten Hundeköpfen e, bei dem noch Kiefer und Zähne vorhanden sind, und von d, mit den zahnlosen Kiefern, ableiten. Fig. b stellt eine Vereinfachung von Fig. c dar. In b sind die Kieferpaare noch angedeutet, aber das Auge tritt bereits in den Vordergrund und wird in a zu einem selbständigen Motiv.
Die Tätowiermuster Fig. o und p wurden für mich von einem Schnitzkünstler in Tandjong Karang geschnitten, um mich einige hübsche Stücke eigener Erfindung sehen zu lassen. Ihrer Grösse wegen sind sie mehr für eine Brust- als für eine Armverzierung geeignet, obwohl Armfiguren gelegentlich auch auf der Brust, auf dem Pectoralis major, angebracht werden.
Für die Schenkeltätowierung der Männer fand ich am Mendalam nur ein einziges Motiv, nämlich das eines Hundes mit schlangenartigem Körper (Fig. f), bei dem die Beinpaare andeuten, dass es sich um ein vierfüssiges Tier und nicht um eine Naga oder eine Schlange, wie man beim ersten Blick denken könnte, handelt. Das Hundemotiv ist bemerkenswerter Weise überhaupt das einzige, mit dem sich die Männer der Mendalam Kajan und der Bahau im allgemeinen tätowieren.
Die Tätowierung der Frauen ist bei den Mendalamstämmen weit höher entwickelt als die der Männer.
Vor 30 bis 40 Jahren bestand die Tätowierung der Frauen, wie oben bereits gesagt ist, in einer einfachen Seeentätowierung (te̥dăk danau), bei der das Unterbein von der halben Kniescheibe bis zur Fusswurzel einförmig dunkelblau tätowiert wurde. Die blaue Fläche wurde durch 4 Längs- und 2 Querlinien in 12 Vierecke zerlegt. Diese Linien, die 6 mm breit waren, wurden durch nicht tätowierte Stellen gebildet und zeigten daher die natürliche Hautfarbe. Von den Linien liefen zwei seitlich, parallel dem Schienbein und zwei zu beiden Seiten der Waden, in ungefähr gleichen Abständen von einander. Die beiden Horizontallinien verteilten diese Flächen je in drei Bleichhohe Vierecke. Auf die gleiche Weise wurden die Unterarme vom Ellbogen bis zum Puls verziert.
Ob diese Tätowiermethode damals auch bei den Häuptlingsfrauen [459] gebräuchlich war, konnte ich nicht feststellen, ich halte es aber für wahrscheinlich, da sie damals überall, auch bei den Mahakamstämmen, verbreitet war.
Seit geraumer Zeit ist aber bei den Frauen der Häuptlinge eine andere Art der Tätowierung im Schwange, bei der Unterarme, Handrücken, Schenkel und Fussrücken mit sehr komplizierten und schön ausgearbeiteten Figuren verziert werden. Die übrigen Frauen ahmten diese Methode nach, so dass das danau-Muster allmählich verschwunden ist und augenblicklich alle Frauen, von der Häuptlingstochter bis zur niedersten Sklavin, nach der neuen Mode tätowiert sind. Die Tätowierungen der angesehenen Frauen unterscheiden sich von denen der gewöhnlichen Frauen zwar nicht durch die Zeichenmotive, aber durch die Art der Bearbeitung und durch die Anzahl der Grenzlinien, welche diese Motive trennen und zugleich zu ihrer Zusammenstellung dienen. Je grösser nämlich die Zahl dieser Grenzlinien, desto höher ist der Rang ihrer Besitzerin. So gehört die auf Tafel: Tätowierung B. abgebildete Schenkeltätowierung, der als Hauptmotiv ein Menschenkopf (kọhong ke̥lunăn) zu Grunde liegt, einer panjin (Freien), weil die Köpfe nur von 4 Grenzlinien (g) umgeben sind; dagegen ist die Schenkeltätowierung auf Tafel: Tätowierung C., die einer Häuptlingsfrau, weil das Kopfmotiv 6 Grenzlinien (g) besitzt. Das Gleiche gilt für die Zahl der Linien in dem Motiv “pusung” der Armtätowierungen (Tafel: Tätowierung D. Fig. a und b). Sklavinnen dürfen diese Figuren nur mit drei Linien begrenzen. Ausserdem sind die Muster bei den Wohlhabenderen besser ausgearbeitet, weil sie geschicktere Tätowierkünstlerinnen und schönere klinge̱ te̥dăk bezahlen können.
Die Schenkeltätowierung der Frauen wird mit zweierlei klinge̱ te̥dăk zusammengesetzt, erstens mit einem viereckigen, einen Menschenkopf darstellenden Muster, das man für die obere Reihe, die Vorderseite und die Hinterseite unten verwendet, indem man sie neben einander auf die Haut abdrückt (Siehe Tafel: Tätowierung B.). Das zweite, für die Hinterseite bestimmte Motiv, ke̥tong pat genannt, ist mit einem anderen klinge̱, das vier verschlungene Linien darstellt, ausgeführt.
Alles übrige tätowiert die Tätowierkünstlerin aus freier Hand, ohne vorher etwas auf die Haut zu zeichnen. Auf diese Weise wird auch das ganze schöne Kniestück tätowiert.
Als Beispiel für eine Schenkeltätowierung einer angesehenen Frau möge die von Tipong Igau, der ältesten Tochter Akam Igaus, dienen, [460] welche mit dem klinge̱ te̥dăk Fig. n (Tafel: Tätowierung A.) und einem zierlichen ke̥tong pat zusammengestellt ist (Tafel: Tätowierung C.). Das hier gebrauchte klinge̱ te̥dăk stellt, wie gesagt, einen Menschenkopf (kọhong ke̥lunăn) dar, der von 6 Grenzlinien eingeschlossen ist.
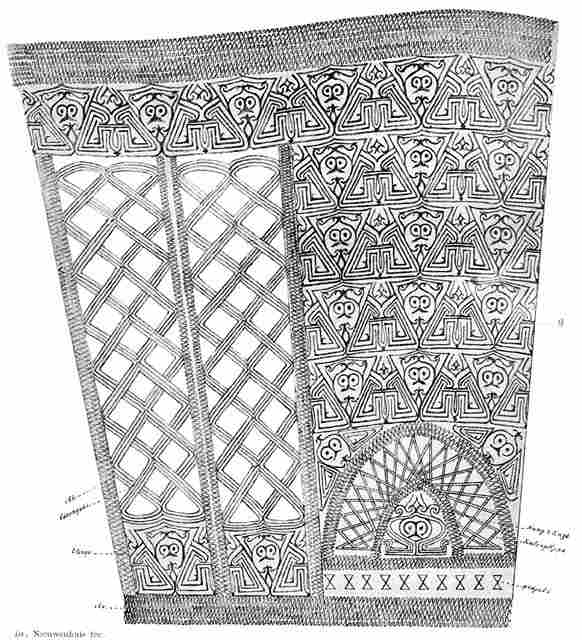
Schenkeltätowierung einer panjin.
Der stilisierte Menschenkopf ist das einzige Motiv, das am Mendalam für ein klinge̱ der Vorderseite des Schenkels benützt wird. Oft bleiben von dem Kopf nicht viel mehr als zwei Augen und eine Andeutung von Nase und Mund übrig, doch wird er stets weiter als kọhong ke̥lunăn bezeichnet. Nur Paja, Akam Igaus zweite Tochter, war sehr stolz darauf, dass ihre Beine mit einem usung tingang (Schnabel resp. Kopf des Nashornvogels) geschmückt waren. Der Vater hatte ihr dieses Muster von den Long-Glat am Mahakam mitgebracht.
Ebenfalls dem Tierreich entlehnt sind die wellenförmigen Grenzlinien der Schenkeltätowierungen, die als iko, Schwanzlinien, bezeichnet werden und die Zickzacklinien im Kniestück, die kalong njipă, Schlangenmuster, genannt werden.
Um die Knöchel tragen die Frauen der Mendalamstämme ein ungefähr 7 cm breites Band, das entweder, nach Art der te̥dăk danau, einheitlich ist, oder aus parallelen, bis 3 mm dicken Linien besteht, die mit gleich breiten Streifen von der natürlichen Hautfarbe abwechseln.
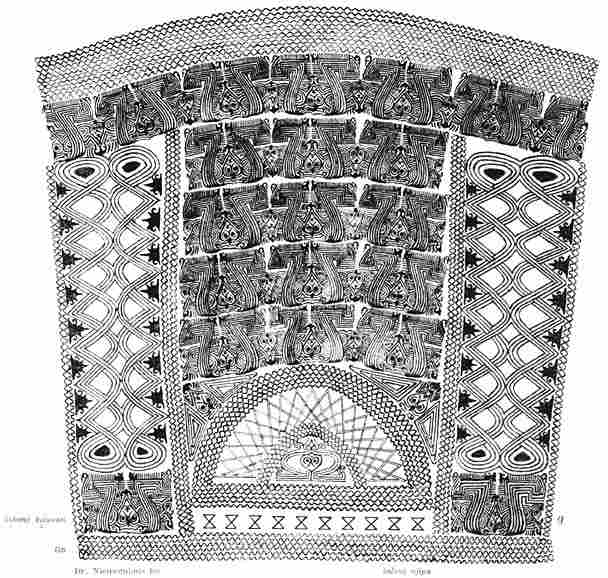
Schenkeltätowierung von Tipong Igau.
Ferner sind der Fussrücken (Tafel: Tätowierung D. Fig. c) und die Zehen mit fünf, der Zahl der Zehen entsprechenden Längsstreifen tätowiert, die wiederum durch zwei Querstreifen von der natürlichen Hautfarbe in ungleichen Abständen unterbrochen werden. Zur Fusswurzel hin sind die Streifen am breitesten, zu den Zehen hin verschmälern sie sich. Bei weitaus den meisten Frauen werden diese Streifen gleichmässig blau tätowiert. Einige Häuptlingstöchter versuchen zwar auch hier schöne Figuren anbringen zu lassen, was allenfalls auf dem Fussrücken glückt, aber die dünne Haut der Zehen entzündet sich so leicht, dass von einem Muster meist nicht viel zu sehen ist. Die Fusstätowierung wird meist ohne klinge̱ te̥dăk, aus freier Hand, ausgeführt. Fig. c zeigt die Fusstätowierung von Tipong Igau, die mit den klinge̱ te̥dăk k, l, m auf Tafel: Tätowierung A., ausgeführt worden ist.
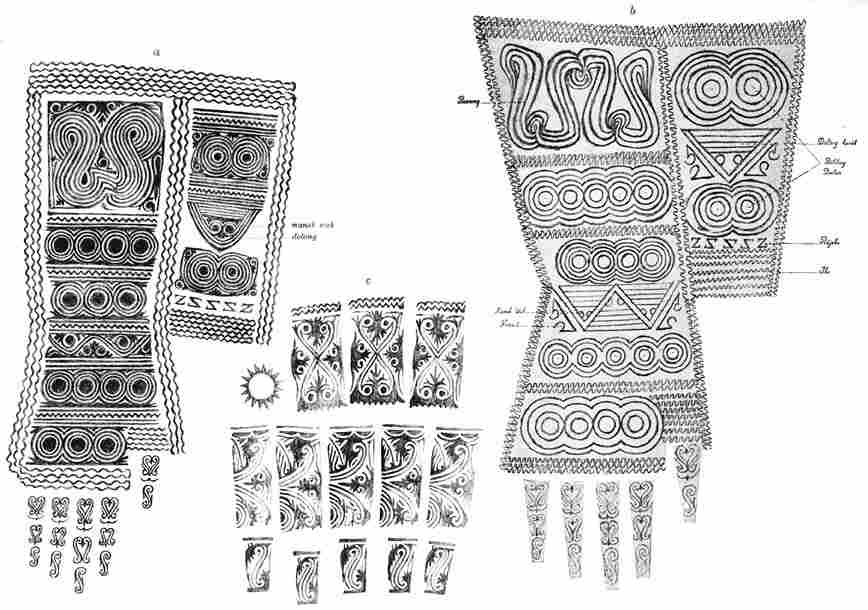
Hand- und Fusstätowierung der Mendalam Kajan.
Auch die Tätowierungen auf Unterarm, Handrücken und Finger werden für gewöhnlich von geübten Künstlerinnen ohne klinge̱ ausgeführt, da ihre Zusammenstellung eine sehr einfache ist (Tafel: Tätowierung D.). Wie aus Fig. b ersichtlich, werden neben Tiermotiven, [461] wie Eulenaugen (manok wăk) und Schwänzen (iko), für diese Tätowierungen auch Himmelskörper, wie der Mond (be̥liling bulan), und Gegenstände aus dem täglichen Leben, wie Haken (krawit) und Bootsspitzen (do̱lo̱ng haro̱k), verwendet, diese kehren mit einigen Variationen in den verschiedenen Armmustern wieder.

Schenkeltätowierung einer Long-Glat-Frau.
Die Armtätowierug Fig. b ist die einer gewöhnlichen Kajanfrau. Fig. a stellt wiederum die Armtätowierung der Häuptlingstochter Tipong Igau dar; die Muster sind hier schöner entworfen und sorgfältiger ausgearbeitet; im übrigen sind die Motive hier die gleichen wie bei b. Die Eulenaugen (manok wak) befinden sich bei b in den Dreiecken, welche die Bootsspitzen (do̱lo̱ng haro̱k) vorstellen. Vergleicht man diese Figur mit a, so sieht man, dass der Schnitzkünstler die Eulenaugen hier mit der innersten Grenzlinie der Bootsspitze verbunden hat, wodurch eine Scheibe, an die sich ein Bogen anschliesst, entstanden ist. Dieses Motiv wiederholt sich in vielen geschmackvollen Variationen in Tipong Igaus Tätowierung. Die klinge̱ te̥dăk, mit denen dieses Muster zusammengestellt worden ist, sind auf Tafel: Tätowierung A. in Fig. g, h und i abgebildet.
Vor noch nicht allzu langer Zeit verteilte sich. die Sitte des Tätowierens bei den Mahakamstämmen derart, dass die Pnihing gar nicht oder wenig tätowierten, die Bahaustämme, ausgenommen die Long-Glat, die Seeen-Tätowierung gebrauchten und bei den Long-Glat, sowie bei den Stämmen am mittleren Mahakam, besonders von den Frauen, sehr komplizierte Muster angewandt wurden.
Jetzt hat die Sitte des Tätowierens auch bei den Pnihing Eingang gefunden. Ihre Männer verzieren sich, wenn auch spärlich, mit den Mustern der Mendalambewohner. Ihre Frauen lassen sich eigentümlicher Weise nicht nach Art der anderen Bahaufrauen taitowieren, sondern bringen ganz unsystematisch auf Armen und Beinen Stilisierengen des aso̱ an, mit denen sich bei den übrigen Stämmen nur die Männer schmücken.
Bei den Kajan und den übrigen Bahaustämmen am Mahakam tätowieren sich die Männer jetzt in gleicher Weise wie die Kajan am Mendalam, nur die Tätowierung der Frauen weicht gänzlich von der ihrer Schwestern am Mendalam ab und steht völlig unter dem Einfluss der Long-Glat.
Bevor die Frauen die Long-Glat-Tätowierung annahmen, trugen sie [462] eine charakteristische Figur auf dem Handrücken; ich fand sie nur noch bei wenigen.
Dass die Tätowierung der Long-Glat sich erst vor kurzem bei den Kajan eingebürgert hat, geht auch daraus hervor, dass die Frauen ihre klinge̱ te̥dăk noch stets von den Long-Glat beziehen, obgleich die Männer ihres Stammes sie sehr gut selbst schnitzen können. Die Busang sprechenden Stämme, die, ausser den Ma-Suling, den Long-Glat direkt unterworfen sind, nehmen auch noch gegenwärtig in höherem oder geringerem Masse die Tätowiermotive dieses Stammes an, nachdem sie ihre frühere danau-Tätowierung aufgegeben haben. Die Hauptstämme, wie die Ma-Suling und Ma-Tuwān, ahmen die Long-Glat vollständig nach, andere gebrauchen zwar die klinge̱ te̥dăk der Long-Glat, tätowieren sich aber nach Art der Kajanfrauen, z.B. die Batu-Pala und noch einige andere, die bereits seit länger als einem Jahrhundert mit den Long-Glat zusammenwohnen.

Muster für Schenkeltätowierungen.

Muster für Schenkeltätowierungen.
Unter den Long-Glat findet man also die am Mahakam vorherrschende Tätowiermethode, der, mit geringen Abweichungen, auch alle Bahaustämme unterhalb der Wasserfälle folgen. Bei dieser Tätowierung wird der Schenkel, der Knöchel, der Fussrücken und die Rückseite von Puls, Hand und Fingern verziert. Verschiedenheiten bestehen nur in der Reihenfolge, in welcher die Figuren angebracht werden, und bei denen der Uma-Luhat in Udju Halang z.B. auch in der Anordnung der Schenkeltätowierung. Wenn der Umfang, in dem die Verzierungen bei den Frauen am Mahakam angebracht werden, auch mit dem der Kajanfrauen am Mendalam übereinstimmt, so sind doch die Motive, welche den Tätowiermustern am Mahakam zu Grunde liegen, viel zahlreicher und verschiedener, auch bieten sie in Bezug auf Geschmack und Kunstsinn das schönste, was die Bahau zu leisten vermögen.
Das Hauptgewicht wird bei den Frauen der Long-Glat und bei denen der weiter unten wohnenden Stämme auf eine geschmackvolle und sorgfältige Ausarbeitung der Schenkeltätowierung gelegt. Wie aus nebenstehende Abbildung (Tafel: Tätowierung E.) ersichtlich, bestehen diese Muster aus drei verschiedenen Teilen, einem Mittelstück, das durch eine Art klinge̱, kalong usung tinggang (Schnabel des Nashornvogels) genannt, zusammengestellt wird, zwei gleichen Seitenstücken, für die stets als Motiv stilisierte Flugfedern des Argusfasans (ke̥rip kwẹ) verwendet werden, und einem weiteren Hinterstück links, das aus 1 bis 2 Teilen bestehen kann. Dieses letzte Stück, das [463] nach hinten den Abschluss bildet, entlehnt sein Motiv der Zeichnung auf einem Prunkgrab (song) und wird kalong song se̥pit genannt (se̥pit = Hinterseite der Tätowierung).
Das Mittelstück der Schenkeltätowierung lässt das Knie der Long-Glat-Frauen unbedeckt und weicht hierin von demjenigen der Frauen in Udju Halang ab, bei denen die Tätowierung bis zur halben Kniescheibe herabreicht. Bei diesen Frauen werden die Figuren unten auch nicht, wie bei denen der Long-Glat, durch Linien begrenzt. Während bei den Long-Glat die klinge̱ te̥dăk, oder wie sie sie nennen, die te̥rong be̥tik, in wechselnder Richtung angebracht werden, richten die Frauen der Uma-Luhat die Figuren stets mit den Tierköpfen nach unten, ausserdem ist bei ihnen die Tätowierung an der Aussenseite des Beines um eine Figurenreihe höher. Die Long-Glat beginnen mit der Ausführung der Tätowierung an der Vorderseite, die Uma-Luhat an der Hinterseite des Beines.
Auf den ersten Blick tragen die Muster bei beiden Stämmen den gleichen Charakter; die Mittelstücke bestehen beinahe stets aus Bögen, deren abgewandte Enden in mehr oder weniger deutliche Tierköpfe auslaufen. Diese stellen entweder den Kopf des Nashornvogels oder, wenn Zähne vorhanden sind, den einer Naga dar. Die Zwischenräume werden mit zierlichen Arabesken ausgefüllt. In diesen Füllfiguren sind die Motive, denen sie ihr Entstehen verdanken, oft sehr schwer zu erkennen; bisweilen treten aber auch hier deutliche Tierfiguren zu Tage. So sind z.B. auf Tafel: Tätowierung F. für die innere Verzierung des te̥rong be̥tik der Long-Glat (Fig. a), bei dem eine doppelte, gleichmässige Nagafigur das Hauptmotiv bildet, zwei Nagaköpfe gebraucht, die sich in der Mitte vereinigen, nur ein Auge besitzen und noch rechts und links zwischen den aufgesperrten Kiefern eine Zunge hervorstrecken. Die Oberkiefer besitzen noch eine Reihe Zähne, die aber nicht mehr mit ihnen in Verbindung stehen. Sowohl die Ober- als die Unterkiefer verlaufen in zierlichen Bögen, die sich mit anderen vereinigen. Die unteren Nagaköpfe haben zu beiden Seiten die Augen eingebüsst, ein seltener Fall; die beiden Kiefer tragen aber noch Zähne.
Vergleicht man die Mittelfigur von a mit der von b, so sieht man, dass diese sich von jener ohne viele Übergänge ableiten lässt, während aber das ursprüngliche Kopfmotiv in a noch deutlich erkennbar ist, ist e an und für sich nicht verständlich.
Die Motive, welche den Tätowierungen der Frauen zu Grunde liegen, [464] sind in allen Ständen die gleichen, nur sind auch bei diesen Stämmen der Entwurf und die Ausführung bei Häuptlingsfrauen besser als bei Sklavinnen, auch sind die Figuren bei jenen oft grösser (Tafel: Tätowierung G., Fig. d, Tätowiermuster einer Sklavin; Tafel: Tätowierung H., Fig. e und f, Tätowiermuster angesehener Frauen). Die Anzahl Reihen zur Füllung der Vorderseite ist bei den Sklavinnen dementsprechend grösser.

Muster für Schenkeltätowierungen.

Muster für Schenkeltätowierungen.
Alle diese Figuren werden mit zwei te̥rong be̥tik, einer rechten und einer linken Hälfte, auf das Bein abgedrückt. Einfachere Figuren, die vom Schnitzkünstler weniger sorgfältig bearbeitet worden sind, zeigen bisweilen asymmetrische Hälften. Von den Figuren a und b wollte man mir nur eine Hälfte verkaufen, daher sind die Figuren bei der Konstruktion symmetrisch geworden; dagegen sind d, e und f mehr oder weniger asymmetrisch.
Völlig abweichend ist die alte Form der Uma-Luhat (Fig. c), die ebenfalls für das Mittelfeld der Schenkeltätowierung benützt wird In den 4 Ecken finden wir je den stilisierten Kopf eines Nashornvogels.

Muster für Schenkeltätowierungen.

Muster für Schenkeltätowierungen.
Berücksichtigt man, dass es mir nur ab und zu glückte, das Tätowiermuster einer Frau käuflich zu erwerben, und dass ich durchaus nicht immer das Schönste erlangen konnte, so kann man sich den Formenreichtum denken, der diesen Stämmen zur Verzierung einer viereckigen Fläche, auf der als Motiv nur ein Bogen angegeben ist, zu Gebote steht. Der den unentwickelteren Völkern so häufig gemachte Vorwurf, dass ihre Kunst von Armut zeuge, trifft für die Bahau in diesem Fall nicht zu.
Das Gleiche gilt auch für die Seitenstücke, die rechts und links vom Mittelfelde angebracht werden und die stets Stilisierungen von Federn des Argusfasans vorstellen. Die Long-Glat bezeichnen sie als “ke̥njṳj jauk dṳ”. Auch hier habe ich das kaufen müssen, was man mir gerade abtreten wollte. So ist von den Mustern, die ich erhielt, nur dasjenige für die Schenkeltätowierung der Long-Glat vollständig; dagegen fehlen bei den fünf (Tafel: Tätowierung I.) abgebildeten Mustern bei a und b das obere Ende, während c, d und e nur kleine Stücke des Ganzen vorstellen.
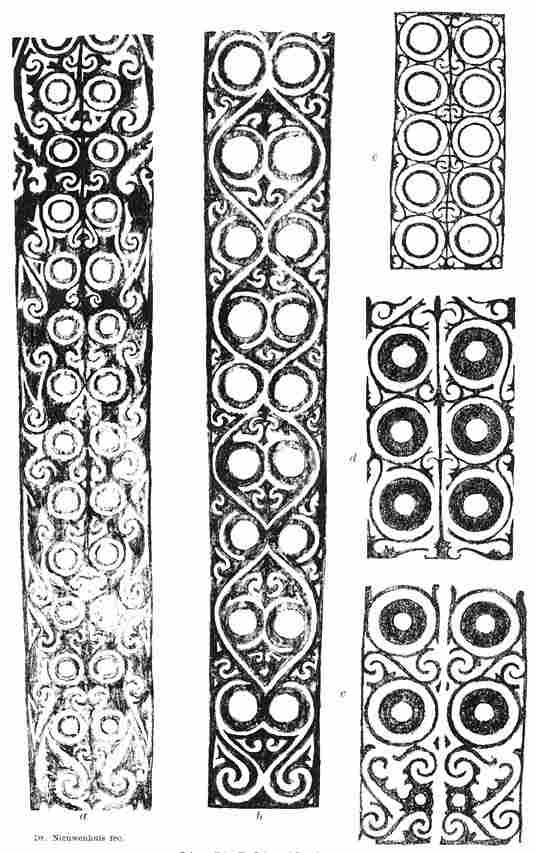
Seitenstücke für Schenkeltätowierungen.
Alle diese Muster haben die schönen Augen auf den langen Flugfedern (ke̥rip) des Argusfasans (kwẹ) zum Motiv und es spricht für die Phantasie der Bahau, dass sie die auch im übrigen schöne Zeichnung auf der Feder nicht ohne weiteres übernommen, sondern sie durch eigene Erfindungen ersetzt haben. [465]
Die Entwürfe beweisen, dass die betreffenden Künstler nicht an Gedankenarmut gelitten haben, denn betrachtet man ein Muster von oben nach unten, so sieht man, dass das Motiv an verschiedenen Stellen verschieden behandelt worden ist. Dass die Figuren nicht immer symmetrisch sind, muss einer nachlässigen Bearbeitung zugeschrieben werden, da die wirklich guten Schnitzkünstler stets auf Symmetrie achten.
Als Schlussstück zwischen den beiden stilisierten Federn auf der Hinterseite der Schenkel gebraucht man ein te̥rong be̥tik, zwischen dessen beiden Hälften die Frauen der Uma-Luhat einen 1 cm breiten Raum lassen. Auch bei den Long-Glat besteht dieses Schlussstück aus zwei Teilen, aber nicht ausnahmslos, wie aus dem sehr schönen Beispiel eines song se̥pit auf Tafel: Tätowierung J, Fig. e zu ersehen ist.
Die verschiedenen Arten song se̥pit, vom einfachsten bis zum kompliziertesten, sind auf der gleichen Tafel in Figur a, b, c, d neben einander abgebildet. Das song se̥pit, das für die abgebildete Schenkeltätowierung einer Long-Glat verwendet worden ist, stellt sich der Fig. e würdig zur Seite. Obgleich diese Figur asymmetrisch ist, da die eine Hälfte breiter als die andere, hat der Künstler den langen, schmalen Raum doch mit bewundernswerter Geschicklichkeit zu füllen verstanden.
Zu dem Reichtum von Fig. e stehen die schlichten, strengen Formen von d in scharfem Gegensatz. Hier ist die Symmetrie viel besser durchgeführt. Am Holzmodell ist auch deutlich zu sehen, dass es von einem geübten Künstler herrührt; denn das Relief ist besonders scharf und tief ausgeschnitten.
Da alle abgebildeten Figuren song se̥pit vorstellen, ist es begreiflich, dass die Hauptlinien den gleichen Charakter tragen, doch machen sich bei ihnen, wie bei den Stilisierungen der Feder des Argusfasans, individuelle Verschiedenheiten geltend.
Für die Knöchel gebrauchen die Long-Glat u.a. stets ein Band, das aus sechzehn 3 mm breiten Linien, welche mit ebenso vielen Streifen von der natürlichen Hautfarbe abwechseln, besteht. Das Band wird te̥dăk aking genannt.
Die Füsse werden bei den Frauen dieser Stämme nach Art der Mendalam Kajan tätowiert; nur werden die Streifen stets ganz gefüllt; besondere Figuren werden nicht angebracht.
Für die Tätowierung der Rückseite von Puls und Hand verwenden die Frauen der Long-Glat zwei verschiedene te̥rong be̥tik, die durch 4 gerade Linien getrennt werden. Die oberste Figur wird auf die [466] Rückseite von Unterarm und Puls, die folgende auf die Mittelhand tätowiert. Zu den Fingern hin folgen wieder 4 gerade Linien und auf den Gelenken zwischen den Knochen der Mittelhand und der ersten Fingerglieder wird eine Reihe Dreiecke angebracht. Das erste Viereck liegt auf dem ersten Fingerglied, das zweite auf dem zweiten; das Nagelglied bleibt frei, nur das Nagelglied des Daumens erhält einen Fleck.
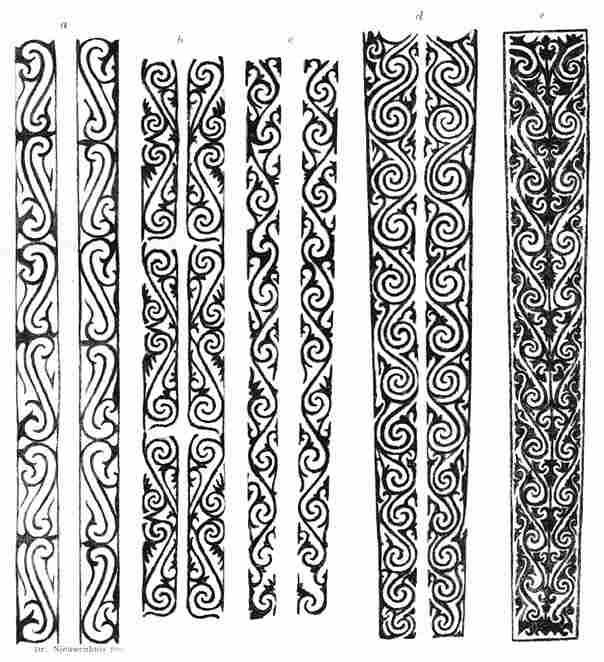
Schlussstücke für Schenkeltätowierungen.
Als Beispiel für Handtätowierungen der Long-Glat mögen die beiden Figuren a und b auf Tafel: Tätowierung K. gelten. Die zwei klinge̱ te̥dăk von Fig. a stammen aus Long Tĕpai; das Muster wird be̥tik kule̱, Panthermuster, genannt, weil es das gefleckte Fell eines Panthers nachahmen soll. Dies ist ein seltener Fall, da gewöhnlich nur die Köpfe der Tiere als Motive verwendet werden. Die schwarzen Flecken auf dem Fell des Borneoschen Panthers sind besonders bei der obersten Figur gut getroffen und geschmackvoll stilisiert, in der untersten Figur treten sie weniger deutlich hervor.
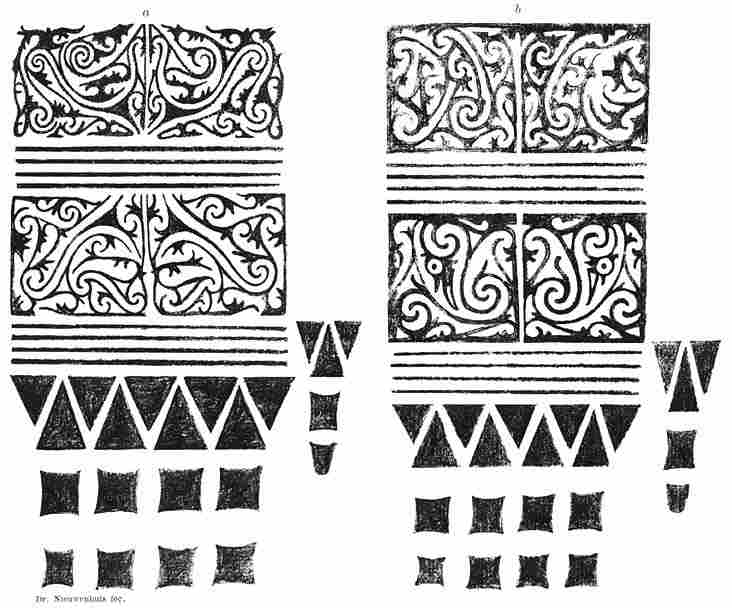
Handtätowierungen der Long-Glat.
Fig. b trägt einen anderen Charakter. Hier ist nur in dem unteren Teil ein Tierornament zu erkennen und zwar in den symmetrisch angebrachten Köpfen des Nashornvogels, die nur aus Auge, Schnabel und Horn bestehen. Die oberste Verzierung von b, in welcher ein Motiv kaum zu erkennen ist, zeichnet sich durch eine bedeutende Asymmetrie aus. Dass diese Asymmetrie in einer Tätowierung der Bahau keine grosse Störung hervorruft, geht aus der Tätowierung der Kajanfrau vom oberen Mahakam hervor (Tätowierung L.). Die obere und die untere Figur waren auf die beiden Seiten desselben Brettes geschnitten. Während die erstere nun stark asymmetrisch ist, hat derselbe Künstler auf der anderen Seite eine beinahe symmetrische Verzierung hergestellt. In der oberen Figur ist ein Tiermotiv nicht leicht zu erkennen, dagegen führen in der unteren die beiden Augen rechts und links in der Mitte wiederum auf zwei Köpfe und zwar, wie das gebogene und das gerade Horn und der grosse Schnabel andeuten, auf die des Rhinozerosvogels.
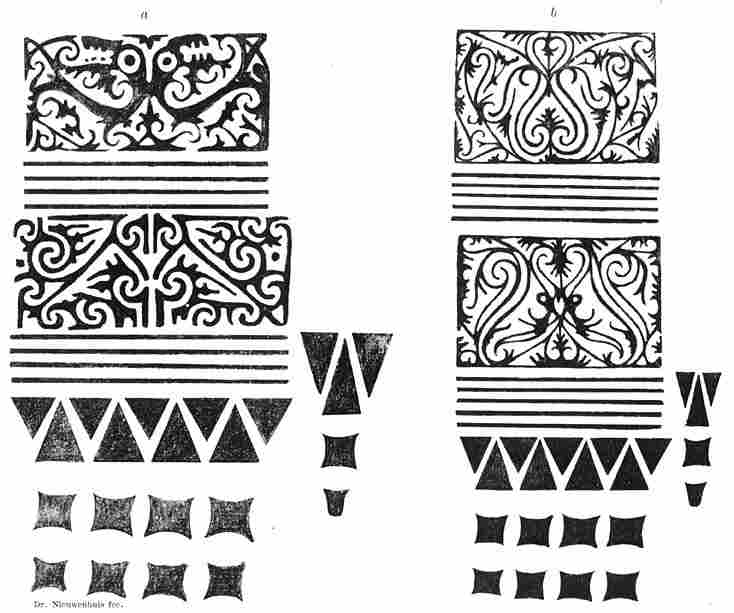
Handtätowierungen der Uma Luhat; Kajan am Blu-u.
Die drei Handtätowierungen, die mit den Tätowierbrettchen der Uma-Luhat zusammengestellt wurden, haben einen eigenen, von dem der Long-Glat abweichenden Stil (Tafel: Tätowierung L. und M. Die Verzierungen sind nicht so reich und fein ausgearbeitet als die der Long-Glat, auch ist das Relief niedriger und breiter. Dass auch die Uma-Luhat Tiermotive für ihre Ornamente verwenden, zeigt die oberste Figur von a, bei der zwei mit Zähnen bewaffnete Köpfe deutlich zu unterscheiden sind.
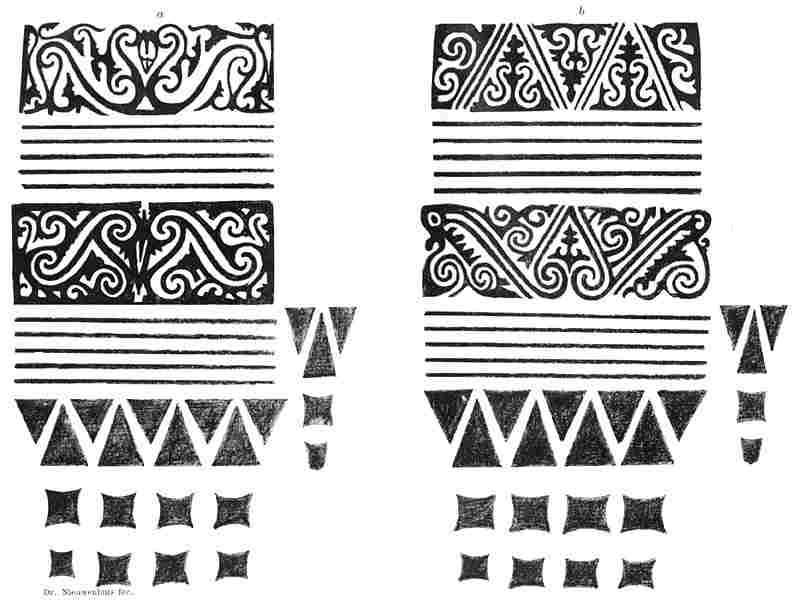
Handtätowierungen der Uma Luhat.
[467]
Fig. b auf Tafel: Tätowierung M. zeigt, in welcher Weise die Künstler eine Figur von der anderen ableiten. In der linken, oberen Ecke der unteren Verzierung ist ein Auge angegeben, von dem aus sich ein mit Zähnen versehener Kiefer nach innen und unten erstreckt. In der rechten Ecke befindet sich im Grunde die gleiche Verzierung, aber durch die Verbindung des Auges mit der weissen Linie, welche sich zwischen den zwei schwarzen befindet, ist die gleiche Figur entstanden, die wir bei der Armtätowierung der Kajan am Mendalam finden; doch ist sie dort aus der Stilisierung eines Eulenauges mit dem Bug eines Bootes hervorgegangen.
Die Kĕnjastämme vom oberen Kajan tätowieren sich auf die gleiche Weise wie die Bahau. Sie zeigen aber einige Eigentümlichkeiten, die um so bemerkenswerter sind, als die Kĕnja noch den ursprünglichen Zustand dieser Stämme repräsentieren.
Der Busang sprechende Stamm der Uma-Lĕkèn tätowiert auf eine andere Weise als die übrigen Kĕnjastämme, die ihren eigenen Dialekt besitzen. Als Beispiel für die eigentliche Kĕnjatätowierung mag die alte Methode der Uma-Tow dienen (Tafel: Tätowierung N), die neuerdings aber mehr und mehr durch die der Uma-Lĕkèn, welche derjenigen der Kajan am Balui und Mendalam gleicht, verdrängt wird. Die Frauen der Uma-Lĕkèn reisen daher jährlich zu den anderen Stämmen am oberen Kajan, um sie zu tätowieren.
Die Männer der Kĕnja tätowieren sich sehr wenig und nur zum Schmuck. Sie erzählten mir, dass die Baliau die Sitte, sich nach begangenen Heldentaten tätowieren zu lassen, von den Bukat übernommen haben.
Die alte Tätowierung der Frauen vom Stamme Uma-Tow besteht in der Hauptsache in einer Verzierung der Hände, Arme und Beine. Die Armtätowierung zeigt unterhalb des Ellbogens ein breites Band, das an der Innenseite einen 2 cm breiten Hautstreifen frei lässt (Tafel: Tätowierung N. Fig. a). Von dem Bande verlaufen bis zu den Fingernägeln Längsstreifen, die nur zweimal von Querlinien von der natürlichen Hautfarbe unterbrochen werden. Dies ist durchaus die danau-Tätowierung, welche früher bei den Busang sprechenden Baliau angewandt wurde.
Die Beinverzierungen sind auf der gleichen Tafel in Fig. b, c, d, e, f abgebildet; sie werden so angebracht, dass b vorn auf dem Schenkel [468] oberhalb des Knies, e an der Aussenseite des Beins, d unterhalb der Kniescheibe längs des Schienbeins, e darunter und f an der Innenseite des Beins zu liegen kommt. Ferner tätowieren sie auf die Wade, unter der Kniekehle, eine Verzierung, die dem Mittelstück von c gleicht.
Von den Frauen der Häuptlingsfamilie ist jedoch keine mehr auf diese Weise geschmückt, diese lassen sich alle von den Frauen der Uma-Lĕkèn tätowieren und viele panjin folgen ihrem Beispiel.
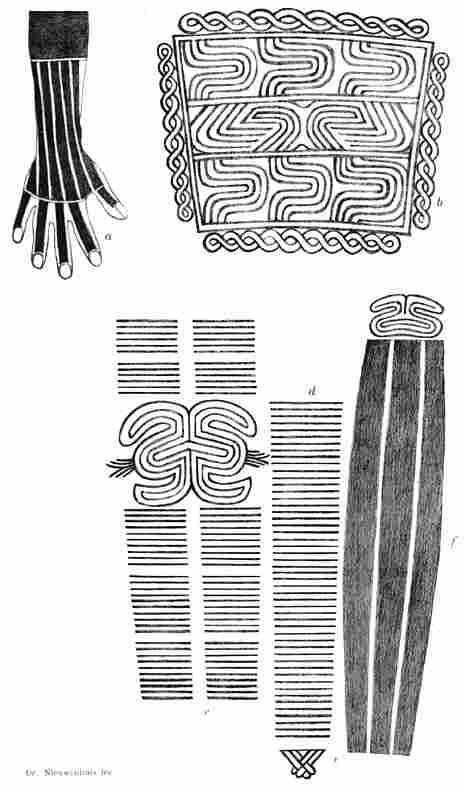
Tätowierung der Kĕnja Uma Tow.
Die Tätowierungen der einfachen und die der angesehenen Frauen unterscheiden sich hauptsächlich durch die Anzahl der verwendeten iko, Schwanzlinien, (Tafel: Tätowierung O. und P.). Die Kĕnjafrauen tragen bis zu 16 solcher Linien, die bis auf die halbe Wade hinunterreichen. Die klinge̱, die für die Lĕkèn-Tätowierung bei den Kĕnja gebraucht werden, sind sehr zahlreich. Hier ist die Tätowierung einer vornehmen Frau wiedergegeben, der allein das Recht zusteht, ein Muster mit zwei Hundeköpfen zu gebrauchen, ferner die einer panjin, bei der das Tiermotiv in den Hintergrund tritt.
An der Aussenseite des Schenkels reicht die Tätowierung bis zum halben Gesäss, an der Innenseite dagegen nur bis zur Schenkelfalte. Überdies sind die Figuren an der Innenseite des Schenkels spärlicher, weil die Haut an diesen Stellen besonders empfindlich ist. Die brauen lassen sich diese Tätowierung vor ihrer Heirat anbringen und zwar erst auf der Hinterseite des Schenkels, dann auf dem Knie und schliesslich auf der Vorderseite.
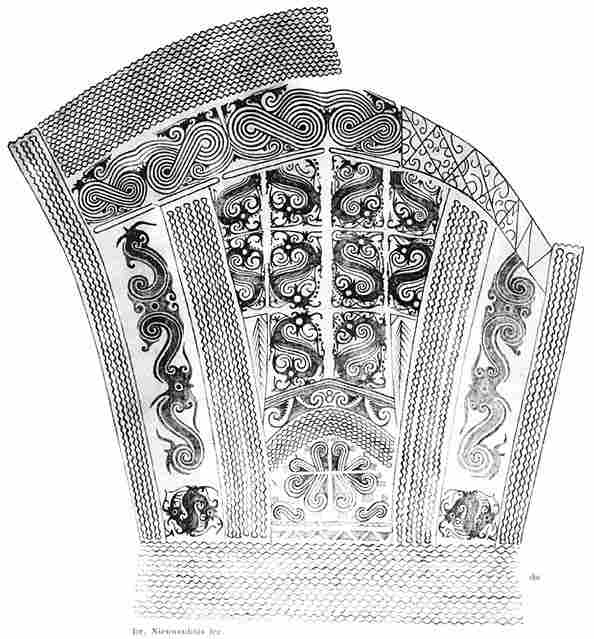
Schenkeltätowierung der Kĕnja.
Die Handtätowierung der Kĕnjafrauen stimmt im wesentlichen mit der der Mendalam Kajan überein.
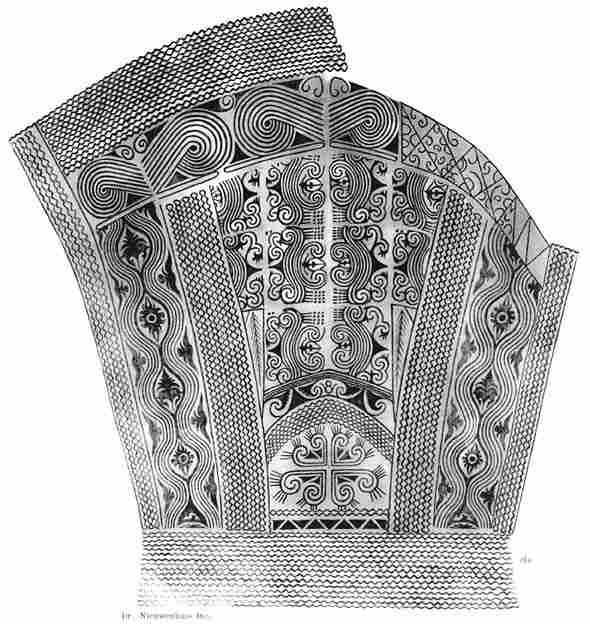
Schenkeltätowierung der Kĕnja.
[469]
Kapitel XX.
Reise zur Küste: von Long Blu-u nach Long Tĕpai—Passieren der westlichen Wasserfälle—Flössen des Rotang—In Long Dĕho bei Bo Adjāng—Aufenthalt wegen Hochwassers—Ertrinken zweier Long-Glat—Ankunft Kwing Irangs—Weiterreise mit den Kajan—Passieren des Kiham Udang—Wiedersehen mit dem Kontrolleur in Long Bagung—Begegnung mit Kĕnja—Über Uma Mĕhak, Udju Halang, Ana und Tengaron nach Samarinda.
Am 13. April fand unsere langersehnte Abreise von Long Blu-u endlich statt. Die Kajan, die durch den Bau ihrer eigenen Wohnung und andere Arbeiten daran verhindert waren, uns zur Küste zu begleiten, brachten uns jetzt nach Long Tĕpai, teils um etwas zu verdienen, teils um auch etwas für uns getan zu haben. Am ersten Taue fuhren wir bis Batu Sala, übernachteten dort und trafen bereits am Vormittag des folgenden Tages in Long Tĕpai ein.
Das Flusstal verbreitert sich vom Batu Mili an; unmittelbar an den Ufern befinden sich nur wenige Hügel und erst in grösserem Abstand sind einige Berge sichtbar. Zwischen den zahlreichen Inseln bei Lulu Njiwung wählt man, je nach dem Stand des Wassers, um die vielen Stromschnellen zu vermeiden, ein verschiedenes Fahrwasser. Von der Mündung des Mĕrasè an tragen die flachen Ufer nur Gestrüpp, niedrigen Wald und einige Reisfelder. Bei Long Tĕpai erreichen die Ausläufer des Batu Lĕsong, der sich hier dem Mahakam nähert, dessen Ufer.
Long Tĕpai stellt oberhalb der Wasserfälle die wichtigste Niederlassung der Long-Glat vor, weniger ihrer Grösse, als der Persönlichkeit ihres Häuptlings Bo Lea wegen. Der Häuptling von Lulu Njiwung, Ding Ngow, ist in bezog auf seine Geburt zwar vornehmer, er ist aber ein junger, unbedeutender Mann, während Bo Lea als bejahrter Mann und energische Persönlichkeit, trotzdem er nur der Sohn einer panjin ist, in den Augen der Bahau viel mehr Ansehen geniesst. Sein Einfluss lässt sich bereits daraus beurteilen, dass bei der Teilung der [470] Niederlassung Lirung Bān die meisten Bewohner ihm folgten (pag. 281). Als ich mich im Jahre 1896 nach dem oberen Mahakam begab, gereichte es meinem Geleite von Mendalam Kajan zur grossen Beruhigung, dass Bo Lea mit meiner Expedition einverstanden war. Nachdem ich in Long Blu-u zurückgeblieben war, begab sich Akam Igau, nur um sich Bo Lea vorzustellen, nach Long Tĕpai. Bei meinem Besuch in Long Tĕpai hatte ich damals das Glück gehabt, den Häuptling von einer akuten Diarrhoe, die ihn an den Rand des Grabes gebracht hatte, kurieren zu können.
Alle schreckenerregenden Berichte, die ich über Bo Lea zu hören bekam, liefen, wie ich später merkte, darauf hinaus, dass er seine Rechte in bezug auf die Erzeugnisse des Waldes den Malaien gegenüber besser als die anderen Häuptlinge zu wahren wusste und dass jene sich bei ihm weniger breit als anderswo machen durften. Seine Massregeln waren allerdings oft hart, entsprachen aber seiner Natur und waren übrigens auch vom europäischen Standpunkt gegenüber Vagabunden, wie die Malaien es sind, die mit allen Mitteln, die ihren Kopf nicht gefährden, bei den Bahau ein Schlaraffenleben zu führen versuchen, durchaus gerechtfertigt.
Da er, wie alle übrigen Häuptlinge, von Banden, die gegen eine Vergütung von 10% seine Wälder auf Guttapercha und Rotang durchsuchten, sehr bestohlen wurde, hatte er zwei Mal einer Gesellschaft, die die gewonnenen Produkte ohne Bezahlung auf Seitenwegen fortschaffte, ihren ganzen Vorrat abgenommen. Die Schuldigen sorgten dafür, dass diese Tat ruchbar wurde und die an dergleichen energische Massregeln nicht gewöhnten Bahau fanden sie gewalttätig und hart. Übrigens erging es den Malaien bei Bo Lea doch noch besser als bei Bĕlarè, bei dem sie sich überhaupt nicht niederlassen durften.
Bei meiner Ankunft hausten in Bo Leas Galerie so zahlreiche Buschproduktensucher, dass ich es vorzog, bei einem niedrigeren Häuptling, Bo Ibau, der mit Kwing Irangs Schwester Uniang verheiratet war, meinen Einzug zu halten. Die Kajan waren hiermit natürlich sehr einverstanden, aber aus politischen Gründen hätte ich lieber bei Bo Lea gewohnt, da die Häuptlinge ein Wohnen unter ihrem Dache sehr hoch schlitzen. Bo Ibau stellte uns seine neue, 18 m lange und 8 m breite Galerie gänzlich zur Verfügung.
Fast alle Hausbewohner befanden sich der Ernte wegen auf den Reisfeldern. Im Hause traf ich nur Bo Ibau mit seiner kranken, kleinen [471] Tochter. Barth hatte das Kind bereits zu behandeln versucht, aber es hatte das bittere Chinin nicht einnehmen wollen und litt noch fortwährend an chronischen Malariaanfällen, auch sah es kachektisch aus und zeigte eine starke Hypertrophie von Leber und Milz. Ich verspürte jedoch wenig Lust, mich dem verwöhnten Kinde viel zu widmen und interessierte mich mehr für das, was von dem Kontrolleur und seiner Reise nach Long Dĕho bekannt war als vorsichtiger Mann wollte mir Ibau über diesen Gegenstand nichts mitteilen und erklärte, dass ich Njok Lea, den ältesten Sohn des Häuptlings, der den Kontrolleur selbst nach Long Dĕho begleitet hatte, hierüber befragen müsse. Da Njok erst abends vom Felde zurückkehrte, machte ich, nachdem ich unseres Gepäckes wegen einige Anordnungen getroffen, einen Gang durch die Niederlassung, um die seit meinem letzten Besuch staugefundenen Veränderungen zu besichtigen.
Die Niederlassung macht einen gut unterhaltenen, aber alten Eindruck, da man zum Bau altes Material, hauptsächlich Pfähle und Querbalken aus Eisenholz, von Lirung Bān, benützt hatte. Hinter dem langen, hohen Hause am Ufer, in dem 16 Familien wohnen, steht ein zweites, gleich langes Haus, das mit dem ersten durch Bretterstege verbunden ist. Sowohl diese Häuser als die anderen und die der Häuptlinge Bo Lea und Bo Ibau sind durch derartige Stege verbunden, so dass man die ganze Niederlassung, ohne den Boden zu berühren, passieren kann.
Während unter den Häusern der meisten Bahau nur die nackte Erde mit allen Abfällen des Hauses zu sehen ist, ist der Boden unter den Wohnungen der Long-Glat zur Hälfte gedielt, auch führen von hier aus in jede Einzelwohnung Treppen. Der übrige Teil des Raumes ist durch Verschläge, in denen Ferkel oder besonders schöne Schweine gezogen werden, eingenommen. Die Long-Glat bauen ihre Häuser ohne Galerieen, die ihnen unterworfenen Stämme haben sich aber, trotzdem sie über ein Jahrhundert mit ihnen zusammenwohnen, neben anderen Eigentümlichkeiten, auch ihren alten Baustil erhalten. Ihre langen Häuser ruhen, wie die der übrigen Bahau, auf Pfählen und besitzen eine durchlaufende Galerie. Bo Leas Haus liegt unterhalb derjenigen der übrigen Long-Glat, dann folgen die der Ma-Tuwān, Batu-Pala und Long-Tĕpai.
Ein Glied der Häuptlingsfamilie der Ma-Tuwān erzählte mit Stolz, dass der Kontrolleur die letzten Tage in ihrer Galerie gewohnt hatte, aus Furcht, durch das lāli parei der Long-Glat aufgehalten zu werden, [472] da er beim ersten Fallen des Wassers weiterreisen wollte. Der Felsblock, an dem der Wasserstand abgelesen wurde, war aber während der ganzen Verbotszeit der Long-Glat unter Wasser geblieben, so dass der Kontrolleur sich längere Zeit bei ihnen hatte aufhalten müssen. Zu meiner Zufriedenheit hörte ich, dass die Frau des Häuptlings ihren ganzen Satz klinge̱ te̥dăk (Tätowierbrettchen) dem Kontrolleur verkauft hatte. Ich hatte nämlich Barth gebeten, jede Gelegenheit, schöne Gegenstände aufzukaufen, zu benützen, und ihn mit allem Nötigen versehen.
Spät abends kehrte Njok Lea von seinem Reisfeld am Tĕpai zurück; man schien ihn vor uns gewarnt zu haben, denn er liess seine Familie und, die seines Vaters auf dem Felde übernachten. Er empfand eine gewisse Genugtuung, dass es den Kajan noch immer nicht geglückt war, die Reise mit mir zu unternehmen, auch berichtete er mit Stolz, dass er dem Kontrolleur nach Long Dĕho das Geleite gegeben hatte und dass er ihn noch weiter gebracht hätte, wenn der Kontrolleur nicht dort auf mich hätte warten wollen. Er erzählte ferner, dass Bang Jok unterhalb der Wasserfälle einen Wachtposten aufgestellt hatte, um ihn, sobald wir nach unten kämen, zu benachrichtigen, und dass er damals mit Frau und Kindern sein Haus eiligst verlassen hatte. Der alte Häuptling Bo Adjāng Lĕdjü und dessen Familie waren aber zu Hause geblieben und hatten Barth freundlich empfangen.
Obgleich sie vom Kontrolleur bereits gut bedacht worden waren, kehrten die Häuptlingsfamilien in den folgenden Tagen von ihren Reisfeldern heim, um auch von mir Geschenke in Empfang zu nehmen. Glücklicher Weise hatte ich darauf gerechnet und von Anfang an einige Sachen bei Seite gelegt. Es zeigte sich, dass der Satz Armbänder aus Elfenbein, den ich einstens Hinan Lirung gegeben hatte, seine Wirkung bis hierher geltend machte, denn Bo Lea bat sich für seine Frau den gleichen Schmuck aus. Ich ging bei der Austeilung der Geschenke mit Überlegung zu Werke, da ich sehr viele Menschen und noch dazu nach ihrem Range zu beschenken hatte. Darauf blieb mir nichts weiter zu tun übrig, als Patienten zu behandeln und auf den Neumond zu warten, an dem Kwing Irang kommen sollte. Als ich von diesem nichts hörte und einige Gerüchte über seine Ankunft sich als falsch erwiesen, wuchs meine Ungeduld aufs neue. Des hohen Wasserstandes wegen kamen auch aus Long Dĕho keine Böte heraufgefahren, so dass ich sehr froh war, als sich vier [473] Fremde dazu überreden liessen, mit einem kleinen Boot, das sie über die Felsen tragen oder ziehen konnten, nach Long Dĕho zu fahren, um dem Kontrolleur einen Brief zu übergeben.
Zu unserem Trost fanden wir hier bei den Long-Glat mehr zu essen als in den letzten Monaten bei den Kajan. Unsere Schutzsoldaten schossen in der Nähe einiger Salzquellen in kurzer Zeit ein wildes Rind und zwei Hirsche, die nicht nur frisches Fleisch, sondern auch Proviant für die Reise lieferten. Das Konservieren von Fleisch durch Räuchern und Salzen war mir früher mehrmals missglückt; Bier, der die Arbeit diesmal auf sich nahm, erzielte ein gutes Resultat, indem er das Fleisch in Stücke, die 2–3 dm lang, 1½ dm breit und 3–4 cm dick waren, schneiden und einen Tag lang über einem Holzfeuer trocknen und räuchern liess. Selbst das fette Schweinefleisch liess sich auf diese Weise aufbewahren. So hatten wir von der Menge Fleisch, die ein grosses Stück Wild liefert, mehrmals einige Wochen essen können, was uns bei Stämmen, die nur eine geringe Anzahl Hühner hielten und bei denen auch der Fischfang wenig ergab, sehr willkommen war.
Meine Gesandten brachten erst am 28. April, nachdem das Wasser stark gefallen war, aus Long Dĕho den Bericht, dass unsere ganze Gesellschaft dort längere Zeit geblieben war und mit den Bewohnern auf freundschaftlichem Fuss verkehrt hatte, dass sie aber aus Furcht, wiederum durch Hochwasser aufgehalten zu werden, den günstigen Wasserstand benützt hatte, um den Fluss weiter hinunter zu fahren. Der Kontrolleur war, als unsere Gesandten ihre Rückreise antraten, bereits abgereist, während Bier sich sogar einen Tag vorher aufgemacht hatte, um den Fluss zu messen.
Das Wasser fiel ständig, daher suchte ich zum soundsovielten Male, Bo Lea und Bo Ibau dazu zu bewegen, mir über die Wasserfälle zu helfen. Die beiden Häuptlinge waren nämlich, aus Furcht vor Kwing Irang, dem daran gelegen war, uns persönlich zu begleiten, bisher meinem Drängen gegenüber taub geblieben.
Ein wichtiger Umstand kam mir zu Hilfe. Hadji Umar hatte durch meine Leute Njok Lea melden lassen, dass dieser mit den 600 Packen Rotang, die sie gemeinschaftlich besassen, so schnell als möglich hinabfahren solle, um die Ware mit ihm unten am Mahakam zu verkaufen. Das half. Nun fand sich plötzlich eine genügende Anzahl junger Leute zur Reise bereit und obwohl ich wusste, dass es ihnen [474] hauptsächlich um den Rotang zu tun war, erfreute mich die Aussicht, wieder ein Stück weiter zu kommen, doch zu sehr, um dem Zufall nicht dankbar zu sein. Eine Verzögerung von einigen Tagen wurde noch dadurch bewirkt, dass einige Leute vom Mĕrasè berichteten, Kwing Irang sei im Begriff aufzubrechen und Sorong befinde sich bereits am Mĕrasè. An diesem Tage traf jedoch niemand ein und als ich am folgenden einige Männer in einem Boot nach oben auf Kundschaft schickte, kamen sie mir abends melden, dass man dort nichts wisse. In der Ungewissheit, ob es Kwing Irang jemals gelingen würde, abzureisen, beschloss ich, die Reise mit Njok Lea zu unternehmen. Dieser hatte es nun mit seinem Rotang so eilig, dass er nicht einmal dafür war, ein Boot zu Kwing Irang zu senden, um zu sehen, wie es dort stand.
Am 3. Mai sollten wir wiederum warten, weil einer der Reisegenossen noch nicht vom Reisfelde zurückgekehrt war, aber ich setzte die Abreise doch leicht durch. Es schlossen sich uns auch einige Böte mit Frauen und Kindern an, die unter unserem Schutze Familienglieder in Long Dĕho besuchen wollten. Um 9 Uhr brachen wir auf und zwar ohne den Rotang, der, aus Mangel an Hilfskräften, erst nachdem man uns bis oberhalb der Wasserfälle gebracht hatte, abgeholt werden sollte.
Bei Long Tĕpai beträgt die Breite des Mahakam 200 m, unmittelbar unterhalb der Niederlassung wird das Flussbett aber von hohen, felsigen Ufern eingeengt. Dabei treten bei niedrigem Wasserstande zahlreiche Felsblöcke aus dem Flussbett hervor, so dass eine grössere Anzahl Böte nur hinter einander dem gewundenen Fahrwasser folgen kann. Nach einstündiger Fahrt erreichten wir, nachdem der Kiham (Wasserfall) Hulu in dieser günstigen Zeit mit einiger Vorsicht hatte befahren werden können, den mir von 1897 her bekannten Lagerplatz oberhalb des Kiham Hida, von dem aus das Gepäck und die Böte eine grosse Strecke weit getragen werden mussten.
An der Stelle, an der wir uns eben befanden, windet sich der Mahakam um den Batu Ajo; an seinem rechten Ufer erheben sich beinahe horizontale Sandsteinschichten in senkrechten, über 100 m hohen Wänden, während am linken Ufer ein viel höheres Gebirge, der Ong oder Batu Hida, steil aufsteigt. Da der Fluss sich sein Bette in den harten, weissen Hornstein, der in ½-1 m mächtigen Schichten unter dem Sandstein liegt, hat erodieren müssen, ist sein Bette über eine etwa 2 km weite Strecke sehr schmal und die Wassermassen, [475] die bei Long Tĕpai noch eine Breite von 200 m zur Verfügung hatten, drängen sich hier durch einen 15–20 m breiten Spalt hindurch.
Diese Stelle kann nur bei sehr tief stehendem Wasser passiert werden, da bei hohem und besonders bei steigendem Wasserstande die Strömung sehr reissend ist. Auch im günstigsten Falle muss alles Gepäck aus den Böten genommen werden. An den schwierigsten Stellen werden die kleineren Böte mit Hilfe von Baumstämmen, welche als Rollen benützt werden, über die Felsen gezogen, während die grossen Böte, die alle mit einem sehr hohen Rande versehen sein müssen, von den Männern über die Fälle gefahren werden müssen. Das Gepäck wird auf den Felspfaden des linken Ufers hinabgetragen. Die Stellen, an denen Felsen oder Geröllbänke grössere Fälle verursachen, oder die ihrer Enge wegen besonders gefährlich sind, tragen, von oben nach unten gerechnet, folgende Namen: Kiham Hulu; K. Hida; K. Nöb; K. Lobang Kubang; K. Binju; K. Bĕnpalang; K. Kĕnhè.
Sobald wir oberhalb des Kiham Hida angelangt waren, ging ein Teil der Männer Rotang für unsere Böte suchen, ein anderer begab sich nach Long Tĕpai zurück, um nun auch die Bündel Rotang hinunter zu befördern.
Njok Lea hatte den Rotang, der unter seinem Hause aufbewahrt lag, bereits am Tage zuvor in dicke Bündel binden und diese am gleichen Morgen ins Wasser bringen lassen. Die Bündel (gulung) bestehen in der Regel aus 40 Stücken Rotang von 3–4 Faden Länge, die mit Rotangtauen zusammengebunden werden. Für den Transport zu Wasser vereinigt man diese gulung zu Bündeln von 1 m Durchmesser und lässt sie einfach von der Strömung abwärts treiben, wobei einige in den Wasserfällen zwar auseinander gerissen werden und verloren gehen, die meisten aber heil ankommen. Unterhalb der Wasserfälle werden die Bündel zu Flössen zusammengefügt, die je von einem Steuermann flussabwärts gelenkt werden. Nach einiger Zeit kehrten die Männer zu uns zurück und bald darauf trieb ein Rotangbündel nach dem anderen an uns vorbei und suchte sich durch die brausenden Wasser massen seinen Weg. Einige Männer fingen die Bündel in dem ruhigen Becken auf, das sich unterhalb des Lobang Kubang befindet, und banden sie dort vorläufig fest, um sie später die folgenden Fälle hinuntertreiben zu lassen.
Mit Rücksicht auf den vorausgeschwommenen Rotang wurde es für ratsam gehalten, nicht am Kiham Hida, sondern weiter unten das Lager aufzuschlagen, und so beeilte man sich, alles wertvolle Gepäck [476] und die Kisten mit Ethnographica dorthin zu schaffen. Die Familien, die mit uns reisten, hatten gleich nach ihrer Ankunft begonnen, ihr Gepäck so weit als möglich abwärts zu tragen. Da sie einen grossen Reisvorrat mitgenommen hatten, um ihn in Long Dĕho, wo Reismangel herrschte, zu hohen Preisen zu verkaufen, hatten sie sehr grosse Lasten zu befördern. Trotzdem hatten sie es so eilig, weiterzukommen, dass sie nicht mit uns Schritt hielten. Als sie daher weiter unten, statt den Reis mit uns über Land zu transportieren, die kleineren Wasserfälle hinunterfahren wollten, schlugen ihre zu schwer beladenen Böte um und die Männer verloren zwar nicht ihr Leben und ihre Böte, aber ihren kostbaren Reis.
Ich sorgte dafür, dass alles, was getragen werden konnte, aus den Böten geholt wurde; alle Pflanzen mussten natürlich im grossen Boot bleiben, ebenso die grossen Kisten. Obwohl ihm sein Rotang sehr am Herzen lag, traf Njok Lea, in gleicher Weise wie früher Akam Igau und Kwing Irang, alle Vorsichtsmassregeln beim Transport, so dass kein Boot umschlug und keine Kiste fiel. Nachts sank das Wasser noch um einen halben Meter, die grossen Böte konnten daher am folgenden Morgen ohne grosse Gefahr die Fälle passieren. Da die Kajan unter Kwing Irang 1897 das grosse Boot mit lebenden Pflanzen wohlbehalten nach unten geschafft hatten, lag den Long-Glat viel daran, ihnen an Geschicklichkeit nicht nachzustehen. Sie wussten auch, dass ich damals durch die beiden Fälle Binju und Kĕnhè gefahren war, und schlugen mir vor, es diesmal auch mit ihnen zu versuchen. Das Wagstück erschien mir nicht gross und ich befand mich bereits mitten auf dem Fluss, als ich am Ufer Njok Lea bemerkte, der aus Verzweiflung über unser ruchloses Unternehmen die Arme in die Luft erhob; doch verloren seine Leute das Vertrauen nicht.
Der Kiham Binju, der auf den Lobang Kubang folgt, stellt eine verengte Flussstelle mit heftiger Strömung dar, aus welcher hohe Felsblöcke hervorragen. Mit einiger Vorsicht legt man die erste Strecke gut zurück, dann aber wird das Boot von einer Stromschnelle gepackt und geradeaus auf eine alleinstehende Felsspitze geschleudert. Die Wassermassen, die rechts vom Felsen verhältnismässig ruhig fortströmen, prallen etwas weiter unten an das hohe Ufer an, links aber bilden sie einen Strudel, dessen mittlerer Trichter bei normalem Wasserstande sicher einen Meter tief ist. Da man, um rechts weiter unten nicht [477] an das felsige Ufer geschleudert zu werden, über diese Stelle hinweg muss, kann sie nur von langen, schweren Böten, die mit grosser Geschwindigkeit ankommen und sich daher nicht leicht ablecken lassen, überwunden werden. Das Wagstück gelang, aber Njok Lea liess es doch nicht zu, dass Demmeni uns in dem zweiten grossen Boote folgte. Wir übernachteten unterhalb des Binju. Die Nacht blieb trocken, aber morgens hörten wir es im Osten gewittern, auch fiel ein schwacher Regen. Der Fluss begann sogleich zu steigen, doch ist, um den Kiham Kĕnhè zu passieren, ein hoher Wasserstand günstiger als ein sehr niedriger. Wir beeilten uns daher mit unserer Mahlzeit und fuhren bis zum Anfang des Kĕnhè. Hier beschlossen wir, das Gepäck nicht auf dem Bergpfade nach Hait Aja (grosser Sand), unserem nächsten Lagerplatz, tragen zu lassen, sondern mit ihm die Fahrt zu wagen.
Der Wasserstand war für mein grosses Boot gerade der richtige und ich begann die Fahrt, wie früher bereits, stehend. Die heftige Strömung brachte aber das Fahrzeug so sehr ins Schwanken, dass ich mich setzen musste, um nicht umzufallen, und gleich hinter Kĕlang Gak, wo sich ein kleiner Fluss über 50 m hohe Felsen in den Mahakam ergiesst, schlug eine Welle über das Boot. Der grosse Bootsraum füllte sich aber nicht so leicht mit Wasser und da wir uns hier am Ende der Flussenge befanden, beunruhigten wir uns nicht. Im Kĕnhè werden die Wassermassen durch zwei hohe Felsen in einem sicher nicht über 15 m breiten Bette wie durch einen Trichter gepresst, derart, dass sie in der Mitte wild dahinschiessen, zu beiden Seiten aber einige Meter weit ruhiger strömen. Die Bemannung musste nun das Boot nicht nur in diesem ruhigeren Wasserstreifen zu halten suchen, sondern es auch schneller als die Strömung fortbewegen, da es sonst am hinteren Ende gepackt und mit der Spitze gegen die Felswand oder in das tobende Wasser gedreht worden wäre; in beiden Fällen schlägt das Boot um und zerschellt in der Regel vollständig.
Bevor meine Leute noch längs des Uferpfades Demmeni erreicht hatten, um auch ihn im zweiten grossen Boot durch den Kĕnhè zu befördern, stieg das Wasser um 6 Meter. Die Felsen am Anfang des Kĕnhè wurden fast gänzlich überflutet und weiter abwärts geriet die ganze Wasserfläche in Aufruhr und bildete zwei grosse Strudel, über die unser Boot aber noch gut hinwegkam. Schlimmer erging es dem Malaien Bang W-ā, der mit uns nach Udju Tĕpu reisen wollte, weil er sich nach der Ermordung seines Halbbruders Adam bei den Bahau [478] nicht mehr sicher fühlte. Der Mann hatte sein kleines Boot hinter das grosse von Njok Lea gebunden, wurde aber vom Strudel losgerissen und verschwand in der Tiefe. Nach einiger Zeit kam er aber, zur grossen Belustigung der Long-Glat, mit seinem Boote wieder nach oben und wurde von ihnen für den Verlust seiner Sachen so reichlich entschädigt, dass er sein Untertauchen kaum zu bereuen hatte. Des mit enormer Schnelligkeit steigenden Wassers wegen machten sich die Leute um die Rotangbündel, die oberhalb der letzten Fälle angebunden waren, Sorgen. Nach einiger Zeit wurden auch die ersten Bündel heruntergetrieben und bei Halt Aja, wo das Wasser stiller wurde, mit vieler Mühe ans Land gezogen. Einige Männer begaben sich zu Fuss wieder nach oben, um auch die übrigen Bündel zu lösen, damit sie nicht hoch auf den Felsen liegen blieben, von wo man sie bei niedrigem Wasserstande nur schwer in den Fluss hätte schaffen können. Viele wurden auf dem Wege nach unten zwischen Felsblöcken und Baumstämmen eingeklemmt und mussten befreit werden. Glücklicher Weise blieben die Bündel heil und kamen, nachdem man auch noch den folgenden Tag mit ihnen zu tun gehabt hatte, wohlbehalten an.
Eine Gesellschaft Buschproduktensucher, Kahájan Dajak, die uns entgegen kam, berichtete, dass sie dem Kontrolleur unterhalb des Kiham Halo, wo er sein Lager aufgeschlagen hatte, begegnet war. Da das Wasser ebenso schnell fiel als es gestiegen war, konnten wir am 7. Mai ruhig nach Long Dĕho weiterfahren.
Bei unserer Ankunft trafen wir nur den alten Häuptling Bo Adjāng Lĕdjü mit einer grossen Anzahl weiblicher Familienglieder zu Hause. Wir wurden in dem verlassenen Hause des Malaien Inoi empfangen, der aus Bandjarmasin gebürtig und hier einige Jahre als Schreiber und Berater Bang Joks tätig gewesen war. Er hatte mit vielen seiner Stammesgenossen in einer der Schulen, welche die Rheinische Mission in der “Zuider-Afdeeling” errichtet hat, seine Bildung genossen. Auch Barth hatte in seinem Hause gewohnt. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, begannen wir Umschau zu halten und die alten Bekannten zu begrüssen.
Obgleich Long Dĕho ein sehr grosses Dorf ist, eine zahlreiche Bevölkerung enthält und von Händlern von der Küste, die hier vor allem in Buschprodukten Handel treiben, viel besucht wird, sieht es doch baufälliger und vernachlässigter als die Niederlassungen weiter oben am Flusse aus. Dies ist zum Teil der geringen Energie der [479] Bewohner zuzuschreiben, die in Übereinstimmung hiermit unter allen Mahakamstämmen am meisten an Nahrungsmangel leiden.
Der greise Bo Adjāng, der mich vor zwei Jahren noch humpelnd in meiner Wohnung besucht hatte, war inzwischen so zusammengefallen, dass er abgezehrt und mit geschwollenen Gelenken bewegungslos auf seiner Matratze sass und sich von seinen zahlreichen Töchtern und Frauen pflegen liess. Er musste ungefähr 90 Jahre alt sein, denn er erinnerte sich noch, mit etwa 15 Jahren, Georg Müller 1825 bei seinem Vater gesehen zu haben. Adjāng war nämlich der jüngste Sohn des berühmten Long-Glat-Häuptlings Bo Lĕdjü Aja, der seiner siegreichen Kriegszüge wegen als der Napoleon von Borneo bezeichnet worden ist. Da die Bahau in Bezug auf alles, was die Ermordung von Georg Müller betrifft, sehr verschlossen sind, hatte ich mit Adjāng, als einem Augenzeugen, Bekanntschaft geschlossen. Er erzählte, dass Georg Müller ein Mann mit einem grossen Bart gewesen sei; auch zeigte er min Müllers Feuersteingewehr, das ich ihm abkaufte. Adjāng war infolge seines Alters minder zurückhaltend als die anderen und berichtete mir einiges über Müllers trauriges Ende (pag. 281).
Wie ich mich bei Bo Adjāng überzeugen konnte, wird die Vielweiberei bei den Long-Glat-Häuptlingen unter malaiischem Einfluss in weit höherem Grade als oberhalb der Wasserfälle betrieben. Von Adjāngs zahlreichen Frauen lebten noch fünf, von denen zwei zur Arbeit bereits zu alt waren, drei aber alle Dienste verrichteten, die anderswo den Sklavinnen zufallen. Eine der Frauen war so jung, dass sie erst seit wenigen Jahren seine Gattin sein konnte. Ferner waren vier verheiratete Töchter anwesend, weil der Tod des kranken Vaters jeden Augenblick erwartet wurde.
Adjāngs ältester Sohn, Ibau Adjāng, und zwei Sklavinnen vervollständigten die Familie, deren Zusammenleben durch Zwistigkeiten aller Art so unangenehm geworden war, dass man seit meinem vorigen Besuch ein grosses Wohngemach angebaut hatte, in dem nun zwei Frauen mit ihren Kindern getrennt lebten. In dem gleichen Genrache hatten auch Ibau Adjāng und seine Schwester Dèw Adjāng ihre eigenen Kammern, in denen sie schliefen und ihr Privateigentum bewahrten.
Am folgenden Morgen hatte ich meine Toilette noch kaum beendet, als vier von Adjāngs Frauen bei mir eintraten und meine Tauschartikel, von denen ihnen der Kontrolleur viel erzählt hatte, besichtigen wollten. Barth selbst hatte seinen Vorrat bereits in Long Tĕpai [480] fast gänzlich erschöpft und so hatte man alle Erwartung auf mich gespannt. Ich fühlte mich der Häuptlingsfamilie gegenüber ohnehin verpflichtet, und da Bang Jok geflohen war, kam meine Freigebigkeit der Familie Adjāng Lĕdjüs zugute. Zuerst musste ich wiederum die Armbänder aus Elfenbein zeigen; vorsichtshalber holte ich auch nur diese aus der Kiste hervor. Von den Frauen hatte keine ein grosses Geschenk von mir zu beanspruchen, aber die einen waren etwas angesehener oder sympathischer als die anderen, so dass ich bald merkte, dass ein Satz Armbänder nicht genügen würde. Die vier vorhandenen Sätze wurden auch sogleich von den Damen in Beschlag genommen, doch sahen sie ein, dass ich sie unmöglich alle abtreten konnte; da sie sich jedoch ebensowenig von den Armbändern zu, trennen vermochten, verfielen sie auf den Ausweg, mir hübsche Perlenmützen und andere kostbare Perlenverzierungen als Gegengeschenk anzubieten. Die einen zeigten sich hierin freigebiger als die anderen, und so gelangte ich in kurzer Zeit zu mehreren schönen Stücken, die ich auf andere Weise nicht hätte erwerben können. Mit diesen Unterredungen und der Behandlung Adjāngs, den ich von Fieber und Husten befreien sollte, und vieler anderer Kranken verging der Tag. Da ich den günstigen Wasserstand noch benützen wollte, um die folgenden Wasserfälle zu passieren, war ich sehr wenig erbaut, als abends die Nachricht kam, dass es Njok Leas Leuten noch nicht gelungen war, allen Rotang von Hait Aja abzuholen; überdies mussten die Bündel hier von neuem gebunden werden.
Sĕkarang hatte, durch die Erfahrung belehrt, bereits abends zuvor alle Pflanzen unter dem Palmblattdache des grossen Bootes hervorholen und an Land bringen lassen. Da er dies bei jedem Aufenthalt tun liess, litten seine Pfleglinge nur während der Fahrt durch Hitze, Dunkelheit und schlechte Luft. Sie sahen in der Tat nach unserer Ankunft am unteren Mahakam nicht schlechter als am oberen aus.
Während ich als Arzt einen Rundgang durch die Niederlassung machte, wurde es mir plötzlich klar, warum es mit dem Herbeischaffen des Rotang so langsam vorwärts ging; in der einen Familie, in der sich ein hübsches junges Mädchen befand, traf ich den einen Long-Glat, in einer anderen den anderen u.s.f. Die jungen Leute, die Njok Lea mitgenommen hatte, fanden hier so viele Bekannte und liebe Verwandte, dass sie in den ersten Tagen nur für diese Sinn hatten und Njok Lea nicht viel mit ihnen anstellen konnte. Nachts [481] lag er auch beinahe allein in dem grossen Raume, der den Long-Glat in unserem Hause angewiesen worden war, während die übrigen die Vorrechte genossen, welche die unverheirateten Frauen den Junggesellen gewähren dürfen. Erst am dritten Tage waren alle Bündel geordnet, aber noch nicht zu einem Floss, das man schon hier zusammenstellen wollte, vereinigt worden. Das Wasser war indessen wieder gestiegen und die Geröllbank, die am jenseitigen Ufer den richtigen Wasserstand für das Passieren der unteren Wasserfälle angab, war bereits überschwemmt.
In meiner Besorgnis, durch Hochwasser in Long Dĕho aufgehalten zu werden, begrüsste ich am anderen Morgen die wenigen Grashalme, die auf der Geröllbank hervortauchten, mit Freude, und da das Wasser stets weiter fiel, suchte ich Njok zur Abreise zu überreden. Der grossen Gefahr wegen weigerten sich viele, aber ich liess alles Gepäck in meine Böte bringen, erstens um in der Nähe des Kiham Udang, des gefährlichsten Falles zu sein, sobald das Wasser eine Fahrt auf demselben zuliess, zweitens um auf die Long-Glat einen Druck auszuüben. Njok zeigte sich endlich, wenn auch zögernd, damit einverstanden, uns in den zwei grossen Böten weiter zu befördern; für die kleinen wäre die Reise zu gefährlich gewesen, was ich nur zu bald selbst merkte, denn obgleich ich früher bereits bei günstigem Wasserstande diesen Teil des Flusses hinabgefahren war, hatte ich nicht gedacht, dass ein Unterschied von zwei Fuss im Niveau des Wassers einen solchen Einfluss auf die Strömung haben könnte. Gleich hinter den beiden, von den Long-Glat abhängigen Niederlassungen Batu Pala und Uma Wak verengt sich das Flussbett von 150 auf 75 m und weiter unten bahnt sich der Fluss zwischen grossen Sandsteinfelsen (Batu Brāng), die nur etwa 40 m von einander entfernt sind, einen Weg. Nachdem wir hier mit grosser Geschwindigkeit hindurch gefahren waren, gerieten wir an eine Stelle, wo das gestaute Wasser, das sich plötzlich verbreiten kann, sehr gefährliche Strudel bildet, die wir nur dank der Schwere unserer Böte und der Geschicklichkeit unserer Mannschaft überwinden konnten. Weiterhin wird der Fluss durch hohe, senkrechte Wände wiederum in ein schmales, nur 60–70 m breites Bette gezwängt, so dass ich der stets heftig bleibenden Strömung wegen schliesslich doch bereute, nicht gewartet zu haben. Ich hoffte jedoch auf ein baldiges Fallen des Wassers und bat daher Njok, der nach Long Dĕho zurückkehrte, so schnell als möglich nachzukommen. [482]
Den Udang zu passieren war unmöglich, denn in seiner engen Schlucht schlugen die zusammengepressten Wassermassen in hohen Wellen empor, während halbuntergetauchte Felsen unregelmässige Strömungen verursachten. Dreihundert Meter weiter aufwärts befand sich aber am linken Ufer eine kleine, von Felsen eingeschlossene Bucht, in der bei normalem Wasserstande Sand und Äste blosslagen, jetzt aber zwei Meter tiefes Wasser stand, das zum Unterbringen unserer Böte gerade genügte. Njok begab sich zu Lande nach Long Dĕho zurück und zwar schweren Herzens, da er mich nicht dazu bewegen konnte, mit ihm zu gehen, und uns allein mit unseren Malaien und Javanern zurücklassen musste. Wir litten jedoch weniger durch den Gedanken an irgend welche Gefahren als durch den Ärger über das Steigen des Wassers und verbrachten im übrigen in unseren Böten eine sehr ruhige Nacht.
Das Wasser war morgens noch nicht gefallen; ich liess daher auf dem hohen Uferwall einen Platz aushauen, auf dem Sĕkarang die Pflanzen der frischen Luft aussetzen konnte. Kurz darauf erschienen fünf Long-Glat, die Njok in seiner Besorgnis geschickt hatte, um auf uns und unsere Böte zu achten. Sie erzählten, dass Njok am vorigen Abend vor Erregung nicht hatte essen können. In unserem feuchtkalten Schlupfwinkel, in wenigen Metern Abstand vom brausenden Fluss, verbrachten wir drei Tage, während welcher das Wasser abwechselnd 6 m stieg und dann um ebensoviel wieder fiel. Da der Wald sehr steil anstieg, konnten wir uns keine Bewegung verschaffen, doch gewährte das wilde Tosen der Wasser im Kiham Udang einen prachtvollen Anblick.
Am 16. Mai, als das Wasser zwar etwas gefallen war, aber doch noch mit grosser Schnelligkeit an unserem Schlupfwinkel vorüberschoss, äusserten des Morgens vier unserer Long-Glat den Wunsch, mit ihrem Boot bis nach Uma Wak zurückzufahren, um dort ihren Vorrat an Sirihblättern zum Betelkauen zu erneuern. Obgleich ich das Unternehmen sehr gewagt und mit dem Anlass in keinem Verhältnis fand, war ich doch zu sehr daran gewöhnt, mich in derartigen Angelegenheiten der Meinung der Bahau zu fügen, die vom Befahren dieser Flüsse so viel mehr als die Weissen verstehen, als dass ich mich ernsthaft ihrem Wunsch widersetzt hätte.
Eine Stunde darauf, als wir neben einander auf dem Uferwall sassen, bemerkten wir ein Boot mit Schilden, das an uns vorüber trieb, als [483] hätte es sich eben vom Ufer gelöst. Wir beunruhigten uns daher keineswegs, fanden es aber schade, dass die Strömung zu heftig war, um das Boot durch Schwimmen vom Untergang im Udang zu retten. Wir mussten ruhig zusehen, wie es dort von den Wellen einige Male emporgehoben, mit Wasser gefüllt und in die Tiefe gezogen wurde.
Zu unserer Verwunderung erschien ungefähr eine Stunde darauf einer der vier Long-Glat, Lugat, mit einigen Bewohnern von Uma Wak und fragte uns, ob sein Bruder Adjāng und Ibau nicht bei uns seien. So viel wir aus seiner verworrenen Erzählung begriffen, waren sie in ihrem Boot hinaufgefahren, aber bald von einem Strudel erfasst worden, wobei Lugat aus dem Boote geschleudert wurde. Nachdem dieser, nach längerem Kampf mit dem Wasser, die Oberfläche erreichte hatte, rettete er sich schwimmend ans Ufer. Dort fand er den einen Gefährten, Dja-āng, dem es ebenso ergangen war. Von den beiden anderen wussten sie nichts. Da sie an diesem Tage nicht zurückkehrten, waren sie augenscheinlich ertrunken. Den Leuten von Uma Wak traten die Tränen in die Augen, als sie hörten, dass die beiden nicht bei uns waren, und Lugat brach in heftiges Weinen aus, rief nach Adjāng und Ibau und machte sich Vorwürfe, dass er nicht besser für sie gesorgt hatte.
Demmeni und ich standen selbst noch so sehr unter dem Eindruck des plötzlichen Todes der beiden tüchtigen jungen Leute, mit denen wir kurz zuvor gescherzt hatten, dass wir keine Trostworte fanden. In unserer unglücklichen Lage und in dieser wilden, finsteren Umgebung fühlten wir uns durch das Geschehene doppelt niedergeschlagen. Schwere Wolken hingen über uns und ununterbrochen fiel ein feiner Staubregen.
Im Lauf des Tages traf Njok tief betrübt bei uns ein. Obgleich ich indirekt an dem Unglück die Schuld trug, indem ich zu früh von Long Dĕho aufgebrochen war, hörte ich kein Wort des Vorwurfs; nur betrauerten alle den Verlust der Ihrigen und Lugat quälte sich unaufhörlich mit Selbstvorwürfen.
Die Leute von Long Dĕho und Uma Wak kehrten mit Njok nach Hause zurück und liessen andere Dorfgenossen bei uns. Am anderen Morgen kam Njok zu uns und sagte, er habe abends mit anderen beschlossen, hier neun Tage zu verbringen, da die Leichen, die er gern begraben wollte, in dieser Zeit an die Oberfläche kommen würden. Die Bewohner der anderen Niederlassungen sollten ihm helfen. Ich war überzeugt, dass die heftige Strömung die Leichen abwärts getrieben [484] haben musste, aber Njok behauptete, dass dies nicht der Fall sei. Nach einiger Zeit trafen auch Ibau Adjāng und einige Böte der Uma Wak und Batu Pala ein, um suchen zu helfen. Ein Lager wurde oberhalb und ein zweites unterhalb des Kiham Udang aufgeschlagen. Zu meinem Erstaunen brachte mir Njok noch eine andere, erfreuliche Nachricht, nämlich, dass die Kajan mit Kwing Irang bereits in Long Dĕho waren und dass Sorong sogleich kommen würde, um zu berichten, warum sie so lange mit der Abreise gezögert hätten.
Gleich nach dem Essen traf Sorong wirklich ein und erzählte, dass Kwing Irang, seinem Plan gemäss, beim bulan pusit (Neumond) mit ihm ein me̥lo̱ njăho̱ gehalten hatte, dass aber am Abend des zweiten Tages alle Gonge in der Niederlassung ertönt hatten, weil ein Ehepaar, Anjang Bawan und Anja Song, die am Abhang des Batu Mili Harz suchten, noch nicht zurückgekehrt waren. Es blieb ihnen nichts übrig, als mit allen anderen auf die Suche zu gehen, was vier Tage dauerte, worauf Anjang, man wusste nicht wie, plötzlich in einer Hütte erschien, in der einige alte, halb blinde Männer wohnten. Sein Mund war voll Erde, die man nur mit Mühe entfernen konnte, auch konnte er beinahe nicht sprechen. Aus seinen verwirrten Antworten erfuhr man nur, dass er und seine Frau durch Geister erschreckt worden waren und dass diese sie auf den Berg mitgenommen hatten. Im Reiche der Geister, die gerade Neujahr feierten, hatten sie einander aus dem Auge verloren; doch hatte sich Anjang trotzdem am Hühner- und Schweinefleisch gütlich getan. Nach einigen Tagen, als man sich gemeinschaftlich über hohe Bretterstege zu den Geistern auf dem gegenüberliegenden Batu Kasian begab, fiel Anjang vom Stege und langte plötzlich bei den alten Männern an. Seit der Zeit war er sehr verschlossen und wollte nichts mehr erzählen. Auch nach viertägigem Suchen hatte man Anja Song nicht gefunden, aber Kwing hatte nicht länger warten wollen und war abgereist. Ich zweifelte nicht an der Wahrheit dieses Berichtes, wusste aber nicht, was ich davon denken sollte, und erhielt auch von Sorong keinen Aufschluss.
Am 18. Mai, gegen Mittag, traf Kwing Irang mit 10 Leuten bei uns ein. Dass er nun doch die Reise mit mir fortsetzen konnte, schien ihn sichtlich zu bewegen und ich war zu froh, diese Unglücksstätte verlassen zu können, um ihm der endlosen Verzögerungen wegen Vorwürfe zu machen. Hierzu hatte ich, mit meiner Überlegenheit an Kenntnissen und Handlungsfreiheit übrigens kein Recht, da er ohnehin meinetwegen [485] mit den Überzeugungen und Sitten seines Stammes einen ständigen Kampf führte.
Kwing erklärte auch jetzt, nicht mit den Long-Glat auf das Finden der Leichen warten zu können. Er wollte am anderen Morgen mit seinen Kajan und ihrem vielen Gepäck den Udang passieren und mich dann abholen. Das Wasser fiel und der Himmel klärte sich auf, so sah ich Kwing guter Stimmung nach Uma Wak zurückkehren. Hier konnten sich die jungen Kajan nur mit Mühe den Liebenswürdigkeiten der Frauen entziehen, die die frischen jungen Burschen gern bei sich behalten hätten; es blieb diesen auch nichts übrig, als durch Geschenke, wie Tragkörbe und neue Kopftücher aus Baumbast, den Frauen ihren Dank zu bezeigen. Daher fuhr die Flotte der Kajan, die aus 20 Böten bestand, erst um 12 Uhr an uns vorüber; nur Kwing legte für einen Augenblick bei uns an, um zu sehen, ob wir reisefertig waren.
Am Abend zuvor war es den Long-Glat geglückt, wenigstens eine der Leichen zu finden. Lugat, der den ganzen Tag mit einigen Freunden den Fluss auf- und niedergefahren war, hatte die Leiche seines Bruders, noch bevor diese in den Udang geriet, auffangen können. Am gleichen Abend wurde Adjāng am Ufer begraben, ein kleines Grabmal errichtet und dort zugleich auch für Ibau, dessen Leiche später am mittlerer. Mahakam gefunden wurde, eine Ausstattung für Apu Ke̥siọ niedergelegt.
Mit Njok vereinbarte ich, dass ich in Uma Mĕhak auf ihn warten sollte, da er uns mit seinem Gepäck und Rotang folgen wollte. Allein hätten die Long-Glat dies sicher nicht zu tun gewagt, da das Unglück, ein deutlicher Beweis der Unzufriedenheit der Geister, sie zur Heimreise gezwungen hätte.
Gegen 3 Uhr wurden wir aus unserer feuchten, dunklen Höhle, in der wir nun 1 m niedriger als anfangs lagen und mit unseren Böten zwischen Sand und Ästen eingeklemmt zu werden drohten, befreit. Die Malaien hatten die Pflanzen wieder in das grösste Boot gebracht, das mittelst fester Rotangtaue längs der Uferfelsen vorsichtig den Fall hinabgelassen wurde.
Das übrige Gepäck wurde, ausser den Kisten, die für einen Mann zu schwer waren, aus den Böten genommen. Die Kisten wurden, trotz der Erhöhung der Bootsränder, doch noch nass, da sie nicht vollständig wasserdicht waren und durch double-waterproof-sheeting nicht [486] ganz bedeckt werden konnten; so verdarb uns noch ein bedeutender Teil unserer grösseren Ethnographica.
Nachdem wir den Kiham Udang überwunden hatten, blieb uns noch Zeit übrig, uns ruhig abwärts treiben zu lassen. Ich fühlte mich wie aus einem finsteren Gefängnis in eine strahlende Aussenwelt versetzt. Von der Tiefebene des mittleren und unteren Mahakam trennte uns nur noch der Kiham Halo. In einem Brief, den der Kontrolleur einigen Kahájan Dajak, die aufwärts zogen, für mich mitgegeben hatte, schrieb er mir, dass er unten in Long Bagung auf mich wartete.
Zwar regnete es am folgenden Morgen und die. tief herniederhängenden Wolken hüllten die schönen Gipfel der Berge ein, auch hatte der bilang (Baumgekko) nachts seine warnende Stimme ertönen lassen, aber Kwing Irang machte, wie früher zur Beruhigung des Tieres einen kleinen Rundgang durch den Wald und da der Fluss nur wenig stieg, sassen wir um 8 Uhr bereits in den Böten, in der Hoffnung, den Kontrolleur noch am gleichen Tage zu erreichen. Wir hatten diese frohe Aussicht zur Ermunterung sehr nötig, denn die schmale Schlucht des Kiham Halo, die uns 1897 bei guter Beleuchtung entzückt hatte, zeigte sich jetzt, wegen der schwer aufliegenden Wolken, nur als eine finstere Spalte, die bei dem Geschrei, das die Kajan über den tobenden Wassermassen anhuben, einen doppelt unheimlichen Eindruck machte.
Auf halbem Wege begegneten wir in der engen Durchfahrt einer Gesellschaft Kĕnja, die ihre Böte langsam an Rotangseilen längs der Uferfelsen aufwärts zogen. Trotzdem ich, hauptsächlich im Hinblick auf unsere späteren Pläne, grosse Lust verspürte, mit Kĕnja in Berührung zu kommen, konnten wir bei ihnen nicht Halt machen, da die heftige Strömung uns mit sich riss. Die Kajan liessen nun ihren Ajo-Ruf um so lauter ertönen; die Kĕnja antworteten und aus den Bergen erschallte das Echo. Der Fluss wurde stets breiter und die Ufer niedriger, bis wir gegen 3 Uhr nachmittags hinter einer Flussbiegung Long Bagung zum Vorschein kommen sahen. Durch einige Gewehrschüsse meldete ich Barth unsere Ankunft.
Long Bagung ist eine Haltestelle für malaiische Händler und Buschproduktensucher und liegt auf dem rechten Ufer des Mahakam. Der Kontrolleur hatte hier bereits wochenlang auf uns gewartet; es war ihm zwar im allgemeinen gut ergangen, doch freute er sich, endlich mit uns weiterreisen zu können. Seine Gesellschaft hatte an Fieber [487] gelitten, am meisten Hadji Umar, der auch jetzt noch krank lag. Die Aufnahme des Mahakam war Bier gut geglückt, nur war er durch das häufige Hochwasser oft an der Arbeit gehindert worden und im Kiham Halo war ihm ein Boot an den Felsen zerschellt, wobei beinahe ein Malaie ums Leben gekommen wäre.
Abends tauschten Barth und ich unsere Erfahrungen über die Gesinnung aus, die die Mahakambevölkerung uns gegenüber hegte und über die Möglichkeit, eine niederländische Verwaltung bei ihr einzusetzen. Auch Barth hatte während seiner monatelangen Reise den Eindruck empfangen, dass eine stärkere Macht, die sich mit der ganzen Verwaltung betraute, hauptsächlich zum Schutz gegen Einfälle aus Sĕrawak und Kutei, sehr erwünscht sei.
Obwohl Barth als Fremder nach Long Tĕpai und Long Dĕho gekommen war, hatte die Bevölkerung ihm viel Sympathie bezeigt, nur war sie ihm, als Fremdem, begreiflicher Weise mit mehr Misstrauen entgegengekommen als einem Menschen ihrer eigenen Umgebung.
Bier, den das lange Warten am selben Ort sehr gelangweilt hatte, fuhr am folgenden Tage fort, um den Mahakam weiter unten zu messen; wir versprachen, in Uma Mĕhak auf ihn warten zu wollen und begaben uns erst zwei Tage später auf die Reise.
Unsere Gesellschaft war somit ohne bedeutende Verluste über die Wasserfälle gelangt; nur Hadji Umars Zustand beunruhigte mich. Umar war bereits die letzten drei Jahre leidend gewesen; ich hatte zwar seinen Zustand während seines Aufenthaltes am Blu-u etwas bessern können, aber seit der Zeit war das Fieber immer wieder zurückgekehrt. Dass Umar sich weigerte, Chinin einzunehmen, verschlimmerte seine Lage; ich wusste ihm nicht zu helfen. Obwohl er mit uns zur Küste fuhr, war seine Anwesenheit uns unter diesen Umständen kaum von Nutzen.
Eine der interessantesten Begegnungen, welche der Kontrolleur während seines sehr eintönigen Aufenthaltes gehabt hatte, war die mit den Kĕnja, die wir im Kiham Halo getroffen hatten. Da Barth meine Absicht, die bis dahin so gut wie unbekannten Kĕnjastämme zu besuchen, kannte, war er dem Zufall dankbar, dass diese Gesellschaft, die eine Handelsreise nach dem unteren Mahakam unternommen und einen Besuch bei ihren Stammverwandten am Tawang gemacht hatte, die ausgedehnte Geröllbank bei Long Bagung als Lagerplatz wählte. Kaum hatten die Kĕnja erfahren, wer auf dem Ufer [488] wohnte, als ihre vornehmsten Leute Barth einen Besuch machten. Dabei erschienen sowohl die Häuptlinge als deren Geleite völlig unbewaffnet, was in einem Lande, in dem jung und alt stets bewaffnet geht, sehr auffallend war. Das Gespräch, das in der Busang-Sprache geführt wurde, verlief durchaus gemütlich. Die Kĕnja hatten sehr offenherzig von ihrem Lande berichtet und zu verstehen gegeben, dass meinem Besuch bei ihnen nichts im Wege stände, dass sie mich im Gegenteil gern bei sich sehen würden. Barth hatte ihnen die Erinnerung an ihren Besuch angenehm zu machen verstanden, indem er sie reichlich mit Tabak und Perlen bedachte.
Der Kontrolleur hatte ausserdem die nähere Bekanntschaft mit Blutsverwandten von Bang Jok gemacht, der sich selbst nur kurze Zeit in Long Bagung aufgehalten und auch seine Frau und Kinder nach Udju Halang mitgenommen hatte. In Long Bagung wohnte nämlich seine Schwester Bua, die in zweiter Ehe einen Malaien Rauf, den Sohn eines früheren Distrikt-Häuptlings vom oberen Barito, Raden Djaja Kusuma, geheiratet hatte. Kusuma war der erste Malaie gewesen, der die Bahauhäuptlinge zu besuchen gewagt und sich angeboten hatte, ihre Wälder auf Buschprodukte durchsuchen zu lassen. Dadurch hatte er in den neunziger Jahren die fremden Buschproduktensucher nach dem Mahakam gezogen. Seine drei Söhne liessen sich dort nieder, zwei als Kaufleute, einer als Gatte von Bang Joks Schwester, die ebenfalls Anrecht auf die noch unberührten Wälder der Long-Glat von Lirung Tika hatte. Bug war nach dem Tode ihres ersten Gatten, eines Häuptlings in Mujub, nicht zu ihrem Bruder gezogen, sondern hatte sich Long Bagung gegenüber, am jenseitigen Ufer, ein Haus gebaut und später Raup geheiratet. Dieser verstand, dank seinen Beziehungen zu den Buschproduktensuchern am Barito, die Wälder seiner Frau vorteilhaft auszubeuten, ausserdem verdiente er viel als Kaufmann, indem er alles, was die Leute für ihre Lebensbedürfnisse nötig hatten, von der Küste beischaffen liess und auch mit den Bahau und Kĕnja von oben Tauschhandel trieb. Eine weitere Kundschaft besass er im Gebiet des oberen Murung, den er längs des Bunut leicht erreichen konnte. Raups Familie hatte sich ebensowenig wie die in Long Dĕho zurückgebliebenen Häuptlinge vor einer Berührung mit dem Kontrolleur gefürchtet und so hatte sich über den hier 200 m breiten Fluss ein lebhafter Verkehr entwickelt. Sehr willkommen war es Barth, dass er hier wieder Salz, Zucker, Petroleum und einige Konserven kaufen konnte, Dinge, mit [489] denen wir bereits seit langem sehr sparsam hatten umgehen müssen. Der Fluss ist hier überdies nicht so ausgefischt wie oberhalb der Wasserfälle, wo der Fischstand durch die tuba-Fischerei sehr heruntergebracht worden ist. Bei Hochwasser suchen die Fische hier in kleinen, für gewöhnlich trockenen Nebenflüssen eine Zuflucht vor der reissenden Strömung. Die Malaien, die sich bei Barth befanden, schlossen die Nebenflüsse bei Hochwasser mittelst eines Heckwerks aus Bambus ab und fingen auf diese Weise bei fallendem Wasser mehr Fische als sie gebrauchen konnten.
Am 22. Mai liessen wir uns, nachdem alles Gepäck in den Böten untergebracht worden war, ruhig vom Flusse abwärts treiben, in der angenehmen Überzeugung, dass uns bei hohem oder niedrigem Wasserstande kein ernsthaftes Hindernis mehr drohte. Das Wasser war wieder so hoch gestiegen, dass wir weiter unten Bier zur Tatenlosigkeit verurteilt antrafen, weil die hier niedrigen und daher überschwemmten Ufer ihm keinen Standplatz boten. Am folgenden Tage fuhr er denn auch nach Uma Mĕhak weiter, mit der Absicht, dieses Stück später zu messen.
Die rasche Strömung brachte uns bereits bald nach 4 Uhr nach Uma Mĕhak, der ersten grösseren Niederlassung unterhalb der Wasserfälle. Seitdem Uma Mĕhak in den letzten Jahren der Sammelpunkt malaiischer Buschproduktensucher geworden ist, sind auf dem Uferstreifen zwischen den langen Bahau-Häusern und dem Flusse malaiische Häuser entstanden, so dass das Ganze nicht mehr den einheitlichen Charakter der Niederlassungen oberhalb der Wasserfälle trägt. Auch beim Betreten des Dorfes machte alles einen verfalleneren Eindruck als oben. Da die Bevölkerung hier nicht zahlreich genug ist, wechselt sie ihre Dörfer viel seltener als es am oberen Mahakam üblich ist, daher sehen die Häuser hier in der Regel älter und baufälliger als im Innern der Insel aus.
Auf der Galerie des langen Hauses wurde uns aber ein gutes Unterkommen angeboten und wir liessen im grossen Raume Bretterverschläge herrichten, um einige von uns, die an Fieber litten, von dem grossen Getriebe fernzuhalten. Das Interesse für uns war hier besonders rege und da wir nur einige Tage bleiben wollten, suchte man nach Möglichkeit, aus unserer Gegenwart Vorteil zu ziehen; hauptsächlich wurde ich um Arzneien angegangen. Wir fühlten aber wenig Sympathie für unsere neue Umgebung, denn aus einem Kreise primitiver, unverdorbener [490] Bahau gerieten wir hier plötzlich in eine degenerierte Gesellschaft der verschiedensten Stämme vom Barito und Mahakam. Von allen Seiten starrten uns Menschen mit fremden, verdächtigen Gesichtern an, die sich hier zu dem alleinigen Zwecke, um den oberhalb der Wasserfälle unbekannten Genüssen, wie Hazardspielen und Hahnenkämpfen um hohen Einsatz und dergl. zu fröhnen, aufhielten. Dabei herrschten hier ständig Streit und Zank, an die wir seit langer Zeit nicht mehr gewöhnt waren. Man hatte uns übrigens oberhalb der Wasserfälle bereits darauf aufmerksam gemacht, dass sich in diesem Zentrum der Buschproduktensucher alles um Spiel und Wetten drehte.
Abends, lange nachdem wir uns zur Ruhe begeben hatten, hörten wir noch Würfel rollen und Geld zählen; beim Schein kleiner Lampen hockten auf der Galerie kleine Gruppen, die teils mit chinesischen, teils mit europäischen Karten spielten. Bei Sonnenaufgang hielten einige Buginesen, die als die wichtigsten Bankiers fungierten, ihren Einzug in der Galerie und versammelten bald einen grossen Kreis um sich. Zum grossen Verdruss ihrer Häuptlinge beteiligten sich auch die Bahau des langen Hauses am Spiel, wodurch sowohl der Ackerbau als das Verhältnis des Hausbewohner untereinander litt. Die Häuptlinge konnten sich nicht besser ausdrücken, als indem sie diesen Zustand als “rusak murib Bahau” “Verderben des Bestehens der Bahau” bezeichneten.
Zwei in Uma Mĕhak verbrachte Tage genügten, um uns davon zu überzeugen, dass derartige Zustände auf die Dauer nur zur Demoralisierung einer Bevölkerung dienen können, deren gute Eigenschaften wir oberhalb der Wasserfälle kennen gelernt hatten. Ausserdem bilden sie für alle, die von der Ostküste aus Beziehungen mit dein Binnenlande anknüpfen wollen, eine Gefahr. Wir hätten hier nur durch einen langdauernden Aufenthalt Einfluss ausüben können; da wir hierfür aber keine Zeit hatten und den ersten Teil des von der Regierung gestellten Auftrages erfüllt hatten, beschlossen wir, den Mahakam weiter bis Udju Halang zu fahren und dort zu warten, bis ein Dampfboot uns zur Küste abholen würde.
Bier begann von Uma Mĕhak aus, bei günstigerem Wasserstande, seine Aufnahme und hoffte sie noch vor unserer Abreise zur Küste bis Ana fortsetzen zu können.
Ich hatte die Ruhetage dazu verwandt, unseren Pflanzensucher Sĕkarang von der Malaria zu kurieren, aber das Fieber hatte ihn [491] bereits so angegriffen, dass es für ihn ein Glück war, dass wir zu Wasser und nicht zu Lande weiterreisten. Schlimmer ging es Hadji Umar, der sich immer noch weigerte, Arzneien zu nehmen, und daher täglich an Malariaanfällen litt und sichtlich herunterkam. Er raffte sich trotzdem auf, um mit uns weiterzureisen und nahm auch seine Familie mit.
Nach einer langen Tagereise erreichten wir Udju Halang, das uns offen stand, da das lāli wegen des Todes von Bang Joks Schwester bereits aufgehoben war. Wir nahmen sogleich die Galerie in Beschlag; während Kwing Irang mit den Seinen am folgenden Tage nach Udju Tĕpu und Ana weiterfuhr, um dort Handel zu treiben und uns zu benachrichtigen, sobald das Dampfboot uns abholen käme. Gleich nach Kwings Abreise traf auch Njok Lea bei uns ein; es hatte ihn unangenehm berührt, dass wir in Uma Mĕhak nicht auf ihn gewartet hatten, doch reiste er schliesslich guter Stimmung Kwing nach.
Trotz meiner Ungeduld, die Küste zu erreichen, hoffte ich doch, hier einige Ruhetage zu finden, da wieder einige von uns an Malaria erkrankt waren. Barth, der die ganze Reise über gesund gewesen war, wurde nachts von einem heftigen Fieberanfall gepackt, ferner erkrankten zwei Schutzsoldaten, auch fühlte sich Sĕkarang immer noch nicht wohl. In den vier Tagen, die wir hier bleiben konnten, gelang es uns zum Glück, alle soweit wiederherzustellen, dass sie die Reise fortsetzen konnten. An Beschäftigung fehlte es uns auch hier nicht. Doris ordnete seine Vögel und die anderen untersuchten die eisernen Koffer, um deren Inhalt nötigen Falls zu trocknen.
Am meisten machte mir wiederum die Bevölkerung zu schaffen, die stark an Malaria und anderen Krankheiten litt und der ausserdem viel daran lag, mir in kurzer Zeit allerhand Gegenstände zu verkaufen. Ich merkte hier deutlich, dass die Bevölkerung, durch den langdauernden Umgang mit Malaien an Handel gewöhnt, sich viel leichter als im Innern von ihrem Hab und Gut trennte. Daher erwarb ich hier an schönen Dingen, besonders an Tätowiermustern, in vier Tagen mehr als während meines langen Aufenthaltes am oberen Mahakam. Auch empfand ich es als vorteilhaft, dass die Leute den Wert des Geldes gut kannten; sie freuten sich hier über einen Gulden ebenso sehr wie oberhalb der Wasserfälle über vier. Von Udju Halang rühren auch die im vorhergehenden Kapitel abgebildeten Tätowiermuster der Uma-Luhat, der Bewohner dieser Niederlassung, her. [492]
Leider war der Häuptling Adjāng nicht zu Hause; er war als der beste Schwertschmied unterhalb der Wasserfälle bekannt und hätte mir gewiss einige schöne Exemplare verkaufen können.
Am dritten Tage unseres Aufenthaltes traf auch Bier, der seine Messung bis Ana fortgesetzt hatte, bei uns ein. Abgesehen von dem kleinen Stück oberhalb Uma Mĕhak, das später ergänzt wurde, hatten wir unseren ganzen Reiseweg von der Wasserscheide an messen können und somit konnten die bereits erwähnten Aufnahmen des Kapuasgebietes und des Gebietes von Ana bis zur Küste miteinander in Zusammenhang gebracht werden.
Nun hatten wir noch nach einem Orte Umschau zu halten, der sich als Wohnsitz für einen niederländischen Beamten eignete; aber die Aufgabe war nicht leicht zu lösen, denn gleich unterhalb Uma Mĕhak flachen sich beide Uferseiten ab und nur hie und da erheben sich einige Hügel, die weiter unten gänzlich fehlen. Die wenigen, nur wenige Meter über dem Wasserstande befindlichen Erhebungen waren bereits von den Niederlassungen der Bahau eingenommen. Wir fuhren daher nach vier Tagen weiter nach Ana, wo wir uns zugleich in grösserer Nähe des Dampfbootes befanden.
In Ana nahm uns die Wittwe des früheren höchsten Häuptlings dieses Gebietes, Si Ding Lĕdjü, als ihre Gäste auf. Lĕdjü war mir während meines ersten Aufenthaltes am oberen Mahakam, im Jahre 1897, entgegengereist und hatte mir auf allerlei Weise zu helfen getrachtet. Seine Wittwe zeigte mir mit Stolz ein schönes silbernes Teebrett, das ich für sie in Batavia als Geschenk der Regierung besorgt hatte und das ihr der Assistent-Resident von Samarinda später überreicht hatte. Obwohl sie in sehr bescheidenen Verhältnissen zurückgeblieben war und ihr Schwager die Häuptlingschaft für ihren unmündigen Sohn Djü führte, tat sie doch alles, um uns den Aufenthalt bei ihr so angenehm als möglich zu machen. Wir wurden nicht in der Galerie, sondern in der Häuptlingswohnung selbst aufgenommen, was bis dahin nicht vorgekommen war. Unseren Malaien wurde eine grosse, leere Wohnung angewiesen, in der auch der grösste Teil unseres Gepäckes Platz fand.
Zum Glück war Sĕkarang so weit hergestellt, dass er die Sorge für die Kisten mit lebenden Pflanzen wieder übernehmen konnte. Die Sammlung befand sich, da sie die meiste Zeit in der freien Luft verbracht hatte, in ausgezeichnetem Zustand. Für diese Produkte der kühlen Gebirgswälder wurde nun aber das Klima in der Ebene [493] viel zu warm; da sie überdies vor den Salzteilchen in der Luft während der Seereise geschützt werden mussten, hatten sie eine ständige Bedeckung nötig, die wir ihnen aus Rotangschirmen, welche mit Kattun überzogen wurden, herstellen liessen.
Sobald Kwing Irang erfahren hatte, dass wir uns in Ana befanden, gesellte er sich zu uns, um mit uns zu überlegen, wer von seinen Leuten uns nach Samarinda begleiten sollte. Um zum ersten Mal in ihrem Leben eine Dampferfahrt mitzumachen, um die Wunder einer Küstenstadt zu sehen und um in Samarinda allerhand Dinge einzukaufen, wollten nämlich sehr viele mitreisen, daher rief Kwing meine Autorität zu Hilfe. Nachdem wir auch Njok Leas Rat eingeholt hatten, beschlossen wir, dass 6 Kajan, 4 Long-Glat und die beiden angesehensten Mantri, Sorong und Bo Ului Jok, mitgehen sollten. Kwing Irang selbst und die anderen Häuptlinge wagten aus Furcht, vor dem Sultan nicht uns zu begleiten und wollten uns daher in Udju Tĕpu erwarten.
Als der Handelsdampfer des Sultans “Sri Mahakam” in Udju Tĕpu ankam und der Bootsführer hörte, dass wir uns in Ana befanden, zeigte er sich sogleich bereit, uns dort mit unserem Gepäck abzuholen.
Nach zweitägiger Fahrt erreichten wir Tengaron, wo wir uns dem Sultan vorstellten. Er empfing uns in seinem Palaste und stellte uns einen Dampfer zur Verfügung, der uns noch am gleichen Tage nach Samarinda brachte.
Errata.
- Seite 6, Zeile 2 und 5 von unten Javanern statt Javanen.
- Seite 25, Zeile 6 von unten Javaner statt Javanen.
- Seite 48, Zeile 2 von unten Schiefern statt Schieferschichten.
- Seite 82, letzte Zeile für ligaroten statt zum Rauchen in Zigaretten.
- Seite 93, Zeile 7 von unten Ot-Danum statt Ot-Danom.
- Seite 118, Zeile 1 von oben isst jeder statt ist jeder.
- Seite 120, Zeile 17 von oben barang statt barang.
- Seite 120, Zeile 19 und 22 von oben Reisrispe statt Reishalm.
- Seite 120, Zeile 14–15 von unten von der Rispe statt von dem Reishalm.
- Seite 121, Zeile 6 von oben wird der Reis statt werden die Reishalme.
- Seite 124, Zeile 3, 5, 14, von unten me̥lă statt me̥lā.
- Seite 125, Zeile 6, 7, von oben me̥lă statt me̥lā.
- Seite 211, Zeile 16 von oben Weissmacht statt weismacht.
- Seite 224, Teile 16 von unten sollte es statt sollten sie.
- Seite 245, Zeile 8 von oben troff statt triefte.
- Seite 288, Zeile 7 von oben Bodenfläche statt Oberfläche.
- Seite 429, Zeile 10 von oben ½ gr Chinin statt 1½ gr Chinin.
- Seite 429, Zeile 15 von unten Sternocleido-mastoidei statt Sterno-mastoide.

