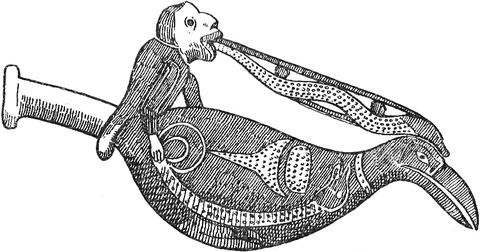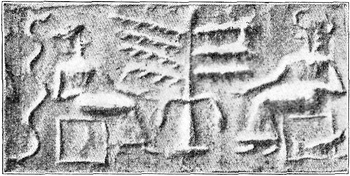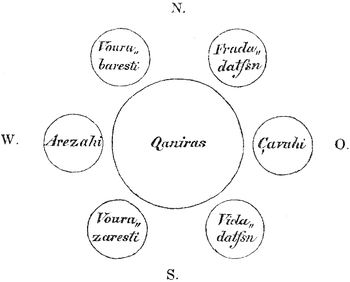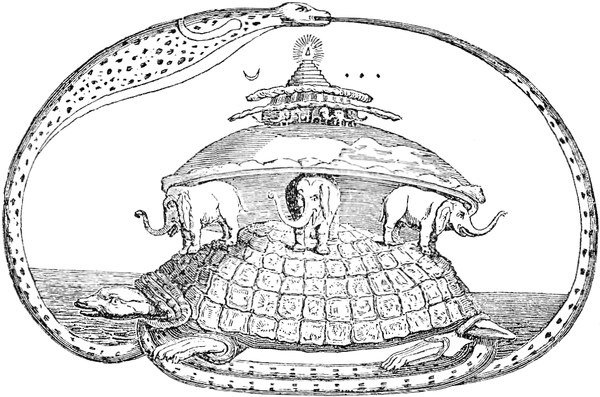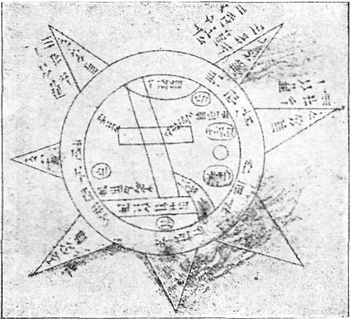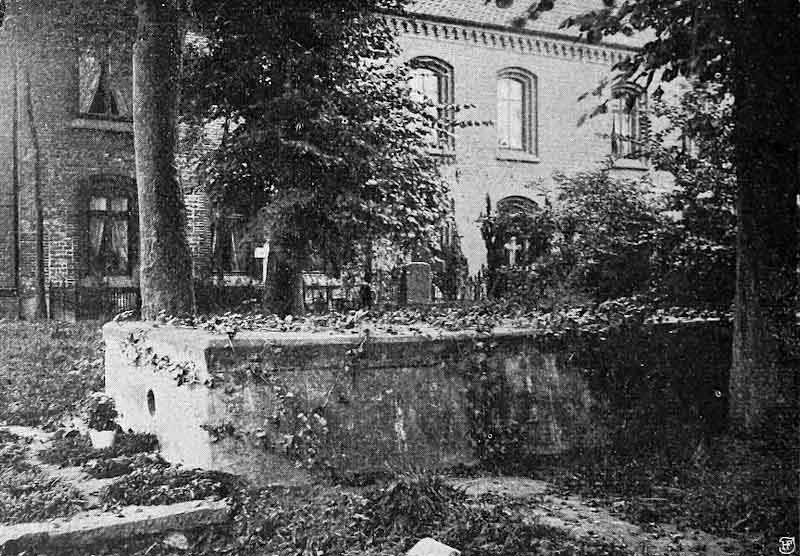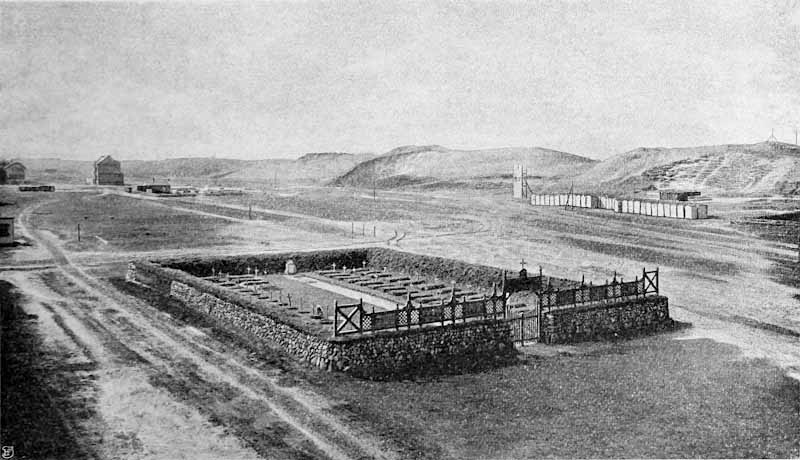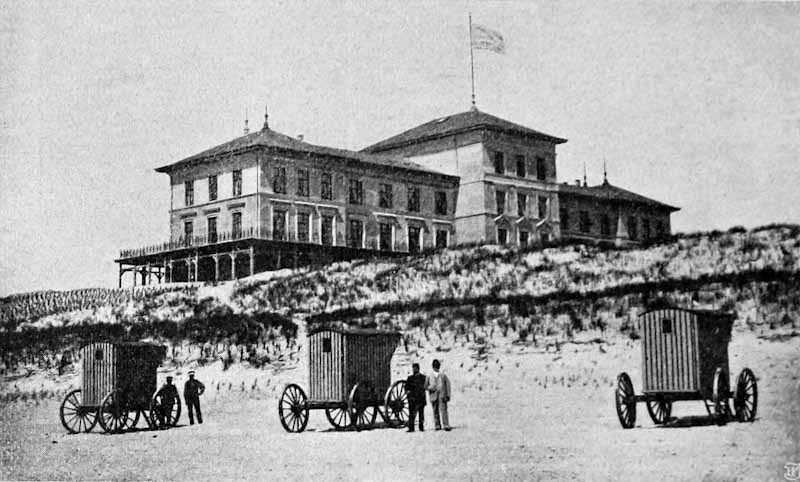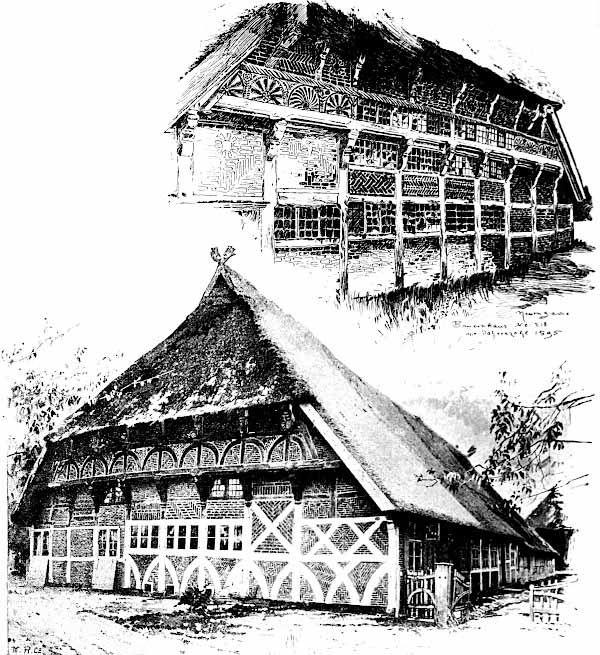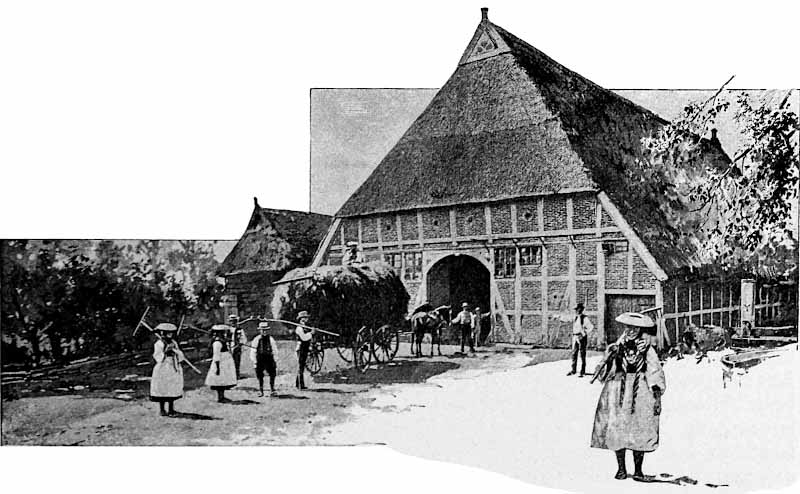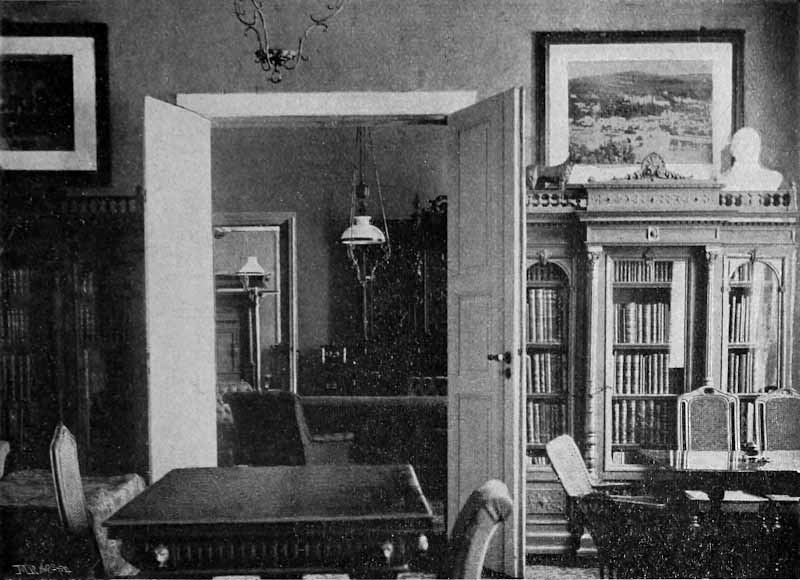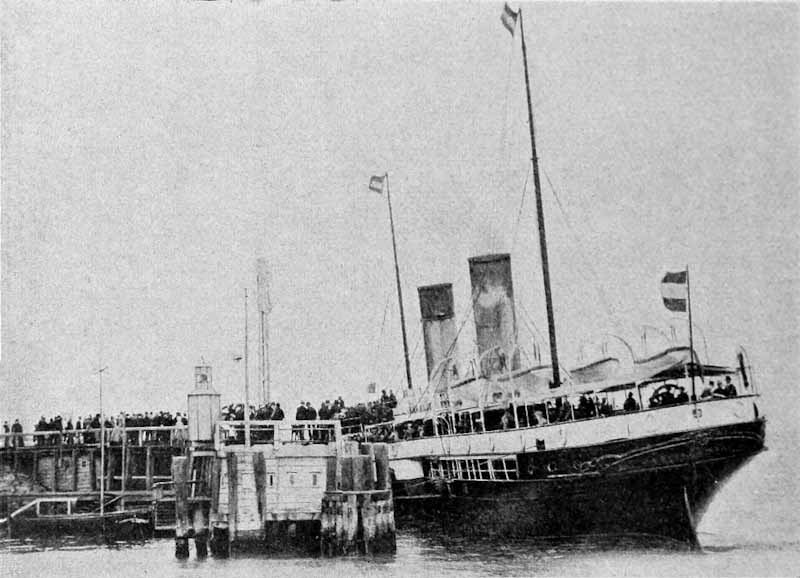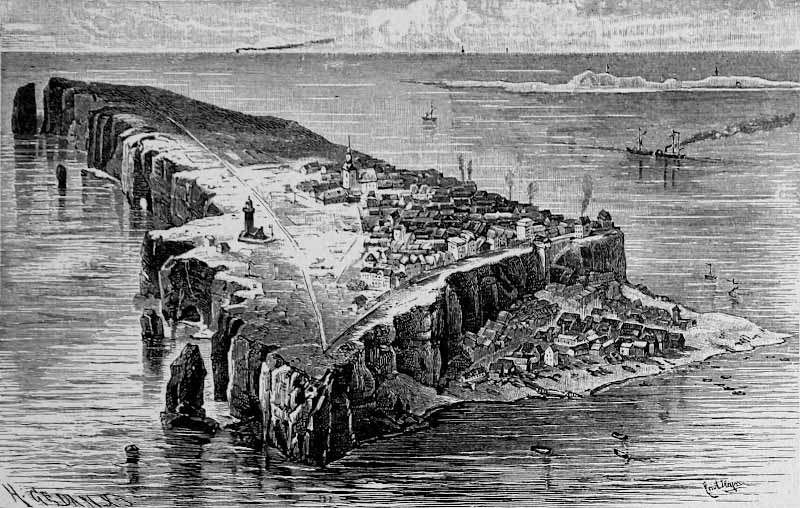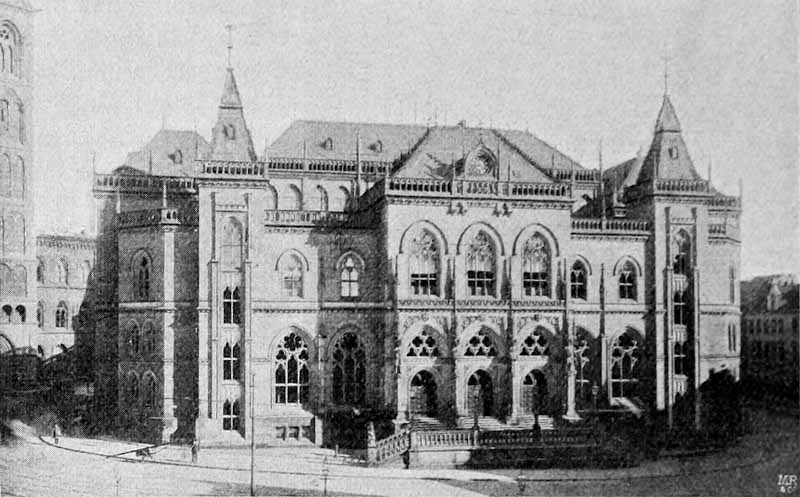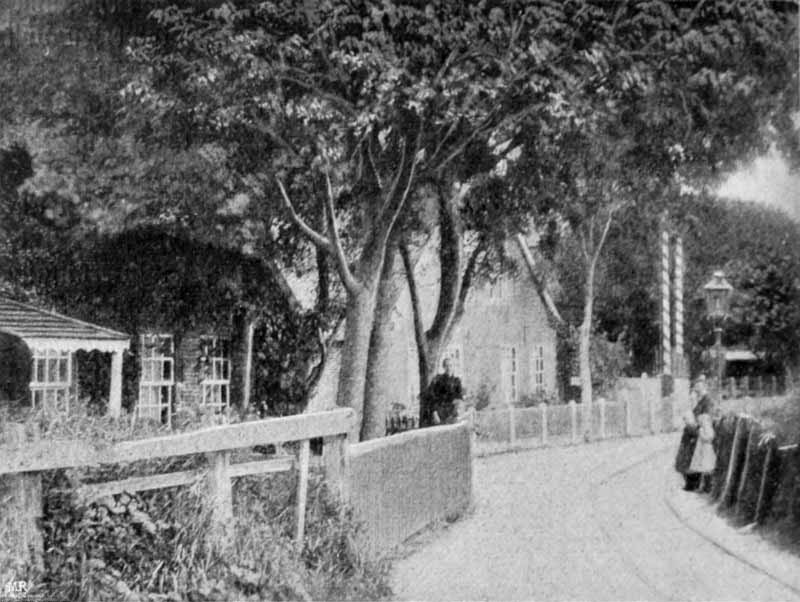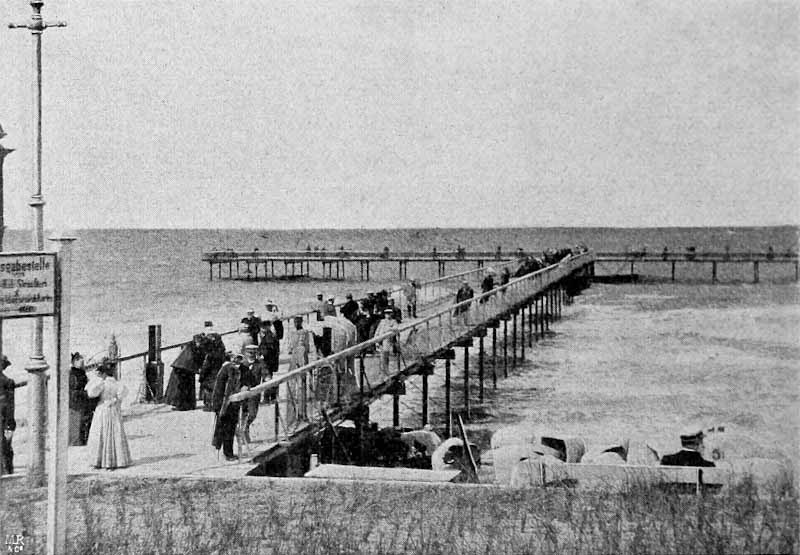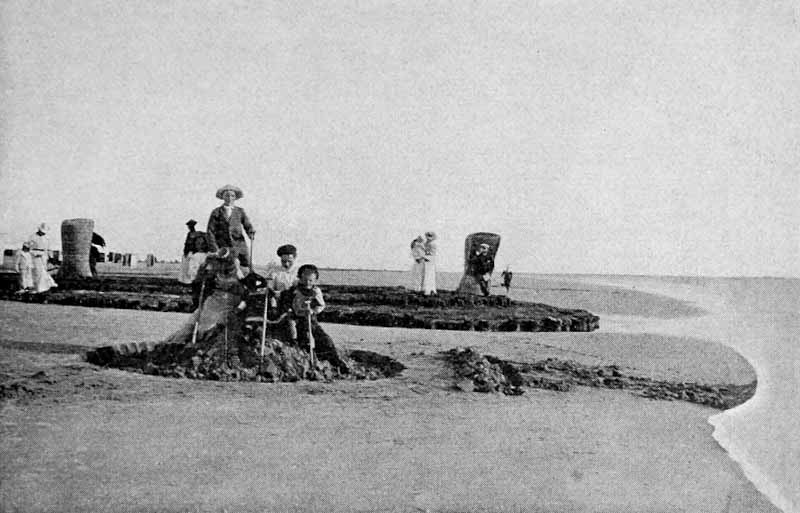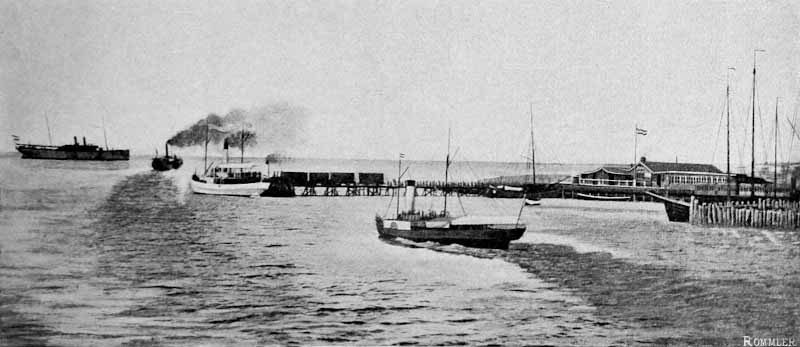.
WELT- UND
LEBENANSCHAUUNGEN
HERVORGEGANGEN AUS
RELIGION, PHILOSOPHIE
UND NATURERKENNTNIS
VON
PROF. DR. MAX B. WEINSTEIN
LEIPZIG
VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH
1910
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Vorwort.
Wer sich mit einem Gegenstande lange und eifrig beschäftigt hat, hegt unwillkürlich den Wunsch, die Ergebnisse seines Studiums und Nachdenkens zu ordnen und für die Dauer festzuhalten. So habe ich dieses Buch nicht bloß für den Leser, sondern auch für mich selbst geschrieben, und darum wird es bei aller Objektivität, die eine wissenschaftliche Veröffentlichung selbstverständlich auszeichnen muß, doch auch den Eindruck des Persönlichen machen. Über die Anschauungen von der Welt, und auch über die vom Leben, ist schon viel geschrieben; das Thema ist ja für Laien und Gelehrte wichtig und interessant genug. Ich glaube aber, daß noch kein Buch vorhanden ist, das die Aufgabe von so allgemeinen Gesichtspunkten und in so umfassender Darstellung behandelt, wie das vorliegende. Meist sind es Ausschnitte aus einzelnen Gedankengebieten der Völker und Forscher, die geboten werden, entweder vom Standpunkte des Anthropologen, oder des Gottesgelehrten, oder des Philosophen und des Naturforschers. Ich habe es versucht, alles in eins zusammenzufassen, Anthropologie, Religion, Philosophie und Naturwissenschaft, denn nur aus einer Darstellung des Ganzen wird man das Bedeutungsvolle des Gegenstandes zu übersehen und das Einzelne zu würdigen vermögen. Und nicht nur das ist von Interesse, was Große denken und sagen, sondern auch, was Völker, selbst in ihrem Naturzustande, erdichten und zur Richtschnur ihres Lebens in sich und mit Anderen machen. Es sind wunderliche und wunderbare Bilder, die kaleidoskopisch an uns vorüberziehen. Es handelt sich aber, wie ich, um Mißverständnissen vorzubeugen, hervorheben muß, nicht um eine Geschichte,[S. IV] sondern um eine Schilderung der Anschauungen selbst. Darum ist der Inhalt, wie ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis lehrt, durchaus nur sachlich geordnet, und wo Raum und Zeit zu entscheiden scheinen, hat sich dieses im Rahmen des Tatsächlichen von selbst eingestellt. Darum sind auch nur die Hauptmomente behandelt, und sollte ein Leser den einen oder anderen Namen vermissen, so hat der Verfasser ein Besonderes, das sich an diesen Namen für seine besondere Aufgabe knüpft, nicht feststellen können. Manche glauben, daß ein Verfasser, was er nicht sagt, auch nicht weiß und nicht gedacht hat. Es wäre beschämend, wenn man nicht unendlich viel mehr wüßte und dächte, als man in seinen Büchern, so zahlreich sie schon sein mögen, niedergelegt hat. Aber es ist nicht angängig, alles, was man weiß und denkt, weiterzugeben, denn man muß auch den Leser berücksichtigen. Auch ist zwar vielfach das Leben lang genug das wichtigste zu lernen, aber leider allzu kurz, was man möchte, zu schaffen.
Ich habe eine rein wissenschaftliche Darstellung gewählt, denn die Anschauungen sind nicht bloß geschildert, sondern aufs sorgfältigste zergliedert und auf ihren Wert untersucht. Auch sind sie von der hohen Warte des allgemeinen Menschengeistes und des großen Wissens unserer Zeit betrachtet. Wer über Welt- und Lebenanschauungen umfassend schreiben will, muß sich nicht allein mit der Arbeit der Vergangenheit vertraut machen, sondern sich auch in die Strömungen der Gegenwart versenken können, und bedarf außerordentlich eingehender Kenntnisse auf allen Gebieten der menschlichen Betätigung. Der Leser soll unterrichtet werden, und zwar sorgfältig und richtig, nicht, wie es durch so viele populäre Werke leider geschieht, oberflächlich oder gar falsch. Außerdem soll er zum eigenen weiteren Denken angeregt und angeleitet werden. Bereicherung mit Kenntnissen und Ideen, Bereicherung mit geistigem Streben ist die Aufgabe eines wissenschaftlichen Buches. Trotz des großen Ernstes der Be[S. V]handlung und der sehr erheblichen Schwierigkeit der Materie wird die Darstellung, wie ich hoffe, als klar und einer guten Prosa angemessen befunden werden. Ich bin keiner noch so tiefgründigen Untersuchung aus dem Wege gegangen, habe jedoch, wo Sonderkenntnisse erforderlich waren, diese stets mitgeteilt. Kritik ist fast auf jeder Seite geübt, ich habe mich bestrebt Objektivität und Ruhe des Urteils zu wahren. Das Buch ist für den Fachmann und für den Gebildeten, überhaupt für jeden, der sich auf dem wichtigsten Gebiete des menschlichen Denkens und Dichtens unterrichten will, geschrieben. Das Persönliche kommt in der Darstellungsweise und in der Geltendmachung der eigenen Meinungen und Anschauungen zum Vorschein. Ich habe vor längerer Zeit zwei Bücher geschrieben, auf die ich mich oft berufe: „Philosophische Grundlagen der Wissenschaften“ und „Die Entstehung der Welt und der Erde nach Sage und Wissenschaft“. Mit dem vorliegenden Buche bilden diese Bücher, wenn auch jedes für sich ein selbständiges Ganze darstellt, eine höhere Einheit, die ich freilich noch gern durch ein Buch über das Leben selbst ergänzen möchte. Bei aller Sorgfalt ist es in umfangreichen Werken nicht immer möglich, Unebenheiten und Versehen zu vermeiden. Ein Herr aus Frankreich hat mich auf eine Stelle in den „Philosophischen Grundlagen“ aufmerksam gemacht, die ich, einem so geschmackvollen und liebenswürdigen Volke gegenüber, wie das französische in der Tat gerne nicht geschrieben haben möchte.
Die wichtigeren Werke, die ich bei Abfassung meines Buches verwendet habe, sind in diesem Buche selbst verzeichnet. Wo es mir nur irgend möglich war, habe ich mich an die Originale gehalten; benutzte ich bei fremden Sprachen zur Erleichterung Übersetzungen, so paßte ich sie möglichst dem Wortlaut der Originale an. Es ist schon ein melancholisches Geschäft, aus Arbeiten Anderer Auszüge zu machen, aber abstoßend langweilig, Auszüge auszuziehen. Ich habe letzteres[S. VI] nur notgedrungen getan, wo mir die Originale nicht zur Verfügung standen oder die Sprache mir doch verschlossen war. Abbildungen enthält nur der erste Teil des Buches, die übrigen Teile boten keinen Anlaß, sie zu schmücken. Ein sehr eingehendes Inhaltsverzeichnis und Namen- und Sachregister wird, hoffe ich, die Brauchbarkeit des Buches auch zum Nachschlagen erhöhen. Beim Lesen der Korrekturen hat mich mein Freund, der Lehrer an der Berliner Baugewerkschule Dr. Levy, formell und sachlich unterstützt. Ihm und der Verlagsbuchhandlung, die viel Mühe mit dem Buche gehabt und für eine würdige Ausstattung gesorgt hat, meinen besten Dank. Möchte der Leser das Buch so gern lesen, wie der Verfasser es gern und aus dem Innern heraus geschrieben hat.
Charlottenburg, im Mai 1910.
Weinstein.
Inhaltsverzeichnis.
| Vorwort | III |
| Vorbemerkungen. Charakteristik, Prinzipe und Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen. | |
| 1. Bedeutung der Welt- und Lebenanschauungen | 1 |
| Ursprung 1. — Verhalten der Menschen 2. | |
| 2. Naturvölker und Kulturvölker | 4 |
| Schwierigkeiten bei den Naturvölkern 4. — Schwierigkeiten bei den Kulturvölkern 6. | |
| 3. Hauptfragen und Stammannahmen | 7 |
| Formulierung der Hauptfragen 7. — Liste der Stammannahmen 9. | |
| 4. Vergleichung der Anschauungen, Parallelen | 10 |
| Gleichartigkeit der Menschheit 10. — Beispiele für Parallelen 12. — Völkerzusammenhänge 13. | |
| 5. Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen | 13 |
| Formelle Einteilung 13. — Sachliche Einteilung 14. | |
| Erstes Buch. Psychisch-religiöse Welt- und Lebenanschauungen. | |
| Erstes Kapitel. Anschauungen der Naturvölker. | |
| 6. Irdisch-menschliche Anschauungen | 16 |
| Irdischer Standpunkt des Naturmenschen 16. — Übertragung auf das Himmlische und Kosmogonische 17. — Naturmenschlicher Egoismus und Unverstand 22. | |
| 7. Über den Ursprung der Religionen, Vorläufiges | 23 |
| Bedeutung und Entstammung der Religion 23. — Ursprung aus der Sprache 24. — Religionsstufen 27. — Ursprung aus der Macht 28. — Ursprung aus dem Kategorischen 29. — Ursprung aus Offenbarung 30. — Ursprung aus Lehre 31. — Verschiedene Ursprungsmöglichkeiten 31. | |
| 8. Allgemeine Belebung | 32 |
| Wie der Naturmensch überall Leben sieht 32. — Behandlung der Gegenstände als lebende 35. | |
| 9. Seele und Beseelung, Animismus, Fetischismus | 36 |
| Entdeckung der Seele 36. — Art der Seele 37. — Beseelung der Gegenstände, Fetischismus, Animismus 39. — Verhalten der Seele 40 — Die Seele und der Tote 41. | |
| [S. VIII] 10. Schamanismus, Totemismus, Seelen-, Ahnenkult | 43 |
| Freiheit der Seele vom Körper 43. — Die Seele als Gegenstand 44. — Seelen- und Ahnenkult 46. — Tierseelen 47. | |
| 11. Geister- und Dämonenglaube, Götzendienst | 48 |
| Tabuismus 48. — Götzen und Götzendienst 48. — Vergottete Gegenstände 50. — Vergottete Menschen 52. | |
| 12. Zauberwesen | 53 |
| Beschwörungen 53. — Spuk und Überlebsel 55. | |
| 13. Höhere Anschauungen bei Naturvölkern | 56 |
| Götterglaube, Mythologie 56. — Höhere Gottheiten 57. — Höhere theogonische und kosmogonische Ideen der Ozeanier 62. | |
| 14. Seele und Jenseits bei den Naturvölkern | 71 |
| Unterhaltung und Vernichtung der Seelen 71. — Aufenthalt der Seelen, Jenseits 72. — Totenvögel, Totenkähne u. ä. 73. — Totenwanderung 75. — Polynesische Hölle 76. — Schicksal der Seele 77. — Resurrektion 79. | |
| Zweites Kapitel. Religiöse Welt- und Lebenanschauungen der Kulturvölker. | |
| 15. Die Kulturvölker als Naturvölker | 80 |
| Wann begann die Kultur? 80. — Unterschied zwischen Kultur- und Naturvölkern 82. | |
| 16. Allgemeine Religionsanschauungen bei den Kulturvölkern im Kreise der Menschheit | 83 |
| Begriff des Wilden 83. — Höhere Anschauungen aus Naturanschauungen 84. — Anschauungen der Littauer, Preußen und Slawen 85. — Anschauungen der Germanen 88. — Anschauungen der Kelten 94. — Anschauungen der Griechen und Römer 95. — Anschauungen der Ägypter 100. — Anschauungen der Hebräer 106. — Anschauungen der Phönizier 108. — Anschauungen der Babylonier und Assyrier 108. — Anschauungen der Eranier 110. — Anschauungen der Indier 113. — Anschauungen der Chinesen, Tibetaner und Japaner 120. — Anschauungen der amerikanischen Kulturvölker 124. | |
| 17. Polytheistische, henotheistische und antagonistische Anschauungen | 127 |
| Die Gottheiten des Polytheismus 127. — Gegenstandsgottheiten und Gottheiten über Gegenstände 128. — Schöpfer und Leiter 131. — Schicksalsgottheiten 136. — Ethische Gottheiten 138. — Begriffsgottheiten 140. — Henotheismus 144. — Antagonistische Gottheiten 148. | |
| 18. Monotheistische Anschauungen | 151 |
| Entstehung des Monotheismus 151. — Monotheistische Unterströmungen 153. | |
| 19. Anschauungen von Welt, Menschheit und Weltkatastrophen | 155 |
| Entstehung von Welt und Menschheit 155. — Paradies und Sündenfall 159. — Flutsagen 161. — Weltuntergang 166. — Messiasidee 169. | |
| [S. IX] 20. Weltbau | 170 |
| Stellung der Erde 170. — Gestaltung der Welt 171. | |
| 21. Leben und Gottheit | 182 |
| Zufall, Freiheit usf. 182. — Menschenschicksal und Götterneid 184. — Lebensweisheit 186. — Orakel und Beschwörungen 189. — Glückliche und unglückliche Tage 191. | |
| 22. Nachleben und Jenseits (Eschatologie) der Kulturvölker | 192 |
| Naturmenschliches 192. — Eschatologie der Hebräer 192. — Eschatologie der Babylonier und Assyrier 196. — Eschatologie der Ägypter 198. — Eschatologie der Eranier 202. — Eschatologie der Griechen und Römer 203. — Eschatologie der Germanen 206. — Eschatologie der Kelten 208. — Eschatologie der Mohammedaner 208. — Eschatologie der Chinesen und Japaner 210. | |
| 23. Seelenwanderung und Wiederbekörperung | 211 |
| Anschauungen der Indier 211. — Anschauungen des Buddhismus 214. — Anschauungen der Eranier 216. — Anschauungen der Kelten 216. — Anschauungen der Pythagoräer und Platons 217. — Anschauungen des Lao-tsse 220. | |
| 24. Seele und Unsterblichkeit, Leben-Reihe | 220 |
| Unterteilung der Seele 220. — Worauf sich die Unsterblichkeit bezieht 223. — Leben-Reihe 224. | |
| Zweites Buch. Philosophisch-deistische und theosophische Anschauungen. | |
| Drittes Kapitel. Pandeistische und Panpsychistische Anschauungen. | |
| 25. Pandeistische Anschauungen | 227 |
| Ägypter 228. — Indier 229. — Ionische Naturphilosophen 231. Stoiker 232. — Pythagoräer und Platoniker 234. — Japaner 235. | |
| 26. Panpsychistische Anschauungen, Hylopsychismus, Hylozoismus | 235 |
| Ionische Naturphilosophen 236. | |
| Viertes Kapitel. Pythagoras, Anaxagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles. | |
| 27. Anschauung aus Gesetz, Harmonie, Weltvernunft, Ideen und Formen | 239 |
| Pythagoras und die Pythagoräer 239. — Anaxagoras, Weltvernunft 243. — Sokrates und Platon, Ideenlehre, Akademie 244. — Aristoteles und die Peripatetiker 249. | |
| Fünftes Kapitel. Anschauungen aus Theosophie, Deismus und Emanismus. | |
| 28. Orphiker und Neu-Pythagoräer | 255 |
| Orphiker 255. — Neu-Pythagoräer 256. | |
| 29. Indische Theosophie und Sufismus | 258 |
| Indische Theosophie 258. — Sufismus 260. | |
| [S. X] 30. Philon von Alexandrien | 261 |
| 31. Der Logos und die Sophia | 265 |
| Der Logos 265. — Die Sophia 266. | |
| 32. Die Gnostiker und Manichäer | 267 |
| Dualistischer Gnostizismus 267. — Monistischer Gnostizismus 271. — Goethes gnostische Dichtung 275. | |
| 33. Der Neuplatonismus | 277 |
| Plotinos und seine Lehre 277. — Dionysios der Areopagite 280. | |
| 34. Übergang zum Mittelalter | 281 |
| Zurückdrängung der Gottheit 281. — Augustinus 282. — Scotus Erigena, Prädestination und doppelte Wahrheit 283. | |
| 35. Islamisch-arabische Theosophie | 286 |
| Koran und Philosophie 286. — Muatazile und Motakhallim 287. — Avicenna und Averroes 288. | |
| 36. Jüdische Theosophie und Kabbala | 290 |
| Salomon Ben Gabirol 290. — Die Kabbala 291. — Maimonides und Jehuda Halevi 293. | |
| 37. Die mittelalterliche Theosophie der christlichen Scholastiker und Mystiker | 293 |
| Scholastiker, Nominalisten und Realisten 293. — Albert der Große 294. — Thomas von Aquino 296. — Dante 297. — Duns Scotus 298. — Roger Bacon 299. — Anselm von Canterbury 300. — Hugo und Richard von St. Victor 300. — Alanus, Bonaventura, Gerson 303. — Meister Eckehart 303. — Ruysbroek 304. | |
| 38. Theosophie und Emanismus in neuerer Zeit | 305 |
| Untergang der Scholastik 305. — Nicolaus Cusanus 306. — Gemistos Plethon 309. — Marsilius Ficinus und Giovanni Pico 309. — Reuchlin und Agrippa 311. — Pomponatius 313. — Die Reformatoren und ihre Nachfolger 314. — Paracelsus 316. — Telesius und Patritius 317. — Giordano Bruno 317. — Campanella 322. — Jakob Böhme 323. — Schelling und Krause als Böhmianer 327. — Baptist van Helmont u. a. 328. — Ausgang in die moderne Theosophie 330. | |
| 39. Deistischer Rationalismus | 333 |
| Descartes und der Cartesianismus 333. — Geulincx, Malebranche und der Okkasionalismus 336. | |
| 40. Prästabilierte Harmonie, Determinismus, Monaden, Korpuskeln, Realen, Samen | 338 |
| Mercurius van Helmont 338. — Leibniz, Monadologie und prästabilierte Harmonie 340. — Christian Wolff 345. — Moses Mendelssohn 345. — Lessing 346. — Herbart und die Realen 347. | |
| Drittes Buch. Metaphysische und physische Welt- und Lebenanschauungen. | |
| Sechstes Kapitel. Welt- und Lebenanschauungen des Idealismus. | |
| 41. Phantomismus (Illusionismus), Eleaten, Skeptiker | 350 |
| Phantomismus und Illusionismus der Indier 350. — Die Eleaten 351. — Die Skeptiker 355. | |
| [S. XI] 42. Phänomenaler Idealismus | 356 |
| Berkeley 356. — Fichtes Phänomenalismus 358. — Humes Phänomenalismus 358. | |
| 43. Kants transzendentaler Idealismus. Organisierte Wesen und Naturzweck | 359 |
| Kants transzendentaler Idealismus 359. — Anschauungsformen und Kategorien 360. — Antinomien und Paralogismen 362. — Ideen und Ideale 364. — Regulative Prinzipe 365. — Teleologie 367. — Organisierte Wesen und Naturzweck 369. | |
| 44. Ich, Nicht-Ich; Thesis, Antithesis, Synthesis; Naturphilosophie | 373 |
| Fichtes erste Philosophie 373. — Schellings Idealismus und Naturphilosophie 375. — Hegel 376. — Schleiermachers spinozistischer Idealismus 378. | |
| 45. Die Welt als Wille und Vorstellung, Pessimismus, Philosophie des Unbewußten | 379 |
| Schopenhauer und die Welt als Wille und Vorstellung 379. — Der Wille zum Leben, Pessimismus 384. — Nietzsches Willenslehre und Idealismus 385. — Eduard von Hartmann und die Philosophie des Unbewußten 386. — Weltende 390. — Andere Idealisten 390. | |
| Siebentes Kapitel. Spinozismus und Neuspinozismus sowie Neuidealismus. | |
| 46. Spinozismus | 390 |
| Spinoza und der Pantheismus, Substanz, Attribute und Modi 391. — Das System 392. — Parallelität von Geist und Körper 393. — Transzendentalität 394. — Ethik und Unsterblichkeit 395. | |
| 47. Neuspinozismus und Neuidealismus | 396 |
| Lotze 396. — Fechner, Psychophysik 398. — Wilhelm Wundt, assoziative Psychologie 399. — Riehl, Lasson u. a. 401. | |
| Achtes Kapitel. Empirismus, Sensualismus, Realismus, Naturalismus, Positivismus. | |
| 48. Die englische Trias: Bacon, Locke, Hume | 402 |
| Bacon von Verulam und der Empirismus 402. — John Locke und der Empirismus, Sensualismus und Positivismus 402. — David Humes sensualistisch-positivistische Anschauung, Assoziationsprinzipe 407. | |
| 49. Die weitere Entwicklung | 411 |
| Condillac, Montesquieu, Rousseau u. a. 411. — Beneke und die Prädetermination 413. — Comte und der Positivismus 415. — Eugen Dührings Wirklichkeitsphilosophie 416. — Ernst Machs sensualistischer Posivitismus 417. — Herbert Spencer und der Agnostizismus 420. | |
| Neuntes Kapitel. Physische Welt- und Lebenanschauungen. | |
| Definitionen 421. | |
| [S. XII] 50. Materialismus und Mechanismus, Atomistik | 422 |
| Der griechische Materialismus und die griechische Mechanistik 422. — Atomistik, auch indische und arabische 423. — Epikuros, Lucretius Carus 425. — Materialismus und Mechanismus im Mittelalter 428. — Mechanistischer Monismus 428. — Gassendi 431. — Hobbes 432. — Boyle, Newton 434. — Aufklärungsphilosophie 434. — Baron Holbach und das Système de la nature 435. — Lamettrie 437. — Ludwig Feuerbach u. a. 438. | |
| 51. Allgemeine und besondere Naturgesetze, Entwicklungslehre | 439 |
| Die Weltgesetze 439. — Die Sondergesetze 443 .— Vererbungsgesetz 444. — Abstammungslehre 445. — Urwesen 446. — Evolution und Epigenesis 447. — Panspermie 447. — Phylogenie und Ontogenie, biogenetisches Grundgesetz 449. — Morphologisch-biologische Vererbungsgesetze, morphologische Potenz 450. — Phylogenetische Evolution 452. — Restitution und Regeneration 453. — Biologisch-harmonische Gesetze, Regulationen 453. | |
| 52. Energetische Anschauungen; Ostwald und Häckel | 454 |
| Ostwalds physische und psychische Energetik 454. — Zwiespältigkeit der Energie 457. — Scheinmonismus 458. — Energetik und Mechanistik 459. — Häckel als Spinozist 461. — Psychom und Psychoplasma 461. | |
| 53. Über die physischen Welt- und Lebenanschauungen überhaupt; Weltende, Unsterblichkeit | 463 |
| Gang der physischen Welt und Weltende 463. — Anfang der Welt und Schöpfung 464. — Endlichkeit der Welt 466. — Zehnders Bild der Lebenmechanistik 467. — Die psychischen Energien als auslösende 468. — Zusammenwirken der physischen und psychischen Energien 470. — Schwierigkeiten aus den regulierenden psychischen Tätigkeiten 473. — Was eine physische Theorie des Lebens zu leisten hätte 477. — Unmöglichkeit einer physischen Theorie des Lebens 479. — Unsterblichkeit aus einem physischen Weltgesetz 479. — Auerbachs Ektropismus 480. — Du Bois Reymonds Welträtsel und Ignorabimus 483. — Letzte Anschauung 484. | |
VORBEMERKUNGEN.
Charakteristik, Prinzipe und Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen.
1. Bedeutung der Welt- und Lebenanschauungen.
Es liegt schon in der Natur des Menschen, von sich selbst und von allem, was ihn umgibt und störend oder unterstützend in sein Leben eingreift, sich eine Ansicht zu bilden. Vielfach und bedeutungsvoll sind die Fragen, die dabei gestellt werden, und mit deren Beantwortung die Menschheit, seit sie ihrer sich bewußt ist und die Fähigkeiten ihrer Seele auch geistig anzuwenden gelernt hat, sich müht und plagt. Und diese Beantwortung bildet eine Welt- und Lebenanschauung; vollständig, wenn sie alle Fragen betrifft, fragmentarisch, wenn sie nur in das Einzelne dringt. Es gibt Anschauungen, die nur aus träger Gedankenlosigkeit oder aus trotziger Verbitterung oder gar aus pathologischer Denkweise hervorgehen. Diese lassen wir beiseite. Die Weltanschauungen, mit denen wir es hier allein zu tun haben, können auf naiver Naturbetrachtung und naivem Egoismus beruhen, sodann auf Kultgebräuchen und Religionslehren, auf philosophischen Untersuchungen und Meinungen, endlich auf naturwissenschaftlichen und soziologischen Feststellungen. Alle diese Grundlagen mögen gesondert stehen oder miteinander verbunden sein. Bei wenigen Menschen haben die Anschauungen nur eine objektive, rein wissenschaftliche Bedeutung. Die meisten wollen neben der Erkenntnis auch eine Beruhigung für das[S. 2] Dasein und darüber hinaus gewinnen. Indessen bilden sich eine eigene Anschauung nur wenige Menschen. Den anderen wird sie durch Erziehung oder Religionsvorschriften eingeimpft. Letztere waren ja früher gerade bei den Kulturvölkern von so zwingender Gewalt, daß eine andere Anschauung als die, welche die Religion allein zuließ, gar nicht gehegt, geschweige geäußert werden durfte. Viele standen und stehen freiwillig unter dieser zwingenden Gewalt, indem die Glaubenssätze der Religion für sie über jeden Zweifel erhaben sind. Andere beugten und beugen sich ihr aus Weltklugheit oder weil das Beispiel des Widerstandes sie schreckte. Auch Lehren, die gerade mit besonderer Kraft ausgesprochen sind oder in Mode stehen, werden gerne ergriffen. Denn es handelt sich, wenn man eine Welt- und Lebenanschauung sich bilden will, immer um eine tiefe und schwere Gedankenarbeit, und mitunter um einen harten Kampf mit sich selbst und mit Anderen. Und bei der Unsicherheit des Kennens und Erkennens fällt der Mensch von Zweifeln in Zweifel und nimmt darum gerne an, was ihm autoritativ übermittelt ist. Mitunter muß der Name an Stelle der Sache treten. Wie wenige von einer Religionsgemeinschaft wissen, was eigentlich die Lehren dieser Religion sind, zumal, wenn diese Lehren von vornherein als „geoffenbart“ vorgetragen werden. Viele wollen sie gar nicht einmal wissen; die symbolischen Formeln genügen ihnen, das übrige soll der Seelsorger verantworten. Und was hat für die meisten Nietzscheaner Nietzsche eigentlich gelehrt? Man darf nicht fragen, ohne auf die hohlsten Redensarten zu stoßen, wenn man überhaupt eine Antwort und nicht eine Widerfrage oder eine Abweisung erhält. Am ehesten auf eine bestimmte sachliche Welt- und Lebenanschauung stößt man bei Naturmenschen und bei unreifer Jugend, nur daß es sich dabei teils um widersinnige, teils um töricht übereilte Äußerungen handelt. Für die Naturvölker werden wir das später eingehend verfolgen, da es ein anthropologisches Interesse hat. Wer die junge Kulturwelt belauschen will, braucht nur ihre modernen Dichtungen zu lesen, die bei schönen Worten und reizvollen Wendungen[S. 3] gedanklich oft recht blühenden Unsinn enthalten und Anschauungen wiedergeben oder erraten lassen, bei denen selbst einen mild urteilenden harte Ungeduld ergreift. Die ernst und selbständig denken, suchen sich allmählich zu einer sie befriedigenden Welt- und Lebenanschauung durchzuringen. Da hierzu auch Kenntnisse gehören und namentlich auch Disziplin des Denkens, kommen nur sehr wenige Begünstigte schon früh zu einer brauchbaren solchen Anschauung. Viele gelangen erst in späten Jahren dazu, und noch mehr mühen sich ihr Leben hindurch umsonst ab und müssen sich mit einem Stück einer Anschauung oder mit mehreren Anschauungen begnügen, zwischen denen sie nicht zu vermitteln vermögen.
Ich habe unbestimmt von einer Welt- und Lebenanschauung gesprochen. Die Welt- und Lebenanschauung gibt es noch nicht. Selbst bei den Kulturvölkern sind unzählige Anschauungen im Schwange, und eine Anschauung wird von der anderen bekämpft, und von jeder Anschauung kann man nachweisen, daß sie hier oder da unrichtig sein muß, von keiner aber, daß sie richtig ist. Die wichtigsten Dinge, die in einer Welt- und Lebenanschauung zur Sprache kommen, sind zeitlich, räumlich und sinnlich unerreichbar. So ist niemand bei der Schöpfung zugegen gewesen; der eine kann sie also ganz leugnen, der andere ebenso sicher absolut bejahen. Daher handelt es sich hier fast ausschließlich um Meinungen. Und diejenige Meinung wird die größte Wahrscheinlichkeit für sich haben, welche mit den Vorgängen im All, jetzt und früher, am besten in Einklang ist. Hier aber spielen subjektive Ansichten mit, gerade wie in der Religion; und was dem einen erwiesen scheint, weist der andere weit von sich. Und wie oft geradezu Widersinniges für sicher genommen wird, werden wir an vielen Beispielen sehen. Ich habe einmal in einer sehr wichtig und bedeutend tuenden Broschüre gelesen, unsere Welt sei die Schlacken oder auch die Auswurfstoffe aus der vierten Dimension. Wie töricht! wird der Leser ausrufen. Aber wir haben noch viel seltsamere Ansichten.
2. Naturvölker und Kulturvölker.
Wir unterscheiden zunächst die Anschauungen der Naturvölker von denjenigen der Kulturvölker. Die Völker der Halbkultur folgen wesentlich den Naturvölkern. Auch steht so mancher Kulturmensch ganz auf dem Standpunkt des Wilden. Trifft er sich dort, so mag er in sich gehen und in die ihm gehörige Klasse überwandern.
Einfacher und doch verworrener sind die Anschauungen der Naturvölker als die der Kulturvölker. Wie es unendlich viele Mühe gemacht hat, in die Religion der Naturvölker einige sichere Einsicht zu erhalten, weil auf Befragen nicht bloß fast jedes Dorf, sondern fast jeder Befragte etwas besonderes erzählt, so verhält es sich hinsichtlich der Weltanschauungen. Gemeinsame Lehren ergaben sich nämlich bald, weil ihre praktische Betätigung in unmittelbare Erscheinung trat. Aber Meinungen und Anschauungen hatte jeder für sich. Und dabei handelte es sich nicht einmal immer um Verlegenheit vor dem Frager und Mißtrauen gegen ihn, sondern einfach um Mangel an Ansicht und Unüberlegtheit. Wie viele Kulturmenschen würden auf Befragen nach ihrer Weltanschauung bestimmt antworten können oder wollen? Und wo sie eine solche Anschauung besitzen, würden sie in Staaten mit polizeilichen oder kirchlichen Gewalten aus Furcht vor Nachteilen, sonst in dem unbequemen Gefühl, etwas Törichtes zu sagen, noch weit mehr mit ihren Meinungen zurückhalten als ein Naturmensch, oder sich mit Ausflüchten helfen. Als ich mich mit der Religion der ozeanischen Völker beschäftigte, fiel es mir auf, daß von den unzähligen Namen für Götter und Helden, welche in einem Hauptwerk hierüber, Greys „Polynesian Mythology“, enthalten sind, kaum zwei in den sehr vielen Angaben der Seefahrer des achtzehnten Jahrhunderts (Cooks, Wilsons, Pokocks u. a.) sich finden. Die bei weitem wichtigste Bezeichnung für Götter und Dämonen in diesen Angaben, Eatooa oder Atoa oder ähnlich, sucht man in gleicher Eigenschaft in Greys Werk vergeblich. Ein anlautender Name kommt[S. 5] wohl vor, er bezeichnet aber eine Insel oder einen Distrikt. Nur die Namen Tane und Maui scheinen zeitlich und räumlich sehr verbreitet zu sein. Frobenius, in seinem Buche „Die Weltanschauung der Naturvölker“ hat sich der Mühe unterzogen, für die afrikanischen Völker den Namen einer der bekanntesten Gottheiten durch die Stämme zu verfolgen. Er geht von dem Namen Tschuka aus, der bei den Ibo und in Kalabar einfach Gott bedeuten soll, und stellt mehr als fünfzig Namen auf, die jenem Namen entsprechen sollen, darunter solche wie Rupe, Ndsakumba und ähnliche, die nicht entfernt mehr an den Ausgangsnamen erinnern. Das kann und wird zum Teil an den abweichenden Sprachen liegen, wie wir ja für unser „Gott“ selbst unter den Indogermanen um eine ähnlich lautende Bezeichnung verlegen sind. Dann aber muß man sich wundern, daß Hottentotten und Buschmänner, die eine von den eigentlichen Bantu-Negern des mittleren Afrika ganz verschiedene Rasse bilden, fast den gleichen Namen für Gott besitzen wie die ihnen so fernen Neger des oberen Kongo, Touquo und Tuiko gegen Tuku (vermehrt Tuku-Tuku), während fast sich berührende Stämme der gleichen Rasse und anscheinend des gleichen Sprachstammes ganz abweichende Namen aufweisen. Bei den Yoruba an der Nigermündung heißt es Dso oder Zo, wie in dem weit entfernten Saumgebiet Ostafrikas. Aber in dem nahen Kamerun soll man das gleiche mit Loba, Lebe, Rubi bezeichnen, wie ähnlich mit Lubari in Uganda, wo ja auch Dso oder Zo bestehen soll, und wo als eigentlicher Name des Schöpfers Kitonda angegeben wird. Vieles muß also an den verschiedenen Angaben liegen, die im gleichen Bezirk von verschiedenen Personen dem gleichen oder einem anderen Forscher gemacht werden. Anderes an der kindlichen Gewohnheit der Naturvölker, Namen beliebig zu ändern oder zu verdrehen. Wer Reisewerke miteinander vergleicht oder die Namen in Atlanten und anderen Werken sucht, gerät mitunter in helle Verzweiflung. Gegenwärtig kommt noch dazu, daß die meisten Naturvölker schon mit Kulturmenschen durchsetzt sind und vieles Kulturelle, namentlich Religiöse,[S. 6] von ihnen gehört und in sich aufgenommen haben. Neuere Mitteilungen über Ansichten von Naturvölkern können darum nur mit größtem Mißtrauen benutzt werden, namentlich, wenn sie an Kulturansichten erinnern. Und da die älteren Reisenden meist weder die Kenntnisse noch das Interesse besaßen, sich wirklich genau über die besuchten Völker zu orientieren, sondern nur allzu gerne sich die tollsten Lügen aufbinden ließen, um zu Hause die merkwürdigsten Fabeln erzählen zu können, so sieht es eigentlich mit Untersuchungen über die Welt- und Lebenanschauung der Naturvölker übel aus. In den Märchen und Erzählungen, die uns von den Naturvölkern vorgetragen werden, sind Züge reinster Empfindung und Tugend und dicht daneben Roheiten entsetzlichster Bestialität. Ganz wie in den Sagen der alten Griechen. Wer kann die rührende Szene zwischen Hektor und Andromache mit der scheußlichen des Totenopfers für Patroklos vereinigen? Wir kommen dadurch auf einen Punkt, der von großer Bedeutung ist und uns noch beschäftigen wird.
Für die Kulturvölker scheint die Untersuchung einfacher und sicherer zu sein, hier ist ja so vieles durch Tradition und Schrift bekannt. Aber das Ungeheuere des Materials wirkt erdrückend. Es prahlte jemand mit seinem Fleiße und rechnete so viel Tätigkeit zusammen, daß für den Tag 26 Stunden Arbeit herauskamen. Selbst dieser Zauberkünstler wäre nicht imstande, das Material auch nur zum vierten Teil zu bewältigen, und wenn er Methusalems Alter erreichte. Man muß sich darum auf Hauptansichten und Hauptwerke beschränken. Und dieses darf um so eher geschehen, als wahrhaft große Meinungen nur spärlich erblüht sind, und als unglaublich Viele bewußt und unbewußt die Wege der Großen wandeln. Das ist kein Tadel; und wer in mühseliger Arbeit das gefunden hat, was einem Großen vor ihm schon als Geschenk des Genies eingefallen ist, darf mit Fug und Recht stolz sein und alberne Kritik aus Zusammengelesenhaben ablehnen. Eine solche Arbeitsvermehrung nimmt man gerne entgegen. Eine andere Schwierigkeit liegt in dem Mangel an Bestimmtheit in so vielen Meinungen[S. 7] und Schriften. Wir werden von zwei wilden Rossen nach entgegengesetzten Richtungen gezogen, dem Verstand und dem Gefühl. Mancher wird innerlich zerrissen, viele geben wenigstens dem einen oder dem anderen etwas nach. Kommt noch dazu die menschliche Gebundenheit um des bloßen Lebens willen an anderer Meinung, etwa die bemerkte an Staat und Kirche, so ergibt sich ein weiteres Schwanken. Hat man doch dem großen Kant Inkonsequenzen in seinem philosophischen System vorgeworfen. Und wer weiß so recht, was Fichtes oder gar Schellings eigentliche Philosophie gewesen ist, da man doch von jedem von ihnen mehrere ganz abweichende Philosophien hat? Und da bei weitem die meisten Menschen inkonsequent sind, die einen aus Anlage, die anderen aus ehrlichem Zweifeln, so berührt uns ein ganz konsequenter Mann oder eine ganz konsequente Ansicht fast unheimlich. Wir werden sehen, daß auf unserem Gebiete davon nur sehr wenig vorhanden ist. Man kann fast sagen: mitunter zum Glück für die Menschheit. Denn mit absoluter Konsequenz ist oft Fanatismus und mit diesem Verfolgungssucht verbunden, die sich in der konsequentesten Religion, der katholischen, in so entsetzlichen Taten geäußert hat, und eine Herrschernatur wie Innozenz III., trotz so großer Leistungen, durch die Ausmordung Tausender andersdenkender unschuldiger Menschen fast fluchbeladen erscheinen läßt.
3. Hauptfragen und Stammannahmen (principia, ἀρχαὶ) der Welt- und Lebenanschauungen.
Der Leser sieht, welch umfangreiche Arbeit hier zu bewältigen ist, und wie alles nur in großen Zügen zur Darstellung kommen kann. Doch habe ich die Absicht, weit über die engen Grenzen der Spezialbetrachtungen hinauszugehen, die immer nur einzelne Klassen der Menschheit betraf. Ich möchte vorführen, was der Mensch allgemein an Welt- und Lebenanschauungen geschaffen hat; nicht diese oder jene Philosophenschule, diese oder jene Religion,[S. 8] dieses oder jenes Volk. Unter solchen Umständen ist eine gewisse Systematik unausweichlich, sonst verläuft man sich in der Fülle des Gebotenen und gerät in Gefahr, die Darlegung in Phrasen aufzulösen. Und nirgends ist diese Gefahr so groß und sind ihr so viele Schriftsteller erlegen als gerade auf dem Gebiete, mit dem wir uns hier beschäftigen sollen. Was Prinz Heinz von seinem dicken Freunde bei der Musterung seiner Rechnungen gesagt hat, und ich einmal einen berühmten Nationalökonomen auf einem Kommers auf die Universitätsvorlesungen habe anwenden hören, soll uns zur Warnung dienen. Gründlichkeit hier, Schmuckrede dort, zwischen diesen Symplegaden müssen wir unser Schifflein hindurchsteuern.
Fast jede Weltanschauung geht von einer Stammannahme oder von mehreren Stammannahmen aus. Es muß daher von großer Bedeutung für die Ordnung des Vortrags sein, wenn vor allem diese Stammannahmen vorgeführt werden. Vollständig dieses zu tun ist für einen beschränkte Zeit lebenden Menschen nicht möglich, wegen der unendlichen Menge von Büchern, die er lesen müßte. Nachdem ich mich aber durch so viele Jahre frei und veranlaßt in so vielen Wissenschaften umgesehen habe, glaube ich, daß in der nachfolgenden Aufzählung Wichtigeres nicht fehlen wird. Sollte der Leser noch eine und eine andere Annahme wissen, so füge er sie gütigst hinzu; wir sind alle gerne Kärrner der Königin Wissenschaft. Die Annahmen gehen aber auf
- den Grund des Alls und den der Einzelnen,
- den Bestand des Alls,
- das Wesen der Dinge,
- das Wesen und den Grund der Geschehnisse,
- die Entwicklung des Alls,
- das Ende des Alls,
- das Ende der Einzelnen.
Das sind sieben Hauptpunkte. Es ist nicht angängig, die allgemeine Liste ganz nach diesen Hauptpunkten einzurichten; die Behandlungen müßten vielfach durcheinander gehen und sich verschlingen, wodurch viele unnötige und störende[S. 9] Wiederholungen entstehen würden. Gleichwohl ist die nachfolgende Liste unterteilt, und zwar derartig, daß sie in einiger Beziehung sich den Hauptpunkten anschmiegt. Wenn manche Hauptpunkte in der Liste nicht berücksichtigt zu sein scheinen, so ist es in der Tat nur ein „scheinen“. Durch gehörige Untersuchung der Stammannahmen und namentlich auch durch Verbindung zweier oder mehrerer von ihnen werden auch diese Hauptpunkte zur Erledigung gebracht.
Die Liste enthält vier Klassen: phantomistische Annahmen, wesenheitliche, wesenheitlich-begriffliche, begriffliche. Es kommt auf die absolute Richtigkeit der Benennungen nicht an, diese müssen nur durchschnittlich zutreffen und können es auch nur. Nun möge die Liste selbst folgen.
- Phantomistische.
1. Nichts,
2. Traum,
3. Schein. - Wesenheitliche.
4. Das (indisch Tad),
5. Etwas,
6. Urwesen, Ding an sich, Substanz,
7. Gott,
8. Götter (in allen Abstufungen),
9. Weltgeist,
10. Schöpfer (Schöpfung),
11. Vernichter, Satan, Widergott,
12. Weltseele,
13. Einzelseele,
14. Weltvernunft,
15. Einzelvernunft,
16. Emanation,
17. Chaos, Urmaterie,
18. Materie (auch Elemente und Körper),
19. Energie, Entropie,
20. Psychoma. - Wesenheitlich-begriffliche.
21. Sein, Nichtsein,
22. Werden, Vergehen,
23. Ruhe, Erregung,
24. Attribute,
25. Ideen,
26. Formen,
27. Modi (auch Essenzen und Bilder),
28. Monaden (auch Realen),
29. Zahl,
30. Raum (auch Leere),
31. Zeit,
32. Harmonie,
33. Disharmonie (auch Entzweiung in sich). - Begriffliche.
34. Gut,
35. Böse,
[S. 10] 36. Liebe (auch Anziehung),
37. Haß (auch Abstoßung),
38. Streit,
39. Zwang (absoluter),
40. Notwendigkeit,
41. Anlage (auch Prädestination, Prästabilisation),
42. Unfreiheit, Determinismus,
43. Ursächlichkeit,
44. Beschränktheit,
45. Zweckmäßigkeit (Teleologie, auch Instinkt),
46. Entwicklung,
47. Produktion und Reaktion (auch Regulative),
48. Parallelismus,
49. Gelegenheitlichkeit,
50. Zufall, Association,
51. Freiheit,
52. Unbeschränktheit.
Die Liste sieht bunt genug aus; es soll ja aber auch ein allgemeiner Überblick über die Welt- und Lebenanschauungen gegeben werden. Wir könnten nun weiter so verfahren, daß wir einfach die obigen Stammannahmen einzeln und zu zweien oder mehreren nehmen, so würden wir schon eine große Zahl aller bisher entwickelten Anschauungen gewinnen. Aber die Liste soll uns nur im einzelnen leiten. Die Betrachtung führen wir allgemein.
4. Vergleichung der Anschauungen, Parallelen.
Drei Hauptaufgaben haben wir zu erfüllen: die Anschauungen einzeln oder in Klassen vorzuführen, sie auf ihre theoretische und praktische Bedeutung zu untersuchen, sie miteinander zu vergleichen. Über die beiden ersten Aufgaben ist nichts besonderes mehr zu sagen. Die dritte Aufgabe aber gibt zu einer wichtigen Bemerkung Anlaß. Die Vergleichung kann zu zwei Zwecken geschehen. Einmal um die Kulturzustände der Völker oder Zeiten, innerhalb deren die Anschauungen geäußert sind, gegen einander abzuwägen. Sodann um über die Priorität einer aufgestellten Anschauung zu entscheiden. Das erstere gehört nur zu sehr geringem Teil hierher, da wir ja keine Kulturgeschichte schreiben, und wird sich meist bei den Vorführungen selbst erledigen. Das zweite lassen wir fort, sofern es sich um Prioritäten einzelner Personen handelt. Diskussionen hierüber haben nur dann einen Wert, wenn mit der Priorität auch der Sinn[S. 11] der Anschauung verbunden ist, den wir ja bei einem gedankentiefen Manne immer eine Stufe höher verstehen müssen als bei einem mittelmäßigen Kopf, wenn der Ausdruck der Ansicht dazu Raum läßt. Nun aber werden Anschauungen nicht bloß von einzelnen Personen ersonnen, sondern, wie Lieder, von einem ganzen Volke, so daß es sich um Volksanschauungen handelt. Dann können Völker miteinander in Wettbewerb treten und hat die Frage nach der Priorität doch große Bedeutung. Ich darf nur an den Streit Babel und Bibel erinnern, der mit so außerordentlicher Heftigkeit in unseren Tagen geführt worden ist. Und gerade an diesen Streit kann ich anknüpfen. Er entsprang aus behaupteten Ähnlichkeiten zwischen der Literatur der Babylonier und gewissen Teilen der Bibel, so daß die erstere Vorläufer und Muster für die Erzählungen und die Lehren der Bibel sein sollte. Auch ganz abgesehen davon, ob die Ähnlichkeiten wirklich so bedeutend sind, daß man es wagen dürfte, ein Werk wie die Bibel in wichtigsten Teilen der Originalität zu entkleiden, machte sich in diesem Streit eine verblüffende Außerachtlassung aller Errungenschaften der Anthropologie geltend. Längst haben die Anthropologen erkannt, daß die Menschheit eine auffallend gleichartige Masse bildet, daß Gebräuche, Gedanken und Vorstellungen sich oft an den entferntesten Punkten der Erde in gleicher Weise vorfinden. Ein so ekelhafter und so seltsamer Brauch wie das Auffangen und Verwenden der Fäulnisflüssigkeit des Leichnams zeigt sich im Herzen Afrikas und auf weit abliegenden ozeanischen Inseln. Die Entstehung der Menschen aus Bäumen oder Steinen wird fast auf der ganzen Erde erzählt. Reineckes Streiche und Schlauheiten, nur übertragen auf Hasen und Schakale, geben auch den verschiedensten Negerstämmen Stoff zum Lachen. Märchen fast des gleichen Inhalts finden sich bei Völkern, die weder sprachlich noch stammlich zusammenhängen. Ich habe mir mehr als zwanzig Ähnlichkeiten sogar im Einzelnen zusammengestellt. Eine sehr seltsame und sehr wichtige, daß nämlich die Wasser über dem Himmel der Bibel in Ozeanien sich wiederfinden,[S. 12] habe ich schon in meinem Buche „Die Entstehung der Welt und der Erde nach Sage und Wissenschaft“ hervorgehoben. Ich kann hier mit noch einer, nicht minder bedeutenden, vielleicht noch bedeutenderen aufwarten. Nach der Bibel schafft Gott zwischen den Wassern eine Dehnung, wodurch die Scheidung zwischen Himmel und Erde bewirkt wird. Bei den Neuseeländern sind Himmel und Erde ursprünglich auch aufeinander und der Gott Tane-mahuta trennt sie, daß ein Zwischenraum zwischen ihnen entsteht. Geschieht letzteres auch grobsinnlich — der Gott stemmt den Kopf gegen die Erde, Papa, und die Füße gegen den Himmel, Rangi, und drückt so diese Gatten auseinander — die Sache ist doch die gleiche, das Schaffen der Ausdehnung zwischen Himmel und Erde. — Der Neuseeländische Maui wird von seiner Mutter, eingewickelt in einen Wulst ihrer Haare, ins Meer geworfen, von den Wogen ans Land gespült und dort aufgefunden und erzogen. Damit vergleiche man die Kindheitsgeschichte Mose. Der Hauptunterschied besteht nur darin, daß Mose von einer Königstochter aufgenommen wird, Maui von einem männlichen Vorfahr. — Die Polynesier haben Schwanenjungfrauen wie wir und mit fast den gleichen Erzählungen. — Ra kennzeichnet in Ozeanien den Sonnengott, genau wie im alten Ägypten. — Fast noch verwunderlicher ist, was Max Müller mitteilt, daß einem Zwillingsgötterpaar der indischen Mythologie, Yama und Yami, ein anderes, Yame und Yama, mit gleicher Bedeutung in Peru entspricht. Nun denke man, welche wilde Theorien unsere Babylonier darauf gegründet haben, daß im Babylonischen, das doch eine Schwestersprache des Hebräischen ist, ein Wort sich fand, das an Jehova anklang! Und Indien und Peru, Altägypten und Ozeanien! — Josuas Wunder, daß die Sonne auf sein Geheiß stehen bleibt, ist von vielen Ozeaniern nachgeahmt, z. B. bis ein Haus fertig ist oder ein Wanderer seinen Weg zurückgelegt hat. — Totenschiff und Totenführer kennen nicht bloß die Griechen, sondern auch die Polynesier und einige Afrikastämme und Indianer. — Maui raubt das Feuer wie Prometheus. — Solare Gottheiten[S. 13] der Neger erregen Krankheiten durch Wurfgeschosse wie Apollon. — Gleich den Israeliten geht ein Hottentottenheros, Heitsi-Eibibs, durch das Wasser, das sich vor ihm spaltet und wie dort über dem Verfolger zusammenschlägt. — Ich könnte noch viel mehr anführen, Regenbogen, Weltei, Wahrsagekunst, Jonas und anderes betreffend. Aber ich glaube, daß die obige kurze Aufzählung schon genügt darzutun, wie außerordentlich vorsichtig man bei Schlüssen aus Ähnlichkeiten sein muß. Diese Vorsicht muß aber geübt werden, sonst kann man hinsichtlich der Völkerzusammenhänge zu den bösesten Schlüssen kommen. Wir werden später noch vieles andere kennen lernen, was auf gleichem Gebiete liegt, Ost und West, Nord und Süd verbindet und seine Wurzel eben in Zufall oder in der Gleichartigkeit des Menschengeschlechts hat. Im allgemeinen kann man sagen, daß alles Entlehnte sich ziemlich bald durch Mißverständnis, Unstimmigkeit und Gezwungenheit verrät. Echtes, Eingeborenes, geht frei nach rechts und links ausgreifend und entwicklungsfähig einher. Doch sollen die Schwierigkeiten bei der Scheidung nicht verkannt werden.
5. Einteilung der Welt- und Lebenanschauungen.
Man teilt die Welt- und Lebenanschauungen in zwei Klassen ein, in monistische und pluralistische oder multistische (dualistische, trialistische usf.). Die erstere Klasse soll Anschauungen enthalten, die, von einem Gesichtspunkt ausgehend, das gesamte All, ohne irgend eine Ausnahme darin, als eine Einheit mit zeitlich und räumlich unbegrenzt gleichen Eigenschaften betrachten. So z. B. behauptet der bekannteste Monismus — den ich hier nicht mit dem unzureichenden und irreführenden Beiwort: materialistischer, sondern allgemeiner und treffender: physischer Monismus bezeichnen will —, daß das gesamte All, belebt und unbelebt, stets und überall nur von den Erscheinungen, die wir in der unbelebten Natur kennen, erfüllt und beherrscht worden ist, wird und werden wird. Ihm gegenüber[S. 14] betrachtet der Dualismus die Welt von zwei unabhängigen Gesichtspunkten, z. B. indem er das All durchaus in Leben und Nichtleben, in Körper und Geist, in Gott und Welt usf. teilt. Noch weiter würde die Teilung gehen im Trialismus, Tetralismus usf. Dabei käme es eigentlich darauf an, daß die Trennungen im Pluralismus absolute sind. Derartige Anschauungen besitzen wir nicht recht; es läßt sich nicht vermeiden, daß eines in das andere eingreift. Indessen gibt es, wie wir noch sehen werden, einen wirklichen Monismus auch noch nicht. Überhaupt bringt es der Gegenstand mit sich, daß keine der Anschauungen auch nur theoretisch, geschweige praktisch, durchaus konsequent ist, wenigstens wenn man sie sachlich und nicht bloß nach den Behauptungen untersucht. Mitunter erscheinen die Anschauungen der Wilden, namentlich in ihrer praktischen Anwendung, bei weitem konsequenter als die der Kulturmenschen. Und das hat seinen guten Grund, den wir noch kennen lernen werden.
Der obigen Einteilung werden wir nur bei den einzelnen Anschauungen Rechnung tragen können. Allgemein werden wir drei Hauptklassen unterscheiden: psychisch-religiöse, religionsphilosophische, philosophisch-physische, und werden darunter finden: irdisch-menschliche, irdisch-göttliche, religiöse, psychische (auch geistige), philosophische (metaphysische), physische (naturwissenschaftliche); phantomistische, theosophische, mystische Anschauungen. Die drei letzten sind durch das Semikolon absichtlich von den anderen getrennt; sie bedeuten eine eigenartige Gattung von Anschauungen diesen gegenüber, in der Phantasie und Grübelei eine besonders große Rolle spielen. Aus den ineinandergreifenden Benennungen in den Hauptklassen sieht der Leser schon, daß auch hier scharfe Scheidungen nicht vorhanden sind. Und wie sollten auch solche Scheidungen bestehen! Jede Anschauung wird regiert durch Erfahrung, Wunsch, Religion und Nachdenken. Die Erfahrung gibt die Welt wie sie ist, oder wenigstens erscheint, das ist das Physische. Der Wunsch richtet sich auf den Gang der Welt in bezug auf uns und auf andere, als positiver und negativer Egoismus, bedeutet also das Irdisch-menschliche.[S. 15] Die Religion ist bei den meisten verdeckter Egoismus, und zwar natürlicher Egoismus, der, berechtigt, auf Erhaltung seiner selbst und anderer geht, aber auch häßlicher, der die Gottheit oder die Weltordnung zur Demütigung, Dienstbarmachung oder gar Vernichtung des Anderen sich zum Vorteil oder nur zur Schadenfreude herbeiruft. Bei anderen, wie bemerkt, und wiederum recht vielen, ist sie lediglich gedankenloses Anhängen an bestimmte Satzungen. Verhältnismäßig die Minderzahl faßt die Religion innerlich mit tiefem Fühlen und fester Überzeugung auf. Endlich das Nachdenken, das philosophische, sucht die unmittelbare Erfahrung der äußeren und inneren Welt zu verknüpfen; Widerstrebendes zu vereinigen, das Mannigfaltige zu vereinheitlichen und aus allem diesen das Gewirr der Welt und des Lebens unter wenige Gesichtspunkte zu bringen, die auch Schlüsse auf Unbekanntes und Zukünftiges gestatten. Dazu können wir getrost auch das Phantasieren und Grübeln rechnen, die beide nur ein Übergreifen des Denkens auf übersinnliche oder unsinnliche Objekte darstellen. Das eine oder das andere von diesen vier Steuern auf dem Meere der Anschauungen mag hier und dort nicht zur Anwendung gelangen, es mag sogar herausgehoben und als unnötig beiseite gelegt werden. Das tut nichts und berührt die Bedeutung dieser Steuer für die Gesamtbetrachtung nicht.
Und so kennzeichnen die gewählten Namen für die einzelnen Anschauungen nur das Vorwiegende in der jeweiligen Anschauung. Denn beispielsweise fehlt das Physische in keiner der Anschauungen, aber es gibt Anschauungen, in denen es ganz besonders zur Geltung gebracht ist. Gleicherweise verhält es sich mit dem Religiösen, wo nur die rein materialistischen Anschauungen eine Ausnahme machen, und mit dem Philosophischen und Irdisch-menschlichen.
ERSTES BUCH.
Psychisch-religiöse Welt- und Lebenanschauungen.
ERSTES KAPITEL.
Anschauungen der Naturvölker.
6. Irdisch-menschliche Anschauungen.
Diese sind bald erledigt. Für sie ist alles, wie es sich den Sinnen darstellt. Weder über das Wesen noch über die Ursache des Vorhandenen wird nachgedacht. Es wird alles so genommen wie es geboten ist, und Kenntnisse und Gesichtsweite richten sich nach dem Wahrgenommenen. Damit verbunden ist die Beziehung jeglichen Gegenstandes und Vorganges auf die eigene Person. Es ist ein rein anthropozentrischer Standpunkt, indem das Ich der entscheidende Inhalt der Welt ist, und Gut und Böse sind, was dem Ich dient oder dem Ich schadet. Von vornherein werden die Himmelskörper als Gegenstände gleich denen der Erde oder gar der nächsten Umgebung angesehen, so als gewöhnliche Körper, Menschen oder Tiere oder Früchte. Der Kulturmensch, der die Gelehrten sich den Kopf über die Welt zerbrechen läßt, wird die Himmelskörper schon als das betrachten, was aus der Wissenschaft auch gegen seine Absicht ihm zur Kenntnis gelangt ist. Aber bei Naturvölkern ist es eine Selbstverständlichkeit, daß die Welt einheitlich der irdischen gleicht. Naiv wird angenommen, was die Forschung mit vieler Mühe, wenn auch in ganz anderem Sinne, zum Teil erst erweist. Nichts ist charakteristischer als die An[S. 17]schauung vom Himmel und von dem darüber Befindlichen, die wir bei so vielen Naturvölkern vorfinden. Der Himmel ist ein Zeltdach, am Horizont an die Erde durch Stricke, Ranken und ähnliches befestigt, oder von Bergen, Felsen, Bäumen, Menschen, Tieren getragen. So kann ein Mensch auch einfach in den Himmel gelangen. Tawhaki, ein neuseeländischer Heros und später Halbgott, hat ein dem Himmel entstiegenes Weib Tanga-Tanga oder Hapai und von ihr ein Töchterlein. Wie in unseren Märchen verschwindet das Weib jeden Tag mit Morgengrauen, bis sie aus Liebe gänzlich bei ihm bleibt. Eines Tages aber beleidigt er sie in dem Kind, das er als übelriechend bezeichnet, und sie entflieht mit dem Kind in ihre himmlische Heimat. Nun sucht er einen Weg, in den Himmel zu gelangen, um sie zurückzuholen. Nach einigen Abenteuern gelangt er dahin, wo die Befestigungsseile des Himmels die Erde treffen. Dort findet er eine alte Tante von ihm, und die gibt ihm den Rat, an dem festgemachten Seil emporzuklettern. Sein Bruder Karibi, der ihn begleitet hatte, nimmt ein zu loses Seil und wird nun von den Winden Ost und West hin und her geschleudert. Tawhaki selbst aber ist vorsichtig, klettert sicher und kommt so in den Himmel. Menschen, die auf irgendeine Weise in den Himmel gelangt sind und zur Erde zurückwollen, machen ein Loch, binden ein Tau an und lassen sich an dem Tau herab. Oder es schießt jemand einen Pfeil in die Höhe, der im Himmel stecken bleibt, dann schickt er einen zweiten in den ersten, einen dritten in den zweiten usf. So gewannen die Söhne Ajelens in Nordamerika eine Pfeilleiter, in den Himmel zu klettern, und einer so entstandenen Pfeilleiter bediente sich der polynesische Heros Quat. In Australien wirft ein Mann seine Lanze, an die ein Seil gebunden ist, gegen den Himmel, die Lanze bleibt dort stecken und er hat so einen Weg. Noch einfacher macht es Kasimbaha in Celebes, er benutzt die Rottangranke, nachdem die Feldratte ihre Dornen abgenagt hat, um in den Himmel zu gelangen. Wenn die Höhe eines Baumes nicht reicht, wird ein Zauber angewendet, ihn rasch wachsen zu lassen. Ein Kannibale, Quasawara, stellte dem[S. 18] vorhin erwähnten Quat (Banks-Inseln) und seinen Brüdern nach. Alle flohen auf die Spitze eines Kasuarinenbaumes. Der Verfolger kletterte hinter ihnen her, aber Quat machte den Baum immer höher wachsen. Zuletzt reichte dieser bis zum Himmel. Da bog Quat den Baum zur Erde, stieg rasch mit seinen Brüdern herab, indem er die Spitze festhielt, und als sie alle unten waren, ließ er die Spitze los, der Baum schnellte auf und der zurückgebliebene Quasawara zerschlug den Kopf an dem Himmel. Wer sich über so kindliche, fast kindische Anschauungen verwundern sollte, der denke, daß ja für den Augenschein der Himmel in der Tat nicht sehr fern ist, je nach Beschaffenheit der Luft und der Vergleichsgegenstände vielleicht 20 bis 80 Meter. Der Naturmensch folgt diesem Augenschein und läßt den Himmel über Bergen sich entsprechend wölben, mitunter auch die Berge in den Himmel ragen. Unwillkürlich denkt man an Astolfs Fahrt mit dem Apostel Johannes zum Monde, um Rolands Verstand, der dort in einer Flasche aufbewahrt wird, herabzuholen, nach Ariostos Dichterphantasie. Auf dem Monde
Diese Verse führe ich des Folgenden wegen an. Der Naturmensch nimmt das gleiche an. Im Himmel ist nämlich für ihn alles wie auf der Erde: Wälder, Seen, Berge, selbst Menschen und Häuser. Und die Menschen unterscheiden sich an sich in nichts von den Erdenmenschen, nur daß man sie, da sie den Himmel bewohnen, etwas höher einschätzt. Tawhaki findet zuletzt sein Weib und sein Kind und bleibt bei ihnen, er spielt die Rolle eines Gewittergottes, indem es von seinen Fußtritten donnert und blitzt. Noch naiver ist die Erzählung von Rupes Himmelaufstieg. Er sucht seine Schwester und will darüber seinen Ahnen Rehua befragen. Der aber wohnt[S. 19] im zehnten Himmel — es wird also eine Vielzahl von Himmeln angenommen, wie auch anderweitig. — Rupe durchklettert alle Himmel, wie, wird einfach nicht gesagt. In allen ist es wieder genau wie auf der Erde. Endlich gelangt er in den zehnten Himmel und findet dort auch den gesuchten Rehua. Und wie gemein irdisch es da zugeht, wird fast mit Humor geschildert. Rupe verlangt zu essen. Da schüttelt der uralte Rehua die Locken, und es fallen eine Menge Vögel heraus, die gebraten werden. Auf Rupes verwunderte Frage, warum die Vögel in seinem Haar nisten, sagt Rehua, er hätte dort eine so große Menge von — Insekten, daß alle Vögel auf seinem Haupte ihre Nahrung suchen. Ja, Rupe findet, daß Rehuas Sklaven diesen schändlich behandelt haben, und muß seine Wohnung vom gräßlichsten Schmutz säubern. Und das im zehnten Himmel! zu dem der Hochgott der Ozeanier, Tane, die Wege besonders versperrt haben soll. In Borneo steigt ein Mann auf die Plejaden und bekommt dort Reis vorgesetzt, den er so kennen lernt. Fast gleiche Auffassungen finden wir in Australien und in Afrika, bei den Eskimo und bei anderen Völkern. Daß die Indianer Jagdgründe im Himmel erwarten, wissen wir ja schon aus Coopers Romanen. Aber folgende indianische Sage ist noch deutlicher, die ich nach Frobenius, gekürzt, gebe. Der Coyote hatte einen Sohn und dieser besaß zwei Frauen, von denen der Coyote eine für sich wünschte. Er wollte ihn töten und veranlaßte ihn, um einen Vogel zu fangen, auf einen Baum zu klettern. Nun ließ er den Baum höher und höher wachsen, bis dieser den Himmel berührte, daß sein Sohn sich an der Feste den Kopf einschlage. — Man vergleiche dazu die vorhin mitgeteilte Erzählung von Quat und Quasawara auf den Banks-Inseln. Aber der Sohn sprang vom Baum in den Himmel hinein. Was er da findet entspricht genau der ozeanischen Auffassung, Männer und Frauen, die Holz fällen. Von einem Mann und einer Frau wird er aufgenommen. Wie er Sehnsucht nach der Erde bekommt, spinnt ihm die Frau ein Seil und läßt ihn in einem Korb zur Erde nieder. Es will schon viel sagen, wenn einmal ein Held sich in den Balg eines Vogels[S. 20] tut und in den Himmel fliegt. Meist ist der Himmel so nahe und so irdisch, daß sogar Menschen ihn zurückschieben, wie in Ozeanien und Australien an vielen Orten erzählt wird. Zugleich ist er so derb solide, daß, wenn er herabstürzt, er alles zerschlägt und die Menschen tötet. Von einem Herabstürzen des Himmels wissen aber afrikanische, ozeanische und australische Stämme manches zu erzählen.
Der Himmel wird entweder oben gehalten oder, wie schon mitgeteilt ist, als Zelt an die Erde mit Stricken, Ranken befestigt. Bei den Wanyamwesi soll, nach Stuhlmann, eine Riesin, Fumyahólo, den Himmel gleich Atlas stützen. Ihr Gatte, Niamtitinwa, gleichfalls ein Riese, hält die Erde auf einer Seite, die andere Seite der Erde ruht auf einem Berg Lugula oder Lugiya. Wenn dieser Riese zu seiner Frau geht, bebt die Erde. Andere Afrikaner lassen die Erde auf einem Horn einer Kuh ruhen. Beben entsteht, wenn die Kuh die Erde auf das andere Horn umlegt. Ozeanier stellen sich die Erde vor als auf ein Netz aufgeschüttet, das im Meere schwimmt, oder als Klumpen, den der Held Maui mit einem Netz aus dem Meere emporgezogen hat. Weit verbreitet ist die Annahme, daß Erde und Himmel von Säulen gestützt werden. Im übrigen wird nicht viel nachgedacht, wir wissen ja auch, wieviel Kopfzerbrechen es den klügsten Menschen im Altertum gekostet hat, eine Stütze für die Erde zu finden, und welch ungetümliche Zurüstungen die geistig so hochstehenden Indier getroffen haben, die Erde halten zu lassen (S. 176). Und ich darf auch auf mein Buch „Die Entstehung der Welt und der Erde in Sage und Wissenschaft“ verweisen. Hier zitiere ich noch nach Max Müller einen Vers aus dem Rigveda, bekanntlich dem ältesten Schriftdenkmal der Indier: „Ungestützt, nicht befestigt, wie bringt er es fertig, nicht zu fallen, wenn er sich erhebt?“ „Er“ ist die Sonne.
Was die Himmelskörper anbetrifft, so werden auch diese rein irdisch, oft menschlich oder tierisch aufgefaßt. Ich habe auch dafür in meinem obengenannten Buche Beispiele gegeben, die ich nur durch einiges ergänzen darf. Bei manchen Indianern werden Sonne und Mond so menschlich angesehen,[S. 21] daß sie Kinder haben. Ein Held gelangt auf dem bekannten Wege in den Himmel und in das Haus der Sonne und heiratet dort eine Tochter der Sonne. Mit seiner Frau in einem Korb herabgelassen, muß er sie in einer Hütte versteckt halten, weil sie zu stark leuchtet. Der Mond kann in Ozeanien von einem Adler verschlungen werden. Aber das Verschlungenwerden von Sonne und Mond bei Finsternissen ist ja fast in allen Erdteilen Erzählung und Glaube. Und bekannt ist der furchtbare Lärm, den viele Völker gegen den Himmel machen, um den Drachen, die Schlange, oder was es für ein Tier sein mag, von seinem Opfer zu verscheuchen. In Polynesien ist die Sonne selbst ein Ungetüm. Maui, der Herkules oder Simson der Polynesier, dem sie zu heiß ist und zu rasch läuft, lauert ihr am Aufgangsorte auf, wirft ihr eine Schlinge um den Hals, mit der er sie drosselt, während er ihr zugleich mit seiner Keule Wunde über Wunde schlägt. Da verliert das Ungetüm durch die Wunden den größten Teil der Hitze und von Siechtum matt schleicht sie nun langsam ihres Weges. Daß der Mond ein gewöhnliches Licht, eine Lampe, ist, findet sich oft erwähnt, noch öfter ist er eine alte Frau. Wunderschön klingt es, liegt aber doch auf gleichem Gebiet, wenn amerikanische Indianer die Dämmerröte für den Widerschein der Fittige eines roten Schwanes erklären:
singt Longfellow im „Hiawatha“ nach einer Sage der Odjibwä-Indianer (in Freiligraths Übersetzung).
Mit derartigen Anschauungen verbindet sich ein naiver Wunderglaube, der das Wunder des Wunderbaren entkleidet. Wie selbstverständlich öffnen sich Felsen auf ein Gebot sogar eines Tieres, wachsen Bäume bis in den Himmel hinein,[S. 22] bleibt die Sonne auf Wunsch stehen, beleben sich Klötze und Häuser. Man wird sagen, das sind Märchen — und solche kann man von den Negern in schöner Auswahl in dem hübschen Buche des Fräulein von Held und in sehr vielen Reisebeschreibungen und anthropologischen Werken lesen —, aber das Märchen hat für den Naturmenschen, wenn es nicht direkt behufs Erzählens erfunden ist, die Bedeutung, die es für das Kind besitzt, oder richtiger besaß, ehe noch der hypermoderne Realismus das Kind in den Märchen Unsinn zu sehen lehrte. Dazu kommt noch ein Umstand, auf den in einem folgenden Abschnitt einzugehen ist, und der derartigen „Märchen“ ein ganz anderes Aussehen verleiht und sie mit Mythe und Religion in Verbindung bringt. Aber diese Selbstverständlichkeit des Wunders bei den Wilden ist eines der größten Hindernisse für die Verbreitung des Christentums unter den Naturvölkern ohne Gewalt, denn für die höheren Lehren hat der Wilde nur selten Verständnis. Der Kampf ums Dasein und der naive absolute Egoismus beschäftigt sein ganzes Leben, Tun und Trachten. In den Erzählungen, die die Reisenden uns mitteilen, kommen zwar auch Züge von Großmut vor, jedoch nur selten, und solche von Menschenliebe, wie die Kulturreligionen sie verstehen, existieren kaum, selbst bei Naturvölkern, die schon in Berührung mit der Zivilisation sich befinden. Diese Tugend scheint der Mensch zu allerletzt zu lernen. Sie ist freilich die schwerste von allen, nicht allein, weil sie absolute Überwindung des Egoismus erfordert, sondern auch weil der Gegenstand der Liebe sich nur sehr selten in liebenswürdiger Gestalt gibt, wo nicht zugleich das Mitleid mitspricht. Und die Naturvölker haben keine rechte Gelegenheit, von uns auch nur aus Mitleid, geschweige aus Fühlen Liebe zu lernen. Gestalten wie Livingstone sind einzig. Indessen ist die Gewalttätigkeit, vielfach Roheit und Brutalität, mit der die Naturvölker so oft behandelt wurden, allerdings nicht der eigentliche Grund für ihren Mangel an unseren Haupttugenden. Die rein egoistische Grundlage ihres Wesens ist noch jedem, der mit ihnen in Berührung kam, aufgefallen, nicht bloß Fremden[S. 23] gegenüber, sondern auch gegen ihre nächsten Angehörigen. Es fehlt ihnen die Schule, die bei den Kulturvölkern nun schon Tausende von Jahren dauert, und namentlich drückt auf sie unwiderstehlich ihre Umgebung. Ein Wilder, der in eine Umgebung versetzt wird, die nach jenen hohen Lehren lebt, kann diese sehr wohl annehmen und auch in sich aufnehmen, wie die Erfahrung ja hinreichend erwiesen hat. So aber verbietet zum Beispiel ein Negerhäuptling, weil es ihm so gefällt (car tel est notre plaisir), seinem ganzen Volke den Anbau des notwendigsten Getreides auf mehrere Jahre, herrscht bei ganzen Stämmen die Sitte, die Alten und Kranken auszusetzen oder zu töten, bildet bei noch anderen die Zahl der gemordeten Menschen, in Schädeln, die auf einer Schnur gereiht getragen werden, den höchsten Ruhm des Helden, und was der Greuel noch mehr sind, an die man nicht denken mag und die man schon als Knabe in Coopers Romanen mit einem gewissen Grausen gelesen hat, während sie in der Wirklichkeit, wegen des Mangels eines jeden edleren Beweggrundes, noch viel entsetzlicher wirken würden. Wenn nicht auch hier ein Motiv vorhanden wäre, das in der ganzen Welt bekannt ist, in der ganzen Welt zu den abscheulichsten Taten geführt hat, noch jetzt bei den Kulturnationen in schönstem Flor steht, hier vielfach mit dem Fluch der Lächerlichkeit begabt, aber beim Naturmenschen dessen ganzes Leben und Tun erfüllend und lenkend — der Aberglaube. Hier verflicht sich unsere Betrachtung mit der für die nächste Klasse der Anschauungen. Diese müssen wir durch eine Sonderbetrachtung einleiten.
7. Über den Ursprung der Religionen, Vorläufiges.
Die Bedeutung des Wortes Religion wollen wir hier im allerweitesten Sinne fassen; also dazu auch Meinung, Erzählung, Sage, Mythe rechnen, sofern sie sich auf nicht jedem zur Verfügung stehende Kräfte und Äußerungen beziehen. So weit müssen wir gehen, wenn wir von der Religion der Naturvölker sprechen.
Religion entstammt dem Ursächlichkeitsbegriff des Menschen, das heißt der Eigenheit der Seele, alles notwendig als die Folge eines anderen anzuschauen. Es kann einen Ursächlichkeitsbegriff ohne Religionen geben, aber keine Religion ohne diesen Ursächlichkeitsbegriff. Das gilt auch für geoffenbarte Religionen, da um eine Offenbarung aufzufassen schon der Ursächlichkeitsbegriff vorhanden sein muß, indem ohne diesen nichts mit einem anderen verknüpft werden kann. Wahrscheinlich gibt es kein Lebewesen ohne den Ursächlichkeitsbegriff, wie dunkel er in manchen Lebewesen auch sein mag. Aber außer diesem Ursächlichkeitsbegriff dürfte auch der Lebenstrieb ein Großes zur Entstehung von Religionen beigetragen haben. Und da dieser Trieb sich vornehmlich äußert in Begehren und Fürchten, so werden schon am Ursprung der Religionen diese Empfindungen für ihre Richtung entscheidend sein. Wie, wann und wo die Religionen ihren Ursprung nahmen, darüber bestehen bei den Forschern noch gegenwärtig unendlich viele Meinungen. Einige sehen die Religionen als Folgeerscheinung der Sprache an. Da auch Tiere in ihrer Weise sprechen können, und wir diesen doch nicht gerne religiöse Anschauungen zuschreiben möchten, muß es sich schon um eine Sprache handeln, die den Menschen vom Tiere unterscheidet. Leider wissen wir nicht recht, wo der Unterschied beginnt. Will man aber von uns selbst rückwärts schließen, so wird man meinen, daß Namen- und Begriffsbildung die entscheidenden Momente in der Sprache waren. Max Müller, der diesen Standpunkt mit größter Konsequenz vertritt, bezeichnet es als Tatsache, daß dazu die Wortwurzeln dienten, allein dienen konnten, und — was das Wesentlichste ist — daß diese Wurzeln, „infolge der Art und Weise, in der sie zuerst ins Dasein traten, Handlungen ausdrückten, die gewöhnlichen Handlungen, die auf einer früheren Gesellschaftsstufe vollführt wurden. Der Himmel war der, der bedeckt, die Sonne die, die wärmt, der Mond der, der mißt, die Wolke die, die regnet“ usf. Sah nun der Mensch z. B. das Feuer, das für ihn eine so eminente Bedeutung hat, so fiel ihm namentlich[S. 25] die Ruhelosigkeit dieses Elementes auf, das Flammen, Zucken, Züngeln, Springen usf. Er bezeichnete es also mit der Wortwurzel in „bewegen“, in den indogermanischen Sprachen mit AG. Da aber diese Wurzel ein Handeln des Menschen ausdrückt, eben das „Bewegen“, so kam er allmählich zu der Anschauung, daß in der Flamme etwas Bewegendes, ein Agens sei, zu ihrer Natur gehöre, „Beweger hier“, „Beweger da“, im sanskritischen AG-ni-s, damit wäre zum Beispiel in Sanskrit der Agni gewonnen, der „Beweger“. Im Laufe der Jahrhunderte trat dann eine immer weitergehende Vergeistigung ein, erst ein beseelter Beweger, wie ein Mensch, dann ein göttlicher Beweger usf., bis zuletzt bei einigen Sekten Agni zum höchsten Gott und Schöpfer hinaufidealisiert ward. Diese Theorie des großen Sprach- und Religionsforschers hat zweifellos etwas sehr Bestechendes. Man bedarf nicht einmal der wirklichen Sprache; es genügt ja völlig, wenn der Mensch in sich selbst die Handlungen auffaßt, wenn er es auch nach außen nicht zum Ausdruck bringt. Er wird dann innerlich das Feuer so betrachten, wie er es mittelst der Sprachwurzeln nach außen kundgibt. Aber bedeuten auch die ersten Sprachwurzeln nur Handlungen des Menschen, ist das auch der Fall mit den ersten bestimmten inneren Denkregungen? Werden auch diese sich nur auf Handlungen beziehen? Fast möchte man es glauben, da das Leben des Menschen in Handlung aufgeht und die Natur ja auch in stetem Geschehen sich befindet. Dinge also, die ruhen, würden keinen Anlaß zur Entstehung religiöser Begriffe geben. Diesen Schluß zieht auch Max Müller, da er von dem bekannten Fetischismus, Animismus und der Personifikation als Grundelemente der Religion nichts wissen will. Es ist schwer auf einem Gebiete wie dieses, wo jede Tradition und jede Erfahrung mangelt, etwas Bestimmtes zu sagen; unter den Völkern, die wir kennen, befindet sich und befand sich keines mehr im Ursprung der Religionsbildung, alle hatten und haben ein schon ziemlich kompliziertes System religiöser Ansichten. Am Kinde aber zu beobachten, wie bei ihm religiöse Anschauung entsteht und wächst, würde nur ersprießlich sein können,[S. 26] wenn man es als Wilden, gesondert von allem kulturmenschlichen Verkehr, aufwachsen ließe. Elterliche Brutalität bringt es manchmal zuwege, daß ein Kind in dieser Weise aufwachsen könnte, wenn die Kultur es nicht an sich von allen Seiten umgäbe. Und seit dem alten Ägypterkönig, von dem Herodot erzählt, daß er, um zu erfahren, welches die eigentlich menschliche Sprache sei, ein Kind vom ersten Tage gegen jeden menschlichen Verkehr abgeschlossen habe, ist das Experiment nicht wieder gemacht worden. Also, es fehlt an Mitteln zur Entscheidung. Nur das, glaube ich, muß man sagen, daß es nicht die äußere Sprache war, die die Religionen schuf, sondern die innere, und diese wird der äußeren weit vorausgegangen sein. Wenn Max Müller nur die äußere Sprache versteht, dann ist meines Erachtens seine Theorie nicht haltbar. Begehren und Furcht, ich wiederhole es, sind die Grundpfeiler für religiöse Anschauungen. Und wahrscheinlich Furcht zuerst, dem Begehren sich später erst anschließt. Die meisten Forscher greifen, wenn es sich um religiöse Regungen oder gar Anschauungen handelt, viel zu hoch. Man muß, wenigstens wenn man Religion in so weitem Sinne faßt, wie es der Anthropolog zu tun gezwungen ist, unter Abstraktion von aller ursprünglichen Offenbarung, tief herabsteigen. Sind die Menschen aus der Reihe der Lebewesen durch fortschreitende Entwicklung hervorgegangen und haben sie ihre seelischen Fähigkeiten allmählich erreicht, so wird man in dem Auftreten religiöser Regungen gar nicht weit genug zurückgehen können. Und bekanntlich behaupten manche Naturforscher, daß Tiere wohl auch etwas haben möchten, was einer Religionsanschauung — im weitesten Sinne des Wortes — entspricht. Sicher ist ja, daß manche Tiere sich vor ungewohnten Dingen und Bewegungen fürchten, daß sie unter Umständen Gespenster sehen usf. Haben doch sogar manche gemeint, daß der Hund im Menschen eine Art göttliches Wesen (göttlich vom Standpunkte des allertiefststehenden Wilden) sehe, was freilich mit der Tatsache, daß der Hund jeden anderen als seinen Herrn auch ohne Grund anbellt und anfällt, nicht recht harmonieren will.
Nun unterscheidet Max Müller allerdings drei Stufen der Religionsanschauung: physische, anthropische (Max Müller scheut sich vor dieser Wortbildung und sagt anthropologische, ich sehe aber nicht ein, warum, um einer ungewohnten und freilich auch anfechtbaren Wortbildung zu entgehen, man zu einer anderen, bereits in anderem Sinne vergebenen greifen soll) und psychologische. Diese Stufen sind sicher für die allgemeine Entwicklung treffend gewählt, sie umfassen aber nicht alles. Man darf ferner Lippert in seinem Hauptsatze im allgemeinen beistimmen, daß Religion ohne einen gewissen, wenn auch noch so niedrigen, rohen und selbst gemeinen Kultus, nicht verstanden werden kann. Allein dieser Satz hilft nur die etwaige Religion des Tieres von der des fortgeschrittenen Menschen unterscheiden, wenn nicht vielleicht gewisse Tierklassen, wie die bekannten Ameisengattungen, auch Kultus besitzen. Die Entwicklungslehre kann aber nicht anders als annehmen, daß zuerst die religiösen Anschauungen des Menschen sich gar nicht von denen der Tiere unterschieden haben, aus welchen er hervorgegangen ist, und daß diese Anschauungen allmählich zu Höherem aufstiegen, indem sich gleichzeitig alle Greuel entwickelten, die den Namen Religion entweihten und entweihen. Wir wissen nicht, ob die geistigen Kräfte des Menschen zunahmen, weil seine animalischen Ausrüstungen mehr und mehr verloren gingen, oder ob das umgekehrte stattfand, daß seine animalische Ausrüstung zurückging, weil die geistigen Fähigkeiten stiegen. Der bequemste Ausweg wird sein, wenn wir annehmen, daß beides gleichzeitig stattfand, indem immer eins das andere nach sich zog. Dann mußte einerseits die Einsicht wachsen, andererseits der Trieb der Selbsterhaltung; und es scheint, daß zunächst die ganze zunehmende Einsicht in den Dienst der Selbsterhaltung gestellt worden ist. Deshalb hat sich der Mensch zunächst soviel furchtbarer als das furchtbarste Tier entwickelt, und seine Religionsanschauung ging keineswegs die stillen Wege, die viele so gerne annehmen, indem sie alle Greuel auf „Aberglauben“ schieben. Wir mögen über den Aberglauben des[S. 28] Kulturmenschen lachen, der auf die Türschwelle oder den Türpfosten seiner Behausung ein Hufeisen nagelt, wir mögen lachen, wenn gleichfalls Kulturmenschen sich vor dem 13ten und dem Freitag fürchten, und was der so zahlreichen Albernheiten noch mehr sind. Glauben die betreffenden Leute an sie, so haben sie zu der bekannten Religion noch eine andere. Verhalten sie sich neutral, so treiben sie all den Unfug aus Affennachahmung, „nützt es nicht, so schadet es nicht“. Glauben sie nicht daran, so machen sie sich eines Vergehens gegen den geistig schwächeren Teil der Menschheit schuldig. Aber dem Naturmenschen ist „Aberglaube“ seine eigentliche Religion, und was man bei ihm noch Mystisches und Höheres etwa findet, hat für ihn gar keine oder nur Erzählungsbedeutung.
Andere haben den Urgrund aller religiösen Anschauungen in dem Gefühl der Schwäche gesucht, das der Mensch der ihn umgebenden Natur gegenüber hat. Er soll eine Macht über sich empfinden und diese allmählich höher und höher einschätzen lernen. Der Trieb der Selbsterhaltung würde ihn dann zur Verehrung und Anbetung dieser Macht durch Worte und Taten führen. Irregeleitet, würde der Mensch zunächst nicht eine Macht annehmen, sondern viele Mächte, und sie in dem lokalisieren, was für ihn besondere Bedeutung hat, also in Sonne, Mond, Feuer, Sturm, Gewitter, Strom, Meer u. a. Man kann sehr vieles für diese weitverbreitete Ansicht vom Ursprung der Religion beibringen. Das Gefühl einer Übermacht über sich ist schon im Tierreich vorhanden; ein kleines schwaches Mädchen kann den stärksten Hund zum hündischen Gehorsam zwingen, wie wir ja zu unserm Vergnügen oft genug sehen; der Hund hat ein Gefühl von der Übermacht des Menschleins. Dahin gehören auch solche Tatsachen aus dem Tierleben, die mit ihrem eigenen Gesellschaftsleben zusammenhängen, wenn einem Individuum selbstverständlich die Übermacht zuerkannt wird, wie bei den Bienen. Auch das Verhalten der Blattläuse gewissen Ameisenarten gegenüber dürfte auf dem Gefühl einer Übermacht beruhen; denn ohne Widerstand zu leisten und ohne einen[S. 29] Fluchtversuch selbst dann zu machen, wenn sie beflügelt sind, lassen sich diese Insekten von den Ameisen in deren Heim schleppen und tragen, wo sie, wie bei den Menschen das Vieh, gehegt und aufgezehrt werden. Fast denkt man an das Verhältnis des Volkes zu wilden Häuptlingen oder sinnlosen Despoten. Ist das Gefühl der Übermacht beim Menschen nur auf dem der Furcht gegründet, so würde es sich wenig von dem der intelligenteren Tiere unterscheiden. Aber beim Menschen soll noch hinzukommen, daß er auch Hoffnung auf Gutes und Erwartung von Gutem für sich auf diese Übermacht gründet. Und das wäre freilich etwas, das im Tierreiche wohl nur selten gefunden wird. Die Beispiele von Hunden, die allerhand Künste vollführen in Erwartung einer Belohnung, von Vögelchen, die auf den Ruf eines, der ihnen Samen oder Bröckchen bietet, ihm beliebig auf Hand und Schulter fliegen, dürfen, glaube ich, hier nicht angeführt werden. Es sind Erfahrungen, denen die Tiere, namentlich im Zustand der Domestikation, folgen.
Auf dem Wege zur spiritualistischen Ansicht von der Entstehung der Religionen treffen wir die Behauptung, daß religiöse Anschauung überhaupt zur Eigenheit des Menschen gehöre, gewissermaßen apriorisch eine Kategorie, ein Regulativ seines inneren und äußeren Lebens bilde. Einen energischen Vertreter dieser Ansicht finden wir in Benjamin Constant, der sie schon im ersten Kapitel seines großen Werkes „De la réligion“ feststellt. Sofern die religiöse Anschauung in der Kategorie der Ursächlichkeit beruht, und diese allerdings eine unumgängliche Vorbedingung unseres inneren und äußeren Lebens bedeutet, könnte man letzteres auch von der religiösen Anschauung annehmen. Daß indessen der Begriff der Ursächlichkeit für sich nicht hinreicht, den Trieb zur religiösen Anschauung zu erklären, darf wohl als sicher hingestellt werden. Es ist zwar richtig, daß die religiöse Anschauung ein Regulativ unseres Lebens ist. Aber es spielt bei ihr noch etwas mit, das durchaus dem Bereiche des Fühlens angehört und für das wir im Begriff der Ursächlichkeit keinen adäquaten Ausdruck finden. Auch die Tiere und[S. 30] selbst die Pflanzen müssen den Begriff der Ursächlichkeit bewußt oder unbewußt (instinktiv, wie wir sagen) besitzen, sonst existierten sie nicht. Aber religiöse Anschauung schreiben wir ihnen doch nicht zu. Ferner gibt es zweifellos Menschen, die jedes religiösen Gefühls gänzlich bar sind, nicht einmal einem Aberglauben huldigen. Soll also religiöse Anschauung in der Tat eine Eigenschaft der Menschenseele sein, so muß sie außer in der Ursächlichkeit noch in anderem eine Wurzel haben, oder nur in diesem anderen. Dieses ist wohl auch die Meinung von Wilhelm Wundt, daß nämlich die Ursächlichkeit für eine rein psychische Entstehung einer religiösen Anschauung nicht hinreicht. Nun haben wir schon früher Furcht und Begehren als die Haupttriebfedern für religiöse Annahmen hervorgehoben. Von diesen Menscheneigenschaften soll aber, als unwürdig, gerade abgesehen werden. Dann würde freilich nichts übrig bleiben als die religiöse Anschauung als eigene Kategorie zu betrachten, wogegen doch sehr vieles spricht, was bei der Vorführung der einzelnen Religionsanschauungen hervortreten wird, wo wir den allerniedrigsten Meinungen begegnen, die jeder Kultur und jeder Menschlichkeit ins Gesicht schlagen. Soll sich aber jene Ansicht auf unsere Idee von Religion beziehen, so ist eben der Begriff Religion viel zu eng gefaßt, und wir brauchen darüber hier noch nicht zu diskutieren.
Endlich die rein spiritualistische Ansicht selbst sieht die Religion als von höchster Macht geoffenbart an. Das kann, absolut genommen, eigentlich nur von der einzigen wahren Religion gemeint sein, denn es ist ja ausgeschlossen, daß eine Offenbarung in mehrerer Gestalt erfolgen kann. Kein Mensch weiß, welches diese einzige wahre Religion ist, jeder gibt die seinige dafür aus. Und irgendein Kriterium zur Entscheidung haben wir nicht. Vergangene und gegenwärtige Geschichte der Religionen schneiden uns dazu jede Möglichkeit ab. Die beliebte Ausrede, daß die Menschen die Offenbarung verdorben hätten, hilft hier nichts, sondern schadet nur. Denn was eine absolute Offenbarung ist, muß mit zwingender Gewalt die Menschen leiten und kann sie nicht[S. 31] zu so furchtbaren Taten führen, wie die religiösen Verfolgungen sie gezeitigt haben. Anders hat eine absolute Offenbarung gar keinen Sinn, denn dem Besten im Menschen widersprechend wird man sie doch nicht gestalten wollen.
Gibt man den Standpunkt des Absoluten auf, so läßt sich über Offenbarung eher reden. Dann wären die Religionen Inspirationen einzelner Menschen oder einzelner Völkerschichten und dürfen darum unvollkommen sein. Die Offenbarung verliert dadurch freilich die Bedeutung, wegen deren sie eigentlich angenommen ist: die absolute Richtigkeit jener betreffenden Religionsanschauung unwidersprechbar zu machen. Sie geht auf den Standpunkt eines jeden menschlichen Einfalls oder Erdenkens oder Fühlens zurück. Dafür haben wir ja allerdings Beispiele, und darunter solche gewaltigster Wirkung und edelster Lehren. Viele aber auch, die absurd und höchst schädlich sich erwiesen haben.
Was ist nun das Ergebnis dieser Betrachtungen? Ich glaube, daß man bei der Untersuchung der Entstehung der Religionsanschauungen, wie in so vielen anderen Fällen, überhaupt nicht rigoros auf diesem oder jenem Standpunkt bestehen kann. Wie die Elektrizität in einem Gewitter aus allen möglichen Vorgängen entstanden sein kann und tatsächlich entsteht, so werden auch die Religionsanschauungen aus den verschiedensten Ursachen hervorgegangen sein. Der Mensch hat ein reichliches Kapital an Eigenschaften und Trieben in seinem Inneren, um sie bald so, bald anders zu kombinieren und in neue Werte umzusetzen. Mitunter ist eines, mitunter ein anderes für seine Ansicht entscheidend. Religionen werden aus allen den vorgenannten, vielleicht aus noch manchen anderen Quellen hervorgegangen sein. Die Entwicklung, die die Religionen genommen haben, weist schon darauf hin, daß sie nicht wohl auf einen Ursprung zurückgeführt werden können, sondern daß bei ihnen verschiedene und mitunter mehrere Momente wirksam gewesen sind. Auch haben sich viele Religionsforscher gezwungen gesehen, einerseits niederen Anschauungen auch höhere Momente zuzugestehen, andererseits in höheren auch niedrige[S. 32] anzuerkennen. Eine wirkliche „Philosophie der Religion“ müßte alle Momente in Betracht ziehen und ihren Einfluß in den einzelnen Religionen verfolgen. Aber dazu mangeln uns nur allzusehr die Kenntnisse, sobald wir aus der geschichtlichen Kulturwelt heraustreten. Es ist nicht Aufgabe dieses Buches, hierauf genauer einzugehen, auf einzelnes und auf andere Theorien wird jedoch noch oft genug hingewiesen werden.
8. Allgemeine Belebung.
Gehen wir nun zu den einzelnen Religionsformen über, so scheint in der Tat die von Max Müller angenommene physische Religion die ursprünglichste zu sein, jedoch in ganz niedriger Bedeutung. Über die Stufe der stumpfen Selbstverständlichkeit erhoben, wird der Mensch in allem, was ihn umgab, etwas gesehen haben, das wir allerdings am besten unbestimmt als Agens, Tätiges, Handelndes, Wirkendes bezeichnen können. Namentlich in den Vorgängen wie Flamme, Sturm, Gewitter, Regen usf. wird dieses zunächst geschehen sein, dann auch in den Gegenständen. An den Tieren war eine derartige Betrachtung selbstverständlich, ihre Ausdehnung auf Bäume, Blumen, Gräser konnte folgen. Dann mögen fließende oder wogende Gewässer und zuletzt Berge, Felsen, Steine an die Reihe gekommen sein. Es ist mißlich, solche Serien ex post aufzustellen, da bei besonderen Völkern vieles von ihrer besonderen Umgebung abhängig gewesen sein wird. Dazu ist zu beachten, daß auf Menschen, wie übrigens auch auf Tiere, Gegenstände besonderer Art und unter besonderen Umständen auch eine besondere Wirkung ausüben, wie überhängende Felsen oder Steine in ebener Gegend, Bäume gewundener oder übermäßiger Gestalt, Dämpfe aus der Erde aufsteigend usf. Kein Hund hält einer Selterwasserflasche stand, die man vor ihm aufknallen läßt, und überhängende oder fast schwebende Steinplatten sind selbst einem beherzten Manne ungemütlich. Also mögen gewisse tote Gegenstände viel eher mit dem Etwas versehen gedacht worden sein, als harmlose[S. 33] Sträucher. Es ist vieles erzählt worden, woraus man schließen möchte, daß die Feuerländer sich auf dieser Stufe der Weltanschauung befinden, in der in allem ein Etwas Tätiges gesehen wird, ohne daß dieses Etwas schon mit dem, was im Menschen das Tätige ist, identifiziert wird.
Wenn der Mensch unter solchen Anschauungen seine Meinung bestimmter zu fassen lernt, so wird er in dem in den Gegenständen Handelnden etwas Lebendes sehen, sei es, daß die Gegenstände selbst leben, sei es, daß etwas in ihnen vorhanden ist, das lebt. Beides finden wir, aber das erstere kann offenbar nicht von weitem Umfange sein, da Lebloses von Lebendem zu unterscheiden selbst dem Tiere leicht fällt. Max Müller hat ein sehr lehrreiches Beispiel auf das sorgfältigste untersucht, die Bedeutung Agnis in der altindischen Religion. Wie wir sahen, scheint ihm „Agni den Begriff der lebhaften Bewegung ausgedrückt zu haben. Am nächsten verwandt würde lateinisch ag-ilis sein“. Im Lateinischen haben wir ignis, im Altslawischen ogni, im Littauischen ugnì. Das würde noch auf der ersten Stufe stehen. Aber nun kommen Namen, die offenbar einen tätigen Gegenstand ausdrücken: Dahana = der Brenner, An-ala = der Blaser (mit der Wurzel An, die auch in animus, anima, ἄνεμος enthalten ist und hauchen, wehen bedeutet). Max Müller führt noch andere Namen auf, die gleichfalls einen tätigen Gegenstand betreffen. Und er sagt allgemein: „Wenn dieser Schritt einmal getan war, wenn das Wort Agni, Feuer, einmal geprägt war, so war die Versuchung groß, ja fast unwiderstehlich, wie Agni als Agens aufgefaßt worden war, so auch ihn als etwas aufzufassen, das den einzigen anderen aktiven Subjekten, die den Menschen bekannt waren, glich, als tierischen und menschlichen Agens.“ Und darin kann man ihm lediglich beistimmen. So führt er denn auch an, daß im Rigveda von der Zunge oder den Zungen Agnis gesprochen wird, von seinen Zähnen, seinen Kinnbacken, seiner brennenden Stirne, seinem flammenden Haar, seinem goldenen Bart. Diese Sprechweisen als metaphorisch aufzufassen, würde möglich sein, wenn der erste Begriff des Agni ein höherer wäre.[S. 34] So aber möchten sie kaum anders als ad verbum genommen werden, als Beschreibung Agnis als eines lebenden Etwas (s. jedoch S. 25). Ich habe schon erwähnt, daß die Polynesier die Sonne auch als Ungetüm betrachten, die Eskimo nehmen Sonne und Mond als Mädchen und Knaben, wie südamerikanische Völker und wie, umgekehrt, die Australier als Mann und Frau. Algonkinindianer, die den Mond für die Frau der Sonne ansehen, erklären sogar die Finsternis dadurch, daß diese Gestirne zuweilen ihr Kind (das also dunkel sein muß) in den Armen vor sich halten. Daß man die Arme nicht sieht, kommt daher, daß sie ständig einen Bogen gespannt vor sich halten. Hübsch ist eine Sage bei den Mexikanern, die Tylor in seinem vorzüglichen Buche „Die Anfänge der Kultur“ mitteilt. Die alte Sonne war ausgebrannt und die Welt in Finsternis begraben. Da sprang ein Held in ein riesiges Feuer und stieg, zum Gott geworden, als Tonatiuh strahlend im Osten als neue Sonne auf. Nach ihm sprang ein zweiter Held in das Feuer. Aber dieses war schon matt, und so kam er nur als Mond, Metztli, empor. Hier sind also Sonne und Mond zwei Männer. Doch steht diese Sage für das Gegenwärtige schon zu hoch. Mehr paßt hierher, daß bei den Alëuten der Mond mit Steinen nach denen wirft, die ihn beleidigen. Man bedenke, daß man in der Tat früher vielfach geglaubt hat, daß die Meteorsteine Auswürflinge des Mondes seien. Auch die Sterne werden für Lebewesen, Menschen oder Tiere, gehalten, wohl auch für Teile von Lebewesen. Ich will nicht die griechischen Katasterismen anführen, die in so schönen Sagen erzählt werden und noch in der so späten Zeit der Ptolemäer zu der Versetzung des prachtvollen Haares der Berenike an den Himmel geführt haben. Aber in Afrika ist die Milchstraße ein Zug Vögel. Anderweitig sind die Sterne Menschen, welche in den Himmel geklettert sind und nun nicht herabkönnen. In Ozeanien werden die Sterne auch als Augen berühmter Häuptlinge ausgegeben, so daß diese letzteren großen Wert im Leben auf möglichst glänzende Augen legen und die ihnen von Natur verliehenen dadurch zu verbessern suchen, daß sie anderen die Augen ausreißen[S. 35] und sie verzehren. Daß der Regenbogen ein lebendes Ungetüm ist, das sogar Menschen frißt oder sie vergiftet, wird in Polynesien erzählt. Der Gott Perkun soll in Littauen auch den Donner selbst bedeutet haben. Stürme werden personifiziert; so sind bei den Indianern, von denen Hiawatha erzählt, Wabun, Schawondasee, Kabibonda Lebewesen, die Ostwind, Südwind und Nordwind bedeuten, deren Vater, der allgemein Sturm, Mudjeekewis, heißt. Bei den Polynesiern finden wir ähnlich personifizierte Winde, die Verwandte sind von Göttern. Der Hauptwindgott Tawhiri-matea, der den Schimpf, der seinem Vater und seiner Mutter, Himmel und Erde, durch ihre gewaltsame Scheidung geschehen ist (S. 12), rächen will, läßt seine Kinder, die Stürme, auf Meer und Land los, und er selbst wütet in ihrer Mitte, so daß die Wälder, die Kinder Tane Mahutas, gestürzt, die Länder überschwemmt und die Meere durchwühlt werden. „Den niederen Menschenstämmen,“ sagt Tylor in seinem genannten Werke, „werden Sonne und Gestirne, Bäume und Flüsse, Wind und Wolken persönliche, belebte Geschöpfe, welche ein nach Analogie des menschlichen oder tierischen gedachtes Leben führen und ihre besonderen Aufgaben im Universum mit Hilfe ihrer Gliedmaßen wie Tiere erfüllen.“ Und er weist mit Recht auf das Verhalten der Kinder hin, die zuerst gleichfalls alles beleben. Wie das Kind „schlägt der Wilde Brasiliens den Stein, über den er gestolpert ist, oder den Pfeil, der ihn verwundet hat.“ Tylor teilt noch andere Beispiele mit. So wird bei gewissen südasiatischen Stämmen der Baum gefällt und zu Spänen zerhackt, von dem jemand tödlich herabgefallen ist. Entsprechende Beispiele finden sich sogar bei Kulturvölkern, ich darf an die Gerichte erinnern, die bei den Athenern über leblose Gegenstände gehalten wurden, durch die ein Mensch umgekommen war, an die Geißelung des Hellesponts durch Xerxes und an anderes aus dem Altertum und selbst aus dem Mittelalter Bekannte. Fast möchte man an die „Tücke des Objekts“ erinnern, die Friedrich Vischer in seinem Roman „Auch einer“ so launig beschreibt. Es war früher eine Sitte in Deutschland, wenn der Hausherr[S. 36] gestorben war, es allem im Hause mitzuteilen, selbst dem Ackergerät und den Vorräten. Wir dürfen uns darum nicht wundern, daß der Naturmensch tatsächlich Gegenstände für lebend hält, die ihm doch tot scheinen sollten, und sich so überall von Leben umgeben fühlt, dessen Natur er nicht kennt, und das ihn infolgedessen beängstigt und bedrückt. Diese Allbelebung, der wir auf niedrigster Kulturstufe begegnen, findet sich von allem Groben geklärt in höchsten philosophischen Spekulationen wieder, wie wir sehen werden. Für die Wildenstufe hat Tylor sie als „Animismus“ bezeichnet, diesem Worte jedoch noch eine weitere Bedeutung verliehen.
9. Seele und Beseelung, Animismus, Fetischismus.
Sobald der Mensch dazu gelangt ist, an sich selbst den Körper von der Seele zu unterscheiden, wird er naturgemäß das gleiche auch für alle anderen Lebewesen und für die von ihm lebend gedachten Wesen tun. Wann der Mensch „seine Seele entdeckt“ hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Den Unterschied zwischen einem lebenden Tiere und einem getöteten kennen anscheinend auch Tiere selbst. Der Mensch aber muß zu irgendeiner Zeit diesen Unterschied tiefer aufgefaßt haben und so zu einer Zweiteilung seines Ich gekommen sein. Gegenwärtig scheint kein Volk zu existieren, das den Begriff der Seele nicht kennt. Und man möchte auch glauben, daß, sobald der Mensch die Ursächlichkeit hinreichend bewußt anzuwenden gelernt hat, er durch den Anblick des Toten neben dem Lebenden zu der Ansicht gezwungen werden mußte, jenem fehle etwas, das dieser besitzt und was, eben weil körperlich der Tote zunächst sich vom Lebenden noch gar nicht unterscheidet, das Leben bedingen muß. Der Tote hat also etwas verloren, das Leben in ihm, wir sagen die Seele. Der Naturmensch faßt die Seele als körperlich auf, namentlich als Atem. Das tut er ja mit dem Menschen überhaupt, man denke an ψυχή, anima, bei den Griechen und Römern, die ein „Wehen“ bedeuten, an ruach,[S. 37] nephesch bei den Hebräern, die das gleiche aussagen. Das deutsche „Seele“ soll auch mit einer derartigen Auffassung zusammenhängen, mit seîvan = sich bewegen, seivs = das Meer, in Verbindung stehen. Mitunter wird die Seele auch als „Schatten“ bezeichnet und zwar nicht metaphorisch, sondern konkret, denn der Naturmensch sieht den Schatten für ein Körperliches an, etwa wie die Luft, und wir haben ja selbst Sagen, die von dem gleichen Gesichtspunkt ausgehen. Der Teufel, erzählt Jakob Grimm, unterhielt in einer Gruft zu Salamanca sieben Schüler mit der Bedingung, daß der siebente nach Beendigung des Studiums das Gelag zahlen sollte. Als er seine Schule entließ, wollte er den letzten Schüler zurückbehalten. Dieser aber wies auf seinen Schatten, der wäre der letzte. Da mußte der Teufel den Schatten nehmen, und der Schüler blieb ohne Schatten, wie — Peter Schlemihl. Sonst also ist die Seele etwas Luftartiges, und darum kann sie auch den ganzen Körper durchdringen und überall in ihm sein, während sie andererseits wie Luft nicht gesehen wird. Mitunter freilich wird die Seele unmittelbar als ein Lebewesen betrachtet, entweder als ein dem Menschen gleichendes Bild — weshalb die Griechen sie auch bildlich als εἴδωλον, kleines, den Verstorbenen, zuweilen sogar in der Tracht, nachahmendes Menschlein darstellten —, oder noch derber als Schmetterling, Wiesel, Vogel, am meisten als Schlange aufgefaßt. Auf anderen Stufen wird die Seele auch als Pflanze betrachtet; Jakob Grimm scheint in seiner deutschen Mythologie damit die Metamorphosen verfolgter Menschen, namentlich Mädchen, wie Daphne und Syrinx, in Verbindung zu bringen. „Ursprünglich,“ sagt er, „mag aber die Idee eines unmittelbaren schnellen Übertritts der Seele in die Gestalt der Blume (wofür er einige Beispiele aus deutschen, romanischen und slawischen Sagen beiträgt) zugrunde liegen, wie aus bloßen Blutstropfen, die nur einen kleinen Teil des Lebens enthalten, eine Blume entspringt, im Blut hat die Seele Sitz, mit seinem Verströmen flieht sie hin.“ Die Tschechen nennen die auf Sandgrabhügeln wachsende Quendelblume „Mutterseelchen“. Aber da die Seele dem[S. 38] Körper Leben verliehen hat, schreibt der Mensch ihr höhere Eigenschaften zu als der Mensch als solcher besitzt.
Übertrug nun der Mensch die Entdeckung an sich auch auf die anderen Lebewesen und auf die ihm belebt scheinenden Gegenstände, so gewann er rings um sich Seelen, die er im allgemeinen seiner Seele ähnlich achten mußte. Und so wurden die Tiere wie er beseelt und füllten sich Sonne, Mond, Gestirne, Bäume, Berge, Felsen, Meer, Flüsse und Naturerscheinungen mit Seelen. Max Müller sagt zwar: „Ich kann nicht umhin, es vernunftwidrig zu nennen, wenn man uns weismachen will, daß zu irgendeiner Zeit in der Geschichte der Welt ein Mensch so einfältig gewesen sei, daß er nicht imstande war, zwischen leblosen und belebten Wesen zu unterscheiden, eine Unterscheidung, bei der selbst die höheren Tiere kaum jemals fehlgehen; oder gar, daß sich der Mensch darin gefiel, der Sonne und dem Mond, Bäumen und Flüssen Leben oder eine Seele zuzuschreiben, obwohl er sich dessen vollkommen bewußt war, daß sie weder Leben noch Seele besäßen.“ Aber gerade dieses letztere kann angesichts der außerordentlichen Zahl von Tatsachen nicht zugegeben werden. Der Mensch war sich eben nicht bewußt, daß die Gegenstände weder Leben noch Seele besäßen, er hat eben gerade das Gegenteil angenommen. Und man kann sagen, daß die Entdeckung der Seele als eines Sonderdinges ihm geholfen hat, die Schwierigkeiten, die sich aus der offensichtlichen Leblosigkeit vieler Gegenstände ergeben, zu verringern. Denn er sah an sich, daß er zu Zeiten — im Schlaf — gleichfalls wie leblos erscheint. Da konnten die Seelen der Gegenstände ähnlich sich in Schlummer oder Halbschlummer befinden. Er sah, daß Menschen leblos sind, sobald die Seele aus ihnen schwindet; das konnte auf die Gegenstände gleichfalls Anwendung finden, wo etwa der Augenschein gegen ein Leben allzusehr sprach.
Mit der Einführung der Seele als Sonderding und Lebensprinzip, was selbstverständlich nur sehr allmählich geschah, nahmen nun die Religionen eine neue Wendung. Sie geht nach verschiedenen Richtungen. Wir unterscheiden zunächst[S. 39] Fetischglaube, Seelenglaube, einschließlich Schamanismus, Ahnenglaube, einschließlich Totemismus, Geister- und Dämonenglaube, Götterglaube. Man darf nicht annehmen, daß es sich hier um nacheinander entstandene oder — wenigstens gegenwärtig — auch nur getrennte Religionsgebiete handelt. Alles geht durcheinander, und wir haben ein solches Gewirr von Angaben und Meinungen, daß es kaum möglich ist, zu sagen, was bei diesem oder jenem Volke das Wesentliche ist. Daher auch die sich oft widersprechenden Definitionen und Ergebnisse der einzelnen Forscher und die Verschiedenheiten in der Bedeutung, die sie, je nach Ansicht, den besonderen Anschauungsformen beimessen. Nur allgemeine Grundzüge lassen sich feststellen.
Es entspricht, wie schon bemerkt, der Natur des Menschen, daß ungewohnte, neue oder seltene Gegenstände seine besondere Aufmerksamkeit erregen. Tritt die Beseelung hinzu, so kann Furcht oder Erwartung an diese Gegenstände sich knüpfen. Sie werden als zauberkräftig im Schlimmen oder Guten angesehen, und der Mensch sucht sie durch Gaben zu versöhnen oder sich günstig zu stimmen. Darauf etwa beruht der Fetischismus, wie die Portugiesen ihn in Afrika zuerst kennen gelernt und aus ihrer Sprache (feitiço, Zauber) benannt haben. Hiernach kann alles Fetisch sein oder werden: Töpfe, Steine, Holz, Haar, Geflecht usf. Charakteristisch ist eine Erzählung aus Afrika. Es wurde ein Anker gefunden, ein jedenfalls ungewohntes oder gar unbekanntes Ding. Einer brach ein Stück davon ab und starb kurze Zeit darauf. Sofort heißt es, der Anker wäre ein Fetisch, und der Mann hätte sterben müssen, weil er durch Verletzung diesen Fetisch gekränkt hätte. In Ozeanien sollen chinesische Töpfe als Fetische verehrt werden. Tausende sind der Beispiele, die für den Fetischglauben aus allen Teilen der Welt beigebracht und Tausende auch die Fetische, die in unsere Museen und Sammlungen versetzt sind. Orte, wo üble Fetische sich befinden, werden gemieden und nur zu Kulthandlungen aufgesucht. Gute Fetische nimmt man nach Hause oder tut sie in besondere Hütten. Erfüllen solche Fetische die Erwartungen[S. 40] nicht, oder zeigen sie sich unwirksam, so werden sie mitunter wohl gezüchtigt, und wenn das nichts nützt, fortgeworfen, als gänzlich leblos erkannt. Fetische können von selbst wirken und ihrem Besitzer Glück und Gesundheit bringen und erhalten — solche haben wir ja in Unzahl ebenfalls z. B. in den Amuletten. Oder sie reagieren nur auf Anrufung durch einen Sachverständigen. Daraus ergibt sich nun der ganze Unfug des Zauberwesens und der Zauberer, der überall auf der Erde sich findet und überall die gleichen Züge trägt. Betrügende Betrüger und betrogene Betrüger spielen da ihre verhängnisvolle Rolle. Bei der Beurteilung darf man nicht vergessen, daß der Wilde so wenig Mittel gegen Krankheit, Hungersnot, Tiere usf. besitzt und darum naturgemäß zu allem greift, davon er irgend glauben kann, daß es ihm nützen möchte. Wir finden das gleiche auch bei uns, wo der Mensch von bessern Hilfsmitteln verlassen ist und irgendwelche Beispiele ihm bekannt sind, daß dieses oder jenes, wenn auch noch so Absurde, irgendwo und wann geholfen hat. Wir sehen aber, daß der Fetischglaube rein auf Furcht und Egoismus gebaut ist, und dementsprechend ist der Kult der Fetische eingerichtet. Mit dem guten Fetisch wird wie mit einem Liebling verkehrt; er erhält Gaben an Essen und Getränk, Sitz und Lager. Manche schaffen sich Hunderte und Tausende von Fetischen an; Steine, über die sie stolpern, Blätter, die zu ihren Füßen geweht werden, Holzstücke, die ihnen auffallen, Figuren usf. Und sie sitzen mitunter in der großen Masse von solchen Gegenständen und bitten sie schmeichelnd und verehrend, ihre Kraft ihnen zu weihen. Gefürchtete Fetische können zu furchtbaren Götzen sich auswachsen, die nur durch blutige Opfer zu versöhnen sind, wozu namentlich auch Menschenopfer gehören. Der Fetischismus wird vielfach, so von Comte, Lippert, Schultze u. a. in viel weiterem Sinne aufgefaßt, was später noch zur Sprache kommt. Ich habe die beschränktere Umgrenzung gewählt, um nicht bei einer allgemeinen Untersuchung sogleich ins Uferlose zu geraten. Gibt es doch auf der anderen Seite Forscher, welche von einem Fetischglauben überhaupt nichts wissen wollen.
Der Seelenglaube erschöpft sich nicht in dem Glauben an eine Seele, sondern er geht auch auf die Beschaffenheit und Eigenheit der Seele ein. Sie kann ihre Behausung überall nehmen, hält sich jedoch am liebsten am gewohnten Orte auf. Da sie immerhin unheimlich wirkt, sucht man sie entweder zu bannen oder man überläßt ihr ihren gewohnten Aufenthalt. So wird oft ein Topf oder ein Korb hingestellt und die Seele des Gestorbenen gebeten, darin ihren Platz zu nehmen. Dem Körper entsprechend, den sie bewohnt hat, zieht sie Nachbildungen aus Holz oder Ton oder Stein vor. Hat sie sich in eine solche Nachbildung begeben, so kann letztere Fetisch werden und darum haben so viele Fetische Menschen- und Tiergestalt. In anderen Fällen sucht man sie den gewohnten Eingang in die Behausung vergessen zu machen und greift zu so kindlichen Mitteln, daß man den Toten rennend mehrmals um die Hütte herumträgt, oder daß man den Toten nicht durch die Türe, sondern durch ein zu diesem Behufe gemachtes Loch hinausschafft, das nachher wieder geschlossen wird.
Lippert erzählt eine tragikomische Geschichte aus unserer eigenen Zeit (1879) und unserem eigenen Vaterlande, die ebensogut in Afrika hätte passieren können. In einem Dorfe bei Zittau hatte sich ein Militärmusiker entleibt. Der Hauswirt gestattete unter keinen Umständen die Hinausbeförderung der Leiche durch den gewöhnlichen Ausgang, weil „in diesem Falle die Seele des Selbstmörders im Hause bleibe und darin spuke“. Die Träger mußten fort und kamen, da es spät war, erst am nächsten Tage mit den Gensdarmes wieder. Wie erstaunt waren sie, die Leiche vor dem Hause in einer hölzernen Kiste zu finden. Der Hauswirt hatte sie in der Nacht mit Hilfe einiger Freunde in die Kiste getan und an einem Strick durch das Fenster hinabgelassen. Wie es bei uns auch von Spukgeschichten wimmelt, brauche ich kaum hervorzuheben.
Geht man ganz nachsichtig vor, oder hat man besondere Gründe, so wird der Tote in der Hütte oder unter dem Eingang der Hütte begraben. Im ersteren Fall wird die Hütte wohl[S. 42] auch von den Angehörigen verlassen, damit die Seele ungestört bei ihrem Körper verweilen kann. Oder es wird der Seele eine besondere Hütte gebaut, in der eben der Tote beigesetzt wird. Dieses letztere berührt sich zwar mit Kulturgepflogenheiten, hat aber einen anderen Sinn, lediglich den, der Seele einen festen Aufenthaltsort zu geben, ohne sie zu kränken. Endlich werden Tote auch unter Bäumen und Felsen oder in Höhlen beigesetzt. Ihr Gebiet geht dann, soweit der Schatten des Baumes, Felsens oder der Höhle reicht. Nach mohammedanischem Glauben bleibt die Seele des Abgeschiedenen noch eine Nacht bei ihm. Wilde verlängern die Zeit beliebig. Damit die Seele nicht herauskomme, werden dem Toten alle körperlichen Öffnungen verstopft, oder es werden die Teile, in denen man die Seele vermutet, wie Hirn, Herz und namentlich Niere herausgenommen und vernichtet, oder als „Medizin“, als Zaubermittel gegen Unfälle und für Stärkung der eigenen Kräfte verwendet. Namentlich Feinden gegenüber, wie Raubtieren und menschlichen Feinden, wird so verfahren, wenn die Feinde nicht ganz aufgezehrt werden, um ihre Seele in sich aufzunehmen. Der Drang nach solcher Medizin ist so groß, daß, wo der Glaube herrscht, die Seele gehe mit der Leichenflüssigkeit ab, selbst dieser widerliche Saft getrunken wird. Frobenius, der davon als vom Fananybrauch spricht, teilt mehrere Beispiele aus Afrika und Polynesien mit. Nicht selten führt der Glaube zu gemeinen Mordtaten, und der Mörder hat nur den Wunsch, etwa die Niere des Getöteten zu verschlingen; er hat dann zwei Seelen, ist also kräftiger und darf auf längeres Leben hoffen. Auch der Glaube scheint zu bestehen, daß man die Seele verhindern kann, mit dem Toten zurück ans Tageslicht zu kehren, wenn man der Leiche Hände und Füße bindet. Der Brauch scheint uralt zu sein, denn auch in prähistorischen Gräbern Europas hat man Skelette mit Fesseln an Händen und Füßen gefunden. Wie sehr die Körperlichkeit der Seele ein Grundgedanke des Naturmenschen ist, ergibt auch die Ansicht, daß die Seele in der Form ganz dem Körper folgt. Fehlt einem Menschen ein Glied, so besitzt[S. 43] auch die Seele dieses Glied nicht. Daher schneiden Wilde den Toten den Daumen der rechten Hand ab, damit die Seele nicht nach ihnen ihre Geschosse schleudern kann. Es wird erzählt, daß, als auf einer Plantage viele Neger Selbstmord begingen, um im Jenseits als freie Seelen zu leben, der Besitzer zuletzt den Leichen Hände und Füße abschlagen ließ. Das wirkte: die Neger fürchteten nun, ihr jenseitiges Dasein so verstümmelt verbringen zu müssen. Daher die Vernichtung der Seele durch absolute Zerstückelung oder besser durch Verbrennen des Körpers (S. 71). Die Seele krankt und altert sogar mit dem Körper, und darum fürchten so manche Wilde bei Siechtum oder Alterschwäche, im Jenseits nicht mehr imstande zu sein, von den dort gebotenen Freuden hinreichend genießen zu können. Daraus hat man die grausame Sitte so mancher Naturvölker erklären wollen, die Alten und Siechen zu töten; man will sie dem Jenseits noch in einiger Kraft erhalten. Eine Sitte, die auch bei Germanen, Kelten und Slawen sich nachweisen läßt.
Eine Seele kann auch Ummauerungen nicht durchdringen. Daher muß, wo der Körper von einem Grabhügel umschlossen ist, an diesem Hügel ein Loch zu ihm gelassen werden, damit Speise und Trank der Seele zugeführt werden können; die neben das Grab getane würde die Seele nicht erreichen.
10. Schamanismus, Totemismus, Seelen-, Ahnenkult.
Da die Seele eine gewisse Freiheit vom Körper genießt, so kann sie sich mitunter aus diesem auch bei Lebzeiten entfernen. Und so glaubt der Naturmensch, daß Gestalten, die er im Träumen sieht, entweder Seelen dieser sind, die sich von ihnen gelöst haben und nun zu seiner Seele gekommen sind, oder daß seine Seele aus seinem Körper gegangen ist und jene Seelen aufgesucht hat. Dabei bieten die leblosen Gegenstände keine Schwierigkeit, denn diese werden ja auch beseelt gedacht. Es kann nicht meine Absicht sein, das unheimliche Kapitel der Träume zu behandeln; ich habe nur das hervorzuheben, was für die Anschauung von Be[S. 44]deutung ist. Wie sehr es in der Natur des Menschen liegt, sich mit seinen Träumen zu plagen, kann selbst der Vorurteilsfreieste an sich gewahren. Und alle Aufklärungen der Physiologen und Biologen nützen nur wenig dem, der von einem bösen Traum betroffen ist; er liegt ihm den Tag über in allen Gliedern; der Träumer ist froh, wenn dieser Tag vorüber, da seltsamerweise im allgemeinen der Wert eines Traumes auf die Zeit zwischen Nacht und Nacht beschränkt wird. Nicht wenige Ethnologen und Anthropologen sind geneigt, die Seelen- und Religionsanschauungen überhaupt aus den Traumerscheinungen abzuleiten. Indessen träumen auch Tiere. Etwas Besonderes muß also beim Menschen wohl hinzukommen, ihm die Reflexion oder den Einfall aus jenen Anschauungen zu erwecken. Manchen Menschen wird die Fähigkeit zugeschrieben, ihre Seele nach gewissen Vorbereitungen, die meist auf Hervorrufung einer Ekstase oder dumpfen Betäubung abzielen, beliebig aus ihrem Körper nach bestimmten Orten hinauszusenden, um dort Erkundigungen über Diebstähle, Feindespläne, Heilmittel, Schicksale von Menschen und Tieren einzuziehen. Der betreffende Mensch liegt gleich einem Toten, seine Seele geht inzwischen, wohin er sie entsandt hat. Nachdem sie das Gewünschte erfahren, kehrt sie in ihn zurück, er erwacht und weiß nun alles. Unzählig sind die Mitteilungen von solchen Seelenentsendungen und den wunderbaren Erfolgen, namentlich bei den Völkern Nordasiens, Nordeuropas und Nordamerikas, und auch Afrikas. Und manche davon sind so auffallend, daß sie selbst unter gebildeten Reisenden Glauben gefunden haben. Die Leute mit solcher Macht über ihre Seele gehören meist zur Klasse der Priester und Zauberer, oder, wie wir sie gemeinhin heißen, weil sie auch Krankheiten heilen und für alle möglichen Fälle Mittel besitzen und verabreichen, „Medizinmänner“. Bei den verschiedenen Völkern führen sie verschiedene Namen. Der bekannteste ist der der Schamanen (aus dem indischen Çramana), und in Verbindung mit gewissen Geisterkulten sprechen wir von Schamanismus als einer Religionsäußerung.
Solche Ansichten kennen auch die arischen Völker. Odhin soll mitunter schlafen und dabei soll seine Seele als Vogel, Fisch oder Schlange die Welt durchstreifen, um dem Herrn, was sie erkundet, mitzuteilen. Eine seltsame Erzählung hat uns der Geschichtschreiber der Langobarden, Paulus Diaconus, aufbewahrt, die ich nach Jakob Grimm (Deutsche Mythologie) wiedergebe. „König Gunthram (der bekannte Frankenkönig) war im Wald ermüdet auf dem Schoß eines treuen Dieners entschlafen. Da sieht der Diener aus des Herrn Munde ein Tierlein, gleich einer Schlange, laufen und auf einen Bach zugehen, den es nicht überschreiten kann. Jener legt sein Schwert über das Wasser, das Tier läuft darüber hin, und jenseits in einen Berg. Nach einiger Zeit kehrt es auf demselben Wege in den Schlafenden zurück, der bald erwacht und erzählt, wie er im Traum über eine eiserne Brücke in einen mit Gold erfüllten Berg gegangen sei.“ Schlangen gehören zu den auf der ganzen Erde verbreiteten Bildern und Verkörperlichungen der Seele. Die Schlange also war König Gunthrams Seele. Paulus Diaconus teilt übrigens noch mit, daß man an der betreffenden Stelle nachgegraben und in der Tat viel verstecktes Gold gefunden habe. Die Seele hat also das Richtige ermittelt. Von dem Gold ließ der König einen Kelch machen, den er dem heiligen Marcellus in seiner Residenz Châlons widmete, wo der König selbst begraben wurde.
Auch fremde Seelen vermag der Kundige zu senden, wohin er will. Die Könige von Dahome, so oft sie den Rat eines Gottes einholen wollten, töteten einen Menschen, dessen Seele zum Gott ziehen und von ihm das Nötige in Erfahrung bringen sollte, um es dem Zauberer dann zu offenbaren. Ähnliches erzählt bekanntlich Herodot von den thrakischen Goten: „Alle fünf Jahre wählen sie einen von ihnen durch das Los, den schicken sie als Boten an Zalmoxis und tragen ihm ihr jedesmaliges Anliegen auf.“ Die Entsendung geschieht, indem drei Leute Wurfspieße halten und der zu Sendende hochgeworfen wird, daß er auf die Spieße fällt. Ist er gleich tot, so wird das als gnädiges Zeichen des Gottes[S. 46] betrachtet, sonst wird ein anderer Bote in gleicher Weise entsandt. Herodot fügt hinzu: „Sie geben ihm aber den Auftrag, wenn er noch lebt“. So gleichen sich Anschauungen in voneinander so fernen Landen und so weit abstehenden Zeiten, zum Beweise wie gleichartig die Menschen denken, schließen und handeln!
Die Anerkennung der Obergewalt mancher Menschen über sich führt dazu, daß deren Seelen besonders hoch bewertet werden. An den Seelenglauben knüpft sich so der Ahnenglaube als das Natürliche und der Übergeordnetenglaube als das oft Aufgezwungene. Den Ahnenglauben finden wir fast auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten verbreitet. Vielleicht mangelt er selbst denjenigen Völkern nicht, die ihre alten Väter und Mütter aussetzen oder gar töten. Es liegt ja nahe, daß der Ernährer der Familie eine eigene Stellung einnimmt und seine Seele besonders geachtet wird. Offenbar wird sie besonders geneigt sein, den Zurückgebliebenen die gleichen und mehr Wohltaten zu erweisen wie im Leben. Da der Wilde absoluter Realist ist, sucht er sich ihre Zuneigung zu wahren. Und dieses hat zu einem eigenartigen Seelen- und Ahnenkultus geführt, der sich überall vorfindet und, wie zu anmutenden Gebräuchen, so auf der Wildenstufe zu den schändlichsten Grausamkeiten geführt hat, die in den merkwürdigsten Formen vertreten sind. Alles dieses steigert sich ins Ungemessene, wenn es sich um die Seele eines mächtigen Zauberers oder eines Häuptlings handelt, so daß hier deren Tod ein wahrer Jammer in des Wortes bösester Bedeutung für ein ganzes Volk werden kann. Wir haben schauerliche Funde aus prähistorischen Zeiten, und entsetzenvolle Erzählungen aus Vergangenheit und Gegenwart. Indessen ist es nicht meine Aufgabe, die Kulte zu besprechen, nur die Anschauungen gehören hierher. Diese aber führen, wie man sieht, zu einer Stufung in den Seelen. Der niedrige Sklave hat eine niedrige Seele, die nichts vermag, der Ahne, Priester und Häuptling besitzen bedeutende Seelen. Und je höher der Rang, je größer die Gewalt, desto mächtiger auch die Seele im Guten und nament[S. 47]lich im Bösen. Diese Differenzierung ist von großer Wichtigkeit; sie hat zu Theorien geführt, wonach die Religionen überhaupt aus Seelen- und Ahnenglaube (wenn wir unter Ahnen allgemein Übergeordnete verstehen) hervorgegangen seien. Ich komme darauf später zu sprechen.
Die Tiere erachtet der Naturmensch als von sich nicht verschieden, er verleiht ihnen Seelen, der seinigen gleich. Sprechen doch manche afrikanische Stämme davon, daß gewisse Menschen beliebig als Menschen oder als wilde Tiere leben können. Und wenn Polynesier von Leuten erzählen, die sich beliebig in Raubtiere, Vögel, Fische oder Schlangen verwandeln, so meinen sie das nicht nach Art unserer Sagen und Fabeln, sondern rein reell. So hat sich neben einem Menschenseelenglauben auch ein Tierseelenglaube ausgebildet und daran ein Tierseelenkult angeschlossen, der Totemismus. Und wunderlich berührt es, wenn als Ahnenseelen auch Tierseelen angenommen werden, wie das namentlich bei den Indianern der Fall ist, wo nicht bloß Familien, sondern auch ganze Stämme irgendein Tier: Bär, Rabe, Schlange, Schildkröte, Spinne usf. als Urahnen bezeichnen. Wenn ich Lippert recht verstehe, will er freilich nicht die Tierseele als die Ahnenseele anerkennen, sondern eine Menschenahnenseele annehmen, die in das Tier gefahren ist, in ihm ihren Wohnsitz aufgeschlagen hat. Damit würde übereinstimmen, daß Ahnentiere in der Regel nicht getötet und nicht gegessen werden dürfen, aber wiederum nicht dazu passen, daß bei gewissen Festen gerade solche Tiere verzehrt werden müssen. Indessen besteht über den Totemismus überhaupt keine rechte Sicherheit. Manche wollen in den Ahnentieren nichts weiter als Wappenbilder sehen, und zweifellos machen solche auch vielfach diesen Eindruck. Oder sie erklären sie lediglich durch Tiernamen menschlicher Ahnen, die durch Mißverstand zur Annahme von Tieren als Ahnen geführt haben. Das eine oder das andere wird in vielen Fällen zutreffen. Sicher aber ist, daß Tierseelen mitunter nicht mindere Bedeutung haben wie Menschenseelen und gleichfalls Verehrung genießen. Familie und Stamm[S. 48] halten ihr Totem (der Name stammt von den Algonkinindianern her, „Dodaim“) hoch und nennen sich nach ihm Bär, Wolf, Hirsch usf.
11. Geister- und Dämonenglaube, Götzendienst.
Ein unmittelbares Kind des Seelenglaubens ist der Geister- und Dämonenglaube. Geister und Dämonen sind die Seelen abgeschiedener Menschen oder Tiere. Ist es gelungen, diese Seelen an Gegenstände, tote oder Lebewesen, zu bannen, so hat man die Fetische, die um so wichtiger sind, je bedeutender die Seele. Häuptlinge und Priester können erklären, in den und den Gegenstand sei eine besonders wichtige Seele gefahren oder gebannt. Der Gegenstand ist dann Tabu, unberührbar und unnahbar, die bekannte Plage der ozeanischen Stämme. Gegenstände, namentlich menschliche Figuren, aber auch Tiere und tierische Figuren, werden besonders gerne zum Sitz einer Seele genommen, und ist die Seele von einiger Bedeutung, so haben wir ein Götzenbild als Fetisch. Götzenbilder sind räumlich und zeitlich außerordentlich verbreitet und finden sich selbst gegenwärtig sogar bei den Kulturnationen. Sie entstammen aber der menschlichen Eigenheit, alles materiell zu fassen. Und es mag noch so oft gesagt werden, Männer und Frauen in katholischen Ländern sollen durch bekleidete und gekrönte Marien- und Heiligenbilder nur an die hohe Gottesmutter und an Menschen frommsten Lebenswandels erinnert werden, so faßt das einfache Volk die Sache doch anders auf, wenn auch nicht so wie der Neger oder der Gesellschaftsinsulaner, der sein Götzenbild absolut sich dienstbar erachtet und es mit einer rohen Seele versieht, die unter Umständen gezwungen werden muß, Dienste zu leisten, aber doch immerhin beseelt. Wie sollten sonst die Wunderbilder, die als solche Wunder tun oder die gar Lebensäußerungen von sich geben, wie Weinen, Zunicken, Blutschwitzen zu erklären sein, von den Hostien, deren Lebensäußerungen so unendlich vielen unschuldigen Menschen den qualvollsten Tod gebracht haben,[S. 49] zu schweigen, die nicht einmal menschliche Figur nachahmen. Es kann kaum anderes angenommen werden, als daß für den Unaufgeklärten in allen diesen Dingen sich mindestens die Kraft der Gottheit oder des Heiligen kundgibt, zumal es sich ja immer um besondere solche Dinge handelt, nicht um alle. Anhänger der Lehre, daß alle Religion aus dem Seelenkult in Verbindung mit Fetischglaube hervorgegangen ist, würden sogar sagen, daß angenommen wird, die Kraft stecke in den betreffenden Dingen. Das geht sicher zu weit, selbst für das Mittelalter; es handelt sich nur um eine Manifestation, nicht um Götzendienst im Sinne des Naturmenschen. Ob aber der Molochdienst der Phönizier und Karthager, der Çiva- und Kalidienst der Indier, der ursprüngliche Götterdienst der Griechen und Römer, der Tierdienst der alten Ägypter, der Baum- und Bilderdienst der alten Germanen, Kelten, Littauer, Preußen, Slawen von jenem Götzendienst sehr weit entfernt gewesen ist, darf mit Recht bezweifelt werden. Tylor macht darauf aufmerksam, wie trotz der allgemeinen Verbreitung der Götzendienst doch manchen Völkern fehlt, während die ganze Umgebung ihm huldigt. Das bekannteste Beispiel ist das der Hebräer, denen ja selbst die Anfertigung eines Götzenbildes verboten war. Aber wie sehr Fetischgötzendienst im Blute des Menschen liegt, sehen wir ja gerade an den Hebräern. Was haben die gewaltigen Seher und Propheten predigen und eifern müssen, um das Volk vom Götzendienst abzuhalten, und wie viele Rückfälle in diesen Dienst sind zu verzeichnen! Die lebhafteste Schilderung haben wir im Buch der Richter vom Götzendienst im Hause des Micha, der sogar einen Leviten zum Priester der Götzenbilder anstellt, sodann in der Anbetung des goldenen Kalbes mit ihrem so verhängnisvollen Ergebnis für das Volk. Aber nach dem Exil finden wir keine Spur von Götzendienst mehr vor, und wie zuwider und verhaßt dieser Dienst dem Volke war, sehen wir an der Heldenzeit der Makkabäer in der Empörung selbst gegen den veredelten Bilderdienst der Griechen. Und unmittelbar neben diesem Hebräervolk sitzt das ihm doch verschwisterte und dabei götzendienerischeste[S. 50] Volk der Phönizier und im Süden hausen die tatsächlich Fetische anbetenden Araber und im Osten die, trotz unserer Babylonier, götzendienerischen Mesopotamier. Als zweites Beispiel werden die Götzendiener der Gesellschaftsinseln und die vom Götzendienst freien Bewohner der Tonga- und Fidschiinseln genannt. Selbst Religionen, die überhaupt nicht auf Götterverehrung basieren, wie der Buddhismus, haben zuletzt doch zu Idolatrie und Fetischismus geführt, sobald sie zu Völkern gelangten, die die hohen Lehren nicht begriffen und nur das aufnahmen, was ihrem, ich möchte fast sagen, Wildeninstinkt entsprach. So ist die edle Lehre Gotamas bei Tibetanern und Mongolen zu einem elenden Götzendienst herabgesunken, mit Geister- und Hexenwesen und allem möglichen Beschwörungsunfug. In China ist ein Götze nach einem Prozeß gegen ihn aus einer Provinz ausgetrieben worden, weil er einem Mädchen durch seinen Priester Heilung versprach und das arme Wesen dennoch starb. Mir fällt ein amüsantes Histörchen aus Herodot ein. Der joviale Vater der Geschichte erzählt, die Männer von Kaunos, der Vaterstadt des großen Malers Protogenes, hätten von ihren Göttern manches erfleht, aber es nicht erhalten. Da seien sie mit Lanzen und Schwertern in den Tempel gestürzt und hätten mit Schreien und Herumstechen in der Luft die Götter aus dem Tempel gejagt, seien in gleicher Weise hinter ihnen her gerannt, bis sie sie über ihre Grenze gescheucht hätten. Dann hätten sie neue Götter in den Tempel geladen. Als es aber unter diesen nicht besser wurde, hätten sie auch diese hinausgetrieben und ihre alten Götter zurückgeholt. Völlig negermäßig! Und ähnliche Beispiele gibt es in großer Zahl bei Griechen, Römern und anderen Völkern, wenn auch nicht so ganz naturnaiv. Sehr lehrreich ist, was Curtis in seinem lesenswerten Buche „Ursemitische Religion“ von den mohammedanischen Stämmen in Syrien und den angrenzenden Gebieten erzählt. Bei vielen dient Mohammeds Lehre kaum als Deckmantel für einen Heiligen-Fetischglauben. Die Heiligen, Weli, können in Gräbern — die große Zahl solcher in allen mohammedanischen Ländern ist ja bekannt —[S. 51] leben, aber auch in Bäumen, Felsen, Steinen, Quellen, Wassern usf. „Theoretisch,“ sagt der genannte Verfasser — und er beruft sich auch auf den bekannten Palästinaforscher Conder — „werden sie in Verbindung mit Gott verehrt; tatsächlich jedoch kennen viele Leute keinen anderen Gott als sie. Sie sind die Gottheiten, welche das Volk fürchtet, liebt, verehrt und anbetet.“ Ein frommer Moslem erzählte, sein Schutzpatron sei in einen in Asâl befindlichen Stein gefahren. Und Steine als Aufenthalt scheinen überhaupt bei den Weli nicht unbeliebt zu sein, namentlich irgend bemerkenswerte, wie Pfeiler, Denksteine usf. Curtis erinnert daran, daß auch im Alten Testament Steine mitunter eine besondere Rolle spielen, wie der Stein Jakobs, auf dem sein Haupt bei dem schönen Traum geruht hatte und den er salbte und ein Haus Gottes nannte. Auch Bäume sind in obigem Sinne heilig. „Offenbar sind nach dem Volksglauben heilige Bäume Stätten der Offenbarung von Geistern.“ „In solchen Bäumen wird Fleisch aufgehängt, gleichsam die Nahrung für die darin wohnhaften Geister.“ Besonders seltsam sind die Gewässer, in denen Heilige wohnen. Sie werden namentlich von Frauen aufgesucht, welche unfruchtbar sind und glauben, daß wenn sie sich dem Wassergeist ergaben, sie fruchtbar werden. Sie legen sich darum in den Wasserlauf und lassen die Fluten über ihren Schoß spülen. Daß es sich hier um etwas anderes handelt als Baden, erhellt aus folgender sonderbaren Erzählung Curtis’. Ein reicher Moslem in Damaskus hatte seine Frau im Zorn verstoßen und die dreifache Scheidung ausgesprochen. Bald tat es ihm leid, er konnte sie aber nach dem Gesetz nunmehr nicht wieder heiraten, bevor sie nicht mit einem anderen vermählt gewesen und von ihm geschieden war, oder bevor sie nicht wenigstens einem anderen sich hingegeben hatte. Die mohammedanischen Ulemas wußten ihm nicht zu helfen. Aber der Patriarch (!) gab ihm den Rat, die Frau sollte sich in den Rásadafluß niederlegen, „sich vom Wasser umspülen lassen und so eine Ehe vollziehen; dann könne er sie wieder heimführen. Damit erklärten sich auch die Ulemas einverstanden.“ Einen viel anderen Rat[S. 52] als hier erste Priester zweier hoher Religionen gaben, würde ein Medizinmann Afrikas auch nicht gegeben haben. Selbst die Bestechung fehlt hier nicht, wobei es ganz handelsmäßig zugeht, indem dem Heiligenbild mehr und mehr geboten wird, wenn es anscheinend nicht in der Laune ist, den Wunsch zu gewähren.
Je bedeutender die Seele, desto höher wertet, wie bemerkt, der Fetischgötze, in dem sie wohnte. Und so konnten Häuptlingsseelen Götzen für ein ganzes Volk abgeben, so daß manche Volksgötzen nach Häuptlingen benannt sind, wie auch umgekehrt Häuptlinge nach Götzen. So müßte die Bevölkerung des Olymps der Naturmenschen ins Ungemessene wachsen, wenn nicht durch Vergessen oder absichtliches Entfernen für Abgang gesorgt würde. Es ist bekannt, daß der Messenier Euemeros zur Zeit Alexanders behauptete — was übrigens andere schon vor ihm angenommen hatten —, die griechischen Götter seien lediglich vergötterte Fürsten und Helden. Er ist wegen dieser öden Ansicht viel angefeindet worden und wird, mit bezug auf die griechischen Götter, die wir kennen, auch im Unrecht sein. Daß aber Götter ursprünglich solche Fetischgötzen von Häuptlingen sein können, wird man kaum bezweifeln dürfen, und die griechischen Sagen tragen selbst viel dazu bei, ihren Göttern Menschenursprung zuzuschreiben. Bei den Naturvölkern aber sind solche Vergötterungen selbstverständlich. Der Häuptling ist der mächtigste im Stamm, er kann zu Lebzeiten Gutes und Übles, und namentlich letzteres, zufügen. Also muß seine Seele der gleichen Art sein, und der Gegenstand, in dem sie wohnt, ein Menschenbild, ein Tierbild oder auch ein lebendes Tier, durch sie besondere Kraft besitzen, gleichfalls Gutes und namentlich Übles anzustiften, und muß durch Opfer, oft sogar Menschenopfer, bei guter Laune erhalten werden. Selbst in Menschen kann die Seele einziehen, dann fallen diese in Raserei. So erzählt Stuhlmann von den Waganda. Er erwähnt auch, daß, wenn ein Priester stirbt, bald sich jemand zu seinem Nachfolger aufwirft, indem er behauptet, jenes Seele sei in ihn gefahren.
12. Zauberwesen.
Nun können noch Seelen frei in der Luft leben oder in Bergen, Höhlen, Wäldern, Gewässern, Wolken usf. Diese geben das Heer der Geister, Gespenster, Dämonen, von denen es um den Naturmenschen wimmelt. Nichts Unangenehmes kann vorgehen, daran nicht irgendein Geist schuld ist. Deshalb ist dem Naturmenschen der Zauberer so unentbehrlich, der es versteht, die Dämonen auszutreiben und zu bannen und sie auch gegen die Feinde auszusenden. Manaia, so erzählt Grey in seiner Polynesian Mythology, hatte die Schwester des Ngatoro-i-Rangi zur Frau. Diese kochte ihm eines Tages schlechtes Essen. Da verfluchte er ihren Bruder und entsandte so böse Geister gegen ihn und sein Volk. Die Frau schickte sofort ihre Tochter aus, den Bruder zu warnen. Das Mädchen kam hin und erzählte den Vorfall; darauf grub Ngatoro-i-Rangi, nachdem er und seine Angehörigen sich durch Untertauchen in Wasser gereinigt hatten, mit diesen eine Grube, und unter Beschwörungen schaufelte er die gegen ihn ausgesandten bösen Geister in diese Grube hinein, überschüttete sie mit Erde, stampfte diese fest und spannte darüber beschwörte Gewänder und zuletzt ein Geflecht. So hatte er die Dämonen vernichtet. Später zieht er mit seinen Leuten gegen Manaia und gebraucht eine Kriegslist. Sie schlagen sich alle die Nasen wund und legen sich für tot, die Waffen verborgen, auf die Erde. Priester Manaias kommen und finden sie und meinen nicht anders, als ihre Geister hätten sie getötet und hergebracht. Auf ihren Ruf strömt das Volk hinzu. Aber während sie noch über die Verteilung der vermeintlich Toten streiten, springen diese auf, fallen über sie her und erschlagen alle. Dann — fressen sie sie auf. Noch eigenartiger ist eine zweite Erzählung Greys, gleichfalls aus Neuseeland. Zwei Zauberer, Purata und Tautohito, besaßen in einer Festung einen holzgeschnitzten Kopf, der auf Beschwörung Geister über Geister aussandte, die alles, was sich der Festung nahte, töteten, so daß niemand mehr wagte, in die Gegend zu kommen,[S. 54] die einem Leichenfelde glich. Da beschließt ein gewaltiger Zauberer, Hakawau, hinzugehen und jenen Zauber zu vernichten. Zuerst beruft er seine Geister und läßt sich von ihnen im Schlafe sein Schicksal zeigen. Dieses ist günstig, denn er träumt, sein Haupt berühre den Himmel und seine Füße ständen fest auf der Erde. Nun macht er sich auf. Und wie er der Festung sich naht, schickt er mit Beschwörung seinerseits Geister wider die feindseligen Geister. Es entsteht eine förmliche Schlacht zwischen den zwei Geisterscharen. Die Zauberer in der Festung schreien lauter und lauter auf den hölzernen Kopf ein, der mehr und mehr Geister entsendet. Hakawau aber ist kräftiger, und so siegt sein Geisterheer und erschlägt das feindliche. Zuletzt dringt er in die Festung ein, indem er über den Zaun klettert, und vernichtet den tödlichen Zauber vollends.
Anrufungen, Beschwörungen und Kulte der Geister und Dämonen wechseln ständig miteinander, und so ist der Naturmensch auch der ständige Sklave dieses Glaubens und lebt namentlich in der Nacht in jeglicher Furcht vor den Schöpfungen seiner eigenen Phantasie, richtiger seiner konsequenten, aber von falschen Voraussetzungen ausgehenden Schlüsse. In geringerer Fülle, aber immer ja noch reichlich genug, ist der Geisterglaube auch bei den Kulturnationen vorhanden. Und zuzeiten nimmt er gar gewaltig überhand.
sagt Faust, bevor die Sorge ihn erblinden läßt, wohl mit Rücksicht auf den gerade blühenden Weinsberger Geisterspuk des so bedeutenden Dichters Justinus Kerner. Und was tut der Spiritismus gegenwärtig anderes als eine Geisterwelt errichten, und auf demselben Stamme wie die Natur[S. 55]völker, nur, bei den ernsten Anhängern, in edlerer und gedankenreicherer Form. Aber der Vampyrglaube der slawischen Völker ist grauenvoll genug, daß er uns selbst in der Oper von Marschner noch erschreckt. Und ähnliche Gespenster- und Dämonengestalten, wo sind sie nicht zu finden? Tote geben überall Anlaß zu Furcht und Wahngebilden, nicht minder tut es das Spiel der Natur an abgelegenem Ort oder zu mitternächtlicher Stunde. Wir verdanken diesen Gebilden so herrliche Dichtungen wie Bürgers „Leonore“ und unzählige Volksballaden. Das sind „Überlebsel“ aus grauer Vorzeit, sagt man. Und in der Tat schwindet bei uns im Volke der Geister- und Gespensterglaube mehr und mehr, wogegen er freilich in der Gesellschaft und in einer ganzen Schule von Psychologen in gleicher oder anderer Form stark anschwillt, trotz der mitunter lächerlichsten Prozesse gegen betrügerische Beschwörer. Der Naturmensch faßt die Sache rein materiell auf, wie die beiden Beispiele, die durch hunderte zu vermehren keinen Zweck hätte, lehren. Die Geister sind für ihn zwar irdisch, sogar vernichtbar. Aber daß sie nicht wahrzunehmen sind, das füllt ihn mit banger Furcht vor stetem und verderblichem Angriff und zwingt ihn zu steter Abwehr. Unfall, Krankheit und Tod sind dem Naturmenschen nicht natürlich, sondern Durchbrechung der Natur und immer auf Rechnung böser Geister zu setzen, die von selbst oder von irgendeinem Feind gesandt, den Menschen befallen. Und so hat er sich ständig zu wahren und zu wehren, und der Zauberer muß bald die günstigen Geister zur Hilfe herbeirufen, bald die bösen durch Beschwörung und Tanz und Rasseln mit allen möglichen Dingen vertreiben und wenn möglich zurück auf den Feind lenken. Wie schon der Römer halb Sklave seiner dies fasti und nefasti, seiner Träume und Ahnungen, aller Vorfälle und Erzählungen war, so ist das in noch viel höherem Grade der Naturmensch. Überall sieht dieser die Hand unheimlicher Mächte. Das gilt vielleicht nicht für alle Naturmenschen, aber sicher weitaus für die meisten. Selbst Beduinen sind der Ansicht, daß Menschen von Geistern im Traume erschlagen werden können. Und „von bösen Geistern[S. 56] Besessene“ kennt das Altertum, das ganze Mittelalter und ein gutes Stück der Neuzeit. Dieses zu besprechen ist unerquicklich, und um so unerquicklicher, als beim Naturmenschen alle Mittel angewendet werden, den Besessenen zu heilen, vom bösen Geist zu befreien, bei uns aber, in unsinnigem Aberglauben, zuletzt die Heilung in Ertränken und Verbrennen der Unglücklichen gesehen wurde.
13. Höhere Anschauungen bei Naturvölkern; Naturreligionen, Naturmythen.
Indem der Naturmensch alles mit Geistern erfüllt, läßt er auch Himmel, Sonne, Mond, Gestirne, Erde, Meer, Flüsse, Quellen, Wolken, Wälder nicht von Geistern frei. Diese besonderen Geister aber haben für ihn nur zeitweise perniziöse Bedeutung, im allgemeinen jedoch spenden sie ihm Wohlleben. Sie treten so nun aus der Reihe der übrigen Geister heraus. Und sie sind es, aus denen sich allmählich die Naturreligion entwickelt. Vor allem der Himmel, als der Ort der Himmelskörper, dann Sonne, Wetter und Erde gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Und indem sie für ganze Völker und Länder entscheidend sind und auf lange Zeiten, werden sie mit den vornehmsten Geistern bevölkert. Aber dieser Prozeß geht langsam vor sich. Und eigentlich muß der Pandämonismus schon bis zu einem gewissen Grade abgeklungen sein, wenn jene höheren Mächte hervortreten sollen. In der Tat haben sie auch bei dem Naturmenschen bei weitem geringere Bedeutung als die unmittelbaren Geister und Dämonen, zumal sie ja ständig sichtbar bleiben und der Mensch so an ihren Anblick gewöhnt ist. Mit ihnen aber beginnt der eigentliche Götterglaube und die Mythologie, die sich dann zuletzt zum Gottglauben steigert. Es ist oft gefragt worden, ob die Wildenstämme schon im Besitz solcher höheren und höchsten Ideen sind. Ich habe schon hervorgehoben, daß bei ihnen keineswegs nur eine Anschauung herrscht, daß ihr Sinnen und Meinen sich vielmehr nach allen möglichen Richtungen wendet. Und so ist es schon[S. 57] zu erwarten, daß, wenn nicht alle, doch einige Stämme außer den unmittelbaren Geistern und Dämonen auch die höheren anerkennen werden, vielleicht den höchsten Geist. Das wird auch vielfach behauptet und durch Beispiele zu erweisen gesucht. Aber es ist mitunter recht schwer, einzusehen, daß dem wirklich so ist. Meist handelt es sich um einen Namen, ohne besondere Angabe der Qualitäten, höchstens unter Bezugnahme auf Schöpfung. Wenn man bedenkt, wie halbselbstverständlich dem Wilden das Wunder ist, begreift man auch, wie wenig die Schöpfung intellektuell für ihn zu bedeuten hat. Sie wird ja oft Menschen übertragen. Frobenius sagt, die afrikanischen Götter hätten dreierlei Ursprung: Geister als vergötterte Ahnen und Herrscher, letztere nicht selten noch zu ihren Lebzeiten. Mystische Gottheiten, die zum Menschen gleichgültig stehen. „Sie entsprossen dem Gefühl, daß neben den von den Afrikanern so sorgsam beobachteten Ausnahmeerscheinungen eine noch unerkannte Regelmäßigkeit in der Natur herrscht; sie sind gleichsam die Personifikation des Rhythmus in der Natur.“ Götter der hohen Mythologie, wie Sonnengötter usf. Eine strenge Scheidung soll es zwischen diesen drei Gruppen nicht geben, sie sollen ineinander übergreifen. Die erste Gruppe kennen wir. Was man mit der zweiten Gruppe anfangen soll, ist nicht recht ersichtlich, zumal sie sich nicht weiter entwickelt hat, wenn wir nicht in die Naturwissenschaft übergreifen wollen. Möglicherweise soll aber auch diese zweite Gruppe gerade zu den Höchstbegriffen führen, dann wäre die dritte Gruppe an die erste anzufügen. Einstweilen können wir in ihr nichts weiter als ein dunkles Fühlen und Ahnen sehen, ohne Namen und Sage, fast die Götter der Mysterien. Ich bekenne, daß ich für diese Götter bei den Naturvölkern keinen rechten Anhalt gefunden habe. Aber Geheimbünde bestehen bekanntlich bei ihnen in reichlicher Zahl, und es ist nicht ausgeschlossen, daß sie Mysterien pflegen wie die Griechen und andere Völker. Wir finden solche Bünde in Nordamerika, Westafrika, den ozeanischen Inseln, in Australien usf., von den Kulturvölkern zu schweigen. Was man von ihrem Tun und[S. 58] Treiben liest, ist freilich kaum geeignet, höhere Begriffe von ihren Geheimnissen einzuflössen; das meiste liegt auf dem Gebiete egoistischer Herrschsucht und der Raub- und Mordgier, auch des bösen Kannibalismus, und ist bei weitem mehr Plage als Wohltat, selbst wenn eine Art Rechtsüberwachung (ähnlich der Fehme) stattfindet. Keineswegs sind diese Mysterien mit den griechischen zu vergleichen, von denen alle alten Schriftsteller mit so hoher Achtung sprechen. Also über die zweite Gruppe weiß ich nichts zu sagen, vielleicht weiß ein anderer mehr.
Die dritte Gruppe wird von Frobenius in mehreren Beispielen behandelt. Aber hier bedarf es mitunter sehr weitgehender Deutungen, um zu höheren Ideen zu gelangen. Nehmen wir einige davon. Schango, bei den Yoruba an der Nigermündung, ist Gott des Donners, Blitzes und Feuers. Er ist Sohn des Meeres (Yemaja); Oschumare, der Regenbogen, ist sein Diener und trägt Wasser von der Erde in seinen Wolkenpalast. Ara, das Donnergrollen, ist sein Bote, Biri, die Finsternis, sein Gefolge. Er hat drei Frauen, die ihm Schnur, Bogen und Schwert tragen. Das alles klingt sehr schön und ganz wie ein hoher Naturmythos. Aber das ist nicht der einzige Mythos von Schango. Nach anderen Mythen stammt er von sterblichen Menschen. „Er war Herrscher in Oyo, der Hauptstadt Yorubas. Er war so grausam, daß Häuptlinge und Volk ihm eine Kalebasse voll Papageieneier schickten mit der Botschaft, daß er durch die Regierungsgeschäfte müde sei und schlafen gehen solle.“ Darüber entsteht ein Krieg; er muß fliehen, alles verläßt ihn, selbst sein Weib. Da hängt er sich auf. Nun erschrecken alle, sie suchen seinen Leichnam und finden eine Kette aus der Erde ragend. Darunter aber hören sie Schangos Stimme. Jetzt bauen sie darüber einen Tempel für Schango als Gott. Und wie Zweifler sagen, Schango sei doch tot, da kommt dieser in einem Gewittersturm und erschlägt die Ungläubigen. Hier ist nichts mehr von hohen Ideen, die Geschichte verläuft richtig fetischmäßig. Noch andere Mythen von Schango stehen nicht viel höher, zumal, wenn man beachtet, was auf S. 16 ff. über die[S. 59] Weltauffassung der einfachsten Naturmenschen gesagt ist. Höchstens eine Art Herrentum nach Art von Mauis erkennt man noch. Eine andere Gottheit ist Hubeane bei den Basuto, hier fehlt eine hohe Sage ganz. Sein Vater war Modimo, „der alles gut erschaffen, nur nicht den Menschen, welcher bald dem Verderben und dem Tode verfiel.“ Hubeane ergeht sich in Nichtswürdigkeiten diesem seinem Vater gegenüber und schlägt ihn sogar. Nun will ihn dieser töten und versucht es mit vergiftetem Brei, durch Meuchelmörder usf. Allen Nachstellungen entzieht sich Hubeane, und zuletzt muß der Vater fliehen. Nach einer anderen Mythe ist Hubeane Sohn eines Weibes, das allein noch übrig blieb, nachdem alle Menschen von einem Ungeheuer verschlungen sind. Er zieht, plötzlich erstarkt, zum Kampf gegen dieses Ungeheuer, wird aber auch verschlungen. Doch weiß er sich zu helfen, denn er schneidet ein Loch durch den Leib des Ungeheuers und schlüpft heraus, hinter ihm her kommen alle Menschen ans Tageslicht. Diese Sage ist in einer anderen, wo Hubeane von einem Schmuck, den er bei der Geburt am Halse schon mitbringt, Litaolane heißt, genauer ausgeführt; namentlich in den Verfolgungen, die er von den durch ihn befreiten Menschen erfährt. So flieht er einmal und verwandelt sich an einem Fluß in einen Stein. Seine Verfolger ergreifen den Stein und werfen ihn an das andere Flußufer hinüber. Dort wird der Stein wieder zu Litaolane, und dieser lacht seine Gegner aus. Die Auslegung, die Frobenius der ersten Sage gibt, meint, Hubeane wird verschlungen = Sonnenuntergang, er kommt wieder ans Tageslicht = Sonnenaufgang. Alle Menschen folgen ihm = erwachen im Schimmer der Morgensonne. Das ist aus Analogien erschlossen. Und alles andere, die Verfolgung durch die Menschen? Man wird gestehen, es ist nicht viel Besonderes an solchen Mythen. Und dabei sagt Frobenius: „Mit Schango und Hubeane haben wir den ganzen Vorrat der unverfälschten Sonnengötter des negerischen Afrika erschöpft.“ Er erzählt dann von dem hottentottischen Heitsi-Eibib, Tsui-Goab, Kauna. Ich kann in allen diesen Erzählungen nur mehr oder weniger törichte[S. 60] Märchen sehen und vermag den Deutungen von Frobenius nicht zu folgen. Nur in einigen Zügen läßt sich etwas Bedeutenderes blicken, wie, daß Heitsi-Eibib durch ein Wasser flieht, das sich vor ihm spaltet, über seine Verfolger aber zusammenschlägt (S. 13), daß Tsui-Goab in einem weißen Himmel über dem blauen Himmel wohnt, und dieser sich, die Menschen zu schützen, vorschiebt, so oft Tsui-Goab zürnt.
Ein Beispiel eines echten Fetischscheusals ist der weiter behandelte O-dente von der Goldküste. Der in einer Höhle bei Date wohnende Geist, er hieß zuerst Konkom, war „ein Mann mit nur einem Auge, einem Arm, krebszerfressener Nase und voller Schwären“. Dieser anmutigen Erscheinung immer zu opfern, ohne sie zu sehen, wurden die Leute müde und bei einem Opferfeste griffen beherzte Männer, als ein Arm aus der Höhle sich streckte, die Fleischstücke in Empfang zu nehmen, diesen Arm und zogen trotz allen Wimmerns die Gestalt nach. Aber entsetzt liefen alle davon unter dem Rufe: „Es ist kein gemeiner Mann, in der Tat, es ist ein Gott.“ Völlig entsprechend dem Standpunkte des Naturmenschen! Deshalb unterhandelten sie mit ihm. Er zeigte sich versöhnlich und legte ihnen als Buße auf, alle Früchte auf dem Felde und im Hause zu verbrennen, sie sollten jegliches hundertfältig zurückerhalten. Die Leute taten’s, da war Konkom gerächt, denn er floh von ihnen und eine Hungersnot brach aus. Er begab sich nach Krakye, wurde dort O-Dente genannt, und die Einwohner behielten ihn gerne. Er zog sich wieder in eine Höhle zurück und Krakye wuchs mächtig. Indessen gefiel es ihm dort nicht, er wollte nach Date zurück. Da erstand in diesem Ort ein Weib Koko, das von ihm, O-Dente, besessen wurde und den Datern alles mögliche verhieß, wenn sie O-Dentes Befehle erfüllten. Der Gott zöge dann selbst wieder zu ihnen. Der Gott verlangte Stiere und Rum, verbot dunkelblaues Zeug zu tragen. Ferner sollte niemand nachts mit einem Licht über die Straße gehen, „er könnte vielleicht eines der Kinder O-Dentes sehen, die im Donner und Windesrauschen gekommen, bei Nacht die[S. 61] Stadt durchwandern, sie zu bewachen.“ Nun geschieht ein Menschenopfer, das ich in seiner Scheußlichkeit nicht erzählen mag, und über diesem Opfer wird ein Altar in Gestalt eines Kegels errichtet. Und das geschah nicht etwa vor Jahrhunderten, sondern in unserer Zeit.
Die anderen ähnlichen Gottheiten darf ich übergehen, sie sind übrigens alle unilateral. Woraus zu entnehmen ist, daß sie Sonnengottheiten bedeuten, kann man nicht immer erfahren. Die Angaben bei den Afrikastämmen sind sehr verschieden. Die Namaqua sehen die Sonne für eine Scheibe Speck an, wovon man sich sogar ein Stück abschneiden kann. Demgegenüber nehmen die Madagassen die Sonne als einen strahlenden Körper an. „Sie betrachten sie als die Quelle des irdischen Besitzes, Genusses und aller Fruchtbarkeit.“ Bei den Ewara an der Guineaküste ist Lisa der Sonnengott, seine Frau ist Gleti, der Mond. Sie haben viele Kinder, davon sind die Töchter die Sterne, welche Gleti stets folgen. Wenn Lisa Gleti schlägt, wird diese dunkel, daher die Mondfinsternisse. Carl Peters in seinem Werke „Im Goldlande des Altertums“ behauptet von den Makalanga einen Sonnendienst gleich demjenigen des semitischen Baal. Er sieht bekanntlich im Makalangadistrikt das biblische Ophir. Max Müller hat nachgewiesen, daß dem Sonnendienst vielfach parallel ein Feuerdienst geht. In Afrika scheint dieser jedoch nicht sehr häufig und wesentlich auf die südlichen Stämme beschränkt zu sein. Die Hereros sollen ein heiliges Feuer, Ukuruo, unterhalten, das von einer Tochter des Häuptlings, die den Titel Ondangere führt, gepflegt wird. Also eine Art Vestalinnendienst, der auch ganz dem römischen gleicht. Den Prometheus spielt ein alter König. Das Feuer erhält auch Opfer, und es dient auch um böse Geister zu verjagen.
Bei den Indianern scheint von höheren Ideen etwas vorhanden zu sein, das Frobenius’ zweiter Gruppe der afrikanischen Gottheiten entspricht. Ratzel, in seiner Völkerkunde, sagt: „Wo sich ein hinreichend abstrakter Begriff (nämlich für Gott) findet, deckt er sich doch nur mit ‚Seele‘,[S. 62] ‚Geist‘, ‚schalten‘ oder einfach ‚wunderbar‘. Manitus (der Algonkins) sind zahllose Geister von bekannter Herkunft, die die ganze Natur bevölkern und bald feindlich, bald wohlwollend dem Menschen begegnen.“ Gleichwohl kennen einige Stämme einen höchsten Weltschöpfer, einen Lichtgott, der die Welt für die Lichtmänner geschaffen hat. Die entdeckenden Europäer wurden für diese gehalten. Sonnenkult haben alle amerikanischen Stämme; Ratzel meint, soweit der Ackerbau reicht (wohl soweit Nutzpflanzen gedeihen). Manche verehren auch Mond und Gestirne. Aber nach den Sagen z. B. der Tlinkitindianer, an der Küste von Nordwestamerika, die Krause in seinem Buche über diese Stämme mitteilt, haben sich Sonne, Mond und Gestirne in drei Kästen befunden, die ein Häuptling, der Onkel Yelchs, besaß. Dieser letztere, als Knabe, setzte es durch, nacheinander mit allen drei Kästen zu spielen, öffnete sie, trotz des Verbots des Onkels, und so flogen erst die Gestirne, dann der Mond, zuletzt die Sonne an den Himmel. Und Yelch, wenn auch die Indianer sagen: „So wie Yelch handelte und lebte, so müssen auch wir handeln und leben“, war keine hohe Gottheit. In den vielen Mythen, die Krause von ihm mitteilt, ist die Hauptsache, daß er als Rabe Streiche über Streiche machte. Ob er Rabe war oder nur ein Rabengefieder trug, er fliegt jedenfalls wie ein Rabe und benimmt sich auch ähnlich. Bei anderen Stämmen sind es andere Tiere, die Yelch vertreten, wie Bär, Schildkröte, Spinne. Es ist also doch eigentlich nur höherer Totemismus und Ahnenglaube, der unter dem Einfluß des Christentums eine neue, mehr aufs Ideale gehende Färbung erhalten hat. Der Indianer unterscheidet sich in dieser Hinsicht vorteilhaft vom Neger. Und nun gar die Kulturvölker des alten Amerika; ich möchte nicht wiederholen, was ich in meinem Buche „Die Entstehung der Welt“ ausgeführt habe, und verweise darauf.
Unter den Ozeaniern haben es die Polynesier, trotz der sonstigen auf Fetisch- und Seelenglauben beruhenden Ansichten, zu einigen hohen Ideen gebracht. Die große Begeisterung, die andere ihren Sagen und Mythen entgegen[S. 63]bringen, teile ich nicht, weil selbst in den besten Kindischheit und Barbarei durchscheinen. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, daß manches auf der Höhe griechischer Schöpfungen gleicher Art steht. Schon das Ehepaar Rangi und Papa, so materiell sie aufgefaßt werden, sind doch als höhere, besondere Wesen, Himmel und Erde, gekennzeichnet. Sie sind zuerst eng aneinander geschmiegt, so daß allgemein Finsternis besteht und ihre Kinder von Licht nichts wissen. Die so vergehenden Zeiten, nach Dekaden gerechnet, werden als Wesen aufgefaßt, Po. Jene Kinder heißen Tangaroa, Rongo-ma-tane, Haumia-tiki-tiki, Tane-mahuta, Tawhiri-ma-tea, Tu-matauenga. Von der gewaltsamen Trennung Rangis und Papas habe ich schon gesprochen. Sobald sie getrennt sind, ist es Licht. Von Sonne und Gestirnen wird nichts gesagt. Aber auch die Bibel kennt Licht ohne Sonne, es ist das erste, was Gott schafft. Nun sollte man erwarten, daß die Kinder Rangis und Papas etwas ganz Besonderes sind. Aber nein, sie sind rein irdisch. Grey, dem ich hier folgen darf, als dem wohl bedeutendsten Kenner polynesischer Mythologie, sagt: „Tangaroa bezeichnet (signifies) Fisch jeder Art, Rongo-matane bezeichnet Kartoffel und alles vegetabilisch als Nahrung Kultivierte, Haumia-tiki-tiki bezeichnet Farnwurzel und alles wildwachsende Eßbare, Tane-mahuta bezeichnet Wälder, Vögel und Insekten, die darin wohnen, und alle Dinge, die aus Holz gemacht werden, Tawhiri-ma-tea bezeichnet Wind und Stürme, Tu-matauenga bezeichnet Mensch.“ Damit ist nicht viel anzufangen. Der Realismus geht noch weiter. Der Wind und Sturm ist mit der Gewalttat, die gegen Himmel und Erde, auf Veranlassung des ersten Menschen, verübt ist, nicht einverstanden und rächt Vater und Mutter, indem er seine Brüder überfällt. Alles unterliegt ihm. Nur Tu-matauenga widersteht allein ohne Hilfe seiner Brüder. Nun zieht er über diese her und zehrt alles von ihnen, was irgend eßbar ist, also vom Wald alles Getier, vom Meer die Fische usf., auf. Zuletzt macht er noch Beschwörungsformeln, um sie zu zwingen, den Menschen immer zur Nahrung zu dienen. Und so wird der erste Mensch als[S. 64] Gott bezeichnet, der die Menschen diese Beschwörungen lehrte. Außer diesem Tu-matauenga läßt nur noch Tawhiri-ma-tea, das Wetter, göttlichere Eigenschaft erkennen. Anderweitig ist Tangaroa ein Hauptgott. Die Nachkommen des ersten Menschen sind die Menschen überhaupt. Sie erst haben Menschengestalt, die vier ersten Geschöpfe gleichen Menschen nicht. Rangi und Papa aber bleiben bis jetzt getrennt. Und wenn Papa voll Sehnsucht seufzt, steigen die Seufzer als Nebel zum Himmel, und wenn Rangi um die Geliebte weint, fallen die Tränen als Tau zur Erde; ein wunderschönes Bild. Rangi und Papa sind auch die Wohltäter der Menschen, indem Rangi Hauche, Menschen und Pflanzen zu kühlen, sendet, und Nebel, Tau und Regen und klares Wetter, damit die Pflanzen wachsen. Papa aber läßt die Pflanzen aus ihrem Schoß hervorgehen. Das tun sie, daß ihre Kinder zu essen haben.
Unter den Nachkommen befindet sich der bekannte Maui, mit vollem Namen Maui-tiki-tiki-a-Taranga. Er ist eine Frühgeburt und von seiner Mutter Taranga in die See geworfen (S. 12). Nach polynesischer Ansicht sollte er verderblicher Geist werden und die Menschen quälen, denn Frühgeburten müssen unter Beschwörungen vergraben werden. Er ist es nicht, zeigt aber in seinem Charakter in der Tat auch bösartige Eigenschaften. So tötet er ohne Grund ein junges Mädchen und macht ganze Ernten verdorren. Seinen Schwager verwandelt er aus Neid über dessen Erfolg beim Fischen in einen Hund, so daß seine Schwester aus Gram sich ins Meer stürzt. Er ist an sich ein Heros, der sich vor den Göttern fürchtet, aber er vollbringt Taten, die göttlich scheinen. Wie er die Sonne zwingt, langsam die Welt zu umgehen und nicht brennend zu strahlen, ist schon erwähnt. Seine zweite Haupttat ist das Heraufziehen der Nordinsel von Neuseeland an einem Kiefer als Angelhaken, aus dem Meere. Er ist aber darum doch nicht Erdschöpfer, da die Erde schon vor ihm bestand; er bewohnt schon ein Land mit seinen vier Brüdern. Die Insel aber zieht er wie zufällig, beim Fischen mit diesen Brüdern, in Gestalt eines Fisches empor. Die dritte Tat,[S. 65] wegen deren man ihn mit Prometheus verglichen hat, betrifft den Raub des Feuers. Indessen ist Feuer längst schon vorhanden, Maui kommt es mehr darauf an, das Feuer seiner Ahnin Mahu-ika zu zerstören. Er löscht aber vorher alles Feuer auf der Erde aus. Warum, ist nicht ersichtlich, da er kein anderes mitbringt, wenn’s nicht ist, daß er indirekt die Feuergöttin veranlaßt, den Rest ihres Feuers in Bäumen zu bergen, denen es die Menschen durch Reiben entlocken können. Er treibt mit der Feuergöttin, trotz der Warnung seiner Mutter, Spott. Er verlangt von ihr Feuer, sie läßt es aus einem Fingernagel hervorsprühen und gibt es ihm. Da löscht er es aus und bittet um neues, um es abermals auszulöschen. So fährt er fort, bis Mahuika die Kraft aller Finger- und Zehennägel verbraucht hat, außer der des Nagels einer großen Zehe. Diesen stampft sie — da sie sich betrogen erkennt — voll Wut auf den Boden. Alles gerät in Brand, Erde, Feld und Wald. Maui flieht als Adler und kann sich zuletzt doch nur retten, indem er seinen Vorfahr Tawhiri-ma-tea um Regen anfleht. Die Göttin aber behält von ihrem ganzen Feuer nur einige Funken, die sie sammelt und mit denen sie verfährt wie angegeben. Wenn diese Mythe nicht sinnlos sein soll, so muß die Feuergöttin irgendeinen bösen Dämon bedeuten, oder es ist in der Sage etwas verloren gegangen. Anderweitig wird der Mythos denn auch anders erzählt, so in Tonga, wo Maui mit dem Erdbebengott ringt, ihn überwältigt und das Feuer, an dem er sich gewärmt hatte, den Menschen bringt. Noch anders holt er das Feuer als Vogel. Sein letztes Abenteuer bringt ihm den Tod und den Tod auch der Menschheit. Eine Ahnin von ihm wohnt am Himmelshorizont, Hine-nui-te-po ist ihr Name, „große Frau Nacht“. Maui zieht zu ihr, begleitet von vielen Vögeln, die seine Genossen sind. Er findet sie schlafend und beschließt, in sie hineinzukriechen, sie ganz zu durchziehen und erst aus ihrem Munde sie zu verlassen. Er bittet die Vögel, nicht zu lachen, bis er wieder heraus ist, damit die Furchtbare nicht erwacht, und begiebt sich in sie hinein. Die Vögel verbeißen krampfhaft das Lachen über die Szene,[S. 66] aber das kleine Vögelchen Tiwakawaka vermag nicht an sich zu halten und lacht plötzlich auf. Da erwacht Hinenui-te-po, springt auf und tötet Maui. Hierin ist zweifellos der Sonnenuntergang geschildert, zumal Grey festgestellt hat, daß der Vogel Tiwakawaka in der Tat nur bei Sonnenuntergang sich hören läßt. Kommt noch dazu, daß Mauis Eltern in der Unterwelt leben, und er bei ihnen weilt und von Zeit zu Zeit emporsteigt, daß er Kraft über die Sonne Tama-nui-te-Ra übt, um verständlich zu machen, daß er als Sonnenheros angesehen wird.
Bastian, in seinem Buche „Die heilige Sage der Polynesier“, teilt aber noch viel höhere Anschauungen aus den Maorisagen mit. Vor Rangi und Papa haben schon andere Dinge bestanden, die zum Teil wesentlich als Begriffe aufzufassen sind. Er zählt deren 17 auf. Zuerst Te-Kore, das Nichts, dann Te-Po, die Urnacht, hierauf Te-Rupunga, das Sehnen, sodann Empfindung, Ausbreitung, das Luftschnappen, Gedanke usf., zuletzt Hau-Ora, Lebensatem, und Atea, Weltall, gespalten in Rangi und Papa. Das geht freilich sehr hoch und weit, und Bastian vergleicht die Reihe mit ähnlichen Reihen in buddhistischen Anschauungen. Von Rangi und seiner zweiten Liebe Atatuhi (Dämmerungsstrahlen) sollen Mond, Sterne, Tagesgrauen, Tag, von ihm und seiner dritten Liebe Werowero (Hitzgezitter), Ra, die Sonne, stammen. Papa mit verschiedenen Männern bringt hervor Blitzesglanz, Donnergeroll, die Hinenui-te-po, sodann Inseln. Hier haben wir eine Kosmogonie in Form einer Theogonie. Noch andere Götter werden aufgeführt, deren Nachkommenschaft immer ihrer Funktion entspricht. So, wenn Tawhiri-ma-teas Geschlecht Erdbeben, Regenbogen, Hagel, Regen, Eis, Sturm, Kälte usf.; Tangaroas Aale, Muscheln, Hai, Walfisch, Seevögel usf. ist. Tu-mata-uenga, in Tiki als Mensch reproduziert, hat Rangis Tochter Kau-ata-ata zur Frau, das wäre also Eva, und von ihr zwei Kinder. Dann entwickelt sich das Geschlecht der Menschen weiter, und es findet sich darunter ein Matuika, Vater des Feuers, ein Fliegengott, ein Gott der Felssteine, ein Trawaru, Vater der Hunde. Die ganze Welt[S. 67] soll aus zehn Himmeln übereinander und zehn Erdschichten untereinander bestehen. In jenen sollen die Götter und Geister thronen — im höchsten weilt Rehua (für Rangi?) — im neunten, achten und siebenten die vergötterten Seelen in der Stufenfolge ihrer Bedeutung. Dann kommen die Untergötter, die Atua, zu denen auch Tawhaki (S. 17) gehört, die Halbgötter. Im vierten Himmel ist ein Lebensquell für Embryonen, im dritten (Nga-Roto) das Wasser über dem Firmament, im zweiten Regen und Sonnenschein. Der erste Himmel ist der feste und das Reich Tawhiri-ma-teas. Wie sich das mit dem auf S. 19 f. Mitgeteilten vereinen soll, kann ich nicht sagen. Auf die Schilderung der Erdschichten kommen wir zurück.
Fast noch verblüffender ist, was Bastian uns von der hawaischen Mythologie erzählt. Er hat auf Hawai in der Bibliothek des Königs (Kalakaua) ein aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts stammendes Manuskript „He Pule Heiau“ entdeckt, dessen Wortlaut er mitteilt und das ein Schöpfungsbild enthält. Die Welt ist mehrmals geschaffen. Die jüngste Schöpfung ging in acht Perioden vor sich. Bis zum Schluß der achten Periode herrscht Po, Finsternis, jedoch mit abnehmender Stärke, indem ein Schimmer stetig wächst. Erst dann tritt Ao, Licht, ganz hervor. Innerhalb dieser Perioden aber erscheinen erst Intelligenz, dann Abgrund (männlich und weiblich). Hierauf entstehen die Lebewesen, von unten nach oben sich entwickelnd. Zugleich füllt sich der Abgrund mit Erde, bis der Abgrund ganz verschwunden ist. Nun, in der achten Periode kommen der Mensch, als Urweib Lalai, indem sie „hervorwächst gleich einem Blatt“, und die persönlichen Götter. Das Weib verbindet sich erst mit den Urkräften, dann mit dem Sonnengott und mit Kane und Kii und anderen Göttern, woraus zuletzt das Heroen- und Menschengeschlecht hervorgeht. Das ganze ist eine Entwicklungsgeschichte, wobei immer zuerst das Geistige und dann das zugehörige Materielle entsteht, und sie wird bis in die historische Zeit hingeführt. Als Probe führe ich nach Bastian die zweite Strophe des Gedichtes an:
Die interessante einleitende Strophe dieser seltsamen Dichtung lautet:
Sehr klar ist das nicht. Es soll aber besagen, daß die neue Welt beginnt, nachdem die frühere zugrunde gegangen ist, daß dieses in tiefer, nur schwach durchschimmerter Finsternis geschieht, daß durch das Plejadengestirn (Makalii) die zukünftige Welt ideell durchleuchtet. Die letzten vier Verse, wenn sie nicht die Herkunft des Dunkels und der Nacht schildern sollen, verstehe ich nicht. Aber Bastian gibt selbst die Übersetzung mit dem größten Vorbehalt. Andere Erzählungen stimmen bis auf die Götterzugabe mit biblischen Angaben. Bastian freilich und Achelis erklären es lediglich aus der übereinstimmenden Denkweise der Menschen. Ich glaube aber nicht, daß das bei so speziellen Angaben, wie die Entstehung des Weibes aus der Rippe des Mannes, zulässig ist. Doch sei wenigstens hervorgehoben, daß eine Göttertrias, Kane, Ku, Lono, vorhanden ist, die[S. 69] alles schafft, Himmel, Erde, Sonne, Mond, Sterne und Lebewesen. Anderweitig ist Tangaroa oder Taaroa der Weltschöpfer, von dem bei den Marquesasinsulanern das von Moerenhout aufbewahrte Gedicht die höchsten Gedanken äußert:
Und dabei die doch zweifellosen Fetische, Götzen und Geister (Atua). Man muß annehmen, daß neben der Volksreligion, die, wie überall, im rein Konkreten haftet, auch eine höhere Anschauung vorhanden ist, die wenigen zugehört. Auch ist bekannt, daß oft die höheren Stände eine andere Religion haben als die niederen, sogar andere Fetische und Götzen. Und im übrigen stehen die sonstigen Sagen von jenen Göttern keineswegs auf sehr hoher Stufe. Selbst die Sage von Taaroa oder Tangaroa endet nicht sehr hoch. Wie es um ihn hell wurde, rief er den Sand der Küste zu sich. Dieser konnte aber nicht zu ihm fliegen. Dann rief er die Felsen zu sich. Auch diese vermochten es nicht, da sie festgewurzelt seien. Nun steigt er selbst zur Erde, und aus der Muschelschale, in der er bisher gehaust, macht er die Inseln, darauf zeugt er aus seinem Rücken die Menschen, wandelt sich in ein Boot und schwimmt auf dem Meere. Dort verspritzt er im Sturme sein Blut, worauf sich das Meer und die Wolken färben. Zuletzt wird sein Gerippe, „das Rückenbein oben, auf dem Boden liegend, eine Wohnung für alle Götter und zugleich das Vorbild für den Tempel.“ „Tangaroa wurde zum Himmel“, sagt Ratzel in seiner Völkerkunde. Man kann das zugeben, wenn man den Himmel nicht so anschaut wie wir es tun, und wenn man über alle Inkonsequenzen hinwegsieht, da ja ohne Tangaroa schon Land, Meer und Wolken vorhanden sind und man nicht recht begreift, wie[S. 70] dieser Gott da noch zum Himmel werden konnte. Auf Neuseeland ist Tangaroa recht indifferent als Gott der Meere, eigentlich der Tiere darin, und anderweit erscheint er auch als böser Geist, wie der ihm entsprechende Kanaloa. Auf die anderen besonderen Lehren einzugehen ist nicht nötig, nachdem wir die Höhen und die Tiefen kennen gelernt und gesehen haben, wie naiv große Gedanken mit skurrilsten Torheiten bei demselben Naturvolk bestehen können, was wir ja von uns selbst auch rühmen müssen. Auch habe ich weiteres Material schon in meinem mehrmals genannten Buche mitgeteilt.
Können wir nun sagen, daß die Naturvölker sich bis zu dem Gedanken eines Gottes in unserem Sinne durchgerungen haben, auch wenn wir ihre sonstigen Anschauungen beiseite lassen? Ich glaube, nein! Sie mögen bis zu einer Ahnung von etwas sehr Hohem und Übermächtigem gelangt sein. Einige unter ihnen mögen auch, namentlich unter fremdem Einfluß, bestimmtere Begriffe davon gefaßt haben. Aber im ganzen sind sie nicht einmal zu einem Polytheismus, wie ihn Ägypter oder Griechen hatten, gekommen. Der Omnanimismus und Pandämonismus ist die Grundlage ihrer Anschauungen, und das Bedeutendste ist eine Monolatrie innerhalb jener und innerhalb einer Polylatrie. Bastian selbst, der am meisten geneigt scheint, wenigstens den Polynesiern hohe Begriffe von Gott und Welt zuzuschreiben, meint, daß es sich bei ihnen nicht um Schöpfungen handelt, sondern um Aufblühen von Vorhandenem. Und der ganze Kult, den sie geübt haben und üben, mit allen Albernheiten und Grausamkeiten, ist ein greller Widerspruch gegen jeden höheren Begriff. Man hat zuerst die Anschauungen der „Wilden“ nicht hoch genug stellen können, dann nicht niedrig genug, und jetzt scheint man sie wieder erheblich zu überschätzen. Das erste kam aus Unkenntnis und theologischer Voreingenommenheit, das zweite aus Enttäuschung angesichts der Wirklichkeit, das letzte scheint auf Übertragung des Verhaltens des Naturmenschen unter dem Einfluß der Kultur oder unter dem Auge des Kulturmenschen auf Verhältnisse des isolierten Naturmenschen zu beruhen.
14. Seele und Jenseits bei den Naturvölkern.
Wir müssen zu den ursprünglichen Seelenansichten zurückkehren. Die Seele bedingt das Leben des Körpers, außerhalb des Körpers kann sie also nicht anders existieren, denn als lebend. Folglich lebt sie, solange der Mensch oder ein anderes Wesen es zuläßt. Der Mensch kann sie vernichten, indem er sie mit der Behausung, in der sie sich befindet, etwa dem Blut, dem Herzen, der Niere, dem Auge usf. verzehrt. Sie ist dann ganz in ihn aufgegangen, mit seiner Seele verschmolzen oder auch von seiner Seele verzehrt. Aus dieser Ansicht haben viele die Menschenfresserei erklären wollen, entweder, um seine eigene Seele zu stärken, sich zum Fetisch einer verwandten Seele zu machen, oder um schädliche und gefürchtete Seelen aus der Welt zu schaffen. Ein zweites Verfahren beruht auf Vernichtung des Körpers durch tiefes Vergraben oder Verbrennen, solange die Seele noch in ihm weilt, wenn auch nicht mehr aktiv. Ein drittes endlich läßt Seelen verkommen, indem ihnen die Bedürfnisse nicht gereicht werden, deren sie nicht entbehren können, wie Behausung, Speise und Trank. Die Umkehrung bedeutet die Konservierung der Seele, indem für ihre Bedürfnisse ständig gesorgt wird. Die harmlose Form ist, wenn ihr Behausung, Speise und Trank geboten werden. Und wir wissen, daß diese Form, vollständig oder unvollständig, bewußt oder unbewußt, bis weit in hohe Kulturen hinein zur Anwendung gelangt, bei den Naturvölkern aber jeder Seele, die erhalten werden soll, oder die man sich geneigt machen will, unmittelbar geboten wird. Noch klingt es harmlos, wenn dem Toten Gerät und Schmuck in das Grab getan wird, zum Gebrauch für seine Seele, und wenn man die Behausung seiner Behausung auf Erden anpaßt, in Form einer Höhle, einer Hütte, eines Palastes, eines Tempels, wie eben die Seele, da der Körper noch lebte, es gewohnt war. Beispiele sind auf der ganzen Erde verbreitet, von niedrigen Löchern und Hütten bis zu den Prunkbauten und Prunkeinrichtungen bei den Etruskern, Ägyptern, Chinesen u. a. Nun aber wird dem Toten auch[S. 72] Lebendes beigegeben, dessen seine Seele im Leben bedurfte, und hierin kennt die Konsequenz des Naturmenschen keine Grenze, außer dem Egoismus, der ihn hindert, alles fortzugeben. Tiere, Sklaven, Frauen, gefangene Feinde werden, lebend oder vorher getötet, mit begraben oder auf dem Scheiterhaufen mit dem Toten verbrannt. Je höherstehend der Verstorbene, desto umfangreicher diese Gaben; bei dem Tode eines Häuptlings wird Jagd nach Menschen gemacht, um die Gabe so groß als möglich zu gestalten. Mit einer armen Polyxena wie Achill würde sich ein Dahomeerhäuptling nicht begnügt haben, hier ging die Zahl der Schlachtopfer in die Hunderte und mehr. Und wie entsetzlich klingt, was Herodot von den Totengaben bei den Skythen erzählt und was wir auch von Germanen, Slawen, Kelten u. a. wissen. Die Seele sollte möglichst viele Seelen zum Genuß, zur Bedienung und als Gefolge bekommen.
Schwer kann das mit einer Ansicht verbunden werden, daß die Seele immer auf Erden verbleibt und im Grabe Hof hält oder in der Luft umherschwirrt oder gar in einen Fetisch fährt. Und so sehen wir in der Tat die Naturvölker, wenn auch einige wirklich glauben, die Seelen blieben auf der Erde so lange, bis diese selbst untergeht, im allgemeinen doch auch zu Aufenthaltsorten für Seelen greifen, die nicht der Erde selbst angehören. Und dazu eigneten sich vor allem Sonne und Mond und dann die Gestirne. Es ist daher ganz richtig, wenn gemeint wird, daß auch diese Himmelskörper als Fetische betrachtet und entsprechend verehrt werden (S. 39 ff.). Hier dürfen wir schon von einem „Jenseits“ sprechen. Aber Naturvölker kennen ein Jenseits überhaupt, entweder als Totenstadt, oder als Unterwelt, oder als Welt hinter dem Horizont, oder über dem Himmel. Totenstädte haben z. B. die Dajaks auf Borneo. Die Erweiterung wären Totenländer. Und Frobenius sagt: „Das Totenland liegt nicht nur sehr oft da, woher einst der Stamm kam, sondern die Ereignisse auf der Seelenreise entsprechen den Vorgängen der einstigen Wanderung. So ziehen die Seelen dieser Völker (der Ozeanier), die einst zu Boot über den Ozean kamen,[S. 73] im Kahne über das Wasser hin in das Land der Seligen.“ Darum, meint der Genannte, werden in Ozeanien die Toten häufig in Kanoes bestattet, was übrigens auch von Indianern bekannt ist. Grimm führt in seiner „Deutschen Mythologie“ an, daß die Asen „Balders Leiche auf ein Schiff brachten, in dem Schiff den Scheiterhaufen errichteten, anzündeten und so der flutenden See überließen.“ Und die Nordgermanen verbrannten noch im zehnten Jahrhundert ihre toten Seehelden auf dem Schiffe. Auch bei den Russen wird von einem Falle erzählt, wo ein Vornehmer in einem Kahne verbrannt wurde, und mit ihm, außer Pferden und Hunden, auch Mädchen verbrennen mußten. Ein unruhiger Störenfried, ein lästiger Geist wird von den Nikobaren im Geisterkorbe eingefangen, dieser auf ein Geisterschifflein gelegt und in die See hinausgerudert. Charons Totenkahn und das ägyptische Totenschiff sind ja bekannt. Indessen werden Seelen in das Jenseits namentlich auch von Vögeln befördert, ein Glaube, der auch den Griechen bekannt war, deren Harpyien und Sirenen Totenvögel (oder Seelenvögel) sind, wie selbst der Hahn bei ihnen Totenvogel sein kann. Die Griechen haben den Totenvogel allmählich zum Teil vermenschlicht, indem sie ihm zuerst menschliche Extremitäten, später umgekehrt einen menschlichen Kopf, mitunter von wunderbarer Schönheit, gaben. Die Naturvölker sind bei der einfachen Vogelgestalt geblieben, indessen doch oft unter Beimischung von etwas Menschlichem. Ist Yelch, der Rabe, ein Totenvogel der Nordwestamerikaner, wie Frobenius meint, so kann es auch ein Mensch in Vogelkleidung sein (S. 62). Andererseits holt Maui die Seelen der Vornehmen in die Sonne. Er wird aber mit Vögeln in Verbindung gebracht, da er sich auf seinen Fahrten so oft in einen Vogel, wie in ein anderes Tier, verwandelt. Ich stelle zwei Abbildungen nebeneinander, eine griechische „Harpyie“ oder „Sirene“ mit einer Seele als εἴδωλον auf dem Arme und einen nordwestindianischen Totenvogel, einen Mann und dessen ihm aus dem Munde entfliehende Seele tragend. Die Seele ist auf letzterer Darstellung als Schlange (S. 45) wiedergegeben, die aus dem Munde des Mannes[S. 74] gleitet. Totenkähne sind auch in Afrika bekannt. Nach der Sage der Ewe an der Nordguineaküste werden die Toten von Fährgeistern über den Fluß Volta gesetzt. Auf Totenvögel dagegen kann man nur aus den Opferungen von Hahn und Henne bei allen Totenfesten und bei manchen Fetischfeiern schließen. Den Australiern ist die Krähe Totenvogel, vom Totenkahn wissen sie gleichfalls einiges. Übrigens bringt Frobenius Totenkahn und Totenvogel in Verbindung, indem er nachweist, daß Totenkähne nicht selten mit Vogelschnäbeln und Vogelattributen versehen sind.
Allein, wo ist das Totenland des Jenseits? Frobenius meint, die Seele zieht der Sonne nach, wie bei den Ägyptern. Demnach wäre das Jenseits im Sonnenuntergangsland. Aber wie erwähnt, ist auch die Sonne selbst Seelenaufenthalt, so nach der Sage der Tahitier und Buschmänner. Barotse sollen Livingstone einen Hof um die Sonne folgendermaßen erklärt haben: „Die Bavimo (Seelen) halten ein Pitscho (Versammlung) ab; siehst du nicht den Herrn (die Sonne) in der Mitte?“ „Wenn Sonnenschein von Regen begleitet wird, sagen die Dahomeer, die Seelen zögen zu Markte.“ Nach den Ewe soll das Totenland eine Sandebene am Flusse Volta sein. Manche Indianerstämme setzen das Totenland weit im Westen an.[S. 75] Jede Seele wird an der Grenze von ihren Verwandten und Stammesgenossen erwartet und findet im Lande reichlich Wild zum Jagen und Flüsse zum Fischen. Andere wieder lassen die Seelen als Vögel die Milchstraße entlang ziehen, und nehmen ihren Aufenthalt über dem Himmel an. Die Melanesier nennen das Totenland Mbulu und beschreiben die Schicksale der Seele auf ihrer Wanderung dahin. Die Damen wird es interessieren, daß die Seelen Unverheirateter es ganz besonders schlecht dabei haben; ein Totengeist Nangga-Nangga hebt sie hoch und schleudert sie gegen einen Felsen, daß sie zerschellen. Aber weniger angenehm wird es sie berühren, daß darum auf den Fidschiinseln die Witwe erdrosselt wurde, damit sie sogleich mit ihrem Manne gehen konnte. Der Mann, wenn seine Frau starb, gab ihr als Beweis der Frauenschaft einen Teil seines Bartes unter die Achselhöhle mit. In das eigentliche Jenseits gelangt die Seele durch Schwimmen oder in einem unsichtbaren Kahn. Doch gelingt dieses fast nur den Seelen der Vornehmen, die der misera plebs gehen auf dem langen gefahrvollen Wege unter oder kehren zurück zur Erde, um hier planlos herum zu irren. Auch bei germanischen Stämmen geht es ins Jenseits über ein Wasser. Jakob Grimm führt mehrere Beispiele dafür in seiner „Deutschen Mythologie“ an. Eine schwedische Volkssage weiß von einem goldenen Schiff, das in Runemad beim Schlüsselberge versenkt liege, und auf dem Odhin die Erschlagenen von Bravalla nach Walhall geführt haben soll. Ein Unbekannter nimmt Sinfiöltis, Siegmunds Sohn, Leiche in einen Kahn und fährt davon. Franken glauben, daß das Totenland im (jetzigen) Britannien liegt, wohin die Seelen der Verstorbenen von den Uferanwohnern übergefahren werden, die dafür von allen Abgaben befreit sind. Die Fährleute sehen niemand, merken nur ihre Kähne voll, wenn sie um Mitternacht abstoßen. Angekommen fühlen sie die Kähne allmählich entlastet und hören eine Stimme jedem einzelnen Namen und Vaterland abfragen. Derartige Sagen müssen auch bei den Kelten bekannt gewesen sein, da noch gegenwärtig anklingende Erzählungen in der[S. 76] Bretagne in Umlauf sind. Aus dem keltischen Artuskreise bittet im Lanzelot vom See die Demoiselle d’Escalot „que son corps fût mis en une nef, richement équippée, que l’on laisserait aller au gré du vent sans conduite.“ Ich habe dieses gleich hier angeführt, weil ich mich später darauf berufen will. Die griechische Sage von der Überfahrt auf Charons Nachen gehört, glaube ich, nicht ganz in diesen Kreis, da die Überfahrt schon in der Unterwelt, wenn auch noch vor dem Seelenaufenthalt, geschieht.
Ganz abweichend davon, aber wiederum mit anderen weitverbreiteten Anschauungen über den Seelenaufenthalt in den großen Zügen in Einklang stehend, ist was Bastian von dem Jenseits der Maori erzählt, und was sich fast wie eine abgekürzte Dantische Höllenbeschreibung liest. Die Erde besteht, wie schon bemerkt, aus zehn Schichten. Die oberste Schicht ist die Erde selbst. Die folgende Schicht gehört dem Reiche der Wurzeln und Knollen. Mit der dritten Schicht, Reinga, wo auch die Nachtgöttin Hine-nui-te-po weilt, hebt das eigentliche Totenreich an. Bis dahin sind die Seelen noch lebens- und empfindungsfähig und können zur Erde zurück und dort noch viel Unheil anrichten. Aber nun beginnen die Kräfte mehr und mehr zu schwinden. In der fünften schon kann die Seele zu einem bleichen Schatten geworden sein, alsdann fällt sie der rachsüchtigen Göttin Rohe, ursprünglich Mauis Gemahlin, zur Beute und wird getötet. Kann sie noch entkommen, so gelangt die Seele mit immer weiter abnehmenden Kräften in die sechste, siebente Schicht. Wenige taumeln in die achte Schicht, wo sie zum Teil vom Gotte Meru vernichtet werden, noch weniger in die neunte, um von da in die letzte Schicht Meto = Verwesungsgestank zu stürzen, wo alles endet. „Das waren die Aussichten nach dem Tode, also noch trauriger als sie Odysseus bei seinen Waffengefährten im Hades fand“, sagt Bastian. Der Eingang zu dieser Unterwelt befand sich auf der Nordinsel von Neuseeland, im Nordkap, der Weg soll wieder westwärts führen. Freundlicher sehen selbst die Australier das Jenseits an, die Guten ziehen zu den guten Geistern, die Bösen zu den bösen.[S. 77] Oder die Seelen sitzen auf Bäumen oder weilen in einer Höhle. Bei den unkultivierten Malayen führt der Weg in das Jenseits über oder unter Meer, und sie müssen mit Waffen und Gefolge und mit Bestechungsmitteln ausgerüstet sein, um die Gefahren von Geistern und Höllenhunden besiegen zu können, ehe sie in das Paradies gelangen. Oder, die eines natürlichen Todes sterben, gehen nach Norden und bleiben dort in einem Walde, „dessen Bäume sich beim Einbruch der Dunkelheit in Hütten verwandeln.“ Dort leben sie „aus den unsichtbaren Bestandteilen der Tiere, aus Reis und den Opfergaben der Verwandten“, letzteres wie überall. Die eines unnatürlichen Todes, im Kampfe oder während der Entbindung Gestorbenen kommen zu den Göttern.
Fassen wir die Frage vom Schicksal der Seele nach dem Tode ethisch auf, so muß es auffallen, wie verschieden die Antworten sind. Dem absolut Hoffnungs- und Freudlosen der Maori steht das fast Vergnügliche der Indianer gegenüber. „Soviel scheint festzustehen,“ sagt Spieß in seinem umfangreichen Werke „Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode“, „daß alle Elemente von Schrecken oder Furcht vor der anderen Welt der ursprünglichen Religion der Indianer fremd waren. Nur einzelne Spuren einer notwendigen oder vermutlichen Reinigung und Vergeltung finden sich. Meist aber besteht der Unterschied zwischen Guten und Bösen nur darin, daß jene ohne alle Schwierigkeit über den See oder Fluß gelangen, welchen man vor dem Betreten der anderen Welt passieren muß, diese entweder in dem Wasser untergehen oder bis zum Kinn in das Wasser sinken, wo sie in alle Ewigkeit vergeblich das nahe lockende Gestade zu erreichen sich abquälen, oder aber, daß sie erst nach schwerem Ringen an das Gestade kommen.“ Also das Ausbleiben des Gewinnes ist die Strafe (Tantalusqual!). Im übrigen hat schon Schiller in Nadowessiers Totenlied treffend das indianische Jenseits geschildert. Dazwischen liegen vermittelnde Ansichten, wie bei den Eskimo, daß die Seelen der Guten in die warme Erde, die der Bösen in den eisigen Himmel gelangen. Eine höchst interessante Umkehrung unserer An[S. 78]sichten, die aus der Natur des Landes sich erklärt, das die Eskimo bewohnen, und Carus Sternes (Ernst Krauses) Warnung durchaus bestätigt, Mythen ohne Rücksicht auf die Lebensverhältnisse zu erklären. Eine entsprechende Umkehrung hat man bei den früheren Negersklaven in Amerika beobachtet. Während der freie Neger in Afrika das frohe Jenseits im Westen sucht, besteht für den amerikanischen Negersklaven dieses Jenseits im Osten, in Afrika, und viele haben sich bei zu drückendem Joche getötet, um nach Afrika zurückzugelangen und dort frei als Seelen zu leben (S. 43). Es läßt sich nicht leugnen, daß manche Naturvölker strenge Bestrafung der Bösen im Jenseits oder auf dem Wege dahin allerdings annehmen, und Belohnung der Guten. Aber sie definieren Gut und Böse nach ihrer Art. Und das kommt, wenn es wohl geht, auf tapfer und feige heraus, wie bei den Germanen. Meist steht es mit dem „Gut“ nach unseren Begriffen sehr übel. Dazu rechne man noch die selbstverständliche Bevorzugung der Vornehmen auch im Jenseits, wovon eine Spur auch im Homer noch erhalten ist, wo Achill im Hades, wenn auch Schatten, doch Übergeordneter der Schatten ist, um Paradies und Hölle der Naturmenschen von denen der Kulturmenschen erheblich zu scheiden. Doch kommt es gedanklich darauf nicht an; die Idee entscheidet hier, nicht ihre Übereinstimmung mit dem, was wir meinen.
Viel weniger als um das Schicksal der Seele nach dem Tode ist der Naturmensch bekümmert um ihr Weilen vor dem Leben. Was mit der Seelenwanderung zusammenhängt, werden wir später besprechen, da eine solche bei den Naturvölkern nur so weit vorhanden ist, als die Seelen an sich beliebig sich von einem Körper in einen anderen begeben können. Aber selbst das genügt schon, um zu überzeugen, daß sie schon früher auf Erden gewesen sind und nun zurückgekehrt seien. Darum erzählen viele Sagen von Menschen, die im Jenseits geweilt haben, und dann wieder zur Erde gelangt, eine vollständige Beschreibung des Jenseits geben konnten. Manche solcher Beschreibungen verlaufen wie die von Orpheus und Eurydike; so eine sehr anmutige Geschichte von einem Indianer,[S. 79] der, da seine Geliebte starb, ihr in das Jenseits folgte, aber durch den großen Geist wieder auf die Erde geschickt wurde. Und irgendwo habe ich gelesen, daß es einem Europäer, der ein Negermädchen zur Frau nahm, auf keine Weise gelang, ihr auszureden, sie sei nicht schon früher unter gleichem Namen und unter gleichen Verhältnissen auf der Erde gewesen. Das ist nicht die bekannte Metempsychose, sondern eine dem Naturmenschen mehr passende Resurrektion. Indessen kommen die Seelen auch in anderer Weise zur Erde. Und zwar nach dem, was Frobenius das Gesetz der Umkehrung nennt. Dieselben Mittel, die die Seele ins Jenseits befördern, bringen sie auch auf die Erde. Also sind namentlich Vögel zugleich Seelenbringer. Bei den Tonganern und Samoanern bringt Tuli als Vogel die Seelen in die Menschenkörper, ja sogar in Würmer. Die Neuseeländer erzählen, daß einst ein gewaltiger Vogel sich auf das Meer senkte und dabei ein Ei fallen ließ; aus dem kamen „ein alter Mann und eine alte Frau, ein Knabe und ein Mägdlein mit Hund und Schwein in einem alten Kanoe hervor und landeten an der Küste Neuseelands.“ Soviel lebende Kraft wohnt den Vögeln inne, daß aus einem Vogel die ganze Erde samt allem Lebenden auf ihr hergestellt wurde, erzählen Malaien auf Sumatra. Hierher gehört auch eine Sage bei den Australiern, daß die Sonne ursprünglich ein Emuei gewesen sei. Ein kleiner Vogel richtete es her und warf es in die Luft, da wurde es hell. Darum dienen Vögel und ihr Blut zu Opfern und symbolischen Handlungen, wo es sich um Belebung und Befruchtung handelt, so daß sogar Fetischbilder, durch Versenken eines Huhnes in ihr Inneres, oder durch Bestreichen mit Vogelblut — man erinnere sich, daß im Blut die Seele wohnt — oder selbst durch Umwinden mit Vogelfedern belebt werden. Brautleute werden in Afrika mit Vogelblut bestrichen, um sie fruchtbar zu machen, und in Felder werden Vogeleier versenkt, daß sie möglichst ertragfähig werden. Und an unseren Freund Storch darf nur erinnert werden.
ZWEITES KAPITEL.
Religiöse Welt- und Lebenanschauungen der Kulturvölker.
15. Die Kulturvölker als Naturvölker.
Daß die gegenwärtigen und vergangenen Kulturvölker einst auf dem Standpunkte der Naturvölker sich befunden haben, kann kaum einem Zweifel unterliegen. Freilich treten uns die meisten Kulturvölker, sobald ihre Geschichte beginnt, schon wie kulturfertig entgegen. Es gehört zu den großen Rätseln der Menschenentwicklung, daß zum Beispiel die Ägypter mit einem Schlage als das Volk dastehen, als welches sie dann mehrere Jahrtausende die Geschichte kennt. Brugsch hat dieses für ihr ganzes Religions- und Mythensystem nachgewiesen. Wir wissen es in gleicher Weise für ihre Kunstfertigkeit, für staatliches und soziales Leben. Und in dem Moment, da für uns die erste Hieroglyphe geschrieben ist, steht sie bis auf Geringfügigkeiten, die nur die Ausführung betreffen, vollendet da. Wie das Volk die Hieroglyphe gelernt hat, wie seine Bauten, Einmeißelungen, Malereien, Einrichtungen des Staates und des Lebens, Meinungen über Gott und Welt begonnen und sich entwickelt haben, ist uns nicht bekannt. Wir müssen annehmen, daß die Ägypter Tausende von Jahren gebraucht haben, ehe sie es zu der Stufe der Kultur gebracht haben, von der aus die ersten und die letzten Kundgebungen in fast gleicher Weise sprechen. Warum haben wir aus diesen Tausenden von Jahren gar keine Mitteilung? Wir wissen es nicht. Das Volk steht fertig da, als wenn es fertig plötzlich geschaffen wäre. Es könnte in dem Moment, da der erste König herrschte, das erste Bauwerk errichtet wurde, eben eingewandert sein. Davon aber wird nichts erzählt; im Gegenteil, wir haben den Eindruck, als wenn Ägypten immer von Ägyptern bewohnt gewesen sei, und finden auch sonst nirgends eine Spur, daß diese etwa früher in anderen Ländern geweilt hätten. Und doch[S. 81] wissen wir aus prähistorischen Funden auch in Ägypten, daß in grauer Zeit, vielleicht vor zehn- oder zwanzigtausend Jahren, Menschen auf sehr niedriger Kulturstufe im Niltale gelebt haben. Sind es die ältesten Ägypter? Ähnlich geht es uns mit den Babyloniern, Phöniziern, Hebräern, ja selbst mit den Griechen nach den Ergebnissen der Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte. Es ist, als wenn die Menschheit vor etwa fünf- bis sechstausend Jahren auf einmal auf die Idee gekommen wäre, zu schreiben und Denkmäler zu hinterlassen, so fest errichtet, daß sie sich bis auf uns erhalten konnten. Ist das die Erfindung eines Mannes bzw. mehrerer erleuchteter Männer? Oder wie sollen wir uns das sonst erklären? Max Müller bringt einmal als Beweis dafür, daß die Schriften des Alten Testaments nicht in sehr früher Zeit verfaßt sein können, die Tatsache bei, daß eine der ältesten Inschriften in semitischer Sprache, die wir besitzen, die bekannte des Edomiterkönigs Mesa, nur etwa in das Jahr 900 v. Chr. hinaufreicht. Aber wenn ein König solche Inschriften schon anfertigt, muß er doch voraussetzen, daß man sie allgemein auch zu lesen versteht, muß die Schreibkunst doch schon fast Gemeingut geworden sein. Und wie viele Jahrhunderte gehören dazu, nach Erfindung der Schreibkunst! Aus unserer eigenen Erfahrung müssen wir sagen, mindestens zehn, wenn nicht noch mehr.
Hiernach bleibt uns allerdings nichts übrig als anzunehmen, daß die Kulturen solcher Völker weit über die geschichtliche Zeit hinaus vorhanden waren, wenn wir auch keine Kunde von ihnen aus dieser extrapolierten Zeit besitzen und auch nicht anzugeben vermögen, warum wir sie nicht besitzen. Die Entwicklung der Menschheit ist mit einer Formel zweifellos nicht abgetan. Einzelne stören offenbar den Gang der Formel, und wohin dieser Gang Menschen erst in Jahrhunderten oder Jahrtausenden bringen würde, dahin versetzt sie überzeugend oder gewaltsam eben ein Einzelner. Dürfen wir aber auch nur im Durchschnitt sprechen, so ist doch gleichwohl sicher, daß rohere Zustände und selbst ganz rohe bestanden haben müssen, falls wir nicht jeden Gedanken einer Entwicklung der Menschheit aufgeben wollen.[S. 82] Denn damit ein einzelner erfolgreich wirken könne, dazu gehört schon eine gewisse Höhe der Kultur. Und die Zeit dazu haben wir, wenn wir bedenken, daß die Menschheit als solche, selbst wenn sie mit den jetzigen tiefststehenden Wilden verglichen wird, schon seit mindestens zwanzigtausend Jahren, wahrscheinlich sogar noch seit sehr viel längerer Zeit besteht, da man bereits dem tertiären Menschen auf der Spur ist. Auch kennen wir ja Völker, die sich zu Kulturvölkern entwickelt haben, wie Germanen, Polen, Littauer usf.
Eine Grenze zwischen dem Naturmenschen und dem Kulturmenschen aufzustellen, sind wir nicht in der Lage; die Naturperiode fließt wie ein mehr und mehr an Fülle verlierender Strom in die Kulturperiode hinein. Und man darf selbst sagen, daß dieser Strom unter eine gewisse Fülle überhaupt nicht hinabsinkt, ja auch an Fülle wieder anwächst, nachdem er schon stark abgenommen hat. Wir besitzen es mehr im Gefühl als in Definitionen, welches ein Kulturvolk ist und welches ein Naturvolk. Der Gesamteindruck entscheidet, im einzelnen können reine Naturäußerungen im höchsten Kulturvolk vorhanden sein. Daher wird der Naturforscher über Kultur anders denken wie der Philosoph oder Theologe, oder Ökonom oder Literat usf., und wer Krieg und Menschenvernichtung verabscheut, anders als der in seinem Kriegsleben einzigen Ruhm und einziges Menschenwürdige sieht. Wir würden uns in ein nicht zu entwirrendes Netz von widersprechenden Meinungen verstricken, wollten wir ein Merkmal für Kultur aufstellen. Selbst das anscheinend Selbstverständlichste: sittliche Höhe und Achtung vor Gottes Ebenbild und Gottes Geschöpfen würde fehlschlagen, da wir größte Verkommenheit und Nichtswürdigkeit durchaus mit dem, was wir Kultur nennen müssen, vereinbar sehen, wie an den Höfen der ersten römischen Kaiser und der drei Herrscher vor Ludwig XVI. in Frankreich. Auch genügt es für unsere Zwecke, wenn wir als Kulturvölker die sonst als solche namhaft gemachten annehmen. Es kommt für unsere Betrachtungen nicht darauf an, ob wir ein Volk mehr oder weniger in den Kreis der Kultur einbeziehen.
Nur in einer Hinsicht müssen wir vorsichtig zu Werke gehen, in historischer. Mißverstandener Nationalstolz und namentlich Eitelkeit im Kreise wirklicher Kulturvölker hat einzelne Nationen verleitet, den Anfang ihrer Kultur möglichst weit in die dunkelsten Zeiten hinauszuschieben; ein Seitenstück zu dem wunderlichen Bestreben mancher Herrschergeschlechter, die Abstammung wenigstens auf die Trojaner zurückzuführen. Lippert ist der Ansicht, daß slawische Schriftsteller, um ihrem Volk eine Art urarische Mythologie mit daran anknüpfenden hohen Anschauungen zu retten, nicht einmal vor Korrigierung von Urkunden zurückgeschreckt sind. Ich habe darüber kein Urteil. Aber als ich das wohl umfassendste Werk über slawische Mythologie las, das von Hanusch, mußte ich gleichfalls staunen, mit welcher Energie und Kunst überall Beziehungen zu der altindischen Religion bis in die Namen hinein gefunden wurden, während größte Gelehrte noch jetzt sich damit plagen, einen oder zwei Götternamen als wenigstens dem größten Teil der Arier überhaupt gemeinsam nachzuweisen. Ähnlich verhält es sich mit den Ungarn, denen Monotheismus und alle schönen Tugenden zugeschrieben werden zu einer Zeit, da sie als wildeste Wildenhorde Deutschland, Italien, Frankreich mit Mord, Brand und Schändung erfüllten. Auch wir Deutschen sind von solchem Chauvinismus nicht frei; viel ist bei uns in bezug auf die alten Germanen gesündigt worden und noch mehr wird gegenwärtig gesündigt. Aber wir haben doch einen Tacitus als Kronzeugen. Wer über die Anschauungen der Völker schreiben will, hat mit nationalistischen Übertreibungen sehr zu kämpfen, daß er schließlich fast um jede kritische Beurteilung gebracht wird. Ein seltsames Beispiel von fast verwunderlichem Chauvinismus bietet das sonst geistvoll geschriebene Buch von Chamberlain, „Die Grundlagen der Kultur des 19. Jahrhunderts“.
16. Allgemeine Religionsanschauungen bei den Kulturvölkern im Kreise der Menschheit.
Man ist früher von dem klassischen Polytheismus und dem Monotheismus als von dem Normalfall menschlicher[S. 84] Religionsanschauung ausgegangen und hat die Anschauungen der „Wilden“ mehr als Kuriosität oder helle Verrücktheit angesehen. Aber mit der wachsenden Ausbildung der Ethnologie und Anthropologie hat sich eine Wendung vollzogen, die nicht wenige Forscher dahin führte, gerade die Anschauungen der Wilden zum Ausgangspunkte der höheren Anschauungen zu wählen und diese aus jenen abzuleiten. Das konsequenteste System nach dieser Richtung hat Lippert aufgebaut. In mehreren Werken hat er nachzuweisen gesucht, wie fast alle Kulturvölker noch in der Zeit, da schon die Geschichte von ihnen spricht, im wesentlichen bewußtem oder unbewußtem Seelen- und Ahnenglauben gehuldigt haben. Man kann sagen, die Tatsachen, die dieser so bedeutende Forscher beigebracht hat, seine Ansicht zu begründen, sind nach einer Richtung hin allerdings erdrückend. Es ist ganz unmöglich, ihrer Beweiskraft, daß Seelen- und Ahnenglaube in allen Religionen der Kulturvölker sich vorfinden und eine mehr oder minder wichtige Rolle spielen, sich zu entziehen. Ich habe ja bereits manches nach ihm selbst, nach Jakob Grimm und vielen anderen in den vorstehenden Abschnitten vergleichend angeführt. Und dieses schon, wenn auch nicht vollständig beigebracht, zeigt, wie die gleichen Ideen sich auf der ganzen Erde verbreitet finden. Aber, wie bei Ausführung einer jeden neuen Idee, gehen Lippert und seine Anhänger, wie ich glaube, vielfach zu weit, wenn sie die Religionsanschauungen mit Seelen- und Ahnenglaube für erschöpft halten, und alles weitere, was die Menschen etwa noch gedacht haben, daraus hervorgegangen ansehen. Die Frage spitzt sich zu der zweiteiligen zu: Kann Polytheismus sich aus Seelen- und Ahnenglaube entwickeln? Kann Monotheismus auch nur aus Polytheismus erwachsen? Ich werde mich mit dieser Doppelfrage später beschäftigen. Lippert aber bemüht sich überall den Seelen- und Ahnenkult nachzuweisen, entweder als allein bestehend, oder als einzige Grundlage der weiteren Anschauungen, oder als neben diesen letzteren Anschauungen fortdauernd und oft sie vertretend. Namentlich auf die Folgen des Seelen- und Ahnenglaubens kommt es dabei an: auf die[S. 85] Annahme von Seelenwesen (Geister, Nixen, Feen, Kobolde, Zwerge, Holde, Unholde, Gespenster, Dämonen, Teufel usf.), von Mineral-, Pflanzen-, Tier-, Menschenfetischen, von Orakeln, auf den Kult, der allem Voraufgenannten gewidmet wird, einschließlich der Bestattungs- und Grabgebräuche, und der Toten- und Seelenfeste, auf Menschenopfer und Kannibalismus, einschließlich der Blutgebräuche. Schon diese Aufzählung lehrt jeden, der Sagen, Märchen und Gebräuche der Völker kennt, daß keine Kultur frei von dem einen oder anderen Naturmenschlichen sich zeigt. Worauf es aber ankommt, ist der Nachweis des Ganzen, oder doch alles Wesentlichen; letzteres, weil Sitte oder Vorteil manches mildert oder entfernt, wie zum Beispiel Menschenopfer und Kannibalismus.
Gehen wir nun auf das einzelne ein, so wird von Lippert vielen Kulturvölkern in ihrer geschichtlich heidnischen Zeit jeder andere Glaube als Seelen- und Ahnenglaube überhaupt abgesprochen. Den Littauern soll ein eigentlicher Götterglauben fehlen; was von ihnen erzählt wird, weise nur auf reinen Seelen- und Ahnenkult hin. Und es sei nicht denkbar, daß, wenn ein Volk, das vor noch nicht sechshundert Jahren zum Christentum bekehrt worden ist, eine Götterlehre besessen hätte, diese ihm in so kurzer Zeit so ganz aus dem Gedächtnis hätte schwinden können, und daß nicht einmal Chronisten und Missionare von ihr berichtet hätten. Von den zwei bestimmt überlieferten Gottheiten, Perkunas und Zemina, sei die erste wahrscheinlich nordgermanischen Ursprungs und importiert, die andere zweifelhafter Qualität.
Von den Anschauungen der heidnischen Slawen hegt Lippert die gleiche Ansicht. Hier ist besonders interessant, was er von dem bekanntesten Slawenkult, dem des Swantewit auf Rügen, ausführt. Die genaue Beschreibung, die Saxo Grammaticus von diesem Kult gibt, bietet ihm selbst die Handhabe, im Swantewit nichts anderes zu sehen als einen Ahnen, der in der Weise der Naturvölker verehrt wird, also nicht etwa einen Himmels- oder Lichtgott, als der er nach der ersten Silbe seines Namens, welches Licht, Welt bezeichnet, von andern gedeutet worden ist. Diesen Namen erklärt er[S. 86] als „der der Swantower“, womit ebensowohl eine Familie wie eine Familiengemeinschaft bezeichnet sein konnte. Und eine Hauptstütze für seine Ansicht ist ihm das mit dem Kult verbundene Orakel, bei dem ein Roß, Swantewits Roß, die Hauptrolle spielt. Das Roßorakel ist auch bei den Germanen bekannt. Tacitus gibt darüber eine Auseinandersetzung, wonach kein anderes Orakel bei ihnen ein so großes Vertrauen genießt, denn sie halten sie (die Rosse) für die „Mitwissenden der Götter“. Hiernach wird das Roß für eine Art Tierfetisch erklärt. Damit vergleiche man aber, was die slawischen Mythographen lehren. Hanusch findet also in den Anschauungen der Slawen Übereinstimmung mit indischen und eranischen höchsten Lehren. Die Trimurti Brahma, Wischnu und Schiwa entsprechen ihm Piorun-Proven, Radegast, Porenut (als gutes Prinzip, wie auch die Göttin Siva; die Göttinnen Morana und Ubijica als verderbliches) als Triglav. Bei den Preußen: Perkun, Potrimbo, Pikollo. Ja die Übereinstimmung gehe so sehr ins einzelne, daß Piorun mit dem physischen, Proven mit dem geistigen Brahma übereinkomme, Piorun-Proven die physische und geistige Lichtgottheit darstelle, Radegast in gleichen Inkarnationen (Awatar) erscheine wie Wischnu, und die welterhaltenden und weltzerstörenden Eigenschaften Schiwas in entsprechenden Gottheiten nachgewiesen werden! Die Gleichheit mit den eranischen Anschauungen soll durch Bjelboh und Czernyboh gegeben sein; ersterer Ormuzd, letzterer Ahriman. Der Weiße Gott und der Schwarze Gott sind allerdings slawische Gewalten, die dem eranischen Dualismus entsprechen, aber nicht entfernt mit der hohen Bedeutung wie Ormuzd und Ahriman; sie unterscheiden sich wenig von gutem Geist und bösem Geist, immerhin ist die Kongruenz bemerkenswert. Swatowit und besondere Kundgebungen von ihm wie Swenteboh, Witislaw, Harowit, Rugiewit, Porewit, Jutreboh usf., die teils Friedensgötter, teils Tages- und Tageszeitengötter, auch Morgen- und Abendsterngötter sein sollen, emanieren von Belboh als dem Lichtgott; Wrag, Zlyboh von Czernyboh. Das Zutreffende dieser Parallelisierung wird außer an den Eigenschaften der Gottheiten auch an entsprechenden Festen[S. 87] der Eranier und der Slawen zu erweisen gesucht. Nun wird noch behauptet, daß die slawischen Anschauungen gewissermaßen die Verschmelzung der indischen und der eranischen darstellen. Bei den Preußen und Littauern soll Auschwe die Lichtgottheit, Puskaijtis die Finsternisgottheit bedeuten. Und es werden noch die bekannten indischen Göttinnen mit littauischen parallelisiert: Maja = Laima, Lakschmi = Lada, Parwati-Bhawani = Liethva (slawisch Baba), Saraswati = Perkunatele, Kali = Niola. Hanusch erkennt auch eigentlich slawische Elemente in der slawischen Götterlehre an. Und diese sollen sich beziehen auf eine Übertragung in die Natur der mehr abstrakten Begriffe, die ursprünglich jene Gottheiten bedeuteten, also auf eine Art Vermaterialisierung der altindisch-eranischen Anschauungen. „Das Äußere der Natur (ὕλη) war im Bewußtsein der Slawen das eigentliche Sein und wurde belebt von einem allgemeinen Geiste, der in den einzelnen äußeren Individuen als individueller Geist erschien. Doch war dieser Geist nichts anderes als eine Personifikation des Lebensprozesses, den man der Analogie nach zum Unbelebten hinzudachte.“ Das klingt fast wie im Geiste des Animismus gesprochen. Und hierher gehört auch das Zugeständnis von irdischen (und unterirdischen) Gottheiten neben oberirdischen und das der Anthropomorphisierung der Gottheiten (der Sonne, des Mondes, der Gestirne, des Wetters usf.), welche letztere in unzähligen Sagen und Liedern eine oft recht anmutende Rolle spielt. Das Ganze kommt auf einen Naturdienst heraus, mit mehr oder weniger wuchtigen Naturgewalten und mit einem unübersehbaren Heer von guten und bösen Geistern, dem sich ein Dienst von Schutzgeistern für alle Verhältnisse und Tätigkeiten des Lebens anschließt. Aber das alles liegt doch weit ab von dem Seelen- und Ahnenglauben, den Lippert den Slawen allein zugestehen will. Seelen Verstorbener als Gespenster und Dämonen kannten die Slawen auch nach Hanusch. Auch behandelten sie die Seelen mitunter wie die eigentlichen Naturvölker, gaben ihnen Grüße an früher Verstorbene mit, empfahlen ihnen geselliges Betragen gegeneinander usf. Ihre Gottheiten aber sind weder[S. 88] Seelen noch Ahnen. Ich weiß den Widerspruch nicht zu lösen; wieviel Unzutreffendes und gewaltsam Hineininterpretiertes auch in den Bearbeitungen der slawischen Mythologie durch slawische Schriftsteller vorhanden sein mag, alles kann unmöglich erfunden sein. Dagegen spricht schon, daß gegen den Dualismus Belboh-Czernyboh sich nichts einwenden läßt, er ist zu gut durch Schriftsteller und noch vorhandene Sagen und Lieder bezeugt. Hanusch hat zu wenig vom Kult (und den Gebräuchen), Lippert zu wenig von der Mythologie gesprochen. Bei Berücksichtigung beider, des Kultes und der Mythologie, wird man wohl den heidnischen Slawen und Littauern mehr die Anschauungen der Naturvölker zuschreiben, jedoch mit nicht wenigen höheren Ideen. Ob die letzteren ein Überrest der früheren Verbindung mit Indiern und Eraniern sind, wie Hanusch will, oder ob sie sich später ausgebildet haben, läßt sich nicht sagen.
Noch schwieriger ist es natürlich mit den Germanen. Cäsar hat im 21. Kapitel des VI. Buches seines „Bellum Gallicum“ eine sehr wegwerfende Bemerkung über ihre Religionsanschauung gemacht. „Deorum numero eos solos ducunt quos cernunt et quorum aperte opibus juvantur, Solem Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt.“ Also nur was sie sehen: Sonne, Feuer, Mond, und aus dessen Macht sie offensichtlich Nutzen ziehen, verehren sie. Das wäre freilich rein der Standpunkt des Naturmenschen, der auch alles nur körperlich auffaßt und es nur beschenkt, wenn ihm eine größere Gegengabe geleistet wird. Tacitus denkt aber über die Germanen erheblich besser. Er schreibt freilich 150 Jahre später, als die Germanen schon vieles an Kultur angenommen hatten. Allein er bringt auch sehr altes und einheimisches Material bei, da er wenigstens einigemal germanische Bezeichnungen benutzt. Er sagt nun im zweiten Kapitel seiner „Germania“, die Germanen feierten in alten Liedern „Deum Tuisconem, terra editum, et filium Mannum originem gentis conditoresque“, und erzählt nun wie Mannus drei Söhne hatte, aus denen die bekannten drei deutschen Hauptstämme seiner Zeit hervorgingen. Also jedenfalls sind[S. 89] die Germanen Nachkommen von Tuisco und Mannus. Von Mannus meint Jakob Grimm: „Kein Name kann deutscher klingen“. Aber was er ideell bedeutet, darüber besteht schon Streit. Der große Mythologe schreibt ihm einen tieferen Sinn zu: als „ein denkendes, seiner bewußtes Wesen“ bezeichnend. „Mannus aber ist der erste Helde, der Gottessohn und aller Menschen Vater“, und er parallelisiert ihn mit dem indischen Manus, der nach einer Version, auf Brahmas Geheiß, alle Geschöpfe, Götter, Asuren und Menschen schaffen sollte und alle Welten, Bewegliches und Unbewegliches. Dann wäre also der germanische Mannus etwas sehr Hohes. Aber wie paßt der Vater Tuisco dazu, der selbst aus der Erde hervorgegangen, also eine Art Erdgeist ist? Der Name ist nicht sicher, es bestehen infolgedessen auch viele Deutungen für den Gott. Die höchste geht auf den Himmel und setzt den Gott, dem Sinn und der Stellung nach, dem Uranos, dem Namen nach (Tivisco, Tuisco) dem Zeus an die Seite. Die Erde spielt dann die Rolle der Gaia, die auch Uranos und Pontos geboren haben soll. Die niedrigste wählt natürlich Lippert. Eine mögliche Lesart ist nämlich auch Tiusco. Grimm stellt sie mit Tivisco zusammen, was eben jene höchste Bedeutung ergibt. Lippert findet etymologisch als Bedeutung „Geist“ angemessener. Und indem Mannus einfach als „Mann“ erklärt wird, ist Tiu sein Schutzgeist, und somit der aller Germanen, und Tiusco bedeutet ein „Geistwesen“, wie Mannisco ein „Mannwesen“, ein „Mensch“. Damit wären wir wieder auf den Ahnen und dessen Seele gekommen.
Tacitus sagt ferner: „Deorum maxime Mercurium colunt.“ Es wäre eine ganz anmutende Hypothese des genannten Forschers, daß dieser Merkur ein Viehschutzgeist ist, da ein Teil der Germanen noch nomadische Viehzucht betrieb, und dieser Deutung von seiten der griechischen und römischen älteren Mythologie keine Schwierigkeiten entgegenstehen. Aber Cäsar erzählt auch von den Kelten, daß ihr höchster Gott Merkur gewesen sei, und die Kelten waren keine nomadischen Viehzüchter. Herodot teilt mit, daß die Thrakerkönige am meisten Hermes verehren und von ihm abzustammen behaupten. Auch[S. 90] hier wird man Viehzucht als Motiv nicht annehmen können. Indessen gibt vielleicht Cäsar selbst die Erklärung: „Hunc omnium inventorem artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur“. Und da Tacitus zur Einführung Merkurs bei den Germanen genau derselben Formel sich bedient wie Cäsar zu der bei den Kelten (nur deorum statt deum), so wird er wohl auch an Cäsars Erklärung gedacht haben. Bekanntlich wird seit Paulus Diaconus Wotan für Merkur genommen, und auf diesen paßt Cäsars Erklärung einigermaßen, die sich auf einen Erfindungs-, Wege- und Handelsgott bezieht. Tacitus mag auch noch gewußt haben, daß Wotan auch Tote (erschlagene Helden) in sein Reich geleitet, also als Psychopompos wirkt, und weiter, daß er auch Sturmgott ist, wie Hermes bei den Griechen ursprünglich einen Windgott bedeutete. Und daß Wotan der größte Gott war, würde auch stimmen; dem Merkur namentlich sollen Menschenopfer gebracht worden sein, wie Tacitus erzählt. Gleichwohl braucht darum Lipperts Ansicht noch nicht unrichtig zu sein, daß es sich um einen Ahnengott handelt, denn alles was aufgezählt ist, als in das Bereich dieses Merkur fallend, übertrifft nicht, was auch ein Naturmensch einem höchsten Fetisch zuschreibt. Ja, wenn wir sehen, wie Jakob Grimm mit so vielen Beispielen belegt hat, daß die Deutschen noch im Mittelalter die Neigung hatten, den „Wunsch“, in der umfassendsten Bedeutung, zu personifizieren, und daß Wotan auch Wunschgott ist, so wird man noch mehr auf die Seite Lipperts zu treten geneigt sein. Es kommt also darauf an, ob die Germanen dem Wotan-Merkur noch andere Eigenschaften zugeschrieben haben, die in das Hohe gehen und aus dem einfachen Seelen- und Ahnenglauben nicht mehr erklärt werden können.
Einmal bemerkt nun Tacitus, die Germanen „schlössen weder die Götter zwischen Wände ein, noch stellten sie sie in menschlicher Gestalt dar, wegen der Größe der Himmlischen; Lichtungen und Haine heiligen sie ihnen. Und mit der Götter Namen nennen sie jenes Geheime, das sie nur[S. 91] mit Ehrfurcht (oder Scheu) sehen“. Ist das gesperrt Gedruckte aus dem Sinne der Germanen gesprochen, so muß der Streit als entschieden gelten. Allein es ist schon von vielen vermutet worden, daß Tacitus, was er hier von den Göttern sagt, aus seinen Ansichten geholt hat. Was wir sonst von den germanischen Götteranschauungen kennen, spricht nicht immer für so hohe Begriffe. Auch wissen wir, daß mindestens später die Germanen sehr wohl Bildnisse ihrer Gottheiten von Holz, Stein oder Metall besaßen; dafür sind sehr viele Zeugnisse vorhanden. Interessant ist, was Tacitus selbst von der Göttin Nerthus, die er als Mutter Erde bezeichnet, erzählt. Ihr Kultort (er wird in der Nähe von Rügen gesucht) ist ein jungfräulicher Hain, den niemand betreten darf außer dem Priester. Dort sei ein Wagen ganz mit einem Gewande (veste!) bedeckt. Der Priester glaubt, daß die Göttin sich darin befände. An ihrem Feste wird der Wagen von Kühen in Prozession herumgeführt, dann herrscht Freude und Friede ringsum, wohin die Göttin gelangt. Zuletzt führt der Priester die „vom Verkehr mit den Sterblichen gesättigte“ Göttin nach ihrem Tempel zurück. Dort werden alsbald „der Wagen, die Gewänder (vestes!) und, wenn du es glauben willst, die Gottheit selbst in einem geheimen See abgewaschen. Diener bedienen, die sofort der See verschlingt“. Hiernach muß der Wagen ein Kultobjekt enthalten, in dem die Göttin selbst weilt, da sie mit den Sterblichen verkehrt (konversiert, sagt sogar Tacitus) und davon ermüdet. Dieses Objekt erklärt Lippert für einen Fetisch. Daß hier ein weibliches Wesen in Betracht kommt, würde zwanglos aus der auch den Germanen früher bekannten Mutterfolge sich ergeben. Außerdem nahmen die Germanen in die Schlacht effigies et signa mit. Das sind nach Jakob Grimm figurierte Gegenstände, nach Lippert Seelenfetische und Gegenstände, die den Fetischen gehören. Von den von Tacitus ferner noch genannten Gottheiten finden sich Mars und Herkules überall, wo Krieg und Heldengeist herrscht, und Kastor und Pollux vertreten, vielleicht irgendein bemerkenswertes Brüderpaar. Doch weiß man mit diesem letzteren allerdings nichts anzufangen. Auch[S. 92] die Isis wird als von einem Teil der Sueven verehrt angeführt. Der Römer meint, ihr Dienst sei importiert, weil wie bei Isisfesten ein Schiff herumgeführt wird. Aber Jakob Grimm hat schon nachgewiesen, daß Umzüge mit Schiffen in Deutschland noch im Mittelalter geschahen, und er vermutet in Isis eine deutsche Göttin und in dem Schiff etwas Ähnliches wie im Wagen der Nerthus. Lippert weist noch auf das Totenschiff hin (S. 75). Gleichwohl kann man sich der Ansicht Jakob Grimms nicht verschließen, daß, da Tacitus so oft und bedeutend von Gott und Göttern der Germanen spricht, teils allgemeinen teils vaterländischen und häuslichen, dieses, zusammengehalten mit sonstigen Überlieferungen und Überlebseln, bloß einen Naturmenschenglauben nicht erlaubt. „Wie läßt sich,“ sagt er, „alles andere, was wir von der Sprache, der Freiheit, den Sitten und Tugenden der Germanen wissen, hinzugenommen, der Gedanke festhalten, sie hätten, in dumpfen Fetischismus versunken, sich vor Klötzen und Pfützen niedergeworfen und ihnen rohe Anbetung erwiesen?“ So niedrig meint es Lippert ja auch nicht, der Seelen- und Ahnenglaube kann sehr wohl mit einer geläuterten Ansicht von Welt und Leben bestehen. Und der Götterdienst der Germanen und die Totenbräuche bei ihnen waren keineswegs sehr harmlos; und letztere sind durchaus, wofür Jakob Grimm selbst viele Beispiele beibringt, auf naturmenschliche Anschauungen von der Seele begründet. Also werden wir wenigstens einen Einschlag von Seelen- und Ahnenglauben, und auch von Fetischismus (Lippert führt mehrere Beispiele an von Bäumen, denen selbst Opfer dargebracht wurden), in der Religion der Germanen nicht von der Hand weisen können. Wir wissen ja, daß z. B. die Franken, selbst nach Annahme des Christentums, noch Menschen beim Übergang über den Po geopfert und in diesen Fluß gestürzt haben, und ähnliche aus dem Seelen- und Fetischglauben fließende Greuel werden noch manche erzählt.
Von dem großen nordisch-germanischen Göttersaal ist nicht gesprochen. Daß er zum Teil auch den eigentlichen Germanen bekannt gewesen ist, darf nicht mehr bezweifelt[S. 93] werden, obwohl die Erzählungen der Edda sehr deutliche Spuren fortgeschrittenerer Kultur und Weltkenntnis, sowie des Einflusses des Christentums an sich tragen. Die nordischen Mythen verstärken den Eindruck, daß die Gesamtgermanen zwar eine höhere Naturreligion gehabt haben, etwa im Sinne der Griechen und Ägypter, daß aber auch viel Naturmenschliches vorhanden war. Von den Menschenopfern bei den Skandinaviern erzählt Adam von Bremen (elftes Jahrhundert) nach den Mitteilungen eines Swen Ulfsson, der sich zwölf Jahre an dem Hofe des Schwedenkönigs aufgehalten hat. Im Hain am Tempel zu Upsala, der Odin, Thor und Freyr geweiht war, hingen mitunter 70 und mehr geopferte Menschen neben Hunden und anderen Tieren. Von diesem Hain sagt der Genannte: „is enim locus tam est sacra gentilibus, ut singulae arbores ejus ex morte vel cibo immolatorum divinae credantur.“ Also man hielt die Bäume wegen der Opfer oder der Opferspeise für göttlich (geheiligt). Die Götter wurden mit Blut versöhnt, die Priester hießen auch selbst Götter: Goda, Dior, Asar, Anses; gleich lebenden Fetischen. Heilige Haine gab es überall, wie auch sonst auf der Welt, einzeln und in der allerverschiedensten Zusammensetzung. Der feste Glaube der Skandinavier, nach tapferem Leben in Walhall das freudigste Dasein bei Trunk, Speise und Waffenspiel fortzusetzen, ist bekannt. Doch muß auch ein Leben der Toten in den Gräbern angenommen worden sein. In dem Harbardslied der älteren Edda, in dem Thor vom Fährmann Harbard (Graubart) so sehr verspottet wird, fragt Thor seinen Quälgeist, woher er solche Spottreden habe, und Harbard antwortet: „Ich lernte sie bei Männern, bei jenen uralten, die in den Heimatshügeln wohnen.“ Da höhnt Thor: „Wie gibst du den Gräbern anmutige Namen, daß du sie Heimatshügel nennst.“ Totenbeschwörung wurde viel geübt. Im Hyndlalied ruft Freia die Vala Hyndla aus dem Grabe hervor, daß sie ihr wahrsagen solle. Richard Wagner hat daraus wohl den Gedanken zu der stürmisch-gewaltigen ersten Szene des dritten Aktes von Siegfried geschöpft. Zauberei und Hexerei blühten in Skandinavien mehr noch als in[S. 94] Deutschland und müssen sich zuzeiten zu wahrer Kalamität ausgewachsen haben, da mehrere Könige Hunderte von Menschen, die diesen Gewerben nachgingen, verbrennen ließen. Wälder, Berge, Wasser, Höhlen wimmelten von Geistern und Dämonen. Meist waren diese bösartiger Natur. Doch hatte jeder Skandinavier auch einen Schutzgeist (Vätten), einen „Führer“, Fylgior, dessen Bedeutung der des Mannes entsprach. Gleichwohl war das Volk auffallenderweise höchst fatalistisch gesonnen: „gegen sein Schicksal kann sich niemand bewahren“ wird in Liedern unzählig variiert. Das ist nicht naturmenschlich gedacht. Als naturmenschlich aber wiederum muß es bezeichnet werden, wenn die Götter, wie es so oft geschieht, kaum höher gestellt werden als machtvollere Menschen. Odin spricht von sich im Runenliede des eddischen Havamal im gleichen Tone, wie ein Runenzauberer reden würde. Er führt sich ein, wie er an einem Baume (wohl an der Weltesche Yggdrasil) neun Nächte hing, ohne Speise und Trank. Da lernte er Runen und fiel herab. Und dann zählt er alles auf, was er mittelst dieser Runen zu vollbringen weiß: Hilfe gegen Sorgen und Seuchen, feindliche Waffen stumpfen und weichen, Freiheit dem Gefesselten, Leben dem Getöteten usf. Und welch eine Fülle von menschlich Verkommenem unter den Asen und Asinnen enthält das Schmählied Lokis, die Lokasenna in der Edda. Da erscheinen die Götter und Göttinnen niedriger noch als im Nibelungenring; Wagner hat sie noch veredelt. Es scheint, als wenn die südlichen Germanen doch höhere Ideen von ihren Gottheiten besessen haben als ihre nordischen Brüder. Doch hat man oft Lieder wie die Lokasenna als bewußte Begründung zu der so hochtragischen Götterdämmerung angesehen.
Von den Kelten ist nicht viel überliefert. Cäsar sagt, daß die Druiden das Volk lehren, die Seele gehe nicht unter, sondern fahre nach dem Tode des Menschen in einen anderen Körper. Diodor aus Sizilien erzählt das gleiche, fügt aber noch hinzu: „Daher kommt es, daß bei ihren Leichenbegängnissen einige Leute Briefe, die sie an ihre verstorbenen Väter, Mütter oder Verwandte geschrieben haben, in das Feuer[S. 95] werfen, in der Meinung, daß die Toten diese Briefe lesen würden.“ Cäsar erzählt auch, daß bei Leichenbegängnissen nicht bloß Gegenstände und Tiere, sondern auch Sklaven und Schutzbefohlene mitverbrannt wurden. Die Gallier liehen auch Geld, mit Bezahlung im Jenseits, wo sie also wie im Diesseits lebten. Lucanus, in der Pharsalia, spricht letzteres auch deutlich aus:
Das alles ist sicher rein naturmenschlich. Daß die Welt von drei Druiden geschaffen oder aus der Tiefe, auch aus dem Meere heraufgeholt sei, gehört ebenfalls hierher. Was es mit den Gottheiten Teutates, Hesus, Cermunus, Taranis, Belis oder Belenus, Ogmius, Andrate und vielen anderen für eine Bewandtnis hatte, können wir nicht sagen. Cäsar teilt mit, die Gallier verehrten Merkur, Apollo, Mars, Jupiter, Minerva. Damit ist für unsere Zwecke nichts anzufangen. Doch wissen wir, daß sie die Gottheiten aus der Materie hervorgegangen ansahen, und daß sie auch Flüssen, Quellen, Bergen, Bäumen opferten. Und ihr Götterdienst war von solchen Greueln erfüllt, daß Kaiser Claudius, nachdem alle Mittel, ihn zu mildern, gescheitert waren, ihn ganz unterdrücken mußte. Gleichwohl werden die Gallier wenigstens in der Kultur ziemlich hoch gestanden haben, da Cäsar und andere so viel von ihren Städten, Tempeln, Schulen und Kenntnissen mitteilen. Von dem, was die altgälischen Barden erzählen und was wir im Ossian lesen, hat, wegen der mindestens zweifelhaften Originalität, abgesehen werden müssen. Einiges ist übrigens von mir an anderer Stelle vorgetragen.
Wir sind gezwungen, die Runde durch die Kulturvölker fortzusetzen. Die griechische Religionsanschauung ist nach allen Richtungen durchforscht. Merkmale des Seelen- und Ahnenglaubens, auch des Fetischismus, sind in ihr, namentlich in früherer Zeit und bei abgelegeneren Stämmen zweifellos[S. 96] vorhanden. Bei Homer führt die Seele ganz das Leben wie bei den Naturvölkern; sie entflieht eilig aus der klaffenden Wunde, sie zieht wie dampfender Hauch unter die Erde, sie erscheint im Traume, um für den Körper Begräbnis zu erflehen, damit sie selbst Ruhe finde, sie trinkt Blut und gewinnt dadurch irdisches Gedächtnis und Kraft, sie bekommt Gaben und Menschenopfer. Kleidung, Schmuck, Waffen wurden den Toten noch bis in die letzte Zeit ins Grab getan.
sagt der Chor in der Alkestis des Euripides zu Admetos. Und eine eingehende Schilderung aller Gaben teilt Atossa in den Persern des Aischylos mit. Lukianos noch spottet darüber, daß man den Toten soviel mitgebe oder mit ihnen soviel verbrenne, als ob sie sich dessen im Jenseits bedienen könnten. Und die überhaupt durch überwältigendes Unglück zweifelsüchtig gewordene Hekabe sagt in den Troerinnen des Euripides, da sie ihrem so grausam hingemordeten Enkel Astyanax die Totenfeier richtet, zu den Dienern:
Und doch glaubt dieselbe Hekabe, daß in der Unterwelt der Vater, Hektor, die Wunden des Sohnes heilen wird. Soviel Inkonsequenz herrscht bei einer ja ungewissen Sache.
In Ausnahmefällen geschah auch den Gräbern Verehrung. Was der Chor in dem vorgenannten Drama Alkestis bei der ergreifenden Totenfeier noch spricht:
ist nicht bloß dichterische Empfindung. Der gleiche Chor ruft der toten Alkestis nach: Κούφα σοῖ χθὼν ἐπάνωθεν πέσοι, sit tibi terra levis, Leicht sei dir die Erde! wie wir noch jetzt sagen. Von dem Seelenphantom, dem εἴδωλον, und den Seelenvögeln habe ich bereits gesprochen (S. 73 f.). Daß die Griechen Seelen auch in Schlangen sahen und verehrten, wissen wir aus Pausanias. Daß auch Fetische bekannt waren, sehen wir aus den vielen Verwandlungen von Menschen in Bäume, Sträucher und Felsen. Außerdem ist es hinreichend bezeugt, wie in frühen und späten Zeiten Steine und Pfosten Sinnbilder von Göttern waren, denen auch Opfer gebracht wurden. Was aber den Ahnenkultus anbetrifft, so hat schon Euemeros den ganzen griechischen Götterglauben auf ihn zurückgeführt. Und das haben bekanntlich mehr oder weniger vollständig viele vor ihm und nach ihm gleichfalls getan. Zu solchen Übertreibungen haben die Griechen selbst beigetragen, indem jedes Fürstengeschlecht und jedes Völkchen möglichst von einer Gottheit, mindestens aber von einer Halbgottheit abstammen wollte, indem von den Göttern gar zu menschlich erzählt worden ist, und endlich, indem den Mächtigen auf Erden nicht selten göttliche Ehren erwiesen wurden. Dazu kommen die noch bis in sehr späte Zeit vorgefallenen Menschenopfer, die jeder wahrhaft höheren Gottheitsanschauung so sehr widerstreben. Und wenn ein Themistokles oder gar ein Cäsar solche Opfer vollziehen, so kann man sich das zwar dadurch erklären, daß sie dem Drängen des Volkes (oder Heeres) nachgegeben haben. Aber auf dem Volke bleibt es doch haften. In der unheimlichen ersten Szene der Hekabe des Euripides sagt der Geist des Polydoros:
Und dieses Opfer ward ihm ja, Achills Seele erhielt die Braut. Gleichwohl überhebt uns einer weiteren Untersuchung die Tatsache, daß, so menschlich oft die Götter an Leben, Be[S. 98]tragen, Fühlen und Leidenschaften sich auch geben, sie doch wirkliche Götter darstellen, keineswegs potenzierte Menschen, wie man oft behauptet hat. Namentlich aber nicht Ahnen, wogegen schon die allgemeine Verehrung, die sie genießen, spricht. Wenn auch gefabelt wurde, Zeus sei König in Kreta gewesen, sei dort gestorben und liege dort begraben — nichts in dem Zeus, wie wir ihn kennen, erinnert daran. Apollon und Artemis sind Götter trotz ihrer Geburt von einem sterblichen Weibe. Das hängt mit der Entstehung der Mythen und Sagen zusammen, die nicht immer von religiösen Anschauungen veranlaßt ist. Ein Teil wird aus Vorgängen zwischen Menschen, namentlich in Fürstenhäusern, stammen, die zuerst bewußt und später, nachdem die Personen vergessen sind, unbewußt, auf Gottheiten übertragen wurden. Einen anderen Teil verdankt man der dichterischen Erfindung des Volkes und Einzelner. Noch ein anderer ist aus Personifizierung von Naturerscheinungen hervorgegangen. Sodann spielt eine große Rolle die Deutung der Gottheitennamen, die Volksetymologie, indem aus richtiger oder unrichtiger Übersetzung und Umschreibung des Namens Tätigkeiten und Wirkungen abgeleitet werden, an die sich naturgemäß Erzählungen anschließen. Weiter werden manche Sagen mehr oder minder geistreiche Redeblüten und erkünstelte Allegorie sein. Zuletzt dürften recht viele als Erklärung von Gebräuchen im Leben und im Kult, deren Ursprung und Bedeutung dem Gedächtnis entschwunden sind, und andere zur Begründung von Ansprüchen auf Menschen und Besitz erfunden sein. Wir haben in den griechischen Sagen und Mythen für alles Beispiele und ebenso in den Sagen und Mythen anderer Völker. Bei so großer Vielartigkeit des Entstehungsgrundes kann man nicht erwarten, ein einheitliches Bild zu bekommen. Und so enthalten die griechischen Sagen Schönes und Anmutendes neben Häßlichem und Abstoßendem, Hohes neben Niedrigem und Tieferdachtes neben Törichtem und Aberwitzigem. Bei Vielem aber tut man dem Volk mehr Ehre an, wenn man es aus naturmenschlichen Anschauungen ableitet als aus Allegorien oder Naturerklärungen, und wenn man davon absieht, von uns nicht[S. 99] mehr zu verstehende Weisheit zu behaupten, wie es früher Mode gewesen ist und auch gegenwärtig mitunter noch beliebt wird.
Bei den Römern liegt der Seelenglaube noch offener als bei den Griechen. Die Inferi, in besonderer Bezeichnung Manes oder Lemures, sind ganz naturmenschlich gedachte Seelen Verstorbener, die unter der Erde weilen. Als Larven fügen sie dem Menschen Böses zu, als Lares familiares sorgen sie für die betreffende Familie. Bekanntlich schrieben die Römer allem, also auch Menschen, jedem einen Genius zu, der im Laufe der Zeit mehr und mehr Funktionen bekam und zuletzt alles vorstellte, wodurch der Mensch zu seinem Tun und Lassen im Leben bewegt wurde. Es war etwas Göttliches in diesen genii, und sie wurden demgemäß auch im Familienkreise oder, wenn es sich um die genii der Götter, der Machthaber oder die des Staates, der Stadt, des Ortes usf. handelte, öffentlich verehrt, und bei ihnen wurde auch geschworen. Ob man die Seelen der Menschen mit den genii zu identifizieren hat, weiß ich nicht; von manchen Forschern geschieht es. Jedenfalls haben wir es mit einem ausgedehnten Glauben und Kult zu tun, der, ob er sich auf die genii, inferi, manes, larvae, lares und welche Namen noch in Gebrauch sein mochten, bezog, sich dem allgemeinen Seelenglauben und Seelenkult eng anschließt. Die Seelen mußten im Tode versöhnt werden, was durch ganz bestimmte Zeremonien und Gaben geschah; sie hatten ein Anrecht auf fortgesetzte Verehrung — Cicero spricht von manium jura, den Rechten der Manen, — seitens der Angehörigen. Geschah das nicht, so irrten sie ruhelos auf der Erde umher und sannen und taten Böses. An drei Tagen im Jahre: 24. August, 5. Oktober und 8. November öffnete man den Seelen absichtlich die Pforte der Unterwelt, den mundus, das war ein in der Mitte der Ortschaft befindliches rundes Loch, mit einer Kuppel überwölbt, die eine mit einem Steine bedeckte Öffnung hatte. In diesen mundus tat man auch die allgemeinen Gaben für die Seelen, in ihn wurden auch Menschen gestürzt, „die zu Schutzgeistern der Stadt werden sollten.“ Da man einmal vergessen hatte, den Toten ihre Spenden zu geben, verließen[S. 100] sie ihre Gräber und man hörte sie durch die Straßen der Stadt und der Umgebung schwirren, bis man ihnen die Gaben an die Gräber brachte, erzählt Ovid. Und so konnten Zauberer auch die Seelen in die Oberwelt beschwören, wovon ja auch die Griechen soviel wußten.
Gleichfalls an Naturmenschliches erinnert die Verehrung des Feuers auf dem häuslichen Herde, das wie lebend behandelt wurde und Opfergaben empfing. Überhaupt hatte der Römer einen häuslichen Kultus — seinen Penaten, das sind eben die Seelen und das häusliche Feuer, gewidmet — der den öffentlichen an Bedeutung weit überragte und einen Kultus des Naturmenschen darstellte. Und gleiches gilt wohl auch von den Griechen. Wie rührend klingt das von der Sklavin mitgeteilte Gebet der zum Sterben bereiten Alkestis vor dem Herdfeuer als Göttin, um Schutz für die zu hinterlassenden Waisen:
Die römische Religion ist ungemein zusammengesetzt: himmlische Götter, Feld-, Berg-, Wald-, Baum- und Quellgötter, Götter der Unterwelt, Götter fast für jedes Ereignis und für jede Handlung im Leben des Einzelnen und der Gesamtheit. Dazu die unzähligen Seelen- und Ahnengötter, denn die manes sind dii und können sogar den Himmel erreichen, wie die von Romulus und der Kaiser. Kaum ein Volk — vielleicht mit Ausnahme der Indier und Japaner — hat einen so gefüllten und so bunten Göttersaal. Und aus allem spricht eine Art Kindlichkeit und Natürlichkeit, wie aus einem veredelten Naturmenschenglauben. Wäre nicht so manches Kindische dabei und so manches Rohe, so mutete sie uns vielleicht mehr an als die glanzvolle griechische Mythe.
Wie vorsichtig man bei den Ägyptern, wegen ihrer Unart, ihren Worten allerlei mystische Bedeutungen zu geben, mit Behauptungen sein muß, hat Brugsch in seiner „Religion und Mythologie der alten Ägypter“ erwiesen. Man kann die höchsten Ideen herauslesen, wo gar keine vorhanden sind,[S. 101] weil ein hohes Wort steht, das gleichwohl in gewöhnlichster Bedeutung benutzt ist. Und auch das Umgekehrte wird der Fall sein. Ein zweiter Umstand, der die Beurteilung der ägyptischen Anschauungen so sehr erschwert, ist die verblüffende Vorliebe für tierische Merkmale. Götter werden mit Frosch-, Schlangen-, Widder-, Schakal-, Katzen-, Sperber-, Falken- usf. -kopf, oder ganz tierisch als Käfer, Affen, Krokodile usw. dargestellt, mitunter sogar in Kombination mehrerer Tiere, wie Râ einmal in derselben Gestalt als Mensch, Frosch und Affe. Und das geschieht nicht bloß in Bildern, sondern auch in Texten: die Seele des Osiris ist der Bock von Mendes, die Seelen der Götter sind Krokodile, heißt es in einer Inschrift des Königs Seti I. Der Erdgott Qeb sagt von sich: ich pfeife wie der Falke und ich gackere wie die Gans. Vieles, vielleicht das meiste, wird symbolisch aufzufassen sein aus den Eigenschaften der Tiere oder auch aus ihrem Verhalten gegen die Naturerscheinungen. Manches muß aber auf theromorphe Anschauungen, auf Totemismus beruhen, da ja die Ägypter tatsächlich gewissen Tieren, nicht bloß dem bekannten Apis, Verehrung dargebracht und sie nach dem Tode mit Feierlichkeit begraben haben. Herodot, der sehr eingehend davon erzählt, weiß warum, aber er sagt es nicht aus Furcht vor den göttlichen Dingen. Einmal, wo er sich gehen läßt, teilt er ein höchst albernes Märchen über den Widderkopf des Amun (Zeus) mit: Zeus hätte ihn vorgesteckt, um sich nicht Herakles, der ihn durchaus sehen wollte, in seiner wahren Gestalt zu zeigen. Wir können kaum etwas anderes annehmen als naturmenschliche Anschauung. Nach Brugsch aber müssen die Ägypter einen sehr hohen Gottesbegriff gehabt haben. Die Texte, die er anführt, sind entscheidend. Wir kommen später auf sie zurück. Daneben besaßen sie eine kosmogonische, schon Herodot bekannte, männlich-weibliche Vierheit, von der ich schon in meinem mehrmals genannten Buche gesprochen habe. Sodann eine Hauptgottheit und eine Neunheit von Göttern, die den eigentlichen Gegenstand der Verehrung bildeten: Râ (auch Tum, Ptah, Amun), Chon, Tafnut, Qeb, Nut (auch Hathor), Osiris, Isis (auch Mut),[S. 102] Set, Nephthys, Horus. Jede der Gottheiten wurde noch vielfach gespalten nach ihren besonderen Verrichtungen oder Erscheinungen, wie die Gottheit Sonne als Morgensonne, Mittagsonne, Abendsonne, Sommersonne, Wintersonne. Umgekehrt übernahm fast jeder Gott auch die Verrichtungen und Erscheinungen aller anderen Götter und vereinigte sie sogar in sich, so daß er dann „Gott“ wurde. Aber eigenartig ist, daß die Neunheit auch als eine Folge von vorhistorischen Königen Ägyptens aufgefaßt wurde, also von Ahnen der Königsgeschlechter. Wie ja umgekehrt den Königen Göttlichkeit zugeschrieben wurde, nicht bloß formell, sondern mit entsprechenden Folgen. Freilich erzählten die ägyptischen Priester Herodot, daß diese Götter-Könige nicht mit den Menschen zusammengelebt hätten.
Was aber den Totenkult anbetrifft, so ist bekannt, wie minutiös ausgebildet er in Ägypten gewesen ist und wie notwendig er für die Fortdauer der Seele nach dem Tode erachtet wurde. Seelen konnten zugrunde gehen, wenn ihnen die nötigen Kulte mangelten. Lippert führt Beweise dafür an, daß noch nach mehr als dreitausend Jahren nach ihrem Tode die ältesten ägyptischen Könige Seelenpfleger hatten. Und solche Seelenpfleger schafften sich viele und erhielten viele durch Stiftungen. So stiftete Ramses II. seinem Vater Seti einen vollständigen königlichen Haushalt, „mit Äckern, Viehweiden, Geflügel, Herden, Schiffen, Zinsen aller Art, mit Handwerksleuten, Knechten und Mägden.“ Sich selbst stiftete er sogar eine Bibliothek in seinem Grabtempel. Und jeder Sohn war verpflichtet, einen Teil der Habe auf den Kult seiner Eltern zu verwenden. Der Tote brauchte im Jenseits alles, was er im Leben nötig hatte. Ich kann mich nicht enthalten, hier schon einen Text aus Brugschs genanntem Werke mitzuteilen. Der Tote wendet sich an Osiris und andere Götter mit dem Gesuche „zu gewähren: das Leuchten am Himmel, das Vermögen auf der Erde und das Wahrwerden der Stimme in der Unterwelt, das Gehen und Kommen nach meinem Hause, meine Abkühlung in seinem Schatten, meine Stillung des Durstes mit Wasser aus meinem Teiche zu jeder Zeit,[S. 103] das Wohlergehen aller meiner Gliedmaßen, das Geschenk des Niles und Hülle und Fülle frischen Gemüses der Jahreszeit für mich, meinen Spaziergang am Rande meines Teiches zu jeder Zeit, das nicht fehlende Ruheplätzchen für meine Vogelseele auf dem Aste des Baumes, den ich gepflanzt habe, meine Abkühlung im Schatten meiner Sykomoren, meine Nahrung von ihren Früchten, meine Sprache, in welcher ich rede, gleich wie die Diener des Horus, meinen Ausgang gen Himmel, meine Rückkehr nach der Erde — ohne Hindernisse auf dem Wege, ohne Bereitung von Fallstricken für meine Person, ohne Absperrung meiner Seele — meine Anwesenheit in der Schar der Gebenedeiten unter den Hochwürdigen, meine Betauung meines Feldes in dem elyseischen Gefilde von Aru, mein Dasein im Friedefeld und meine Erscheinung mit Opferkannen und Brotspenden vor dem Gotte Onnophris.“ Völlig Leben und Freuden eines Grundherrn, statt der Seele eines Toten! Die letztere macht sich bemerkbar in der „Vogelseele“ und in der Furcht bei der Rückkehr auf die Erde, durch Hindernisse und Fallstricke verloren zu gehen. Die Vogelseele gemahnt an Fetische. Sehr charakteristisch ist ein schönes Zwiegespräch eines Menschen mit seiner Seele, das wohl vor viertausend Jahren gehalten worden ist. Die Seele mahnt zum Ausharren im Leben. Ganz nach dem Grundsatz des Herakles in der Alkestis — „dem Sterblichen geziemt es, sterblich nur gesinnt zu sein“ — sagt sie ihm nach manchen Ausführungen über Gestorbensein: „Folge dem frohen Tag, vergiß die Sorgen.“ (Noch genauer ausgeführt ist dieser epikureische Gedanke in dem etwa aus Ramses II. Zeit stammenden sogenannten Harfnerlied S. 188). Der Mann aber zählt in einer Unzahl von Strophen alle Trübsale des Lebens und alle Schlechtigkeiten der Menschen auf und schließt mit den Worten (Greßmann, Altorientalische Texte):
Die Seele ist nun überzeugt und sagt:
Also bleibt die Seele und läßt sich an der Stätte des Toten nieder, oder — wie man wohl nach den Worten des Menschen schließen muß — sie ist immer bei dem Toten, wohin er geht.
Fetische sollen den Ägyptern, nach Lippert, sehr vertraut gewesen sein. Auf einem Block, der späterhin als Mühlstein verwendet wurde, und der eine Inschrift aus der Zeit von etwa 712 v. Chr. trägt, die sich jedoch als Erneuerung einer alten Schrift, die „seine Majestät (König Schabaka) als ein Werk der Vorfahren gefunden habe, von Würmern ganz zerfressen“, gibt, und die nur noch teilweise lesbar ist, deren Inhalt also jedenfalls sehr alt sein muß, heißt es: „Ptah war zufrieden, nachdem er alle Dinge geschaffen hatte. Er hatte die Götter gebildet, die Städte gemacht, die Gaue gegründet. Er hatte die Götter in ihre Heiligtümer gesetzt, ihre Opferbrote gedeihen lassen, ihre Heiligtümer gegründet, ihre Leiber ähnlich gemacht zu ihrer Zufriedenheit. Die Götter zogen ein in ihre Leiber aus allerlei Holz, kostbaren Steinen, aus allerlei Metall und allen Dingen, die wachsen, woraus sie entstanden waren. Er fügte zusammen alle Götter und ihre Seelen im Ptah-Tempel, dem Besitze alles Lebens, in dem das Leben der beiden Ägypten gemacht war.“ Das klingt stark fetischistisch, namentlich das Unterstrichene läßt schwer andere Deutung zu. Gleichwohl glaube ich, daß man doch zu weit geht, wenn man die Gestirne, und namentlich die Herrscher unmittelbar als Fetische bezeichnet. Mögen auch die Herrscher Söhne der Sonne oder Sitz eines Gottesgeistes gewesen sein, Fetische im Sinne des Naturmenschen waren sie nicht. Als Götter bezeichnen sie sich nach ihrem Ableben. Aber im Sinne der Ägypter können[S. 105] alle Toten Götter sein, sie kehren in Gott zurück, wie wir später sehen werden. Die Hofsprache muß von der Anschauung unterschieden werden. Unsere Herrscher sind auch von Gottes Gnaden, und niemand hält sie für etwas anderes als fehlende, im wesentlichsten machtlose Menschen, obwohl manche vom Gottesgnadentum wirklich überzeugt sind. Tiere sind gewiß Fetische gewesen, wie der berühmte Apis, wie Schlangen, Krokodile, Katzen, Vögel, der Skarabäus usf. Sodann hat man auch Standbilder als Aufenthaltsgegenstände von Seelen angesehen. Wie bei uns Heiligen- und Marienbilder von Ort zu Ort und von Haus zu Haus geführt werden, um ihre Wunderkraft zu spenden, sind schon im grauesten Altertum Götterbilder durch weite Lande zu gleichem Zweck versandt worden. Wir besitzen Berichte darüber, einen aus der Zeit Ramses II. über die Versendung „Chons des Gebieters“ nach Bechten (Baktrien?), um eine Prinzessin vom bösen Geist zu befreien, wie Griechen Palladien raubten, Römer Götterstandbilder und Embleme entführten. Da aber in der späteren Zeit den lebenden Seelen die Wahl des Aufenthaltes freistand, mögen allerdings noch mehr Gegenstände als Fetische angesehen worden sein, als wir nachweisen können. Belebung toter Dinge ist dem Ägypter durchaus geläufig. Ein Text, den Brugsch aus dem 125. Kapitel des Totenbuches, den der Tote ins Grab (in die Brusthöhle) bekam, läßt in 24 Versen Pfosten, Schwelle, Schloß, Schlüsselloch, Getäfel, Türflügel, Friesstücke usf. des Totengerichtssaales den Toten nach ihren Namen fragen. Er muß sie angeben, bevor er weiter kann. Und diese Namen sind zum Teil ganz persönlich lebenbedeutend, wie die linken Pfosten „Ausführer dessen, was wahr ist“, die Friesstücke „Schlangenbrut der Göttin Ranut“, das Schlüsselloch „Lebensauge des Gottes Sebek“ heißen. Kaum wird man hier Allegorien oder tiefsinnige Mystik sehen können. Und wem fällt nicht das erste Wunder ein, das Mose vor Pharao vollbringt und dessen Zauberer sofort nachahmen, die Verwandlung von Stäben in Schlangen? Bei den Ägyptern hat sich der Seelen- und Ahnenglaube (wenn letzterer vorhanden gewesen sein sollte) nie zu den Greueln entwickelt,[S. 106] die wir anderweit so oft gefunden haben. Herodot sagt: „Denn die kein Tier opfern dürfen außer Schweinen, Stieren und Kälbern, nämlich die da rein sind, und Gänse — wie werden die denn Menschen opfern?“
Wir wenden uns zu den Hebräern. Es ist bereits von Vielen hervorgehoben worden, wie wenig dieses Volk, trotz seines so langen Aufenthaltes unter den Ägyptern, von diesen an Anschauungen angenommen habe. Der Gott, den Mose das Volk lehrte, war absolut verschieden selbst von dem höchsten Gott Ägyptens, denn dieser gehörte so ganz zur Materie, daß man den Ägyptern nicht mit Unrecht eine Art Pantheismus zugeschrieben hat. Der Gott Mose steht aber ganz außerhalb der Materie. Gleichwohl bezeugt es die Bibel selbst, daß den Hebräern vor dem Exil dieser Gott nur selten genügte, daß sie sich Götzen schufen, auf Höhen opferten und besondere Hausgötter (Theraphim) besaßen und verehrten. Das ist so bekannt, daß ich darauf nicht einzugehen brauche. Eine andere Frage aber ist, ob die Hebräer auch dem Seelen- und Ahnenglauben und dem Fetischglauben huldigten. Lippert hat in Konsequenz seiner Theorie das in vollem Umfange bejaht. Aber ich glaube doch, daß der Einwand dagegen, über den er zu leicht hinweggeht, entscheidend ist. In der Bibel wird nämlich so wenig von dem Leben nach dem Tode gesprochen, daß oft und von vielen der Schluß gezogen worden ist, die Hebräer hätten ein solches Leben überhaupt nicht gekannt. Ist auch dieser Schluß übereilt, so bleibt doch die Tatsache bestehen: die Bibel spricht nicht von dem Leben nach dem Tode, oder nur in ganz dunklen Ausdrücken (S. 193). Daß die Verfasser und Redaktoren der Bibel, um den ägyptischen Seelenkult auszumerzen, absichtlich alle Hinweise darauf ferngehalten hätten, wie Lippert annimmt, kann nicht zugegeben werden, denn sie hätten mehr Grund und Anlaß gehabt, den Götzen- und Theraphimdienst zu übergehen, und das haben sie nicht getan. Wie in der Antike, spricht die Bibel überall objektiv von ihren Menschen, sie verhehlt nicht einmal bei ihren Lieblingen selbst das Schlechteste in ihrem Beginnen. Einen Seelenglauben wird man[S. 107] hiernach bei den Hebräern nicht annehmen können. Daß ein Ahnenglaube nicht bestand, ist wohl am besten dadurch erwiesen, daß weder einer der Patriarchen, noch der Führer — und Abraham und Mose waren doch gewiß verehrungswürdige Gestalten — irgend einen Kult, auch nur den allereinfachsten, geschweige göttlichen, empfingen. Es bleiben also noch die Fetische. Diese verlieren eigentlich ohne Seelenglauben ihre besondere Bedeutung. Sie werden kleine bequem im Hause aufzubewahrende und auf Reisen mitzunehmende Götzenbilder gewesen sein, wie etwa die Heiligenbilder, mit denen Ludwig XI. von Frankreich seinen Hut gespickt hatte und zu denen er betete, indem er den Hut vor sich hinstellte, wenn er eine seiner bekannten Unternehmungen beabsichtigte oder ausführte. Mitunter handelte es sich auch um große Götzenbilder, wie in Davids Hause und bei Micha. Will man dieses alles Fetische nennen, so mag das sein. Aber ich glaube, daß das goldene Kalb und die ehernen Schlangen die einzigen Tierfetische sind, die man als solche bestimmt deuten kann. Die Stiftshütte mit ihren Einrichtungen hält Lippert für eine Fetischbehausung mit zugehörigen Spenden. Als was sie in der Bibel gedeutet werden, weiß jeder. Indessen überall, wo wir Opfer finden, werden wir auf anthropomorphische Auffassungen gestoßen. Daher die Propheten von diesem ganzen Dienst nichts wissen wollten. Geisterbeschwörung, Zauberei und Wahrsagung kannten und übten die Hebräer in reichem Maße. Man denke an die Beschwörung für den tragischen König Saul. Man darf aber wohl wieder auf die Propheten und Seher verweisen, um darzutun, daß hier im ganzen doch ein anderer Geist herrschte als bei rohen Naturvölkern und selbst als bei den umgebenden Kulturvölkern. Was noch aus den Weissagungen geschlossen wird, aus der Beschneidung usf., kann aus einem Seelenglauben gerechtfertigt werden. Dann aber bezieht sich — wie doch nun einmal die Bibel zu dem Leben nach dem Tode sich verhält — dieser Glaube allein auf das Lebende und hat mit dem eigentlichen naturmenschlichen Seelenglauben, wie er geschildert ist und der gerade auf den Tod sich bezieht, nichts[S. 108] zu tun und ist von ihm so weit verschieden, wie die Blutsbrüderschaft von dem Totenopfer, obwohl beide Ansichten von der Seele betreffen.
Die Phönizier müssen noch in sehr später Zeit einen ziemlich ausgedehnten Fetischglauben, neben ihrer Astral- und Naturreligion gehabt haben. Berge werden als Baal genannt und verehrt, wie Baal-Hermon, Baal-Libanon, und auch Bäume tragen diese Auszeichnung, wie der Baal-Thamar, die Palme. Steine wurden als Beth-el, Heim (Aufenthaltsort) der Gottheit (βαίτυλος) angesehen und empfingen, wo Phönizier waren und hinkamen, Opfer. Heliogabal war, ehe er Kaiser wurde, Priester eines schwarzen Steines zu Emesa, wahrscheinlich eines Meteorsteines, da er vom Himmel gefallen sein sollte. Astarte wurde zu Byblos als konischer Stein verehrt, eine hier abgebildete Münze aus der Zeit des Kaisers Macrinus zeigt ihren Tempel mit Altar und diesem Stein im Säulenhofe. Doch wurde sie freilich meist in menschlicher Figur dargestellt. Wir wissen von den Anschauungen der Phönizier zu wenig, wenn wir auch ihren blutigen und menschenmordenden Molochskult kennen. Aus Inschriften in Gräbern und auf Sarkophagen muß man schließen, daß die Phönizier sehr besorgt um Erhaltung ihrer sterblichen Reste waren. Aber es finden sich auch Verwahrungen dagegen, daß die Toten Schätze besäßen, König Eschmunazar sucht sich in dieser Weise gegen Grabräuber zu schützen.
Den ausgesprochenen Fetisch- und Seelenglauben der Araber habe ich bereits in meinem genannten Buche geschildert. Wie es mit den Babyloniern und Assyriern in dieser Beziehung steht, läßt sich nur vermuten. Ihre Religion, wesentlich eine Astralreligion, sollen sie von dem so rätselhaften Volke der Sumerer überkommen haben; sie steht in vieler Beziehung hoch genug. Daß aber bei ihnen[S. 109] Wahrsagekunst, Traumdeuterei, Zauber- und Beschwörungswesen, Magie jeder Art, Astrologie in höchster Blüte standen, weiß man sicher. Sie hatten Geister und Dämonen in reicher Zahl, wie die sieben Hauptdämonen, von denen es in einer Legende heißt (Greßmann, Altorientalische Texte):
Der Himmelsdamm soll der Tierkreis sein. Vielleicht ist es aber der Horizont, wohin es, wie überall, zur Unterwelt geht. Jene Dämonen sind Sturm-, Finsternis- und Wettergeister, sie verschlingen auch Sin, den Mond. Andere Dämonen in besonders großer Menge bringen Pest, Not und alle Krankheiten. Ihre Darstellung ist tierisch und oft grotesk-furchtbar; Drachen und Greife spielen eine Hauptrolle, aber auch Hunde, Skorpionen, Schlangen, Panther, Wölfe usf. Soviel ich jedoch sehen kann, findet sich keine Angabe, die auf eine Beziehung zu Seelen Abgeschiedener deutete, wiewohl Hexen und Verhexungen sehr bekannt und gefürchtet sind; schon das zweite Gesetz Hammurabis behandelt Zauberer und solche, die der Zauberei bezichtigt werden. Ein Gottesurteil, Werfen in den Strom, entscheidet. Ein Leben nach dem Tode wird durchaus angenommen, und zwar wie bei Naturmenschen mit den Bedürfnissen des Diesseits. Gilgames (Jzdubar), der Held des gleichbenannten Epos, hat seinen Freund Eabani durch Tod verloren. Er denkt nun voll Furcht auch an seinen Tod, und nachdem ihm sich unsterblich zu machen oder wenigstens das Jenseits zu schauen mißlungen, muß Nergal, der Totengott, auf Eas Befehl ein Loch in der Erde öffnen, durch das Eabanis Geist emporsteigen kann. Gilgames befragt ihn nun. Wir besitzen nur den Schluß, aber er entscheidet. Eabani sagt:
Das entspricht völlig uns schon bekannten Ansichten. In dem furchtbaren Fluch, den Hammurabi auf denjenigen herabbeschwört, der seine Gesetze mißachten sollte, findet sich auch: „Unten in der Unterwelt möge er (Samas, „der große Richter Himmels und der Erde“) seinen Totengeist nach Wasser schmachten lassen!“ Vielleicht ist dieses Wasser das Wasser des Lebens, das die Richter der Unterwelt, die Anunnaki, in Verwahrung hielten (S. 197). Daß die Geister auch einen Kult hatten, sieht man aus den vier letzten Versen des angeführten Textes. Daß die Götter Fetische waren, möchte ich nicht behaupten, trotz solcher Ausdrücke wie im zweiten Gesetz Hammurabis: „Er (der bezichtigte Zauberer) soll zum Stromgott gehen und in den Stromgott eintauchen.“ Lippert aber ist naturgemäß dieser Ansicht und erklärt den Gestirndienst für Fetischdienst. Es spricht einstweilen dagegen der Mangel von Seelengeistern. Die Sitten, mögen sie zum Teil noch so sehr „afrikanisch“ sein, haben damit nichts zu schaffen. Was es aber mit dem auf assyrisch-babylonischen Denkmälern so oft wiederkehrenden heiligen Baum naturmenschlich für eine Bewandtnis hat, kann ich nicht sagen. In den Mythen ist der Baum hinreichend bekannt und als Weltgegenstand auf der ganzen Erde verbreitet. Als das möchte ich den assyrisch-babylonischen nicht ansehen, wegen der Anbetungen und Opfer, die ihm sogar von Göttern und Genien dargebracht werden. Doch sei auf das schöne Buch des Pfarrers Alfred Jeremias „Das Alte Testament im Lichte des alten Orients“ verwiesen.
Sehen wir von dem eigentlichen Zoroastrismus der Eranier ab, der einer anderen Betrachtung angehört, so wissen wir nicht viel von den sonstigen Anschauungen dieser Völker, um mehr behaupten zu können, als daß Seelen- und Fetischglauben bei ihnen wahrscheinlich bekannt und gehegt worden[S. 111] ist. Reste finden wir in den Zarathustrischen Lehrwerken. Als der Urstier starb, heißt es im Bundehesh: „Gosurun, das ist die Seele des einzigerschaffenen Stieres, ging aus dem Leibe des Stieres hervor und stand vor dem Stiere. So stark wie tausend Menschen, wenn sie zugleich ihr Geschrei erheben, klagte Gosurun dem Ahura.“ Die Klage bezieht sich auf durch Ganamino (Ahriman) in die Welt gebrachte Übel. Von Ahura auf die Zukunft verwiesen, klagt die Stierseele weiter dem Sternenkreis, dem Mondkreis, dem Sonnenkreis. Nun zeigt ihm Ahura den Frohar des Zarathustra. Dieser Frohar ist aber allgemein die Seele, die also präformiert besteht (von Ahura geschaffen, Kap. II) und selbständig lebt. An einer anderen Stelle (Kap. VI) treten die „Frohars der Krieger und Reinen“ beim Kampf Ahuras gegen Ahriman mit Keulen und Lanzen in der Hand auf, also wie die Menschen selbst (S. 43). Und so sind überhaupt anscheinend alle Frohars (Seelen) zuvor schon in Ahuras Reich vorhanden, etwa wie Platons Ideen. Und selbst die Welt hat einen solchen Frohar; lange bevor sie Welt wird, besteht sie schon im Himmel. Und auch die höchsten Götter besitzen Frohars. Ahura sagt ausdrücklich (Kap. XV): „Die Seele ist zuerst geschaffen und der Leib wurde hernach für sie geschaffen, und sie wurde in den Leib gelegt“ (ähnlich Kap. XVII). Die Seele wird auch das „Selbsttätige“ genannt.
Weiter wissen wir von wunderbaren Vögeln; wie Karsapt, der dem Urmenschen und Paradiesherrscher Yima die mazdaijaçnische Lehre von Ahura überbrachte, von Varaghna der demselben Yima, da er die Unwahrheit gesagt hatte, die drei Gnaden entnahm, von dem auch aus Märchen bekannten Simorg und vielen anderen. Manche von ihnen kämpfen gegen die bösen Nachtgebilde, wie, ganz naturgemäß, der Hahn. Auch sind Dämonen, Geister, Gespenster usf. in unendlicher Zahl bekannt, gute (Yazatas) und böse (Dêvs), menschlich und tierisch geformte, wie der furchtbare Dahâka, dem Yima erliegt, und der teuflische Vernichter Aesna daeva, den man mit dem Asmodeus verglichen hat. Die Vorbedingungen für Seelen- und Fetischkult sind hiernach aller[S. 112]dings gegeben. Gleichwohl kann ich nicht ersehen, daß ein solcher Kult in der historischen Zeit stattgefunden hat. Zwei Stellen finde ich in Windischmanns „Zoroastrische Studien“, die unmittelbar auf Berg- und Baumkult sich beziehen, und beide betreffen das unsterblichmachende Haoma: „Anrufen will ich den Berg Hukairya, den ganz reinen, goldenen, von welchem herabfließt Ardviçura Anâhita, tausend Männer hoch besitzt sie Majestät wie alle Wasser, die auf der Erde hervorfließen.“ Die Ardviçura Anâhita ist das Lebenswasser, in ihm wächst der (weiße) Haoma-Baum Gaskerena (S. 175 f.). Und es heißt: „Wir rufen Gaskerena, den starken, von Mazda geschaffenen, an.“ Selbst dieses als Fetischismus anzusehen, möchte ich zaudern; es fehlt das Charakteristische, da ja die Gegenstände nur vorgestellt sind, nicht in Körperlichkeit angebetet werden. Außerdem sind es Lebensspender. Auf das irdische Homa, das bei Opfern dienende gelbe Homa, bezieht sich die Anbetung nicht. Lippert schreibt dem Fetischismus unter den Eraniern eine viel größere Bedeutung zu und rechnet hierher auch die Anbetung des Feuers. Der Zarathustrismus verleiht dem Feuer an sich keine göttliche Bedeutung; die Erklärungen, die ich darüber im Bundehesh aufgesucht habe (von den fünf und den drei Feuern) sind rein physisch. Gleichwohl findet eine wirkliche Feuerverehrung bekanntlich in so ausgedehntem Maße statt, daß sie vielfach als das Wesentliche der „Religion der Magier“ angesehen wurde. Möglich, daß dabei auch an einen Geist gedacht ist. Strabo erzählt, die Götter nähmen von den Opfern nur die Seele, alles Körperliche werde von den Priestern und Opfernden verzehrt. Aber dem Feuer wird Fett und Öl unmittelbar gespendet, das eben das Feuer anfacht, wie wenn es einen von der Spende sich ernährenden Geist enthielte. Auch dem Wasser wird geopfert, hier aber nach Strabos Bericht in der Weise, daß alles neben dem Wasser geschieht, dieses selbst nichts erhält, damit es nicht verunreinigt werde. Etwas Bestimmtes läßt sich für die historische Zeit nicht behaupten; diese ist zu spät, in Anbetracht der langen Vergangenheit, die das Volk schon vor seinem Eintritt in die[S. 113] Geschichte gehabt hat. In dieser Vergangenheit aber wird es wohl viel Naturmenschliches gedacht und gewirkt haben.
Wir suchen das am besten bei den Indiern auf, deren Anschauungen sich vielfach mit denen der Eranier decken, wie sie ja wahrscheinlich mit diesen am längsten zusammengelebt haben. Seit den Auseinandersetzungen Carus Sternes (Ernst Krause) neigt man von mehreren Seiten der Ansicht zu, daß die Wiege der Arier in (Nord-)Europa gestanden hat, die Indier der am weitesten nach Osten verschlagene Stamm sind, und demgemäß die urarischen Anschauungen nicht bei ihnen zu suchen sind, sondern eher an ihrem westlichen Gegenpol. Es läßt sich gegenwärtig nicht viel darüber sagen. Nur wäre es sehr merkwürdig, wenn in der Heimat noch mehr als tausend Jahre tiefe Barbarei herrschte, da bei den östlichst ausgewanderten Stämmen schon hohe eigene, nicht etwa von Fremden angenommene, Kultur strahlte. Kein Volk hat eine so merkwürdige Reihe von Religionsanschauungen entwickelt wie die Indier. Alles ist in diesen Anschauungen vertreten, des Wilden Ansichten, des Polytheisten, des Monotheisten und des höchstdenkenden, völlig abstrakten Philosophen. Und das Übel ist, daß das meiste nebeneinander hergeht, das Absurdeste mit dem Großartigsten sich nahe verträgt. Gleichwohl müssen wir annehmen, daß das Naturmenschliche an sich allem voraufgegangen ist und sich später neben dem Höheren noch erhalten hat, mitunter auch in einer Kraft, daß es dieses Höhere völlig überwallt. Als die Indier ihr jetziges Land von Iran aus erwarben und in allmählichem Vordringen in Besitz nahmen, was wohl vor mehr als viertausend Jahren geschah, fanden sie schon eine, nichtarische, Bevölkerung vor, wir nennen sie Dravida, die noch gegenwärtig wesentlich auf dem Standpunkte des Naturmenschen sich befindet. L. Feuth in seiner interessanten Sammlung „Aus dem Lande der Nibelungen“ schreibt den Dravida weite Verbreitung, bis nach Persien hin, und bedeutende Kultur zu. Ich vermag ihm aber in seinen Argumenten nicht zu folgen. Fetisch- und Seelenglaube waren vorherrschend, und böse und gute Geister erfüllten das All und wohn[S. 114]ten in allen Gegenständen, namentlich in Tieren (Schlange), doch auch in Bäumen, Pfählen, Steinen. Sollte die Seele eines Verstorbenen in einen Gegenstand einziehen, so wurde dieser auf das Grab gesetzt und mit Öl bestrichen. Das Priestertum war ein Schamanentum.
Die Indier haben manches von diesen Anschauungen und Kulten angenommen, wenn sie es nicht schon selbst mitgebracht haben sollten. Die Schlange (Nâgaa) spielt bei ihnen eine große Rolle, sogar als Gewitter- und Sturmerregerin. Krischna sieht seines Bruders Râma Seele „als Schlange aus seinem Munde hervorgehen und in das Meer gleiten, wo sie von den Schlangengöttern mit großen Ehren empfangen wurde“. Das entspricht völlig dem, was auf S. 45 gesagt ist. Und so wurde auch den Schlangen ein erheblicher Kult gewidmet. Ein anderer Fetisch ist der „weiße Elefant“, der mit dem Apis der Ägypter verglichen werden darf und der als Regenmacher dient. Gubernatis hat über die Tiere in der indogermanischen Mythologie ein umfangreiches Buch verfaßt, auf das verwiesen werden muß. Die Deutungen auf Naturerscheinungen, wie Wolken, Morgenröte, Blitz, Donner usf., lehnt Lippert ab. Für die Urzeit, wie ich glaube, durchaus mit Recht; später haben die betreffenden Tiere in der bilderreichen Sprache des Indiers allerdings zur Allegorisierung der vergötterten Naturerscheinungen gedient. Auch die Ägypter nannten trotz ihres Apis sehr viele Götter „Wildstier“. Und nicht selten ist die allegorische Bedeutung völlig vergessen und tritt das Tier an Stelle der Erscheinung, wie die Kuh für die Morgenröte, oder Kühe für Wolken, das Roß in Vertretung Indras als Sonnen- und Wettergott (auch Poseidon wandelt sich in ein Roß), wie ferner die Schlange als Wolkenungetüm, das die Wasser zurückhält und von Indra mit dem Donnerkeil erschlagen werden muß, bevor die Wasser befreit sind und auf die Erde strömen können. Der weiße Elefant wird sogar gewürdigt, sich in den Schoß der Prinzessin Maja zu begeben und von ihr als Buddha geboren zu werden. Die Seelen bedürfen in der Unterwelt der Nahrung. Sie empfangen sie aus den Opfern, den Geschenken, die sie im Leben an die Priester der Unterwelts[S. 115]gottheit Yama gespendet haben. Lippert erzählt, daß Fürsten Hunderte von Dörfern und ganze Länder an Brahmanen vergeben hätten, um dadurch im Jenseits standesgemäß versorgt zu sein. Überhaupt soll das „Gib, auf daß ich gebe“ ein Grundzug der alten indischen Indrareligion sein; was dem entsprechen würde, was von Naturmenschen zu erwarten ist (S. 39 f.). Indessen konnten doch arme Leute sich dadurch den Unterhalt im Jenseits sichern, daß sie sich auf Erden besondere Entbehrungen und Kasteiungen auferlegten. In dem als Bhagavad-Gîtâ (Gottheit-Lied) bezeichneten Zwiegespräch des Epos Mahâbharâta, das man schon mit der Ilias verglichen hat, das aber gedanklich so viel höher steht als diese, als sie im ganzen künstlerisch von ihm übertroffen wird, will der Pandu-Held Ardschuna nicht gegen seine Verwandten, die Kuruiden, kämpfen. Er sagt zur Begründung (Übersetzung von R. Boxberger):
Der Ahn darf also nur so lange im Himmel bleiben, als er Opfer empfängt, sobald dieses aufhört, muß er in die Unterwelt. Auch die Gottheit Krischna (Wischnu), die eben mit Ardschuna das Zwiegespräch hält und die so außerordentlich hohe Ideen vertritt, lehrt:
Und er stellt auch fest, daß der Mensch nach dem Tode mit dem vereint wird, woran er im Sterben denkt. Völlig wildenmäßig mutet es an, wenn in dem Atharvaveda zu dem Toten gesagt wird: „Kehre nicht zurück auf den Götterpfaden, dort bleibe, wache bei den Vätern“, und namentlich, wenn den Toten die Fessel angelegt wird: „Die Kudifessel, die man den Toten anlegt, die Hemmerin der Füße“ (S. 42). Selbst der große Sanskritkenner Max Müller gibt das Naturmenschliche in den An[S. 116]schauungen der Indier zu, aber doch nur in den allerursprünglichsten. Indem er jedoch den Gang dieser Anschauungen an einem Gott, an Agni, dem Feuergott, darlegt, sagt er: „Sie werden sehen, daß wir im Veda diesen Gott des Feuers beobachten können lange bevor er überhaupt ein Gott ist, und auf der anderen Seite werden wir seine weitere Entwicklung bis dahin zu verfolgen imstande sein, wo er nicht bloß ein Gott des Feuers, sondern ein höchster Gott, ein Gott über allen anderen Göttern, Schöpfer und Lenker der Welt ist.“ Dann erzählt er, wie Agni in den Veden oft menschlich und tierisch aufgefaßt wird. Dêva wird er zunächst, rein physikalisch, der „Glänzende“, genannt, bis dieser Name höhere und höhere Bedeutung gewinnt und Gottheit überhaupt bezeichnet. Dabei bleibt das Bewußtsein von der eigentlichen Natur des Agni: „Du, o Agni, wirst geboren, zu erstrahlen wünschend, du wirst geboren aus den Himmeln, du aus den Wassern, du aus dem Steine, du aus dem Holze, du aus den Kräutern, du, o König der Menschen, der reine“, heißt es in einem Lied des Rigveda. Daraus aber ergibt sich, daß für Max Müller Agni auch in der ursprünglichsten Auffassung nicht ein Fetisch im Sinne des Naturmenschen ist. Aus solchen Rigvedaversen an Agni, wie: „Du bist dem Menschen immer Vater und Mutter“, „Agni halte ich für meinen Vater, ich halte ihn für meinen Verwandten, meinen Bruder und meinen beständigen Freund“, könnte Agni als Ahn in Anspruch genommen werden, aber dem stehen unzählige andere Verse unmittelbar entgegen. Alles was von Agni gesagt wird, er lecke mit Zungen, er esse mit scharfen Kinnbacken, er zerkaue und strecke nieder die Wälder, er tue den Bäumen Gewalt an, er mache die Pflanzen zu seiner Speise, er schere das Haar der Erde, er springe aus dem Holz hervor usf., klingt theromorph und anthropomorph, kann aber kaum anders denn als sehr prägnante dichterische Ausdrucksweise angesehen werden (s. jedoch S. 33 f.). Wenn es dann an einer anderen Stelle des Rigveda heißt: „Agni, unser Priester, wird beim Opfer herumgeführt, ein Roß seiend“, so könnte man freilich wie bei Swantewit an einen Tierfetisch als Ver[S. 117]treter Agnis denken. Max Müller lehnt es aber ab und hält auch dieses für bildliche Ausdrucksweise, und nach allem, was sonst der Rigveda von Agni sagt, wohl mit Recht. Agni ist freilich kein ursprünglicher Gott, der Urgott der Indier scheint Indra zu sein, der später von seiner Höhe herabsank, immerhin aber stets Bedeutung hatte, während er bei den Eraniern sich nur noch als Geist findet. Der gleiche Forscher führt als weiteres Beispiel die Stürme (Marut) an, von denen auch im Rigveda ganz persönlich gesprochen wird. Sie schütteln Himmel und Erde, gleich dem Saum eines Gewandes, sie erscheinen glänzend auf ihren Wagen mit Speeren, Dolchen, Ringen, Äxten und Peitschen, die sie in der Luft klatschen lassen, sie schießen Pfeile und schleudern Steine, sie haben goldene Kopfbinden rings um den Kopf, sie werden auch als Musikanten Sänger, Pfeifer und Tänzer, mitunter auch als Vögel und als wilde Eber mit Hauern dargestellt. Man kann nicht irdischer und dramatischer sprechen, und weniger fetischmäßig. Wie es sich mit dem Soma als Gottheit, als Opfer und als berauschendes Getränk verhält, ist nicht ganz klar, so wenig wie bei dem entsprechenden Haoma der Eranier. Ursprünglich als höchst bedeutungsvoll, ja Unsterblichkeit verleihend, dargestellt, gepriesen und empfohlen, wurde es später verpönt und verboten, wahrscheinlich infolge zu großer Anwendung als berauschendes Getränk. Einen Fetisch werden wir in der betreffenden Pflanze, die also von Soma bewohnt gewesen sein sollte, kaum sehen können.
Nach allem möchte ich glauben, daß zwar die Indier des Rigveda und der folgenden Zeiten die Seele und ihr Leben naturmenschlich aufgefaßt haben. Dafür spricht schon die angenommene Seelenwanderung, von der später die Rede sein wird. Daß sie selbst Götter naturmenschlich als mit menschlichen Bedürfnissen und Schwächen behaftet sich dachten. Daß aber der Fetischglaube sich nur in vereinzelten Erscheinungen, die für das Ganze bedeutungslos waren, geltend machte, selbst wo Tiere wie Stier, Schlange, Elefant und der berühmte Affe Hanumann in Betracht[S. 118] kommen. Im einfachen Volk und bei Einzelnen wird natürlich, wie ja auch bei den höchsten Kulturnationen, sehr viel Fetischismus vorhanden gewesen sein. Aber die Religionsanschauungen der Indier nehmen eine so merkwürdige Richtung, einerseits in das rein Abstrakte, andererseits in das rein Ethisch-Anthropopathische, daß so niedrige Ansichten wie die des Fetischismus nicht in ihnen als Wesentliches existiert haben können, trotz aller heiligen Tiere und verehrten Erscheinungen. Der Fetischismus stellt sich sonst überall mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dar — er ist ja dem Naturmenschen in der Tat selbstverständlich —, die gegenständliche Ausdrucksweise der Indier ist aber meist so dunkel und verstiegen, daß wir uns zu Allegorien und Symbolen retten müssen, wenn wir nicht reinen Unsinn und absurdes Geschwätz bei einem doch so tief veranlagten, so hoch denkenden und so dichterisch empfindenden Volke annehmen wollen. Höchstens furchtbaren Dämonenglauben und ins äußerste gegen sich und gegen die Mitmenschen getriebene Konsequenz gewisser Götter- und Kultlehren müssen wir bei einzelnen Sekten zugestehen, und Leichtgläubigkeit gegenüber von Behauptungen anerkannter und nicht anerkannter Priester und Zauberer, und endlich einen verblüffenden, spitzfindigen, kleinlichen, das ganze Leben wie ein eisernes Gespinst durchziehenden Formalismus gegen die höheren Mächte, von denen selbst der so freie Buddha das Volk nicht hat lösen können. Solche Ausdrücke wie in dem Rigveda: „Indra hilft dem, der reichlich schenkt und opfert; eine heilige Handlung hat keine Wirkung, wenn die entsprechende Dakschina nicht gereicht wird“, und „Indra wendet sich ab von Dürftigkeit und Hunger“, dazu Verwünschungen von Werkfeindlichen und Nichtopfernden, sind freilich schlimm. Dieselbe Ansicht findet sich sogar in der Bhagavad-Gîtâ. Krischna sagt daselbst:
Dabei steht die Bhagavad-Gîtâ im bewußten Gegensatz zu den „heiligen Schriften“, also wohl den Veden und ihren Opferkommentaren. Noch schlimmer sind die Witwenverbrennungen und gar die tückischen Menschenopfer an die Zerstörungsgöttin Kali. Auch zeigen sich die bildlichen Darstellungen der Gottheiten meist aufs höchste abenteuerlich-grotesk und nicht selten rein götzenhaft. Wir haben aber bei den Indiern in Anschauung, Literatur und Kunst eine wunderliche Mischung von Edelstem und Rohestem, Schönstem und Abstoßendstem, wie kaum bei einem anderen Volke. Das erschwert die richtige Einschätzung außerordentlich. Denn wer hört und liest, daß Götterbilder gebadet werden sollen, daß Götterbilder mit Leben begabt und des Lebens beraubt werden, wird gewiß geneigt sein, in diesen Götterbildern Fetische zu sehen. Wer aber an die unglaublichen geistigen Leistungen des Volkes denkt, wird jenes auf gleiche Stufe stellen mit dem entsprechenden bei der Athene, bei unseren Marien- und Heiligenbildern und bei unseren Kirchen, wo ebenfalls Weihung und Entweihung stattfindet, und es mit dem Bedürfnis so vieler Menschen erklären: woran sie sich wenden, gegenständlich vor sich zu haben, und dieses dann mit Verehrung zu behandeln; und der Verehrung zu entkleiden, sobald es profanem Zwecke übergeben wird oder übergeben werden muß.
Man hat die ältere Indierreligion, die sich an die Namen Indra, Rudra, Yama, Agni, Varuna, Mitra u. a. anschließt, als die Vedareligion bezeichnet, die jüngere, um die Trimurti: Brahma, Wischnu, Çiva, mit den zugehörigen Frauengestalten, sich bewegende, als Hindureligion. Brahma gehört beiden Religionen. Für die jüngere Linie gilt hinsichtlich unseres Themas nichts anderes als für die ältere. Die Gottheiten sind nur konzentrierter und machtvoller und darum — bis auf Brahma, von dem als von einem Abstraktum[S. 120] nachher zu sprechen ist — um so furchtbarer; Çiva gehört zu den grauenvollsten Schöpfungen der menschlichen Phantasie. Die dritte und vierte, mit dem Hinduismus parallele Religionsanschauung: der höhere Brahmaismus und der Buddhismus gehen schon über eigentliche Religionsanschauungen hinaus und führen in die philosophische Theosophie und das ethische Menschentum. Wir werden ihre Hauptlehren aber gleichwohl noch, wenigstens teilweise, mit in diesem Buche behandeln.
Die Chinesen machen uns die Arbeit leicht, ihre konfuzianischen Anschauungen, die der Staatsreligion angehören, sind so völlig auf Seelen- und Ahnenglaube begründet, wie kaum selbst bei einem Naturvolke. Wie die ganze Welt durch das Zusammenwirken von Yang (Wärme, Licht, Männlichkeit) und Yin (Kälte, Finsternis, Weiblichkeit) entstanden ist, besteht auch die Seele aus zwei Teilen: einem guten Teil, Schen, und einem bösen, Kwei. Nach dem Tode gibt jener Teil die guten, dieser die bösen Geister. Der Tote bedarf der Wartung und stetiger Gaben. Letztere werden ihm jetzt meist in Attrappen aus Papier gereicht, das gilt namentlich von Geld, Menschen und Tieren. Im Hause sind auf einem Tisch Seelentafeln aufgestellt, die Namen und Rang der Ahnen enthalten, vor ihnen Opfer an Speisen und Trank. Seelentafeln besitzen auch die Tempel und Altäre der Götter, Kaiser, Heiligen, großen Männer und der Naturgegenstände (Flüsse, Berge, Sterne, Sonne, Mond, Himmel usf.), welche verehrt werden. Es wird angenommen, daß die Seelen sich zeitweilig in diese Tafeln (oder auch Bilder) begeben und von den Opfern genießen. Selbst die höchstverehrten Gegenstände, Himmel und Erde, werden als Seelen verehrt. Der Kaiser, „der Sohn des Himmels“, ist die Seele des Himmels auf Erden. So durchdringt der Seelenglaube und Seelenkult die ganze Staats- und Volksreligion, und wie das Volk allen möglichen Seelen opfert, so geschieht es auch vom Staat, vom Kaiser und den Mandarinen an bestimmten Tagen, einzeln und kollektiv. Seelen, welche sich bewähren, indem sie die Wünsche erfüllen, erhalten die ausschweifendste Verehrung; ihnen werden[S. 121] Kapellen und Tempel errichtet, das Volk strömt in Massen mit Geschenken aller Art herbei. Bleibt die Erfüllung der Wünsche aus, so geraten die Seelen in Verruf und werden verlassen. Priester und Priesterinnen sind imstande Seelen in sich aufzunehmen und von Ort zu Ort zur Anbetung zu transportieren, sie sind lebende und wandelnde Fetische. Indessen scheint es, als ob gegen das Verfahren des Wilden der umgekehrte Weg eingeschlagen ist. Dieser entnimmt die Seele dem Menschen oder Tiere und versetzt sie in die Gegenstände. Die Chinesen dagegen glauben, daß die Seele der Lebewesen aus der Seele von Gegenständen, nämlich aus der des Himmels (als Schen) und der der Erde (als Kwei) stammt. So werden auch folgerichtig Krankheiten daraus abgeleitet, daß Schen den Körper ganz oder zum Teil verläßt, und besteht die Kunst des Arztes nicht darin, einen bösen Geist aus dem Körper zu bannen, sondern den guten in den Körper zurückzuführen. Es ist also nicht richtig, wenn die Anschauungen der Chinesen denen der Naturvölker gleichgesetzt werden, vielmehr gehören sie eigentlich dem Pandeismus statt dem Pananimismus, an, und zwar einem dualistischen. Das Naturmenschliche tritt in der Verselbständigung der Seelen hervor und in den materiellen Eigenschaften, die den Seelen zugeschrieben werden. Deshalb freilich unterscheiden sich selbst die höchsten Seelen, die von Himmel (Tien) und Erde (Ki) und die der Kaiser nur graduell von den naturmenschlichen Seelen, und können allerdings sie und alle beseelt gedachten Gegenstände als Fetische bezeichnet werden. Die ganze Natur besteht aus solchen Fetischen. Der Gang der Natur, das Tao, das durch den Planeten Jupiter (Tai-sui) geregelt wird, bestimmt den Gang des Menschen; der Mensch hat sich genau diesem Gang anzuschließen, und wo er ihn nicht ohne weiteres erkennt, durch Orakel ihn zu ermitteln. Kombinationen ganzer und gebrochener Linien, die schon von dem 2300 v. Chr. gelebt haben sollendem Fohi herrühren, und denen, indem sie für Gottheiten, wie Himmel, Erde, Gewässer, Berge, Wind, Donner usf. stehen, dieser Gottheiten Seele innewohnt, dienen dazu; und die Enträtselung geschieht[S. 122] durch Priester. Die hierher zu rechnenden Lehren, die das ganze Leben und alle Handlungen des Chinesen, vom Niedrigsten zum Höchsten, regeln, hat Konfuzius im Yih-King gesammelt. Es war dem Menschen die Möglichkeit geboten, ganz in die Natur aufzugehen, ein Tschen-sjen zu werden und so mit der Welt einig zu leben. Indessen bestand ein Mittel, zum Ziele zu gelangen, doch auch darin, möglichst viele Schen in sich zu vereinigen; und das geschah ganz naturmenschlich durch Verschlucken von möglichst vielen Gegenständen, die man beseelt glaubte. Eine ganz andere Auffassung des Taoismus behandeln wir später (S. 143, 220).
Der Buddhismus, der als Foismus in China so weite Verbreitung gefunden hat, mußte sich solchen Volksansichten fügen und hat sich dem Seelenkultus angeschlossen, freilich auf eine ihm eigene, mehr geistige Weise, indem der Kultus durch Vorlesen seiner heiligen Bücher und Anrufen von Buddhas Namen geschieht. Doch kommt zur Abwendung von Unheil auch das Hersagen von Zaubersprüchen und das Opfern von Gegenständen in Frage, was ganz den Sinn der Geisterversöhnung hat. Gleiche Mittel dienen bei den Seelenmessen, die Seelen zu befreien, sie in den Zustand der buddhistischen Seligkeit zu versetzen. Wie aber hier die indische Tüftelei hineinspielt, zeigt sich an der Bedeutung des Gedankens. Es genügt oft schon, wenn ein Heiliger sich ganz in Wünsche für den Toten versenkt, um diesem die Seligkeit zu verschaffen. Wie auch in gleicher Weise ein Mensch sich selbst in den Heiligenzustand aller Grade versetzen kann, bis zum höchsten des Buddha, wenn er den Ordnungen des Hinayana und des Mahayana, die bekanntlich auch so vieles Edle und Ideale in sich vereinigen, nachstrebt. Der Buddhismus hat in Tibet und einem Teil der Mongolei als Lamaismus eine beherrschende Machtstellung gewonnen. Aber das Volk ist dabei leer ausgegangen. Es hat früher einem vollständigen Seelen- und Fetischglauben gehuldigt, war ganz dem Schamanentum ergeben, und jetzt sind Menschen seine Götter, die Lama, welche als inkarnierte buddhistische Intelligenzen angesehen werden; die beiden[S. 123] Höchstgestellten, der Dalai Lama und der Tasi Lama, als inkarnierte Boddhisattwen (historisch und geistig), die Unzahl der anderen als inkarnierte buddhistische Heilige vergangener Zeiten. Die Inkarnationen sind eine indische Erfindung; Wischnu zählt deren, Awatare, eine erhebliche Zahl. Der verkommene Buddhismus hat sich ihrer bemächtigt, um Menschenfetische aus einem der größten und edelsten Männer aller Länder und Zeiten zu schaffen. Neben den hohen Lehren des Meisters, die sich ja nicht verlieren können, wuchert greulichster Aberglaube und einfältigster Heiligenkult.
Von den Anschauungen der Japaner habe ich schon bei anderer Gelegenheit gesprochen. Ihre primitive Religion aber, mit einigen Änderungen jetzige Staatsreligion, ist der Shintoismus (chinesisch: Pfad der Götter, japanisch: Kami no Michi). Beseelung alles möglichen spielt wie in China eine Hauptrolle. Dazu die Vergöttlichung und der Kult von Herrschern und anderen Menschen (für Kriegskunst, Schreibkunst, Sittenlehre usf.) und die Verehrung von Tieren, wie Fuchs, Hirsch, Schildkröte Schlange, wesentlich wegen ihrer schädlichen Eigenschaften, sowie von gewissen Bäumen (Sakaki und Hinoki). Die Sanktuarien der Shintotempel enthalten als „Stellvertreter des erlauchten Geistes“, Mitamaschiro (auch Shintai), irgendeinen Gegenstand, einen Metallspiegel (in einem Spiegel hat die Sonnengottheit Amaterasu ihr Antlitz bewundert), ein Schwert u. a., die in Beutel oder Truhen verschlossen sind und als Fetische angesprochen werden könnten. Ähnliche Götterembleme in Schreinen haben auch die einzelnen Familien in ihrer Behausung auf einem „Göttersims“, neben Krügen oder Flaschen mit Maiswein und Vasen mit Zweigen der heiligen Bäume oder mit Blumen. Auch Familienahnendienst besteht in ausgedehntem Maße, und mitunter ebenfalls im Hause selbst, wo auf dem „Sims der erlauchten Seelen“ Seelentäfelchen stehen. Die Toten bekommen Gebrauchsgegenstände mit. Weiter an naturmenschliche Anschauungen erinnert die Furcht des Shintoisten, sich rituell zu verunreinigen. Blut, Tod und Geburt verunreinigen am meisten und nachhaltigsten, und wie der Neger die gebärende[S. 124] Frau absperrt, tut es auch der Shintoist. Auch Atem verunreinigt. Kein Verunreinigter darf einen Tempel besuchen. Und die Priester mußten mit vorgehaltenen Masken opfern, ganz wie Saxo Grammaticus von den Priestern des Swantewit erzählt, die im Tempel des Gottes nicht atmen durften, sondern zum Atmen jedesmal hinausgehen mußten. Lippert meint, da im Atem die Seele sei, solle eine Beleidigung der Gottheit, durch aufdringliche Vermischung der Menschenseele mit ihrer Seele, verhindert werden. Bei allem ist die vielfach sehr schöne Mythologie bemerkenswert, die sich auf Naturgottheiten bezieht. Der Shintoismus hat sich später mit dem Buddhismus vereinigt; die Gottheiten, Kami, wurden mit den Buddhas, Hotoke, gleichgesetzt, sie sollen die Satzungen Buddhas bewahrt haben. Karl Florenz („Die Religionen der Japaner“, in dem B. G. Teubnerschen Sammelbuche „Die Orientalischen Religionen“), dem ich in obigem zum Teil gefolgt bin, sagt: „Die Shintogottheiten werden angerufen in Verbindung mit allem Günstigen, Freudigen, Glückverheißenden; Buddha aber in Verbindung mit den Kümmernissen des Lebens und beim Tode“. Das letztere entspricht ja völlig dem Charakter der Buddhalehre, wie das erstere dem Charakter des Shinto (eigentlich des Volkes) angemessen sein wird. Der reine Buddhismus soll in Japan eine höhere Stufe einnehmen als in China oder Tibet und sich mehr den Lehren des Meisters anschließen. Gleichwohl wird das Pantheon des japanischen Buddhismus als das riesenhafteste der Welt bezeichnet, wie Japan als das tempelreichste. Doch gehört die weitere Schilderung nicht mehr hierher.
Indem wir nun noch ganz über den Stillen Ozean wandern, gelangen wir zu den amerikanischen Kulturvölkern. In Amerika überhaupt scheint der Sonnenkult besonders verbreitet zu sein; seine größte Ausbildung hat er jedoch eben unter den Kulturvölkern dieses Erdteils erfahren. Bei den Mexikanern, wo der Sonnengott zugleich Kriegsgott (Huitzilopochtli) war, nahm dieser Kult die grauseste Form durch die Massenmenschenopfer an, die mit Kannibalismus verbunden waren. Blut mußten die Menschen den Gottheiten bei jeder Ge[S. 125]legenheit als Gabe bringen; war es nicht das eines Opfers, so war es das eigene Blut durch Schlitze in der Brust, den Ohren, der Zunge, den Lippen. Im Blut wohnt die Seele, wie wir wissen. Die Mayavölker übten ähnliche Gebräuche, wenn auch nicht entfernt in der rücksichtslosen Furchtbarkeit wie die Mexikaner. Und bei den Peruanern hat der Sonnenkult schon einen bedeutenden Adel erreicht, der nur selten von Menschenopfern unterbrochen wurde. Die Inka waren Sonnensöhne und vertraten die Sonnengottheit auf Erden. Vertreter der Gottheit waren auch die Herrscher Mexikos; sie legten einen Eid ab, bewirken zu wollen, „daß die Sonne ihren Lauf gehe, daß die Wolken regnen, die Flüsse fließen und die Früchte reifen.“ Wir kennen ähnliche Verpflichtungen der Herrscher auch bei anderen Völkern, und ein König der Norweger hat sich selbst zum Opfer bringen müssen, als es unter seiner Herrschaft nicht gelang, die Götter dem Volke günstig zu stimmen und eine Hungersnot abzuwenden. In Mexiko wie in Peru erhielten die Herrscher schon bei Lebzeiten Gottesdienst und Opfer, die nach ihrem Tode fortgesetzt wurden. Menschliche Schutzgeister fanden sich überall. Zum Teil waren es die Geopferten selbst, die man dann schon bei Lebzeiten vor ihrer Opferung mit göttlichen Ehren behandelte und mit allen Gaben beschenkte, um sie sich günstig zu stimmen. Andere Geister gewann man durch Vermauern oder Vergraben von Menschen, namentlich von Kindern. Sonnensäulen und Huacas — ein Wort, das auch Geister bedeuten soll — sind Mäler solcher Schutzgeister, oder auch Steine, die sich an den Orten befinden. Viel verbreitet in Mexiko war auch die Sitte, Götter selbst zu essen. „Am dritten Jahresfeste des Huitzilopochtli verfertigen die Priester ein Bild des Gottes, zusammengebacken aus allerlei Sämereien mit dem Blute der geopferten Kinder. Nach diesem Bilde schoß ein Priester einen Pfeil und durchschoß den Gott. Dann nahm ein Priester an ihm die Handlungen vor wie an einem Menschenopfer. Er öffnete die Brust, brachte ein Herz hervor und reichte es dem Könige, der es aß. Den Leib des Bildes aber verteilte er so an die Quartiere der Stadt, daß jeder Einwohner[S. 126] ein Teilchen davon erhalten konnte. Dieses nannte man Teocualo, der Gott, den man ißt.“ So erzählt Lippert. Die Handlung läßt verschiedene Deutung zu; die einfachste und naheliegendste scheint mir doch die zu sein, daß das Bild den Gott darstellte und jeder, aus einer Opferhandlung an ihm, einen Teil von ihm in sich aufnehmen wollte. Nach dem Genannten wären die Tempel hier, in Peru, und übrigens auch anderweitig, lediglich Begräbnisstätten für einen vergötterten Ahnen. Zu all diesem Naturmenschlichen kommen nun noch die Tierfetische, die Totems. In Mexiko gelten als solche Kolibri, Reiher, Adler, Schlange, Bär usf. Und die Götterbilder erhielten sie als Symbole, wie aus nebenstehender Darstellung einer Gottheit zu ersehen ist. Im Haupttempel wurde sogar eine lebende Klapperschlange gehalten und verehrt. In Peru kommt der Kondor hinzu. Wir besitzen durch John L. Stephens (Reisen in Zentralamerika, Reisen in Yucatan) eine große Zahl von Darstellungen mittelamerikanischer Gottheiten und Kulthandlungen. Auf dem seltsamen Kreuz zwischen den beiden anbetenden Figuren im Tempel zu Palenque steht ein Hahn oder ein Reiher, die Arme des Kreuzes enden wohl in stilisierten Schlangen. Tiere, Alligatoren, Vögel, Affen, kommen auf den Bildwerken Mittelamerikas oft vor, nicht selten auch Menschen mit eigenartigen Tierköpfen.
Ich schließe damit die wohl etwas ermüdende Aufzählung. Das Naturmenschliche ist für eine Betrachtung der Welt- und Lebenanschauungen von außerordentlicher Bedeutung, weil[S. 127] es das Allgemeinmenschliche darstellt. Es verleugnet sich zu keiner Zeit und bei keinem Volke, selbst nicht bei uns, von denen nicht besonders gesprochen zu werden brauchte. Und wo es nicht offen zutage tritt, weil mehr Erfahrungen und bessere Einsichten zu anderen Anschauungen geführt haben, da wirkt es versteckt durchaus noch mit und lenkt die Ansichten weit mehr, als stolze Kultur zugestehen mag. Es ist materiell verfeinert und ethisch gehoben worden, aber im Wesen findet es sich nicht sehr verändert. Und eigentlich sind es nur der absolute Materialismus und absolute Energismus, die aber, wie sich später zeigen wird, zu absolutem Zwangssystem führen, sowie der Spinozismus, die das Naturmenschliche äußerlich ganz abgestreift haben. Demnach werden wir auch in der Folge noch oft an die bisherigen Darlegungen zu erinnern haben.
17. Polytheistische, henotheistische und antagonistische Anschauungen.
Die Gesamtheit der Gottheiten des Polytheismus können wir einteilen in: irdische Geister- und Gegenstandsgottheiten, Vergötterungen, Naturerscheinungen, Herrsch- und Schaffensgottheiten, Schicksals- und ethische Gottheiten, Prinzipiengottheiten. Die beiden ersten Gottheitenarten sind unmittelbar naturmenschlich, sie gehören dem Animismus und dem Seelen-Ahnenglauben an. Sie liefern das unübersehbare Heer der Genien, Geister, Feen, Nymphen aller Art, Dämonen, Hexen usf., wovon schon die Rede gewesen ist. Auch die Naturerscheinungen als persönliche Gottheiten aufgefaßt, enthalten sehr viel Naturmenschliches. Ist das Feuer, das Wetter, der Sturm, die Sonne, der Mond, ein Stern, der Himmel, die Erde eine Gottheit, so muß eine Beseelung angenommen sein, die mit der betreffenden Erscheinung so verbunden ist wie bei den Lebewesen. Daraus folgt natürlich nicht, daß diese Beseelung aus den Lebewesen herstammen muß, sie kann selbständig gesetzt sein und mit besonderen Eigenheiten; wie auch eine Pflanze anders beseelt ist, denn ein[S. 128] Tier, und dieses anders, denn ein Mensch. Soll also auch nicht bestritten werden, daß in gewissen Fällen die Naturgottheiten in der Tat aus Fetischen abgeschiedener Seelen hervorgegangen sind, die sich die betreffenden Erscheinungen zum Sitze erwählt haben, so glaube ich doch nicht, daß dieses in allen Fällen geschehen ist. Weder Zeus als Himmel noch Helios als Sonne, noch Wuotan als Wetter, noch Rā, Indra, Mitra, Ahura-Mazda und so viele andere enthalten einen Hinweis auf rein Seelenhaftes. Wenn Seelen ihren Wohnsitz in Sonne, Wetter, Feuer usf. aufschlagen, so geschieht das in den hervorgehobenen Fällen immer, nachdem die Gottheit von der Erscheinung schon geschieden, Zeus schon der Gott des Himmels, Helios der der Sonne usf. geworden ist. Man muß auch beachten, wie in diesen Fällen so ganz anders von den Seelen gesprochen wird als von den Göttern. Homer ist für die Griechen Kronzeuge, da er in bezug auf die Seelen ganz naturmenschlich denkt, seine Götter aber absolut nichts Schattenhaftes, wie doch die Seelen bei ihm, an sich haben. Die Vergöttlichung der Naturerscheinungen ist eine Folge des Animismus überhaupt, nicht erst der Verselbständigung der Seele und ihrer Lokalisierung in der Welt. Auf dieser Stufe des Polytheismus gehören die Weltanschauungen einem monistischen Animismus an, der nur in der Weise einer Entwicklung fähig ist, daß die Beseelungen, besser die beseelten Dinge, mehr und mehr voneinander nach ihrer Bedeutung geschieden und geordnet werden, bis Wetter, Himmel, Sonne, Gestirne usf. höher bewertet sind als selbst der Mensch. Aber die Welt ist einheitlich aus, nach Art der lebenden Menschen, bestehenden Dingen zusammengesetzt, und sie war von je so und bleibt so. Ein Polytheismus ist nur darin zu sehen, daß eben die höher erachteten, das heißt die mächtigeren, Dinge aus egoistischen Gründen verehrt werden, wie Menschen auch, die man fürchtet und sich geneigt machen will.
Wie man lernte, die Gottheiten aus den Dingen herauszunehmen und sie als Herrscher über diese Dinge zu setzen, ist schwer zu sagen. Die Erkenntnis und die Verselbständigung der Seele kann wohl nicht herangezogen werden, weil mit ihrer[S. 129] Entnahme die Ertötung der Dinge selbst notwendig verbunden war; beim Himmel und seinen Objekten, der Erde, dem Meere usf., aber davon keine Rede sein konnte. Zwar darf man von einem Sterben und Aufleben bei wechselnden Erscheinungen sprechen, wie bei Wettern, Sonnenunter- und -aufgängen u. ä., und das hat man ja auch überall getan. Aber das ist noch durchaus verschieden von der Beherrschung durch freie Gottheiten, die das wechselnde Verhalten der Dinge nach Belieben leiten. Auf dem rein animistischen Standpunkt glauben wirklich viele Völker, daß jeder Tag eine neue Sonne hat, die am Morgen geboren wird und am Abend stirbt. Ja, manche leiten daraus das Sterben der Lebewesen überhaupt ab. Ich habe die polynesische Sage von Maui, dem Sonnenheros, und seinem Tode in der Finsternisgöttin erzählt (S. 65); sein Tod brachte, erklären die Neuseeländer, das Sterben in die Welt, vorher hat alles unbegrenzt gelebt. Und Osiris, ursprünglich ein Sonnengott, ist nach seinem Tode ein Totengott geworden. Im siebzehnten Kapitel des Totenbuches heißt es: „Ich bin der gestrige Tag, ich kenne auch den morgenden Tag. Das ist Osiris. Was ist das? Der gestrige Tag ist Osiris, der morgende Tag ist der Lichtgott Rā.“ Hier zeigt sich’s ganz deutlich, daß wir es nicht mit von der Erscheinung getrennten Gottheiten zu tun haben; die gestrige Sonne ist Osiris, die heutige Rā. Aber ein Volk wie die Ägypter ist dabei nicht stehen geblieben, und wo es dem Rā oder Osiris die höchsten Eigenschaften zuschreibt, wozu auch ewige Dauer gehört, da hat es ihn von der Erscheinung schon abgelöst. Die Römer hatten etwas, das die Scheidung der Gottheiten von den Erscheinungen hätte vorbereiten können, die genii, die ja außer den Dingen stehen und diese leiten. Allein, sie schieben selbst den Gottheiten Genien zu; Jupiter hatte seinen genius wie Mars, Minerva, die anderen Götter alle, und wie Menschen und Tiere usf. Die genii standen also selbst den Göttern noch übergeordnet, die den Erscheinungen übergeordnet standen; wenn auch die genii untrennbar von den Göttern waren, daß man sie vielleicht auch als ihnen beigeordnet bezeichnen könnte.
Man wird hiernach wohl nicht umhin können, anzunehmen, daß von den Erscheinungen getrennte Gottheiten durch ein Gefühl von Höherem als die Erscheinungen sich allmählich aufgedrängt haben. Dieses Gefühl wird erst sehr dunkel gewesen sein, sich aber bei einem Volke im Laufe der Jahrhunderte zu immer größerer Klarheit herausgearbeitet haben. Wie sehr Völker zu kämpfen hatten und haben, um sich dieses Gefühls stets bewußt zu sein, sehen wir ja daran, daß immer und immer wieder die Gottheit mit der Erscheinung verwechselt, trotz schon erreichter höherer Auffassung, in die rein animistische Auffassung zurückgefallen wird. In demselben Kapitel des Totenbuches, dem obiges Zitat entnommen ist, heißt es: „Ich bin der Urgedanke dessen, was da ist und was da sein wird. Was ist es? Das ist Osiris.“ Also dieser höchste Gedanke betrifft den gleichen Gott, der nur der gestrige Tag sein sollte. Ähnliches gilt von Helios, Marduk, Jupiter, Zeus und von anderen Gottheiten. Wenn es wahr ist, daß die Namen der Gottheiten Appellative sind (was freilich gegenwärtig nur für einige zugestanden wird), nur daß wir so viele noch nicht zu übersetzen vermögen, wie Istar, Aphrodite u. a., so ist eine derartige zweiseitige Auffassung ganz verständlich, die Namen entsprechen den mit den Erscheinungen identifizierten Gottheiten, zum Beispiel Dyaus (Zeus, Jovis), „was glänzt“, „das Strahlende“. Sie blieben den Gottheiten auch, als diese von den Erscheinungen getrennt wurden; und nun waren sie zugleich nur Namen, wie von Personen, und Erscheinungsbezeichnungen, sodaß die Gottheit bald ein Individuum, bald eine Erscheinung bedeutete. Lippert geht von der Ansicht aus, daß ursprünglich dem Seelen-Ahnenglauben entsprechend die Namen der Gottheiten Herr, Herrin, Mann, Frau, Geist besagen sollten. Zweifellos läßt sich das bei einigen Namen nachweisen. Zeus als Ὑπατος ist höchster Herr, Schang-ti der Chinesen für Himmel ist das gleiche, Freia ist die Frau, Mannus der Mann usf. Aber andere sind ebenso sicher nicht auf solche Bedeutungen zurückführbar. Dyaus, Dev, Div als Glanz, nach Max Müller, ist schon erwähnt. Hier freilich macht Lippert eine sehr treffende Bemerkung. Bei den[S. 131] Eraniern sind die Dev gerade das Entgegengesetzte wie bei den ihnen so nahestehenden Indiern, nämlich böse Geister statt gute. Es wäre nicht denkbar, daß man die bösen Geister auch als glänzende bezeichnet hätte. Es müsse darum Dev ursprünglich eine beiden Völkern gemeinsame neutrale Bedeutung besitzen. Und diese findet er nach Worten in slawischen Sprachen in der Tat nahestehend den Bezeichnungen seiner Annahme. Die Etymologien sind vielfach recht unsicher, er kann in diesem Falle wohl recht haben. Amun heißt aber der Verborgene oder Gerufene, Brahma der Sprechende, Agni der Flackernde, Apollon der Abwehrende, Helios der Brennende, Artemis die Schlachtende (als Todesgöttin), Wuotan der Wütende (der Stürmende) usf. Auch wären solche Namen wie Dyauspitar (Jupiter), Demeter unnötige Pleonasmen, wenn der erste Teil nichts anderes besagte als der zweite. Zu beachten ist endlich, daß umgekehrt selbst Personennamen in Würdebezeichnungen übergegangen sind, wie Cäsar in den Kaiser. Die Ansicht Lipperts wird sich also wohl kaum allgemein aufrecht erhalten lassen. Wo sie aber bei höchsten Auffassungen zutrifft, handelt es sich oft lediglich um Anerkennung der höchsten Herrschaft, wie bei unserem der HERR, nicht um Ahnenglauben.
Wenn die Gottheiten von den Erscheinungen getrennt sind und nun diese beherrschen, so verursachen sie sie auch, wie Poseidon oder Wuotan den Sturm, Zeus oder Indra den Donner und Blitz, Osiris die Nilüberschwemmungen. Sie treten also nicht bloß als Leiter und Herrscher auf, sondern auch als Hervorbringer, und wenn die letztere Eigenschaft ausgedehnt wird, können sie auch zu Schöpfern werden. Indessen hängt es wohl mit der ursprünglichen Anschauung von den Gottheiten als den Erscheinungen selbst zusammen, daß in vielen Fällen sie tatsächlich nicht als Schöpfer dieser Erscheinungen gelten. Im Gegenteil finden wir vielfach Kosmogonie mit der Theogonie verbunden; Erscheinung und die zugehörige Gottheit erstehen zugleich, oder sie sind zugleich vorhanden. Allenfalls werden Menschen, Lebewesen überhaupt, von einer Gottheit geschaffen. Und selbst dabei ist oft Unsicherheit und Zweideutigkeit vorhanden, indem[S. 132] neben diesen Schöpfungen auch spontane Entstehung angenommen wird, oder einfacher, Abstammung von Gottheiten auf natürlichem Wege. Es ist fast trivial, auf Hesiodos’ Theogonie zu verweisen. Chaos, Ge, Tartaros, Eros werden, und nun entwickelt sich die ganze Götterreihe, wobei die Erscheinungen als ihnen selbstverständlich zugehörig und mit ihnen hervorgehend angesehen sind. Uranos entsteht mit dem Himmel, Helios mit der Sonne, Pontos mit dem Meer usf. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Ägyptern. Nun = Thot (Urwasser = Urgeist) sind vorhanden, es entwickelt sich die kosmogonische Götter-Vierpaarheit; wodurch die Grundlage zu allen Erscheinungen gewonnen ist. Aus einem Ei, das das Paar He-Hehet aus dem Urwasser heraufholt, ersteht Rā und mit ihm sogleich das Licht, die Sonne. Rā aber differenziert sich in neue Gottheiten, welche Naturerscheinungen darstellen. Unter den verschiedenen indischen Kosmogonien entspricht die wichtigste, mit den Grundelementen Tad (Das), Tapas (Inbrünstige Betrachtung), aus denen Kama (Wille), Ritam (Weltordnung, Kausalität), Satyam (Wahrheit, Folge) und der Wechsel von Tag und Nacht, Sonne, Mond, Gestirne usf. hervorgehen, gleichfalls diesem Prinzip. Noch mehr hierher gehört vielleicht die Kosmogonie, die mit Brahmanaspati (Herr des Gebets oder Opfers) als Urprinzip beginnt. Âditi und Dakhsha sind seine Folgen, das, woraus entsteht, und das, was entstehen lassen kann. Daraus die Âdityas, zu denen Varuna gehört. Dieser nun ist der eigentliche Weltschöpfer: er schafft alle Wesen, erhält Himmel und Erde, er setzt die Sonne an den Himmel. Die Sonne (Sûrya) wird jedoch auch wie Rā in einem Weltei aus dem Urmeere emporgehoben. Nach einem Rigvedahymnus stellt Varuna einen Baum „in das Bodenlose“ auf, der wohl ein Weltbaum sein soll, wie die Esche Yggdrasil der Germanen. W. Schwartz hat ein Buch, „Indogermanischer Volksglaube“, geschrieben, in dem er den Weltbaum als Licht- oder Sonnenbaum erklärt und als kosmogonisches Prinzip in Anspruch nimmt. „Das aufsteigende Licht erschien .... als Lichtsäule oder unter dem Reflex eines[S. 133] Baumes als Stamm; die in den Wolken sich verästelnden Sonnenstrahlen als Äste und Zweige, die Wolken als Blätter.“ Nach ihm und anderen wären Sonne, Mond, Gestirne Früchte dieses Himmelsbaumes. Ich kann diesem und was noch weiter von fast allen Erscheinungen als mit dem Weltbaum zusammenhängend gesagt wird, nicht folgen, so interessant die Ausführungen im einzelnen sind. Der Weltbaum ist, glaube ich, lediglich als Stütze der Welten gedacht, oder als Träger, da ja für den wissenschaftlich nicht geschulten Geist eine Stütze durchaus nötig ist, so daß eine solche fast auf der ganzen Welt als Baum, Berg, Säule, Tier, Mensch usf. angenommen wird. Varunas Baum wird nichts anderes sein, wie auch Zeus’ Baum, auf den er die Welt gleich einem Gewand gehängt hat. Bei den Japanern entstehen wenigstens die Sonnen-, Mond- und Sturmgottheiten (Amaterasu, Tsonkiyoumi, Sousano) zugleich mit Sonne, Mond, Gewitter aus dem rechten und dem linken Auge und aus dem Atem des Götterpaares Isanami und Isanaghi.
In anderen Fällen sind die Gottheiten vorhanden, und besondere von ihnen bauen die Welt, wenn nicht einer von ihnen alles bildet. Dann werden die Erscheinungen unter die Gottheiten verteilt. Schon die Ägypter kennen einen allgemeinen Weltschöpfer, der bald Amun, bald Osiris, Rā, Ptah, Atum oder Tum genannt wird. So heißt es in dem siebzehnten Kapitel des Totenbuches: „Ich, der Gott Atumu, ich bin der Seiende. Ich war allein im Urgewässer (Nun). Ich, der Gott Atumu, der Schöpfer des Himmels und Bildner des Seienden, ich bin aufgegangen aus dem Urgewässer.“ „Ich bin der Lichtgott Rā in seinen ersten Aufgängen. Was ist das? Nämlich der Lichtgott Rā als König am Anfang seiner Herrschaft über das, was er erschaffen hat.“ Aber an der gleichen Stelle wird doch Rā als Gottheit (Atumu) in der Sonnenscheibe bezeichnet: „Ich bin der, welchen keiner unter den Göttern übertrifft. Was ist das? Das ist Atumu (wofür auch Rā steht) in seiner Scheibe.“ Und ferner wird ein solcher Schöpfer zunächst nur Schöpfer der Gottheiten dargestellt, die nun ihrerseits weiterschaffen. So heißt es in dem sogenannten[S. 134] Apophisbuch von 310 v. Chr., das einem Priester Esmin ins Grab gegeben war und ihn in der Unterwelt vor dem Feinde Rā’s, dem Drachen Apophis, schützen sollte, und in dem Rā als Allherr redet:
Nun wird, wie in babylonischen und anderen Schöpfungsgedichten, erzählt, was nicht vorhanden war. Dann lautet es: „Ich schuf alle Gestalten, indem ich allein war.“ „Es entstanden viele Gestalten der Gestalten, In den Gestalten der Erzeuger Und in den Gestalten ihrer Kinder. Ich ergoß Samen in meine Hand, Ich begattete mich mit meinem Schatten.“ „Ich spuckte aus den Schu, ich spie aus die Tafêne (Tafnut).“ „Sie (diese Götter) brachten mir mein Auge hinter sich her, Und nachdem ich es mir eingesetzt hatte, Weinte ich über sie. So entstanden die Menschen.“ Bis auf das letzte sehr schöne Bild, daß die Menschen aus den Tränen (rîme = weinen, rôme = Mensch) des Gottes entstehen, ist alles wunderlich, kraus und zum Teil häßlich. Weiter wird erzählt, wie von Schu und Tafnut alle anderen Götter hervorgehen. Sie erzeugen Qeb und Nut, diese Osiris, Seth, Isis, Nephthys. In einem anderen Text sagt Rā zu Thot: „Ich werde dich aber die beiden Himmel mit deiner Schönheit und deinen Strahlen umfassen lassen.“ Und als Erklärung wird hinzugefügt: „Das ist die Entstehung des Mondes, des Thot.“ Der Wert derartiger Feststellungen wird dadurch sehr geschmälert, daß sie so oft auf einem Wortspiel beruhen. Und in Wortspielen ist niemand so groß wie die Ägypter, Brugsch gibt eine Menge Beispiele dafür.
Bei den Babyloniern sind die Gottheiten schon vor der Welt vorhanden, mindestens die drei: Anu, Ellil und Ea, wohl auch die Istar. Andere heißen ihre Söhne, wie Marduk Sohn Ea’s genannt wird. Die Welt ist, wenigstens zum Teil, von Marduk gebildet. In dem Schöpfungsepos, Enuma Elis, Tafel VI ist leider gerade der diese Bildung beschreibende Text fast ganz zerstört. Einiges ersieht man aber aus der Tafel VII, in der[S. 135] Marduk unter verschiedenen Namen gepriesen wird. Dort heißt es von ihm u. a.:
Ein anderer Text gibt Anu als Schöpfer des Himmels, Nudimmud, d. i. Ea, als Schöpfer des Ozeans an. Letzterer schafft dann auch aus Lehm den Ziegelgott, den Schmiedegott, kurz überhaupt die Handwerksgötter, und ferner Berge, Meer, Rohr, Wald, Könige, Menschen usf. Nach noch einem anderen Text ist es die Göttertrias Anu, Ellil und Ea, die Sonne und Mond mit den Gottheiten Samas und Sin hervorbringt. Wunderlich klingt folgende Reihe aus einem als „Beschwörung gegen Zahnschmerz“ bezeichneten Texte. Der Verfasser beginnt mit dem Uranfang, ehe er zu seinem Zahnwurm kommt, der ihn plagt:
Was endlich in einem letzten Text (alle aus „Greßmann, Altorientalische Texte“ entnommen) der Strom, „der alles schuf“ und den die großen Götter gruben und mit Zyklon, Feuer, Grimm, Schrecken, Furchtbarkeit begabten, bedeuten soll, weiß ich nicht. Die babylonischen Texte enthalten nicht selten, was uns Aberwitz erscheint. Wir haben ja auch unter ihnen reine Schülerarbeiten und Formeln von irgendwelchen obskuren Beschwörern; Kundgebungen, die nicht besser ausgefallen sein werden, als solche gegenwärtig ausfallen.
Ähnliche Ideen von der unabhängigen Schöpfung der Erscheinungen und der Gottheiten finden sich bei den Indiern. Da aber bei diesen ja alles vertreten ist, läßt sich eine Scheidung zwischen den einen und den anderen Ideen kaum be[S. 136]wirken. So gehört das oben (S. 132) Gesagte zum Teil auch hierher, namentlich wenn die Gottheiten so verblaßt sind wie dem Varuna (oder wie der schaffende Gott genannt wird) gegenüber. Vielleicht hierher gehört auch die germanische Kosmogonie, denn im Eddagedicht Vafthrudnismal werden für Sonne, Mond, Tag, Nacht, Jahreszeiten Väter angegeben (Mundilföri für Sonne und Mond, Dallingr für den Tag, Norvi für die Nacht, Windswalr für den Winter, Savasudr für den Sommer: alle offenbar Appellativnamen). Die Erde ist aus Ymir hervorgegangen. Aber das Voluspagedicht, das von letzterem sehr wohl weiß, erzählt nichts von Vätern der erstgenannten Dinge; Sonne und Mond werden als vorhanden eingeführt, nur ohne Namen und ohne bestimmten Sitz, bis beides die Götter verliehen.
Die Schicksalsgottheiten sollten nach unserem Gefühl mit den ethischen Gottheiten verbunden sein. Tatsächlich sind sie es nicht, sie stehen neben diesen. Sie sind auch früher als diese, denn Ethik, selbst nur Sinn für Recht und Unrecht ist nicht ursprünglich naturmenschlich, sondern Folge höherer Gesittung; ein praktisches Regulativ zwischen Egoismus und Altruismus, das das wirkliche Zusammenleben der Menschen miteinander ermöglicht — abgesehen von der Kindesliebe, die ja überhaupt nicht bloß eine menschliche Eigenschaft ist. Die Schicksalsgottheiten entstammen dem dumpfen Gefühl der Ohnmacht des Menschen gegen Tod und Unheil. Alle müssen sterben, und vieles Unheil läßt sich mit aller Mühe, allem Flehen und allen Gaben an die gewählten Gottheiten nicht abwenden. Da der Mensch jedes gegenständlich auffaßt, so denkt er sich zuletzt persönliche Mächte, welche unbewegbar walten, und deren Willen gegenüber selbst seine Gottheiten ohnmächtig sind. So hängt sein Los ab von diesen Gottheiten und vom Schicksal. Erstere bewirken alles, sofern jene letzteren indifferent sich verhalten, Gutes und Böses; daher ihre Verehrung und Versöhnung mit Gabe und Beschwörung. Aber die Schicksalsgötter sind nicht zu beugen, sie werden darum sehr gefürchtet, und an ihnen wird möglichst vorbeigegangen. Die Griechen hatten für ihre[S. 137] Moirai: Klotho, Lachesis, Atropos; die Spinnerin (des Lebensfadens), die Loserin (der Geschicke), die Unabwendbare, einen gewissen, aber nur wenig verbreiteten Kult; die Römer für ihre Parcae: Nona, Decima, Morta, gar keinen, obwohl Parca ursprünglich Geburtsgöttin war. Ob die germanischen Nornen, in der Edda Urdr, Verdandi, Skuld (aber auch andere) verehrt worden sind, steht wohl nicht fest. Je höher die Herrscher- und Schaffensgottheiten steigen, um so mehr müssen die Schicksalsgottheiten zurücktreten. Sie verhalten sich darum überhaupt mehr passiv; sie herrschen nicht, schaffen nicht und leiten nicht. Sie bestimmen nur ein für allemal. Was sie bestimmen, geschieht, mitunter freilich (wie bei Homer) unter ihrer Mitwirkung. Trotz ihrer unabwendbaren Macht sind sie also nicht immer kosmische Gottheiten. Die griechischen Moiren waren Töchter von Zeus und Themis. Daher sind sie von den Unsterblichen den Sterblichen gesetzt, wie Penelope sagt. Ja, jedem Sterblichen kann eine Moira gesetzt sein. Dann ist Moira einfach das Geschick, und Zeus heißt der Moiragetes, wie Apollon der Musagetes. Aber Hesiodos nennt im „Schild des Herakles“ Atropos die „älteste und erhabenste Göttin“. Die Nornen haben zum Teil noch niedrigere Abkunft, außer von Göttern auch von Alben und Zwergen. Mehr der indischen Auffassung von der Allbedeutung und Allmacht des Wortes entspricht die griechische Aisa und römische Fata für Moira und Parca. Es sind der Spruch des Zeus und des Jupiter, als der höchsten Gottheiten, dem aber diese Gottheiten selbst nicht mehr sich entziehen können, so daß die Folgen ganz unabwendbar bleiben. In dieser Auffassung schwinden die Schicksalsgottheiten als solche völlig und gewinnt das Wort bestimmende Kraft, oder der Spruch, oder der Gedanke, oder das Opfer. Das gehört schon in die Betrachtung der letzten Klasse von Gottheiten. Bei anderen Völkern als den genannten habe ich besondere Schicksalsgottheiten, den Moiren entsprechend, überhaupt nicht finden können; bei diesen werden also die eigentlichen Gottheiten zugleich auch das Geschick bestimmen. Sie haben auch nicht solche Sagen wie die Griechen, von dem Sturz ganzer Götter[S. 138]dynastien, und wie die Germanen, von der Vernichtung von Göttern in der Götterdämmerung, wenn auch Weltvernichtung ihnen bekannt ist.
Ins Äußerste getrieben, führt die Schicksalslehre zum Fatalismus, dem Kismet, einem Bruder der rein mechanistischen Weltanschauung. Selbst das noch verhältnismäßig frohe Griechentum kennt diese triste Seelenberuhigung, der sich später namentlich die stoische Schule bemächtigte. Aber wie rührend klagt nicht schon Hekabe in den Troerinnen des Euripides:
Von Gottheiten wie Nike, Fortuna, Victoria, Sors usf. braucht hier nicht gesprochen zu werden.
„Fast in allen polytheistischen Religionen,“ sagt Twesten in seinen „Ideen der asiatischen Kulturvölker und Ägypter“, „welche Spuren ihrer älteren Gestaltung in der Überlieferung oder in dem späteren System bewahrt haben, bei den indischen und iranischen Ariern, wie bei den Ägyptern und bei den Griechen, tritt die Verbindung der Götter mit den Körpern oder Kräften der Natur mehr und mehr in den Hintergrund, indem bald an denselben Göttern intellektuelle und moralische Eigenschaften die Naturseite zurückdrängen, bald ein neues Geschlecht das ältere ersetzt, wenn dieses den geistigen Ansprüchen nicht mehr genügt.“ Das letztere muß zwar, als zu hoch gedacht, abgelehnt werden, aber mit dem voraufgehenden kann man sich nur einverstanden erklären.
Die ethischen Gottheiten, sofern sie mit dem Jenseits in Verbindung stehen, werden wir später behandeln. Für das Diesseits besondere ethische Gottheiten einzuführen und hoch zu verehren, war nur den Griechen vorbehalten. Apollon, Nemesis, Themis haben nirgends ein gleiches. Die Furiae der Römer, die den Erinnyen entsprechen, stehen gleichwohl in weiter Ferne von ihnen, da sie nur Gespensterseelen von Verbrechern sind, deren die Götter sich bedienen, lebende[S. 139] Verbrecher zu schrecken und zu strafen. In Apollon hat das, was wir als Griechentum bezeichnen, die Kalokagathie, seine blühendste Idee erreicht. Sonst werden die verschiedenen Gebiete des Ethos von verschiedenen Gottheiten mitverwaltet, insgesamt namentlich von der höchsten Gottheit. Die griechische Kalokagathie schließt ein: Gerechtigkeit, edles Benehmen, in sich gefaßte Harmonie des Lebens, ruhige Milde, Liebe zu Kunst und Kenntnis. Was über diese Eigenschaften hinausgeht: die entsagende, tiefgefühlte und stets geübte Liebe zur Menschheit, gehört, soweit ich sehen kann, nicht zum Kreise der Apollinischen Lehren. Man denke nur, wie als etwas so Außerordentliches es hervorgehoben wurde, daß die Athener einen Altar des Mitleids hatten, was doch selbstverständlich hätte sein sollen. Ein anderes dagegen mutet uns in der Apollinischen Lehre christlich und mosaisch an, die Entsühnung von Sünde; Apollon ist auch der entsühnende Gott. Er ist überhaupt die Gottheit des höheren inneren Lebens, darum auch der Amphiktyonie. Am nächsten den Griechen stehen die Eranier; Ahurô Mazdâo ist das Prinzip des Guten, er ist aber zugleich ein Weltgott, das Prinzip des Lichtes. Das Gute, das er vertritt, bedeutet Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit. Das Schöne fehlt bei ihm, das für Apollon so charakteristisch ist: die edle Einfalt und stille Größe, wie Winckelmann von der Kunst der Griechen sagt. Wohl auch die vorbezeichnete Liebe. Ahurô Mazdâo, Ormuzd, gleicht mehr dem Zeus, der ja auch die Gerechtigkeit verwaltet, und nur partiell dem Apollon. Die Indier haben in der Wischnu-Lehre einen wunderlichen Ausweg gefunden, um einen Gott in verschiedener Bedeutung für die Welt erscheinen zu lassen und ihn zugleich menschlich-persönlich zu machen, die Inkarnationen, Awatâras, Wischnus. Von diesen kommen hier die erste und neunte in Betracht. Als Krischna ist Wischnu das Ideal alles Edlen, Guten und Schönen; halb Gott, halb Mensch, zieht er von Land zu Land in stetem Kampfe mit dem Schlechten und Gemeinen. Die schon erwähnte Bhagavad-Gîtâ (S. 115) enthält die Lehren dieses Gottes. Sie werden unendlich variiert vorgetragen:
An anderer Stelle werden Wollust, Zorn und Geiz die drei Pforten der Unterwelt (Hölle) genannt. Das entspricht alles der Apollinischen Lehre. Und doch ist im wesentlichen Krischnas Lehre weit von dieser entfernt, denn ihr Grundzug ist die absolute Entsagung; frei von Begierden, aber auch frei von Gefühlen. Den Menschen soll kein Leid anfechten, aber auch keine Freude erfreuen, die Sinnenwelt soll ihm nichts gelten:
Und an anderer Stelle:
Das ist nichts Apollinisches, Apollon ist der Gott des maßvollen Lebens, er ist auch der Gott der schönen Sinnenwelt. Krischnas Lehre hat im späteren Buddhismus ihre Höhe erreicht (S. 214 f.). Und wirklich wird der Buddha als neunte Inkarnation Wischnus angesehen. Nach der Meinung der Wischnuiten gibt es unzählige Buddhas, die jedesmal erscheinen, wenn die Welt in Genuß, Sünde und Leiden versunken ist. Der geschichtliche Buddha ist einer von ihnen. Und der Zweck der Lehre? Nicht die Menschheit apollinisch zu immer höheren und höheren Idealen zu führen, sie immer mehr dem Schönen und Guten zu unterordnen, sondern ihr den Willen zum Leben zu nehmen, daß die Menschen nicht im Kreise der Seelenwanderung wiederkehren, daß sie in das allgemeine Nirwana — Krischna, als das Allwesen, sagt: in ihn — eingehen und aufgehen. Davon später.
Andere Völker haben auch Gottheiten, die die Sitte wahren, wie die Germanen Freyr, Freia und Fricka, aber nicht ganz[S. 141] von der Bedeutung und der Hoheit der behandelten. Bei manchen finden sich „Söhne“ der Gottheiten, wie Söhne des Rā in Ägypten, die Sonnensöhne des Inkalandes, die Himmelssöhne des Reiches der Mitte, die Nachkommen der Amaterasu in Japan. Dann haben diese als Fürsten und Herrscher die Bedeutung ethischer Gottheiten, neben ihren sonstigen göttlichen Eigenschaften. Ethos wird dann freilich meist von diesen Herrschern definiert. Und wenn dabei Eigennutz, Grausamkeit, Schwäche und Urteilslosigkeit mitspielen, so ist das Volk dieses auch von seinen Gottheiten gewöhnt. Aber Ordnung schafft diese Anschauung. Und mitunter in so bewunderungswürdiger Weise wie in Peru, da der Mensch über den Menschen mehr unmittelbare Macht hat als die Gottheit, er also jeden zu seinem willenlosen Sklaven zwingen kann. Später tritt das Gesetz als diese Gottheit auf und die gesellschaftliche Sitte; die Gesamtheit ist die Exekutive, oder Organe sind es, die bestellt sind. Keine höhere Stufe aber gibt es, als wenn das sokratische Daimonion in uns wohnt, wir das Ethos aus uns selbst schöpfen.
Wir kommen zu der letzten Klasse von Gottheiten, zu den Begriffsgottheiten. Es versteht sich von selbst, daß je höher die Gedanken von den Gottheiten steigen — ohne daß diese Gottheiten in das All selbst einverleibt werden, was der Pandeismus vollbringt, dessen Betrachtung später folgt —, diese um so mehr der irdisch-menschlichen Eigenheiten, Eigenschaften entkleidet werden. So nähern sie sich stetig dem rein Begrifflichen, und das Persönliche macht sich nur noch in der Art des Begrifflichen geltend, und darin, daß auch dem Begrifflichen Wirkung zugeschrieben wird. Die Indier allein haben es hier zur letzten Konsequenz gebracht. Ihre begriffliche Urgottheit ist Tad, nichts weiter als Das ohne jede Eigenschaft; nicht einmal Sein oder Nichtsein wird diesem reinen Begriff zugesprochen. Doch weil mit einem solchen einzelnen Begriff absolut nichts anzufangen ist, haben die Indier freilich noch andere Begriffsgottheiten eingeführt, wir das Wort oder der Spruch oder der Gedanke, die Ordnung, das Opfer. Ist die Welt vorhanden, so können[S. 142] diese Dinge als weltregierende Prinzipe angesehen werden, die Prinzipe sind vergottheitet. Mußte die Welt jedoch erst geschaffen werden, so ist den Begriffen eine tätige Macht zuzuschreiben. Davor sind die Indier nicht zurückgeschreckt, sie sind konsequenter gewesen als Platon, zwischen dessen Ideen und den Dingen eine unüberbrückbare Kluft besteht. Die Begriffe wirken wie der Logos, λόγος, von dem wir noch zu sprechen haben, und sie werden auch so persönlich gefaßt wie dieser λόγος. Andeutungen einer solchen Begriffsanschauung finden sich bei den Indiern schon in frühester Zeit. So heißt es in den Vedânta-Upanishaden: Am Anfang war das Sat. Max Müller übersetzt Sat mit das Seiende, τὸ ὄν; an einer anderen Stelle wird gesagt: Am Anfang war das Asat, also das Nichtseiende, τό μὴ ὄν. Wie in einer Polemik gegen diese sich anscheinend widersprechenden Angaben wird in der Bhagavad-Gîtâ behauptet: „Das anfangslose Brahma heißt nicht Sein noch Nichtsein“. Daher auch andere Formeln vorhanden sind wie: „Im Anfang war das Selbst“, was wohl Tad bedeutet. Oder Tad twam asi: „Das Selbst bist du.“ Es ist ganz natürlich, daß so abgrundtief-abstrakte Auffassungen dem Ausdrucke, der doch immer an dem Materiellen hängt, widerstreben, und daß darum selbst noch so weitgehende Umschreibungen doch immer an Materielles erinnern. Aber freilich kommt hinzu, daß, indem aus dem Immateriellen Materielles folgen soll, ersteres selbst auf der höchsten Stufe unwillkürlich Materialität gewinnt und so zu dem äußersten Seienden wird, das alles umfaßt. Hier nun verschmilzt die Begriffsanschauung einerseits mit dem Deismus und Pantheismus, sowie mit der Theosophie und dem Emanismus, die bald zu besprechen sind. Andererseits geht sie in den Materialismus insofern über, als, sobald sie materialistisch ist, sie in die Anschauung einer Allmaterie führt, oder zu etwas, das in der materiellen Welt wahrgenommen wird. So heißt es in denselben Upanishads, die von dem Selbst als von dem Urding sprechen, auch: Am Anfang war Finsternis; und gar: Am Anfang war Wasser; auch: Am Anfang war Pragâpati, der Herr alles Geschaffenen.
Sehr nahe den Begriffsreligionen scheint der von Lao tsse (etwa um 600 v. Chr.) bei den Chinesen weitergebildete (S. 122) „Taoismus“ zu stehen. Das Urwesen ist Tao, ein absolutes Sein und absolutes Wissen, also etwa wie das indische Tad mit Tapas vereint. Zu diesem Tao kommt Yin, das gebärende weibliche Prinzip, und Yang, das tätige, gestaltende männliche. Ihnen gesellt sich das Khi, eine Art Eros. Damit sind neben Tao noch drei kosmogonische Prinzipe gewonnen. Die ganze Welt, bis ins einzelne, existiert von je in Tao. Durch jene drei, wohl auch in ihm gedachte Prinzipe, kommt sie zur Wirklichkeit. Und so ist Tao auch der höchste Gott, dem aber als abstraktem Wesen weder Opfer, noch Gebet, noch Geschenk frommt, sondern nur ein tadelloses Leben (S. 122). Eine solche geistige Lehre konnte für die Chinesen so wenig bedeuten, wie die entsprechenden hohen Lehren anderen Völkern. Sie ist bald in Verfall geraten und hat sich der staatlichen Religion gegenüber nicht halten können. Die Griechen sind spät erst zu Abstrakten als kosmogonischen Prinzipen gelangt, wie δύναμις, νοῦς, ἀνάγκη, πιστίς; Schaffenskraft, Vernunft, Notwendigkeit, Glaube und Ähnliches. Die römischen Begriffsgottheiten darf man nicht hierher rechnen; die Indigetes sind allmählich ersonnene, Tätigkeiten und Geschehnisse darstellende, und darum ihnen vorstehende Gewalten, die der Römer auf Schritt und Tritt vor sich fand, und die nichts mit den höheren Fragen der Menschheit zu tun hatten, sondern nur mit ihren Verrichtungen und den Vorgängen in ihrem Leben. Es sind vergeistete Begriffe; jeder einem engen Gebiet angehörend und insgesamt, trotz der sehr großen und beliebig zu vermehrenden Zahl, für die Weltanschauung nicht bedeutender als die Geister selbst. Das sieht man an solchen Vergeistungen wie Adeona (für die Rückkehr der Kinder), Afferenda (für die Zubringung der Mitgift), Fabulinus (für das Sprechen der Kinder), Mutunus Tutunus (für die Begattung und Befruchtung) usf. Nicht wenige im Heer der Indigetes sind überhaupt Erscheinungen, wie der berühmte Aius Locutius, die mächtige Stimme, welche dem Plebejer M. Caedicius in der Nacht verkündete, daß die[S. 144] Gallier auf Rom rückten, und andere. Von weiteren Völkern ist in dieser Hinsicht noch weniger zu sagen, sofern es sich um Anschauungen im Gebiete des Religiösen handelt. Erst in einer monotheistischen Anschauung finden wir eine Bezeichnung Gottes, die ganz der begrifflichsten der Indier entspricht. Da Mose in der Szene am Dornbusch Gott um seinen Namen fragt, um sich dem Volke gegenüber darauf berufen zu können, wird ihm zur Antwort: Eheje ascher Eheje, „Ich werde sein, der ich sein werde“, so solle er dem Volke sagen. Wie das indische „Tad twam asi“ klingt dieses. Und der Name, den wir Jehova lesen, steht ja auch mit Sein in Verbindung. Und auch darin ist viel Ähnlichkeit zwischen den in Religionsanschauungen von allen Ariern am weitesten gekommenen Indiern und den in gleicher Weise unter allen Semiten am meisten sich auszeichnenden Hebräern, daß neben dem Abstraktesten als Gottheit auch so Konkretes aufgefaßt und ausgesagt wird, nur daß hier das Konkrete bei anthropomorphistischer Redeweise endet, dort darunter noch tief hinabgeht. Namentlich aber fehlt den Hebräern die Mehrheit der Begriffsgottheiten, die sich bei den Indiern in Tad, Tapas, Om, Ritam, Satyam, Brahman, Purusha, Sat, Asat usf. kundtut und eben dem Polytheismus angehört, im Gegensatz zum Monotheismus.
Die religiösen und die mit ihnen zusammenhängenden Weltanschauungen im Polytheismus haben sich noch nach anderer Richtung hin entwickelt, nach der des Henotheismus. Ich muß aber hier eine Bemerkung, die ich über diese Heraushebung einer gewissen Erscheinung in den Religionsansichten in meinem Buche „Die Entstehung der Welt“ gemacht habe, zurücknehmen. Ich halte jetzt den von Max Müller betonten Unterschied zwischen Henotheismus und Monotheismus für durchaus berechtigt, ja notwendig. Bekanntlich hat man früher dazu geneigt, der Menschheit den Monotheismus als das Ursprüngliche, den Polytheismus als das Spätere zuzuschreiben. Der lange und heftig darüber geführte Streit ist im Grunde wesenlos. Wenn ein Mensch mit dem Begriff Gottheit nicht das verbindet, was wir damit[S. 145] verbinden, sondern nicht mehr als was der Naturmensch darunter versteht, oder höchstens die Annahme einer besonderen Übermacht, so ist es ziemlich gleichgültig, ob er mehrere Götter setzt oder nur einen Gott. Indessen müssen wir doch auch sagen, daß der Naturmensch praktisch sicher sich niemals mit einem Gott begnügt. Die Idee, die er von Gott hat, ist so ganz auf ihn und seine Bedürfnisse zugeschnitten, daß er immer eine große Zahl von Gottheiten braucht. Wie er, wenn er steigern will, einfach die Worte wiederholt, zum Beispiel viel-viel für mehr, ferne-ferne (vgl. das griechische Tar-Taros) für sehr ausgedehnt, so nimmt er zwei und mehr Gottheiten, um sein Ziel desto sicherer zu erreichen. Und da die Gottheiten auch so beschränkt sind, wie er selbst sich fühlt, bedarf er für jeden besonderen Fall auch eine besondere Gottheit. Ich habe schon erwähnt, daß oft in Hütten unzählige Gottheiten vorgefunden werden, und daß dem Wilden und dem nicht unterrichteten Volke überhaupt die ganze Welt mit Geistern aller Art erfüllt ist. Es mag sein, daß manches Volk schon in sehr frühen Kulturzuständen eine reinere Religionsanschauung besitzt. Curtius spricht in diesem Sinne von den Pelasgern und ihrem Dienst zu Dodona, der sich wesentlich nur auf ein Götterpaar, Zeus und Dione, bezogen haben soll. Allein Religionen entwickeln sich in der Regel mit steigender Kultur zu immer höheren Anschauungen und immer reineren Diensten. Wenigstens von dem Moment ab, wo letztere mit vollem Bewußtsein geübt werden; während vorher, da der ursprünglich so rohe Dienst fehlt, anscheinend, eine edlere Religion besteht, die aber bewußt überhaupt noch nicht vorhanden ist, sondern nur dumpf gefühlt oder geahnt wird. Es verhält sich mit solchen Religionsanschauungen, die also als Menschen-Gemeingut sich einstellen, wie mit der Kultur selbst.
Anders ist es mit den anormal von Einzelnen den Menschen verkündeten und ihnen aufgedrängten Lehren. Deren Hoheit freilich geht mit den Stiftern zugrunde, oder erhält sich nur kurze Zeit nach ihnen. Und die Anschauungen sinken mitunter in erschreckender Weise, bis Propheten und Reforma[S. 146]toren kommen, die ihnen für einige Zeit den ursprünglichen Sinn wieder verleihen oder wieder zu verleihen sich mühen. An solchen Fall des Geistes nur zu denken ist widerwärtig, geschweige darüber zu schreiben, zumal in unserer Zeit, wo Menschen und Völker sich in Erfindungen überbieten, sich gegenseitig zu vernichten, ganz im Gegensatze zu den edelst gemeinten Religionslehren. Von vorgetragenen Anschauungen ist aber noch nicht die Rede, sondern von den spontan auftretenden. Auch bei diesen ist es möglich, daß die Zahl der Gottheiten steigt, statt ständig abzunehmen. Wenn Stämme sich friedlich vereinigen, tun sich auch ihre Gottheiten zu einer Gesellschaft zusammen. Brugsch hat das für die Ägypter klar erwiesen, deren Gaugottheiten, nach Vereinigung der Gaue, alle zu Landesgottheiten geworden sind. Selbst wenn Stämme oder Völker durch das Übergewicht eines Stammes oder Volkes gewaltsam in eine Herrschaft gezwungen werden, gehen ihre Gottheiten im allgemeinen nicht verloren, sobald der Zwang nicht eben aus Religionsanschauungen heraus geübt worden ist. Die bezwungenen Gottheiten bleiben geduldet, meist sogar anerkannt und zu denen der Eroberer kollegial, vielleicht in niederer Stellung, gesellt. Welchen Synkretismus haben nicht die Römer geübt! Und gleiches zeigt sich bei den Indiern, Mexikanern u. a. Die Hebräer sind in dem Lande Kanaan sogleich tief von den Lehren Mose gesunken, indem sie die Gottheiten der unterdrückten ersten Besitzer dieses Landes aufnahmen. Auch durch einfachen Import können die Götter sich vermehren, wie, wahrscheinlich, bei den Griechen aus dem Verkehr namentlich mit den semitischen Völkern (Phöniziern, Lydern, Assyrern) und mit Ägyptern, sicher bei den Römern; man denke an die einfach aufgenommenen, ja herbeigeholten griechischen Gottheiten und an den Isisdienst.
Bei allem aber geht nebenher das unbewußte Bestreben, die Gottheiten zu zentralisieren. Daraus erwächst zunächst die Heraushebung gewisser Gottheiten als Mittelpunkte, um die sich die anderen Gottheiten gruppieren. Gehören diese anderen Gottheiten dem Stamme selbst an, so kommt dieses in der Weise zum Ausdruck, daß sie als Söhne, Töchter, Enkel,[S. 147] Brüder, Schwestern usf. jener Gottheiten aufgezählt werden. Daher die Theogonien. Sind sie feindlichen oder niedergeworfenen Stämmen entnommen, so spielen sie die Rollen böser Geister oder gestürzter Götter. Die Beispiele bei den Griechen sind jedem Leser bekannt. Gesellt sich noch zu den Anschauungen der Kult, so zwingt auch dieser zu einer gewissen Ökonomie und Hervorhebung. So kann zuletzt ein Volk, ein Stamm, ein Gau, eine Stadt, eine Familie, bei voller Anerkennung aller anderen noch vorhandenen Gottheiten, die Verehrung auf eine einzige Gottheit beschränken, und damit haben wir den Henotheismus. Dem allein verehrten Gott werden dann naturgemäß auch alle Eigenschaften zugeschrieben, die auf alle Gottheiten verteilt sind. Er nimmt die Stelle des Oberherrschers im Gottheitenkreise ein, die zur absoluten werden kann, wenn die anderen Götter nur noch die seinen Willen ausführenden Mächte sind, wie die Engelscharen Gottes. Einen solchen äußersten Henotheismus hat es nie und nirgends gegeben, die Gottheiten haben stets überall ihre persönliche Bedeutung behalten. Nicht Zeus, noch Marduk, Rā, Indra, Huitzilopochtli, Wuotan usf. konnten je eine solche Stellung in der Religionsanschauung erreichen, trotz ihrer Übermacht. Der Henotheismus ist also keine vollendete Anschauung, sondern eine solche, der sich Völker mehr oder weniger genähert haben, von philosophischen Ansichten natürlich abgesehen. Dabei waren freilich die Ideen dem Kult voraus, wie immer. Der Grieche mochte also an sich Zeus als den Weltherrscher und Weltlenker in der Idee anerkennen. Daneben verehrt hat aber der Athener seine herrliche Stadtgöttin Pallas Athene, die Demeter, Dionysos und viele andere; der Spartaner seinen Apollon und Herakles usf. Immerhin kommt der Henotheismus dem Monotheismus ganz nahe. Am nächsten vielleicht ist er ihm bei den Ägyptern, unter dem so seltsamen König Amenhotep IV (um 1370 v. Chr.) gekommen, der einzig die Sonne, Rā, als Gottheit anerkannt wissen wollte. Wir besitzen aus seiner Zeit eine außerordentlich schöne, dem Amenhotep-Echnaton (als Totem) in den Mund gelegte Hymne an die Sonne, von der ich es bedaure, daß[S. 148] ich sie wegen ihrer Länge nicht wiedergeben kann (in Greßmann, Altorientalische Texte, S. 189 ff.). Darin wird Rā als der glänzende Gott gefeiert, der alles geschaffen hat, Welt, Menschen, Gebirge, Flüsse, Städte, Dörfer, Wege, alles Getier, bis zum niedrigsten Wurm, und der über alles machtvoll herrscht. Warum der Henotheismus in Monotheismus nicht übergehen kann, und auch nicht übergegangen ist, werden wir im nächsten Abschnitt sehen.
Zuletzt müssen wir noch eine sehr bedeutungsvolle Anschauung hervorheben, die als dualistische bezeichnet wird, hier aber da sie auf der Annahme von zwei Gegengottheiten beruht, als antagonistische darzustellen ist. Daß gute und böse Geister geglaubt und verehrt werden, ist schon hervorgehoben und ausgeführt worden. Ein sich bewußt bekämpfendes Götterpaar haben aber die Eranier geschaffen. Ormuzd als Prinzip des Guten, des Lichtes, und Ahriman als Prinzip des Bösen, der Finsternis, bilden dieses Paar. Sie sind, sobald Ahriman die Welt des Lichtes entdeckt, in Kampf und bleiben in Kampf. Ormuzd schafft alles Gute, Ahriman vernichtet es oder sucht es zu vernichten und schafft alles Böse. Gutes und Böses sind eben in der Welt vorhanden und ringen miteinander; Zarathustras Anschauung ist eine Übertragung in das Göttliche. Die Welt stammt von Ormuzd, von ihm ressortieren alle guten Gottheiten und guten Geister. Die Unterwelt ist das Werk Ahrimans, und ihm gehorchen alle Dämonen aller Krankheiten und Übel. Der Kampf aber soll mehr und mehr zum Siege des Guten führen, und dazu sind die Menschen hervorgebracht. Das folgt schon aus der geistigen Höhe der Eranier und mehr wohl noch aus der des Zarathustra. Der Entwicklungsgang zeigt, daß erst das Böse so sehr überwiegt, daß das Gute kaum in Betracht kommt, wie auch viele Völker nur dem bösen Prinzip opfern und schmeicheln, aus Furcht. Dann gewinnt das gute Prinzip mehr und mehr an Boden und Einfluß. Es stehen aber noch beide Prinzipe indifferent nebeneinander, gute Geister und böse Geister wirken getrennt. Im weiteren Verlaufe beginnt der Kampf und das Übergewicht des Guten. Ich darf aber[S. 149] nicht unterlassen hervorzuheben, daß nach anderen Anschauungen Ormuzd und Ahriman nicht als getrennte Gottheiten aufzufassen sind, sondern daß die höchste Gottheit, nennen wir sie Ormuzd, zwei Prinzipe in sich vereinigt, nämlich als Vohu manô, der „gute Geist“, der alle Wirklichkeit und Güte hervorbrachte, und als Akem manô, der „böse Geist“, aus dem alles Unwirkliche und Üble entstanden ist. Und diese Prinzipe sind auch im Menschen vereinigt, wie in Ahuramazda. Bei letzterem treten sie als sein Çpenta mainyu, sein „wohltätiger Geist“, und als Angra mainyu, sein „schädlicher Geist“, auf. Das soll die eigentliche Lehre Zarathustras gewesen sein. Dann wäre freilich ihr Dualismus kein Antagonismus, sondern Gott wäre so dualistisch in seinem Wirken aufgefaßt wie der Mensch. Dem Naturmenschlichen liegt dieses sicher bei weitem näher. Max Müller, der ebenfalls Zarathustras Lehre so deutet, weist darauf hin, daß oft Eigenschaften der Gottheiten von ihnen getrennt und zu besonderen Gottheiten gemacht werden; so sei es später mit dem Angra mainyu geschehen, und mit allen besonderen Eigenschaften Ormuzds. Jenes wurde zum Ahriman, diese gaben das Heer der weiteren Götter und der Engel. Wie Ormuzd sei dann auch der von ihm abgetrennte Ahriman gespalten und so mit einem Heer von Unterweltgeistern und Dämonen versehen worden. Das sind Ideen, die schon oft geäußert und auch auf andere Religionsanschauungen angewendet worden sind, wir begegnen ihnen noch in der Emanationslehre. Ahriman ist oft als der gefallene Engel, aus dem Satan hervorgegangen ist, der Widersacher, gedeutet worden. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß ein Teil der persischen Lehren in das alexandrinische Judentum und in das Christentum eingedrungen ist. In der Tat trägt auch Satan alle Züge des Ahriman. Es ist aber dieser Satan nicht der im Hiob, welches ja als eines der ältesten Bücher der Bibel, vielleicht das älteste, angesehen wird, vorkommende, da der letztere nicht als Prinzip des Bösen auftritt, sondern lediglich als eine Art Mephistopheles, ein Ankläger. Gott fragt ihn, ob er schon einen so gerechten[S. 150] Mann wie Hiob gesehen habe. Da antwortet er, Hiob sei ja mit allen Glücksgütern gesegnet. Wenn Gott ihm diese nähme, so würde er ihm schon absagen. Auch erscheint dieser Satan im Kreise der „Göttlichen“ vor Gott. Ich darf auf den Prolog im Himmel zum Faust verweisen. Die Sage von dem gefallenen „Engel“ ist höchst dunkel und unbefriedigend. Man sieht, daß sie eigentlich eine Art Erklärung für ein angenommenes Fremdes bieten soll, und weder Milton noch Klopstock haben im Grunde das Fremde von dieser großartigen Figur des Luzifer abstreifen können. Ich habe mich selbst mit ihr beschäftigt und sie mir verständlich zu machen versucht; was ich darüber erdichtet habe, kann ich aber hier nicht vortragen, ich wills in einem Drama „Adam und Lilith“ veröffentlichen.
Indessen ist der Kampf zwischen Gut und Böse so sehr Menschengemeingut, daß selbst monotheistische Anschauungen unwillkürlich auch ein Prinzip des Bösen einführen; man denke an die Schlange der Bibel. Ja, polytheistische Anschauungen können ein Prinzip des Bösen mehr entbehren als monotheistische. Denn da ihre Gottheiten beschränkt in der Macht sind, vermögen sie schon von selbst nicht alles aus der Natur der Dinge und Menschen fließende Böse und Schlimme zu verhindern. Fast naiv sagt Zeus gleich im Beginn der Odyssee:
und bezieht sich dann darauf, daß selbst er mit den Warnungen, die er durch Hermes hinabsandte, den Aigisthos nicht verhindert habe, Klytemnästra zu ehelichen und Agamemnon zu töten. Wenn die Menschen außerdem noch das passiv wirkende Schicksal nehmen und Gottheiten, die nach Laune entscheiden, so wird eine besondere Gottheit für das Schlimme entbehrlich. Bei den Griechen und Römern zeigt sich dieses am deutlichsten. Dann bei den Babyloniern, den Germanen (denn Loki ist nicht eigentlich das Prinzip des Bösen, nur Wagner hat ihn dazu in dem genialen Loge gemacht) u. a. Die Ägypter haben im Set ein solches Prinzip, aber nicht entfernt[S. 151] von der Großartigkeit und Bedeutung des Ahriman. Er ist auch nicht das Prinzip des moralisch Bösen, eher das des Naturverderblichen, wie sein Verhalten gegen Osiris zeigt. Auch der Indier Çiva und ihre Kali sind wie Set mehr Prinzipe der Vernichtung als des Bösen, und Çivas Natur ist keineswegs eine entschiedene, sie zeigt sich auch schaffend, wie Wischnu-Krishna Schöpfer und auch Vernichter ist. Überhaupt müssen wir das Vernichtende von dem eigentlich Bösen scheiden. Ahriman ist vernichtend und böse, die entsprechenden Gottheiten anderer Völker, wo solche vorhanden, sind nur oder fast nur vernichtend. Sie sind nicht einmal immer oder nicht ausschließlich Unterweltsgottheiten wie Ahriman, sie stehen nur mit der Unterwelt in Verbindung. Die Eranier haben das böse Prinzip mit als Gottheit anerkannt, weil sie den Monotheismus des guten Prinzips nicht durchzuführen wußten. Und sie sind wenigstens konsequent darin gewesen, indem sie ihm fast die Größe und Macht gegeben haben wie dem guten Prinzip. Unberührt davon bleibt ihr sonstiger Polytheismus, der teils die Naturerscheinungen betrifft (Sonne, Wetter, Himmel usf.), teils mehr begriffliche Dinge und Dinge der Anschauung, wie in den Amesha Çpenta: Herrschaft, Weisheit, Unsterblichkeit usf.; Raum, Zeit, Kraft, Stoff usf. Die Bedeutung des Kampfes zwischen Gut und Böse wird uns aber später noch viel beschäftigen. Denn auf einer anderen Stufe, auf der das Böse in das „Fleisch“ verlegt wird, tritt das Leben in Kampf mit der Materie, und die Anschauung gewinnt ein philosophisch-naturwissenschaftliches Gepräge, trotz ihrer Bedeutung für das Ethische, und sie geht auf das All, seinen Zweck, seine Entwicklung und sein Ende.
18. Monotheistische Anschauungen.
Der Monotheismus bildet eine Religionsanschauung, die — wenn außerordentliches Wirken und Walten in Frage kommen soll —, dem Gedanken die höchste ist. Die Erfahrung hat aber gelehrt, daß es zugleich diejenige Anschauung ist, welcher der Mensch am heftigsten und am meisten[S. 152] widerstrebt. Der Einzige ist dem Menschen zu übergeordnet, zu unnahbar. Und leitet Einer alles im All, so hat er nicht nur Unzähliges zu versorgen, sondern auch Unzähliges nach unzähligen Richtungen. Wie sollte das Individuum dabei mit seinen Sonderwünschen Berücksichtigung finden! Der Allgott kann nicht Hausgott sein, kaum Volksgott. So wenigstens spricht es allgemein im Menschen. Wir sehen denn auch geschichtlich, daß keine monotheistische Anschauung auf dem Wege der Entwicklung erstanden ist, daß alle, die wir kennen, von bestimmten Personen ins Leben gerufen sind (S. 81), von Menschen, die gewaltigen Geistes den Gang der Entwicklung unterbrochen haben und die Menschheit in Bahnen leiteten, die ihr ganz fremd gewesen sind, denen sie höchst widerwillig folgte, die sie bei jeder Gelegenheit verlassen hat, und die sie noch heute scheuend möglichst meidet. Daraus schon kann man schließen, daß der Monotheismus nicht aus irgendeinem Polytheismus sich sublimiert hat. Aber ein noch stärkeres Argument besteht in folgendem. Wir kennen keine einzige polytheistische Anschauung, in der nicht neben dem männlichen Prinzip das weibliche vertreten wäre, und zwar nicht etwa bloß untergeordnet nebenbei, sondern meist durchaus nebengeordnet und hauptsächlich. Istar ist ein absolutes Hindernis für eine Monotheisierung der babylonischen Anschauungen, Hathor oder Isis für eine solche der ägyptischen, Dione, Hera, Athena für eine solche der griechischen, usf. durch ausnahmslos alle wirklich polytheistischen Anschauungen. Im ältesten Monotheismus, der Grundlage für alle anderen entsprechenden Anschauungen, findet sich auch nicht die leiseste Spur eines weiblichen Prinzips neben dem männlichen. Ich habe schon bemerkt, daß polytheistische Anschauungen nicht einmal zu einem wirklichen Henotheismus geführt haben. Jetzt sehen wir, daß sie dahin auch gar nicht führen können. Sie vermögen nur bis zu einem Duismus, zu einem Gottheitpaar (unterschieden vom Dualismus der Gegengottheiten der Eranier) aufzusteigen, nicht zu einem einzigen Gott. Gäbe es polytheistische Anschauungen ohne ein weibliches Prinzip, so wäre ein solches[S. 153] Aufsteigen, wenn auch, nach der Art des Menschen, nicht wahrscheinlich, doch wenigstens möglich. Solche Anschauungen aber hat kein Polytheismus ausgebildet. Das gewaltige Hindernis des weiblichen Prinzips für wirklichen Monotheismus hat auch der ebenso große Orientalist wie außerordentliche Babylonierbewunderer F. Delitzsch anerkannt. Wenn er und andere, wie namentlich der so verdienstvolle Pfarrer Jeremias, wenigstens von „monotheistischen Unterströmungen“ bei gewissen Völkern, namentlich aber den Babyloniern, sprechen, so muß es richtiger „henotheistische Unterströmungen“ heißen. Was Friedrich Delitzsch sagt, muß ich anführen („Babel und Bibel“, erster Vortrag 1905, S. 81 f., Anmerkung 42). Seine babylonischen Zitate gebe ich aber in Übersetzung nach Greßmann („Altbabylonische Texte“) und vollständig, damit der Leser selbst urteilen kann. Der Text — als Tafel des Kudurru Sohnes des Mastukku unterzeichnet und als kollationierte Kopie eines älteren Textes angegeben — ist neubabylonisch; aus welcher Zeit er stammt, ist nicht entschieden. Greßmanns Übersetzung ist insofern nicht vollständig, als vor dem Namen die Bezeichnung „Gott“ (il) fehlt. Die Formel lautet immer: „Gott (Name) ist Marduk in bezug auf...“ Nur dreizehn Götter sind lesbar: Tu, Lugal-Akila, Ninib, Nergal, Zamama, Ellil, Nabium, Sin, Samas, Adad, Tishu, Râbu, Sukamuna. Diese also sind Marduk mit Bezug auf: Pflanzung, Quelltiefe, Kampf, Schlacht, Herrschaft und Entscheidung, Erleuchtung der Nacht, Recht, Regen, Heer,?, Bewässerungsröhren. Auf der Rückseite als Fortsetzung können wir noch fünf Zeilen wenigstens teilweise lesen, nach der Formel: Eigenschaftsname (Untersucher, Üppiger sind noch zu entziffern), Bild, Göttername. Darunter steht: „Zusammen acht Bilder der großen Götter“; Zamama, Nabium, Nergal, Sulmânu, Pabilsag sind als solche Götter noch zu entziffern. Diese Rückseite, die drei Namen enthält, die auch auf der Vorderseite stehen und die von demselben Schreiber herrührt, läßt keinen Zweifel, daß es sich überall um Götter, mindestens zum Teil sogar um große Götter handelt, falls die Vorzeichnung il = Gott zur Feststellung noch nicht ausreichen sollte. Also ist Marduk[S. 154] einfach diese Götter, er hat ihre Verrichtungen. Friedrich Delitzsch sagt nun: „Marduk ist sowohl Ninib als Nergal; sowohl Mondgott wie Sonnengott usw.“ Das von ihm sogar gesperrt gesetzte „ist“ steht nicht im Text, bei Greßmann ist es als von ihm zugesetzte Erläuterung in Klammern getan. Doch mag das sein. Wie darf man aber aus einer solchen Festsetzung schließen, daß der biblische Monotheismus babylonisch ist? Es kommt hier nicht darauf an, daß es sich gerade um Bibel und Babel handelt, sondern ob jene Festsetzung einen Monotheismus bedeutet. Da ist es mir schwer begreiflich, wie man den Charakter des Monotheismus so verkennen kann. Im Monotheismus ist Gott weder Sonnengott, noch Mondgott, noch überhaupt ein Erscheinungsgott. Wir haben hier Jehova als Beispiel. Wo steht in der Bibel auch nur ein Wort davon, daß Jehova Sonnengott, Mondgott, Pflanzengott, Besitzgott usf., sogar Bewässerungsröhrengott ist? Gott steht im Monotheismus über alle Welt, er ist nichts von dem in der Welt; er schafft die ganze Welt (in der Bibel einfach durch Befehl) und regiert die ganze Welt. Marduk, selbst in der Deutung durch Delitzsch, ist nichts weiter als so und so viele Götter bestimmter Gegenstände und Erscheinungen, die der betreffende Verfasser des Textes sogar sämtlich aufzuführen sich gezwungen sieht, gewisse acht „großen Götter“ (als Bilder) zusammenzählend. Das steht tief selbst unter der Auffassung, die die Griechen von Zeus hatten, den sie ja auch Zeus-Helios, Zeus-Hades nennen und der ihr Gottherrscher gewesen ist. Und was sagen alles die Ägypter von fast jedem ihrer Götter aus, und wie außerordentlich viel Höheres und Umfassenderes! Delitzsch schwächt im Laufe seiner Auseinandersetzung seine Ansicht auch ab, indem er meint: „Es läßt sich, soweit dieser Text in Betracht kommt, höchstens von einer monotheistischen Unterströmung reden.“ Ich selbst glaube, kaum von einer henotheistischen Unterströmung. Ich darf mich mit diesen Auseinandersetzungen begnügen, aus denen wohl hinreichend erhellt, was unter Monotheismus zu verstehen ist und wie er sich zu Polytheismus und Henotheismus verhält.[S. 155] Von den monotheistischen Anschauungen braucht nichts gesagt zu werden; wir sind alle in ihnen erzogen. Und worin wir dabei mit uns selbst in Kampf geraten, das gehört vor das Forum des Philosophisch-Naturwissenschaftlichen. Dahin — wenn nicht in das Gebiet der Gedankenunfähigkeit oder Gedankenträgheit — gehört auch, was über Atheismus zu sagen wäre, denn Atheismus als Religionsanschauung ist natürlich ein Widerspruch in sich und hat auch nie existiert.
19. Anschauungen von Welt, Menschheit und Weltkatastrophen.
Die mythischen und sagenhaften Anschauungen über die Entstehung der Welt und des Menschen habe ich in meinem besonderen Buche hierüber dargestellt. Manches ist hier wiederholt, ergänzt und weitergeführt, jedoch nur soweit der Zweck dieses Buches es erforderte. Von allgemeinerer menschlicher Bedeutung ist dabei die Annahme eines Urwesens oder mehrerer Urwesen. Wo nur ein Urwesen in Frage kommt, ist es Gott, Rā, Jehova oder Brahma. Ob Nun (auch Ptah, Rā, Amun usf.) der Ägypter Gott oder Urmaterie (Urwasser) bedeutet, ist nicht zu entscheiden. Als „Vater der Götter“, als das er in einem Tempel aus der Zeit Seti I. bezeichnet und mit Federn auf dem Haupte (Zeichen der Beseelung) und der Geißel in der Hand (Zeichen der Leitung) dargestellt ist, möchte man ihn für Gott halten, zumal er auch „nutr“ heißt. Ebenso wenn er der „Herr der Acht“ (S. 132) und unmittelbar „Schöpfer“ genannt wird. Aber Nun heißt auch der Nil zur Zeit seines höchsten Standes, und sogar das Meer; Brugsch bringt Belege dafür. So wird es sich wohl um eine Urmaterie in Verbindung mit einem Urgeist handeln, was der pandeisierenden Richtung der ägyptischen Anschauungen (S. 228) entspricht. Bei zwei und mehr Urwesen kann es sich nur um Gottheiten handeln, oder um Gottheiten in Verbindung mit Materie. Auch hier sind die Anschauungen nicht immer gesichert. Was sind Okeanos und Tethys, Gottheiten oder Urwasser und Urkraft? Homer[S. 156] spricht von ihnen wie von Personen, doch von Okeanos sicher auch wie von einem Weltstrome. Und Chaos und Ge, Tartaros und Eros? Chaos möchte man für Urmaterie halten, doch zeugt Chaos die Finsternis (ἔρεβος) und die Nacht (νύξ). Tartaros scheint mehr ein Begriff zu sein, wie etwa Unendlichkeit; später ist es ein Ort. Ge, Gaia, trägt die Züge einer Göttin, außerdem ist es freilich auch die klobige Erde. Nur Eros ist lediglich Gottheit bei Hesiod, hat aber hier gar keine kosmogonische Bedeutung. Die Eranier kannten außer den Gottheiten Ormuzd und Ahriman noch vier andere kosmogonische Urwesen: Twasha, Zrwana akarana, Anaghra raocâo, Anaghra temâa, die als Raum, Zeit, Licht, Finsternis gedeutet werden; die beiden letzteren sollen auch Kraft und Materie darstellen. Sind auch die Amesha Çpenta, zu denen Vohumano, Ashavahista, Kshatra, Aurwatat, Ameretat, Armaiti gehören, als Urwesen aufzufassen, so kämen noch Eigenschaften hinzu: Erhaltung, Wahrheit, Ordnung (Herrschaft), Vollkommenheit, Unsterblichkeit, Weisheit. Die Eranier hätten dann freilich alles, was zur Schaffung, Ordnung, Wirkung und Leitung einer Welt gehört, schon im voraus angenommen. Den Germanen galten als Urwesen eine Gottheit und Materie, da die Götter Burs Söhne heißen, und aus Ymir, dem Riesen, die Welt gebaut wird, wie bei den Indiern aus Purusha (Person). Ob die Hebräer außer Jehova auch die Materie als Urwesen ansahen, ist nicht sicher. Es ist nicht nötig, den ganzen Erdball zu durchwandern, wir finden immer Urwesen gleich den hervorgehobenen, bald in dieser, bald in jener Zusammensetzung. Manche Völker haben je nach der Lehre verschiedene Arten von Urwesen angenommen, wie besonders die Indier, außer dem absolut Seienden und dem absolut Sinnenden, Tad und Tapas, auch persönliche Gottheiten und persönliche Weltwerkmeister (z. B. Varuna) und Weltmaterie (was ja Purusha ist). Die noch vor zehn Jahren Modernen haben es versucht, den alten Indiern nachzutun und dichterisch die Welt aus sich zu schaffen. Da wir uns schon so lange mit schwierigen und ernsten Dingen beschäftigen und noch schwierigere und[S. 157] ernstere Dinge uns bevorstehen, darf ich vielleicht auch für das Vergnügen des Lesers etwas tun, indem ich ein Gedicht, das die Kreuzzeitung vor mehreren Jahren aus gleichem Grunde mitgeteilt hat, nachdrucke. Der Dichter heißt — ich will’s lieber nicht sagen.
Man sieht wie einfach das Schaffen ist, worüber sich die Menschen so sehr den Kopf zerbrechen.
Ein zweiter, allgemeinerer kosmogonischer Gedanke betrifft den Menschen. Dieser ist nun bei manchen Naturvölkern gleichfalls ein Urwesen, und auch ein Schaffensprinzip. Im allgemeinen entsteht er nach der Welt, als Abkömmling der Götter, oder von ihnen besonders hervorgebracht. In der elohistischen Schöpfungsgeschichte der Bibel wird der Mensch von Gott geschaffen: „Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Weib schuf er sie.“ Der Mensch ist wie Licht, Sonne, Mond usf. geschaffen; es wird nicht gesagt woraus. Die jehovistisch-elohistische Erzählung gibt aber den Stoff an und fügt den Odem Gottes hinzu. „Und der ewige Gott bildete den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase Odem des Lebens; da ward[S. 158] der Mensch zu belebtem Wesen.“ Aus Erde sind auch alle Tiere gebildet, nur der Odem Gottes fehlt ihnen. Bei den Babyloniern scheint nach Berossos, und übrigens auch nach dem Schöpfungsgedicht Enuma Elis, das Blut der Götter in der Erschaffung des Menschen eine Rolle zu spielen. Bel läßt sich den Kopf abschlagen, und das hervorstürzende Blut wird mit Erde vermischt. Daraus werden Menschen und Tiere geformt. Diese Wendung ist recht verschieden von der biblischen. Die Ägypter dachten sich den Menschen gleichfalls aus Erde gebildet. Wir haben Darstellungen, wo der Gott vor einer Töpferscheibe sitzt und den Menschen formt. Hesiod nimmt, nach den fünf aufeinanderfolgenden Geschlechtern, verschiedene Substanzen an, Gold, Silber, Erz oder Esche, Eisen; für das vierte Geschlecht ist der Stoff nicht angegeben. Dieses nach der Güte der Menschen symbolisch zu deuten liegt nahe, scheint aber nicht ganz zulässig. Bildner sind hier die Götter allgemein bei den beiden ersten Geschlechtern, und ist es Zeus bei den beiden folgenden Geschlechtern. Vom fünften Geschlecht wird ein Bildner nicht genannt, es wird geboren. Nach anderen griechischen Sagen wird der Mensch aus Erde, Schlamm, Lehm oder Ton von Göttern und besonders bekanntlich von Prometheus geformt, dem Athene geistig beisteht; letzteres jedoch erst nach späterer Dichtung. Sonst wachsen die Menschen auch aus Bäumen oder Sträuchern hervor, wie bei den Germanen, Eraniern, auch Griechen (Attis aus dem Mandelbaum, Adonis aus dem Lorbeer), Italikern und anderen Völkern, oder aus Steinen, Felsen, Eisblöcken. Die Sage, daß nach der Flut die Menschen aus Steinen entstanden, die Deukalion und Pyrrha hinter sich warfen, gehört nicht hierher; Zeus belebte die Steine. Ebenso begaben Odin, Hönir und Lodurr Esche und Ulme mit Seele, Atem, Blut und Farben zu lebenden Menschen.
Auch die Anschauung von einer Entwicklung der Welt ist weit verbreitet. Wir haben hier verschiedenes zu betrachten. Das erste betrifft den Menschen. Hier spielt die Neigung, die Vergangenheit in günstigem Licht der Gegenwart gegenüberzustellen, eine große Rolle. An die herrliche[S. 159] Paradiesgeschichte der Bibel und den verhängnisvollen Sündenfall brauche ich nur zu erinnern. Einen Sündenfall kannten auch die Eranier. Das erste Menschenpaar, Maschiah und Maschianeh (Mensch und Menschin), wird von Ahura Mazda vermahnt, gute Gedanken zu denken, gute Worte zu reden, gute Werke zu tun und den Devs (den bösen Geistern) nicht zu opfern. Und gehorsam und guten Sinnes sagt es: „Ahura hat Wasser, Erde, Bäume und Tiere, Sterne, Mond und Sonne und alle Annehmlichkeiten geschaffen, welche von der Reinigkeit offenbar sind samt und sonders.“ Hierauf lief der Feind in ihr Denken und verfinsterte ihr Denken, und sie logen sodann: „Ahriman hat geschaffen Wasser, Erde, Bäume und Tiere und das übrige.“ Durch diese gottlose Rede wurden beide Gottlose (Darvand’s) und ihre Seele ist bis zum zukünftigen Körper in der Hölle. So lautet es im Bundehesh. Es wird dann geschildert, wie ihre Speisen geschmacklos und ihr Leben mühselig wird, wie sie in Sünde fortfahren und dadurch die Devs immer mächtiger werden. In einer anderen eranischen Sage spielt auch das Paradies eine gewisse Rolle. Vîvanhão, den man mit dem indischen Vivasvân gleichsetzt, doch ohne das Dunkel, das auf dieser Persönlichkeit ruht, zu erhellen, ist der erste Mensch, der den heiligen Haoma grüßt (S. 112). Sein Sohn ist Yima, entsprechend dem Yama, Sohn des indischen Vivasvân. Ihm schon (vor Zarathustra) wird von Ahura die mazdajaçnische Lehre kundgetan. Darauf lebt er mit seiner ganzen menschlichen Nachkommenschaft auf paradiesischer Erde, bei paradiesischem Klima unsterblich und unschuldsvoll. Und wie die Erde zu klein wird, sie alle zu fassen, gräbt er die westliche Grenze wiederholt mit goldener Schaufel und spricht: „Sei freundlich, Çpenta-Armaiti, gehe auseinander und dehne dich aus zum Tragen des Viehes, der Zugtiere und der Menschen.“ Und jedesmal dehnt sich die Erde um ein Drittel größer als sie war. So lebt Yima mit Allen tausend Jahre. Darauf folgt ein Ereignis, das der Flut entspricht, worüber später gesprochen wird. Unsterblichkeit und die Gnaden verliert aber Yima mit seiner ganzen Nachkommen[S. 160]schaft wegen einer Lüge. Er wird Opfer des Drachen Dahâka. Yima ist Firdusis Dschemschid (Dschem der „Glänzende“), der untergeht, weil er sich anbeten ließ; Dahâka der arabische Tyrann Dhohhak (Zohak) mit Schlangen, die ihm aus den Schultern wuchsen.
Die babylonischen Texte kennen zwar die Sünde gegen Gottes Gebote und Bußpsalmen, aber der Sündenfall ist bei ihnen nicht erzählt. Ein Siegelbild, das hier wiederholt sein mag, ist auf diesen Sündenfall gedeutet worden. Zwei Personen sitzen zu beiden Seiten eines Baumes, hinter der Person links ringelt eine Schlange in die Höhe. Die Personen sind voll bekleidet (sogar mit Hüten), da doch Adam und Eva nackt sind, vor und bei dem Sündenfall. Schlangen, zusammen mit Gottheiten, finden sich bei den Babyloniern auch sonst. Will man die beiden Darstellungen (Fig. 27 und 70) bei Jeremias „Das Alte Testament“, S. 81 und 203 nicht gelten lassen, weil die erste vielleicht nicht babylonisch, sondern persisch, die zweite vielleicht nicht Original, sondern Kopie oder freie moderne Erfindung ist, so bleibt doch noch die nach Fig. 35, S. 100, in der Sin (Mondgott) und Istar einander gegenüberstehen, und zwischen ihnen, außer anderen Zeichen, zweifellos auch das Bild einer sich emporringelnden Schlange sich befindet. Es sind im wiedergegebenen Siegelbild zwei Gottheiten — eine sicher eine Gottheit, weil sie eine gehörnte Kopfbedeckung trägt, die, wie Jeremias sagt, „bei den Babyloniern ausschließlich göttliches Abzeichen ist“ — mit dem bekannten mystischen Baum zwischen ihnen; eine Darstellung, die sich so außerordentlich oft und vielfach variiert auf babylonischen, assyrischen (auch persischen) Denkmälern findet. Die eine Gottheit hat eine Schlange zum Symbol, oder die Schlange kann auch ein feindliches Wesen sein, da ja Drachenkämpfe der Gottheiten bei den Babyloniern so gewöhnlich sind. Und es kennen[S. 161] sogar die Babylonier einen ewig lebenden Menschen, der nach dem Sündenfalle ja nicht möglich sein sollte. Wir werden ihm bei der Flutsage begegnen.
Bei anderen Völkern scheint von einem Sündenfall im Sinne der biblischen Erzählung ursprünglich überhaupt nicht die Rede zu sein. Selbst was Hesiodos von den mehrmals berührten fünf Menschengeschlechtern erzählt, gehört nicht hierher. So möchten es nur die Hebräer und die Eranier sein, denen ein solcher in allen Einzelheiten geläufig war, freilich in ganz verschiedener Ausführung. Selbst die nächsten Verwandten der Eranier, die Indier, kennen den eigentlichen Sündenfall nicht; das Bewußtsein seiner Göttlichkeit hat der Mensch durch Avidyâ, Nichtwissen, verloren. Gerne übergeht man die Bedeutung des Sündenfalles eines einzelnen Menschenpaares für die ganze Menschheit. Die Bibel kennt als Folge die Mühsale des Lebens und den Tod; der Sündenfall ist eine Erklärung dafür, wie viele Völker für beides eine Erklärung gesucht und in der mannigfachsten Weise gefunden haben. Die unterschiedslose Belastung der Menschheit in alle Zeit mit der Sünde als solcher, ist, soweit ich sehen kann, in der Bibel nicht vorhanden; bei den Eraniern könnte sie eher nachgewiesen werden. Unterschieden davon ist der Sündenfall Luzifers im Engelschore, wovon schon gesprochen ist (S. 150).
Aber freilich, die Bosheit und Gewalttat der Menschen auf der Erde steigt, und schließlich sendet Gott die Flut, alles Lebende, mit Ausnahme des Noah und dessen, das ihm mitzunehmen befohlen ist, zu vernichten. Flutsagen sind bekanntlich überall nachzuweisen. Als der Erzählung der Bibel am nächsten stehend, muß man die Sage der Babylonier ansehen. Wir haben vier Berichte darüber (die Bibel enthält bekanntlich zwei). Einer ist im Gîlgames-Epos enthalten, zwei scheinen nur andere Rezensionen dieses Berichtes zu sein, der vierte ist der von Berossos überlieferte. Im wesentlichen stimmen diese Berichte überein. Der babylonische Noah heißt im ersten Bericht Ut-Napistim, den wir oben kennen gelernt haben, mit dem Beinamen Atra-hasis (der „Hochgescheite“, nach Greßmann), woraus vielleicht[S. 162] der Xisuthros des Berossos entstanden sein möchte, wie sein Vater Opartes aus dem babylonischen Ubar-Tutu. Der eigentliche Urheber der Flut ist Ellil, Gottheit der Erde, auch des Tierkreises, der früher als Bel gelesen wurde. Drei andere Götter (Anu, Ninib, Ennugi) lassen sich im Ratschluß der Götter dazu bereden. Den Grund für die Flut können wir nur aus den Vorwürfen, die später Ea dem Ellil macht, entnehmen. Demnach handelt es sich anscheinend um Sünden einzelner gegen Ellil; denn jener sagt, er hätte dem Sünder seine Sünde, dem Frevler seinen Frevel auflegen sollen, er hätte ja Löwen, Wölfe, Hungersnot oder Pest senden können die Menschen zu verringern, statt der Sintflut, die alle vernichtete. Istar ist auf Seiten Ea’s. Aber an einer anderen Stelle sagt sie, sie hätte die Sintflut den Göttern geraten. Die Götter spielen übrigens dabei eine traurige Rolle. Wie die Sintflut wächst, bekommen sie Furcht. „Sie entwichen und stiegen empor zum Himmel Anus. Wie ein Hund drückten sich die Götter, an der Mauer lagernd.“ Ea, der immer den Menschen Wohlmeinende rettet Ut-Napistim, indem er ihm rät, ein Schiff zu bauen. Daß er ihn aber auch veranlaßt, den Anderen eine bösartige Lüge zu sagen und sie dadurch in ihr Verderben zu reißen, klingt häßlich. Im übrigen stimmt vieles mit der biblischen Erzählung; so namentlich das Schiff (in der Bibel ein Kasten, die Arche), seine Ausrüstung samt Inhalt, das Landen an oder auf einem Berg (Nisir oder Nimus statt Ararat), das Aussenden einer Taube und eines Raben (bei den Babyloniern auch noch einer Schwalbe), das Opfer Ut-Napistims, Noahs, nach der Flut. Das spätere Schicksal des babylonischen Noah ist aber ein ganz anderes als das des biblischen; denn er wird der Menschheit entrückt und lebt unsterblich, wie wir gesehen haben, im weiten Westen.
Bei den Eraniern sagt Ahura Mazda dem Yima die Flut an. Aus hier gänzlich fehlenden Gründen soll harter Frost die Erde ergreifen und Schnee alles verhüllen. Um sich und alles andere vor den beim Schmelzen der Eis- und Schneemassen entstehenden Fluten zu schützen, soll Yima sich ein „Varem“, eine Wohnung, machen. Die Indier haben die[S. 163] Flutsage in mehreren Versionen, ihr Noah ist Manu (Manu = Mensch). Die Voraussagung der Flut, die Warnung und der Rat, ein Schiff zu bauen, wird diesem von einem Fisch (er wird als Gott-Fisch gedeutet, wie etwa der Ea der Babylonier), den er klein gefangen hat, und auf dessen Bitte, daß er nicht von anderen Fischen verzehrt werde, in einem Topf, dann in einem Loch aufwachsen läßt, bis er ihn ins Meer tut. Das Schiff wird an das „Horn“ des Fisches gebunden und dieser führt es zum nördlichen Gebirge. In einer späteren Sage nimmt Manu, wie Noah, auch Pflanzen und Tierpaare in das Schiff, und wird die Flut wie in der Bibel sieben Tage voraus verkündet. Als Grund für die Flut ist in der Mahabharata die Sühnung der Erde überhaupt angegeben. In einer anderen Sage aber, in mir nicht verständlicher Weise, die Rettung der Vedas und der sie bewahrenden sieben Rishis (Seher, Sänger). Die Rettung heiliger Schriften aus gleichem oder ähnlichem Anlaß spielt auch bei den Eraniern, Germanen und Babyloniern eine Rolle. Die von Zeus wegen der Frevel des „ehernen“ Geschlechts verhängte Flut, der Kasten (λάρναξ), den Deukalion-Noah auf Rat seines Vaters Prometheus baut und in dem er sich mit seiner Gattin Pyrrha nach dem Berge Othrys rettet, gehören der bekannten griechischen Flutsage an. Diese deukalionische Flutsage ist viel ausgeschmückt und später auch von Plutarchos und Lukianos mit orientalischen Zügen bereichert worden, wodurch sie sich der biblischen oder babylonischen näherte. Pausanias, in seiner Beschreibung Attikas, erzählt auch, daß die Athener im Umkreise ihrer Stadt einen Erdspalt zeigten, durch den die Flut abgelaufen sei. Vor die deukalionische Flut ist die ogygische zu setzen, die Boiotien betraf und Attika, und in der die sonderbaren Städte Athen und Eleusis am Kopaissee untergegangen sein sollen. Aber eine Sintflut war es nicht. Der alte Buttmann sieht in Ogyges den Okeanos, also den Wassergott überhaupt, und erklärt, freilich in seiner Vorliebe für seltsame Etymologien — z. B. Tubalkain ist Vulkan — auch Noah für einen Wassergott (wegen des hebräischen Nahar, das Fluß bedeutet). Eine Flutsage der Germanen ist[S. 164] schwer zu erweisen. Die jüngere Edda erzählt, daß, als die Götter (Odin, Wili, We) den Riesen Ymir, den wir schon kennen, töteten, aus ihm soviel Blut ausgeflossen sei, daß das ganze Riesengeschlecht ertrank. Ein Riese nur rettete sich mit seinem Weibe auf einem Boot (Lûdr) und erzeugte das Menschengeschlecht. Dieser Noah heißt Bergelmir. Jakob Grimm nennt diese Flutsage gegenüber der biblischen „roh und unausgebildet“. Diese germanische Sage erinnert jedoch an eine ähnliche der Babylonier, wo Ellil den Löwen Labbu tötet, und dessen Blut „drei Monate, einen Tag und zehn Stunden“ fließt. Flutsagen finden sich noch weit auf der Erde verbreitet. Bei den Litauern ist die Arche eine Nußschale, die der höchste Gott Pramzinas, der die Flut zur Vertilgung der Bösen herabgesandt hatte, da er Nüsse aß, aus dem Himmelsfenster auf die Erde warf.
Andere Völker erzählen anderes, so Indianerstämme, Neger, Ozeanier, Peruaner usf. Richard Andree hat sich die große Mühe gemacht, alle Flutsagen zu sammeln und führt 88 auf. Aber in wirklichem Zusammenhang dürften nur die biblische und babylonische stehen, wie auch Andree meint. Von diesen wird letztere, wegen ihrer viel roheren Züge, wohl die ältere sein. Die dichterische Erzählung vom Regenbogen ist der Bibel eigen. Sonst werden Flutsagen zu verschiedensten Zeiten lokal entstanden sein, da ja Überflutungen und Überschwemmungen überall vorkommen und aus den verschiedensten Ursachen. Das Wesentliche ist das ethische Motiv und die Rettung eines Menschenpaares. China scheint eine Flutsage nicht ausgebildet zu haben. Die Überschwemmungen des Nils sind der Segen des Landes. Die des Hoangho jedoch der „Fluch Chinas“. Sie sind aber von je als natürlich angesehen worden, und uralt sind die Versuche, den Fluß einzudämmen. Ob Japan eine Flutsage hat, weiß ich nicht; bei den gewaltigen Beben (Japan ist das erdbebenreichste Land der Erde) und den damit oft in Verbindung stehenden Meerüberstürmungen sollte man Flutsagen erwarten.
Sehr wunderlich — wenn der Gegenstand nicht so ernst wäre, fast wie eine Spotterzählung — klingt eine aus etwa[S. 165] 1300 v. Chr. uns überlieferte ägyptische Sage aus dem „Buche von der Himmelskuh.“ Es ist eine Inschrift in einer Kammer Seti I. in Bibân el Moluk. Die Menschen müssen über den Gott Rā schlecht gesprochen und gegen ihn Anschläge gemacht haben. Das nimmt er ihnen gewaltig übel. Ganz im Stile eines Herrschers versammelt er, Rats zu pflegen, die anderen Götter, die sich völlig wie Hofschranzen ihm nähern. Der älteste Gott, Rā’s Vater Nun, wird zuerst gefragt und erwidert: „Mein Sohn Rā, du Gott, der größer ist als sein Schöpfer und gewaltiger als sein Erzeuger, bleib auf deinem Throne sitzen! Die Furcht vor dir ist groß, wenn dein Auge (es ist damit die Göttin Hathor gemeint) sich gegen die richtet, die dich lästern.“ Rā sagt nun: „Seht, sie laufen davon in die Wüste, aus Furcht wegen dessen, was sie gesagt haben.“ „Laß dein Auge hingehen, daß es sie für dich schlage, die boshaft gelästert haben“, ermahnt Nun. Hathor eilt hinter die Menschen nach der Wüste und tötet sie alle. Ein Teil ist aber nach Süden geflüchtet, diesen will Rā retten. Er läßt von Elefantine Didi (?) holen, dieses, sowie Getreide, von dem „Lockigen“ zu Heliopolis und seinen Dienerinnen mahlen und zu Bier verarbeiten und das Bier an den Ort bringen, wo Menschen noch weilen. Dann steht „die Majestät des Rā in der Frühe unter dem Schutze der Nacht auf, um diesen Schlaftrunk auszugießen.“ „Da wurden die Gefilde vier Spannen hoch mit der Flüssigkeit angefüllt, durch die Macht der Majestät dieses Gottes.“ Hathor aber, die hinkommt den Rest der Menschen zu töten, findet alles mit dem Bier überschwemmt. „Da trank sie und es schmeckte ihr gut, und sie kehrte trunken heim, ohne die Menschen erkannt zu haben.“ Eine wunderliche Menschenvernichtungs- und Flutsage! Die Flut aus Bier und zur Rettung des Menschenrestes! Übrigens ist doch Rā’s Weilen auf Erden nicht mehr. Die Göttin Nut als Kuh hebt ihn in die Höhe und bildet den Himmel, dort bleibt Rā.
Von viel größerer Bedeutung ist es natürlich, wenn nicht bloß die Lebewesen untergehen, sondern die ganze Welt vernichtet wird.
Bei den semitischen Stämmen kenne ich nur einen Hinweis des Babyloniers Berossos darauf, den Seneca erhalten hat. Die Welt soll verbrennen, wenn die Planeten im Krebs sich zusammenfinden, „so daß eine gerade Linie durch die Kreise aller gehen kann“. Das ist astrologische Ansicht, nicht Mythe, doch weben sich bei den Babyloniern freilich Astrologie und Mythos durcheinander. Weltuntergang und Weltbrand sind sonst spezifisch arische Anschauungen. Denjenigen Indiern, die die Welt nur als eine Täuschung (Maja) oder als einen Traum Brahmas ansehen, ging die Welt unter, sobald der Gott die Täuschung erkannte oder vom Traum erwachte. Eine Stelle in der Bhagavad-Gîtâ lautet:
So schwer der Sinn zu durchdringen ist, so wird doch zweifellos von höheren Weltzeitaltern gesprochen; Zeitaltern des Lichtes wechselnd mit Zeitaltern der Finsternis. Die gewöhnlichen Weltenalter betragen ein Kalpa, gleich 432 Millionen Jahre. Je nach Verlauf einer solchen Kalpa geht die Welt unter und wird neu gebildet. Es ist die Lehre der Râmânuga-Schule des Vedânta, die wir noch genauer kennen lernen werden. Gottes Tag und Nacht betrügen je tausend solche Kalpa, wenn in der obigen Stelle unter Weltenalter die Kalpa verstanden sind. Vielleicht aber sollen die tausend Weltenalter selbst eine Kalpa sein, dann würde nach der obigen Stelle die Welt abwechselnd eine Kalpa bestehen und darauf eine Kalpa nicht bestehen. Der Untergang (Mahapralajas) betrifft nicht nur die ganze Welt, sondern auch alle Götter, bis auf den Einen und Einzigen. Einen Untergang der Welt kannten auch die Eranier: der Komet Muspar, indem er auf die Erde stürzt und alles schmelzt, verbrennt sie. Es steht dieses allerdings mit der Reinigung der Welt von Bösem in Ver[S. 167]bindung. Allein, es heißt im Bundehesh doch auch ausdrücklich: „Ahura wird auf seinem herrlichen Thron ohne Schöpfung sein, denn Werke wird er nicht vollbringen, während jene (die Amesha-Çpenta?) den Toten bereiten.“ Den Weltbrand der Griechen — der durch Phaethon veranlaßte, gehört nicht wohl hierher — werden wir später kennen lernen.
Wir wenden uns sogleich zu den Germanen, von denen wir darüber die eingehendsten Nachrichten haben. Der Weltuntergang (ragna rök, der Waltenden Verrauchung) ist in der Edda als ein Kampf, der Kampf der Götter gegen Surtur (der Schwarze, Hüter des Feuerlandes Muspelheim) geschildert, in dem jene untergehen und die Welt verbrennt. Die Wala in der Voluspa erzählt:
Nun folgt der Kampf der Götter: Odin steht gegen den Wolf Fenrir, von dem er verschlungen wird, Thor gegen die Midgardschlange, die ihn vergiftet, Freyr gegen Surtur, von dem er getötet wird. Zuletzt sinkt die Erde ins Meer, die Sterne fallen vom Himmel:
Andere nordische Sagen stimmen mit der obigen Erzählung überein, nur daß sie mehr ausführen. In Deutschland selbst haben wir die Götterdämmerung in dem Althochdeutschen, im neunten Jahrhundert aufgezeichneten Lied Muspilli. Elias steht anstelle der Asen, der Antichrist und Satanas für Loki und Surtur. Elias wird verwundet und das weitere lautet in der Übersetzung von Johannes Scherr: „Die Berge entbrennen, kein Baum bleibt stehen auf der Erde, die Wasser trocknen aus, das Meer verdampft, in Lohen vergeht der[S. 168] Himmel, der Mond fällt hernieder, Midgard flammt auf, kein Fels steht fest. Der Tag der Vergeltung fährt über die Lande, fährt über die Völker mit Feuer. Da kann kein Verwandter dem anderen helfen vor dem Muspille.“ Einzelnes stimmt auffallend mit dem Bericht der Wala.
Der zerstörten alten Welt (nur das Meer bleibt) muß eine neue folgen. Auch nach germanischer Sage ist diese neue Welt besser als die frühere. Die Wala schaut:
Nach Vafthrudnismal in der älteren Edda heißen die neuen Asen Vidar und Veli, Modi und Magni, Nachkommen von Odin und Thor, die nicht mit der Welt untergegangen sind. Aber Baldr ist ja die poetischere und höhere Figur mit seinem blinden Bruder Hödr. Das neue Menschenpaar ist Lif und Lifthrasir; sie hatten sich während des Weltunterganges (?) in Hoddmimirs (der Weltesche) Grün geborgen, ihre Speise war Morgentau. Als Sonne leuchtet nach der jüngeren Edda eine Tochter der früheren Sonne. Damit vergleiche man den Weltuntergang und Weltneubau nach der Offenbarung Johannis, namentlich Kap. 6, 7 und 20, 21. Man wird sehr erhebliche Ähnlichkeiten zwischen beiden Er[S. 169]zählungen finden. Auch die Sybillinischen Orakel, Buch V, 345 ff., gehören hierher.
Die Menschheit hat immer gerne an kommende bessere Zeiten geglaubt. War die Welt in Sünde und Gewalttat versunken und in Ärmlichkeit und Verkommenheit, so sollte die Gottheit eingreifen, nicht bloß strafend wie früher, sondern helfend und schaffend. Die Indier haben zu diesem Behufe die Inkarnationen, Awatars (S. 139), einer Gottheit (Wischnu’s) erdacht, semitische Völker den Messias, andere Völker Wiederkehr lange vergangener Wohltäter oder von Göttern auf Erden. An diesem Glauben sind die Peruaner und Mexikaner zugrunde gegangen, da sie in solchen Bluthunden wie Pizarro und Cortes mit ihrem spanischen Gesindel diese erwarteten Wohltäter und Götter (Viracocha bei den Peruanern, Quetzalcoatl bei den Mexikanern) sahen. Aber die Juden haben sich an dem Messiasglauben gewaltig aufgerichtet und ihm ihre Erhaltung durch Jahrtausende zu danken. Und das Christentum ist durch ihn Weltreligion geworden. Kaum ein Gedanke der Menschheit hat sich von so enormer Bedeutung, ideeller und praktischer, erwiesen, wie dieser vom Messias, den der zweite Jesaias so liebevoll ausführt, der Indier so phantastisch begabt. Steigen wir von der hohen Messiasidee herab, so sind es Helden und Herrscher, deren Wiederkehr vom Volke erwartet wird, und die inzwischen irgendwo verborgen oder schlafend vorgestellt werden. Unser Friedrich I., Barbarossa (eigentlich nicht er, sondern Friedrich II.) gehört hierher als die markanteste Gestalt. Aber andere Völker der Erde besitzen ähnliche Gestalten. Stanley — „Through the dark Continent“ — erzählt aus den Sagen von Uganda, daß der erste König Kintu als milder und Blutvergießen scheuender Herrscher im hohen Alter, da er seine Nachkommen allen Grausamkeiten frönen sah, mit seinem Weibe geflohen sei. Das Volk war überzeugt, daß er sich verborgen halte, und alle späteren Herrscher suchten ihn. Einem der spätesten, dem siebenundzwanzigsten (Mtesa war der fünfunddreißigste), Ma’anda ward es zuteil, ihn mit seiner Gefolgschaft in einem tiefen Walde sehen zu dürfen.[S. 170] Er sollte nur mit seiner Mutter und dem führenden Bauern kommen. Sein treuer Katekiro folgte ihm aber, um ihn vor etwaigem Verrat zu schützen. Kintu erkannte des letzteren Anwesenheit und machte Ma’anda Vorwürfe. Als Katekiro darauf hinter einem Baume vortrat, tötete Ma’anda ihn durch einen Speerwurf. Da entschwand Kintu mit allen um ihn.
20. Weltbau.
Was die Gestaltung der Welt betrifft, so hängt diese naturgemäß nicht unmittelbar mit der Mythe zusammen, sondern mit dem äußeren Schein. Gleichwohl darf man von mythischen Kosmologien sprechen als von solchen Anschauungen über die Welt, die nicht auf wissenschaftlicher Untersuchung oder Meinung beruhen, sondern, wie die Mythen von den Gottheiten, behauptet werden, und die den Mythen und Sagen zugrunde gelegt werden. Da ist allen Völkern gemeinsam die zentrale Stellung der Erde. Die Erde ist die Mitte der Welt. Meist wird sie von Wasser umgeben gedacht. Ihre Gestalt ist die einer Scheibe (rund oder eckig), eines Zylinders (auch Würfels) oder eines gewaltigen Gebirges oder einer konvexen Schale. Sie schwimmt auf Wasser oder ist durch Säulen, Menschen oder Tiere unterstützt, oder hängt an Wurzeln des Weltbaumes. Der Himmel ist einfach oder, entsprechend der Zahl der gesondert sich bewegenden Gestirne — sieben Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Mond, Sonne) und die Fixsterne insgesamt — und der etwa angenommenen Götterwohnsitze, mehrfach gedacht. Alle Himmel sind solide und umgeben die Erde wie Glocken. Die Gestirne sind Leuchten, auch Götterwohnsitze oder gar Körperteile der Götter (Augen, Antlitz, Leib); sie bewegen sich auf den Himmeln von Ost nach West und kehren auf unsichtbaren Wegen von West nach Ost zurück. Es liegt nicht in der Natur der Mythe, konsequent zu sein und auf die Einzelheiten in den Erscheinungen zu achten. Bemerkt sie Abweichungen gegen die gedachten einfachen Verhältnisse, so sind eben die Götter frei und können sie beliebig ver[S. 171]anlassen. Daher eine Wiedergabe der Erscheinungen nur in den großen, allgemein wahrnehmbaren Zügen, und vielfache Verworrenheit und unbekümmertes Widersprechen in der Beschreibung.
Der Griechen mythischen Ansicht erste literarische Mitteilung finden wir bei Homer. Die Erde ist eine Scheibe vom Strome Okeanos umflossen und vom Himmel überdeckt. Aus dem Okeanos steigen die Gestirne empor und in ihn tauchen sie unter, sofern sie überhaupt auf- und untergehen und nicht, wie die Bärin, „niemals in Okeanos’ Bad“ sich hinabtauchen. Fern im Westen, hinter dem Okeanos, ist der Eingang zu Hades’ Reich, das sich jedoch unter die Erde hinziehen muß. Denn wie im Kampfe der Götter vor Troja Poseidon die Erde erschüttert, springt „des Nachtreichs Fürst Aïdoneus“ voll Schreck in die Höhe und schreit:
Diese Behausung ist „Fürchterlich, dumpf, voll Wustes, wovor selbst grauet den Göttern“. Weiter, wohl darunter, findet sich Erebos. Und noch weiter, und so tief unter Hades’ Reich wie die Erde vom Himmel entfernt, der Tartaros, der furchtbarste Ort, wo die Titanen Japetos und Kronos, von Zeus verbannt, gefesselt in tiefster Finsternis sitzen. Im Westen, am Rande der Erde, jedoch diesseits des Okeanos, wenn nicht als Inseln im Okeanos, liegt auch das Elysische Gefild, „wo der bräunliche Held Rhadamanthys wohnt, und ganz mühelos in Seligkeit leben die Menschen“. Aus allen diesen Angaben hat man entnehmen wollen, daß Homer die Welt eigentlich als Kugel ansieht, deren eine Hälfte erleuchtet über der Erde, deren andere Hälfte ewig dunkel unter ihr liegt. Was den Okeanos anbetrifft, so ist er bei Homer ein Strom. Neuere Untersuchungen glauben jedoch, daß die vorhomerische Bedeutung den Himmelshorizont gebe, Okeanos früher überhaupt der Himmelsgott gewesen sein möchte. Die Etymologie mit der deutschen „Woge“ entfiele dann freilich. Es soll Okeanos dem Sanskritwort açayana entsprechen und „um[S. 172]fassend“, „anliegend“ heißen. Ich sehe nicht recht, warum das nicht auch der homerische Okeanos soll sein können, der ja auch die Erde umfaßt, ihr anliegt. Die Götterwohnung ist auf dem Olympos, über den Wolken, deren Tore die Horen öffnen und schließen; und Helios leuchtet den Göttern wie unten den Menschen. Hesiods Anschauungen von der Welt stimmen mit denen Homers im wesentlichen überein, er ist nur in seinen Mitteilungen etwas detaillierter. So hinsichtlich des Tartaros, daß ein Amboß neun Tage und Nächte fallen müßte, um von der Erde zu ihm zu gelangen, daß selbst ein Sturmwind in einem vollen Jahre ihn nicht zu durcheilen vermöchte, daß auf ihm die Erde gewurzelt ist und der Boden der Meere. Das sind recht stattliche Abmessungen, denn im Sinne Hesiods umgerechnet wäre die Weite des Tartaros mehr als dreißig Erden- und die Tiefe gar zwanzig Sonnenweiten. Der Himmel wird nach Hesiod von Atlas getragen, nach Homer, in einer freilich noch nicht geklärten Stelle, trägt Atlas die Säulen, die den Himmel stützen und von der Erde ab halten. Diese Säulen laufen wohl rings (ἀμφίς) um die Erde herum. Aber dann schwindet freilich Atlas als Person, der doch Kalypso zur Tochter besaß. Man hat auch Atlas als das Meer erklärt (etwa Okeanos?). Stützen für den Himmel, Gebirge, auch rings umlaufende, finden wir auch anderweit. Unerklärlich für die Mythe ist der Aufgang der Gestirne, nachdem sie untergegangen sind. Von der Sonne wird erzählt, sie fahre nächtlich auf dem Okeanos in einem Nachen, Becher, von Westen über Norden um die Erde herum, nach Osten zurück. Es mag aber auch gedacht sein, daß die Gestirne unter der Erde zurückkehren. — Das Weltbild der Argonautensage schließt sich dem vorstehend Beschriebenen an; man hat noch, was wahrscheinlich auch Homer und Hesiod annahmen, einen Meeresarm oder Stromweg vom Schwarzen Meere nach dem atlantischen oder arktischen Meer ziehen lassen, so daß Europa für sich zur Insel wird.
Von den Römern haben wir eine eigentliche mythische Kosmographie nicht; die Dichter wandeln in griechischen Bahnen.
Die Welt der Germanen ist dreiteilig: obere Welt, mittlere Welt, untere Welt, jeder Teil wieder aus drei Teilen bestehend; und von den neun Teilen spricht die Edda an verschiedenen Stellen. Nach Simrock sind diese: Muspelheim (Feuerwelt), Asenheim oder Asgard (Götterwelt), Liosalfaheim (Lichtelfenwelt) als obere Welt; Jötunheim (Riesenwelt), Midgard oder Mannheim (Menschenwelt), Wanaheim (Wanenwelt, Welt der Neben-, Halb- oder Untergötter) als mittlere Welt; Swartalfaheim (Schwarzelfenwelt), Niflheim (Nebel-, Eiswelt, Gegenwelt zu Muspelheim), Niflhel (Helwelt, Totenwelt) als untere Welt. Die drei Hauptwelten werden von je einem Zweige (oder einer Wurzel) des Weltbaumes Yggdrasil gestützt; für diesen Baum soll auch die Irminsul, deren Nachbild Karl der Große bei den alten Sachsen gestürzt hat, stehen. Die Welt der Germanen ist hiernach reicher gegliedert als die der Griechen und poetischer gestaltet. Übrigens bestehen zwischen den verschiedenen Teilen der Welt auch Verbindungen, wie von Asgard zur Erde die Brücke Bifröst (bebende Ruhe), auf der Richard Wagner am Schluß des „Rheingold“ unter so wunderbarer Musik die Götter von der Erde nach Walhall (eigentlich ein Saal in der Götterburg Gladsheim) ziehen läßt. Um die Erde windet sich der Weltwurm, Midgards ormr, Jakob Grimm sagt: „offenbar das Weltmeer“. Also der Okeanos? Noch sind die drei berühmten Brunnen zu erwähnen, die in den drei Welten Asenheim, Jotunheim und Niflhel unter den Zweigen des Weltbaumes hervorsprudeln: Urdbrunnen, Mimisbrunnen, Hwergelmir (der rauschende Kessel). Am ersten Brunnen „halten die Asen und Nornen ihr Gericht“, den zweiten hütet der weise Mimir (nicht der Mime Wagners, sondern ein halbgöttliches Wesen, das mit dem Brunnenwasser täglich Weisheit trinkt, und dem Odin ein Auge als Pfand in den Brunnen versenken muß, bevor er aus diesem gleichfalls Weisheit und Zukunftschauen trinken darf), am dritten sitzt Nidhöggr mit anderen Schlangen. Der Himmel wird wie bei den Griechen als die Erde deckend oder umfassend gedacht. Die Gestirne haben jedes seine Stätte (oder seinen „Stuhl“, oder seinen „Tisch“),[S. 174] die wandelnden unter ihnen Rosse und Wagen. Die Sonne ist das „Feuerrad“ (fagra-hvel in der Edda) oder der „leuchtende Schild“ oder „Wuotans Auge“ oder „Gottes Antlitz.“ Der Mond wird auch als „Schein“ bezeichnet. Der Sonne und des Mondes Lauf um die Welt wird als Flucht vor zwei Wölfen (Sköll und Hati) gedacht, die sie verfolgen und sie zuzeiten verschlingen (Finsternisse!). Die Mondveränderungen werden Zwergen zugeschrieben, „wir wissen nicht näher wie“, sagt Jakob Grimm. Wir wissen auch nicht, wie sich die Germanen die Rückkehr der Gestirne von Westen nach Osten gedacht haben.
Darf man in der zoroastrischen uns überlieferten Literatur alte Tradition sehen, so hatte die Mythe der Eranier bereits eine ziemlich richtige Ansicht von der Erde und dem Weltall. Im Minokherd heißt es: „Himmel und Erde und Wasser und alles andere unter dem Himmel ist so geformt worden wie das Ei der Vögel, der Himmel ist über der Erde und unter der Erde einem Ei ähnlich durch das Händewerk des Schöpfers Ahura Mazda geformt, die Erde innerhalb des Himmels wie das Gelbe im Ei.“ Also das Weltall ist kugelförmig. Noch bedeutungsvoller ist eine Stelle im älteren Bundehesh. Dort wird im einunddreißigsten Kapitel von Himmel, Erde und den Gestirnen unmittelbar als stützenlos gesprochen. Der Himmel ist „ohne Säulen“, die Erde „hat keine Träger“, die Gestirne „schweben im Luftraum“. Weiter wird im Bundehesh erzählt, die Erde enthalte sieben Quartiere, Keschvaras, eines in der Mitte, sechs um dieses herum. Das nachfolgende, aus Windschmanns „Zoroastrische Studien“ entnommene Bild (jedoch mit Vertauschung zweier Quartiere) gibt die Lage der Quartiere gegeneinander und ihre Namen an. Nun wird im sechsten Kapitel, das den Lauf der Sonne in Tag und Jahr behandelt, mitgeteilt (ich habe die Ordnung beibehalten): „Wenn die Sonne aufgeht, erleuchtet sie das Keschvar Çavahi, Fradatatfsn und Vidadatfsn und die Hälfte Qaniras. Wenn sie an jener Seite der Finsternis untergeht, erleuchtet sie das Keschvar Arezahi, Vourubaresti und Vourazaresti und die Hälfte von Qaniras. Wenn hier Tag, so ist dort Nacht.“[S. 175] Man sieht an der Abbildung, daß eine solche Beleuchtung nicht möglich ist, wenn die Erde nicht Zylinderförmig oder kugelförmig ist; das letztere würde mit der Angabe im Minokherd stimmen. Noch wird von der Erde folgendes erzählt. Es sind auf ihr mehrere wichtige heilige mythische Berge. Der Berg Harburc ist um die Erde und an den Himmel befestigt, er reicht sogar über die Region der Gestirne hinaus, bis zu den „anfangslosen Lichtern“. An ihm gehen Sterne, Sonne und Mond auf und unter. Das letztere ist schwer zu verstehen, zumal es im fünften Kapitel heißt: „Der Berg Taera ist in der Mitte der Welt, die Sonne umkreist ihn wie das Wasser rings um die Welt... Der Taera Harburc ist jener, an welchem ich Sonne, Mond und Sterne von zurück wieder kreisen lasse... Am Harburc geht jeden Morgen die Sonne auf und am Abend unter, der Mond, die Fixsterne und die Planeten haben ihr Band und ihr Gehen an ihm.“ Hiernach wäre zu schließen, daß der Harburc ein die Erde etwa in Richtung des Äquators umkreisendes Gebirge ist. Er könnte aber auch die Erde so umlaufen wie die Stützsäulen der griechischen Mythe. Für letzteres spricht, daß das dem Okeanos vergleichbare Meer Frhankart oder Voroukasha am Fuße des Harburc läuft und die Erde, anscheinend im Süden, zu einem Drittel umgibt. Zwei Flüsse gehen vom Nordpunkt (?) des Harburc aus, einer nach Osten, der Arg, der andere, Vas, nach Westen; beide münden im Meer Frhankart oder Voroukasha. So wird der Wasserring um die Erde (die bewohnte?) vervollständigt. Von Bedeutung ist auch der Strom, den die Wunderquelle Ardviçura Anahita (Anahita ist auch Göttin des Planeten Venus) aussendet. Letztere kommt vom Himmel auf einen aus Rubin bestehenden Berg herab, der bald Hugar Bulvend, bald Hukairya, oder Haraiti, oder[S. 176] Hara Berezaiti genannt wird. Auf diesem Berg befindet sich der Paradiesbaum und das Paradies, das Mithra (früher Yima) bewohnte, und von ihm führt der Weg über die Brücke Cinvat in den Himmel. Die Ardviçura strömt durch goldene Kanäle zur Erde in das Weltmeer und unter die Erde, und bildet so das belebende und reinigende Naß. Der Himmel ist aus Edelstein geformt, die Gestirne sind unter ihm, „zwischen Himmel und Erde“, angebracht. Die Sonne heißt auch „Rosselenker“, Aurvat-açpa. Tierkreis und viele Sterne sind mit Namen bekannt. Im übrigen besteht die Welt aus dem Lichtreich, der „bekörperten“ eigentlichen Welt, und dem Finsternisreich unter dieser. Diese selbst ist also in der Mitte, im Vai.
Von den Indiern weiß ich nichts erheblicheres zu sagen; sie dichten eine Menge übereinander angeordnete Oberwelten, fast für jeden Gott eine, oder für jede Gestirnklasse eine, außerdem solche für Büßer, Fromme, Wahrheit usf. Unter dem Himmel kommt die Luftwelt, Dunstwelt. Diese Oberwelten insgesamt werden im Norden (?) von Elefanten getragen. Letztere stehen auf der Erde, die ihrerseits auf Elefanten ruht. Die Stütze dieser Tiere ist die Weltschildkröte, und diese wieder lagert auf der gewaltigen Weltschlange, die das ganze Universum umspannt und im unteren Teile im un[S. 177]geheuren Meere ruht. Zwischen Erde und Schildkröte sind die Welten der Verfluchten, untereinander angeordnet. Das vorstehende Bild gibt die ganze Phantastik mit dem goldenen Berg Meru als Oberwelten. Wer von der Unentwirrbarkeit indischer Kosmogonie und Kosmographie einen Begriff haben will, lese den zweiten Abschnitt im Werk Adolf Bastians: „Der Buddhismus in seiner Psychologie.“ Es ist kaum möglich zu erkennen, was wirklich gedacht wurde. Die Indier haben eine schöne Mathematik und Astronomie besessen. Wie sie aber mythisch den Lauf der Gestirne erklärten, habe ich nicht erkunden können. Wunderlich ist (S. 212), daß die Götter vom Monde speisen, daher seine Abnahme, die in Zunahme durch einwandernde Seelen übergeht.
Wir wollen nur noch die Vorstellungen der Hebräer, Babylonier und Ägypter betrachten. In der Bibel wird von der Welt oft gesprochen, meist in der Weise wie sie durch die Schöpfungsgeschichte gegeben ist. Die Erde aus dem unteren Wasser hervorragend, darüber der Luftraum und der Himmel; an dem Himmel die Gestirne, über dem Himmel die oberen Wasser. Letzteres entspricht der babylonischen Vorstellung, worauf man viel Wert gelegt hat, aber auch Vorstellungen, die wir in Ozeanien (S. 17) und wohl auch in Ägypten (S. 181) finden, und sie liegen ja nahe. Die Erde ist fest. Im 104. kosmographischen Psalm heißt es: „Er hat die Erde auf ihre Vesten gegründet, sie wanket nicht in Ewigkeit.“ Und im Hiob, Kap. 38, spricht der Ewige: „Worauf doch wurden ihre (der Erde) Gründe eingesenkt, oder wer legte ihren Eckstein?“ Aber gerade in diesem Buche, Kap. 26, haben wir eine merkwürdige Angabe Hiobs, daß die Erde frei schwebe: „Den Norden spannte er über Leeres, hängte die Erde über das Nichts.“ Dort wird auch von Säulen des Himmels gesprochen, ob bildlich oder materiell, ist, wie in poetischen Werken so oft, schwer zu entscheiden. Doch steht der Himmel auch auf dem Saume des Weltozeans. Von den Wassern sagt der 104. Psalm: „Du hattest die Flut wie Gewand darüber (über die Erde) gedeckt, auf Bergen standen Gewässer. Vor deinem Dräuen flohen sie, vor deines Donners Stimme enteilten sie.[S. 178] Stürmten Berge hinan, Täler hinab, zum Raum, den du für sie gegründet; du setztest Grenzen, sie überschreiten sie nicht, nicht kehren sie wieder, die Erde zu bedecken.“ Die oberen Wasser „bilden das Obergemach“ im Himmel. Auch eine Unterwelt, Tachat, Scheol, ist vorhanden, nach Hiob, Kap. 26, unter den Wassern: „Die Schatten (Rephaim) entstehen (oder erbeben) unter den Wassern und deren Bewohnern. Nackt ist die Unterwelt vor ihm und keine Decke hat der Abgrund.“ Ebenso nach Kap. 38, Vers 16, 17: „Kamst du bis zu des Meeres Quellen, durchwandeltest den Abgrund der Flut? Sind dir enthüllt des Todes Pforten, die Pforten des Todesschattens siehst du?“ Die Gestirne kehren unter der Erde nach Osten zurück. Im Prediger (Kap. 1, Vers 5) wird von der Sonne gesagt: „Und aufgeht die Sonne und untergeht die Sonne, und zu ihrer Stätte keuchend, geht sie daselbst auf“. „Keuchend“ (wörtlich), weil sie in die Höhe steigen muß.
Die babylonische Mythe weiß im Grunde auch nicht mehr von der Welt. Ihr allgemeines Weltbild ist, wie schon erwähnt, das der Bibel; es mag auch älter sein. Jeremias bringt in seinem Buche „Das Alte Testament im Lichte des alten Orients“ eine „babylonische Weltkarte“, die ich wiederhole. Er sagt: „Jedenfalls stellen die sieben Dreiecke die sieben entsprechenden Teile des den Himmelsdamm und die Erde umströmenden Meeres dar, und sie hängen mit den sieben Kreisen (s. unten) des Supuk (Supuk samê ist der Tierkreis) zusammen, der in den Himmelsozean taucht. Vielleicht sind auch die sieben Meere in Betracht zu ziehen, die in der indischen Kosmologie hervortreten, und die sieben Inseln im Meere bei Henoch, Kap. 77“, wir können hinzufügen: die sieben Keschvars der Eranier. Vom gleichen[S. 179] Autor entnehme ich noch die folgenden Angaben: Das All ist ein doppeltes sich entsprechendes. Das himmlische All hat die drei Teile: Himmelsozean, Tierkreis (himmlische Erde), Nordhimmel. Das irdische All die: Ozean (in der Erde und um die Erde), Erde, Lufthimmel (wo Meteore erscheinen und die Geister schweben). Die Wandelsterne, innerhalb des Tierkreises sich bewegend (an Zahl sieben mit Sonne und Mond), sind die Dolmetscher des göttlichen Willens. „Der Fixsternhimmel verhält sich dazu wie ein an den Rand des Offenbarungsbuches geschriebener Kommentar.“ Die Sterne heißen denn auch Sitir samê, „Schrift des Himmels“. Aus solchen und ähnlichen Anschauungen ist die berühmte chaldäische Astrologie hervorgegangen, mit allen ihren wissenschaftlichen Leistungen und, bis in unsere Zeit nachklingenden, Torheiten. Nach den sieben Planeten wird der Tierkreis als aus sieben konzentrisch übereinander gestellten Ringen bestehend (die sieben Kreise, von denen oben die Rede war) angesehen, „wie eine kreisförmige Treppe, ein riesiger Stufenturm“ (indisch?). „Die siebente Stufe führt in den obersten Himmel, den Himmel des Gottes Anu.“ Letzterer Himmel wird auch als der Fixsternhimmel betrachtet und als erster Himmel gezählt. Dieser Stufenhimmel ist in den Stufentempeln Babyloniens mit allen oder einigen Stufen nachgeahmt. Unter den sieben Stufen sind drei hervorgehoben, die von Sin (Mondgott), Samas (Sonnengott), Istar (Venusgöttin); diese bedeuten die Regenten des Tierkreises. Auf Siegelzylindern finden wir häufig Samas zwischen zwei Bergspitzen als „Himmelstor“ hervortretend. Aber weder von diesem Tor noch von dem Weltberg und dem „Länderberg“ habe ich mir eine Anschauung bilden können. Arrhenius („die Vorstellung vom Weltgebäude“) bringt nach einer Zeichnung von Faucher-Gudin eine Abbildung der babylonischen Welt. „In der Mitte liegt der Kontinent, der nach allen Seiten hin sich zum Weltberg Ararat erhebt. Das Land ist rings vom Ozean umgeben, auf dessen hinterer Seite die Wohnungen der Götter liegen. Über dem Weltberg liegt der Himmel wie eine Glocke (nach der Abbildung auf einem um den Ozean herumlaufenden[S. 180] zweiten Gebirge aufruhend). Der nördliche Teil war mit einem Rohr versehen (mit zwei Öffnungen). Aus der östlichen Öffnung trat die Sonne am Morgen hervor, erhob sich am Firmament, um am Nachmittag wieder zu sinken und schließlich beim Einbruch der Nacht in die westliche Öffnung des Rohres einzutreten. Während der Nacht schob sie sich durch das Rohr und trat am nächsten Morgen durch dessen östliche Mündung wieder heraus.“ Woher der gelehrte Verfasser den Sonnentubus genommen hat, kann ich nicht sagen. Bequem ist er zweifellos, aber in keinem der mir zur Verfügung stehenden Texte und Abbildungen finde ich auch nur eine Andeutung davon. Im übrigen ist die irdische Welt in allen Teilen ein Abbild der Himmelswelt, was auch die Ägypter annahmen und wovon (in Umkehrung) wir ja Beispiele bei den Naturvölkern fanden. Das meiste von diesem Besonderen steht, wie man sieht, trotz äußerer Ähnlichkeit in striktem Gegensatz zu der biblischen Anschauung; der Himmel hat in dieser mit der irdischen Welt nicht das geringste zu schaffen, und das ganze All ist nichts Gott gegenüber. Gott hat den Gestirnen die „Satzungen“ gegeben.
Auch der Ägypter Welt bestand aus den bekannten drei Teilen, Himmel, Erde, Tiefe (Pet, Ta, Dat). Der Himmel ist der Ausgespannte, der Verhüllende, der Hohe, der Gewölbte (Kapu) usf. Er ruht auf vier Säulen oder wird von der Luftregion (Shu) gestützt und trägt die Gestirne und ihre Gottheiten. Der Tempel wird als ein Abbild des Himmels angesehen und dementsprechend ausgebaut und geschmückt. Brugsch führt viele Beispiele an. So ist also „für die auf Erden lebenden Bewohner der Himmel eine prächtige Tempelhalle, ein Dom, unter dessen glanzvollem Dache sie sich ihres Daseins freuen“. Mit einem Himmel überdacht werden auch die Grabkammern; aber dieser Himmel ist schwarz, es ist der untere Himmel, an dem die Sonne nächtlich hinzieht. Mitunter scheinen sich die Ägypter mehrere Himmel übereinander gedacht zu haben; die doppeltgekrümmte Figur in der nächsten Abbildung, welche Himmel, Luft und Erde durch Personen darstellt, erscheint zweimal oder dreimal wieder[S. 181]holt, als Sonnenhimmel, Mondhimmel usf. Die Sonne fährt auf ihrem Himmel auch im Sonnennachen (na-n-Rā), der vom Urgott Nun (auf einem Bilde, aus dem Urgewässer hervorragend) getragen wird. Im Hiob wird der Himmel als Spiegel bezeichnet, bei den Ägyptern als Eisen. Eisen (ba) steht mitunter geradezu für Himmel („Rā fährt oder schwimmt oder wandert auf dem Eisen“), wie umgekehrt das „Eisen des Himmels (ba-n-pet)“ für Eisen überhaupt benutzt wird. Der mythische Name der Erde (Ta) heißt Qeb. Das soll Biegung, Krümmung bedeuten. Ob den Ägyptern aber die runde Gestalt der Erde bekannt war, oder ob Qeb lediglich die Unebenheiten kennzeichnen soll, ist ungewiß. Auch „Schwäche“ soll in dem Worte liegen, und die Erde wird auch als schwacher, alter Mann dargestellt (wie in der obigen Abbildung) oder als leidendes Weib. Die untere Welt ist das Nachtsonnenreich der Welt, unter der Erde und unter den Wassern. Wir kommen auf sie zurück. Figürlich wird sie als zusammengekrümmte Gestalt, Osiris, gebildet. „Die untere Hemisphäre zusammengekrümmt enthält seine (des Osiris) Gestalt“, heißt es in einer Inschrift. Die ganze Welt scheint vom Urwasser Nun eingeschlossen zu sein, wie sich aus einer Abbildung bei Brugsch, „Religion und Mythologie der alten Ägypter“, S. 216, ent[S. 182]nehmen läßt. Das entspräche etwa der biblisch-babylonischen Auffassung. Wenn aber auf der Abbildung auch ein Rand des Wassers außerhalb der Welt sichtbar ist, so würde das mehr an den Okeanos der Griechen erinnern, hinter dem ja auch die Welt, im Tartaros, sich fortsetzt. Indessen kann es sich auch um eine Willkür des Malers handeln. Das All wird unter dem Bilde des Skarabäus dargestellt.
21. Leben und Gottheit.
Die Anschauung vom Leben richtet sich nach dem Grade der Freiheit Gott oder den Göttern gegenüber und nach dem Grade des Vertrauens. Die arischen Stämme scheinen noch am wenigsten abhängig von ihren Göttern gewesen zu sein, aber wohl auch am wenigsten vertrauend auf sie. Aus ihrer Mitte ist der Buddhismus hervorgegangen, in dem die Götter, wenn ihr Dasein nicht geleugnet wird, doch als sehr geringwertig für die Menschen angesehen werden. Hier gilt der extremste Grundsatz nach einer Seite hin; das Leben des Menschen ist bestimmt durch ihn selbst, er ist selbst Meister seines Geschickes (S. 211 ff.).
Fünf Gesichtspunkte sind es vor allem, nach denen das Leben mit seinen inneren und äußeren Vorgängen beurteilt wird: Zufall, Freiheit, Fürsorge, Vorausbestimmung, Zwang. Die genaue Untersuchung dieser Gesichtspunkte gehört in die Metaphysik und Ethik. Auch entfallen hier, wo wir von den aus der Religion fließenden Anschauungen sprechen, der erste und fünfte Gesichtspunkt; es bleiben nur die drei mittleren Gesichtspunkte, und sie setzen das Verhältnis des Menschen zur Gottheit fest. Wenn bei religiöser Anschauung Willensfreiheit herrschen soll, so muß Verantwortlichkeit gegen die Gottheit bestehen. Der Egoismus führt dann auch zu Anforderungen an die Gottheit. Beide können mit dem Leben abgetan sein, oder auch sich über das Leben hinaus fortsetzen. Im ersten Falle hat der Mensch alles Unheil, das ihn im Leben betrifft, als Strafe für freiwillige Missetat zu betrachten, alles Gute als Belohnung für Wohlverhalten.[S. 183] Das letztere nimmt er meist ohne zu danken hin; er wird immer irgendeine schöne Tat finden, für die er Belohnung glaubt sich erwarten zu dürfen. Denn das rein ethische Wohltun aus Trieb der Seele und Freude daran ist gar selten und schaltet eigentlich die Gottheit aus. Aber eine Strafe sieht der Mensch nicht immer als verdient an. Dazu gehört wahre, herzensinnige Frömmigkeit und Zerknirschung, wie wir sie in den Hymnen, Psalmen und Kirchenliedern oft so ergreifend ausgedrückt finden. Hier vermischt sich die Anschauung mit der von der Fürsorge der Gottheit für den Menschen. Das Leben wird der Gottheit vertrauensvoll überlassen. Was diese bietet, wird in Demut angenommen, was sie verhängt, in Demut ertragen; vielleicht als Belohnung, vielleicht als Buße, immer aber als Ratschluß des Höchsten, der schon weiß, warum. Ich brauche aus dem Monotheismus keine Beispiele anzuführen. Aber auch der Polytheismus kennt solche Anschauungen:
ruft die unglückselige Hekabe bei Euripides aus. Ähnlich heißt es in dem schönen babylonischen Klagelied an Istar:
Damit in Verbindung steht dann die für alle Religion so absolut notwendige Anschauung, daß die Gottheit sich erbitten läßt, unverdiente Gnaden erweist, verdiente Strafe erläßt. Im Polytheismus wird sogar eine Gottheit gegen die andere angerufen. In jenem Istar-Liede sagt der Flehende:
So wird Istar auch der „Stern der Klagen“ genannt, und dieses trotz der Schilderung ihrer willkürlichen, absoluten Übermacht, die Freunde verfeindet und auf dem Schlacht[S. 184]felde herrscht. Seltsam, mehr wunderlich, klingt die fast stehende Versöhnungsformel an die Gottheiten, daß „ihr Herz sich beruhigen möge“ oder „sie selbst sich beruhigen mögen“, wie überhaupt die babylonischen Texte soviel von der Unruhe der Gottheiten sprechen, ja von ihrem Lärmen, wodurch auch so viel Kampf und Streit zwischen ihnen entsteht; so der kosmogonische Kampf Apsus und Tiamats gegen sie. Vielleicht treffen unsere Übersetzungen nicht den richtigen Sinn. Es sind auch Kollektivlieder für jede beliebige Gottheit gedichtet und bekannt. Wenn der Mensch sein Wohlverhalten dem Gotte vor Augen stellt, so geschieht das nicht selten in der Weise, daß er sagt, die und die Sünde hätte er nicht begangen. Das 125. Kapitel des ägyptischen Totenbuches ist dafür sehr charakteristisch. Die Vorschrift lautet: „Was NN (als Toter) spricht, wenn man zur Halle der beiden Wahrheiten (S. 189) gelangt, nachdem NN sich losgemacht hat von allem Bösen, das NN getan hat, um das Antlitz aller Götter zu schauen“. Und nun kommen die Bekenntnisse. „Ich habe nicht falsch gehandelt gegen die Menschen“ usf. Dreiundsechzig solche negative und kaum zehn positive, unter den letzteren freilich das so schöne:
Andere Völker sind ähnlich verfahren. Bei allen aber werden nicht selten Zweifel an der Hilfe der Gottheit geäußert, entweder weil diese dem Menschen zu fern steht und sich um ihn nicht kümmert, oder weil der Mensch sich zu niedrig dünkt Gott gegenüber. Wie oft ist dem letzteren Gefühl in Psalmen, aber auch in den anderen Schriften der Bibel Ausdruck verliehen: „Was ist der Mensch, daß du sein gedenkest“ usf. Bei den Ariern finden wir mehr den Zweifel an dem Wollen der Gottheit; Euripides bietet eine Menge von Beispielen. Hekabes Ausruf: „Ihr Götter! Zwar unnütze Helfer seid ihr uns; doch ist es tröstlich anzuflehen die Himmlischen, wenn unsereinen heimsucht das Mißgeschick“, gehört noch zu den mildesten.
Weit verbreitet ist sogar die Anschauung von der Gottheiten „Neid und Mißgunst“ gegen die Menschen. Wie sie untereinander Neid und Mißgunst hegen und dadurch zum Kampf gegeneinander getrieben werden, daß ein Göttergeschlecht das andere stürzt, hat in furchtbaren Worten Aischylos im Prometheus geschildert. Dann wie die Gottheiten nach Willkür herrschen, ganz wie Tyrannen auf Erden:
Und dann:
Prometheus, der dies von Zeus sagt, rettet die Menschen. Das steht nicht fern von der Art wie Ellil bei den Babyloniern verfährt, daß Ea wenigstens für wenige Retter sein muß. Namentlich erregt Glück den Neid der Götter. Und wer etwa sich darin überhebt, muß es schwer büßen. Niobes Tragödie spricht noch jetzt zu uns aus den herrlichen und rührenden Darstellungen, die wir bewundern. Selbst die Bibel hat Anklänge, daß Gott dem Menschen nicht alles gewähren will, wie in der Paradiessage und in der Sage vom Turmbau zu Babel. Doch tragen solche Erzählungen auch den Stempel der Erklärung für Erscheinungen im Leben der Menschheit. Warum der Mensch mühselig sein Leben verbringt, warum er stirbt, warum er so zerstreut und vielsprachig auf Erden weilt. Andere Völker haben aus gleichem Grunde andere Sagen erfunden.
So ist die Freiheit des Menschen doch keine unbedingte und die Fürsorge der Gottheit keine vollkommene. Darum ist es dem Menschen auch ein vertrauter Gedanke, daß er über sich überhaupt nicht zu bestimmen habe, daß, wie seine Geburt, so auch sein ganzes Leben durch die Gottheit vorausbestimmt ist und sein Tod. Was ihm Gutes zukommt, was ihn Böses berührt, hat die Gottheit schon vorgewirkt. Dieses[S. 186] entweder absolut oder relativ (vom Schicksal S. 136 ff.). Wie weit die absolute Vorausbestimmung geht, sehen wir in dem grämlichen „Prediger“: „Denn auch daß ein Mensch esse und trinke und Gutes genieße für alle seine Mühe, ist eine Gabe Gottes. Ich weiß, daß alles was Gott tut, das wird ewig sein, hinzuzufügen ist nichts und davon zu nehmen ist nichts, und Gott tat es, daß sie sich fürchten vor ihm.“ „(Ich weiß) daß, was den Menschensöhnen begegnet und was dem Vieh begegnet einerlei Begegnis für beide sei; wie der Tod dieses, so der Tod jener, und einerlei Geist in allem, so daß der Vorzug des Menschen vor dem Viehe nichts sei, denn alles ist eitel.“ Daraus folgt dann das berühmte: „Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig.“ So scharf wie im „Prediger“ findet sich der Pessimismus freilich selten ausgesprochen, außer etwa bei Philosophen. Aber über Gebundenheit und Machtlosigkeit klagt der Mensch überall.
Die Verzweiflung führt dann zunächst zu der Lebensweisheit der Unbekümmertheit und des Genießens. Im „Prediger“ wird sie fortwährend empfohlen: „Siehe, was ich gesehen habe, das ist gut, daß es schön ist, zu essen und zu trinken und Gutes zu sehen für alle seine Mühe, die er sich müht unter der Sonne die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben, denn das ist sein Teil.“ „Am Tage des Glückes fühle dich glücklich, und am Tage des Unglückes sieh’s an.“ „So preise ich die Freude, daß nichts gut ist für den Menschen unter der Sonne als zu essen und zu trinken und sich zu freun.“ „Denn so viele Jahre der Mensch lebt, ihrer aller freue er sich und gedenke der Tage der Dunkelheit, daß ihrer viele sein werden; alles was kommt ist nichtig.“ Gemildert werden diese Lehren durch die ethische Auffassung, daß die Freude ein Entgelt für die Mühsal ist, die der Mensch tragen muß, und daß bei allem der Mensch doch nichts Böses tun darf, sondern Gutes wirken muß. Eine Tradition schrieb den „Prediger“, selbstverständlich mit Unrecht, König Salomo zu. Die Azteken hatten im König Netzahualcoyotl (1470) einen ähnlichen Salomo: „Allen irdischen Dingen ist ihr Ende bereitet. Inmitten der fröhlichen Laufbahn ihres Glanzes und[S. 187] ihrer Eitelkeit geht ihnen die Kraft aus und sie werden zu Staube. Das ganze Erdenrund ist nichts als ein Grab, und alles, was darauf lebt, wird einst darunter begraben werden. Die Dinge von gestern sind heute nicht mehr und die Dinge von heute werden vielleicht schon morgen nicht mehr sein. Die einst auf Thronen gesessen, Versammlungen gelenkt, Heere befehligt, Länder erobert, göttliche Verehrung gefordert, der Macht der Herrschaft, dem Ruhm nachgejagt haben, wo sind sie jetzt? Verschwunden mit all ihrer Herrlichkeit, gleich dem Rauche, der aus dem Krater des Popokatepetl aufsteigt und spurlos verschwindet.“ So lautet die triste Weisheit des aztekischen Königs nach Ixtlilxochitl, als wenn er das entsetzliche Schicksal seines Volkes und seiner Nachkommen geahnt hätte. Und daran schließt er, wie der „Prediger“, die Mahnung: „Aber du, mein Freund, so freue dich der Anmut dieser Blumen, freue dich mit mir. Wirf nun Furcht und Sorge von dir, die uns den Genuß verderben bis ans Ende des Lebens. Sammle ja alle zusammen, welche Liebe dir verbindet, welche teuer dir in Freundschaft. Denn auf Erden ist nichts sicher als des Todes herbe Schneide. Auch im Wechsel ist die Zukunft.“ Phantasiebegabte Ethnologen haben bereits behauptet, die Azteken und Mayas wären die verlorenen zehn Stämme Israel. Also Tradition! Gleiche Anschauungen sollen sich im alten peruanischen Drama „Ollanta“ finden. Sicher haben die Literaturen der meisten Völker solche und ähnliche Ausbrüche von Menschenverzweiflung über das Leben. Wie die Indier darüber dachten, haben wir an anderer Stelle zu erörtern. Von den griechischen und römischen Lehren genügt es, zwei Äußerungen hervorzuheben. Herakles sagt in der Alkestis zu dem um seine Herrin trauernden Diener:
Und als Hauptspruch den schon benutzten (ähnlich auch von Epicharmos):
Und sicher fällt meinem Leser noch Horatius’ Ermahnung ein: „Quid sit futurum cras fuge quaerere, quam fors dierum cunque dabit, lucro appone.“ In einer Rezension des Gilgames-Epos der Babylonier (vielleicht aus mehr als 2000 v. Chr.) sagt Sabitu (eine Göttin, die am Rande der Welt wohnt) zum Helden:
Ähnliche Lehren finden wir in dem ägyptischen sogenannten Harfnerliede, dessen Inhalt aus etwa 1700 v. Chr. stammt. Es wird geschildert wie Menschen, Städte und Länder vergehen, und dann rät der Dichter:
Alles dieses klingt so allgemein menschlich aus urältester Zeit, und klingt noch heute.
Es ist nur ganz natürlich, daß der Mensch gerne sein Schicksal erkennen möchte. Die Chaldäer vornehmlich haben dazu die Astrologie geschaffen, die sich aber fast überall auf der Erde vorfindet, sei es daß die Gestirne, als Gottheiten, in ihrer Stellung bei der Geburt und später, ihren Willen kundtun, sei es daß höhere Mächte das Geschick wie Schrift am Himmel ordnen (S. 179). Es wird jedem Stern an sich eine Bedeutung für das menschliche Wesen und für die Welt beigemessen — wer denkt nicht an den Stern bei Christi Geburt![S. 189] — und auch in Verbindung mit den anderen Sternen. Und es gilt, aus der Kombination der Sterne das Wahre zu erraten, oder am Himmel wie in einem Buche zu lesen. Das verstehen nicht alle, sondern nur gewisse Leute. Sonst hat die Menschheit noch die Orakel der Gottheiten ausgebildet, wofür die Griechen wohl die merkwürdigsten Beispiele besitzen. Oder Wahrsagungen durch Geister Verstorbener, oder von weisen Männern und Frauen, — die Beschwörung der Hexe von Endor, zu der der gewaltige und unglückliche Saul wandert, gehört hierher. — Auch Zeichen an Tieren, namentlich bei den in dieser Hinsicht recht törichten Römern, die sich von ihren eigenen Deutern verspotten lassen mußten, oder solche an Gewitter, Wind und allen möglichen Begegnissen spielen eine große Rolle. Von diesem allen zu sprechen ist nicht meine Aufgabe. Die „Geheimlehre“ ist eine sehr ausgebreitete Wissenschaft mit Horoskop, Beschwörung, Hölzchenwerfen, Kartenlegen und allem so sonderbaren Unfug, Zauber und Spuk. Sie hat noch jetzt, wie die vielen Prozesse zeigen, die dabei doch immer nur flagrante Fälle treffen, eine außerordentliche Bedeutung in vielen, nicht selten geistig sehr wenig gebildeten oder von Aberglauben durchsetzten Kreisen. Ich wüßte aus meinen Kreisen die unglaublichsten Dinge zu erzählen, wie ein, an sich ganz verständliches Drängen des Menschen, seine Zukunft und die Folgen seines Tuns und Lassens zu erkennen, zu größten Albernheiten ausartet. Wieviel Unheil die griechischen Orakel angerichtet haben, meist durch Zweideutigkeit, oft auch durch Dienstfertigkeit gegen eine Person oder einen Stamm, wie des delphischen Orakels gegen die Spartaner, ist bekannt. Aber die erleuchtetsten Geister der Griechen haben doch an sie geglaubt. Da ist es nicht zu verwundern, wenn Ägypter, Chinesen, Amerikaner, Indier usf. gleichfalls an solche Dinge glaubten, und daß Weissagungen zu Staatseinrichtungen wurden. Der delphische Gott hat fast die ganze alte Kulturwelt, bis tief nach Asien hinein und bis zu den Säulen des Herakles durch seine Aussprüche beherrscht. Wir kennen deren eine große Zahl. Und wie gerne denkt man an die Prophezeiungen der gewaltigen Propheten[S. 190] mit ihrer so immensen ethischen und religiösen Bedeutung! Und, in weitem Abstande freilich, doch zum Teil von poetischem Geist getragen, stehen die sibyllinischen Weissagungen, aus so viel späterer Zeit. Auch in den babylonischen, ägyptischen und anderen Texten haben wir Prophezeiungen, namentlich aber viele Beschwörungen von Göttern und Dämonen. So sehr bildeten diese einen Bestandteil des Lebens, daß sie sich zu Formeln verdichteten, in die, ähnlich wie bei den Bittliedern (S. 184), nur der jedesmalige Name des Gottes oder Dämons des Beschwörenden, oder desjenigen für den etwas beschwört werden sollte, und die Bitte (z. B. um Heilung von der und der Krankheit) einzutragen war. So beginnt ein babylonischer Text:
Und bei solcher Beschwörung wurden, harmlos genug, Blüten, Früchte, Wolle usf. verbrannt. Eine der großen babylonischen Beschwörungen unter dem Namen Ea und Atrahasis (S. 161), betrifft Unheil und Sünde, die das ganze Land ergriffen haben, und Plagen, die Ellil gesandt hat, richtet sich aber wesentlich auf Hilfe für schwangere Frauen. Ea und Atrahasis scheinen die Helfenden zu sein. Selbst die Gottheiten benutzen bei ihrem Tun Beschwörungsformeln; in demselben Text bilden (symbolisch?) Ea und die Göttermutter Mami oder Aruru Wesen aus Lehm, dabei spricht Mami eine Beschwörung und speit auf den Lehm. Bei dieser Beschwörung spielen sieben „Mütter“ (man denkt unwillkürlich an die Mütter im „Faust“) eine Rolle. Selbst Ormuzd bedient sich einer Beschwörungsformel, des Honover, gegen Ahriman und stürzt ihn dadurch zu Grunde. Die ungeheure Bedeutung des Spruches bei den Indiern habe ich mehrmals hervorgehoben. Und der Römer konnte ohne Abwehrformeln überhaupt nicht leben; wie auch gegenwärtig der Bauer, und nicht bloß dieser, gegen Beschreien, bösen Blick, Katzen, die ihm über den Weg laufen u. a. Abwehrformeln murmelt oder sich bekreuzigt.
Mit derartigen Anschauungen hängen dann die der Dies nefasti zusammen, der Tage, die an sich voll Unheil sind, und an denen nichts unternommen werden darf, sowie ihrer Gegensätze, der Dies fasti, der guten Tage. Die Kalender in allen Teilen der Erde hatten die Aufgabe, diese Tage anzumerken. Und Priester und Wahrsager wurden bei großen und kleinen Unternehmungen benutzt, durch Vogelschau, Opfer und sonstige Anzeichen festzustellen, ob der betreffende Tag dazu auch geeignet sei. Die Geschichte der Völker ist voll von Beispielen dafür. Auch die Sabbatvorschriften, für die die Bibel einen so menschenfreundlichen und edlen Zweck angibt, die Ruhe von Mühe und Arbeit für sich und alle anderen, selbst für das arbeitende Vieh, beziehen sich anderweitig vielfach auf schlimme Tage. Ein babylonischer Text, den man als Sabbatvorschrift bezeichnet und der in der Tat für den 7., 14., 19., 21. und 28. des Schalt-Ellul das Kochen von Fleisch, das Anziehen eines Hemdes, das Opfern, das Fahren, das Wahrsagen, das Behandeln von Kranken, jede Unternehmung verbietet, wie etwa am Sabbat der Hebräer, beginnt aber mit der Überschrift: „Ein böser Tag“. Es ist also kein Sabbat, kein Sonntag, der ja ein feierlicher und glücklicher Tag sein sollte und war und ist. Auch die Folge im Monat zeigt dieses; zwischen dem 14. und 19. sind nur fünf, zwischen dem 19. und 21. gar nur zwei Tage. Und unsere „Freitage“ und „Dreizehnten“! Selbst die gleichfalls auf der ganzen Erde verbreiteten Speiseverbote gehören bis zu einem gewissen Grade hierher, soweit sie nicht einheimischen Anschauungen ihre Entstehung verdanken. Doch kann ich darauf nicht eingehen.
Im ganzen nimmt die Freiheit des Menschen zu, wie die Zahl der Gottheiten abnimmt und der monotheistische „Knecht Gottes“ ist sicher freier als der polytheistische „Bildner“ seiner Gottheiten. Das liegt auch daran, daß nicht, wie unter Menschen, mit der Macht des Einzelnen die Unterdrückung und so oft auch die Ausnutzung wächst, sondern daß der Glaube an die Fürsorge aus dem donnernden und gefürchteten Gott einen, wenn auch strafenden, doch gütigen Vater im[S. 192] Himmel macht, trotz der vielen Erfahrungen, die hier so bewegend widersprechen.
22. Nachleben und Jenseits (Eschatologie) der Kulturvölker.
Wir kommen zu einer recht schwierigen und umfangreichen Untersuchung, aber einer von der höchsten Bedeutung. Wie die Naturvölker über Nachleben und Jenseits denken, habe ich oft und eingehend auseinandergesetzt (auch Abschnitt 14). Wir haben es jetzt mit den Kulturvölkern zu tun. Daß auch bei ihnen Reste naturmenschlicher Anschauungen auf diesem Gebiete in reichlicher Zahl sich finden, habe ich gleichfalls schon dargelegt und mitgeteilt. In der Tat ist im Grunde jedes Nachleben mit irdischem Fühlen, Denken und Bedürfen an sich naturmenschlich, und nur die hinzukommenden ethischen Motive und ethischen Veranstaltungen können Kulturelles begründen. So sehen wir denn auch im allgemeinen rein Naturmenschliches mit Kulturellem gepaart und gemischt. Drei Hauptanschauungen müssen wir vor allem unterscheiden. In der einen Anschauung ist der Gestorbene für immer tot, höchstens, daß er am Ende der Zeit auferweckt wird. Nach der zweiten kann er als Dämon, Gespenst, Geist usf. aus gewissen Gründen die Erde noch besuchen. Es handelt sich dann nur um Naturmenschliches, das wir schon kennen. In der dritten Anschauung stirbt der Mensch nur, um in anderer Gestalt wieder zu kommen. Das allgemeine Leben ist kein einmaliges, sondern ein von Ewigkeit her bestehendes Kommen und Scheiden der Seele, bis zum Eingehen in die letzte Ruhe (Seelenwanderung, Metempsychose). Das ist dem nächsten Abschnitt vorbehalten.
Wir betrachten die erste Anschauung und müssen dabei sogleich ein Volk gesondert behandeln, weil bei ihm die größten Zweifel noch ungelöst vorhanden sind: die alten Hebräer. Der bekannte Pentateuchausdruck für das Sterben ist: „Sich zu den Vätern versammeln“. Wie das animistisch gedeutet werden kann, ist bereits ausgeführt (S. 106). Sonst finden wir die Angabe, die Seele oder der Geist, Nephesch[S. 193] oder Ruach, als das von Gott dem Staubgebildeten Eingehauchte, verlasse den Menschen im Sterben; der Leib werde zur Erde. Der „Prediger“ in seinem Pessimismus sagt: „Allen Lebenden ist Hoffnung, denn es ist besser um einen lebenden Hund als um einen toten Löwen“. Und er spricht den Toten jeden Anteil ab „an allem, was unter der Sonne geschieht“. Selbst den Lohn empfangen sie nicht, „sie wissen nicht das geringste“. Das wäre also absoluter Tod. Aber wie unsicher sich der „Prediger“ fühlt, zeigt die Äußerung: „Alles geht an einen Ort, alles ward aus dem Staube und alles kehrt zurück zum Staube. Wer kennt den Geist (Ruach) der Menschensöhne, ob er in die Höhe (Maala) steigt, und den Geist des Viehs, ob er hinuntersinkt zur Erde (Arez)“. Und diese Unsicherheit finden wir fast überall bei den alten Hebräern. Der Aufenthaltsort des Toten ist der Scheol, Tachat; aber es ist schon nicht gewiß, ob wir darin einen Hades, Orcus zu sehen haben oder nur das Grab des Betreffenden. Das erstere scheint das allgemeinere, doch sind die Epitheta auf Grab wie auf Totenreich anwendbar: die „Öde“, die „Verborgenheit“, „einsame Gruft“ usf. Im Hiob, Kap. 10, wird vom „Land der Finsternis und Todesschatten“ gesprochen, auch vom „Land des Grauens, ein Dämmerungsdunkel, wo es graut wie Dämmerungsdunkel“. Im Jesaias werden die „Pforten der Unterwelt“ (Schaare Scheol) genannt. Und die Toten heißen „Bewohner der Nichtigkeit“. Solche und ähnliche Angaben deuten wieder mehr auf eine besondere Unterwelt. Die Geschiedenen werden meist als Rephaim, die Kraftlosen, Matten bezeichnet oder als Zalmaweth, Schatten, Bilder; letzteres fast genau den griechischen εἴδωλα entsprechend. Und überhaupt gleichen diese Anschauungen in merkwürdiger Weise den griechisch-römischen, ohne die späteren Ausschmückungen. Von Lohn oder Strafe sind in den alten Schriften keine rechten Spuren zu finden. Bei bewußt- und empfindungslosen Seelen würden sie auch keine Bedeutung haben. Um so höher muß man eigentlich Anschauungen einschätzen, wenn sie die Menschheit Recht, Sitte und Liebe lehren wollen, ohne Drohen mit ewigen Strafen und ohne[S. 194] Verheißung ewigen Lohnes. Auf Auferstehung der Toten deuten Aussprüche wie Jesaias 26, 19: „So mögen aufleben deine Toten, meine Leichen wieder erstehen: Erwachet und jubelt, Bewohner des Staubes! Denn Tau auf Pflanzen ist dein Tau, aber die Erde wirft Schatten nieder“. Erst nach der Rückkehr vom Exil scheinen sich die Ideen von Hölle und Paradies zu bestimmten Anschauungen ausgebildet zu haben. Schon solche Stellen wie Psalm 17, 15: „Ich aber werde schauen in Gerechtigkeit dein Antlitz, der Wonne Fülle haben, wenn ich erwacht, an deinem Bilde“. Psalm 16, 10, 11: „Denn nicht überläßt du meine Seele (Naphschi) der Gruft (Scheol), lässest nicht deine Frommen schauen die Grube (Tachat). Den Pfad des Lebens wirst du mir kundtun; Fülle der Freuden ist vor deinem Antlitz, Wonne in deiner Rechten immerdar“. Psalm 26, 9: „Raff meine Seele nicht mit Sündern hin, mit Blutmenschen nicht mein Leben“ u. ä. deuten darauf hin. Man weiß nur von wenigen Psalmen, wann sie gedichtet sind; manche meinen übertrieben, alle seien erst nach dem Exil entstanden. Genauere Angaben finden sich in den Apokryphen und den Pseudepigraphen. In dem zweiten Makkabäerbuch (wohl kurz vor Christi Geburt geschrieben, vielleicht schon um 100 vor Chr.) handelt Kap. 7 von dem Martyrium der sieben Brüder, die die katholische Kirche unter ihre Heiligen aufgenommen hat (die Reliquien werden im Kölner Dom gezeigt), und dabei von Auferstehung und Leben im Himmel. Im Kap. 12 wird erzählt, wie Juda’s Leute bei den bei Adullam gefallenen Juden „unter dem Hemde Zaubermittel von den Götzen aus Jamnia gefunden hätten“. Um das zu sühnen, sammelte Juda Geld und sandte es als Opfer nach Jerusalem, „indem er auf die Auferstehung Bedacht nahm. Denn hätte er nicht erwartet, daß die in der Schlacht Gefallenen auferstehen würden, so wäre es Torheit gewesen, für Tote zu beten. Sodann zog er in Betracht, daß dem in Frömmigkeit Entschlafenen der herrlichste Gnadenlohn aufbehalten sei“. Zwischen 150 vor Chr. und 40 nach Chr. soll das „Buch der Weisheit Salomonis“ verfaßt sein. Darin heißt es von[S. 195] den Gottlosen: „Und nicht erkannten sie Gottes Geheimnisse, Noch hofften sie einen Lohn des heiligen Wandels, Und wollten nichts wissen von einem Ehrenpreis für makellose Seelen. Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen. Und ihn zum Bilde seines eigenen Wesens gemacht. Durch den Neid des Teufels aber kam der Tod in die Welt. Es erfahren ihn aber die, welche jenem angehören, der Gerechten Seelen aber sind in Gottes Hand, und keine Qual kann sie berühren. Nach dem Wahne der Unverständigen scheinen sie tot zu sein“. Nun kommt etwas, das wie Glaube an Fegefeuer klingt: „Denn wenn sie auch nach der Anschauung der Menschen gestraft werden, ist doch ihre Hoffnung ganz von der Unsterblichkeit erfüllt. Und nachdem sie eine kurze Qual überstanden haben, werden sie große Wohltaten erfahren, denn Gott hat sie nur geprüft und hat sie seiner würdig befunden“. Das wird noch weiter ausgeführt, und wie sie zuletzt auch die Heiden richten und über die Völker herrschen. Es heißt dann: „Die Gottlosen aber werden ihren Gesinnungen gemäß Strafe erleiden.“ Hier, und noch an anderen Stellen, haben wir also Unsterblichkeit, Auferstehung, Belohnung nach dem Tode, Läuterung, Strafe der Sünder. Alle Elemente, aus denen später das Christentum die gewaltigen Dichtungen von Paradies, Hölle, Fegefeuer, Auferstehung und Jüngstem Gericht geschaffen hat. Die Unsterblichkeit ist jedoch noch an die Erfüllung von Gottes Geboten geknüpft. Und schon im Daniel (vor 100 vor Chr.) heißt es in Kap. 12: „Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben, etliche zu ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die so viele Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich“. Bald ist auch die Hölle als Gehinom bekannt und das jüngste Gericht und ebenso die Totenbrücke (S. 192). Der Talmud namentlich bildete die Lehren weiter aus. Interessant dafür ist eine Legende. Ein römischer Kaiser fragte den berühmten Jehuda Hanassi, wie das wäre; der Körper könne doch ohne Seele nichts, und die Seele sei doch an sich ohne Leidenschaft;[S. 196] wer büße denn für Missetat. Da antwortete der Talmudist mit einer Erzählung: Ein König hatte einen Garten mit herrlichen Früchten und ließ ihn, um ganz sicher zu sein, von einem Blinden und einem Lahmen bewachen. Aber der Lahme stieg auf des Blinden Schultern, und indem er dessen Schritte lenkte, kamen sie an die Früchte und stahlen sie. Wer war schuld? Der Blinde, der die Früchte nicht sehen oder der Lahme, der nicht zu ihnen gelangen konnte? Der König erkannte die List und bestrafte beide. „Ganz so wird es auch Gott beim Jüngsten Gericht machen. Er wird die Seele wieder in den Körper versetzen, damit sie gemeinsam der Strafe teilhaftig werden für die Untaten, die sie eben gemeinsam verübt haben.“ Daß die Bibel Menschen kennt, die weggenommen werden, wissen wir von Henoch und Elias. Ich habe von dem vielen nur weniges anführen können. Was steht nicht alles in dem wunderlichen und zum Teil so schönen Buche Henoch (167–64 vor Chr.), an das die Apokalypse so sehr erinnert! Und wie vieles in den älteren Büchern noch bis auf Jesaias! Und sicher sind die späteren Ideen vom Leben nach dem Tode nicht ohne Anhalt an Lehren der Bibel oder von Werken, die uns verloren gegangen sind, entstanden, wenn man bedenkt, wie außerordentlich abweisend die Juden gegen jedes Fremde, namentlich Heidnische, stets gewesen sind, trotz aller äußerlichen Drangsale. Die Ideen des Christentums vom Leben nach dem Tode brauche ich nicht auseinanderzusetzen; wir kennen sie alle, haben sie in der gewaltigen „Göttlichen Komödie“ und in unzähligen malerischen Darstellungen.
Ea-bani, Gilgames’ Freund, träumt einen schweren Traum; ein Dämon führt ihn in die „Behausung der Finsternis, die Wohnung Irkallas (des Totengottes)“
Das ist die erste babylonische Beschreibung der Unterwelt und ihrer Toten. Und es finden sich in der Unterwelt alle Menschen: Tiarenträger, Hohepriester und Priesterknechte, Beschwörer und Bettelpriester, Helden und Feige. Eine fast wörtlich gleiche Beschreibung gibt die berühmte „Höllenfahrt der Istar“. Die Unterwelt heißt Kurnugea (Land ohne Rückkehr). Und die Todesgöttin Ereskigal selbst sagt, daß das Los der Toten bejammernswert ist. Warum Istar die Unterwelt besucht, ist nicht gewiß; sie erzwingt sich vom Pförtner Einlaß durch die Drohung, die Tore zu sprengen und die Toten herauszulassen. Auf Ereskigals Befehl öffnet der Pförtner und soll Istar „gemäß alten Geboten“ behandeln. Durch sieben Tore muß sie wandeln und an jedem wird ihr vom Pförtner ein Teil ihres Schmuckes und ihrer Bekleidung fortgenommen. Als sie vor der Todesgöttin steht, ist sie gänzlich entblößt. Sie fährt drohend gegen diese auf, wird aber auf deren Befehl vom Vezier Namtar, der auch Krankheitsdämon ist, eingeschlossen und mit sechzig Krankheiten behaftet. Da hört alle leibliche Liebe auf Erden auf und alle Befruchtung und Fortpflanzung. Samas weint darob vor Sin (Mondgott und Istars Vater) und Ea, und letzterer schafft einen babylonischen Orpheus, Asusu-namir, einen Spielmann. Dieser soll vor Ereskigal spielen, bis sie sich erfreut, und dann den Schlauch mit dem Lebenswasser verlangen. So geschieht’s. Ea’s Geschöpf wird zwar wegen der angewandten List verflucht, der Niedrigsten Niedrige zu sein. Aber er erhält den Schlauch, Istar wird vor die Annunaki (Richter in der Unterwelt) geführt, mit dem Lebenswasser besprengt und aus der Hölle entlassen. An jedem Tore empfängt sie die ihr dort abgenommenen Gegenstände. Das Gedicht ist in starker Unordnung, Greßmann meint, durch Schuld des Abschreibers. Am Schluß steht etwas, das darauf schließen läßt, daß die Toten auch zur Erde emporsteigen, und zwar in den Klagetagen des Tamuz (Dumuzi), des babylonischen Adonis, den seine Schwester Belili (eine Unterweltsgöttin, anstatt Aphrodite) beweint. Der Unterweltsgott ist Nergal; er ist es in sonderbarer Weise geworden. Die Götter veranstalten ein[S. 198] Mahl; da Ereskigal die Unterwelt nicht verlassen darf, soll sie sich das Essen holen. Sie sendet ihren Vezier Namtar hinauf. Alle Götter erheben sich vor ihm, nur Nergal (Gottheit alles Schlimmen, der Sonnenglut, des Krieges, der Pest) bleibt sitzen. Darüber ergrimmt die Todesgöttin und verlangt Nergals Auslieferung, um ihn zu töten. Nach großem Jammern wird Nergal seinem Schicksal entgegengesandt. Aber er nimmt sich vierzehn Geister mit und läßt von jedem ein Tor der Hölle bewachen (hier sind also vierzehn Tore vorhanden, nicht sieben). Nun stürmt er auf Ereskigal los und will sie seinerseits töten. Auf ihr Bitten jedoch läßt er sie leben. Sie gibt die „Tafeln der Weisheit“ (?) in seine Hand und wird seine Gattin, er wird dadurch Gott der Unterwelt. Nergals Hauptkultort ist Kutha (wie Marduks Babylon), danach heißt die Unterwelt auch Kutha. Es gibt noch mehr babylonische Unterweltsberichte, aber neues ist nicht zu ersehen. Die Unterwelt entspricht etwa dem Hades-Orcus. Totenrichter sind vorhanden (die Annunaki), ein Totengott und eine Totengöttin herrschen, eine Schreiberin und Dämonen aller Übel stehen ihnen zur Seite. Alfred Jeremias sagt: „Die Anzeichen häufen sich, daß die Babylonier mit ihrem Unsterblichkeitsglauben die Anschauung von einem Strafgericht bzw. von einer Strafbefreiung nach dem Tode verbunden haben“. Und das ist wirklich alles, was man einstweilen behaupten kann.
Mehr wissen wir von den Ägyptern. „Pyramidentexte“ (Zaubertexte, die zwischen 2600 und 2500 v. Chr. in den Grabkammern der Pyramiden eingegraben wurden, die toten Könige für das Jenseits auszurüsten) und das „Totenbuch“ (wohl ebenso alt, vielleicht noch älter und dem gleichen Zwecke dienend) geben Auskunft. Außerdem unzählige bildliche Darstellungen. Das unterirdische Totenreich ist Amenti, das „Westland“, oder Achernuti, die „heilige Unterwelt“, oder Aalu, „Schlangenfeld“. Außerdem ist eine Art Elysium vorhanden, wie Sonnenberg, Am-Sesennu. Doch kann das Totenreich auch jene Tiefe, untere Welt, Dat, sein. Sie ist mit Dämonen und Ungetümen erfüllt. Der Tote, der sie von West nach Ost zu durchwandern hat, muß sich durch[S. 199] alle Gefahren winden, und besteht sie nur bei richtigem Kult auf Erden für ihn (S. 102). Sein Geleiter ist Anubis (daher Hermes-Anubis, Hermanubis bei den Griechen). Dieser hat ihn auch auf der Totenbarke über ein Wasser (entsprechend dem Acheron) zu fahren. Alle Gegenstände, die der Tote trifft, selbst die leblosen, muß er auf ihre Anfrage bei Namen nennen (S. 105). Ist er zu den „Hallen der Wahrheit“ gelangt, so richten ihn Thot und Anubis. Und Osiris, der eigentliche Herrscher der Tiefe, mit 42 Richtern künden das Urteil. Ein ungünstiges vernichtet den Toten ganz. Oder es treibt ihn zu Qualen, oder auf die Erde in Tiere, oder in die Luftregion. Dort wird seine Seele von Stürmen gepeitscht und allmählich geläutert (also eine Art Fegefeuer). Ein günstiges bringt die Freuden des Jenseits. Der Tote zieht zum Sonnenberg (S. 181) im Osten (eine Art Paradies), darf aber überhaupt seine Zukunft beliebig wählen (S. 102 f.). Im Totenbuch heißt es (der Tote spricht): „Ich bin angekommen in dieser Welt der leuchtenden Geister, nämlich der Götter neben der Sonnenwohnung“. „Offen stehen mir die Türen des Himmels, offen mir die Türen der Erde, offen mir die Riegel des Erdgottes Qeb, offen das erste Haus (die erste Zone des Sonnenlaufes).“ Bekannt ist, daß der Tote sich mit jeder der Gottheiten identifiziert. „Ihr Vordergötter reicht mir eure Hände; ich bin nämlich geworden zu dem, was ihr seid.“ In unendlichen Wiederholungen spricht der Tote: „Ich bin Rā“, „ich bin Tum“, „ich bin Osiris“ usf. und vindiziert sich alle Eigenheiten des betreffenden Gottes, als sei er selbst dieser Gott. „Ich der Gott Atumu, ich bin der Seiende. Ich war allein.“ „Ich bin der Lichtgott Rā in seinen ersten Aufgängen.“ „Ich bin Gott, der Große, das Werden, er selber.“ „Ich bin der gestrige Tag, ich kenne auch den morgenden Tag, das ist Osiris.“ Lepsius sagt: „Der Gedanke lag durchgehends zugrunde, daß der reine und gerechte Mensch zugleich ein Einzelwesen und zugleich der höchste Gott selber sei, oder nur freiwillig die Existenz und Form des einzelnen Menschen angenommen habe, mit dessen Tode aber in seine göttliche Existenz zurückkehre... Der Gerechte würde also nach dem Tode zum[S. 200] Gotte, er ginge in Gott selbst über.“ Vielleicht eilt das etwas zu hoch; es entspräche dem Gedankenkreise der doch bei weitem tiefsinniger und ethischer denkenden Indier.
Wenden wir uns zu den Ariern, so haben die eben genannten Indier ihr Paradies mit allen Wonnen, ihre Hölle mit allen Qualen aufs ausschweifendste ausgestattet. Wo die Gefilde der Seligen liegen, und wo die Orte der Schrecken, ist schon erwähnt (S. 176). Das höchste Paradies, das rein geistige, ist die Nirvana, von der später gesprochen wird. Das göttlich-menschliche Paradies ist angefüllt mit Gandharvenjungfrauen, schöngeformten Asparasen, prachtvollen Blumen und Bäumen, Eß- und Trinkhäusern; überall Tanz, überall Gesang, Schatten, Duft. In Sänften, auf Wagen und Elefanten kommen die Seligen zur Behausung Yamas, des Herrschers, dessen Antlitz schöner als Lotos. Und viele Paradiese sind übereinander, mit steigender Seligkeit, zu denen die Menschen nach ihrem inneren Wert schweben. Die Hölle ist grauenvoller, als die Paradiese schön sich bieten. Sie besteht aus mehr Abteilungen untereinander als das Paradies übereinander; jeder Art von Verbrechen ist eine Hölle zugewiesen. Eigenartig berührt es, daß die Frauen den Männern in die Hölle folgen müssen, ob auch in das Paradies, weiß ich nicht. Eine hübsche Sage im Krishnajogâras erzählt Wollheim da Fonseca: „Einst floh eine von Tigern aufgescheuchte Gazelle aus dem Walde, um ihr Leben zu retten, dem Palaste des Königs zu. Als der Fürst sie kommen sah, erwachte die Jagdlust, und aufspringend tötete er die Gazelle rasch mit dem Schwerte. Also brachte der König die bei ihm Schutz Suchende um. Deshalb ist er mit seiner Gattin von dir (nämlich dem Totenrichter Yama) zu bestrafen. Darauf ward nun der Fürst samt seiner Gemahlin in die Hölle gebracht“. Der gleiche Verfasser teilt auch nach dem gleichen Werke eine Schilderung der Höllenstrafen mit, die ein erlöster König gibt: Hunger, Durst, Liegen in glühenden oder umflammten Eisenbetten, Umarmen von Feuersäulen, Besprengtwerden mit Höllenstein, auf Dornen wandeln, von Blutströmen überflossen werden, von Tieren fortwährend zerrissen[S. 201] werden sind noch das Mildeste. Dante hat nichts Schrecklicheres gesehen als jener indische König. Yama ist der Totenrichter, Tschitraguptas der Toten-Staatsanwalt, Zeugen sind — außerordentlich schön gedacht — Sonne, Mond, Feuer, Äther, Erde, Wasser, sogar Tageszeiten und Gesetz. Als Diener fungiert Tschandas mit andern. Die Dauer der Höllenstrafe richtet sich nach dem Verbrechen, die geringste beträgt 26 Jahre, die längste 800 Millionen Kalpas (zu 432 Millionen Jahre gerechnet), also bei weitem mehr als die Welt selbst besteht. Eine vorzeitige Befreiung kann „durch Gebet, Opfer und fromme Spenden der Nachkommenschaft“ (oder anderer) erzielt werden, was bis zu einem gewissen Grade mit katholischen Lehren übereinstimmt. Nach Verbüßung der Strafe tritt die Möglichkeit einer Läuterung ein, indem die Seele eine Wanderung durch Körper unternimmt; sie beginnt meist mit dem niedrigsten Tier und steigt zum Menschen empor, zunächst in die verachtetste Kaste, um dann, wenn sie sich in Tugend bewährt, zu den höheren Kasten und zuletzt in das Paradies (S. 181) zu gelangen. Doch läutert auch schon ein heiliger Ort. Wie ein Sünderpaar, das aus der Hölle entlassen zu Heuschrecken wurde und durch einen Sturm in den Ganges geweht und in diesem so heiligen Wasser ertrunken war, sogleich in das Paradies einging. Wir kommen darauf zurück. Die Anschauung von der Hölle (späterer Name Naraka) ist viel jünger als die vom Paradiese. In dem Rigveda wird nur allgemein von jener gesprochen, als von einem tiefen Ort, dem Orte der niederen Finsternis, der Grube (Karta). So heißt es IX, 73: „Der weise Hüter des Gesetzes läßt sich nicht hintergehen, er hat Krinigar (das Gewissen) ins Herz gelegt; wissend sieht er auf alle Dinge und schleudert die Bösen und die Ruchlosen in die Grube“. Auch von dem Verschlungenwerden durch einen Wolf oder von vieräugigen grauen Hunden nach dem Tode ist die Rede. Ebenso allgemein sprechen die Upanishaden: „Es gibt in der Tat jene unseligen Welten, welche in dichte Finsternis gehüllt sind; Menschen, die unwissend, nicht erleuchtet sind (also Frevler), gehen nach ihrem Tode zu diesen Welten“. Von Interesse ist,[S. 202] daß hier auch der Totenweg erwähnt sich findet, der später als Brücke bezeichnet wird, also Totenbrücke ist. „Derselbe Pfad führt entweder zu den Göttern oder zu den Vätern. Auf beiden Seiten brennen immerdar zwei Flammen; sie versengen den, der verdient versengt zu werden, und lassen den vorübergehen, der verdient vorüberzugehen.“
Die Jenseitslehre, Eschatologie, der Indier ist mit dem obigen bei weitem nicht abgeschlossen, wir werden ihr bald wieder begegnen. Die der Eranier stellt sich relativ einfach dar. Drei Nächte verweilt die Seele bei dem Körper zu seinen Häupten; in Lust und Wonnen, wenn der Geschiedene gerecht gelebt hat, in Übelbefinden und Abscheulichem, während der Dev Vajis, der Höllenwächter, sie ständig mit Schrecken ängstigt, bei dem Ungerechten. Dann geht es auf gefahrvollen Wegen zu der noch gefahrvolleren Cinvatbrücke, der Totenbrücke (S. 176). Dort wird die Seele von Roshnu, dem Gerechten, nach ihrem Übeltun und Wohltun gewogen. Für die gutbefundene Seele weitet sich die Brücke viele Speerbreit, und jene geht ein nacheinander in die vier Paradiese der guten Gedanken, guten Worte, guten Taten, endlosen Lichter, und bleibt im letzten vor Ahuramazda in ewiger Freude. Die Seelen der Guten (Ferver, Fravardin, Fravashi) sind die Helfer Ahuramazdas im Kampfe gegen das Böse. Der Gott sagt zu Zarathustra (im Fravardin Yasht): „Wenn die starken Schutzengel der Tugendhaften mir nicht Beistand leisten würden, dann würden Vieh und Menschen, die beiden letzten der hundert Klassen von Wesen, für mich nicht mehr existieren, dann würde des Teufels Macht, des Teufels Ursprung beginnen, die ganze lebendige Schöpfung würde dem Teufel gehören“. Eine so hohe aktive Bedeutung haben die Guten. Den Schlechten zieht sich die Brücke fadenbreit zusammen und sie stürzen in die Hölle. Der Dämon Vizaresha schleppt sie dahin. Die Totenbrücke ist vom späteren Judentum und wahrscheinlich auch von den Arabern übernommen. In einem hebräischen Werke des 10. Jahrhunderts, das aber, wie Max Müller sagt, „Bruch[S. 203]stücke viel älteren Datums enthält“, heißt es: „In dieser Stunde (des Jüngsten Gerichts) ruft Gott die Götzen der Völker ins Leben zurück, und er sagt: ‚Jedes Volk gehe mit seinem Gott über die Brücke des Gehinom, und wenn sie über dieselbe gehen, so wird sie ihnen wie ein Faden erscheinen und sie fallen in das Gehinom hinunter‘.“ Diese jüdische Ansicht soll nicht von den Mohammedanern entlehnt sein, also wohl von den Persern. Die Eranier kannten auch ein jüngstes Gericht und eine Auferstehung, Apokatastase, die mit dem Weltende (S. 166 f.) verbunden wird. Die Auferstehung beginnt mit den Urwesen, Urmenschen und dauert 57 Jahre. Sie ist eine körperliche: „Von der Erde werden die Knochen, vom Wasser das Blut, von den Bäumen die Haare, vom Feuer der Lebenshauch, wie sie in der Schöpfung ergriffen worden sind, zurückgefordert“. Die Seelen erkennen die wieder aufgebauten Körper. Dann werden die Frommen von den Gottlosen getrennt. Jene kommen in den Himmel, diese erleiden drei Tage und drei Nächte körperlich in der Hölle Strafe. Darauf werden alle Sünder in den durch den Weltbrand geschmolzenen Metallen (S. 166) gereinigt. Die Frommen sollen die Schmelze nur wie warme Milch fühlen, die Gottlosen aber wie glühende Schmelze. Und alles lebt vor Ahuras Angesicht. Die Weltschlange Dahaka geht in der Schmelze unter, Ahriman stürzt in die Tiefe. Ein allgemeines Opfer leitet die neue selige Zeit ein. Jedenfalls haben wir es mit einem Unsterblichkeitsglauben zu tun. Was Xenophon dem hinscheidenden Kyros in den Mund legt: „Mag ich nun bei der Gottheit oder nichts mehr sein“, ist nicht persisch gedacht, sondern griechisch-philosophisch.
Die Anschauungen der Griechen und Römer von Unterwelt und Paradies sind so bekannt, daß nur das Bedeutendste gesagt zu werden braucht. Daß sie bis zu einem gewissen Grade den Anschauungen der Hebräer gleichen, habe ich schon hervorgehoben (S. 183). Jedenfalls sind sie im allgemeinen unerfreulich und wenig von ethischem Geiste getragen. Vergehen gegen die Götter und Wohltun gegen die Götter spielen eine bei weitem größere Rolle als Böses gegen die Menschen und Gutes gegen sie. Indessen büßen die[S. 204] Danaiden doch für Gattenmord, und heißt es von dem milden Menelaos in der Odyssee:
Maßvoll wie der Grieche immer ist, sind auch seine Höllenstrafen nicht so übertrieben und seine Paradiesesfreuden wesentlich Ruhe und sorglose Bequemlichkeit. Doch kommen Menschen auch zu den Göttern in den Olymp, steigen zu der Höhe der Halbgötter (es genügt, an Herakles zu erinnern) oder werden als Gestirne an den Himmel versetzt. Andererseits kennen die Griechen eine besondere Hölle sogar für Götter, den Tartaros (S. 172). Eine Art Vorhölle ist die Asphodeloswiese, auf der die Nichtschlechten = Nichtguten schattenhaft irren (S. 172). Daß Menschen aus der Unterwelt auch zum Leben zurückgeführt werden können, beweist das Beispiel der Alkestis. Bei Eurydike mißlingt dieses nur durch Orpheus’ Unvorsichtigkeit. Erst spätere Zeit faßte das Nachleben vom ethischen Standpunkte auf. Pindar hat viele Anspielungen darauf. Seltsam berührt darunter die Behauptung, daß Menschen, welche unglücklich gelebt haben, und doch rechtlich geblieben sind, nach achtjähriger Läuterung im Hades von Persephone zur Welt wieder entlassen werden, um dort starke, kluge und glückliche Regenten zu werden. Das alles gehört zur Unsterblichkeit der Seele, die übrigens Pindar auch ausspricht, und von der ja auch so viele Griechen überzeugt waren. Aber darauf kommen wir noch zurück. Die Mysterien scheinen wesentlich den Eingeweihten Hoffnung auf ein frohes Jenseits geboten zu haben. Aussprüche von Platon, Sokrates, Cicero und anderen deuten darauf hin. Polygnotos soll in Delphoi die Unterwelt dargestellt haben. Trotz allem ist die Haltung der Griechen in der Frage der Unsterblichkeit eine schwankende, selbst wenn wir von gewissen[S. 205] überhaupt alles verneinenden Philosophen absehen. Oft schrumpft die Unsterblichkeit zu dem bildlichen Bleiben des Ruhmes usf. zusammen. Aber gewaltige Verfechter der Unsterblichkeit haben wir in Pythagoras, Pindaros, Sokrates, Platon u. a., selbst in den Naturphilosophen (S. 231 f.).
Die Römer haben manche Anschauung von den Etruskern übernommen. Diese aber müssen eine Unterwelt voll Schauern gehabt haben, wie wir aus den Bildern ihrer Grabkammern schließen können, in denen entsetzliche Dämonen mit Schwertern, Hämmern, Feuerbränden u. a. die Toten verfolgen, und aus der zahlreichen Schar ihrer Unterweltsgottheiten. Ich darf auf das so schöne Werk von Dennis, „Cities and Cimeteries of Etruria“ und auf das von K. O. Müller „Die Etrusker“ verweisen. Wir wissen aber von der eigentlichen Religion der Etrusker gar zu wenig und das Wenige gar zu unsicher, da dieses Volk so auffallend vieles von den Griechen übernommen hat, selbst Namen der Gottheiten (wie Aplu für Apollon). Mantus und Mania sollen Pluton und Persephone entsprechen, Charun ist Charon. Vieles ist rein naturmenschlich; und naturmenschlich, zum Teil mit allen Greueln, war auch der Totenkult. Ich weiß nicht, wo ich einmal gelesen habe, daß Dante seine furchtbare Phantasie in der Ausmalung der Hölle seiner toskanischen Abstammung zu verdanken habe. Das Elysium der Etrusker scheint im ungestörten Genuß der Lebensfreuden — namentlich Tafelfreuden sind dargestellt — bestanden zu haben.
Der Orcus des synkretistischen Römers ist bald die Unterwelt, bald der in schrecklicher Gestalt angenommene Todesgott. Wenn man an den griechischen Todesgott, Thanatos, an den milden Bruder des Schlafes denkt, wird man kaum umhin können, die an Orcus sich knüpfenden Schauer als aus Etrurien überkommen anzusehen. Rom war ja eine Zeitlang in Etruskischer Abhängigkeit, fast etruskische Bundesstadt. Dis pater und Proserpina sind die römischen Pluton und Persephone. Die Menschenopfer, die in Latium dem Dis (auch dem Saturn, Vater des Dis), ebenso noch anderen Unterweltsdämonen, gebracht wurden und die Herkules durch[S. 206] Opfer von Bildern, Puppen, Mohnköpfen usf. abgelöst haben soll, würden vielleicht auch auf etruskische Rechnung zu setzen sein, wenn die Römer und Griechen nicht überhaupt Menschenopfer geübt hätten (S. 97). Indessen soll in der Tat Dis pater oder Vatis eine etruskische Unterweltsgottheit gewesen sein, wie auch die etruskische Mania den Römern als Unterweltsgottheit diente. Von den Geistern der Verstorbenen habe ich bereits gesprochen (S. 97 f.). Alles andere ist fast ganz den griechischen Anschauungen nachgebildet, wenn es nicht überhaupt graeco-italischer Gemeinbesitz war. Die Unterweltsfahrt des Äneas bei Virgilius weicht, trotz der Nachahmung derjenigen des Odysseus, von dieser in manchen Beziehungen ab; der späte Dichter wird vieles hinzugeklügelt haben, um seine Erzählung mit neuem Schmuck zu durchwinden. Und Virgil ist der Führer Dantes, so weit er als Heide gehen darf, bis er von der Engelsgestalt der Geliebten Beatrice abgelöst wird. Virgils Paradies ist also auch nicht unser Paradies, sondern das griechische, seine Hölle hat aber einige Züge zu Dantes Hölle geliefert. Lucanus, der Dichter der Pharsalia, soll einen wirklichen Teufel der Unterwelt gekannt haben, einen Beelzebub.
Die Unterwelt, das Niflhel der Germanen, Hels Nebelreich mit den Giftströmen kennen wir bereits (S. 173). Nastrand, Leichenstrand, heißt diese Welt auch.
Ähnlich sind andere Schilderungen. Die Totenherrscherin Hel, auch Hellia, ist Tochter Lokis und der Schwester des Fenriswolfes und einer „ungeheuren Schlange“. Und nichts gibt sie zurück, was ihr zukommt. Selbst die Götter können ihr niemand entreißen, Baldr war ihr verfallen. Übrigens wird die[S. 207] obige Schilderung der Voluspa schon von christlichen Elementen durchsetzt sein. Spätere Sagen schmücken Hel und Hels Reich weiter mit Furchtbarem aus. Hel ist halb schwarz halb weiß; was sie besitzt, drückt unersättliche Gier aus. Zu ihrem Reich führt nach neun Tagen Weges, der durch dunkle, tiefe Täler geht, die die Dunkelelfen bewohnen, über den Fluß Giöll eine mit Gold gedeckte Brücke, die eine Jungfrau Modgudhr, Seelenkampf, bewacht. Den Fluß Giöll stellt Jakob Grimm mit der Lethe in Parallele. Die Toten fahren oder reiten hin. So haben wir eine wirkliche Höllenfahrt der Brunhild, und auch ein „Helreidr“ dieser Walküre, und das Sternbild der Wagen (der große Bär) soll zuweilen Helwagen heißen. Hel bedeutet übrigens die Göttin wie den Ort, was auch bei Hades und Orcus der Fall ist. Die ursprüngliche Anschauung von diesem Reich wird wohl einfach die eines Nebellandes gewesen sein, ähnlich der homerischen vom Hades, eines Aufenthaltes der Toten allgemein, da selbst Gottheiten hinziehen wie Baldr und Brunhild. Die Hölle wird sogar als Herberge, Gasthaus, Valhöll, bezeichnet. Doch scheint die Absonderung der auf dem Schlachtfelde gefallenen Helden zum Aufenthalt im Göttersaal Odins, in Walhall, gleichfalls alt zu sein. Später sind die Fürsten noch hinzugefügt, wovon schon die Vala in der Edda spricht. Einen eigentlichen Todesgott hatten die Germanen nicht. Doch sendet Odin seine Walküren in die Schlacht, die gefallenen Helden zu ihm zu geleiten. Daß Wasser- und Meergeister, wie die Meergöttin Rân, Menschen in den Tod ziehen, ist ein naheliegender Gedanke. Der Tod als tötende Person ist eine späte Anschauung des Christentums; der ihm gleichbenannte griechische θάνατος nimmt nur die Toten an sich. Und so sind auch unsere so ergreifenden Totentänze ohne Beispiel im Altertum. Ebenso ist der Höllenfürst eine späte, vielleicht dem Parsismus unter Vermittlung des Judentums entnommene Anschauung (S. 149 f.). Aus allem aber ist zu ersehen, daß die Germanen, wenn nicht eine allgemeine, doch mindestens eine partielle Unsterblichkeit kannten. Und es ist bemerkenswert, daß die Walhall bewohnenden Helden fast die[S. 208] Aufgabe der eranischen Fravarshis (S. 192) haben, der Gottheit im letzten Kampfe beizustehen.
Von der slawischen Eschatologie weiß ich nichts zu sagen, bis auf das schon erwähnte Naturmenschliche (S. 85 f.).
Den Kelten werden Anschauungen beigemessen, die denen der Indier von der Seelenwanderung entsprechen. Gewährsmann ist freilich Cäsar. Wir haben davon schon gehandelt (S. 94), und kommen darauf noch zu sprechen (S. 216).
Wir kehren nach Asien zurück, um nur noch einiges zu behandeln. Der heidnischen Araber Anschauungen waren rein naturmenschliche. Mohammed jedoch hat unter dem Einfluß des Judentums und Christentums eine Hölle und ein Paradies gelehrt; zwischen beiden einen Damm, auf dem sich die Nichtschlechten = Nichtguten befinden, wie das Christentum eine Hölle für die guten Heiden besitzt. So heißt es in Sure VII, Vers 39 ff. des Korans von der Sünde: „Ihnen sei Dschahannam, der Pfuhl, und über ihnen seine Decken (aus Feuer), und also belehren wir die Sünder“. „Diejenigen aber, welche glauben und das Rechte tun — nicht belasten wir eine Seele über Vermögen — jene sollen des Paradieses Gefährten sein und darin ewig verweilen.“ „Und zwischen ihnen ist eine Scheide; und auf den Wällen sind Männer, die Alle an ihren Merkmalen erkennen (die Höllengefährten sind schwarz, die Paradiesesgefährten weiß); und sie rufen den Paradiesesgefährten zu: ‚Friede sei auf euch‘, sie können es aber nicht betreten, wiewohl sie es begehren. Und so ihre Blicke zu den Gefährten des Feuers gewendet werden, sprechen sie: ‚Unser Herr, bring uns nicht zu den Ungerechten‘.“ Der Koran kennt auch eine Auferstehung. Die Überlieferung, Sunna, hat Mohammeds Lehren viel interpretiert und näher ausgeführt. So wird der Tote schon im Grabe von Munkir und Nakir unter Folterung verhört. Der dabei Rechtbefundene verbleibt in Ruhe und atmet Paradiesesluft, der Sünder wird mit Keulen geschlagen und mit dem Grabe zerdrückt (Eranische Sage S. 192). Am Tage des Jüngsten Gerichts wird vom Engel Israfil die Posaune des Schreckens und die des Gerichts geblasen, da vergeht zunächst alle noch lebende[S. 209] Kreatur. Nun versammeln sich alle Seelen und gewinnen jede ihren Körper wieder, Mohammed erscheint an ihrer Spitze. Gabriel hält eine Waage mit Schalen: Paradies und Hölle; Keiner kann dem Anderen helfen, Jeder muß für sich allein stehen. Gnade waltet nicht, nur Gläubigkeit und gute Taten entscheiden. Die Ungläubigen verfallen überhaupt ewig der Hölle und Pein. Den Gläubigen wird die Strafe nach Maß der Sünden bemessen. Nun müssen die Seelen die Totenbrücke Serat beschreiten, sie ist scharf wie ein Messer und heißer als Feuer. Sie spannt sich über dem Höllenschlund von der Erde zum Himmel. Jeder Ungläubige und Sünder stürzt hinab. Mohammed mit den Gläubigen und Rechtschaffenen überschreiten sie, denn ihnen breitet und kühlt sie sich, während Engel zu beiden Seiten mit den Flügeln den Abgrund verdecken. Im Himmel aber wird der Platz nach der Würdigkeit zuerteilt. Der Gedanke der Totenbrücke ist höchst poetisch und von Rückert in diesem Sinne bearbeitet. Er ist aber sicher, wie namentlich die Einzelheiten zeigen, den Persern entnommen (S. 192). Die Hölle hat sieben Stockwerke: je eines für milde Strafen der Mohammedaner und für die Juden, zwei für Christen und eine gewisse Sekte von ihnen, je eines für die Feueranbeter (Parsen), für Götzenanbeter, für Ungläubige und Heuchler aller Religionen. Nur im obersten Stockwerk ist die Strafe endlich, in allen anderen Stockwerken währt sie ewig. Vom Paradies sagt schon Mohammed in der Sure LXXXIII des Koran: „Siehe, die Gerechten werden wahrlich in Wonne sein. Auf Hochzeitsthronen (sitzend) werden sie ausschauen. Erkennen kannst du auf ihren Angesichten den Glanz der Wonne. Getränkt werden sie von versiegeltem Wein, dessen Siegel Moschus ist — und hiernach mögen die Begehrenden begehren — und seine Mischung ist Wasser von Tasnîm, eine Quelle, aus der die Allah Nahestehenden trinken.“ Dieses ist dann mit aller derjenigen glühenden Sinnlichkeit ausgeschmückt worden, die so großen Eindruck auf naturmenschliche Gemüter macht und so außerordentlich zum erstaunlichen Erfolg des Mohammedanismus beigetragen hat.
Der Chinesen naturmenschliche Anschauung vom Nachleben und Jenseits ist schon geschildert (S. 120 f.). Ob Konfucius ihr huldigte, ist nicht gewiß. Er gebrauchte Fragenden gegenüber Ausflüchte. Wenn er jener Anschauung zustimme, fürchte er, daß die Menschen über der Pflege der Seele der Verstorbenen ihre eigene Seele vernachlässigen möchten; wenn er ihr widerspreche, müsse er besorgen, daß die schöne Pietät gegen Verstorbene verloren gehe. So ist denn auch oft behauptet worden, daß die Lehre des Konfucius an sich nur das Diesseits betreffe, nicht Strafe noch Lohn im Jenseits drohe und verspreche. Die Lehre des edleren und geistigeren Lao-tsse ist mehr philosophisch und geht auf eine schließliche Vereinigung mit dem Allgeist Tao (S. 220). Aber Paradies und Hölle scheint sie gleichfalls nicht zu kennen. Die Glückseligkeit beruht für den Guten in der Ruhe, mit der er dem Tode entgegensieht, die Strafe des Bösen in der Angst vor dem Tode. Also Paradies und Hölle hat jeder in sich, was ja auch die Ansicht sehr vieler höchstgeistigen Europäer ist. Die Eschatologie der Japaner wird trotz ihres schönen Göttersaales kaum eine andere sein. Von der Eschatologie der amerikanischen Kulturvölker ist mir, abgesehen vom Naturmenschlichen, schon Mitgeteilten (S. 124 f.), nichts bekannt geworden.
Der Rundgang zeigt, daß, bei aller Ähnlichkeit der Grundideen auf der Erde, im einzelnen zwischen den Kulturvölkern doch erhebliche Verschiedenheiten vorhanden sind. Selbst so nahe Stämme wie die Indier und Eranier, die Hebräer und Babylonier weichen in ihren Anschauungen über das Nachleben gar sehr erheblich ab. Und andererseits bestehen Übereinstimmungen zwischen so fernen Völkern wie Hebräer und Griechen-Römer. Nur das Gefühl von Unsterblichkeit der Seele, von Lohn und Strafe findet sich fast überall. Hier mehr, dort weniger deutlich, hier real, dort geistig gedacht, immer aber nach dem Leben beurteilt und in den höchsten Religionen oft nicht viel anders aufgefaßt als in den für uns niedersten. Einbildung auf seine Kultur ist nirgends weniger angebracht als hier.
23. Seelenwanderung und Wiederbekörperung; Sansara, Nirvana.
Ein höchst merkwürdiges Kapitel in der Lehre von den Anschauungen der Menschheit bildet das in der Überschrift gekennzeichnete. Die Anschauung von der Seelenwanderung und Wiederbekörperung mag ihren Ursprung aus dem naturmenschlichen Animismus genommen haben. Ihre eigentliche Bedeutung gab ihr jedoch die kulturelle Ethik und die eschatologische Metaphysik. Wir tun am besten, sie sogleich für dasjenige Volk zu schildern, das diese Anschauung am meisten ausgebildet und am tiefsten durchdacht hat, die Indier. Die Anschauungen anderer Völker lassen sich leicht daran erklären. Das Wesentliche ist, daß die Seele von je war (was auch Platons Ansicht ist) und nur ständig die Körper wechselt, bis sie geläutert und gereinigt (was das bedeutet, richtet sich nach der Lehre) zum ewigen Seelenleben oder zur ewigen absoluten Ruhe eingeht. Danach steht der Seele nach dem Tode zweierlei bevor: entweder ein neues körperliches Leben oder ein Seelenleben, indem wir noch von der absoluten ewigen Ruhe absehen. Sie hat zwei Wege: den Dêvayana, den Götterpfad, und den Pitriyana, den Väter-Ahnenpfad. Vom Dêvayana lesen wir in einem Upanishad — die Upanishaden zählen wie die Veden, denen sie an Alter fast gleich sind, die sie aber an geistigem Inhalt außerordentlich übertreffen, während sie sie teilweise kommentieren, zu den heiligen Büchern der Indier. Der Name besagt: „ein Niedersitzen zu Füßen des Lehrers“ — in Max Müllers Übersetzung: „Sie (die die höchste Stufe der Vollkommenheit erreicht haben) gehen zum Lichte, vom Lichte zum Tage, vom Tage zur Monatshälfte des zunehmenden Mondes, von der Monatshälfte des zunehmenden Mondes zu den sechs Monaten, wo die Sonne nach Norden geht, von diesen sechs Monaten zu der Welt der Devas (niederen Götter), von der Welt der Devas zur Sonne, von der Sonne zur Stätte des Blitzes. Wenn sie die Stätte des Blitzes erreicht haben, nähert sich ihnen eine Person, nicht ein Mensch, und führt sie in[S. 212] die Welten Brahmans. In diesen Welten Brahmans verweilen sie immer und ewig, und es gibt keine Rückkehr für sie“. Was der Leser in dieser Angabe nicht verstehen sollte, das vom Tage, dem Halbmonat, den Sechsmonaten Gesagte, haben andere auch nicht verstanden; es scheinen hier uralte Termini technici versteckt, deren Sinn verloren gegangen ist, und den die Vedantaphilosophen in ihren Kommentaren (Sûtras) nur mit Zwang und Mühe wiederherzustellen versucht haben. Das übrige aber ist klar. Das wird in anderen Stellen und anderen Werken noch sinnfälliger und genauer geschildert: wie, daß der betreffende Mensch durch die Sonne hindurchgeht, ebenso durch den Mond, daß er die Welten der einzelnen Götter durchmißt, einen Fluß Vigarâ (Nichtalternd) überschreitet, vor die Halle (Vibhu) Brahmans gelangt, deren Hüter Indra und Pragapati sind, und vor den Thron Brahmans tritt, dessen einzelne Teile als Einsicht, Glanz, Umschau, Verstand, Geist usf. bezeichnet werden. Aber das Wesentliche ist immer das gleiche: Eingehen der Seele in den Raum zum höchsten Gott.
Von den Nichtvollkommenen aber heißt es: „Sie gehen (bei der Verbrennung, die hier vorausgesetzt ist) in den Rauch ein, vom Rauch in die Nacht, von der Nacht in die Monatshälfte des abnehmenden Mondes, von dieser Monatshälfte zu den sechs Monaten, wo die Sonne nach Süden geht. Von den sechs Monaten gehen sie in die Welt der Väter, von der Welt der Väter zum Äther, vom Äther zum Monde. — Das ist Soma, der König, das ist die Speise der Götter, die Götter nähren sich davon. — Nachdem sie dort solange verweilt als noch ein Rest (von guten Werken) übrig ist, kehren sie auf dem Wege, auf dem sie gekommen sind, zum Äther zurück, von da zur Luft. Wenn er (der Geist) zu Luft geworden ist, wird er zu Rauch, nachdem er zu Rauch geworden ist, wird er zu Nebel, nachdem er zu Nebel geworden ist, wird er zur Wolke, nachdem er zu einer Wolke geworden ist, fällt er als Regen herab. Dann werden sie (die Seelen) als Reis und Korn, Kräuter und Bäume, Sesam und Bohnen geboren. Von da ist das Entkommen sehr schwer. Denn, wer immer diejenigen,[S. 213] welche diese Speise essen und Samen ausstreuen, sein mögen, er wird gleich ihnen. Diejenigen, deren Lebenswandel gut gewesen ist, werden wahrscheinlich irgendeine gute Geburt erlangen, wie als Brahmana oder als Kshatriya oder als Vaisya. Diejenigen aber, deren Lebenswandel schlecht gewesen ist, werden wahrscheinlich eine schlechte Geburt erlangen, wie als Hund oder als Schwein oder als Kandâla“. Auch hier sind viele Abwandlungen vorhanden, ohne das Wesentliche zu ändern. Namentlich haben Manu’s Schriften für jedes Verbrechen, für jede Schlechtigkeit und Gedankenlosigkeit genau das Geschöpf angegeben, in das die Seele eingehen muß. Diese Wanderung der Seele dauert so lange fort, bis der Mensch in einem Leben es zur höchsten Vollkommenheit gebracht hat. Die ganze Lehre ist verhältnismäßig einfach. Auch wissen wir was Sünde, Vergehen, Gedankenlosigkeit usf. bedeutet. Die Schwierigkeit liegt in der Bedingung der Vollkommenheit. Unzählige Ausführungen und Bücher haben die Indier darüber geschrieben, aber naturgemäß sind die Definitionen sämtlich negative. Als Grundprinzip gilt: eine Seele ist von je und bleibt in alle Ewigkeit. Es kann Seelen geben, die immer nur von Körper zu Körper gehen, denn es heißt am Schluß des letzten Zitats: „Auf keinem dieser zwei Wege (Dêvayana, Pitriyana) ziehen jene kleinen, oft wiederkehrenden Geschöpfe fort. Für sie gilt der dritte Zustand, von dem es heißt: leb und stirb.“ Aber auch sie haben keinen Anfang und kein Ende.
Diese Lehre hat mehrere Erweiterungen erfahren, die sich alle auf den letzten Zustand und auf die Vollkommenheit beziehen. Wir werden später sehen, daß die Indier auch den Pandeismus gelehrt haben. Der letzte Zustand besteht in dieser Lehre im Eingehen in die betreffende Gottheit, Brahma oder Wischnu. So sagt in der Bhgavad-Gîtâ Krishna-Wischnu, nach vielen Lehren über ein vollkommenes Dasein:
und an einer anderen Stelle:
Und dieses wird noch in vielen Wendungen dringend eingeschärft. Die Seele geht zuletzt dahin zurück, woher sie von je stammt, zur Allgottheit. Was aber die Vollkommenheit betrifft, so schließt sie nicht allein moralische und ethische Forderungen ein, sondern auch solche, die sich auf die Affekte beziehen; es wird Freisein von Affekten verlangt. In der gleichen Bhagavad-Gîtâ heißt es:
Der Mensch hat sich von den Schlacken des Lebens zu reinigen:
Wie der Buddhismus derartigen Anschauungen noch eine besondere Wendung gegeben hat, ist bekannt. Er hat die Lehre von der Metempsychose und Metensomatose zur letzten Ausbildung gebracht und gleicherweise die Lehre vom letzten Zustand. Im Buddhismus spielen die Gottheiten keine besondere Rolle; ihr Dasein wird nicht geleugnet, nur ihre Bedeutung für Welt und Menschen (S. 182). Sie stellen selbst nur einen Durchgangszustand dar im Leben des Alls, leben und vergehen wie alles im All und haben es so nur mit sich zu tun, gleich jedem lebenden Geschöpf. Es vermischt sich nun ein philosophischer Gedanke mit ethisch-moralischen Betrachtungen. Das Leben, ganz allgemein, ist ein Leiden, ob es unglücklich oder glücklich verläuft. Und ein Leiden ist vor allem die Wiedergeburt. Dieses zu erkennen ist die erste Stufe des Wissens. Die zweite aber besteht darin, daß man zu erkennen hat, wie alles darauf gerichtet sein muß, nicht[S. 215] wiedergeboren zu werden. Und dieses wird erreicht durch ein ethisch-moralisches Leben und durch Abtötung jedes Willens nach Leben und Wiedergeburt, so zwar, daß ein solcher Wille niemals auch nur in das Bewußtsein treten kann. Die Taten sollen so sein, daß bei jeder Wiedergeburt der Mensch zu immer höherer Stufe sich erhebt, denn es büßt der Mensch mit jeder Geburt die Sünden und Mängel, und es genießt der Mensch die Folgen der Tugend des voraufgegangenen Lebens: Karma-Gesetz. Die Gedanken aber sollen sich ganz in sich versenken, bis alles was das Leben bildet mit seinen Leidenschaften, Gefühlen, Begehren, Anschauungen, Erwartungen, kurz der ganze Wille im Leben und zum Leben vergangen und verklungen ist. Wer so höchste Vollkommenheit und Abwesenheit jedes Lebenswillens erreicht hat, geht zur absoluten Ruhe ein, in das Nirvana (ein Wort, das schon in den Upanishaden für den letzten Zustand gebraucht wird), das „Verwehen“ ein. Nicht daß die Seele sich verliert — auch dem Buddhismus ist alles was ist, ewig — sie kommt in einen Zustand, der dem Tod entspricht, in menschlichem Ermessen, das ja nur das Leben kennt. Ein Zustand, in dem nichts vorhanden ist, was das Leben ausmachte, zu dessen Einsicht also nur unendliche Abstraktion führt, weshalb es auch oft mit „Nein, Nein“ erklärt wird, wie Brahma als letzter Begriff. So lehrt die Dharma.
Buddha ist bekanntlich unter dem Namen Gautama Sarvarthasiddha als Fürstensohn zu Kapilavastu (um 623 v. Chr.) geboren. Bis zu seinem 29. Lebensjahre hat er wie alle Fürstensöhne, wenigstens der Volksidee nach, herrlich und in Freuden gelebt. Wie er also zu seiner Leidensauffassung und Verneinung des Lebens kam, richtiger, sie konsequenter ausbildete als schon vor ihm geschehen war? Er sah auf einer Ausfahrt nach einem Lustgarten einen Greis „mit kahlem Haupt, gebeugtem Körper und zitternden Gliedern. Bei einer zweiten Ausfahrt gewahrte er einen unheilbaren Kranken, von Aussatz und Geschwüren bedeckt, vom Fieber geschüttelt, ohne Führer und ohne Hilfe; auf einer dritten einen von Würmern zerfressenen, verwesenden Leichnam am Wege. Er fragte sich, wozu Lust, Tugend und Freude nützten,[S. 216] wenn sie dem Alter, der Krankheit und dem Tod unterworfen seien.“ Da verläßt er alles, zieht als Bettler durch die Lande und hört in allen Schulen die Lehren der Priester und Forscher. Wie ihn nichts befriedigt, schließt er sich in einen Wald ein, lebt in harten Kasteiungen und Bußübungen, weshalb er Muni und, unter Hinzufügung seines Geschlechtsnamens, Çakjamuni genannt wurde. Als er auch Kasteiung und Bußübung für erfolglos erkennt, versinkt er in tiefstes Nachsinnen über den Grund der Leiden und den Zweck des Lebens. Jetzt erst blitzt der richtige Gedanke in ihm auf, als blitzender Strahl schießt er aus seiner Stirne bis an das Ende der Welt. Und nun ist er Buddha (S. 139), der „Erleuchtete“. Das ist Legende, aber wie sehr der Indier zu Beschaulichkeit und Nichtigerklärung der Welt neigt, hat uns Rudyard Kipling in einer seiner reizendsten Geschichten, vom höchstgestellten Minister Purun Dass geschildert.
Bei den Eraniern finden wir, was sehr seltsam berührt, nichts von dieser Lehre der Seelenwanderung und Wiederbekörperung. Sie wird also bei den Indiern wohl nach der Trennung von ihnen entstanden sein. Aber am äußersten Ende Europas soll ein arisches Volk diese Lehre wenigstens zu einem Teil besessen haben, die Kelten. Cäsar weiß davon. Er sagt in „De bello Gallico“, VI, 14: „In primis hoc volunt (nämlich die Druiden) persuadere; non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios“. Das ist aber wohl das einzig Sichere; alles was sonst noch in dieser Hinsicht von den Kelten und Druiden erzählt wird, ist Fabel oder aus ungewissen Überlieferungen und späteren Bardenliedern erschlossen. Die Seele soll nach dem Tode ihres Besitzers zuerst in die Lüfte zu den Wolken schweben, letztere also sollen Sitz von Seelen sein. Wären die Ossiangedichte altes Gut, so hätten wir einen Beweis für diese Behauptung: „Meine Väter neigen sich herab von ihren Gewölken, zu empfangen ihren graulockigen Sohn“, klagt Fingal nach dem Fall seines geliebten Sohnes Oscar. Als Wolkengeister schweben sie über kämpfenden Heeren und nehmen Teil an der Entscheidung, wie die Walkyren, die ebenfalls Wolkengeister sind. Auch auf[S. 217] dem Monde weilen die Seelen, ein Glaube, der weit verbreitet ist. Dort hausen sie unter Schnee und Eis und vergessen alles vom vergangenen Leben. Bei Sonnenfinsternissen kehren sie zur Erde zurück, werden von der Sonne erweckt und beginnen ein neues irdisches Dasein.
Von den Griechen haben namentlich die Pythagoräer und Platon die Wiedergeburt gelehrt. Jene beschränkten die Seelenwanderung auf die Tiere und Menschen; Pflanzen sollte eine Seele nicht zukommen. Zwischen zwei Leben liegt ein reiner Seelenzustand, wie ja auch bei den Indiern, Kelten und bei Platon. Ob dieser Zustand in Verbindung steht mit Lohn und Strafe, die die Pythagoräer wie auch Andere lehrten, läßt sich schwer entscheiden, denn bekanntlich hat sich durch Pythagoras’ Lehre ein Wust von allen möglichen mystischen Ansichten ergossen. Eigenartig noch ist die Meinung, daß die Seele nicht in jeden Körper eingehen kann, sondern nur in den, der ihrer Harmonie (davon später) gemäß ist. Im allgemeinen betrachteten sie, wie die Indier, die Verbindung der Seele mit dem Körper als unwillkommen. Indessen sagten sie doch auch, daß die Seele durch die Organe, die der Körper ihr bietet, Gelegenheit zur Erkenntnis bekomme, und daß sie darum den Körper liebe, ein Gedanke, der ganz und gar den Anschauungen der Indier widerspricht. Pythagoras selbst soll Waffen im Heratempel zu Argos als die bezeichnet haben, die er in einem früheren Dasein vor Troja geführt habe, und in einem Hund die Seele eines verstorbenen Freundes erkannt haben; wenn ersteres kein Märchen, letzteres kein boshafter Witz ist.
Platons Ideen von der Seelenwanderung sind namentlich in seinem Phaidros auseinandergesetzt. Max Müller weist auf die, zum Teil allerdings verblüffende, Übereinstimmung mit indischen Ideen hin; namentlich die Lehre, daß die Seelenbekörperung neun Stufen hat, entspricht der in Manu’s Gesetzbuch, wo gleichfalls neun Stufen vorgesehen sind. Auch der Zwischenzustand der Seele zwischen zwei Leben und der Endzustand muten stark indisch an. Platon hat alles in ein mythisch-dichterisches Bild gekleidet. Er behandelt Menschen[S. 218] und Götter in eins, was abermals indischem Verfahren entspricht. Das Bild vergleicht die Seele „der zusammengewachsenen Kraft eines befiederten Gespannes und seines Führers. Der Götter Rosse und Führer nun sind selbst gut und guter Abkunft, die anderen aber vermischt.“ „Die Kraft des Gefieders besteht darin, das Schwere emporhebend hinaufzuführen, wo das Geschlecht der Götter wohnt.“ Sie wächst vom Göttlichen und schwindet vom Bösen. „Der große Herrscher im Himmel, Zeus“ zieht mit seinem Gespann den Himmel hinauf voran, ihm folgen alle Götter und dann die Seelen, „wer jedesmal will und kann“. Zeus und die Götter lenken leicht und sicher und schauen völlig alle Herrlichkeiten. Die Gespanne der anderen Seelen aber steigen schwer und in Unordnung, so daß die Seelen von den Herrlichkeiten gar keinen oder nur teilweisen Genuß haben. Auf des Himmels Rücken angelangt und vom Umschwung fortgerissen, blicken die Götter in das, „was außerhalb des Himmels ist“ und sehen „farblose, gestaltlose, stofflose, wahrhaft seiende Wesen“ und sie „lassen sich wohl sein, bis der Umschwung sie wieder an die vorige Stelle zurückgebracht hat“. Die ganze Fahrt vollbringen von den Menschenseelen einige, die der Gottheit am nächsten „folgten und nachahmten“, wenn auch in Ängsten und Beschwerden und „kaum das Seiende erblickend“. Andere erhoben sich bisweilen und tauchten dann unter im Sträuben der Rosse. Die übrigen aber werden nur im unteren Raume umhergetrieben, einander stoßend und drängend. „Und dieses ist das Gesetz der Adrasteia“, sagt der Dichter-Philosoph, daß die Seele, welche als des Gottes Begleiterin etwas vom Wahrhaften erblickt hat, keinen Schaden erleidet und, soweit an ihr liegt, unverletzt bleibt. Die Seele aber, die nichts sieht, fällt zur Erde und beginnt den Kreislauf der Wiedergeburten, die also, wie schon bemerkt, neun Stufen haben. Die besten können als weise Männer geboren werden, oder als der Musen und der Liebe Lieblinge. Die folgenden als verfassungsmäßige oder kriegerische Könige, dann die nächsten als Staatsmänner usf., bis zu den letzten, welche das dem Griechen Verächtlichste werden — Tyrannen. Eine[S. 219] Seele kann mehrere Wiedergeburten erfahren. Die höchststehende kehrt schon nach dreitausend Jahren dorthin zurück, woher sie gekommen ist. Anderen Seelen mag dieses nicht unter zehntausend Jahren gelingen. Innerhalb der Wiedergeburten, nach jedem Tode, kommt die Seele vor das Gericht. Die böse verfällt dem unterirdischen Zuchtorte, wo sie tausend Jahre Strafe erleidet, die bessere wird nach einer Stelle des Himmels entrückt, wo sie, gleichfalls tausend Jahre, wie im letzten Leben verweilt. Dann kann jede der beiden Seelen ihre fernere Wiedergeburt frei wählen. Und so ist auch tierische Wiedergeburt nicht ausgeschlossen. Der Philosoph leitet aus den Wiedergeburten die Tatsache des Erinnerns ab, daß uns so manches, das wir zum erstenmal sehen oder lernen, bekannt vorkommt. Die Ähnlichkeit der Platonischen Anschauung mit indischer, sowohl in den Zwischenzuständen als im Endzustand und in den Verwandlungen, ist nicht zu verkennen. Platon ist von dieser Anschauung in anderen Schriften mehrfach abgewichen. Gleichwohl muß sie für ihn doch grundlegende Bedeutung gehabt haben. Wir sehen das an dem tiefen Ernst, mit dem Sokrates, Platons Wortführer, sie vorträgt.
Es ist oft selbst von Griechen behauptet worden, daß Pythagoras und Platon ihre Wiedergeburtanschauungen von den Ägyptern entlehnt haben. Auch sagt Herodot von den letzteren: „Auch sind die Ägypter die ersten, die den Satz aufgestellt haben, daß des Menschen Seele unsterblich ist, und wenn der Leib vergeht, so fährt sie in ein anderes Tier, das immer gerade zu der Zeit entstände, und wenn sie herum ist, durch alle Tiere des Landes und des Meeres und durch alle Vögel, so fahre sie wiederum in einen Menschenleib, der gerade geboren würde, und käme in dreitausend Jahren herum.“ Wenn Herodot dann fortfährt: „Diese Meinung haben einige Hellenen auch vorgebracht, die einen früher, die anderen später. Ihre Namen weiß ich zwar, will sie aber nicht nennen“, so kann er damit nur Pythagoräer und Orphiker meinen. Aber es ist immerhin eigenartig, daß auch Platon die dreitausend Jahre hat, wenn auch nur für die auserwählten Seelen. Eduard Zeller lehnt die Wiedergeburtslehre für die Ägypter ab. Es[S. 220] ist für uns schwer, eine Entscheidung zu treffen, da die Ägypter sehr viel vom Animismus in ihren Anschauungen besaßen. Die außerordentliche Mühe, die die Ägypter sich gaben, ihrer Seele Wohnstätten auf Erden zu beschaffen, spricht gegen den Glauben einer Wiedergeburt bei ihnen. Der, freilich späte, Pausanias (zur Zeit Hadrians und der Antonine) meint, die Griechen hätten ihre Anschauungen von den Chaldäern und Indiern erhalten. Vielleicht hat er nicht so unrecht. Klingt es nicht ganz indisch, wenn Empedokles sagt: „Ich war bereits einmal Knabe, Mädchen, Pflanze, Vogel und flutentauchender stummer Fisch“ und wenn er über das furchtbare Geborenwerden klagt?
Es ist noch zu erwähnen, daß auch bei den Chinesen eine Schule des Lao-tsse (S. 210) bestand, die Seelenwanderung und Wiederbekörperung lehrte. Der bedeutende Mann sagt im Tao-te-king: „Wer nicht einsieht, daß es eine Fortdauer gibt, und daß auch er fortdauere, der bereitet sich durch seine Unüberlegtheit selbst Unheil. Wer aber von der hohen Bedeutung der Fortdauer überzeugt und durchdrungen ist, der ist sicher auch groß gesinnt, edel und vortrefflich“. Der Tod bedingt Auflösung in die Grundstoffe. Aber hiernach erfolgt immer ein Wiederaufleben zu einem neuen Zweck, zu einer neuen Bestimmung, zu neuem Leben. Lao-tsse, der etwas später als Buddha blühte, ist in Indien gewesen, er wird aus den dortigen Philosophenschulen manches gelernt haben. Aber sein Taoismus ist doch kein Brahmanismus, geschweige gar ein Buddhismus. Es ist, wie schon bemerkt, auch nicht zu ersehen, wie er sich das Ende dachte, ob als ein Aufgehen im Tao, oder als überhaupt nicht vorhanden, so daß die Wandlungen ins Unendliche fortdauern.
24. Seele und Unsterblichkeit, Leben-Reihe.
Leicht erkennt der Mensch, daß das Leben nach zwei Richtungen sich abspielt, nach der animalen und nach der geistigen. Früh ist deshalb schon zwischen einer animalen Seele und einer geistigen unterschieden worden. Der[S. 221] ersteren Seele Tätigkeit geht auf Entwicklung des körperlichen Lebens, Erhaltung dieses Lebens, Befriedigung der sinnlichen Begierden und Lüste und auf Zusammenleben mit der äußeren Welt. Die zweite Seele hat es mehr mit dem Absehen von dem körperlichen und äußeren Leben zu tun, und mit Denken, Schließen und Erkennen. Platon hat von dieser zweiten Seele einen Teil abgetrennt, den er θυμός (Mut) nennt. Wir wollen ihn mit „Verstand“ bezeichnen. Er wirkt gegen die bösen und schlechten Triebe der ersten Seele und leitet, im Gegensatz, die Wünsche und die Handlungen zum Guten. Alsdann bleibt von der zweiten Seele das rein Geistige übrig, der νοῦς, Nus, die „Vernunft“. Diese Dreiteilung nach Platon (ἐπιθυμητικός, θυμός, νοῦς) erschöpft die Seelentätigkeiten zweifellos nicht. Wenn aber die Stoiker eine Siebenteilung der Seele vornahmen und davon fünf Teile an die Sinnentätigkeit vergaben (nach den fünf Sinnesorganen), einen Teil auf die Fortpflanzung rechneten (wie die Pythagoräer) und den letzten auf die Sprache, d. h. das Denken, so kann dieses noch weniger befriedigen. Der Leser weiß, daß die Psychologie meist eine Dreiteilung vornimmt: in Denken, Fühlen, Begehren, die kaum für die Zwecke des reinen rationalen Teiles dieser Wissenschaft ausreicht, und auf die übrigens auch nicht viel Wert gelegt wird. In der Tat haben wir es hier mit Teilungen der Seele nur mit Rücksicht auf die voraufgehenden Unsterblichkeitslehren zu tun. Denn naturgemäß entsteht die Frage, was denn von der Seele unsterblich sein soll. Wir wollen darum die Tätigkeit der Seele sorgfältiger unterteilen. Eine eingehendere Untersuchung aller Seelentätigkeiten zeigt, daß man die Seele für unseren Zweck, und wohl auch allgemeiner, in folgende Klassen zerlegen kann.
Animale Seele, zur Entwicklung, Erhaltung und Bewegung des Körpers.
Trieb-Seele, zur Befriedigung von sinnlicher Lust und von Trieben.
Sinnen-Seele, zum Wahrnehmen der Außenwelt und aller Reize an und in unserem Körper.
Gefühls-Seele, zum Empfinden der Affekte, wie Liebe, Haß, Zorn, Mitleid usf.
Regulierende oder kategorische Seele (Bewußtsein, Kategorien, Freiheit, Wille; Anschauungsformen).
Verstandes-Seele (Erkennen, Behalten, Erinnern, Wissen, Vorstellen u. a.).
Vernunft-Seele (Sinnen, Denken, Schließen usf.).
Göttliche Seele, Geist, Glaube, Intuition.
Über die vier erstgenannten Klassen ist nichts zu bemerken. Die fünfte Klasse, deren Tätigkeiten wir auch insgesamt als Kategorien, Stammtätigkeiten, bezeichnen können, gibt die Normen für alle Seelentätigkeit überhaupt und zwar zwangmäßig. Unter dem Gesichtspunkt des Bewußtseins kennen wir überhaupt nur die Tätigkeiten der Seele. Nur das animale Leben bietet manche und sehr wichtige Tätigkeiten, die unserem Bewußtsein sich entziehen. Die eigentlichen Kategorien, wie Quantität, Qualität, Ursächlichkeit usf. regeln alle und jede Wahrnehmung und Erfahrung und sind selbst für das animale Leben unausweichlich. Freiheit wird allerdings als Kategorie von vielen geleugnet. Eine Erörterung hierüber ist noch nicht am Platze. Hier genügt es, daß alle unsere seelischen Tätigkeiten uns frei erscheinen, selbst wo wir gezwungen werden. Wille endlich ist die Einleitung mindestens zu allen bewußten Tätigkeiten. Welche kategorische Bedeutung dem Willen zugeschrieben wird, weiß der Leser aus Schopenhauers Philosophie. Endlich die Anschauungsformen, unter denen wir und die Welt uns erscheinen, sind Raum und Zeit. Die Wirkung der regulierenden Seele erstreckt sich also über alle Tätigkeiten der übrigen Seelen. Über die sechste und siebente Klasse ist wiederum nichts zu bemerken. Die achte Klasse hat im Sinne namentlich der indischen, und überhaupt der theosophischen, Lehren hinzugefügt werden müssen; ihre Bedeutung wird durch die Darlegungen im folgenden Buch noch klarer als durch die Bezeichnung werden. Und nach den wichtigsten Ansichten ist diese Klasse als Intuitionen enthaltend auch von der Macht der regulierenden Seele aus[S. 223]zunehmen. Die modernen Theosophen scheinen diese Seele in drei Seelen abzustufen: Buddhi-Manas, der Mensch als höchstes Prinzip; Buddhi, die Welt als höchstes Prinzip; Atma, das höchste Prinzip überhaupt. Unsere sieben anderen Klassen sind dann in vier untergebracht: Kama-Manas, die intellektuelle Seele, Vernunft-, Verstandes- und regulierende Seele einbegreifend; Kama, die Triebseele; Prana, die animale Seele; Linga-Scharira (der Ätherleib), wohl die Sinnenseele. Die Namen sind indisch wie die Ideen. Der Zerlegung der höchsten Seele in die drei Seelen kann man zustimmen. Die Zusammenfassung der Vernunft-, Verstandes- und regulierenden Seele scheint mir aber unzweckmäßig und lediglich der heiligen Siebenzahl wegen erfolgt zu sein. Ich habe übrigens in meinem Werke „Philosophische Grundlagen der Wissenschaft“ die Seelentätigkeiten einzeln untersucht und sie in eine kanonische Tafel gebracht, soweit sie für den dort entscheidenden Zweck nötig war. Die obige Klasseneinteilung ist für das Allgemeine spezifizierter.
Worauf bezieht sich nun die Unsterblichkeit? Auf die achte Seele unter allen Umständen, und für diese ist die Unsterblichkeit eine absolute. Das ist die Auffassung aller bisher behandelten Anschauungen. Der Buddhismus scheint die absolute Unsterblichkeit auf diese Seele zu beschränken, vermutlich auch der Wischnuismus, soweit er Pandeismus ist (S. 229 f.). In diesen beiden Anschauungen würde es sich hiernach für die übrigen Seelen nur noch um relative Unsterblichkeit und Fortleben nach dem Tode handeln, bis sie nach der abgelaufenen Zahl von Inkarnationen, Bekörperungen, annihiliert werden, oder, wohl besser, sich selbst annihilieren, in der Weise, daß sie entweder in Tat verschwinden oder in ein Anderes übergehen, das nicht mehr mit Leben und Individualität in Verbindung steht. Schreiben wir den Tieren und Pflanzen keine achte Seele zu, so wären diese von der absoluten Unsterblichkeit ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, auch der Standpunkt unserer modernen Theosophen. Nach Platon bezöge sich die absolute Unsterblichkeit auch auf die siebente Seele, da er sie mit der achten zu der Vernunft-[S. 224]Seele zusammenfaßt. Jedoch diese und die anderen Anschauungen können wohl eine absolute oder relative Unsterblichkeit ohne die fünfte Seele nicht behaupten, diese müßte immer mit einbegriffen sein. Die, nach Platon, am wenigsten konzedierende Ansicht schreibt hiernach auch dieser fünften und dazu der sechsten Seele absolute Unsterblichkeit zu, den vier anderen Seelen nur relative. Aber Anschauungen wie z. B. die des Mohammedanismus und Christentums, soweit sie ewige körperliche Strafen und ewige körperliche Freuden als Belohnungen im Jenseits annehmen, müssen auch für diese vier Seelen absolute Unsterblichkeit behaupten, also für die Seele als Ganzes. Glauben sie, daß eine Seele schon für sich Pein und Lust empfinden kann, so mag die erste Seele mit dem Tode schwinden oder, bei Behauptung einer Wiederbekörperung, beschränkt fortbestehen. Zugleich wird angenommen, daß, was absolut oder beschränkt fortbesteht, immer beisammen bleibt, sonst würde ja die Individualität verloren gehen. Bei einer Wiederbekörperung ändert sich dann nur die Person. Aber die Individualität muß immer freier werden von den Schlacken des materiellen, persönlichen Lebens, je mehr von dem nur beschränkt Fortbestehenden sich annihiliert oder annihiliert wird, bis absolute Freiheit davon eintritt, die Person für immer schwindet und die absolute Unsterblichkeit nur noch das höchste Sein bedeutet.
Fassen wir nun in der allgemeinsten Darstellung der oben behandelten Anschauungen alle Vor-Leben, Leben, Nach-Leben zu einer Leben-Reihe zusammen, mit verschiedenen Einzel-Leben, so träten also die acht Seelen in den verschiedenen Leben in verschiedener Weise, Intensität, in Tätigkeit. Jede von ihnen kann in einem Leben aufs äußerste wirken, und in einem anderen Leben ganz zurückgedrängt sein, daß sie wie nicht vorhanden erscheint. Und dieses kann auch im Einzel-Leben der Fall sein; wir wissen ja, daß in unserem Körper-Leben in der Tat die Seelentätigkeiten fortdauernd wechseln. Daher kann auch der Unterschied zwischen Mensch und Tier und Pflanze, überhaupt[S. 225] zwischen Mensch und jedem anderen Ding, aufgehoben werden, wie im Menschen die verschiedenen Zustände schwinden. Und es ist kein Widerspruch, wenn eine Lehre, wie die der Indier von der Metempsychose, die Menschenseele auch in Tiere, Pflanzen und andere Dinge wandern und ein neues Körper-Leben beginnen läßt. Die Gesamtheit der Seelen bleibt, aber sie treten in der Tätigkeit teilweise oder ganz zurück, so daß auch eine von ihnen oder zwei von ihnen, wie im Tiere die beiden animalischen Seelen, ausschließlich wirken. Die ganze Reihe soll aber, wenn sie auch Rückschritte aufweist, im wesentlichen in der angegebenen Weise doch nach aufwärts führen, bis zuletzt die animalischen Seelen ganz geschwunden sind, wenn auch das Gesamtseelenindividuum sich noch bekörpert zeigt. In Buddhas Lehre heißt das, bis der Wille zum (Körper-) Leben völlig erloschen ist. Alsdann enthält die Leben-Reihe keine Körper-Leben weiter und das Nach-Leben ist ein einziges, körperfreies. Diese nähere Ausführung unter Spezialisierung der Einzelseelen habe ich zum zusammenfassenden Verständnis der voraufgehenden nicht leicht zu durchdringenden Anschauungslehren von Welt und Leben unternommen. Will der Leser von Einzelseelen nichts wissen, so mag er darunter Tätigkeitsklassen der Seele überhaupt verstehen. Das ändert an den Ausführungen nichts. Er beachte aber immerhin, wie doch die fünfte Tätigkeitsklasse als regulierend und kategorisch so ganz verschieden ist von allen anderen Tätigkeitsklassen. Davon werde ich bei Betrachtung der sogenannten materialistischen Anschauungen von Welt und Leben eingehend zu sprechen haben.
Von je ist danach gefragt worden, warum, wenn das Leben auch Vor-Leben hat, wir von diesen nichts wissen, wenigstens nicht Alle etwas davon wissen, wenn auch Einzelne, wie Pythagoras und Buddha, volle Kenntnis davon gehabt haben wollen. Die schon erwähnte (S. 217) Tatsache, daß wir beim Kennenlernen neuer Dinge wohl glauben, sie schon zu kennen, reicht, wie jeder sieht, durchaus nicht zum Nachweis hin, daß wir etwas von unserem Vor-Leben wissen, ganz abgesehen davon, daß ja die Vor-Leben überhaupt vonein[S. 226]ander verschieden sein können und auch sein sollen. Die einzige einigermaßen befriedigende Antwort haben wiederum indische Weise gegeben, die ja, als die energischesten Verfechter der Leben-Reihe, die Frage am meisten angeht, und an sie sich anschließend unsere Theosophen. Wir können aber Frage und Antwort erst in einem späteren Abschnitt behandeln.
Den Eindruck wird aber, glaube ich, der Leser gewonnen haben, daß es sich hier, wenn auch um zweifelvolle und vielleicht unrichtige, doch um sehr großartige Anschauungen handelt, namentlich bei den in Indien erblühten und später nach dem Westen verbreiteten von der Leben-Reihe und ihrer Gipfelung im reinen absoluten Geistes- oder Gottes-Leben. Wir lernen im nächsten Buch ihre mehr phantastische und im letzten Buch ihre metaphysische Ausbildung kennen. Neben solchen Anschauungen nimmt sich die von Paradies und Hölle philosophisch freilich recht dürftig und derb naturmenschlich aus. Ob auch ethisch und erzieherisch, ist allerdings eine andere Frage, denn die Leben-Reihe (Sansara bei den Indiern) ist gegen die Ruhe-Ewigkeit (Nirvana) aufs äußerste herabgesetzt.
ZWEITES BUCH.
Philosophisch-deistische und theosophische Anschauungen.
Zu den philosophisch-religiösen Anschauungen rechnen wir diejenigen Lehren, bei denen Gott oder die Gottheit, oder eine wie eine Gottheit wirkende Seele, den Mittelpunkt der Annahmen bildet, und wo zugleich die Ordnung von Welt und Leben nach philosophischen Gesichtspunkten betrachtet wird, rein religiöse Willkür ausschließend. Das Religiöse lehnt sich an den Glauben, das Philosophische teils an Naturerkenntnis, teils an metaphysische Begriffe an und strebt, alles mehr der ruhigen Vernunft anzupassen. Manche der Anschauungen, die wir in diesem Buche kennen lernen werden, liegen fast ganz im Bereiche der Dichtung. Eigen ist ihnen allen aber die Erhöhung des Gottes- und des Seelenbegriffes und die Bemühung, zwischen diesen Begriffen und der Welt mit dem Menschen eine Verbindung herzustellen, die jenen Begriffen nicht zu nahe tritt und doch Welt und Menschheit in keine zu unwürdige Stellung bringt, ja im Gegenteil, Welt und Menschheit möglichst an jene Begriffe anschließt. Die theosophischen Anschauungen haben ihre Grundlage, außer im Glauben, in der Intuition.
DRITTES KAPITEL.
Pandeistische und panpsychistische Anschauungen.
25. Pandeistische Anschauungen.
Wenn auch nur durch einen Buchstaben (d statt th), unterscheiden wir grundsätzlich Pandeismus vom Pantheismus.[S. 228] Die letztere Anschauung rechnen wir zu den metaphysischen Anschauungen, während die erstere noch an der Religion teilhaben soll. Sie ist eine Art gesteigerten, vereinheitlichten und in das Göttliche übertragenen Animismus. Die ganze Welt ist mit Seelengottheiten erfüllt, und diese Gottheiten sind zu einer einzigen Welt-Seelengottheit (mitunter freilich auch zu zwei solchen Gottheiten) zusammengeflossen, die alles durchdringt und erfüllt und außer der Welt keine Bedeutung hat. Ansätze dazu finden sich vielfach. Wir besprechen aber nur die hinreichend deutlich hervortretenden Anschauungen. Daß einzelne Gottheiten Teile der Welt sind, würde schon aus Naturmenschlichem folgen. Zeus soll ursprünglich der Himmel selbst sein, Hera die Luft, Ge die Erde usf., Gottheiten und Gegenstände zugleich (S. 127 f.). Hades, Orcus waren immer sowohl Gott als Unterwelt, ebenso war Hel Göttin und Totenwelt. Von der ägyptischen Himmelsgöttin Nut wird gesagt, sie sei Lichtwohnung der Sonnenscheibe, Halle des Mondes, die Sterne träten aus ihren Lenden hervor und gingen in ihren Mund hinein, sie spanne und wölbe sich über der Erde: alles völlig materiell. Ich verweise auch auf das Bild S. 181, wo die Göttin als durchstirnte Frau im Doppelwinkel gebogen erscheint, die Füße im Osten, die Hände im Westen auf die Erde gestützt, den Rumpf in der Höhe gestreckt. Gleiches gilt auch von dem Luftgott (Shu), dem Erdgott (Qeb), sie sind mit ihr auf demselben Bilde zu Personen vereinigt. Aber bei den Ägyptern soll sich der Pandeismus auch vollständiger ausgedrückt finden. Heinrich Brugsch bringt dafür Belege. Er sagt: „Gott und das Weltall erscheinen verbunden wie die Seele mit dem Körper. Gott ist ein Geist, der in seinem kosmischen Hause wohnt, das er sich selbst gebaut hat“. Der Name für Gott soll ägyptisch Nutr, Nuta, Nuti lauten, und dasselbe besagen wie physis-natura, „die stets fortwirkende Tätigkeit des Erzeugens und Hervorbringens“, zugleich auch das in dem Erzeugten Enthaltene einbegreifend, also das Erzeugte und das es Erzeugende. Von Gott (ob Amun, Rā, Osiris, Chnum usf.) wird nun in Inschriften außer vielem, das ihn als den „Einen“, den „Ur[S. 229]geist“, den „Uranfänglichen“ (auch „Anfangslosen“?), den „Ewigen“, den „Schöpfer“, die „Wahrheit“, das „Leben“, den „Urvater“, die „Urmutter“, den „Barmherzigen“ usf. bezeichnet, auch ausgesagt: „er ist der Schöpfer seiner Gestalt und der Bildner seines Leibes“, „das Bleibende, das sich mehrt, ohne vernichtet zu werden“, „der Eine, der sich millionenfach vervielfältigt“, „der Himmel birgt seinen Geist, die Erde seine Gestalt und die Tiefe verschließt sein Geheimnis“, „bleibend ist er, das Bleibende in allen Dingen“, „das Bleibende aller Dinge (Menchet)“ usf. Diese und ähnliche Angaben zeigen allerdings, daß die Ägypter auch einer pandeistischen Anschauung sich genähert haben. Da aber Gott und die Gottheiten in anderen unzähligen Angaben zweifellos nicht selbst die Welt sind, sondern sie und ihre Teile errichten und beherrschen, handelt es sich mehr um besondere, nicht einmal genau ausgeführte Ansichten, als um allgemein anerkannte.
Entschiedener tritt Pandeismus bei den Indiern hervor. So ist in der Schöpfungsgeschichte, die von Brahmanaspati und Aditi ausgeht, Varuna die ganze Welt. Die Erde, der Himmel, die Ozeane sind Varuna; Sonne und Mond leuchten als seine Augen, der Himmel ist sein Leib, seine drei Zungen sind Himmels-, Luft- und Erdenraum, er geht in seinen eigenen Körper ein usf. Seine Gottheit tut er als Schöpfer seines eigenen Leibes dar. In der Bhagavad-Gîtâ sagt Krischna-Wischnu dem Ardschuna von sich: er sei aller Dinge Ursprung und Untergang, die Kraft in allen Dingen und die Erscheinungen, Duft im Wein, Glanz in Sonne, Mond und Gestirnen, Laut im Wort, sogar jeder Buchstabe, jedes Lied, Gebirg Himalaja, Feigenbaum, Roß, Mensch, Schlange (überhaupt jedes Tier), jede Jahreszeit. Wie er sich nachher Ardschuna als Gottheit zeigt, da sieht dieser, außer unendlichem Strahlenglanz, „das Weltall in ihm vereint:“
Dann wird geschildert, wie alles auch seinen Untergang in Krischna-Wischnu findet; sein Mund nimmt die Menschenscharen auf, in ihn strömen sie hinein wie die Flüsse in das Meer. Gleichwohl ist nicht zu verkennen, daß auch hier die Verschmelzung zwischen Gott und Welt keine absolute ist. Das Geistige, das Leben wird bei weitem mehr betont als das Materielle, und oft wird von Gott wie außer und über der Welt gesprochen. In anderen Fällen heißt es, in einem Upanischad, vom Purusha als Weltprinzip: aus ihm sei alles entstanden und in ihn kehre alles zurück, „aus ihm wird der Atem (Geist) geboren, das Denkorgan und alle Sinnesorgane, Äther, Luft, Licht, Wasser, und die Erde, die Trägerin von allem“. Auch hier jedoch findet sich ein Zwiespalt, denn aus Purusha (Person) wird auch, nachdem er geopfert ist, von den Göttern die Welt der Gegenstände und Erscheinungen gebildet, wie bei den Germanen aus dem Riesen Ymir. Mehr in das Gebiet des Metaphysischen, also mehr zum Pantheismus, gehört, was vom Brahman gelehrt wird. Es ist ganz unpersönlich, ein Es, das Selbst der ganzen Welt, wozu auch das einzelne Ding, der einzelne Mensch zählt.
sagt ein Rigvedalied (164 des ersten Buches) von diesem Bráhman. Als Brahmán wird es persönlich und dann kommen, wie in den anderen Fällen, die Zweifel, indem die Welt auch als von ihm geschieden angesehen werden kann. Im Atharvaveda wird gefragt: Von wem wurde diese Erde geordnet? Von wem der obere Himmel geschaffen? usf. Die Antwort lautet von Brahmán. Wenn das nicht alles aus sich heraus geschehen ist, wäre Brahmán außerhalb der Welt. Sätze wie in einem Upanishad: „Brahmán schwillt durch Hitze, daraus entsteht Nahrung (Stoff), aus Nahrung Atem, Geist u. a.“ sprechen für die erstere Auffassung. Ganz metaphysisch schon wird Prana (Geist, Atem, Seele, ψυχή) als Welt bezeichnet.
Unter den Griechen finden sich ähnliche Aussprüche erst bei den Philosophen (und Orphikern). Auch diese Aussprüche sind insoweit zweiseitig, als sie wie für Brahmán[S. 231] und Bráhman theologische und metaphysische Bedeutung haben. Pandeistisch ist, wenn der Eleate Xenophanes (aus Kolophon um 580–492 v. Chr.) von Gott gesagt haben soll: „Er ist ganz und gar Geist und Gedanke und ewig“, „er sieht ganz und gar, er denkt ganz und gar, er hört ganz und gar (οὖλος δ’ορᾶ, οὖλος δέ νοεῖ, οὖλος δέ τ’ἀκούει)“. „Das Eine und Weltganze (ἒν καὶ πᾶν) fällt mit ihm zusammen“. „Gott ist mit allen Dingen mitgeboren.“ Der Agrigentiner Empedokles (482–422 v. Chr.), den man auch zu den Eleaten zählt, faßte die Welt in ihrem ursprünglichen Zustand als eine in sich harmonisch geeinte Kugel auf, und nannte sie persönlich: „der Sphairos“.
Sphairos ist darum von manchen als der empedokleische Gott bezeichnet worden. Und das gehörte dem Pandeismus an; wenn nicht Aristoteles recht hat, wonach die Gottheit später entstanden sei als die Kräfte, die den Sphairos sich in die wirkliche Welt umwandeln ließen (Zwietracht und Streit). Bekannt ist, daß auch die ionischen Naturphilosophen von einem mehr oder weniger belebten Urwesen ausgingen. Da aber dieses Urwesen wohl als Seele aufgefaßt werden muß, sprechen wir davon im nächsten Abschnitt.
Die griechische Naturphilosophie ist durch die metaphysische Spekulation, die Sophistik und die praktische Philosophie aufgehalten und unterbrochen worden. Die Götter rückten in weite Ferne oder wurden ganz wegdisputiert. Indem jedoch die Volksreligion sich ungeschwächt erhielt und eher, aus dem Orient und Ägypten, neue Elemente aufnahm als solche verlor, mußte auch die Philosophie zurück in das Handgreiflich-religiöse gehen, um dieses so weit als möglich zu heben und zu veredeln und dem Gedankenwege anzupassen. Namentlich in der späteren Zeit, als durch die Römer ein unabwendbares Verhängnis über die Mittelmeerwelt hereinbrach und die Gemüter bedrückte, macht sich dieses Zurückgehen auf die Religion bemerkbar, und wir finden vollständig ausgebildete pandeistische Lehren, die mit Emanis[S. 232]mus und Theosophie zuletzt in das Mystische übergreifen und ihren Einfluß bis in die Neuzeit hinein fühlbar machen. Noch von heidnischen Gottheiten ausgehend, wachsen sie durch das Judentum allmählich in das Christentum hinein, ohne dabei ihren hellenistisch-kosmopolitischen Charakter ganz zu verlieren. Wie aber die Kenntnisse mehr und mehr schwinden und mit ihnen die realen Verknüpfungen der Tatsachen, schweifen die Lehren mit Vorliebe ins Uferlose und Phantastische und werden Gegenstand mehr der Sentimentalität und des Aberglaubens als der Überlegung und des Glaubens. Gleichwohl sind diese Lehren von hohem Interesse, zum Teil von dichterischer Gewalt, und für sehr viele ein froher Ersatz für das nur so wenigen gegebene und die meisten so abstoßende kühle Philosophieren, das schließlich auch noch nichts Entscheidendes geboten hatte, weder aus Erfahrung noch aus Denken, und das im Grunde zuletzt jeden auf sich selbst verweist, indem es ihm freilich die Mittel zu geordnetem Lernen und Schließen an die Hand gibt.
Wir nehmen zuerst die Schule der Stoiker. Zeus ist der Geist (νοῦς) der Welt und in der Welt, er ist das Keimende in der Welt (λόγος σπερματικός). Er wird sogar materiell vorgestellt, als feiner feuriger Dunst und als bildendes Feuer (πῦρ τεχνικὸν), jedoch auch als Hauch (πνεῦμα). Welches Etwas er auch sei, so führt er dieses doch selbst in jede andere Materie, Luft, Wasser, Erde usf. über. Sein besonderer Wohnsitz ist der Umkreis der Welt oder die Sonne, aber von da breitet er sich durch die ganze Welt in ihren verschiedenen Erscheinungen aus. Wie Zeus die Welt aus seiner Substanz bildet, so nimmt er sie auch wieder in sich auf, wandelt sie also wieder in feurigen Dunst durch einen Weltbrand, um sie später aus sich neu niederzuschlagen. Die Seelen sind Teile des göttlichen feurigen Dunstes, gewissermaßen mehr oder weniger bedeutende Konzentrationen dieses Dunstes in den Lebewesen. Jede Seele hat, wie die Gottheit im All, so in dem betreffenden Leibe einen Sitz, im Herzen, wo sie sich von dem Blute nährt; von da breitet sie sich, wie die Gottheit durch das All, so durch den Körper aus, namentlich in[S. 233] den Sinnes-, Sprach- und Zeugungsorganen. Dieser Pandeismus, der von Chrysippos (aus Soloi 280–208 v. Chr.) herrühren soll, ist schon eine Verbindung mit dem Emanismus; Gott ist die Welt, insofern als diese aus seiner Substanz durch Verdichtung und Abkühlung entstanden ist und entsteht, und er sich strahlengleich mit seiner Substanz durch sie noch verbreitet. Daß Gott als feurig gedacht wird (jedoch auch als Atem oder Äther) ist dem Menschen entnommen, dessen Wärme sein Lebensprinzip bedeutet; eine Idee, die sich schon bei den ersten griechischen Philosophen und namentlich bei Heraklit findet. Der stoische Pandeismus ist namentlich darin ein erklärter Emanismus, daß auch die Götter sich nur als Äußerungen und Ausflüsse des Welt-Gott (Zeus) darstellen wie die Seelen. Und damit kam er der Volksreligion durchaus entgegen, die ja von einer Theogonie ausging. Da die Gottheit die ganze Welt durchstrahlt und ihrerseits ein Materielles ist, so war es ganz folgerichtig von den Stoikern, wenn sie auch den leblos scheinenden Körpern vom göttlichen Odem mitteilten; sie betrachteten die Eigenschaften der Körper als materiell und hauchartig. Sie gingen noch weiter und erklärten alle Eindrücke auf uns als materiell. Und so konnten ihnen selbst Tugend, Gedanken, Stimmungen, ja auch Zeitabschnitte wie Jahr, Tag, Jahreszeit usf. in gleicher Weise erscheinen, göttlich-materiell. Das geht über alles hinaus, was selbst naturmenschlicher Animismus phantasiert hat. Wenn weiter die Stoiker dem konsequenten Sensualismus huldigten, daß alles Wissen, im weitesten Sinne des Wortes, nur aus sinnlichen Eindrücken stammt, die Seele bei ihrem Eintritt in den Körper tabula rasa ist, so hat auch dieses in der Annahme des gleichen Göttlich-Materiellen für die Eigenschaften der Körperwelt und für die Seele seinen Grund; Materielles wirkt eben auf Materielles. Darin begegnen sie sich mit den älteren Atomisten und Mechanisten, die ja die Seele gleichfalls als materiell auffaßten. Nur das Leere sahen die Stoiker als nichtmateriell an, ferner den Raum als solchen (also auch den Ort als solchen), die Zeit als solche und den formalen potentiellen Schluß. Von Gott hatten sie trotz[S. 234] der angenommenen Materialität einen sehr hohen Begriff. „Er ist die ewige Vernunft, welche die ganze Welt regiert und alle Materie durchdringt; er ist die gütige Vorsehung, welche das Ganze sowohl wie das Einzelne besorgt; er ist weise und Grund des natürlichen Gesetzes, welches das Gute befiehlt und das Böse verbietet; er bestraft auch das Böse und belohnt das Gute; er ist vollkommen und eines glückseligen Bewußtseins. Seiner Naturseite nach ist er die bewegende Kraft der Materie, die allgemeine Natur, ohne welche auch nicht das Geringste geschieht, er ist das Verhängnis (εἱμαρμένη), welches alles nach notwendigen Gesetzen des Zusammenhanges zwingt, und die Notwendigkeit aller Dinge.“ Die Heimarmene findet sich gleichfalls bei Herakleitos und ist überhaupt ein höchst beliebter Begriff. Aus den letzteren Eigenschaften Gottes folgt der für die Stoiker so charakteristische Fatalismus. „Er (Gott) ist die belebende Seele der Welt, welche einen natürlichen Trieb hat, aus sich wie aus einem Samen alles hervorwachsen zu lassen.“ So stellt sich die stoische Anschauung als ein monistischer-deistischer Materialismus und Mechanismus dar. Es ist bekannt, von welch außerordentlicher Bedeutung der Stoizismus für die spätere Griechen- und namentlich für die Römerwelt gewesen ist; seine Ethik und Dialektik haben die besten Menschen und größten Staatsmänner beherrscht, trotz des Indifferentismus, den er aus dem Fatalismus heraus lehrte.
Die späteren Schüler der platonisierenden Pythagoreer und der pythagorisierenden Platoniker schlossen sich zum Teil diesem Pandeismus an. Doch gehören deren Anschauungen in eine andere Darlegung (S. 255 ff.). Hier will ich allgemeiner noch hervorheben, daß die Griechen, wenigstens in hellenistischer Zeit, auch einem Pantheos (Allgott) Altäre errichtet haben. Ob dieser Pantheos mit der Welt identifiziert wurde, kann ich nicht sagen; er ist als eine aber persönliche Einheit aufgefaßt worden, nicht etwa als eine Kollektivgottheit, wie aus Inschriften aus Epidauros und Pergamon hervorgeht.
Pandeistische Andeutungen finden sich selbstverständlich[S. 235] auch bei vielen anderen Völkern. So könnte man den Taoismus der Chinesen, in der ihm von Lao-tsse gegebenen Form, hierher rechnen, wenn er nicht auch dem Naturalismus zuzuzählen wäre, da bei ihm mehr die Natur als die Gottheit in den Vordergrund gestellt wird. Die Erwähnung an dieser Stelle muß genügen, zumal mit solchen Sätzen wie: „aus Tao ist alles hervorgegangen, in Tao kehrt alles zurück“ nicht viel für unsere Frage anzufangen ist. Von den Japanern soll einer ihrer bedeutendsten Philosophen, Yamazaki-Ansai, um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, entwickelt haben: „Gott ist das Wesen aller Dinge und durchdringt den Himmel und die Erde.“ Das klingt pandeistisch, kann jedoch auch metaphorisch gemeint sein, wie wir ja ähnliche Aussprüche von Gott tun.
Die weiteren Betrachtungen über pandeistische Anschauung schließen sich an die in den nächsten Abschnitten zu besprechenden Lehren an.
26. Panpsychistische Anschauungen; Hylopsychismus, Hylozoismus.
Von diesen Anschauungen sind die als omnanimistisch bezeichneten bereits geschildert. Die der Theosophie angehörenden finden später ihre Erledigung. Was übrig bleibt folgt wie von selbst dem Pandeismus, und ist im Grunde nur durch Seele und Gott verschieden. Eine All-Weltseele wird statt eines All-Weltgottes angenommen. Die Seele steht uns näher als Gott, wir glauben sie besser zu kennen, da wir sie uns selbst ja zuschreiben. Es hat darum scheinbar weniger Schwierigkeit, sie mit der materiellen Welt verbunden zu denken als Gott. Alle Einzelseelen sind dann nur Teile der Weltseele. Und wie im Pandeismus von Gott den Dingen nur nach Maßgabe ihrer Stellung in der Welt zukommt, so auch von der Seele. Da in unserer Seele Gutes und Böses, Edles und Niedriges verbunden ist, entfällt bei Annahme einer Allseele auch die Unbequemlichkeit eines Grundes für das Üble in der Welt, den wir nicht gerne in Gott suchen, und nicht gerne für einen zweiten Gott[S. 236] ausgeben. So gewinnen wir einen, wie man ihn auch nennt, Hylopsychismus (ὕλη, Materie) oder Hylozoismus, der dem Pandeismus nur so weit entspricht, als dieser reiner Hylodeismus ist und Gott außerhalb der Materie nicht weiter gesucht wird. Thales von Milet (phönizischer Abkunft, wahrscheinlich 624–546 v. Chr.) scheint einen solchen Hylozoismus angenommen zu haben. Da er nach Aristoteles gemeint haben soll, alle Dinge seien von Göttern voll (πάντα πλήρη θεῶν εἶναι), so ist es freilich schwer, zu entscheiden, ob seine Anschauung in einem höheren Sinne, als von der Annahme einer Weltseele beherrscht, zu verstehen ist, oder lediglich in dem Sinne des Naturmenschen. Man möchte fast das letztere glauben, da als Beispiel der Magnetstein angeführt wird, der Eisen anzieht. Zeller ist dieser Ansicht. Das Feuchte galt dem Thales als Seele, und darum das Wasser als Urstoff, aus dem alles andere sich durch Erstarren und Sichverflüchtigen bildete. Hiernach sollte in allem das Feuchte noch bestehen, in größerem oder geringerem Grade. Daß die Seele im Blut gesucht wurde und im feuchten Atem, wissen wir bereits. Es macht keinen großen Unterschied, wenn Anaximenes (wahrscheinlich 585–528 v. Chr.) statt des Feuchten das Luftartige als Seele, die Luft als Urmaterie annahm. „Wie Luft (Atem) unsere Seele ist und uns zusammenhält, so umfaßt auch die ganze Welt der wehende Hauch (πνεῦμα) und die Luft.“ Thales sah in der Seele, wie aus dem Beispiel des Magnets zu erkennen, ein Bewegendes, Anaximenes erkennt in ihr ein sich selbst Bewegendes. Im übrigen herrscht Übereinstimmung. Feinste Luft (durch Wärme ausgedehnteste) ist das Feuer, also am meisten seelisch; dichteste (durch Kälte verdichtetste) ist die Erde, also am wenigsten seelisch. Die Gestirne sind (von der Luft) zusammengedrücktes Feuer, also jedenfalls hochbeseelt und doch erdenähnlich. Der gleichen Anschauung huldigte Diogenes von Apollonia (von 430 v. Chr.); er sprach sie noch schärfer aus, indem er im Luftartigen geradezu ein „ungewordenes, unbegrenztes, vernünftiges Wesen, das alles beherrscht und ordnet“, behauptete. „Denn gerade dieser Stoff (Luft), dünkt mich, ist Gott, ist[S. 237] allgegenwärtig, alles verwaltend und in allem vorhanden. Und es gibt auch nicht das Geringste, das nicht an seinem Wesen teilhätte.“ Dieser Stoff ist „ewig und unsterblich“, er ist „Seele und Geisteskraft“. „Bloße Umwandlungen der Luft sind alle Dinge.“ Hier schwindet eigentlich die Materie und ist die Welt nur Seele in verschiedener Darstellung, Manifestation. Schwierig ist es, die Rolle der Wärme und Kälte (sie finden sich auch bei den Scholastikern als Prinzipe) zu verstehen, die Diogenes wie auch seine Vorgänger zur Bildung der Welt aus der Seelen-Urmaterie heranziehen. Man weiß nicht recht, was sie neben der Seele noch sollen. Vielleicht, daß diese die Wärme und Kälte aus sich selbst heraus entwickelt und so der eigene Grund ihrer Verwandlungen mit der Urmaterie ist. Aber es wird auch von äußerer Wärme gesprochen, der Sonnenwärme, welche Pflanzen, Tiere und Menschen aus dem Urerdschlamm hervorgelockt haben soll.
Daß der zwischen Thales und Anaximenes lebende Landsmann dieser beiden, Anaximandros, eine Weltseele angenommen hat, ist wohl nicht sicher, aber wahrscheinlich. Er spricht von dem Ersten (ἀρχή) als von einem Unbegrenzten (ἄπειρον), Unbestimmten, aus dem alles hervorgeht und in das alles zurückkehrt nach der Ordnung der Zeit. Dieses Erste ist ewig und ständig in innerer Bewegung, also wohl beseelt, zu denken. Durch die Bewegung (also das Leben) treten Scheidungen und Bindungen des im Ersten Enthaltenen ein, die so unsere Welt darstellen; wie Warmes und Kaltes sich abtrennen und in ihrer Vereinigung das Feuchte bilden, wie dann aus diesem durch die weiteren Bewegungen Erde, Luft und Feuer sich sondern, letzteres sich zur Höhe begibt und sich in einem Feuerkreis um die Luft sammelt, diese in Gewittern durchbrechend. Mit den Scheidungen und Bindungen finden zugleich Lösungen und Durchmischungen statt. Und so gibt die Bewegung im Ersten eine ständig sich entwickelnde Welt und periodisch sich wiederholende Welten. Diese letztere Anschauung ist viel bewundert und von vielen aufgenommen und weiter entwickelt worden. Die Bewegung als Prinzip hielt auch der[S. 238] Ephesier Herakleitos (um 504 v. Chr.) fest, und er präzisierte sie sogar in dem berühmten Ausspruch πάντα ρεῖ, „Alles ist in Fluß“. Nirgend ist auch nur für Augenblicke Stillstand. „Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen und nicht zweimal eine Substanz berühren.“ Allein das Seelische sah er nicht in dieser Bewegung selbst, sondern in einem Feurigen; „diese Welt (κόσμος), die Eine für alle Wesen, hat weder der Götter noch der Menschen einer gemacht, sondern sie war immer und ist und wird sein ein ewig lebendes Feuer, sich entzündend nach Maß und erlöschend nach Maß“. Das Feuer wird auch als Hauch (ψυχή) bezeichnet, aus dem uns schon bekannten Grunde. Die Welt ist aber stetige Umwandlungen von Feuer. Und diese nie stillstehenden noch beharrenden Umwandlungen des eigentlich Seelischen geschehen wie ein „Krieg, der ein Recht, Vater und König aller Dinge ist“. „Krieg ist aller Dinge Vater, aller Dinge König. Und die Einen macht er zu Göttern, die Anderen zu Menschen, die Einen zu Sklaven, die Anderen zu Freien.“ So bildet das Psychisch-Wesentliche in Heraklits Lehre die rastlose Tätigkeit der Seele auch im Kleinsten der Welt, wodurch alles, wie es entsteht, sofort vergeht, so daß alles ist und auch nicht ist. Der Begriff des Lebens ist der absoluter Veränderung. Nach solcher steckt im Seelen-Feuer ein stetes, unstillbares Verlangen. Und wie die Veränderungen nach der einen Richtung gehen, geschehen sie auch nach der entgegengesetzten: „Des Feuers Verwandlungen sind zuerst Meer, des Meeres zur Hälfte Erde, zur Hälfte Feuer.“ „Für die Seelen ist es Tod: zu Wasser werden, für das Wasser Tod: zu Erde werden. Aus Erde wird Wasser, aus Wasser Seele.“ „Verbindungen sind: Ganzes und Nichtganzes, Eintracht und Zwietracht, Einklang und Mißklang, und aus Allem Eins und aus Einem Alles.“ „Der Gott ist Tag-Nacht, Winter-Sommer, Krieg-Frieden, Überfluß-Hunger.“ „Gut und Schlecht ist eins.“ Ganz rein psychisch scheint die Anschauung Heraklits nicht gewesen zu sein. Daß noch eine „verborgene Harmonie“ angenommen wird, die die[S. 239] Gegensätze immer ausgleicht, kann eine Eigenheit der Weltseele bedeuten, wie ja auch die Menschenseele sich in sich immer ausgleicht, daß trotz der vielen und stetig wechselnden Tätigkeiten die Einheit gewahrt bleibt. Allein es wird auch von göttlichen Gesetzen, von Weisheit, Vernunft, ja von Verhängnis — die Heimarmene —, von Zeus als dem Regenten über alles gesprochen, insgesamt von Prinzipien, „daß das Urwesen nach festen Gesetzen sich in alle Dinge umsetze und aus ihnen wieder zurücknehme“. „Denn die Sonne wird ihre Maße nicht überschreiten, ansonst werden sie die Erinnyen, der Dike (als Weltordnung) Schergen ausfindig machen.“ Davon handeln wir später. Ebenso von den hohen Anschauungen des Anaxagoras und anderer, da sie über das rein Psychische bereits hinausragen.
VIERTES KAPITEL.
Pythagoras, Anaxagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles.
27. Anschauungen aus Gesetz, Harmonie, Weltvernunft, Ideen und Formen.
Der Leser wird mir in den späteren Auseinandersetzungen leichter folgen können, wenn ich, die bisherige Systematik scheinbar, jedoch nur scheinbar, unterbrechend, zuvor von den Anschauungen spreche, die sich an die Namen in der Kapitelüberschrift knüpfen.
Pythagoras, aus Samos (etwa 571–497 v. Chr.), gehört zu den geheimnisvollen Gestalten des Griechentums; und so rätselvoll wie er sich darstellt, sind auch seine und seiner Schüler, der Pythagoreer, Lehren, mit denen sich schon die Alten abgemüht haben, und die wir fortwährend wieder aufgenommen finden. Das Wesentlichste aus diesen Lehren verdanken wir hier, wie in so vielen anderen Gebieten, den Mitteilungen des Aristoteles. Originales scheint von Philolaos (S. 242) überliefert zu sein. Alle Dinge in der Natur bestehen[S. 240] aus Begrenzendem und Nichtbegrenztem, „wie denn auch die ganze Weltordnung (κόσμος) und alles in ihr aus diesen beiden besteht“. Das Begrenzende wird als Punkt oder Punkte aufgefaßt; und sofern jeder Punkt eine Einheit bildet, heißt es das Eins und, weiter gedehnt, die Zahl. Diese sei das Wesen aller Dinge. „Und in der Tat hat ja alles, was man erkennen kann, eine Zahl. Denn ohne sie läßt sich nichts erfassen oder erkennen.“ Das Nichtbegrenzte ist, was zwischen den begrenzenden Einheiten sich befindet, wie beim Klang das Intervall, bei den Körpern die Leere zwischen den einzelnen Punkten. Und so bestehe alles aus den Gegensätzen des Begrenzenden und des Nichtbegrenzten, das die Pythagoreer auch durch Grade und Ungrade arithmetisch symbolisierten. Entstanden nun sei die Welt an sich nicht, sondern nur nach der menschlichen Denkweise. Von je sei das Ureins, das Ungrade, gewesen und das Leere. Indem dieses Ureins das Leere an sich und in sich sog, zerging es in eine Vielheit von Einsen, die durch das Leere getrennt wurden. Und so seien die Dinge der Welt gegeben. Das Ureins war also eigentlich eine lückenlos zur Einheit zusammengezogene Vielheit. Da die Punkte mathematisch angesehen wurden, so konnte diese Urvielheit auch als Urpunkt bezeichnet werden, denn sich berührende Punkte, selbst in unendlicher Zahl, geben immer nur einen Punkt. Die Dinge entstehen erst durch das Zwischentreten des Nichtbegrenzten, der Leere, des Intervalls. Daher wird das Ureins „als Grund aller Dinge, als Gott gepriesen, welcher alles lenke und führe, ein einiger und ewiger, bleibend und unbewegt, sich selbst gleich und verschieden von allen anderen Dingen“. Denn alle anderen Dinge enthalten ja noch ein anderes, das Leere. Und die Weltentstehung und Weltentwicklung beruht auf einem An- und Einatmen des Leeren durch das Ureins, auf einem Lebensprozeß. „Das Eins (τὸ ἕν auch ἥ μονάς) ist aller Dinge Anfang.“ So ist die Welt dualistisch erwachsen und dualistisch gedacht; das absolut vollkommene Ureins ist ihr einer Teil, das völlig negierende Leere der andere Teil. Darum die Unvollkommenheit der[S. 241] Welt. Die Verschiedenheit der Dinge folgt aus der Verschiedenheit der Menge des Leeren, die sie enthalten, wie die Verschiedenheit der Klänge aus der Verschiedenheit der Intervalle zwischen den Tönen.
Um auch die Ordnung der Welt zu erklären, gingen die Pythagoreer von dem Prinzip aus, daß schon das Eins die Verbindung der Gegensätze enthalte, denn zu Gradem addiert gibt es Ungrades, zu Ungradem Grades; es vereinige in sich das Wesen des Graden und des ihm entgegengesetzten Ungraden. In dieser Vereinigung liege die Grundharmonie. Und so seien die Zahlen nicht bloß das Wesen der Dinge, sondern auch das Wesen ihrer Zusammenstimmung, die Harmonie. Das Leere aber bedinge die Gegenstimmung, die Disharmonie. Zwei Töne für sich wären stets harmonisch; nach Maß der Leere zwischen ihnen, ihres Intervalls, können sie harmonisch bleiben wie in der Oktave, Quinte usf., oder disharmonischen Klang geben, wie in der Sekunde, Septime usf. Im ganzen wäre aber die Welt nach bestimmten Zahlenverhältnissen geordnet. „Denn nichts von den Dingen wäre irgendwem klar, weder in ihrem Verhältnis zu sich noch zu anderen, wenn die Zahl nicht wäre und ihr Wesen.“ So richtig der letztere Gedanke an sich ist, so übertrieben verfolgten ihn die Vertreter dieser Lehre, die schließlich alles in der Welt durch Zahlen ausdrücken zu können glaubten, selbst Begriffe und konkrete Gegenstände. In letzterer Hinsicht ist bekannt, wie sie durch Zahlenverhältnisse die fünf regelmäßigen Körper: Kubus, Pyramide, Oktaeder, Ikosaeder, Dodekaeder, daraus die fünf antiken Elemente: Erde, Feuer, Luft, Wasser, Äther, letzteres das „Lastschiff“ der Weltkugel, darstellten. Und so hatten sie eine gewaltige Ehrfurcht vor den Zahlen, und die Vierzahl (Tetraktys), der sie eine ganz besondere Bedeutung beimaßen, war ihnen sogar „die Quelle der nimmer versiegenden Natur“.
Das vornehmste, ursprünglichste und eigentlichste Element des Lebens ist das Feuer. Es befinde sich in der Mitte der Welt, strahle von da in die ganze Welt aus und ernähre so die ganze Welt und halte sie zusammen. Um dieses Zentral[S. 242]feuer (die Hestia, die Burg des Zeus) drehen sich die zehn Sphären, nämlich, von außen nach innen, der Fixsternhimmel, die fünf Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn), Sonne, Mond, Erde und Gegenerde. Die Gegenerde (ἀντίχθων) ist eingeführt, um die heilige Zahl Zehn zu erhalten, die „alles vollendend, alles wirkend und Anfang und Führerin des göttlichen, himmlischen und menschlichen Lebens“ ist. Die leuchtenden Gestirne strahlten entweder das Licht der Sonne zurück oder das des Zentralfeuers. Letzteres gelte insbesondere von der Sonne, die einem spiegelnden Kristall zu vergleichen sei. Zwischen den Abständen der Sphären und ihrer Bewegung herrsche musikalische Harmonie; und indem jede Sphäre durch ihre Schwingung einen Ton erzeuge, erklänge die Welt in der berühmten Sphärenharmonie, die wir nicht wahrnähmen, entweder weil die Töne für unsere Wahrnehmung zu hoch liegen, oder weil wir sie ständig in gleicher Weise hören. Über der ganzen Welt und sie umgebend sei wieder das Feuer. An der Unvollkommenheit der Erde liege es, daß wir vom Zentralfeuer nichts direkt bemerkten, sondern unter Vermittlung der anderen Weltkörper, welche von ihm Strahlung erhielten. Diese anderen Weltkörper werden dann auch für vollkommener als die Erde angesehen, so auch als von vollkommeneren Wesen bewohnt. Die Welt aber ist einheitlich, und von der Mitte aus begann sie zu entstehen.
Kaum eine Schule ist so konsequent verfahren wie die pythagoreische und hat, von trockenen Zahlenbeobachtungen ausgehend (bekanntlich bei den Experimenten über die Tonverhältnisse), so phantasievolle Vorstellungen entwickelt. Ihr Weltgebäude ist kühn und schön entworfen, und seine Entwicklung aus Punkt und Leere ist groß erdacht. Und Pythagoras soll ja zuerst für die Welt die Bezeichnung Kosmos benutzt haben, was Schmuck, Ordnung und Schönheit bedeutet. Wie die Pythagoreer, deren bedeutendste Philolaos und Archytas (beide etwas älter als Platon) waren, ihre Ideen bis in die feinsten Regungen der Seele harmonisch verfolgten, gehört nicht hierher. Die Seele selbst scheinen sie für die Harmonie des Körpers gehalten zu haben. Doch[S. 243] unterschieden sie die animalische Seele, mit dem Sitz im Herzen, von der Vernunft, deren Wurzel im Gehirn liegt. „Hirn ist das Prinzip des Verstandes (νοῦς), Herz das des Lebens (ψυχή) und der Empfindung (αἴσθησις)“. Von einer dritten Seele, im Nabel, ließen sie Wachstum und Fortpflanzung abhängen. Von einer vierten, im Schamglied, Zeugung. Wegen der pythagoreischen Seelenwanderung darf ich auf Früheres verweisen (S. 217).
Wie bei den Pythagoreern die Harmonie die Welt durchdringt, so bei Anaxagoras aus Klazomenai (um 500 bis 428 v. Chr.), dem Freunde des Perikles und der Aspasia, die Weltvernunft (Nus, νοῦς). Es ist freilich nicht sicher, daß er diese Vernunft durch die ganze Materie verbreitet sich gedacht hat. Indessen wirkt sie unmittelbar auf die Materie ein. Diese ist ursprünglich, wie bei Anaximandros, eine regellose Mischung aller möglichen Dinge. Die Weltvernunft aber bringt in dieser Mischung eine Wirbelbewegung hervor, die sich weiter und weiter ausbreitet, indem sie sich zugleich erhält. Durch die Bewegung aber wird Verwandtes zusammengeführt, Verschiedenes getrennt; so entstehen die Dinge. Verbindung und Scheidung ist niemals vollständig, sondern nur mehr oder weniger vollständig, so daß jedes Ding von allen Dingen an sich etwas enthält; nur von gewissen mehr, von anderen weniger, wodurch seine Art bestimmt ist. Z. B. besitze der weiße Schnee auch ein Dunkles, denn er löse sich im dunklen Wasser dunkel auf. Die Gesamtheit aber kann sich weder vermindern noch vermehren, sondern alles bleibt stets gleich. Ein ganz modernes Prinzip! „Der Geist ist unendlich und nach eigener Wahl herrschend, und vermischt ist er mit keinem Dinge (wiewohl in einigen Dingen enthalten), sondern allein selbst ist er für sich“, sagt der Philosoph. Der Geist ist nicht nur Ursache des Beginnes der Weltbildung, sondern auch der Entwicklung der Welt, ihrer Ordnung, er ist der „Wächter“ der Welt, „er bewege und ordne nicht nur das Vergangene, sondern auch das Gegenwärtige und Zukünftige“. Schöpfer ist er nicht, die Materie besteht neben ihm von je, nicht einmal[S. 244] ihre Bestandteile vermag er zu ändern. Ja selbst die Bewegung und Entmischung beherrscht er nur teilweise, da diese auch von der Natur der Materie abhängt. Er kann sein Streben nur angenähert durchführen. Und so ist die Welt nur im großen und ganzen durch ihn geordnet. Daher wohl das Unvollkommene. „Da der Geist anfing („von einem gewissen kleinen Punkte aus“) zu bewegen, sonderte er aus dem bewegten All; und so viel der Geist bewegte, alles dieses wurde ausgeschieden. Der bewegten, aber ausgesonderten, Dinge Umkreisung machte noch um vieles mehr ausscheiden.“ Also die Welt bildet sich nach dem Anstoß auch selbst weiter; wiederum ganz modern gedacht! Die Griechen aber sahen in seinem Dualismus und der halben Macht der Weltvernunft einen erheblichen Mangel seines Systems. Anaxagoras war Physiker, Mechanist, nebenbei auch Theosoph. Als solchem werden wir ihm noch begegnen. Die Athener nahmen ihm seine Indifferenz gegen die Götter übel, die schon aus der halben Wirksamkeit selbst der Vernunft folgt; und weil er auch die Gestirne für Steine (von der Erde durch die Wirbel losgerissen oder im Äther durch die Entmischung entstanden) erklärte, verfiel er der bösen Anklage der Gottlosigkeit, die selbst einem Sokrates das Leben kostete. Er mußte trotz des Schutzes des gewaltigen Perikles fliehen. Euripides soll sein Schüler gewesen sein.
Es ist bekanntlich noch nicht gelungen, mit Sicherheit festzustellen, was Platon (427–347 v. Chr.) unter den „Ideen“ (εἶδος, ἰδέα) verstanden hat, und der Auffassungen gibt es gar viele. Ihre Konzeption verdanken die Ideen offenbar der Erkenntnis, daß trotz des Mannigfaltigen gewisse Züge ganzen Klassen von Dingen und Erscheinungen gleicherweise zukommen. Rein dialektisch wäre also eine Idee das in einer Mannigfaltigkeit Gemeinsame. So bedeutete die Idee jedoch nur ein Abgezogenes, einfach einen Denkakt ohne jede Realität. Das ist aber nicht Platons Meinung. Zunächst behandelt er die Ideen als vor der Welt Vorhandenes. Im Timaios heißt es, indem von der Bildung der Welt durch Gott (Zeus) gesprochen wird: „So ist denn jene (die Welt) nach dem Urbilde dessen[S. 245] entstanden, was der Vernunft und Erkenntnis erfaßbar ist und beständig dasselbe bleibt. Schreiten wir nun auf diesen Grundlagen zur Betrachtung dieser unserer Welt fort, so ist sie eben hiernach ganz notwendigerweise ein Abbild von etwas Ewigem.“ Dieses „Ewige“, oder auch die „ewigen Götter“, sind eben die Ideen, die also vor der Welt vorhanden sein mußten, wenn die Welt ihr Nachbild sein sollte. Und von ihnen, als dem „Vorbilde“ (παράδειγμα, Paradigma) heißt es weiter: „Von allem nun, was zur Gattung der Teile gehört, werden wir sie mit Nichts in Vergleich bringen wollen, denn was dem Unvollkommenen (eben als Teil) gleicht, das kann nicht schön sein. Wohl aber werden wir sie demjenigen, wovon die übrigen lebendigen Wesen (nämlich nach Platons panpsychistischer Ansicht alle Wesen überhaupt) als Einzelne und nach ihren Gattungen bloße Teile sind, als am allerähnlichsten setzen“. Im weiteren Verlauf des Gesprächs, an das wir uns vorläufig halten, wird dann untersucht, „ob es ein Feuer an und für sich gibt und überhaupt alles übrige, wovon wir ein jedes so als an und für sich seiend zu bezeichnen pflegen. Oder aber, ob nur das, was wir sehen und was wir sonst mit den Sinnen des Körpers wahrnehmen, bereits die Wahrheit bedeutet, die wir suchen, und einzig und allein Wahrheit hat, und es außerdem schlechthin nichts anderes gibt. So daß es nur ein eitler Wahn von uns wäre, wenn wir jedesmal von einem jeden Dinge eine nur dem Denken erfaßbare Idee als das Seiende annehmen, und dieselbe nichts als ein Name wäre.“ Man kann die Aufgabe nicht schärfer stellen. Und Platon entscheidet sich, daß zugestanden werden müsse: „das Eine sei die stets auf dieselbe Weise sich verhaltende Art, unerzeugt und unvergänglich, weder in sich ein Anderes von anderswoher aufnehmend, noch selber in irgendein Anderes ausgehend, unsichtbar und auch sonst mittelst der Sinne nicht wahrnehmbar, das, dessen Betrachtung dem vernünftigen Denken zuteil geworden ist. Das Zweite aber, jenem gleichnamig und ähnlich, sei sinnlich wahrnehmbar, erzeugt, in steter Bewegung, entstehend an einem Ort und wieder von da verschwindend.“ Andere Äußerungen[S. 246] Platons in anderen seiner Gespräche stimmen damit im wesentlichen überein, daß die Ideen das An-sich- und Für-sich-Seiende (οὐσία, αὐτοζῶον) und zugleich, als Urbilder (Paradigmen) der Dinge, das An-sich dieser Dinge, überhaupt von Allem seien. Und indem jede Idee eine Klasse von Dingen in sich verkörpert, ist sie eine Einheit, eine Henás oder Monás. Unter diesen Ideen scheint Platon eine Rangstellung anerkannt zu haben, vermöge deren sie einander untergeordnet, übergeordnet und beigeordnet sind. Ja, indem er von der mitgeteilten Behauptung, daß jede Idee für sich sei, abgeht, bringt er die Ideen selbst miteinander in Verbindung, so daß in einer Idee auch mehrere Ideen sich abspiegeln können und in der Vorstellung jede ein Vieles zu sein vermag, wodurch auch die sinnliche Mannigfaltigkeit erklärt ist.
Die Nachbilder der Ideen sind in etwas ausgeprägt, das am besten wohl mit dem Heraklitischen Apeiron, dem unbegrenzten Etwas, verglichen wird. Es ist nicht, was wir Materie heißen. Platon nennt es die „Gattung des Raums“, „dem Untergange nicht unterworfen, welche allem, was ein Werden hat, eine Stätte gewährt, selbst aber den Sinnen unzugänglich ist, auch vom Geiste nur sozusagen durch einen erschlichenen Schluß erfaßt und kaum zuverlässig bestimmt wird, die, welche wir auch im Auge haben, wenn wir träumen, es müsse doch notwendig das, was ist, an einem Orte sein und einen Raum einnehmen; was aber weder auf der Erde noch sonst im Weltall sich befinde, sei überhaupt gar nicht vorhanden“. Dieses also Geträumte ist nach Platon auch das „Nichtseiende“, indem ihm eben nur die Ideen das wahrhaft Seiende bedeuten. Es ist auffallend, daß Platon den Raum als ein Besonderes denkt, da doch die Zeit als Abbild der Idee „Ewigkeit“ erklärt wird. Warum ist nicht der Raum ein Abbild der Idee „Unbegrenztheit“? Ist der Raum der Ort der Äußerungen (Bilder) der Ideen, so gibt die Seele die Verbindung zwischen diesen Bildern und den Ideen. Sie wird hiernach die Vorstellung dieser Ideen sein und zugleich das deren Abbilder Belebende und Bewegende. Sie tritt im Ein[S. 247]zelnen auf, aber auch als Gesamtseele, Weltseele. Sie wird als der Grund aller körperlichen Gestalten bezeichnet und als die Herrscherin. Ihr Sitz ist in der Mitte der Welt, die kugelförmig gedacht ist; sie zieht sich aber durch alle Dinge, und die Einzelseelen sind ihr angehörig. „Und so darf man es denn mit Wahrscheinlichkeit aussprechen, daß diese Welt als ein wirklich beseeltes und vernünftiges Wesen durch Gottes Vorsehung entstanden ist.“ Weltseelen und Einzelseelen werden für Götter (zu diesen sind auch die Gestirne als selige Wesen, „sichtbare Götter“, und die Götter der Volksreligion gezählt) und Menschen von Gott selbst geschaffen, für Tiere, Pflanzen und andere Dinge von den Göttern. Doch wird auch gesagt, die Seelen seien von je. Davon und von ihren Wanderungen ist bereits gesprochen (S. 217 f.). Die Umgebung der Seelen mit dem Leibe erfolgt durch die Götter, wenn es nicht, wie es auch den Anschein hat, durch die Seelen selbst, wenigstens durch die Weltseele, geschieht. Und indem die Seelen das Ewige sind und dem wahren Sein so nahe stehen, haben sie im Leben dem Werden und Vergehen, dem Einstürmen der Veränderungen Widerstand zu leisten, um ihre ewige Göttlichkeit zu wahren. Das würde freilich dem, daß die Seelen auch das Bewegende sein sollen, widersprechen, wenn nicht die von der Seele stammende Bewegung ein anderes bedeutet, als die von außen kommenden Veränderungen, vielleicht die innere Bewegung der Triebe, Gedanken und Gefühle. Dann wären die Veränderungen in dem „Raum“ begründet. Und dieser müßte doch etwas mehr bedeuten als bloß ein Nichtseiendes, zumal er ungeschaffen neben Gott bestehen und dessen Wirken auf Vollkommenheit hinderlich sein soll, daß die Welt nur unvollkommen aus den Händen des höchsten Werkmeisters hervorgeht. Trotz der Allmacht dieses Werkmeisters und der absoluten Vollkommenheit der Vorbilder, der Ideen.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in dem Verhältnis der Seele zu der Ideenwelt. Sie soll in diese Welt hineinragen. Ist sie geschaffen, so kann sie selbst nur Abbild einer Idee sein, also von den Ideen keine vollkommene Kenntnis er[S. 248]reichen. Besteht sie seit je, so ist nicht zu begreifen, wie sie in ein Abbild der Ideen gerät, da die Ideen es doch nicht tun. Und noch weniger, wie sie aus den Abbildern der Ideen Kenntnis von den letzteren erlangen soll, da doch die ganze Kenntnis nur die aus den Abbildern geschöpfte sein kann, also unvollkommen und schattenhaft. Indessen wird auch gesagt, die Seele kenne die Ideenwelt aus ihrer Existenz außerhalb des Körpers, und im Leben erinnere sie sich dieser Welt (S. 225 f.). Das ist aber doch nur ein Notbehelf, trotz dessen Ontologie und Ideologie unvermittelt bleiben. So ist in Platons Lehre so manches unverständlich und einiges mit anderem nicht zu vereinen. Der große Mann hat in seinem langen Leben wahrscheinlich seine Ansichten nicht immer festgehalten oder gegenüber weiteren Überlegungen nicht immer festhalten können. Und eine letzte Zusammenfassung seines Systems besitzen wir nicht. Er hat wohl auch ein festes System gar nicht geben wollen. Denn sein eigentliches Bemühen gehörte der Sokratischen Ethik an. Das Gute und das Schöne sind ihm die eigentlichen Ideen, beide sogar die Gottheit selbst. Und so knüpft sich an seinen Namen der Sokratische Idealismus in seiner eingreifendsten Bedeutung. Wir aber haben zunächst seine Reihe: Gott, Ideenwelt, Raum (auch Materie), Weltseele (auch Einzelseelen), Welt (mit Einzeldingen). Die Welt ist durch die Ideenwelt bestimmt. Gott schafft nach der Ideenwelt, er schafft auch die Seelen. Ist der Raum bedeutungslos, so bildet das Ganze eine Art Monismus. Allein das geht wohl zu weit, kaum kann man in Platons Lehren auch nur einen Dualismus mit Sicherheit anerkennen. Plutarch freilich, in seinen Lehrmeinungen der Philosophen, sagt: „Sokrates, des Sophroniskos Sohn, und Platon, Aristons Sohn, haben über das All gleiche Meinung. Sie geben drei Prinzipien an: Gott, die Materie und die Idee. Gott ist nämlich der Verstand, die Materie der erste Gegenstand des Entstehens und Vergehens, und die Idee ein unkörperliches Etwas, das in den Gedanken und Vorstellungen Gottes existiert. Gott aber ist die Seele der Welt“. Er meint also in der Tat einen Dualismus,[S. 249] indem er die Ideen und die Weltseele in Gott verlegt oder als Emanationen Gottes ansieht und neben Gott die Materie bestehen läßt. Nach Xenophon hat übrigens Sokrates es absichtlich vermieden, über das Weltganze zu sprechen, und sogar diejenigen für Toren erklärt, die darüber grübeln, da noch so viel über den Menschen selbst zu denken sei. In seinen späteren Jahren muß Platon die Einfachheit der Ideen aufgegeben haben. Pythagorisierend nahm er sie als zusammengesetzt an aus dem Eins, als dem Guten, und aus dem Unbegrenzten — dem Großen und dem Kleinen. Das soll wohl heißen, daß jede Idee in sich ein unterschiedsloses Gutes einheitlich darstellt, das in seiner Art allumfassend ist. Das Umfassende als „unbestimmte Zweiheit“ angesehen, wäre jede Idee Einheit und Zweiheit. Diese Darstellung ist von anderen übernommen, wir werden ihr wieder begegnen (S. 256).
Platons Schule ist die Akademie, zu der viele hervorragende Männer gehörten, die jedoch mehr und mehr in pythagorisierende Zahlenlehre verfielen, wie Speusippos, der unmittelbare Nachfolger Platons, alles aus Eins und der Vielheit abzuleiten suchte, ohne dabei die Weltseele und die Idee des Guten aufzugeben, und Xenokrates, dem das Eins oder das Ungrade und das Zwei oder das Grade „Vater“ und „Mutter“ der Götter waren, das Eins sogar dem Zeus und dem Nus gleichkam. „Indem zu der Zahl das Selbige und das Andere hinzutritt, entsteht die (Welt-) Seele.“ Die Kräfte der Natur waren ihm Götter. Die Zahlenangaben sind symbolische Ausdrucksweisen, deren Verständnis sich uns meist entzieht. Von den Neuplatonikern sprechen wir später. Über Weltzeitalter, Seelenwanderung und den Platonischen Ideen ähnliche Dinge bei anderen Völkern ist bereits gesprochen (S. 226).
Der größte Schüler des Platon, der große Aristoteles (384–322 v. Chr.), der Sohn des Nikomachos, hat die Lehren seines Meisters vielfach sehr scharf kritisiert. Er hat sie auch zu verbessern gesucht. Die Formen (εἶδη) der Dinge entsprechen den Platonischen Ideen. Sie sind aber bei ihm nicht Wesen für sich, sondern nur das, was die Dinge als[S. 250] solche ausmacht. Alle Dinge bestehen zunächst aus Stoff (ὕλη) und Form oder Inhalt (μορφή, εἶδος, λόγος, τό τὶ ἐστί usf.). Der Stoff als solcher ist nicht die Dinge selbst, wie auch nicht bei Platon, er ist eine „erste Materie“. Indem er aber doch Dinge werden kann, muß er dazu die Fähigkeit besitzen. So ist er eine Dynamis, eine Möglichkeit, Potentialität für Wirkliches. Verwirklicht ist ein Ding in der Form, und so bedeutet diese die Energie oder Entelechie des Dinges. Und sie ist so unveränderlich und ewig wie bei Platon die Idee, nur daß sie nicht außerhalb des Dinges etwas, ein Reales, bedeutet. Sie ist das, was das Ding zum Dinge macht, also auch dessen Wesen, Begriff und Endzweck. „Wenn etwas wird, so wird es nicht nur aus etwas, sondern durch etwas“, heißt es in der „Metaphysik“. Auch der Stoff ist ewig; er soll auch das Unausweichliche, die Ananke, einbegreifen und den Zufall, die Tyche, und darum die Unvollkommenheit der Welt bedingen, die Platon in dem „Nichtseienden“ des Stoffes sah. Die Form muß Macht haben, den Stoff sich zu unterwerfen. Diese Macht aber wird nicht aktiv in der Form gesucht, sondern passiv in dem Stoff, dem ein Verlangen (ὁρμή) nach der Form zugeschrieben wird. Das wäre eine dritte Eigenheit des Stoffes. Aristoteles faßt also den Stoff realer auf als Platon. Indessen kann etwas Stoff mit Bezug auf Eines und Form mit Bezug auf ein Anderes bedeuten. So ist Erz Stoff einer Bildsäule, Form aber mit Bezug auf die Teile, aus denen es gewonnen ist; dadurch verläuft alles freilich ins Begriffliche. Aus Form und Stoff gehen, wie die Dinge, so auch die Veränderungen hervor; diese sind Wirklichkeiten von Möglichem und als solche gleichfalls Energien oder Entelechien. Das Verändernde ist die Form, das Veränderte der Stoff.
Die Veränderung ist so anfang- und endlos wie Form und Stoff. Daher (?) muß es ein unveränderliches Veränderndes (unbewegtes Bewegendes) geben, also eine Form ohne Stoff, eine reine Aktualität, die, als ohne Stoff, auch das absolut Vollkommene ist. Diese Form ist der Geist (νοῦς), die Gottheit, die allumfassende, absolute Ver[S. 251]nunft, die in unaufhörlichem Sich-selbst-Denken (θεωρία) das „Denken des Denkens“ ist; eine Wendung, die Andere viel benutzt und auch mißbraucht haben. Diese letzte Form ist nur in sich tätig; sie wirkt aber durch ihre Anwesenheit, daß alles ihr zustrebt, und bedingt dadurch das Leben der Welt in seiner bestimmten Ordnung. „Einen auf die Welt gerichteten göttlichen Willen, eine schöpferische Tätigkeit oder ein Eingreifen der Gottheit in den Weltlauf hat Aristoteles nicht angenommen“, sagt Zeller. Man sieht, die ganze Anschauung ist höchst mechanisch, im Grunde ist die letzte Form auch überflüssig; sie besagt ja nur, daß das Leben der Welt einen bestimmten Lauf von Ewigkeit zu Ewigkeit hat. Und so gehörte diese Lehre sachlich nicht hierher, wenn es sich nicht sonst empfohlen hätte, sie an Platons lebendige Ideenlehre anzuschließen. Auch ist die Stellung des νοῦς, nachdem dieser einmal angenommen ist, in der Tat die einer besonderen Gottheit, die nur als solche mit der Welt aktiv nichts zu tun hat. Diesen Mangel der Gottheit, wenn er ein solcher ist, ersetzt Aristoteles durch Einführung der „Natur“ (φίσις), die für Leben und Sein in der Welt den Grund abgibt, wie eine wirkliche Kraft. Vielleicht hat Aristoteles doch die reine Passivität Gottes verlassen und Gottes Vernunft als Weltvernunft aufgefaßt. Allein Aristoteles sagt, die Natur sei nicht göttlich (οὔ θεία), sondern dämonisch (δαιμονία), sie wirke wie eine nach unbewußten Trieben handelnde Künstlerin. Gleichwohl ist seine Anschauung, wie die Platons und vieler Philosophen vor und nach ihm, eine zweckheitliche, teleologische. „Die Natur tut nichts zwecklos“, „sie strebt immer nach dem Besten“, „sie macht nach Möglichkeit immer das Schönste“. Und insofern die Natur die Welt selbst mit allen Geschehnissen ist, liegt die Teleologie in ihr. Ihre Entwicklung ist durch sie selbst bestimmt. Das wäre durchaus modern gedacht. Noch sei erwähnt, daß Aristoteles als drittes Prinzip den Dingen die Beraubung, Privation (στέρησις) zuschreibt, sicher um die Verschiedenheiten der Dinge dialektisch zum Ausdruck zu bringen. Und er denkt sich die Dinge in der Tat auch[S. 252] der Art nach verschieden und meidet die mathematischen Konstruktionen der Pythagoreer und Platons, sowie die Ableitungen der Atomisten, die wir noch kennen lernen werden.
Die Welt hat bei Aristoteles Kugelform; in der Mitte ruht die Erde, der Himmel dreht sich in stets gleicher Weise. Alles an diesem ist viel vollkommener als auf der Erde, die Gestirne sind vollkommenere Wesen als selbst der Mensch. Es gibt einen oberen Himmel der Fixsterne und untere Himmel der Planeten. Außer der allgemeinen Bewegung des oberen Himmels, der diese unteren Himmel mitführt, haben diese auch noch eigene Bewegungen; schwingende und neigende, eben zur Erklärung der scheinbaren Bewegungen der Planeten, zu denen auch Sonne und Mond gezählt werden. Eine ähnliche Anordnung nimmt auch Platon an, und zwar von der Erde aus: Mond, Sonne, Merkur (Stilbon), Venus (Heosphoros), Mars (Pyroeis), Jupiter (Phaethon), Saturn (Phainon), Fixsterne. Im übrigen ist alles in der Welt möglichst konzentrisch kugelförmig geordnet, wie auch die Bewegung der Sphären kreisförmig sich darstellt und die Elemente kugelig sich übereinander lagern (Erde, Wasser, Luft, Feuer, Äther). In Aristoteles Ansichten liegt es, daß das Bessere immer das Schlechtere regiert. So hängen die Winde der Luft von den Gestirnen ab, die Wogen des Meeres von den Winden. Je mehr die Zahl der Regierenden wächst, desto geringere Einheitlichkeit; und so herrscht in allem auf der Erde die größte Unordnung, und diese nimmt ab, je höher wir steigen. Aristoteles sah darum auch diejenigen Gestirne als die ferneren an, die die geordneteren Bewegungen aufweisen, die Fixsterne also als die fernsten. Die Sonderbewegungen der Planeten werden schon von Platon und Früheren durch Einführung weiterer Sphärendrehungen erklärt. Mit der Fixsternsphäre wird die Zahl aller erforderlichen Sphären von Eudoxos auf 23, von Kallippos und Aristoteles auf 34 geschätzt. Da aber jede höhere Sphäre jede tiefere in ihre Bewegung hineinziehen müßte, sind noch 22 Sphären angenommen, die sich entgegen jenen drehen. Insgesamt hat man so 56 Sphären. Jede Sphäre muß von einem unkörperlichen und unbewußten[S. 253] Geist bewegt werden, davon also 56 vorhanden sind, zu denen eben die Gestirne zählen. Dieses System, in Verbindung mit pythagoreischen Harmonielehren, hat wohl Cicero vorgeschwebt, als er seinen wunderlichen Aufsatz „Scipios Traum“ schrieb. Die Welt ist ewig von je in je, und, indem auch die Formen ewig sind, hat es die gleichen Dinge, zum Beispiel Menschen, immer gegeben, wie auch Platon annimmt, trotz der stetigen Entwicklung nach oben. Das Leben der Wesen hat niemand nach der vitalen wie nach der geistigen Seite so eingehend zergliedert wie Aristoteles. Das gehört nicht mehr hierher. Nur an seine berühmte, aus seiner Formenlehre folgende Definition der animalen Seele als der Entelechie des organischen Körpers sei erinnert. Der Mensch besitzt noch einen Geist (νοῦς) außerdem, mit der animalen Seele verbunden. Wie, ist nicht zu ersehen, zumal vom Geist mindestens ein Teil, der tätige (ἀίδιος), ewig sein soll.
Aristoteles’ Schule ist die der Peripatetiker, seine eigentlichen Schüler aber hat er im Mittelalter unter den Arabern und abendländischen Scholastikern gehabt, bei denen er Jahrhunderte hindurch souverän herrschte, bis nach Anbruch der neueren Zeit diese Herrschaft unter harten Kämpfen allmählich gebrochen worden ist, ohne doch bisher ganz zu verschwinden. Er war eben ein außerordentlicher Mann, der auf dem Gebiete der Dialektik Großes und auch als Naturforscher höchst Bedeutendes geleistet hat. Er wird uns noch oft begegnen, er und sein Lehrer Platon, die eigentlichen Sterne griechischer Idealphilosophie.
FÜNFTES KAPITEL.
Anschauungen aus Theosophie, Deismus und Emanismus.
Die Theosophie und die mit ihr meist verbundene Emanationslehre beruhen außer auf dem Glauben, wie an einer anderen Stelle bereits hervorgehoben, weniger auf logischen Verstandesfolgerungen und auf Naturbetrachtungen,[S. 254] als vielmehr auf Eingebungen, innerem Schauen (contemplatio), auf Intuition, meist aus dem Fühlen heraus. Es wird dieser Intuition, mitunter höchster Phantasie und Verzückung, ihr Recht eingeräumt, selbst gegen den Widerstand der kühlen Vernunft. Zugleich tritt die irdische Welt als Selbständigkeit in den Hintergrund. Verband der Pandeismus Gott mit der Welt, so schließt die Theosophie umgekehrt die Welt an Gott an. Gleichwohl neigt sie meist zu einem gewissen Pandeismus, wofür wir manche Beispiele kennen lernen werden. So ist die Theosophie doppeldeutig zu verstehen, als eine Erkenntnis Gottes durch die Welt und als eine Erkenntnis der Welt durch Gott; letzteres also als eine Erkenntnis, wie Gott sie besitzt, als eine absolute Erkenntnis. Fast alle Schulen und Vereinigungen, die sich in dieser Weise mit der Theosophie beschäftigt haben und noch beschäftigen, wie unsere modernen Theosophen, haben die zweite Art der Erkenntnis in ihren wesentlichen Teilen geheim, esoterisch behandelt. So verband und verbindet sich mit der Theosophie ein Occultismus, der, soweit er an die Öffentlichkeit tritt, naturgemäß als Mystizismus erscheint. Und sie führt zu Supranaturalismus. Ja in den Auswüchsen zu Theurgie, Nekromantie und manchem Spuk, den wir vom Spiritismus kennen. Es ist auch vielfach das Gebiet der Geheimgesellschaften, deren Lehren nur den Eingeweihten, Mysten, Adepten bekannt waren oder bekannt sind. Ob die griechischen Mysterien hierhergehören, läßt sich nicht feststellen. Da wir nicht mehr sagen können, als wir wissen, beschäftigen wir uns hier nur mit den exoterischen Lehren. Sie enthalten viel Bedeutendes und Hohes neben manchem, das wir nur kopfschüttelnd vernehmen mögen. Ich erinnere aber zum Verständnis des Folgenden, namentlich in nichtheidnischen Kreisen entstandenen, daß, frei von allem Mystizismus, schon in der Bibel die Wesensgleichheit des Geistes des Menschen mit dem Odem Gottes vorgetragen ist. Um solche Wesensgleichheiten in allgemeinerem Sinne handelt es sich in allen zu beschreibenden theosophischen Anschauungen. Für Gott werden wir auch Urgeist setzen.
28. Orphiker und Neu-Pythagoreer.
Die Orphiker sagten: Vom Geiste (ὅλον, Universum) lösten sich, wie vom Winde geweht, Stücke ab. Die lebenden Wesen atmeten sie ein und würden dadurch zu belebten Dingen. Doch ist uns von den Neu-Orphikern manches Ausführlichere überliefert. Nach der sogenannten Rhapsodischen Schule ist eine Trias von drei Urwesen vorhanden: Chronos (wohl Zeit), Aither (das allgemein Leuchtende), Chaos (wüste Materie). Aus Chronos entsteht im Aither ein leuchtendes (silbernes) Ei. Daraus geht der Weltschöpfer, als Trias: Phanes-Erikapaios-Metis, hervor. Der erste Name hängt mit Leuchten zusammen, der zweite soll Lebensspender bedeuten, der dritte tatkräftige Einsicht. Diese Dreigottheit strahlt Sonne, Mond und Tag von sich, damit entsteht auch Nacht, dann Uranos, Gaia, Kronos und die übliche Götterreihe mit Zeus. Sie führt auch den Namen Eros, als schaffende Kraft, Protogonos als Urgeborener, Monogenes als Einziggeborener, Dionysos, Pan usf. Zeus verschlingt alles mit Phanes zugleich und bringt nun die eigentliche Welt hervor. Eine andere Schule stellt an die Spitze ein „Unaussprechbares“, dann ein Dreiwesen Chronos—Herakles—Ananke-Adrasteia und Materie als Wasser und Erde, alles zusammen wieder eine Dreiheit. Aus dem Dreiwesen geht hervor als zweite Trias: Feuchter Äther, unbegrenztes Chaos, nebelartige Finsternis. Nun erst entsteht durch das Dreiwesen in dieser Trias das Ei, darin der Same aller Dinge, und aus dem Ei, dem Phanes entsprechend, das neue weltschöpferische Wesen Protogonos-Zeus-Pan. Der Deutung wird durch die Namen nur wenig nachgeholfen. Gruppe glaubt, daß einiges auf den Orient, als Heimat solcher Mythen, hinweise, namentlich auf Babylon, und er führt die Istar-Tammuz-Sage (S. 197) als Quelle an; ich habe nicht recht ersehen können, in welchem Zusammenhange. Einiges sei auch wohl im kleinasiatischen Attiskult zu suchen. Pan ist in solche kosmogonische Theorien, wie auch in die stoischen, nur seines Namens wegen verschlagen, der als „All“ (τὸ πᾶν) übersetzt wurde. Tatsächlich ist Pan[S. 256] lediglich Hirtengott, und der Name bedeutet nur Hirt (nach Roscher aus Paon zusammengezogen). Die Anordnung in Triaden ist eigentlich neu-platonisch, wie wir noch sehen werden; doch mag sie auch den orphischen Systemen eigen gewesen sein. Gruppe hält es nicht für ausgeschlossen, daß solche Theosophien schon zur Zeit der Peisistratiden in Griechenland (Athen) im Schwange gewesen sind. Allerdings werden schon von dem behaupteten Lehrer des Pythagoras, Pherekydes aus der Insel Syros, ähnliche Theosophien mitgeteilt, mit Zeus-Eros, Chronos, Chthonie (Erde) als erste Trias; Feuer, Luft, Wasser (alle aus Chronos hervorgehend) als zweite, aus der dann die Götter entstehen und die Welt von Zeus-Eros gebildet wird. Auch von Epimenides soll etwas Ähnliches gelehrt worden sein. Wir haben es weniger mit Philosophen als mit Theologen zu tun.
Die Neu-Pythagoreer, in ihren verschiedenen Lehren, beschäftigten sich insgesamt mit den vier Stammannahmen der Tetras: Gott, Seele, Materie, Widergott. Einige Schulen vereinigten Seele mit Gott und gewannen so die Dreiheit, Trias: Weltgeist, Materie, Widergeist. Entzogen andere Schulen auch noch der Materie ihre Neutralität, indem sie den Widergeist in sie versetzten, so ergab sich die Zweiheit, Dyas, von Geist und Materie, beide aktiv und widerstreitend. In letzterem Sinne sprechen sie in Pythagoras’ Zahlenlehre von dem Eins als dem Geist und dem Zwei als der Materie, und das Eins sollte das Vollkommene, das Zwei das Unvollkommene sein. Aber das Zwei muß zugleich das dem Eins Widerstreitende bilden, sonst ist das Übel in der Welt nicht zu erklären. Gleichwohl beherrscht das Eins das Zwei; absolut als Urgeist, weniger vollkommen als Seele. Die lebenden Wesen haben nun teil am Urgeist als Seele oder Geist und an der Materie, samt deren Widergeist. Wie sich aber in ihnen Geist und Widergeist bekämpfen, ist nicht recht ersichtlich; nur scheint strengste Ethik und Askese als Wirkerin gegen den Widergeist betrachtet zu sein, die den Geist frei macht und ihn in seiner Göttlichkeit erscheinen läßt. Der seltsame Wundermann Apollonios von Tyana (4 v. Chr. bis[S. 257] 96 n. Chr.), dessen Leben Philostratos beschrieben hat, gehört den Neu-Pythagoreern an. In seinem Wesen gemahnt er sehr an die indischen Asketen, die sich sogar Macht über den Beschluß der Götter zuschrieben, und die Götter durch Buße und inniges Gebet zwingen zu können glaubten, wie unsere Gesundbeter der „Christian Science“. Der Neu-Pythagoreismus ist mit Platonischen Lehren durchsetzt und geht schließlich in den Neu-Platonismus über. Aber auch stoische Elemente sind ihm nicht fremd. Denn manche Neu-Pythagoreer vereinigten Geist und Materie zu einer Unität, gleich derjenigen der Stoiker, und unterschieden sich von diesen im Grunde nur noch durch das Mystische und durch ihren Hang zur Weltentfremdung und Selbstkasteiung. Ihrem Mysticismus entspricht ihr weitgehender Dämonenglaube, den wir auch bei den Stoikern finden und der hoch in das griechische Altertum hinaufreicht, als ein Naturmenschliches. Einige sahen in den Dämonen die eigentlichen Regenten, Archonten der Welt, ganz im Sinne des alten Hesiodos, dessen Anschauungen wir hier zur Klarstellung anführen. Nach ihm sind die Dämonen Geister dahingeschiedener Menschengeschlechter, wie nach dem Naturmenschen. Vom Geschlecht aus dem Goldenen Zeitalter heißt es in den „Werken und Tagen“:
An einer anderen Stelle nennt er sie „heilige Diener des Zeus“ und gibt ihre Zahl auf drei Myriaden an. Die Seelen der anderen Menschengeschlechter werden als „sterbliche Götter der oberen Erde“ bezeichnet (die des zweiten, Silbernen Geschlechtes), oder als indifferente selige Geister (die Halbgötter des vierten Geschlechtes), oder sie werden gar nicht genannt. Darauf bezieht sich beispielsweise Plutarchos in seiner Schrift über Isis und Osiris (oder wer diese Schrift verfaßt hat). Er bringt aber noch eine sehr eigenartige Auffassung des Empedokles bei, wonach die Dämonen für ihre Fehler und Vergehungen auch gestraft werden, bis sie ge[S. 258]läutert ihrem früheren Stande zurückgegeben sind. Wir werden diesen Dämonen bald unter anderer Gestalt wieder begegnen. Aber solchem Dämonenglauben wird es möglicherweise zuzuschreiben sein, wenn einige Neupythagoreer gar nur die Materie mit ihrer Gottheit als ursprünglich anerkennen und das Gute als eine daraus nachgeborene Gottheit ansehen wollten. Das erklärt dann freilich das Unvollkommene der Welt radikal. Einen ähnlichen Gedanken in einer sehr viel höheren, und auch umgekehrten, Auffassung finden wir bei unserem Jakob Böhme wieder. Zunächst wenden wir uns noch zwei morgenländischen Anschauungskreisen zu.
29. Indische Theosophie und Sufismus.
Wie die hebräische Philosophie auf der Bibel, beruht die indische auf Veda und Upanishaden, als den heiligen Büchern. Und da die Upanishaden wesentlich der Erläuterung der Veden dienen, wird die indische Philosophie besonders als die Vedantaphilosophie bezeichnet. Daß es jedoch indische Philosophien gibt, die weit ab von den Lehren der Vedas und der Upanishaden führen, beweisen namentlich die buddhistischen und manche Philosophien rein materialistischen Charakters, die in Indien als das Fremdartigste dastehen. In der Vedantaphilosophie nun, die uns hier noch allein angeht, herrscht wesentlich die Anschauung, daß Seele und Urgeist das gleiche sind, sei es, daß sie getrennt voneinander bestehen, so daß jedes lebende Wesen eine Art Kleingott bedeutet, der nur durch die Verbindung mit der Materie gehindert ist, Gott gleich zu werden, oder daß die Seelen am Urgeist überhaupt teilhaben. Diese Anschauung ist späterhin nach zwei Richtungen weitergebildet worden. Ramanuga und seine Schule betrachteten den Urgeist Brahman als wirkliche Gottheit, und für sie war die Gottheit im lebenden Wesen real. Ja, ihre Lehre ging bei Vielen in den schon behandelten Pandeismus über, wenn auch die Materie mit der Gottheit verbunden wurde. Die Welt war eine Evolution Brahmas. Max Müller teilt einen interessanten Text aus dem Kandogya-[S. 259]Upanishad mit, der für Ramanugas Anschauung spricht. Indra als Führer der glänzenden Götter, Devas, Virokana als Führer der den Devas widerstreitenden Âsuras, wollen das absolute Selbst, das Atmân, erkennen und wenden sich an Pragâpati, den Herrn der Schöpfung. Er erklärt ihnen zuerst, was sie im Auge, im Wasser sich spiegeln sähen, das sei das Selbst. Beide fassen danach das Bild als das Selbst auf, also ein Anderes. Und Virokana ist damit befriedigt und gründet darauf bei seinen Âsuras die Lehre der Äußerlichkeiten. Aber Indra merkt bald, daß das Bild nicht das Selbst sein kann. Er kommt zu Pragâpati zurück. Und das muß er nun wiederholt tun, indem er immer höhere Antworten erhält, die die jedesmaligen Zweifel anerkennen und seine Anschauung von Stufe zu Stufe steigen lassen. Der letzte Bescheid geht von der Verbindung zwischen Körper und Seele aus. „Wie ein Pferd an einen Wagen gespannt ist, so ist der Geist (prana) an diesen Körper gespannt.“ Steht der Geist von dem Körper absolut frei, so ist er die „höchste Person“ (uttama purusha). Wer weiß: ich will denken, der ist das Selbst. Wer weiß: ich will reden, ich will sehen, der ist das Selbst usf. Die Organe sind nur Mittel. Sogar das Denkorgan ist nur Mittel; wer weiß, daß er denken will oder denkt, der ist das Selbst. „Derjenige, welcher dieses Selbst kennt und es versteht, erlangt alle Welten und alle Wünsche.“ Letzteres bedeutet, daß er die höchste Erkenntnis besitzt, sich selbst und so die Welt erkennt. Schon hier ist das Absolute stark verflüchtigt, obwohl es als purusha (Person) bezeichnet wird.
Noch mehr geschieht dieses in der zweiten Schule der Vedantaphilosophie, der Sankhya. Der Urgeist rückt in unbegreifliche Fernen; die Seelen mögen an ihm teilhaben, für die Anschauung ist dieses aber nicht von Belang. Dadurch geht die Sankhyaphilosophie in einen gewöhnlichen Dualismus zwischen Geist und Materie über, dessen Betrachtung nicht mehr ganz hierher gehört. Die Abstammung von oder die Verbindung der Seele mit Brahman zeigt sich nur darin, daß sie in der realen Welt allen Vorgängen gegenüber das absolut[S. 260] Ruhende, reiner Geist ist. Ihr Verhältnis zu der realen Welt kommt nur dadurch zustande, daß von ihr aus Licht auf die Dinge fällt; wie manche Griechen geglaubt haben, daß wir dadurch sehen, daß vom Auge Strahlen ausgehen, die die Gegenstände betasten. Und die Hemmungen unseres Geisteslichtes an den Dingen sind unsere körperlichen Leiden und Freuden, wenn wir sie als Hemmungen hinnehmen. Durchschauen wir aber, daß Leiden und Freuden doch uns selbst gar nicht berühren, da in uns gar nichts vorgeht, so haben wir die Erkenntnis erreicht, die uns von der Welt frei macht und die Seele als absoluten Geist bestehen läßt. Daß diese Lehre, wie jeder Dualismus, an der Unbegreiflichkeit der Wirkung differenter Potenzen aufeinander leidet, sieht der Leser. Verdeutlichungen durch Bilder, wie daß ein weißer Kristall rot erscheint, wenn hinter ihm ein roter Gegenstand gehalten wird, sind üble Notbehelfe, namentlich für uns, die wir die physikalischen Gründe kennen. Eine Art Vermittlungsschule zwischen den beiden genannten ist die von Sankara begründete. Die Seele ist Brahman selbst. Und die Welt? Diese ist überhaupt nicht. Wir werden diese Lehre im dritten Buche behandeln. Hier erwähnen wir nur noch, daß Askese, Selbstquälen und Sichversenken wie zur absoluten Erkenntnis, so auch zur Erreichung hoher magischer Macht führen soll. Die Yoga-Lehre (Anspannungslehre) geht so auch in Okkultismus über. Und wer hat nicht von den übermenschlichen Taten indischer Fakire gehört?
Mit den orphischen und den indischen Lehren eine gewisse Ähnlichkeit haben die der persisch-mohammedanischen Sekte der Sufi (die Reinen, Frommen). Die Seelen sind auch hier Teile Gottes, in der Art Gott gleich, aber dem Grade nach unendlich von ihm verschieden. Im letzteren Umstand besteht die Differenz gegen die indischen Lehren, nach denen Seele und Brahman überhaupt das gleiche bedeuten. Indessen durchdringt auch nach den Sufi Gott alle Materie. Darum sollen die Menschen stets der geistigen Wesenseinheit mit ihm eingedenk sein, und Gott lieben heißt: sich selbst lieben. Denn zuletzt wird die Seele mit Gott vereinigt. Den Sufismus soll[S. 261] zuerst eine Frau, Rabia, im 8. Jahrhundert bekannt haben; von ihr werden viele schöne Aussprüche mitgeteilt. Die Lehre ist bei vielen ihrer Anhänger in einen Pandeismus und eine Theosophie (Arif) übergegangen. Manche haben sich mit Gott derart verbunden geglaubt, daß sie sich für „Leute der Gewißheit“ hielten und das Studium der heiligen Bücher für ein Dreschen leeren Strohes erklärten. Die Derwische werden ein Zerrbild der philosophischen Sufi bilden, wie die Fakire ein solches der philosophischen Vedantisten. Im Sufismus spielt die Intuition die Rolle, wie in der Theosophie überhaupt. Demut und Ergebung ziehen ihr voraus, vollständiges Aufgehen in Gott folgt. Die Sufi haben sich an der glühend sinnlichen Poesie des Orients in hervorragendstem Maße beteiligt. Es wäre schade, wenn alle Schönheiten dieser Poesie symbolisch gemeint sein sollten. Und ihr größter Lyriker, Mohammed Schemseddin, genannt Hafis (Ehrennamen für jemand, der den Koran auswendig weiß), soll Goethe zu seinem Westöstlichen Divan begeistert haben.
30. Philon von Alexandrien.
Wir kehren zum Abendlande zurück. Den Übergang zu den Neu-Platonikern einerseits und den Gnostikern andererseits gibt die Anschauung Philons, des alexandrinischen Juden (geboren um 30 v. Chr.), die zwischen Platons Philosophie und den biblischen Lehren zu vermitteln suchte. Man rechnet Philon zu den Eklektikern. Eklektiker waren übrigens fast alle hellenistischen Philosophen nach der Stoa. Höchst charakteristisch ist schon, was er von der Schöpfung der Welt sagt: „Gott sah in seiner Göttlichkeit voraus, daß eine schöne Nachahmung nicht würde existieren können, ohne ein schönes Muster, und daß von den sinnlichen Dingen keines tadelfrei sein würde, das nicht einem Vorbilde und einer geistigen Idee nachgeformt worden wäre. Deshalb schuf er, da er diese sichtbare Welt gründen wollte, vorher die nur im Denken vorhandene Welt, damit er nach einem unkörperlichen und gottähnlichen Muster das Körperliche ausführe, dieses ein späteres[S. 262] Abbild des Früheren, ebensoviele sinnliche Dinge umfassend, wie in jenem ideelle enthalten sind. Die Ideenwelt (sie entspricht der Platonischen) nun dürfen wir nicht als an irgendeinem Ort vorhanden uns vorstellen oder bezeichnen.“ Philon nimmt das Beispiel eines Architekten, der eine Stadt gründen will, und führt weiter aus: „Ähnlich muß man es sich in betreff Gottes vorstellen, der, als er die Gründung dieser seiner ungeheuren Stadt überdachte, zuerst die Vorbilder zu derselben ersann und dann eine ideelle Welt aus ihnen zusammensetzte und endlich nach deren Vorbild die Sinneswelt schuf.“ „Es ist offenbar, daß jene vorbildliche Abbildung, die wir die ideelle Welt nennen, selbst das vorbildliche Muster ist, die Idee der Ideen.“ Er nennt diese Idee der Ideen die „Vernunft Gottes“. Gemeint ist eine Idee von den Ideen, so daß wir die absteigende Reihe hätten: Gott, Ideen, Zusammenfassung der Ideen, sinnliche Welt. Und für diese Ansicht führt er die Genesis selbst an: „Es ist dies nämlich die Meinung Mose, nicht die von mir herrührende. Indem er uns die Schöpfung des Menschen erzählt, sagt er ausdrücklich, daß derselbe nach dem Bilde Gottes geschaffen ist. Wenn aber der Teil (der Mensch) ein Bild des Bildes ist, so ist es offenbar auch das Ganze, das heißt die gesamte sinnlich offenbare Welt.“ Und so erklärt sich denn die Unvollkommenheit in der Welt durch die absteigende Bedeutung in der Schöpfungsreihe, und freilich auch dadurch, daß Gott von seiner unendlichen Güte der endlichen Welt nur einen endlichen Teil verliehen hat. Gott selbst ist gänzlich außerhalb der Welt, zu nichts in der Welt in Beziehung; er ist das „Seiende“. Die Idee der Ideen ist der Logos, „der intelligible Ort der intelligiblen Welt“ der zusammengefaßten Ideen. Die „Fleischwerdung des Logos“, um mit dem Evangelisten Johannes zu sprechen, gibt die sinnliche Welt. Und so ist auch der Logos von Philon als Erzengel aufgefaßt, der Mittler zwischen der sinnlichen Welt und Gott, indem er selbst die „Vernunft Gottes“ ist, eine Ausstrahlung Gottes, des absoluten Lichtes.
Zu diesem und zu allem folgenden wollen wir ein ver[S. 263]sinnlichendes Beispiel aus der Natur nehmen. Die Sonne ist, wie wir metaphorisch sagen können, die Lichtgrundquelle, das Licht. Sie sendet mannigfache Strahlen aus: rote, grüne, chemische, wärmende, elektrische usf. Die Strahlen sind nicht die Sonne, haben aber ihren Ursprung in der Sonne; schwindet die Sonne, so vergehen die Strahlen; sie sind ohne sie nichts, die Sonne aber besteht auch ohne die Strahlen. Die einzelnen Strahlenarten würden den einzelnen Ideen entsprechen. Alle zusammen geben sie die Idee der Ideen und entsprechen dem Logos. Denken wir uns, daß sie irgendwo im Raume etwas bewirken, das materiell sich neu geltend macht (wie etwa die chemische Zusammensetzung von Chlor und Wasserstoff zu Salzsäure, oder das Wachsen und Blühen einer Pflanze), so haben wir ein Ähnliches für die Hervorbringung der sinnlichen Welt durch den Logos. Das Beispiel zeigt, daß der Vorwurf, den man Philon und überhaupt allen macht, die zwischen Gott und der Schöpfung vermitteln, daß nämlich die Vermittlung selbst, der Logos, doch auch nur Gott sei, nicht ganz gerechtfertigt ist. In der Tat sind es die Strahlen, welche die Salzsäure zustandebringen, die Pflanze wachsen und blühen lassen; nicht die Sonne selbst tut es, sie ist die Ursache der Strahlen, wie Gott die Ursache des Logos, und dieser seinerseits die Ursache der sinnlichen Welt. Die weitere Entwicklung geht nun dahin, daß die verschiedenen Teile der Welt Materialisierungen verschiedener Ideen innerhalb des Logos sind, durch den Logos. Der Mensch ist Materialisierung der bedeutendsten Ideen; seine Seele enthält sogar von den Ideen selbst, und die Zusammenfassung dieser Ideen ist der Logos im Menschen, seine Intuition, die hiernach von der Denkkraft ein Anderes ist. So enthält der Mensch neben dem Körper auch Strahlen Gottes, die einzeln verschiedene Fähigkeiten seiner Seele bedeuten, zusammen die absolute Einsicht. Diese Lehre kann als Emanationslehre bezeichnet werden, besser aber als Radiationslehre, denn bei Emanation denkt man an Ausfluß von dem Gegenstande selbst, was ja nicht stattfinden soll. Der Mensch hat nichts von Gott selbst in sich, sondern nur von seinen Ideen,[S. 264] seinen Strahlen, wie auch der Logos als Zusammenfassung aller Ideen, aller Strahlen. Bis hierher ist, glaube ich, das System ganz konsequent. Was außerdem vom Menschen und der Seele ausgeführt wird, enthält freilich Schwierigkeiten in reicher Zahl. Der Mensch soll als Mikrokosmos dem Makrokosmos entsprechen, also würde er vom Logos im Kleinen alles enthalten, was der Welt als Ganzes zukommt. Darin soll seine Ebenbildlichkeit Gottes bestehen, er wäre eine Art inkorporierter, in sich zusammengezogener Logos. Das ist schwer zu verstehen; wir müßten denn alle Strahlen, die den Logos ausmachen, einzeln hinlänglich geschwächt uns vorstellen. Wenn weiter dieser Logos dann als Nus (νοῦς) bezeichnet und von der logischen Einsicht abgesondert wird, so müssen wir zwischen der Intuition und der logischen Einsicht einen Unterschied annehmen und jene vielleicht als absolute Einsicht (ohne logisches Denken und Schließen), diese als relative bezeichnen. Nun soll der Nus allein unsterblich, die übrige Seele, die, wie bei den Stoikern die Seele überhaupt (S. 232), materiell gedacht ist, sterblich sein. Die relative Einsicht wird aber gleichfalls als Logos bezeichnet, wie soll sie denn sterblich sein? Auch daß sich, wie Philon lehrt, der Nus soll von Gott trennen können — was offenbar zuliebe denjenigen angenommen ist, die an einen Gott überhaupt nicht glauben — versteht man nicht innerhalb des Systems. Wir können freilich auch für diese Trennung physikalisch ein Analogon bieten. Wenn die Sonne plötzlich keine Strahlen mehr aussendet, so laufen die vorher erregten, wie innen gegen die Sonne zu abgerissen, durch den Raum weiter. Indessen behalten sie doch, wenn auch von der Sonne getrennt, ihre Qualität bei und schreiten fort, wie wenn sie noch mit der Sonne zusammenhingen, nur sich immer weiter innen und nach außen von ihr entfernend, nichts aber in ihrer Art noch in ihrem Gange ändernd.
Wie die Idee der Ideen als Erzengel personifiziert, individualisiert wird, so auch jede Idee oder ein Bündel von Ideen für sich. Daraus resultiert das Heer der Engel, Dämonen, Geister. Die letzteren sind auch Seelen; gehen sie in Körper[S. 265] ein, so verfallen sie der Sinnlichkeit, aus der sie sich in einem Leben oder in mehreren Leben — Philon ist also ein Anhänger von Platons Metempsychose — wieder befreien müssen, wenn sie ihre frühere Göttlichkeit erreichen wollen. Dieses kann man mit der Hauptlehre allerdings nicht in Einklang bringen. Und das liegt eben daran, daß die Strahlen, Kräfte Gottes auch als absolut gut behandelt werden. Ist die Materie gänzlich neutral, so bleibt hier, wie in allen von den gleichen Voraussetzungen (der absoluten Güte Gottes und der Neutralität der Materie) ausgehenden Anschauungen, kein Platz für das Böse, und die Einführung beruht auf Redewendung ohne Grund. Aber das berührt die allgemeine Anschauung des Philosophen nicht.
31. Der Logos und die Sophia.
Der Begriff des Logos ist von so großer Bedeutung geworden, weil der vierte Evangelist ihn zur Grundlage seines Systems gemacht hat. Logos bedeutet ursprünglich das Wort, und so ist es von Luther übersetzt worden. Das „Wort“ aber hat bei Johannes die gleiche Rolle wie der Logos bei Philon. „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfange bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht, und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheinet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen.“ Das ist alles durchaus im Sinne der Philonischen Anschauung; nur daß das „Wort“ noch näher mit Gott verknüpft ist als bei Philon. Logos hat schon früh bei den Griechen die Nebenbedeutung von Gedanke, logische Ordnung, gehabt. Herakleitos aus Ephesos soll bereits gelehrt haben, „das Wesen des Schicksals sei der Logos, der die Substanz des Weltalls durchdringe“. „Alles geschieht nach dem Logos.“ „Der Logos ist ewig.“ „Der Seele ist der Logos eigen, der sich selbst mehrt.“ Letzteres ein Seitenstück zu: „Der Sinn ist dem Menschen Dämon (ἦθος ἀθρώπῳ δαίμων).“ Max Müller stellt diesen Logos mit dem indischen Ritam in Pa[S. 266]rallele, eben der zwingenden Ordnung. Aber das „Wort“ selbst hatte bei den Indiern kosmogonische Bedeutung im Brahma, als Spruch, während der Logos bei Heraklit nicht schöpferisch auftritt, sondern nur als von je vorhanden (ἀεὶ ἐῶν). Erst die Stoiker faßten den Logos auch als schöpferisch auf, indem er bei ihnen die göttliche Vernunft bedeutete. Und so sprachen sie auch gemäß ihrem schon gebildeten Pandeismus von einem Logos in jedem Dinge, von „bekörperten Logoi“, die den Typus der Dinge, ihre „spezifische Qualität“ darstellten; alle die platonischen Ideen real gedacht. So hat sich also die später so wichtige Auffassung des Logos allmählich vorbereitet. Die eigenartige Zwischenstellung des Logos zwischen Gott und der Welt scheint aber vorher nicht gekannt zu sein, denn Platons Ideen sind nicht schöpferisch, weder seine eigenen, noch wie sie Aristoteles auffaßte; sie treten nicht als Mittler zwischen Gott und der Welt auf, daß Gott selbst von der Welt völlig unberührt bliebe. Goethe läßt Faust Logos zuletzt mit „Tat“ übersetzen. Das entspricht der Auffassung Philons sehr nahe, wohl mehr als „Wort“, da die Ideen bei Philon „Kräfte“ Gottes sind („Kraft“ benutzt ja Faust vorher auch). Weiter nennt Philon den Logos den „Sohn Gottes“, den „Einziggeborenen“, den „Erstgeborenen“. Diese Wendung scheint, wenigstens für den Logos (sonst S. 255), vor Philon nicht bekannt gewesen zu sein. Sie ist aber später die wichtigste geworden. Im Evangelium Johannis wird sie auf Christus übertragen: „Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater.“
Noch ein zweites Prinzip bei Philon hat in der Folge große Bedeutung erlangt: die Sophia, die „Weisheit“ Gottes. Während dem „Worte“ in der Bibel nur mit Zwang der Sinn des Philonischen Logos beigelegt werden kann, das „Wort“ dort vielmehr lediglich soviel wie Ruf, Befehl, etwa wie in den ersten Zeilen der Genesis, besagt, nicht mehr, scheint die „Weisheit“ eine besondere Stellung einzunehmen. In den „Sprüchen“ Salomos sagt die „Weisheit“ (Chachma) von sich: „Mich schuf der Ewige als seines Wandels Anfang.“ Sie war, ehe[S. 267] noch die Erde, ehe Meer, Wolken, Himmel waren. „Da war ich Wonne Tag für Tag, Pflegling, spielend vor ihm (vor Gott) aller Zeit.“ Ähnlich könnte man die Aussprüche in Hiob, Kap. 28, interpretieren, wo die Weisheit gleichfalls bei der Schöpfung zugegen ist. Doch wird sie hier zuletzt als „Fürst des Herrn“ erläutert. Der geistvolle Sirachide aber sagt (Sprüche, Kap. 24) ganz sinnfällig von der Weisheit: „Ich ging hervor aus dem Munde des Höchsten, und wie ein Nebeldampf bedeckte ich die Erde. Ich nahm meinen Wohnsitz in der Höhe und mein Thron war auf einer Wolkensäule. Die Himmelswölbung durchkreiste ich allein, und in der Tiefe der Fluten des Chaos wandelte ich.“ Sodann: „Von Ewigkeit her, von Anfang an schuf er mich, und bis in die Ewigkeit werde ich nicht aufhören.“ Dann folgt eine hochpoetische Schilderung, die die Weisheit von sich selbst gibt. Bei Philon scheint die Weisheit mit dem Wort zusammenzufallen: als „Vernunft Gottes“.
32. Die Gnostiker und Manichäer.
Indem wir uns zu den christlichen Gnostikern (Gnosis = Erkenntnis, intuitives Wissen, Offenbarung) wenden, haben wir mit der Schwierigkeit zu kämpfen, daß deren Lehren, abgesehen schon von ihrer Dunkelheit, uns nur bruchstückweise überliefert sind. Die Theosophie unserer Zeit wendet ihnen besondere Aufmerksamkeit zu. Außer den älteren Werken von Baur und Harnack (in seiner Dogmatik) besitzen wir ein zweibändiges Buch von Heinrich Schmitt, das mit schöner Begeisterung geschrieben ist, aber doch auch vieles dunkel läßt, trotz der „Licht“lehre, die die Gnosis sein soll, und das manches enthält, das wie ein Spätprodukt aussieht, und leider viel Allzuüberschwengliches, womit man nichts anzufangen weiß. Es hat in der Gnosis zwei Hauptschulen gegeben, dualistische und monistische. Die ersteren sind von zwei Prinzipien, Gott und Widergott (auch Materie, als widersetzlich gedacht) ausgegangen, die anderen von Gott allein. Und die Lehren sind eine Mischung von Heidentum, Christentum und Philosophie. Sie sollen aber[S. 268] freilich wesentlich dem Heiden-Christentum zugute kommen, obwohl sie sich besonders der Philonischen Emanationslehre anschließen. Von beiden Schulen können nur die bedeutendsten Vertreter hervorgehoben werden. Ich werde mich an die trockene Darstellung der älteren Werke halten, und was Schmitt ausführt zuletzt erwähnen.
Basilides (ein Alexandriner zur Zeit Hadrians) gehört der dualistischen Schule an. Seine Lehre ist eine Emanationslehre. Für den höchsten Begriff wollen wir immer Gott sagen. Gott ist das Absolute und Unerkennbare im Sinne Philons. Aus ihm ist hervorgegangen die Vernunft, aus dieser das Wort und nun in weiterer Reihe: die Vernünftigkeit, die Weisheit, die (sittliche) Kraft, die Gerechtigkeit, der Frieden. Das sind sieben Stufen nach Gott, alle geistig-ethisch. Außerdem sollen Weisheit und Kraft ihrerseits die Tugenden, die geistigen Herrscher, die Engel hervorgebracht haben. Alles wird als reale Emanation Gottes angesehen. Die Engel werden auch als die Ersten genannt und als die Werkmeister der Welt, die Demiurgen. Also Gott schafft selbst die Welt nicht, sondern von ihm emanierte Prinzipien bilden sie. Der weltbildenden Engel aber sind, in stetig abnehmender Vollkommenheit, so viel als der Tage im Jahre, 365. Die weitere Ausführung scheint nun wesentlich in den Bahnen des Zarathustrismus zu laufen. Denn es wird offenbar ein böses Prinzip vorausgesetzt, das, sobald es, wie Ahriman das Reich Ormuzds, das Lichtreich Gottes erblickt, in Widerstreit mit den Engeln gerät. Es entsteht eine „Verwirrung und Vermischung“, letztere wohl der Lichtkräfte mit den Finsterniskräften. Und dabei bilden die Engel die Welt, so gut sie es bei diesem Tohuwabohu vermögen, aus Lichtern mit angehängter Finsternis. Den 365 Engeln entsprechen 365 Himmel oder Welten. Unseren Himmel und unsere Welt hat der erste unter jenen Engeln gewirkt. In diesem für uns eigentlichen Demiurgos soll Basilides den Gott der Bibel gesehen haben, was der Bibel selbst widerspricht, da Jehova gar keine Widersacher hat, noch haben kann. Dieser Demiurgos habe ein Volk sich auserwählt, die Israeliten, und habe ihnen die ganze mensch[S. 269]liche Welt unterwerfen wollen. Dagegen hätten sich die anderen Engel erhoben. Und den Streit zu schlichten, habe Gott Christus, seinen Mittler, in die Welt gesandt. Eine andere Wendung sagt auch, daß Christus in der Regierung der Welt überhaupt die, als nicht hinreichend stark dem Finstern gegenüber erprobten, Engel ablösen sollte. So wacht also über der Welt eine Vorsehung, die von Gott ausgegangen ist und im Mittler ihre wirkende Kraft gefunden hat. Wie die Welt entstanden ist, wird nicht gesagt; die Materie scheint eine Art Mischung von Licht und Finsternis zu sein. Es wäre die Welt eine doppelte Emanation: der Lichtmächte, von oben nach unten, und der Finsternismächte, von unten nach oben. Letztere Emanation ist auch eine Evolution. Die der Lichtmächte wäre im Menschen die bedeutendere. Mit ihr wachse die Intuition. Und die vollkommenen Adepten seien darum auch absolut frei, sogar neben den Engeln. Diese Überhebung soll zur moralischen Verkommenheit vieler Anhänger dieser Lehre geführt haben. Im übrigen wird noch die Seelenwanderung völlig im Sinne der Indier und namentlich Buddhas gelehrt, und in dem Körper-Leben die Strafe für bewußte Sünden, Anhängen an die finstern Mächte in uns, gesehen. Die Läuterung geschieht durch allmähliches Abstreifen der Finsternis, wahrscheinlich in eranischem Sinne (S. 203). Für die unverschuldeten Leiden hatten die Basilidianer den bekannten Jammertrost, daß sie gegen mögliche, in der Anlage vorhandene, Sünden hüten oder warnen sollten.
Dieser Dualismus ist noch in verschiedener Weise durchgeführt worden. Eine Schule (des Hermogenes, Arnobius, Synesius u. a.) nahm als zweites Urwesen die Materie. In Gott sei alles in größter Ordnung, in der Materie in größter Unordnung (beides wie bei Anaximander, Anaxagoras und anderen griechischen Philosophen). Was dort in Ordnung, hier in Unordnung sich befindet, soll das gleiche sein (Bewegung?). Gott bringt nun in die Unordnung der Materie Ordnung hinein; indes, da es sich eben um zwei Urwesen handelt, so weit nur, als das Gute in ihm dem Grade nach das Böse in der Materie überragt. So entstehe und entwickle[S. 270] sich die Welt, indem die Ordnung in Gott für sich schon die Unordnung in der Materie zu ordnen beginne, wie ein Gegenstand die Wünsche lenkt. Und die Welt sei Unordnung neben Ordnung. Die Seele sei aus dem Etwas in der Materie hervorgegangen, oder auch sie sei eine Emanation einer höheren Emanation Gottes, die ihrerseits noch weit von Gott abstehe. Lactantius’ Dualismus enthält Christus als Prinzip des Guten, den Teufel als Prinzip des Bösen, beide von Gott hervorgebracht.
Endlich erwähne ich noch bei den Dualisten den Manichäismus, der diesem Gnostizismus nahe steht. Der Stifter Mani (um die Mitte des 3. Jahrhund. n. Chr.) war ein Perser. Daraus erklärt sich, daß seine Lehre wesentlich alten Zoroastrismus mit verarbeitet. Von Interesse ist, daß jeder Schöpfung im Reiche der Finsternis eine gleichgebildete im Reiche des Lichtes entspricht, was an die eranischen Fervers und Platons Ideen erinnert. Auch die Wendung darf nicht übergangen werden, daß im Kampfe zwischen Licht und Finsternis in manchen Stellen des Universums (in Sonne und Mond) das Licht in bedeutendem Übergewicht sich befindet. Und indem Verwandtes sich anzieht, wirken diese Stellen im Umschwung der Welt wie Schöpfräder und führen mehr und mehr von mit Finsternis behaftetem Licht in die Lichtsphäre. Dieser Prozeß des Heranlockens von Licht durch Licht ist aufgefaßt als eine Kraft des Lichtes (der Physik widerspricht er). Und Christus soll der höchste Walter dieser Kraft sein. Wenn die Manichäer sonst nicht alles physisch betrachteten, würde man die obige Anschauung als eine hübsche Allegorie ansehen, um die Tätigkeit Christi in der Seligmachung der Menschen sinnfällig auszudrücken. Aber was sollen dabei Sonne und Mond? In der Sonne scheinen die Manichäer überhaupt etwas Göttliches gesehen, wenigstens ihr Licht als eine göttliche Offenbarung angenommen zu haben. Auch ging Mani bei ihnen bald aus einem Parakleten in den Erlöser über oder in den heiligen Geist. Er fiel in Persien als Opfer seiner Lehren, da dort gerade die eranische Religion unter dem Einfluß der eben sich erhebenden Sassaniden in den[S. 271] Monotheismus geleitet wurde, der in der Tat mit dem Zarathustrismus an sich nicht unverträglich ist.
Die Lehre des Valentinus (um die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Alexandrien und Zypern), der monistische Gnostizismus, wird als idealistische bezeichnet. Der Anfang ist ein Ururwesen, die absolute Stille, das große Schweigen (Sige, σιγή), und ihm zur Seite als Urwesen das absolute Sich-in-sich-Denken (Ennoia, ἔννοια) und die unergründliche Tiefe, der unergründliche Schoß (Bythos, βυθός). Unter Vermittlung der beiden Urwesen emaniert aus dem Ururwesen der Nus, auch Monogenes (S. 266), der einziggeborene Vater und Grund aller Dinge, der zugleich allein seinen Ursprung, das Ururwesen, fassen kann. Nus wäre die absolute Vernunft, der absolute Geist, Urvernunft, wie wir der Kürze halber sagen wollen. Mit dem Urgeist geht die absolute Wahrheit, Urwahrheit (Aletheia, ἀλήθεια) hervor. Dieses wird so gedeutet, daß Gott an sich nicht begriffen werden kann, sondern nur unter den Gesichtspunkten der Vernunft und der Wahrheit, dem man gewiß zustimmen wird. Aus den beiden letzteren nun emaniert das Wort (der Logos) und das Leben (Zoê). Und aus diesen der geistige Mensch (ἄνθρωπος) und die geistige Gemeinschaft (ἐκκλησία), Kirche. So haben wir mit Bythos und Ennoia (oder Sigê, wie manche sagen) vier Emanationspaare (Syzygien), die die erste Emanationsreihe darstellen, die Urachtheit. Jedes der Paare wird als männlich-weiblich angesehen; das männliche gab das Wesen, die Substanz, das weibliche die Kraft. „Shakespeares Romeo und Julia“, sagt Heinrich Schmitt in seinem genannten Buch, „ist in den herrlichsten Szenen auch nur eine Umschreibung des heiligen Geheimnisses der Syzygie des Valentinus.“ Allein Valentinus wird einfach von der gemein-irdischen Beobachtung des Zeugens durch Mann und Weib ausgegangen sein, und wird dieses Prinzip in die geistige Sphäre erhoben haben. Vielleicht hat er auch nur die ägyptische Achtheit (S. 101) neu gedeutet, die ja auch gepaart ist. Dieses System wird nun weitergeführt. Jede Emanation wird als Aion bezeichnet, ein Name, der Zeitliches bedeutet[S. 272] wie auch Welt. Es bringen nun Logos und Zoê fünf physische, Mensch und Gemeinschaft sechs ethische Aionenpaare durch Emanation hervor. Die Namen kann ich nicht anführen, sie stehen auch nicht alle fest; es finden sich aber darunter solche wie Mischung, Durchdringung, Lust u. a. in den fünf Paaren; Glaube, Liebe, Hoffnung, Einsicht usf. in den sechs Paaren. So haben wir insgesamt jetzt 15 Paare zu 30 Aionen. Diese bilden das berühmte geistige Lichtreich der Fülle, das Plérôma (πλήρωμα). Aber schon in diesem Reich geht die Bedeutung herab mit der Entfernung vom Ururwesen, obwohl noch jeder Aion sich in voller Seligkeit befindet, völlig frei von allem Übel. Die wachsende Beschränktheit bezieht sich auf wachsenden Verlust an Einsicht in das Ururwesen. So steht jedem Aion der Hóros (ὄρος), die Grenze, zur Seite und hält ihn in sich zusammengefaßt.
Nun heißt es, daß der letzte weibliche Aion, die himmlische Weisheit, Sophia, vor Sehnsucht nach dem Ururwesen in leidenschaftliche Wallung geriet, sich von ihrem männlichen Part abwandte und nach dem Ururwesen, stürmend, begehrte. Sie wird zwar von ihrem Hóros in sich zurückgeführt, aber der Abfall von ihrer Bestimmung bleibt. Jetzt bringt das Aionenpaar Vernunft und Wahrheit das neue Paar Christus und den Heiligen Geist hervor, die das Reich der Fülle in sich festigen, derart, daß jeder Aion das ganze Pleroma in sich erkennt, und wenigstens in dieser Beziehung die Sehnsucht gestillt wird, wenn auch nicht die nach dem Höchsten. Wie in früheren Systemen ist auch hier alles übersinnlich vorgebildet, was der sinnlichen Welt angehört, das zeigt sich ja schon in den Paaren. Und so hat auch die Leidenschaft der Sophia, ihr Sichvergessen, den Grund alles Übels in der Welt. Denn diese Leidenschaft, als Achamoth von ihr getrennt gedacht, geht in die sinnliche Welt. Aus der Sophia also, weil ohne Zusammenwirken mit ihrem männlichen Aion, entsteht die sinnliche Welt. Diese Welt ist keine rechte Emanation mehr, sondern eher ein Akzidens des letzten weiblichen Aion nach dem Abfall. Da sie aber immerhin von einem Aion stammt, der das ganze übersinnliche[S. 273] Reich in sich vorstellt, so enthält sie alles Übersinnliche in sinnlichen Bildern, gleicherweise also auch das Lebende, das Geistige und Wahrheitliche usf. und das Leidenschaftlich-Üble. Wie die sinnliche Welt entsteht, ist schwer zu ersehen. Eine hübsche Auslegung besagt, daß aus den vier Äußerungen der Leidenschaft (Achamoth) die vier Elemente erwachsen sind: aus den Tränen das Nasse, aus dem Lachen das Feurige, Lichte, aus der Traurigkeit das Dunkle, Starre, aus der Furcht das Bewegliche, Luftige. Aber es wird auch sehr vieles andere erzählt; so namentlich das Befremdende, daß Christus aus Mitleid die Gedanken des abgefallenen Aion in der Materie nachgestaltet habe. Das Wesentliche bleibt: die Welt ein Produkt aus Tun und Leiden und aus dem Lichtreich, dem Pleroma, als Folge und infolge eines Abfalles hervorgegangen. Achamoth spielt die Rolle des Demiurgs, die Weltseele ist ihr Erzeugnis wie die Welt. Nach einer anderen Wendung ist sogar erst diese Weltseele, und zwar ganz unbewußt, der Weltbildner. Und so sinkt die Welt allerdings immer tiefer in der Reihe des Göttlichen, einer blinden Naturkraft verdankt sie ihre Entstehung. Und diese Naturkraft führt den Plan ihrer Mutter, Achamoth, auch ohne diese und ihren Plan zu kennen, aus und pflanzt der Welt auch das Lebende und Geistige ein. Mit dem letzteren aber hat der Mensch ein Übersinnliches, wenn auch nur im Abbild, gewonnen; insgesamt besteht er aus Materie (ὕλη), Seele (ψυχή) und Geist (πνεῦμα). Und es wird von materiellen, psychischen und geistigen Menschen (Hylikern, Psychikern und Pneumatikern) gesprochen. Heiden, Juden und Eingeweihte bedeuten die Muster für diese Dreiteilung. Materie und Seele sind vergänglich, ewig besteht nur der Geist. Es scheint, als wenn die rein materiellen Menschen als Ausflüsse besonderer Prinzipe angesehen werden, der Archonten (Herrscher), die zwischen dem himmlischen Reich des Lichtes und dem irdischen weilen und vielleicht tiefere Emanationen des Demiurg sind. Zu ihnen wird der Dämon Adamas gehören (der alte Adam in uns), der die Rolle des Teufels im System vertritt. Aber vielleicht hat man eine weitere unterweltliche Emanation angenommen, deren Archon Adamas ist,[S. 274] höllische Geister und Teufel. Christus, wie er nach dem Fall der Weisheit die Äonenwelt geordnet, führt auch die Welt immer mehr dem Geistigen zu, dem Lichtreiche. Und am Ende der Tage wird er der Welt-Naturkraft das Bewußtsein ihrer Wesenseinheit mit Achamoth verleihen, daß der Demiurg in Achamoth aufgeht, Achamoth aber sich mit Sophia vereinigt. Und alles Materielle und alle Seelen verglühen in einem allgemeinen sich selbst aufzehrenden Weltfeuer. Die Geister aber schweben in das Lichtreich zu den ihnen vorgebildeten Aionen und verschwimmen mit ihnen zu ewiger Ruhe. Der wahre Schluß wäre erreicht, wenn auch diese Aionen in das Universum eingingen, in das große Schweigen, bis vielleicht neue Aionen und neue Welten den Kreis der Offenbarungen des Ururwesens durchlaufen. So in ewiger Reihe.
Valentinus soll Verfasser des Buches Pistis Sophia (Glaube Weisheit) sein, das Schmitt als das Gnostikerevangelium bezeichnet. In diesem Buche läßt er Christus selbst, nach seiner Verklärung, im unendlichen Lichte noch einmal seinen Jüngern erscheinen und das Geheimnis des Irdischen und Überirdischen offenbaren. Adolf Harnack denkt von den Gnostikern ziemlich hoch. Von ihren Lehren sagt er (Dogmengeschichte): „So entstand ein philosophisches dramatisches Gedicht, dem Platonischen ähnlich, aber ungleich komplizierter und darum phantastischer, in dem gewaltige Mächte, das Geistige und Gute mit dem Materiellen und Schlechten, in eine unheilvolle Verbindung gesetzt erscheinen, aus der aber schließlich das Geistige, unterstützt durch die stammverwandten Mächte, die zu erhaben sind, um je in das Gemeine herabgezogen zu werden, doch wieder befreit wird.“ Namentlich das System des Valentinus verdient wohl diese bedeutenden Worte des großen Theologen. Heinrich Schmitt sieht aber in diesen Lehren überhaupt das Höchste, was Menschengeist ersonnen hat: wahre, absolute Offenbarung, und in Valentinus den größten intuitiven Denker. „An der lebendigen Wirklichkeit und Wahrheit des Pleroma zweifeln,“ sagt er, „bedeutet soviel wie an der Wahrheit des[S. 275] mathematischen Bewußtseins zweifeln, denn seine höchsten Formen sind nur die vollendete Selbsterkenntnis des mathematischen Bewußtseins.“ Das „mathematische Bewußtsein“ steht hier wohl für formale Logik, denn die Wahrheit der Mathematik geht nur so weit wie die der formalen Logik. Diese allein ist intuitiv absolut wahr. Die Grundlagen der Mathematik, die Axiome, sind nur Behauptungen, denen die Erfahrung bisher noch nicht widersprochen hat.
Zuletzt möchte ich den Leser auf eine merkwürdige Stelle in Goethes „Dichtung und Wahrheit“ hinweisen, fast am Schluß des achten Buches. Gott erscheint sich in seiner Produktion zunächst als Zweites, das wir den Sohn nennen. Gott und Sohn wieder erscheinen sich im Dritten (Heiliger Geist). Nun sagt unser Olympier: „Hiermit war jedoch der Kreis der Gottheit geschlossen, und es wäre ihnen selbst nicht möglich gewesen, abermals ein ihnen völlig Gleiches hervorzubringen. Da jedoch der Produktionstrieb immer fortging, so erschufen sie ein Viertes, das aber schon in sich einen Widerspruch hegte, indem es, wie sie, unbedingt und doch zugleich in ihnen enthalten und durch sie begrenzt sein sollte. Dieses war nun Luzifer, welchem von nun an die ganze Schöpfungskraft übertragen war.“ Luzifer schafft die Engel, unbedingte, aber nun in ihm enthaltene Wesen. „Umgeben von einer solchen Glorie vergaß er seines höheren Ursprunges und glaubte ihn in sich selbst zu finden, und aus diesem ersten Undank entsprang alles, was uns nicht mit dem Sinne und den Absichten der Gottheit übereinzustimmen scheint.“ Das Heer der Engel teilt sich, ein Teil konzentriert sich mit Luzifer, der andere wendet sich seinem Ursprunge zu. „Aus dieser Konzentration der ganzen Schöpfung, denn sie war von Luzifer ausgegangen und mußte ihm folgen, entsprang nun alles das, was wir unter der Gestalt der Materie gewahr werden, was wir uns als schwer, fest und finster vorstellen, welches aber, indem es, wenn auch nicht unmittelbar, doch durch Filiation vom göttlichen Wesen herstammt, ebenso unbedingt mächtig und ewig ist als der Vater und die Großeltern.“ Goethe meint nun, durch die stetige Konzentration ohne die[S. 276] Expansion hätte die Welt samt Luzifer sich zuletzt doch aufgerieben. Darum verleihen nun die „Elohim“ in einem Augenblick „dem unendlichen Sein die Fähigkeit, sich auszudehnen, sich gegen sie zu bewegen; der eigentliche Puls des Lebens war wiederhergestellt.“ „Dieses ist die Epoche, wo dasjenige hervortrat, was wir als Licht kennen, und wo dasjenige begann, was wir mit dem Worte Schöpfung zu bezeichnen pflegen.“ Was von der Expansion hier gesagt ist, liegt ganz im Sinne des Valentinus, denn dieser nimmt gerade die Sehnsucht (πάθη) nach oben, als den Aionen eigen, die zwar Sophia zum Abfall bringt, aber doch zuletzt die Welt zu Gott zurückführt. Bewegung nach unten und nach oben ist die Grundidee des Gnostikers wie des Dichters, und übrigens auch griechischer Naturphilosophen. Der Mensch soll auch nach unserem Dichter das Vermittelnde zwischen oben und unten sein. So sicher legte sich der junge Goethe, was er von den gnostischen Lehren las, zurecht. Schon in den ersten Gesprächen, die wir von ihm noch besitzen, finden sich die Ideen der Konzentration und Expansion. Und damit vergleiche man aus dem späteren Zyklus „Gott und Welt“ die schöne Strophe:
Die gnostischen Lehren sollen ihren Ursprung von dem rätselhaften samaritanischen Messias Simon Magus genommen haben. Harnack sagt, daß seine Existenz und seine hohe geschichtliche Bedeutung nicht geleugnet werden können. Er lebte zugleich mit Petrus, in heftigem Widerstreit zu ihm, der seinen Zauber durch Gottes Wort zunichte machte. Übrigens gibt es der gnostischen Schulen viele, wie die Doketen, Peraten, Ophiten usf. Jede Schule lehrte noch etwas Besonderes. Doch Askese, Okkultismus, Astrologie und Magie zeigten sich überall. Darauf habe ich nicht einzugehen.
33. Der Neuplatonismus.
Wir wenden uns nunmehr den neuplatonischen Lehren zu, die mit den gnostischen eine gewisse Verwandtschaft haben, im Grunde die heidnische Gnosis bedeuten. Der Urheber war ein Lastträger, Ammonios Sakkâs zu Alexandrien (Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr.), der eigentliche Begründer Plotinos (204–270 n. Chr.), in Ägypten geboren und des ersteren Schüler; Longinus, Porphyrios und Jamblichos sind die Emendatoren und Interpreten. Die Philosophie, um deren Wiederbelebung es sich handelt, ist zwar die platonische, aber das Ganze zeigt sich mit Pythagoreertum und Stoischem gemischt und stellt eine Theosophie dar, weshalb die Behandlung hier erfolgt. Gott als Urwesen steht über allem Denken und Sein; selbst das Bewußtsein gehört nicht zu seinen Eigenschaften, er ist überhaupt absolut eigenschaftslos. Ihn zu erkennen ist daher nur Sache der reinen Intuition. Daher betrachtet Plotinos alles Wahrnehmen, selbst alles Denken, wie wir es kennen, als gänzlich belanglos. „Im Himmel bedürfen die Seelen der Worte nicht; dort ist kein verständiges Denken und nicht das Vernünftige in unserem Sein.“ Wir werden das im Mittelalter wiederfinden, bis zu völliger Verachtung aller Wissenschaft. Und von Goethe erzählt Kestner (Gespräche Bd. I, S. 22): „Er strebt nach Wahrheit, hält jedoch mehr vom Gefühl derselben, als von ihrer Demonstration.“ Das Wahrnehmen ist ein Leiden und eine beschwerliche Notwendigkeit für die Seele, hervorgehend aus der allgemeinen Sympathie der Dinge in der Welt, und das Leben bedeutet kaum mehr als ein Traum. Einzig die Intuition hilft: „Was die übersinnliche Wahrheit ist, weiß der, der sie sieht.“ Eben diese Intuition stempelt die neuplatonische Philosophie zu einer Theosophie. Und Plotinos behauptet selbst, „oftmals das gepriesene Schauen des Göttlichen und die Einigung mit ihm erfahren zu haben“. Überhaupt ist der Mensch niemals von Gott getrennt. „Wir haben das Eins (Gott), wenn wir es auch nicht sagen“; vielleicht auch, wenn wir es nicht bewußt sind. Sind wir es bewußt, so hört das Eigen[S. 278]bewußtsein auf. Das ist eigentlich der Standpunkt des Indiers der Upanishaden. Die Intuition gilt höher selbst als die Vernunft. Gott weilt überall, aber nicht in den Dingen. Es ist eine Konzession an das Menschenherz, wenn Gott auch das absolut Gute genannt wird, und an die Kausalität, wenn er auch Urgrund (ἀρχή) bedeutet. An sich steht Gott in gar keiner Beziehung zu irgend etwas. Es ist dann freilich schwer zu verstehen, wie selbst die Intuition ihn fassen und mit dem Einen eins sein soll. Nun folgt eine Art Emanationslehre. Gleich einer Quelle, die Wasser aussendet und dabei doch Quelle unvermindert bleibt, warf das Eins ein Zweites aus sich heraus, den Nus, den wir schon kennen, die absolute Vernunft, die absolute Intuition. Als Zweites ist es unvollkommener denn das Erste; es ist aber absolute Vernunft, weil es das Erste geschaut hat. Sonst ist es ein übersinnlich Seiendes, ein Lebendes und Vermögendes. Hier sind offenbar mehrere Aionen der Gnostiker in einen Aion vereinigt. Auch darin liegt Gnostisches, daß nun der sinnlichen Materie entsprechend eine übersinnliche gesetzt wird, welche nichts anderes ist als die Allgemeinheit der Vernunft. Die Vernunft ist hiernach eine Einheit in sich, aber doch eine Mannigfaltigkeit, ein κόσμος νοητός, gegenüber dem Einen, das sie umgibt wie ein Kreis seine Mitte. Eine Emanation der Vernunft ist nun die absolute Seele, ein Gedanke, ein Logos von ihr. Wie die Vernunft alle Arten des Denkens, so faßt ihre Emanation Seele alle Arten des Seins zusammen, sie steht aber schon an der Grenze des übersinnlichen Reiches. Plotinos’ Pleroma, um gnostisch zu reden, ist also recht beschränkt, denn auch die absolute Seele begreift viele Aionen in sich. Und so besteht das erste Universum mit dem Urwesen (τό πρῶτον) nur aus dieser Dreiheit: Ureins, Urvernunft, Urseele. Plotinos war eben Heide.
Die absolute Seele bringt die Weltseele hervor. Und diese ist mit der Welt so verbunden wie die Menschenseele mit dem Leib. Sie ist aber so mannigfaltig wie die absolute Seele, und so gehört sie allen Teilen der Welt an. Die Welt wieder, als Materie gedacht, schafft sich die zweite Seele selbst, unbewußt, wie der[S. 279] Demiurg der Gnostiker. Die Emanation tritt als Drang, Notwendigkeit auf. Da aber die zweite Seele doch Emanation der übersinnlichen ersten Seele, und diese Emanation der absoluten Vernunft ist, muß sich die Welt immerhin als so gut als möglich und so schön als möglich geordnet erweisen. Die zweite Seele prägt ihr auch von ihrem Übersinnlichen ein. Das kann wegen der Unfähigkeit der Materie nur allmählich geschehen; in diesem allmählichen Aufnehmen des Übersinnlichen beruht, was wir Zeit nennen. Da ferner alle Seelen die zweite Seele sind, so besteht zwischen ihnen, also zwischen den Dingen, ein Zusammenhang, eine „Sympathie“, was wir noch oft und später, in anderer Form, auch bei den Leibnizschen Monaden wiederfinden werden. Diese Sympathie bewirkt es, daß keinem Dinge etwas widerfahren kann, das nicht alle Dinge mitempfinden. Ferner führen die Seelen, wie bei den Gnostikern, als von oben stammend und nach unten (wenn auch passiv) wirkend, ein Doppelleben, zur Höhe und zur Tiefe. Die Materie aber ist der Gegenpol im Ganzen zu dem Urwesen, und an der Grenze des Seins das Mangelhafte, das Böse. Das Leben zeigt verschiedene Grade, aber alles hat Seele. Wir finden so einen monistischen Idealismus, der zu einem Panpsychismus geführt hat; selbst leblosen Körpern kommt eine Seele zu, wie der Erde, den Steinen. Eine Auflösung der Welt erfolgt nicht; die Welt bleibt, nachdem sie entstanden, ewig. Ewig strahlen auch die Seelen in die Materie hinein, aber ihr Zusammenhang mit der Materie ist nur ein scheinbarer. Da die Materie doch auch nur Emanation der Seelen sein soll, muß angenommen werden, daß überhaupt die Emanationen miteinander an sich ohne Verbindung sind. Nur die Gemeinschaft des letzten Ursprunges hält sie zusammen. In der Tat lehrt Plotinos auch eine gewisse Willensfreiheit. Und doch wird die Sucht nach Selbständigkeit als Ursprung alles Bösen betrachtet (wie in Goethes „Weltbild“) und alles Niedrigen, wie von allem Leben die Pflanze das niedrigste sein soll, da jede für sich allein steht. Die reinste Seele kommt dem Himmel (Zeus?) zu. Diese ist ganz in sich zusammen[S. 280]gezogen und folgt nur ihren absoluten ehernen Gesetzen. Dann haben wir die Seelen der Gestirne. Und so werden auch Himmel und Gestirne wie Götter behandelt; sie haben aber bloß die der ersten absoluten Seele nächststehenden Manifestationen der Weltseele. Mit der Welt hängen sie nur durch die „Sympathie der Dinge“ zusammen, sonst sind sie in bezug auf diese, wie alles, passiv. Tatsächlich liegt das Gesetz der Welt, die Vorsehung, nur in der absoluten Vernunft. Nach den sichtbaren Göttern kommen die Dämonen und dann die Menschen, Tiere, Pflanzen usf. Des Menschen Aufgabe im Leben ist die Katharsis, die Reinigung von allem Irdischen, verbunden mit Sichversenken, die zur Intuition führt. Jede Seele kann durch Dämonen, Götter und Himmel zurück zum Lichtreich gelangen. Die Schule der Neuplatoniker lehrte denn auch Seelenwanderung.
Man sieht, wie in den Emanationslehren die Emanationen so verschieden angegeben sich finden. In manchen Systemen werden Urwesen und Emanationen nach Triaden als πατήρ, δύναμις, νοῦς geordnet (S. 255). Der mit dem Pseudonym Dionysios der Areopagite (ein unbekannter christlicher Neuplatoniker, der um 500 n. Chr. gelebt haben mag) bezeichnete Schriftsteller, der einen so merkwürdigen Einfluß auf die mittelalterlichen Religionsphilosophen ausgeübt hat, zählt als Hierarchie drei Triaden zu je drei Abteilungen von Emanationen auf. Die erste Trias besteht aus den Seraphim, die von Gott, den Cherubim, die von den Seraphim, und den Thronen (festen Naturen), die von den Cherubim erleuchtet werden. Dann folgen in den nächsten Triaden: die Archonten, Tugenden, Mächte; Prinzipes, Erzengel und Engel, die immer weiter das göttliche Licht durch Überlieferung verbreiten, aber in immer geschwächterer Form, bis es zum Menschen gelangt. Doch kann der Mensch zu den Engeln sich emporheben, ja noch höher, bis zu Gott, wie er auch selbst Licht zu verbreiten weiß. Der himmlischen Hierarchie sollte die kirchliche entsprechen. Die Kirche als Aion hat schon Basilides aufgestellt. Bei Dionysios erscheint das ganze Pleroma als über[S. 281]sinnliche Kirche. Fünf Stadien hätte der Mensch zu durchlaufen bis zur Vergottung: Reinigung, Erleuchtung, Weihung, Vergöttlichung, Aufgehen in Gott. Sie bilden das große Mysterium, das, wie man sieht, indisch ausläuft, und zu entsprechenden Mystizismen und Verzückungen geführt hat.
34. Übergang zum Mittelalter; Augustinus, Scotus Erigena.
Schon lange vor Dionysios mußte die Kirchenlehre mehr und mehr in die Anschauungen eingreifen, und nachdem der Evangelist Johannes Christus mit dem Logos identifiziert hatte, war es nur folgerichtig, daß nun allmählich Christus die weltschöpferische Rolle übernahm. Gleichwohl konnte die völlige Hinausschiebung Gottes in das absolut Untätige, entgegen dem deutlichen Bibelworte, nicht ohne Widerspruch bleiben. Hieraus ist dann der durch das ganze Mittelalter und darüber hinaus sich fortsetzende Streit über das Wesen Gottes und über das Verhältnis der drei Einheiten zueinander entstanden, der durch ein Glaubensbekenntnis allein naturgemäß nicht geschlichtet werden konnte. Diesem Streit zu folgen ist nicht meine Aufgabe. Wir finden aber in allen theosophischen Lehren die Rolle Gottes bald aktiv, bald passiv aufgefaßt. Und seltsamerweise mußte sie für das Volk wie für den verstandesmächtigen Philosophen immer passiver werden, für diesen aus tiefer Überlegung der Hoheit des Gottesbegriffes, für jenes aus Zurückdrängung Gottes durch die Zwischenstufen. Ja auch diese Zwischenstufen wurden je höher, je mehr vom Volke in die neutrale Ferne gerückt. Und wie die Macht der menschlich so schönen und rührenden Gestalt der Himmelskönigin zunahm, und die Heiligen mit ihren Wundern im Leben und im Tode sich überall einschoben, mußten zuletzt auch die beiden anderen Einheiten der Trinität fast passiv werden, um so mehr passiv, je genauer ihre Verbindung mit Gott selbst gedacht und geglaubt wurde. Es kam noch ein anderes hinzu, was die poetischen Systeme der Theosophen abseits drängte und[S. 282] zersetzte: die ständig wachsende Macht der Aristotelischen Lehre, die, an Stelle der lebenden Gestalten der Ideen Platons und der Emanationen, in den Formen dialektische Bilder brachte und für die lichtgewobenen Schönheiten potentielle Realitäten gab. Gleichwohl finden wir Emanationslehren noch das ganze Mittelalter hindurch und sehen sie am Beginn der Neuzeit und in unserer Zeit mit außerordentlicher Kraft sich wieder beleben. Sie sind eben schöne Dichtungen und für den Menschen durch die Stellung, die sie ihm im Universum verleihen, auch sehr schmeichelnd und Unendlichkeit verheißend. Bringen wir zunächst für das Mittelalter noch einige Angaben.
Der große Kirchenvater Aurelius Augustinus (geb. 354 zu Thagaste in Afrika, gest. 430 als Bischof von Hippo Regius ebenda), das Licht der patristischen Philosophie, gehört nicht eigentlich zu den Theosophen. Seine Anschauung muß aber kurz skizziert werden, weil sie von so außerordentlichem Einfluß auf die des ganzen Mittelalters gewesen ist. Gott hat die Welt geschaffen: Allein nicht aus sich, sondern als Evolution in Zeit und Raum aus dem Nichts (Platons Nichtseiendes?). Daher kann die Welt die Vollkommenheit Gottes nicht besitzen. Sie ist nur für sich vollkommen, gegen Gott aber unvollkommen. Gleichwohl wird für alles und jedes sein Grund in Gott verlegt. Nur eine Weisheit besteht, in dieser sind die unendlichen unbegrenzten Schätze der intelligiblen Dinge (Rerum intelligibilium); letztere enthalten alle unfehlbaren und unveränderlichen Gründe (rationes) der Dinge, auch der sichtbaren und veränderlichen, welche durch sie (die Weisheit Gottes) geschaffen sind. Denn Gott hat nichts nichtwissend geschaffen; hat er aber wissend geschaffen, so hat er es so weit geschaffen, als er es wußte. In der Tat ist ja das Nichts qualitätlos. Es liegt in solchen Anschauungen zweifellos etwas Neuplatonisches, Theosophisches, und Augustinus ist auch der Ansicht, daß das bloße offenbarende Wort, die Schrift, nichts ist ohne die Bestätigung des göttlichen Geistes in uns, also durch Intuition erst Realität gewinnt. Aber im Grunde läßt er das Problem des Bösen in der[S. 283] Welt doch auch ungelöst; Unvollkommenheit ist noch kein Böses, wenigstens sträubt sich unser menschliches Gefühl gegen eine solche Ansicht. Denn wenn wir auch zugeben, daß aus Passivität Anderen Unheil erwachsen kann, so ist doch das Böse für uns ein durchaus aktiver Begriff. Eher vermöchten wir das Schlimme, das uns selbst im Leben widerfährt, Krankheit, Verlust usf., der Unvollkommenheit der Welt zuzuschreiben. Aber wir können nicht umhin, dem Bösen auch eine ethische Bedeutung beizumessen; und dann ist es aus einer Unvollkommenheit der Welt nicht abzuleiten, namentlich nicht, wenn es bewußt auftritt. Augustinus’ Lehre ist eben optimistisch, und eine solche Lehre hat keine andere Erklärung für das Schlechte als die Redewendung: „Das Böse oder das Übel bezeichnet nur die Beraubung des Guten (privatio boni)“, welche eben nur Redewendung ist für etwas, das wir nicht ergründen können. Wenn wir Gott theologisch-religiös auffassen und ihn aktiv allein und aus Nichts und gegen Nichts die Welt schaffend annehmen, so bleibt mindestens das Bewußt-Schlechte unerklärt. Und das ist es auch in der Folge geblieben, die bei weitem theologischer verfährt als der bei allem Aberglauben so geistvolle und hochdenkende Kirchenvater. Seine Ansicht von der Welt als Einheit mit absoluter Ordnung der Entwicklung unterscheidet sich von den reinmaterialistischen Anschauungen, die wir noch kennen lernen werden, nur durch den Grund der Einheit und Ordnung, denn sogar die Wunder reiht er in diese Ordnung ein, so daß sie zur Natur zählen. Der Materialist setzt keinen Grund, für Augustinus ist der Grund im Schöpfer und Lenker der Welt. Und so gehören ihm zur Natur auch die Engel. Und er hat nicht übel Lust, denen zu folgen, die im Himmel und den Gestirnen zwar auch nur Dinge der Natur sehen, aber höhergestellte als Mensch und andere Wesen (S. 289). Alles dieses, zum Teil vergröbert, aber auch durch den Einfluß der Aristotelischen Philosophie mehr ins Abstrakte gewendet, finden wir namentlich auch bei den Scholastikern.
Johannes Scotus Erigena (um das 9. Jahrhundert in[S. 284] Irland geboren) läßt in einer seiner mehreren Ansichten alles von Gott emaniert sein. Gottes Klarheit, welche mit Recht auch Dunkelheit genannt wird, breite sich über alles aus. Die ungeformte Materie soll nur das Unendliche bedeuten, welches, da es formlos sei, alle Formen in sich enthalte. Gott hat die Welt aus seinem eigenen Wesen gebildet. Jedes Geschöpf ist eine Theophanie, ein Sichoffenbarmachen Gottes. Gott sei an sich vorhanden wie ein Gedanke im Menschen bestehe; er manifestiere sich in der Welt durch sich selbst, wie ein Gedanke, der sich denkt, sich selbst zur Erkenntnis komme. So sei Gott ohne die Welt absolut negativ. Es klingt wie eine Blasphemie, wenn gesagt wird, Gott wisse nicht, was er sei, und er werde erst geschaffen mit der Schöpfung, indem er sich in seiner Schöpfung offenbart, die Schöpfung so aus Nichts hervorbringend. Das ist auch fast so abstrakt wie die indische Tad-Anschauung. Freilich bleibt es bei diesem absoluten, und ja auch nicht zu durchdringenden, Pandeismus nicht. Wie der Indier muß Scotus Gott doch etwas zuschreiben, Willen, und die Geschöpfe sind dann Willensakte. Der Wille ist persönlich als Emanation Gottes (als Christus) gedacht, wie wohl auch die Ursachen (zusammengefaßt als Heiliger Geist), die Scotus von Gott ausgehen läßt, Emanationen sind, und die Wirkungen, die wieder von ihnen ausgehen, Emanationen ihrer selbst darstellen. So ist Christus der Urheber, und der Heilige Geist der Vollender der Welt (Pater vult, filius facit, spiritus sanctus perficit, heißt die berühmte Formel). Die Ursachen müssen als verschieden voneinander angesehen worden sein, und weil sie Emanationen gleicher Ordnung bedeuten sollten, besteht kein Rang zwischen ihnen, also auch keine Folge ihrer Wirkungen. Es wird nun jedes Geschöpf als eine Art Mikrokosmos angesehen, indem aber die Ursachen in ihm sich in beliebiger Folge geltend machen können, soll es eine allgemeine Folge auch des Denkens nicht geben. Das ist freilich ein Schluß, der den Weg zur absoluten Wahrheit, das heißt zur Erkennung des Ganzen im Mannigfaltigen versperrt; Jeder faßt nach seiner Weise sich und die Welt auf. Da Jeder aber eine Theophanie darstellt, so[S. 285] ist seine Auffassung eine reale. Die Welt hat so viele Gestaltungen als Geschöpfe sind, alle diese Gestaltungen sind die ganze Welt. Indessen wird doch auch eine Abstufung in den Geschöpfen angenommen. Und als ein unergründliches Geheimnis — darin verborgen, daß Gott alles nach Maß und Zahl und Gewicht geschaffen habe — wird es bezeichnet, daß jedes Geschöpf in der Ekstase, also intuitiv, Gott (incomprehensibilem et inintelligibilem causam) in seiner nächsthöheren Theophanie (proxima illi theophania) „von Angesicht zu Angesicht“ erkenne. So konstatiert Scotus eine Harmonie in der Welt, in der alles, selbst die Materie, eben als Theophanie, unvergänglich ist, selbst jeder Gedanke, jedes gute oder böse Wollen; aber ohne jede „Sympathie der Dinge“. Eine solche Welt würde es eher verstehen machen, wenn wir, nachdem Jahrtausende hindurch Menschenliebe gepredigt worden ist, uns Vorträge halten lassen über den ethischen Wert des gegenseitigen Sichtotschlagens. Da die irdische Welt die letzte aller Emanationen ist, so schafft sie selbst nichts wirklich; sie scheint nur zu schaffen, und so ist sie auch Nichts, und sie wird mit allem untergehen, was in ihr ist. Ewig ist nur das Geistige, und durch das Geistige findet die Rückkehr zum Ursprung zurück, die Erkenntnis Gottes in uns (als Theophanie). Das System ist idealistisch-monistisch, und so fehlt auch eine wirkliche Erklärung des Bösen in der Welt. Es wird nur eine indirekte doppelte Prädestination gelehrt. Gott hat die Zahl der Guten und Bösen vorherbestimmt, die letzteren jedoch nur als notwendigen Gegensatz zu den Guten. Damit ist der Begriff des Guten und Bösen als solcher aufgehoben, es tritt nur die Relativität ein, und diese ist vergänglich. Wenn der Leser fragt: wie hat sich der Philosoph mit der Kirchenlehre abgefunden? so kann man ihm nur antworten: wie ein souveräner Denker, gar nicht! Da er aber gleichwohl dem orthodoxen Glaubensbekenntnis angehört, so haben wir ein Beispiel der „doppelten Wahrheit“, die immer auftritt, wo Glaube und Denken nebeneinander wirken, und die so oft gegen herrschende Gewalt aushelfen muß. Auch stand Scotus erst am Beginne des dunklen Mittelalters und[S. 286] blieb auch für mehrere Jahrhunderte der bedeutendste Denker der christlichen Welt. Seine Emanationslehre hat aber etwas Nordisch-Düsteres, das Universum ist für ihn kein „überschäumendes Licht“ wie für die südlichen Emanisten.
35. Islamisch-arabische Theosophien.
Wir unterbrechen hier die Betrachtung der christlichen Theosophie, um uns erst zu der islamisch-arabischen und der jüdischen Philosophie zu wenden. Beide haben auf den Gang der christlichen Philosophie im Mittelalter einen bedeutenden Einfluß gehabt, nicht allein indirekt durch Verbreitung namentlich der Aristotelischen Anschauungen, sondern auch unmittelbar, indem vieles von ihren Lehren auf jene überging. Der Mohammedaner steht dem Koran gegenüber gebundener da als wir der Bibel, denn der Koran enthält wenig Erzählung, an die man glauben soll, sondern vor allem Lehre. Nimmt der Moslem diese nicht an, so ist er eben kein Moslem. Daher können mohammedanische Anschauungen, solange sie eben mohammedanisch sind, nur Besonderes betreffen, worin der Koran der Deutung Spielraum läßt. Liberal und orthodox kann sich hier nur auf die Auslegung gewisser Einzelheiten beziehen. Aber diese Einzelheiten gehen wie überall eben auf die Grundfragen der Menschheit. Und in diesen hat Mohammed keine andere Lösung vorbereitet, als wir sie in unseren heiligen Schriften finden. Daher die Verwandtschaft zwischen den mohammedanischen Auslegungen und den unsrigen auch dort, wo auf dem Boden des Bekenntnisses stehengeblieben, also von der eigentlichen Religionslehre nicht abgewichen wird. Diese Verwandtschaft ist naturgemäß größer mit den jüdischen Auslegungen als mit den christlichen, da die Trinität dem Islamismus wie dem Mosaismus fehlt, beide also nur von Gott Rechenschaft sich zu geben haben, während im Christentum noch von der Wesenseinheit Christi und des Heiligen Geistes mit Gott die Klarheit gewonnen werden muß. Wir behandeln zunächst die Anschauungen zweier islamischen Sekten, die sich in der Tat[S. 287] wie Kirchlich-Liberale und Kirchlich-Orthodoxe gegenüberstehen, während beide doch kirchlich sind. Wir würden sie nach den Auseinandersetzungen über religiöse Anschauungen im voraufgehenden Buche sowenig zu erwähnen brauchen wie jüdisch- oder christlich-kirchliche Anschauungen, wenn sie nicht einige Wendungen hätten, die gerade hierher gehören.
Zunächst die Anschauungen der freieren Sekte der Muatazile (Mu’tazila, die Sichabsondernden). Sie nehmen an, daß Gott bei der Erschaffung der Welt, die in ihm mit allen ihren Eigenschaften als eine Möglichkeit bestand, alles in sie hineingelegt habe, freilich nur alles Gute. In die vernünftigen Wesen habe er auch den freien Willen getan; wenn der Mensch diesen zum Bösen anwende, sei Gott nicht verantwortlich. Es ist nicht eine Emanationslehre, sondern eine Evolutionslehre; aber doch ist in den Dingen Göttliches vorausgesetzt, da was jetzt in ihnen vorhanden, vorher als Mögliches in Gott bestanden hat. Den Gegensatz zu den Muatazile bildeten die Motakallim (Mutakallimun, die Sprechenden) als Orthodoxe. Wir werden ihnen später als Atomisten begegnen. Hier haben wir nur zu erwähnen, was sie von der Welt und dem Menschen sagten. Alles ist von Gott geschaffen, aber ganz nach Willkür. Gott hätte jede andere Welt ebenso schaffen können. Gott regiert auch die Welt absolut und ständig; kein Vorgang ohne Gottes Veranlassung. Und so entsteht alles in jedem Augenblick aus nichts, als wenn die Welt fortwährend, in jedem Zeitmomente — die Motakallim dachten sich die Zeit atomistisch als aus lauter „Jetzt“ sich reihend — geschaffen würde. Wenn gleichwohl Naturgesetze gelten, so wird Gottes an sich souveräner Wille durch seine Vernunft geleitet. Diese Vernunft setze vieles als notwendig, wie die Vereinigung von Seele und Leib und die sittliche Ordnung. Und Gottes Vorauswissen hemme ihn, Böses und Übel, das eintreten soll, zu hindern; denn täte er es, so würde er ja sein Wissen ändern, und Gott ist absolut. So sind denn auch die menschlichen Handlungen solche Gottes; doch werde der Mensch auch erleuchtet, und dann ist er ein „einsichtiges“ Werkzeug Gottes. Diese Lehre, ab[S. 288]gesehen von der letzteren Erleichterung, ist um so herber, als der Mensch gleichwohl für Missetat bestraft werden soll. Und auch das Anthropomorphische in Gottes Eigenschaften wird dadurch nicht annehmbarer, daß es mit absoluter unendlicher Macht verbunden auftritt. Das Ganze ist auf dem starren Glauben des Mohammedanismus gegründet, der ja auch zu dem Kismet geführt hat. Die Vollendung dieser orthodoxen Lehre ist die der Aschariten, die auch jede Kausalität leugnen, überhaupt jeden Zusammenhang in der Welt, außer durch Gott, ablehnen.
Die mohammedanische Wissenschaft übernahm, wie so vieles andere vom Abendlande, auch den Neuplatonismus. Gleich einer ihrer bedeutendsten Philosophen, Aviçenna (Iba Sina 980–1037 n. Chr.), scheint Plotins Lehren fast unverändert in seine Anschauungen übertragen zu haben, nicht bloß hinsichtlich Gottes und der Emanationen, wo seine Intelligenzen der Nus Plotins und die beiden Seelen sind, sondern selbst in bezug auf die Ordnung in der Welt und die Stellung des Menschen. Ja selbst der große Averroes (Ibn Roschd 1105–1198 n. Chr. zu Cordova) gehört eigentlich hierher. Wir betrachten seine Lehre etwas genauer, weil vieles in ihr enthalten ist, das gegen die Emanationstheorie zu sprechen scheint, die er auch abgelehnt haben soll. Die Welt ist von Gott gebildet, aus Materie. Wesen, Wissen und Wirken sind bei Gott absolut und das gleiche mit ihm selbst. Die Materie hat Gott nicht geschaffen, sie besteht neben ihm, und zwar von vornherein mit allen Fähigkeiten begabt, das zu werden, was sie in der Welt ist; also eine Welt mit allen Vorgängen abzugeben. So wird die Schöpfung der Welt durch Gott mehr auf einen Auslösungsakt zurückgeführt, und ist im Grunde nur in diesem Auslösungsakt spiritualistisch, etwa wie bei Anaxagoras, gedacht. Und auch dieses wenige Spiritualistische ist noch fast bedeutungslos gemacht, indem die Schöpfung in die Unendlichkeit zurückverlegt wird. Allein dieser Standpunkt ist offenbar nicht konsequent beibehalten, sonst müßte Averroes zu einer rein physischen Anschauung von dem Gang der Welt gekommen sein. Davon ist er aber oft weit abgewichen.[S. 289] Schon die Sonderstellung, die er dem Himmel zuweist und die in vieler Hinsicht an neuplatonische Anschauung erinnert, ist sehr eigenartig. Dieser Himmel war nicht und ist nicht vergänglich. Ihm wird eine Seele zugeschrieben, die ihn auch bewegt; und diese Seele ist mit Vernunft begabt, und zwar mit solcher, wie sie eigentlich sonst Gott beigemessen wird. Mit dieser Vernunft regiert der Himmel die Bewegungen aller Gestirne. Und sein Erkennen geht nur auf sich und das Höhere; das Niedrigere, die eingeschlossene Welt, erkennt der Himmel nicht als solches, sondern allein aus dem Höheren. Und so wird ihm, was für die Gestirne geschieht, für die Menschheit abgesprochen, wie auch Gott selbst: nämlich die Vorsehung. Indessen doch nicht in dem Grade wie Gott, über den es ja kein Höheres gibt, woraus ihm etwas offenbar werden könnte; während der Himmel eben den Gang der Welt noch aus höheren Ursachen entnehmen kann. Man muß nun schließen, daß er diese Erkenntnis weiter dem Niederen zu erkennen gibt; wir hätten die Astrologie, und alles so Befremdliche, was vom Himmel gesagt ist, wäre nur dieser Astrologie wegen gesagt. Aber auch die Rolle Gottes ist nicht so allein auf den ersten Anstoß beschränkt, wie aus den Annahmen über die Materie sich zu ergeben scheint. Schon die höheren Ursachen (Mächte), die der Himmel erkennt, müssen doch Gott ihre Entstehung verdanken. Und wenn wir erfahren, daß der Mensch nicht bloß sich und was unter ihm, sondern auch das Höchste zu erkennen die Fähigkeit haben soll, so muß doch Gottes Geist wenigstens in ihm sein. Und dieser Eindruck wird verstärkt, indem der Mensch auch zu der letzten Erkenntnis soll gelangen können, worin er sich selbst erkennt. Mitunter freilich scheint es, als wenn die Erkenntnis des Höchsten nicht die Erkenntnis Gottes zu bedeuten hat, sondern nur die Erkenntnis des Höheren und noch Höheren usf. Aber der Vernunft wird doch auch Unsterblichkeit zugeschrieben. Nicht dem besonderen Verstande des besonderen Menschen, welcher vielmehr mit ihm stirbt, sondern der allgemeinen Vernunft, von der der besondere Verstand nur ein Akzidens im Leben ist. Und diese allgemeine Vernunft ist eben einheitlich.[S. 290] Wir haben also bei Averroes tatsächlich einen Dualismus von Geist und Materie, vermehrt durch die Sonderstellung des Himmels, und durch die In- und Außerweltstellung Gottes. Vieles aber verliert sich völlig in Mystik; schon was vom Himmel gesagt ist, gehört hierher. Noch mehr, wenn gar dem Himmel intelligibles Mitwirken bei der Entstehung der Dinge zugeschrieben wird; so wird „der besondere Mensch von der Sonne hervorgebracht und von der besonderen Materie, welche ein anderer besonderer Mensch darbietet, daß sie von der erzeugenden Kraft der Sonne belebt werde“. Daß, obwohl die Sonne allgemein Menschen beleben kann, sie diesen besonderen Menschen belebt, liege daran, daß ihr eine besondere Materie geboten ist, die eben nur Bestimmtes empfangen könne. Das alles wird man nur verstehen, wenn Averroes, trotz seiner Ablehnung der Emanationslehre, doch nach deren Schema gearbeitet hat; sonst kämen Dinge heraus, die man einem so hervorragenden Denker nicht zumuten darf.
Andere Philosophen der mohammedanischen Welt haben von ihrer Rechtgläubigkeit hinzugefügt. Aber der große Einfluß der Gnosis auf sie zeigt sich bei ihnen in dem so hervortretenden Hang zum Mystizismus selbst bei den bedeutendsten unter ihnen. Wir verdanken solchem Tüfteln und Forschen nach dem Geheimen der Natur die Alchemie und die feinste und spitzfindigste Ausbildung der Astrologie. Und abgesehen von ihren Übersetzungen der griechischen Werke (namentlich der aristotelischen), haben sie durch nichts so erheblich auf die Forschung des mittelalterlichen Abendlandes gewirkt wie durch ihre Geheimwissenschaften. Wir werden übrigens von ihnen noch bei mehreren Gelegenheiten zu sprechen haben.
36. Jüdische Theosophie und Kabbala.
Da die Gnosis im Grunde aus jüdischen Anschauungen sich entwickelt hat, denn das erste konsequente, wenn auch nicht vollständige, System ist das von Philon, so darf es nicht wundernehmen, wenn sie auch bei jüdischen Forschern sich weitergebildet findet. Hervorzuheben ist zunächst der so bedeutende Dichter Salomon ben Gabirol (1020 n. Chr.[S. 291] zu Malaga geboren und in der Philosophie als Avicebron bekannt). Ich brauche nur aus einem Hymnus von ihm, „die Königskrone“, die entscheidenden Verse anzuführen:
Also die Emanationen sind Weisheit, Willenskraft, Sein. Und die Willenskraft baut die Welt als Emanation.
Das imponierendste System der jüdischen Gnostik und Mystik ist die Kabbala. Früher mißachtet und verrufen, wird sie jetzt mit Eifer hervorgezogen und auf ihren wissenschaftlichen Ideengehalt untersucht. Das kabbalistische System ist in sehr vielen Traktaten und Werken niedergelegt. Die bedeutendsten Schriften sind das Sepher Jezira (Buch der Schöpfung) und das Sepher Sohar (Buch des Glanzes), redigiert von Mose de Leon um 1300 n. Chr. in Spanien. Es ist eine ins Minutiöse durchgeführte Emanationslehre, um die es sich handelt; freilich mit Zahlen- und Buchstabenmystik aufs äußerste durchsetzt (namentlich im erstgenannten Werk, das alles in der Welt aus Zahlen und Buchstaben aufbaut). Das Urwesen ist „das Unendliche“ (En Soph), oder „der heilige Alte“, oder der „Alte vom Tage“, auch das „heilige Antlitz“. Es bedeutet ganz Licht. Der Emanationen gibt es zehn in absteigender Bedeutung: die höchste Krone oder oberste Höhe, die ideelle Weisheit oder ideelle Einsicht, die Liebe oder Gnade, die Stärke, das Recht, die Herrlichkeit[S. 292] oder Barmherzigkeit, der Sieg oder die Geistesmacht, der Glanz oder die Schönheit, der Grund, der Kranz oder das Reich. Es bestehen nun vier Welten in absteigender Folge. Der Mensch ist in allen beteiligt, nach den verschiedenen Bedeutungen seiner Seele, deren, gemäß der Bibelbezeichnungen, vier angenommen werden: Adam mit dem Beiwort Kadmon als Urmenschenseele, Neschamah als intuitive, Ruach als denkende, Nephesch als lebende Seele (vgl. S. 221 ff.). Daher kann der Mensch sich bis zu dem Höchsten erheben. Die vier Welten aber sind: Aziruth, entsprechend dem Pleroma, also das absolute Lichtreich, alle Urbilder der Schöpfung enthaltend; Beriah, eine intellektuelle Sphäre der Innerlichkeit, die Aionen Weisheit und Einsicht herrschen darin; Jezirah, die Welt der Engel, an deren Spitze der Erzengel Metathron (also dem Griechischen entnommen, der dem Throne Nächststehende), hier waltet die Schönheit. Die letzte Welt zerfällt in mehrere Schichten, die oberste Schicht ist die des Demiurgos; dann folgt die der Dämonen, die irdische Welt. Und nun geht es merkwürdigerweise wieder in die Höhe, denn die weitere Schicht enthält Emanationen von Sieg und Glanz, und die letzte Schicht das Reich (Malkuth). H. Schmitt sieht darin einen hervorragenden Optimismus, da schon in der niedrigsten Welt das Lichtreich erreichbar ist. Weiteres anzuführen muß ich mir versagen; meine Leser wissen aber, wie so vieles aus der Kabbala als Mystik und Okkultismus in die Nekromantie, Theurgie, und was des Spukes mehr, übergegangen ist. Wir haben es nur mit dem Gedanklichen zu tun. Und dieses ist bedeutend genug in der Reihe der gnostischen und neuplatonischen Systeme. Es führt sogar über diese hinaus durch die bezeichnete konsequente Einfügung des Menschen in alle Welten, wodurch sein Anteil am Lichtreiche und seine Bestimmung, durch reines Leben und durch Erkenntnis sich zu diesem Reiche aufschwingen zu können — was ja der eigentliche Zweck dieser Lehren ist —, noch entschiedener hervortreten. Darin kommt diesem System nur die indische und die moderne Theosophie gleich. Die kabbalistische Literatur ist unendlich.[S. 293] Unseres Goethe wegen verweise ich auf das tüchtige Werk von C. Kiesewetter „Faust in der Geschichte und Tradition“, in dem der Leser vieles Hierhergehörige finden wird, sowie auf das große Faustbuch von Scheible in der absonderlichen Sammlung „Das Kloster“.
Zum Schluß erwähne ich noch, daß unter den Juden auch Sekten wie die Muatazile und Muatakallim sich finden; es sind die Karaiten oder Karäer, die freiheitlicheren und die Rabbaniten, die orthodoxeren. Über die ersteren ist viel geschrieben worden; ich kann aber darauf nicht eingehen, das Wesentliche ist schon bei den islamischen Sekten gesagt. Unter den jüdischen Philosophen des Mittelalters ist aber besonders der allbekannte Arzt der ägyptischen Herrscher, Maimonides (Mose ben Maimûn, abgekürzt Rambam, gestorben 1205 n. Chr.) hervorzuheben, der den Karaiten zuneigt und so die Schrift geistig auszulegen wünscht. In den Geschöpfen macht er einen Unterschied zwischen solchen mit vergänglicher Seele, und solchen mit unvergänglicher. Ob er zu letzteren alle Menschen rechnete, oder nur die tugendhaften und erleuchteten, kann ich nicht sagen. Die Frage, ob die Welt in endlicher Zeit geschaffen ist, oder seit unendlicher, hält er für unentscheidbar. Übrigens gehört auch der so außerordentliche und edle Dichter Jehuda Halevi (um 1140) hierher.
37. Die mittelalterliche Theosophie der christlichen Scholastiker und Mystiker.
Wir wenden uns wieder den christlichen Anschauungen zu, um uns mit ihnen ohne Unterbrechung bis zum Schluß dieses Buches zu beschäftigen. Die Theosophen und Mystiker stehen in einem gewissen Gegensatz zu den Scholastikern, namentlich mußten sie sich den Nominalisten unter diesen, die mit Aristoteles den Allgemeinheiten (Universalien, Ideen) der Dinge jede Existenz außerhalb des menschlichen Verstandes absprechen und die Annahme einer solchen für eine pure Einbildung erklären, fernhalten, während sie mit den Realisten, die mit Platon gerade jenen Allgemeinheiten absolutes Vorhandensein zusprechen, wenigstens einige Be[S. 294]rührungspunkte haben konnten. Gleichwohl gehört auch die Scholastik hierher, soweit sie Welt- und Lebenanschauung betrifft; und seltsamerweise haben gerade die Nominalisten viel Übernatürliches geglaubt. Die Lehren der Religion werden möglichst dogmatisch aufgefaßt; Philosophisches kommt nur zum Vorschein, wenn sie mehr oder weniger frei interpretiert sind. Gott ist Schöpfer und Erhalter der Welt fast ganz im biblischen Sinne. Die Welt ist sein Werk und real. Der Zweck des Lebens in der Welt ist Vorbereitung für das Jenseits, wo Gottes Gnade vollendet, was sie im Diesseits begonnen. Das Leben aber ist geregelt durch die religiöse Offenbarung. So mischt sich hier Transzendentes mit Realem, und das Realste ist gerade die Offenbarung. Daher auch die Lehren über Glauben, Ethik, Moral absolut, dogmatisch genommen werden. Und Gott ist nicht bloß Schöpfer, sondern auch Erlöser und Vollender, die Trinität. So ist weiter die Welt ein „Gottesstaat“ (die Civitas dei des Augustinus) auch den Scholastikern. Ein Unterschied in ihr besteht freilich; der Mensch als vernünftiges Wesen ist auch Selbstzweck, das Nichtvernunftbegabte ist nur vorhanden. Derartige Anschauungen müssen zu schwerzuverstehenden Prädestinationen führen, wie schon selbst die Gnade Gottes nicht begriffen werden kann, da sie ja in der Welt fehlen dürfte, wenn Gott die Welt vollkommen geschaffen hätte. Oder sie müssen in einen Dualismus zwischen Gut und Böse, Materie und Geist auslaufen.
Sehr bemerkenswert ist es, daß die beiden größten Scholastiker, Albert der Große, Albertus Magnus (1193–1280, zu Lauingen in Schwaben geboren) und Thomas von Aquino (1225–1274) trotz ihrer aristotelischen Richtung der Emanationslehre zuneigen. Der erstere meint, Gott sei erkennbar durch Intuition, die seine Gnade verleiht, und aus der Wahrnehmung in der Natur. Ganz faßbar könne er nicht sein, weil er eine Unendlichkeit darstellt. Gott sei der allgemeine tätige Verstand (Intellectus universaliter agens). Und dieser ströme ständig Intelligenzen aus. Die Welt ist durch Gottes Willen geschaffen. Dieser Wille ist frei; in der geschaffenen Natur zeigt er sich in den Gesetzen, denen sie folgt, nur scheinbar[S. 295] gebunden. So bildet sich die Natur stetig selbst, aber immer unter dem Willen Gottes. Die ganze Welt aber ist eine Emanation nach absteigenden Graden; letzteres, weil immer die Ursache vollkommener ist als die Wirkung. Darum hat denn Gott auf diesem Wege nur eine unvollkommene Welt hervorgehen lassen können. Sie bildet aber eine feste Einheit, weil keine Emanationsstufe fehlt; die Emanationen sind stetig wie das stetige Strahlen der Sonne. In dieser Weise ist also auch Gott in den Seelen wie überhaupt in allen Dingen gegenwärtig, da selbst die niedersten Grade der Emanation an die höchsten stetig anschließen. Und so geschieht alles aus sich heraus, vermöge des Anteils am göttlichen Willen und an der göttlichen Intelligenz. Die Dinge als solche sind vergänglich wie die ganze sichtbare Welt; aber das in sie Emanierte ist, als gottentstammt, unvergänglich. Die Materie ist gleichfalls von Gott geschaffen; sie wird nicht als Emanation angesehen, sondern als eine Art Bedingung für die sichtbare Schöpfung. Und so enthält ihm die Materie die Keime aller Wesen von je und in die Zukunft in sich, so daß die Entwicklung der Dinge wie bei Averroes, eine Art Evolution ist, aber doch nur, weil Gott diese Keime von vornherein in die Materie gelegt hat, während bei Averroes die Keime der Materie an sich gehören sollen. Der Emanation von oben nach unten entspricht die Evolution von unten nach oben, wie wir es schon von mehreren Systemen kennen. So entwickelt sich auch die Menschheit zu immer höheren Graden, wobei sie alles Frühere immer beibehält. Wie das geschieht, ist nicht recht verständlich, wenn nicht wieder die präformierten Keime zu Hilfe gerufen werden, also Gottes Willensakte. Trotz der theosophisch-theologischen Anlage ist ein gewisser Mechanismus der Durchführung nicht zu verkennen; er zeigt sich in der starren Evolution des einmal in die Materie Gelegten. Wie denn auch deshalb Albertus das Wunder, Augustinus nachahmend, ganz natürlich erachtete. Die Verschiedenheit der Dinge (die Individuation) folgt aus dem gleichen Prinzip. Gott hat sie eingepflanzt, in der Materie evolviert sie sich. Albert scheidet aber den Geist von der[S. 296] Materie, und ersteren behandelt er wesentlich spiritualistisch; Gott zieht ihn unmittelbar aus seinem Lichte heraus, nicht aus etwas der materiellen Prinzipe. Daraus leitet er Freiheit des Willens ab, denn Gott ist absolut frei. Und so stehen wir hier hinsichtlich des bewußten Bösen vor derselben Schwierigkeit wie bei Augustinus und so vielen Anderen.
Wenig verschieden von diesen Anschauungen sind die des größten Schülers Alberts, des Scholastikers par excellence, Thomas von Aquino. Nur daß Gott eine noch höhere Stelle angewiesen wird und, man möchte sagen, eine noch größere Freiheit. Alle möglichen Welten sind Gott offenbar. Er wählt eine nach Maßgabe seiner Güte und seiner Vollkommenheit. Aber den Geschöpfen ist nur das, und gerade das verliehen, was der einmal gewählten Welt gemäß ist. Sollte damit das Unvollkommene und Schlechte im einzelnen motiviert sein, so ist also zugleich die Verantwortlichkeit aufgehoben. Gleichwohl vindiziert der Philosoph den Geschöpfen Willensfreiheit; es bleibt also auch hier bei der Unvollkommenheit im Verhältnis zu Gott. Im übrigen wird die Emanation ganz so durchgeführt wie bei Albert dem Großen. Dementsprechend liegt auch der Vernunftgrund (ratio) der Geschöpfe, insgesamt und im einzelnen, in der Idee, die Gott von sich selbst hat, nur daß diese Idee als unendlich durch die Vernunftgründe in der Welt nicht erschöpft werden kann, viel weniger durch ein Einzelnes. Und in einem ist Thomas konsequenter als Albert. Beide betrachten die Materie als durchaus zugehörig zu den Wesen, nicht bloß zufällig oder nach Willkür um die Seele gehüllt. Aber Thomas, die Seele eben als Göttliches ansehend, schreibt ihr auch zu, daß sie sich selbst den Körper aus der sonst eigenschaftlosen Materie aufbaut. Das ist eine Durchbrechung der absoluten Evolutionslehre Alberts, und nach der spiritualistischen Seite hin. Die Vernunft ist aber das oberste Prinzip. Man hat darum diese Lehre als den intellektualistischen Determinismus bezeichnet. Auch das verdient noch besonders hervorgehoben zu werden, daß eine Schöpfung in der Endlichkeit der Zeit nicht angenommen zu werden brauche. Eine[S. 297] solche Schöpfung sei nur Glaubenssache, denkbar sei auch eine Schöpfung in der Unendlichkeit. Offenbar wollte der Aquinate dadurch der unschönen und vorwitzigen Frage aus dem Wege gehen, was denn Gott vor der Erschaffung der Welt getan habe. Daß aber, sobald die Schöpfung in die Unendlichkeit hinausgerückt wird, die Idee der Schöpfung überhaupt aufhört, liegt auf der Hand. Dann hat eben die Welt von je bestanden, sie ist gar nicht erschaffen, und Gottes Tätigkeit beschränkt sich allenfalls auf ein Leiten der Welt. Läßt man dieses Leiten auch noch fort, so gelangt man zu der rein mechanistischen physischen Anschauung von der Welt. Und daran ändert nichts, daß man die Schöpfung von ihrer Ursache unterschieden hat, gemeint hat: Gott sei ohne Ursache, die Welt aber mit Ursache. Das könnte für die Schaffung in der Unendlichkeit einen Sinn nur haben, wenn die Welt Emanation Gottes wäre oder zu seinem Wesen gehörte, was ja abgelehnt wird. Solchen im Grunde bedeutungslosen Distinktionen begegnet man oft. Ich glaube darum, daß Thomas von Aquino nur hat sagen wollen, wir vermögen für die Erschaffung der Welt keinen Zeitpunkt anzugeben, und das Festhalten oder Nichtfesthalten an der biblischen Angabe hierüber dürfe jedem überlassen bleiben. Und das kann vom Standpunkte der Wissenschaft, die ja schon bei der Entwicklung der Erde mit Hunderten Millionen von Jahren rechnen muß, nur gutgeheißen werden, obwohl Thomas davon nichts gewußt hat. Albert der Große (Doctor universalis) war auch ein großer Naturforscher, der Aquinate (Doctor angelicus) ein gewaltiger Dialektiker. Diesem ist sein noch außerordentlicherer Landsmann Dante in seinen Anschauungen gefolgt. Und die Verse am Schluß der ganzen „Göttlichen Komödie“ (übersetzt von König Johann von Sachsen)
können durchaus auf thomistische wie gnostische Anschauungen gedeutet werden. Solcher Verse aber gibt es viele in dem Gedicht des Florentiners. Und das Standbild des Dichters vor der Santa Croce in seiner Vaterstadt drückt dieses mächtige Hinausschreiten des Begeisterten in das Reich des höchsten Schauens über alle Maßen schön aus.
Das Übernatürliche als eine notwendige Ergänzung unserer natürlichen Erkenntnis sieht auch der große Johannes Duns Scotus (wahrscheinlich ein Schotte von der Grenze Englands, gestorben 1308 zu Köln) an. Und dieses Übernatürliche ist das Göttliche in uns. Es ist aber nur der Möglichkeit nach in uns. Ob wir zu ihm gelangen, hängt von unseren Handlungen ab, die in unserem freien Willen liegen. Hier ist, wie auch sonst vielfach, der freie Wille auf das Gute bezogen; bei anderen Philosophen findet er sich auf das Schlechte gerichtet, wohin er eigentlich mehr gehört, vom ethischen Standpunkt gesehen. Alles Übernatürliche ist darum so weit natürlich, als es der vernünftigen Seele von vornherein, wenn auch zunächst nur potentiell, vom Schöpfer eingepflanzt ist. Außer der Natur steht das Übernatürliche, wenn es in den Geschöpfen nicht schon vorhanden ist und jedesmal von Gott ausgeht und diesen Geschöpfen erst verliehen wird. Gott ist das schlechthin Einfache (simpliciter simplex). Gleichwohl müssen wir in ihm eine Vielheit erkennen, nach der Augustinischen Trinitätslehre, als Wissen, Verstand und Wille, und als Vorbilder der Mannigfaltigkeit in der Welt. So ist die Schöpfung eine doppelte: nach dem Verstand — die Natur, nach dem Willen — die Vernunft. Die Mannigfaltigkeit in[S. 299] der Welt ist an sich zufällig; daher muß in Gott etwas sein, das ihn veranlaßt hat, die Welt so zu schaffen, wie sie sich zeigt. Das ist eben der Wille Gottes, und dieser ist ja frei in bezug auf alles, was nicht dem Wesen Gottes angehört. Für uns die wichtige Folgerung hieraus wäre: die Welt gehört nicht zum Wesen Gottes, weder direkt noch indirekt. Scotus ist also weder Pandeist noch Emanist, er steht einfach auf dem Boden der Bibel. Abweichend aber meint er, daß Gott auch eine dieser Welt, sogar sittlich, entgegengesetzte Welt hätte hervorbringen können. Daraus würde nun folgen, daß das Böse in der Welt auch durch Gottes Willen entstanden ist, da ja alles absolut seinem Willen entspricht. Und so sieht alles wie ganz nach Willkür geschaffen aus. Eine Milderung findet sich nur darin, daß, nachdem Gott die Welt wie sie ist geschaffen hat, er an sie gebunden sein soll, indem Gott neben einem absoluten Willen auch einen geordneten Willen haben soll. Warum, sieht man nicht ein. Es wird zwar gesagt, daß der Wille Gottes mit seinem Wesen zusammenhängt. Aber was ist sein Wesen, wenn er auch Entgegengesetztes wollen kann? Und das Ganze wird nicht klarer, wenn der Verstand Gottes in zwei Teile zerlegt wird, einen in sein eigenes Wesen gerichteten und einen, der die Welt erkennt, weil er sie gewollt hat, und wenn ferner gemeint wird, der erste Verstand greife in den zweiten ein und so entstehe die Welt dem Wesen Gottes gemäß. Auf diese Weise läuft man eigentlich immer im Kreise herum, und das hat seinen Grund in dem ja überall im Mittelalter sich zeigenden Wunsche, das Theologische mit dem Philosophischen und der Naturerkenntnis, den liber scriptus mit dem liber vivus zu versöhnen, was eben nicht möglich ist. Der Begriff von Gott wird dabei immer komplizierter und immer unverständlicher. Im übrigen denkt Scotus von der Welt ganz physisch, namentlich ist ihm der Himmel nichts besonderes. Und alles ist ihm vergänglich, das Göttliche in uns natürlich nicht.
Mit einem Fuße bei den Mystikern steht der Empiriker Roger Bacon (Doctor mirabilis, 1214–1292), Landsmann des noch empirischeren Bacon von Verulam, insofern er von einem[S. 300] intuitiven absoluten Wissen spricht, zu dem man durch verschiedene Grade der Erleuchtung aufsteigt, um zuletzt „reiner Spiegel Gottes“ zu werden. In Gott sei der tätige Verstand des Menschen, der Verstand des Irdischen sei nur ein leidender Verstand, wie auch arabische Philosophen sagen. So bestehe neben der sinnlichen Erfahrung eine übersinnliche. Arabisch ist es auch (S. 289 f.), wenn er die Materie als die Keime aller Entwicklung der Welt enthaltend ansieht. Indem er aber die Materie gleichwohl von Gott erschaffen sein läßt, nähert er sich dem Standpunkt des Albert, daß eben Gott diese Keime in die Materie gelegt hat (S. 295).
Gehen wir zu den Mystikern selbst über, so haben wir solche verstandesklare Größen wie die genannten Scholastiker nicht zu verzeichnen. Unser unglücklicher genialer Kaiser Otto III. war eine durchaus mystisch veranlagte Natur. Mystiker waren alle großen Mönche und Ordensstifter. Aber dieser Mystizismus bezieht sich nur auf die bestimmte christliche Religion und die Erscheinungen in ihr, und geht dabei stark in das Visionäre über, wie bei dem so sympathisch-milden heiligen Franziskus und dem so energischen Bernhard von Clairvaux, der trotz seines reinen Wollens so viel unfruchtbares Unheil auf die Welt heraufbeschworen hat, weil er die schlechten Instinkte der Massen und die niedrige Herrsch- und Goldbegier der Führer nicht in Rechnung zu ziehen verstand. Wir haben es hier mit dem philosophischen Mystizismus zu tun. Der Begründer dieses mittelalterlichen Mystizismus ist, obwohl vor ihm schon Anselm von Canterbury (in Italien 1033 geboren) sich als ein halber Pandeist zeigte, der Deutsche (?) Hugo von St. Victor (gestorben 1140). Die Welt ist eine Abspiegelung Gottes. So ist die Vernunft ein Ebenbild Gottes, und die Offenbarung in ihr bedeutet die übernatürliche Offenbarung Gottes. Unser Erkennen ist eine Kette, die Glied an Glied bis zum Höchsten führt, der selbst keine Wirkung ist und keine Ursache hat. Und wir hören bei ihm auf, weil eben unsere Vernunft sich als Spiegel von ihm darstellt. Folgerichtig erkennt Victor eine innere Lehre an, also eine Entwicklung aus sich selbst heraus. Und diese soll auf der einen[S. 301] Seite zu der Erkenntnis Gottes führen, welche allen Menschen gemeinsam ist, auf der anderen Seite zu der des Erlösers, welche dem Christentum eigen ist. Da die Vernunft aller Menschen gleichen Ursprung hat, muß man annehmen, daß in manchen Menschen die zweite Erkenntnis schlummert oder durch eine Widersetzlichkeit zurückgehalten wird. Diese ist die Sünde, welche die Vernunft in Verwirrung gebracht hat und welche den Menschen überhaupt von dem Höchsten entfernt. Woher aber die Sünde kommt, ist um so weniger zu verstehen, als die vernünftigen Geschöpfe die ganze Idee Gottes spiegeln sollen, nicht bloß einen Teil, wie alle anderen Dinge der Welt. Allerdings wird dieser Satz auch eingeschränkt; die Vernunft soll sich nach dem Höchsten zu entwickeln. Demnach wäre das Ebenbild Gottes nur potentiell und würde allmählich aktuell und völlig real, sobald der Mensch sich von allen Schlacken gereinigt hat. Alsdann erkennt er Gott durch Anschauen, intuitiv, denn die reine verstandesmäßige Ableitung kann das Unendliche nicht begreifen. So spricht Hugo von drei Augen der Seele; eines, das Auge des Fleisches, für die sinnlichen Dinge und den Körper, eines der Vernunft, für die Erkennung ihrer, der Seele selbst, und alles dessen, was in ihr ist, und eines der Anschauung (contemplatio) für die Erkennung Gottes in sich und in Gott. Gleichwohl ist die Seele einheitlich. In einer uns schon bekannten, aber trotz der fortwährenden Wiederholung gleich unverständlich bleibenden Wendung soll das Böse zum Guten dienen, um letzteres zu durchschauen. Nicht viel verständlicher ist die weitere, gleichfalls so oft wiederkehrende Behauptung, daß die Welt der Menschen wegen da ist, der Mensch aber Gottes wegen. Letzteres könnte doch nur einen Sinn haben, wenn Gott erst im Menschen sich selbst offenbart, was Thomas von Aquino vom Verhältnis Christi zu Gott aussagt. Sittlich aber scheint mir Hugos Idee bedeutender. Und sie ist für ihn der Ausfluß aller Vorschriften für das Leben, die in dem Satz gipfeln, daß gegenüber der Einsicht des Menschen in sich selbst und seiner Beschäftigung mit sich selbst die Einsicht in die Natur und die Beschäftigung[S. 302] mit der Natur ganz zurückzutreten hat, als wenn Gott nur in uns, nicht in der Natur zu erkennen wäre. Der Mystiker sieht darum sein Heil in Sittenreinheit und frommem Sich-in-sich-Versenken. Die äußeren Mittel der Religion unterstützen beides.
Ein Namensvetter unseres Philosophen, der Schotte Richard von St. Victor (gestorben 1173), hat für uns darum noch hervortretende Bedeutung, weil er den Wert des Schauens ganz besonders betonte; der Glaube steht ihm sehr tief gegenüber dem Schauen, tiefer noch als der Verstand, der seinerseits schon tief genug angesetzt wird. Er stirbt, wenn das Schauen beginnt; und wenn Gott erscheint, vergehen Sinn, Gedächtnis und Vernunft. Das hätte ein Indier sagen können oder ein Valentinianer. Und Schauen ist „Ekstase, Entrückung (raptus) des Geistes, Herausschreiten (excessus) aus sich selbst“ usf. Wollte man das wörtlich nehmen, so käme man zu den visionären Verzückungen der Heiligen und Unheiligen oder auf naturmenschliche Denkweise. Und wohin soll man die Ansicht bringen, daß Gott den Geschöpfen sich noch besonders mitteilen kann? Das ist klarer und echter Mystizismus, in dem die Gottheit des Menschen schon im Leben auf die Spitze getrieben ist. Doch wird er dadurch gemäßigt, daß auch ein Schauen in der Vernunft und in der Einbildungskraft, außer dem in der reinen Intelligenz, anerkannt ist. Es dürfte dem Leser aufgefallen sein, daß hier und in allem Früheren, obwohl wir im vollen Kirchentum stecken, fast nur von Gott die Rede ist. In der Tat haben sich die Philosophen mit der Trinität nicht gut abfinden können, oder nur vermittelst der „doppelten Wahrheit“. Indessen möchte ich eine Ansicht nicht unterdrücken, die hierüber ein Mystiker geäußert hat, der Engländer Isaac (um 1150), und die man allerdings mit Heinrich Ritter (Geschichte der christlichen Philosophie) als verständig ansehen darf. „An Gott (dem Vater) hat alles teil, sofern es ist, weil er das höchste Sein ist und das Sein allgemeines Prinzip aller Dinge ist. Die bestimmte Weise des Teilnehmens, nach welcher ein jedes Ding ein besonderes Wesen von Natur ist,[S. 303] empfängt aber ein jedes Geschöpf nur durch den Sohn Gottes, indem der Vater alles nur durch den Sohn verleiht. Endlich aber muß von der natürlichen Verleihung der Gaben der Gebrauch unterschieden werden, welchen die vernünftigen Wesen von ihren Gaben machen und durch welchen sie erst wahrhaft der Tugend und der Erkenntnis Gottes teilhaftig werden. Dieser Gebrauch gelingt ihnen nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes.“ Andere Ganz- oder Halbmystiker, wie den Alanus (gegen 1200), seinerzeit ein großes Kirchenlicht und für die unseligen Waldenser von verhängnisvoller Bedeutung, den Bonaventura (1221 im Kirchenstaate geboren), der eine Reise des Geistes zu Gott geschrieben hat und stark pandeistische Neigungen zeigt, den Franzosen Johann Gerson (zu Gerson bei Rheims 1363 geboren) usf., übergehen wir, es kommt Neues nicht zum Vorschein. Eine Erwähnung verdient aber durchaus der fromme Dominikaner „Meister Eckehart“ (geboren bei Gotha, gestorben 1327). Seine Anschauungen sind wesentlich gnostisch, und zwar mit den Valentinianischen verwandt. Die Emanation beginnt mit Christus, dem Bilde des Vaters, und dem Heiligen Geist, dem umfassenden Liebesbunde. Zugleich emanieren alle Gründe der Schöpfung, deren Abbild die Schöpfung ist, wie ihr Sein sich als ein Überströmen des Seins Gottes darstellt. Gott ist das Sein selbst, für Gott gibt es keine Zeit, sondern — und diese Wendung ist von großem Interesse — nur ein Jetzt; Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sind ihm in das Jetzt zusammengezogen, so daß die ganze Welt von je und in je ihm zugleich, im Jetzt webend, und nur ist durch dieses Jetzt-Sein. Aber freilich nicht in diesem Sein. Denn Gott, als das reine absolute Sein, hat nicht Teil an der mannigfaltigen endlichen Welt. So besteht für ihn auch keine Mannigfaltigkeit, keine Zahl. Alles ist Eins, es ist für ihn auch kein Raum. Im Grunde der Seele ist ein „ungeschaffenes und unschaffbares Licht“, ein „Seelenfünklein“, das mit den übrigen Seelenkräften nichts gemein hat, ein göttlicher Keim. Dieser leuchtet intuitiv in das Lichtreich, und durch ihn kann der Mensch zum Schauen des Höchsten gelangen. Damit[S. 304] wohl verträglich ist die Ansicht, daß außerhalb dieses „Seelenfünkleins“ die Welt nur Schein und Nichts ist. Von dem Gottesfunken in uns sind ja alle idealistischen Denker und Dichter überzeugt. „Soll die Seele Gott erkennen,“ sagt Eckehart, „so muß sie ihn erkennen oberhalb der Zeit und oberhalb des Raumes. Denn Gott ist weder Dieses noch Jenes, wie diese mannigfaltigen Dinge, Gott ist Eins! Soll die Seele Gott sehen, so darf sie nicht zugleich den Blick auf irgendwelche Dinge richten, die in die Zeit gehören (und in den Raum, müssen wir hinzufügen). Denn während Zeit und Raum und sonst dergleichen Bilder (Körper) ihr (der Seele) Bewußtsein erfüllen, vermag sie unmöglich Gott gewahr zu werden.“ Die Seele muß sogar sich selbst vergessen und sich selbst verlieren. In Gott findet sie sich wieder. Damit hat freilich die Welt ihre ganze Bedeutung eingebüßt; man weiß nicht, wozu sie da ist. Im übrigen schließt sich Eckehart den großen Scholastikern an.
Der flämische Jan van Ruysbroek (1293–1381) muß es in der Verzückung sehr weit gebracht haben, da er „doctor ecstaticus“ genannt wurde. In der Schilderung des Zustandes eines wahrhaft Gottschauenden geht er so weit, daß er von einem „Verschlungenwerden in den grundlosen Abgrund unserer ewigen Seligkeit“ spricht, wobei jedes Denken ein Ende hat. „Wo wir aber prüfen und erfassen wollen, was wir fühlen, verfallen wir in Vernunft. Und da finden wir sogleich Unterschied und Anderheit zwischen Gott und uns und finden Gott als ein Unbegreifliches aus uns.“ Außer dieser seligen Gnadeneinheit mit Gott haben wir im Leben in und mit der Natur eine leidende und tätige Einheit, die jedoch gleichfalls eine „Begegnung unseres Geistes mit Gott“ bedeutet. Vielleicht ist dieser Mann der konsequenteste Theosoph des Mittelalters, trotz seiner sonstigen Anhänglichkeit an die kirchlichen Lehren und Gebräuche. Und er spricht in schönen Bildern. Maria war und ist ihm die „Morgenröte und der Anbruch des Tages aller Gnaden“. „Gott hat unzugängliche Höhe und abgründige Tiefe, unbegreifliche Breite und ewige Länge, (er ist) ein dunkles Schweigen (Sigê der Gnostiker),[S. 305] eine wilde Wüste, das Rufen aller Heiligen in der Einheit, ein allgemeiner Genuß an sich selbst und an allen Heiligen in der Ewigkeit.“ Er kennt, wie andere Gnostiker, zwei Himmel, den äußeren, ohne Zeit und Ort, für das Reich Gottes und seiner Heiligen, „erfüllt mit Glorie und ewiger Freude“, ohne jede Veränderung, und den inneren Himmel, „der erste Antrieb“. Letzteres klingt averroistisch. Und das Böse und Schlechte? Davon wird nur in Gleichnissen gesprochen, die ohne Bedeutung sind.
38. Theosophie und Emanismus in neuerer Zeit.
Die Scholastik hatte den Vorrat an zugänglichen Begriffen und Distinktionen bis zu einem gewissen Grade erschöpft und war zuletzt dahin gelangt, ihr System, wie von Raimundus Lullus (1235 auf Malorca geboren, 1315 von fanatischen Mauren in Afrika gesteinigt) geschehen, in Tabellen, Schemata und Reihen zu ordnen, die dem Menschen sogar das Denken ersparen sollten. Gleichwohl ist ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen; die logische Schärfe des Ausdrucks hat ihr sehr viel zu verdanken, und würde ihr noch weit mehr zu verdanken haben, wenn das Latein wissenschaftliche Sprache geblieben wäre. Viel ist uns von der emsigen Forscherarbeit der Scholasten im Gebiete der Begriffsbestimmungen verloren gegangen, dadurch, daß wir ihre Sprache verlassen und uns zu den Nationalsprachen gewendet haben. Auch ist wohl deutlich genug hervorgetreten, daß sie die eigentlichen Probleme der Menschheit keineswegs außer acht ließen. Wir haben Welt- und Lebenanschauungen von ihnen kennen gelernt, die tief durchdacht und durchfühlt sind. Die Scholastik konnte sich aber auf ihrer Höhe nicht halten. Als die Wissenschaften erwachten, die Kenntnis der Welt wuchs, die Schätze griechischen Geistes erschlossen wurden, als die Renaissance mit der Fülle großer Erscheinungen auf fast allen Gebieten menschlicher Tätigkeit anbrach, und als die Reformation sich vorbereitete, die Geister frei zu machen, war für die Scholastik nur noch ein stilles Dasein möglich,[S. 306] das sie lange wie im Verborgenen führte, um später allerdings zu neuer Kraft sich aufzuraffen, dann rasch zur Vereinzelung zurückzusinken. Sie hatte der Menschheit nicht mehr viel Neues zu sagen, und wo sie einen Anlauf nahm, sprang sie ihrer Natur nach zu kurz, vor die Naturwissenschaft, oder zu weit über diese hinweg, und mußte darum zurückgewiesen werden. Anders verhält es sich mit dem theosophischen Mystizismus. Ist er schon wegen seiner dichterischen Färbung und schrankenlosen Unbegrenztheit von je ein Schoßkind der Menschen gewesen, so eignet ihm noch zu, daß er sich so leicht aller Wissenschaft anpaßt. Er kann ihre Ergebnisse in sich aufnehmen, und indem er sie ins Hohe und Höchste zu führen vorgibt und versucht, scheint er sie sogar zu veredeln. Dazu kommt der große Einfluß, den er auf die Kunst ausübt, die ja von Dichtung sich nährt und lebt. So darf es nicht wundernehmen, daß der Baum der Theosophie mit seinen verschiedenen Zweigen immer reich in Blüten gestanden hat, wenn auch diese Blüten nur selten Früchte entwickelten. Auch kommt es dem Menschen nicht immer auf die Früchte an.
Am Eingang der neueren Zeit steht die imponierende Gestalt des Kardinals Nikolaus Cusanus (eigentlich Krebs, zu Cues an der Mosel 1401 geboren, gestorben 1464). Er ist bis zu einem gewissen Grade Pandeist. Gott schafft die Welt nur aus sich (de nullo alio creat, sed ex se); indem er alles umfaßt, entfaltet er alles aus sich, ohne doch sich dabei irgend zu verändern. Im Grunde ist das eine Emanationslehre. Doch verwirft der Cusaner die Abstufungen in dieser Lehre, die Welt ist als Ganzes aus Gott entstanden. „Gott ist vermittelst des Universums in allem, und die Vielheit der Dinge vermittelst des Universums in Gott“ (Deus est mediante universo in omnibus et pluralitas rerum mediante universo in deo). Und so gehört auch ausnahmslos alles zusammen, und wir vermögen das Einzelne nur als Glied des Allgemeinen und das Allgemeine nur als Ausfluß Gottes zu erkennen. Deshalb entscheidet der Cusaner die oft aufgeworfene Frage, ob etwas aus der Wirkung oder aus der Ursache erkannt werden kann,[S. 307] dahin, daß dieses nur aus der Ursache, in letzter Instanz also nur aus Gott, zu geschehen vermag. In der Welt haben wir daher „wie in einem Buche, geistig die Gedanken Gottes zu lesen“. Die Idee von dem absoluten Ganzen der Welt, von ihrem absoluten inneren Zusammenhange dürfen wir gerne entgegennehmen; sie entspricht unserem Wissen von der Welt, und ist übrigens sehr alt, da sie sich schon bei den ionischen Naturphilosophen und bei Herakleitos, bei Platon u. a. findet. Einer pandeistischen Anschauung ist sie so gemäß wie einer rein physischen. Freilich faßt er den Zusammenhang der Geschöpfe nicht mechanistisch auf, sondern die allgemeine Liebe aus Gott verbindet jedes mit allem, wie in einem Lebewesen, womit nach Platon die Welt auch verglichen wird, indem jedes Glied mit allen anderen Gliedern sympathisch zusammenhängt, so daß keines verletzt werden kann, ohne daß alle Glieder darunter leiden. Wenn nun Cusanus dazu kommt, gleichwohl drei Welten zu unterscheiden: eine intelligible um Gott, eine intelligible um den menschlichen Geist, eine sinnliche um die sinnliche Welt, so kann das eigentlich nur den Sinn haben, daß unsere Tätigkeit sich auf Gott, auf unseren Geist, auf die sinnliche Welt richtet, so daß es sich nur um drei Stufen der Intelligenz handelt, die sich auf drei Verschiedenes in der Einheit richten, wie uns schon bekannt. Indem der Mensch nun zunächst von oben nach unten geht, findet er unten die Begrenzung und muß umkehren, um nach oben zu steigen. So wendet sich alles erst vom Hohen zum Sinnlichen und dann vom Sinnlichen zurück zum Hohen. „Dieses ist der Kreislauf des Seins und des Denkens. Und so kehrt alles in das Prinzip zurück, von welchem es ausgegangen ist.“ Goethes Kontraktion und Expansion! die wir auch schon aus anderen Lehren kennen. Schlimm ist es aber, daß der Mensch zwar in sich die Welt und sich in der Welt erkennt, jedoch nur menschlich und vermittelst der Welt. Gott und die Wahrheit unmittelbar zu erkennen, ist ihm nicht gegeben. Er kann beides nur durch die Welt erkennen. Auch so noch ist er zuletzt nur auf wahrscheinliche Vermutungen (conjecturae) angewiesen. Diese Ver[S. 308]mutungen, die unsere Vernunft, unsere Gedankenwelt zusammensetzen, schaffen wir, wie Gott die Welt schafft. Und so befinden sich alle unsere Wissenschaften nur innerhalb der Genauigkeit. Völlig wie ein moderner Naturforscher räsoniert, wenn er von der leeren Wahrheit der Unvereinbarkeit des Widersprechenden absieht und die Welt nimmt, wie sie sich ihm darbietet. Es ist merkwürdig, daß ein Kardinal das sagen konnte, denn die Vermutung bezieht sich auch auf unsere Kenntnis von Gott und im Grunde auch auf die Sittengesetze. Nur die Vermittelung durch Gott selbst gestattet, die Genauigkeit in eine gewisse Wahrheit zu wandeln. Es scheint, als ob der Cusaner uns so beschränkt, weil wir das Unendliche nicht fassen können. Und das hat seinen guten Grund. Das Unendliche als Fertiges liegt allerdings nicht im Bereiche unserer Intelligenz, die diskursiv ist. Ein Kreis bleibt für uns ein Kreis; mag sein Mittelpunkt noch so weit von uns fortrücken, er wird im Fortrücken seines Mittelpunktes niemals etwas anderes für uns als ein Kreis. Und so wissen wir vom Kreis immer nur das eine; was ein Kreis mit einem vollendet unendlich großen Radius ist, wissen wir nicht, denn die Antwort: eine gerade Linie, ist falsch, obwohl der Herr Verfasser sie selbst in einem Examen gegeben hat. Aber die Gnostiker behaupten ja, daß wir die Unendlichkeit in der Intuition besitzen. Auf diesem Standpunkt scheint also Nikolaus Cusanus sich nicht zu befinden. Im übrigen ist für ihn die Welt zwar unendlich und für unendliche Zeit, aber von Gott in der Endlichkeit geschaffen. Und indem sie von Gott doch verschieden ist und nicht sein unendliches Wesen einbegreift, ist sie auch „wegen der in ihr liegenden Zufälligkeit der Materie“ unvollkommen, eine uns schon bekannte Wendung. Da zeigt sie sich denn wenigstens als das Vollkommenste, ein bestes Gemeinsames, dem „das Bild und das Leben Gottes in unvergänglicher Weise eingeprägt ist“. Im Grunde wäre das die Sprache eines religiös-frommen Naturforschers, nicht eines Mystikers, wie mitunter gesagt wird. Der Cusaner hat uns lediglich auf die unendliche Entwicklung verwiesen, auf die asymptotische An[S. 309]näherung an Wahrheit und Gott, obwohl auch in seinem System ein mächtiger Helfer in Christus, als Mittler zwischen Mensch und Gott, steht.
Nicht ganz, aber fast Neuplatoniker, durch seinen Kampf gegen Aristoteles und die aristotelischen Scholastiker bekannt, und durch seinen Einfluß, den er auf Cosmo von Medici und dadurch auf die Akademie zu Florenz geübt hat, von Bedeutung ist der Grieche Gemistos Plethon (um 1450), dem man sogar polytheistische Neigungen nachgesagt hat. Gott ist das Eins, und in ihm sind Wesen, Energie und Vermögen zu einer Einheit verbunden. Erste Emanationen sind die Geister, die das ganze Gebiet der Vernunft (νοῦς), Gottheiten, verschiedenen Wesens, verschiedener Energie und eines Vermögens, das mit Wesen und Energie verbunden ist, bedeuten. Die zweite Emanation ist die Seele als Weltseele, in der auch das Vermögen als ein Besonderes sich geltend macht. Gott (Zeus, Basileus) schafft die Welt der sinnlichen Dinge, die Materie ist als Unbestimmtes nur ein Zeichen der Unvollkommenheit dieser sinnlichen Dinge, nicht ein Besonderes, das schon dagewesen wäre vor der Welt. Vorsehung und Notwendigkeit beherrschen die Welt, beide in Gott begründet und selbst die Gottheiten beugend. Der Notwendigkeit ist sogar Gott selbst unterworfen. Die Gottheiten sind Vermittler zwischen Gott und der Welt. Das Ganze macht einen verworrenen Eindruck; man weiß nicht recht, was die Gottheiten zu tun haben, wenn Gott selbst alles schafft, wenn Vorsehung und Notwendigkeit herrschen. Wenn die Gottheiten nur Naturkräfte sind, warum wird ihre Verehrung von einem Christen polytheistisch empfohlen? Man weiß auch nicht, woher der Mensch den freien Willen hat, der von ihm behauptet wird, und davon doch seine Verantwortlichkeit abhängt. Ein Anhänger des Plethon war sein Schüler, der berühmte Kardinal Bessarion.
Die Akademie zu Florenz hat wohl in Cosmo di Medici ihren Begründer, es war eine geistige Gemeinschaft. Platonismus, und vor allem Neuplatonismus wurden gepflegt. Marsilius Ficinus (1433–1499) gehörte zu den hervorragend[S. 310]sten Vertretern dieser Akademie. Den Neuplatonikern kann er nur bis zu einem gewissen Grade zugezählt werden, denn er verwirft die Plotinische Emanationslehre ganz und gar. In vielem steht er auf dem Boden der Lehre des Thomas von Aquino, er ist wesentlich Theologe. Daß er nebenbei auch Mystik treibt, von Seelen der Gestirne spricht, von ihren Einflüssen auf die irdischen Dinge, daher Kabbala lehrt und Alchymie, das hebt ihn noch nicht auf die Höhe theosophischer Gedanken über die Welt. Doch nimmt er eine Weltseele an, die alles belebt, und behauptet, daß wir mitunter schon im Dasein Gott schauen können, und daß „die Seele, von den Fesseln des Körpers erlöst und rein scheidend, aus einem sicheren Grunde Gott wird (fit deus); Gott aber und Gottes Ewigkeit ist das gleiche“. Ganz theologisch ist wieder, wenn jedem Wesen eine besondere Seele zugeschrieben wird.
Eine sympathische und durch seinen frühen Tod verklärte Gestalt ist der Freund des Ficinus, Giovanni Pico (1463–1494), jüngster Sohn des Fürsten von Mirandola. 900 Streitsätze schlug er nach der Sitte der Zeit, nach der ja auch Luther verfuhr, in Rom an und forderte alle zum Kampfe um sie heraus. Selbst das Reisegeld für Ferne wollte er bezahlen. Aber dreizehn dieser Sätze schienen ketzerisch, und Innozenz VIII. verbot den Kampf. Pico war Dichter und Philosoph. Als letzterer kam er zu der auch vielen anderen geläufigen Ansicht, daß im Grunde die meisten Philosophen doch gar nicht so sehr voneinander in ihren Meinungen abwichen. Der Leser wird das schon aus dem Bisherigen bestätigen können. Der Mensch ist ein mittlerer Mikrokosmos. „Gott gibt dem Menschen bei der Geburt die mannigfaltigen Samen und Sprossen aller Art Leben ein.“ Ganz auf sich gestellt, vermag er alles nach unten und alles nach oben zu durchleben. Wendet er seinen Blick nach oben und zieht sich in die Mitte des Universums, also wohl in sich selbst, zurück, so wird er „Eins mit Gott Geist werden, in des Vaters einsamer Finsternis (Abgeschiedenheit? Sigê?), der über allem thront, und wird allem vorausstehen“. Mit dem Begriffe Gottes plagt sich Pico nicht minder, wie alle anderen[S. 311] vor ihm und nach ihm, die diesen Begriff auf das Höchste treiben wollten und wollen. Das liegt daran, daß alle Ausdrücke der sinnlichen Welt angepaßt sind. Und ob man „Sein“ sagt, oder „Eins“, oder „Das“, oder „Selbst“, man bleibt in der sinnlichen Welt und mindestens in den Kategorien der menschlichen Vernunft. Was wir von Gott bejahen, müssen wir deshalb von ihm verneinen. Und so meint in der Tat „Gott sei Alles“ das gleiche wie „Gott sei Eins“, „Gott sei das Sein“ nichts anderes wie „Gott sei das Nichtsein“. In manchen Lehren erinnert Pico an Nikolaus von Cusa, so namentlich in der von der Einheit der Welt, von der Notwendigkeit der Materie für das erste Leben und Erkennen, von der Befreiung von dieser Materie durch die allumfassende Liebe, und in der Anerkennung und Hervorhebung der Freude an der Schönheit der Welt und der Menschenwerke. Angenehm berührt seine Toleranz gegen jede Religion bei eigener tiefer Religiosität.
Auf dem gleichen Wege treffen wir unseren Landsmann Johann Reuchlin (1455 zu Pforzheim geboren, gestorben 1522, er nannte sich gräzisiert auch Kapnion). Er war in Italien und kannte Pico persönlich. Das ist nun ein Theosoph und Mystiker aus des Herzens Grunde. Er hat auch ein höchst umfangreiches Werk über die Kabbala geschrieben. Er verwirft manches dieser Lehre, aber das meiste anerkennt er doch. „Denn was anderes bezweckt der Kabbalist oder Pythagoras, als die Seelen der Menschen in Götter zu beziehen, das heißt, sie zur vollkommenen Glückseligkeit zu fördern“, sagt er. Und Gott gleich werden ist sein Bestreben, denn der Grund aller Vernunft ist die letzte und höchste Wahrheit. Diese Wahrheit kann aber nicht durch Denken erreicht werden, das ja nur diskursiv wirkt, sondern allein durch innere Offenbarung. Er urteilt darum auch von Denken und Logik sehr gering. Darin tut er eigentlich, gerade nach seiner Ansicht, unrecht, denn die Gesetze der reinen Logik sind als Selbstverständlichkeiten Offenbarungen, durch keinen Schluß zu gewinnen. Ja solche Sätze wie „das Nichtseiende ist Seiendes und das Seiende ist Nichtseiendes“ stellen[S. 312] nur scheinbar einen logischen Widerspruch dar, wie schon oben bemerkt. Er meint — der Leser verzeihe diese Abschweifung — der obige Satz sei in mente richtig, da könne man Entgegengesetztes und Widersprechendes vereinigen, aber in ratione würden sie weitest auseinandergehalten. Doch nicht, die Worte besagen ja nichts ohne Bezugnahme. Der Satz an sich ist in mente gerade so falsch wie in ratione. Wendet man ihn aber auf etwas an, dem wir alle positiven und alle negativen Prädikate gleicherweise zusprechen oder absprechen, so ist er richtig. Es gehört das zu den Antinomien unserer Vernunft. Aber Reuchlin haßt die Logik — und das ist sehr bezeichnend — als „Feind des Glaubens und der Theosophen“, was also die arme Logik gar nicht ist, wenn Reuchlin unter Logik nicht das Urteil des sogenannten kalten Verstandes meint. Dieses können Glaube und Theosophie allerdings nicht brauchen, oder nur in dem Sinne des Cusaners. Ganz entgegen dem Cusaner schreibt er jedem Dinge sein eigenes besonderes Wesen zu, das es aus den allgemeinen Naturgesetzen herausheben kann. Darum muß auch jedes Ding für sich in seinen geheimsten Eigenschaften studiert werden. So kommt er also auch zur Magie, freilich auch zur Naturwissenschaft.
Ein Genosse Reuchlins in Theosophie und Okkultismus war der Kölner Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486–1535), ein höchst unruhiger und zerfahrener Herr, der alles mögliche trieb und sich mit allen Leuten zankte. Und dabei doch ein nicht unbedeutender Mann. Bei allem Hang zur Mystik spricht er mitunter wie ein moderner Naturforscher, so hinsichtlich der Grundlagen der Wissenschaften, und er hat auch die Naturwissenschaft zu fördern versucht. Und obwohl er, ganz wie Reuchlin, die Offenbarung in uns sucht und alle Schlußwissenschaften als eingebildet und leer abweist, ist doch seine Mystik durch fromme Religiosität gemäßigt. „Nicht in der Zunge, sondern im Herzen ist der Sitz der Wahrheit; nicht der Verstand, sondern der Wille verbindet mit Gott.“ Die Freiheit des Menschen geht ins weiteste, und so darf er auch die Schrift auslegen und braucht[S. 313] sich nicht an theologische Behauptungen zu halten. Was Agrippa von der Religion sagt, ist fast alles vortrefflich; Luther freilich zählt er zu den Ketzern und Kupplern, ohne deshalb dem Papste gewogen zu sein. Alle Dinge hängen aber in ihrem Urgrunde zusammen. Die Welt ist dreifach: die elementare sinnliche (Welt der irdischen Dinge), die himmlische (Welt der Gestirne), die übersinnliche (Welt der Intelligenzen). In allen Welten findet sich das gleiche, nur in steigender Vergeistigung, ein Gedanke, den wir schon von Gnostikern und Kabbalisten kennen. Gott aber ist das Urbild von Allem. Was aus ihm hervorgeht ist: bei den Intelligenzen die verteilten Gewalten, bei den Gestirnen die Kräfte, in der sinnlichen Welt die Körper. Der Mensch hat vom Göttlichen, und darum kann er auch das Göttliche schauen. Wie Reuchlin, schreibt er den Dingen der Welt besondere Wesenheit, qualitates occultae, zu und mit den gleichen Folgen. Was ihn dazu veranlaßt, ist die Bemerkung, daß die Körper aufeinander wirken, was aus der Materie nicht erklärbar sei. Nun, wir plagen uns noch heute mit dieser Angelegenheit, obwohl wir von den qualitates occultae nichts wissen wollen. Agrippa sieht in allen Elementen Leben und Seele, er leitet sie aber von einer allgemeinen Weltseele ab, zwischen die und die Körper er als Vermittlung einen Welthauch (spiritus) setzt, der nicht Körper und nicht Seele sein soll, eine Art Äther, nach den drei Welten und der Weltseele auch „fünfte Essenz“. Das Ganze hat das Aussehen einer Emanationslehre. Und durch einen Sinn der Natur, welcher auch den Tieren innewohnt und ihnen einen wahrsagerischen Geist gibt, hängen wir mit der übrigen Welt zusammen, in einer Weise, welche die menschliche Wahrheit weit übersteigt; „wir vermögen durch ihn die verborgenen Zeichen der Dinge zu erkennen und ihre geheimen Kräfte zu gebrauchen.“ Das wieder ist hellste Mystik, wenn es nicht naturwissenschaftlich gedeutet wird.
Wie eine starke Abkühlung nimmt sich solcher Schwärmerei gegenüber die Lehre des Mantuaners Petrus Pomponatius (1462–1525 oder 1530) aus, den man auch als Atheisten[S. 314] verschrien hat. Der Mensch wird sehr tief gestellt nach Verstand und nach Sittlichkeit. Das Wahre zu erkennen, ist ihm nicht gegeben. Übel und Sünde aus der Unvollkommenheit der Welt zu erklären, lehnt er ab. Er meint, Gott habe die Welt nach allen Möglichkeiten geschaffen. Zu diesen Möglichkeiten gehörte aber ebenso alles Übel wie alles Gute. „Alles Gute und alles Übel der Natur ist von Gott.“ Aber die bewußte Sünde gleichfalls in dem Weltplan zu suchen, scheut sich unser Philosoph, wie alle Religionsphilosophen sich scheuen. Er meint, diese stamme aus dem freien Willen des Menschen. Die Welt ist wie zufällig aus dem Willen Gottes in der Endlichkeit hervorgegangen und hört in der Endlichkeit auf. So spielt auch die Welt eine nur sehr geringe Rolle. Es ist eine trübselige Anschauung, etwas erhellt durch die Abweisung der noch trübseligeren Lehre von der Prädestination. Die Gaben Gottes an die Menschen gehen nur nach dem Guten, und auch nur ohne Zwang; der Mensch hat die Fähigkeit bekommen, nach dem Guten zu streben. Tut er es nicht, wendet er sich zum Bösen, so hat er die Folgen im Diesseits und im Jenseits zu gewärtigen. Hier spricht er ganz wie ein Theologe, und theologisch ist im Grunde auch seine Ansicht von der Unsterblichkeit der Seele. Letztere ohne Leib kann er sich nicht denken; die absolute Unsterblichkeit lehnt er darum ab. Aber die Auferstehung im Leibe gibt er zu, wie ja auch die Lehre vom jüngsten Gericht fordert. Pomponatius ist Aristoteliker und dementsprechend reichlich praktisch nüchtern. Er gehört zu den Materialisten des Mittelalters.
Den Praeceptor Germaniae und großen Humanisten Philipp Melanchthon dürfen wir hier übergehen. Abgesehen von der Theologie und der schönen Sittlichkeitslehre, hat er nirgend einen besonderen eigenen festen Standpunkt und keine Wendung, die in der Anschauung von Welt und Leben etwas Neues besagte. Luther werden vielfach mystische Neigungen zugeschrieben, sein Verhalten gegen Teufel und Hexen spricht wohl dafür. Aber der große Reformator hatte zu viel mit der Praxis zu tun, als daß er sich der Schwärmerei[S. 315] oder neuen Anschauungen hätte hingeben können. Höchstens, daß der Kirchenvater Augustinus, dem der düstere Calvin folgte, seine jugendlicheren Jahre beherrschte. Zwingli aber ist Neuplatoniker als Philosoph. Überhaupt war die Reformation zunächst der Ausbildung größerer Anschauungen nicht günstig. Die Religion zu reinigen von Schlacken und Äußerlichkeiten, nahm alles in Anspruch, und wo auf die Innerlichkeit zurückgegangen wurde, geschah es doch wesentlich auf Grund schon alter Formeln. Wie rasch auch die reformierten Kirchen verknöcherten, ist bekannt. Erst die entfesselte Forschung der Humanisten, Astronomen und Naturforscher, die plötzliche Weitung des Blickes rings um die Erde herum, haben die neue Zeit aufgehen lassen. Mit der eindringenden Kenntnis des schönen und freien Heidentums, mit der Zertrümmerung des Himmels und der Übertragung seiner Gebilde aus der Sphäre der Geister und Engel in die irdische Welt, mit den experimental gewonnenen Ergebnissen auf dem Gebiete der Mechanik, Physik und Chemie, mit der Einsicht von der frei schwebenden Kugel der Erde, von ihren Landen, Bewohnern und Produkten konnten alte Probleme mit neuen Ideen in Fülle verarbeitet werden. Ob das aber ohne die Reformation so rasch hätte geschehen können, darf nach dem Schicksal, das so viele edle Geister unter dem Papsttum noch im 16. und 17. Jahrhundert betroffen hat, wohl bezweifelt werden. Das Standbild auf dem Campo dei fiori redet eine zu deutliche Sprache.
Neben der rein theologischen Festigung der Welt- und Lebenanschauung ging die mystische, die sich auch in den bekannten Aufständen Luft machte. Es ist natürlich, daß zu einer so bewegten Zeit wie die der Reformation viele für sich selbst denken und handeln wollen, zumal wenn die Lösung, die man ihnen vom Bisherigen gibt, doch nur wieder Fesseln anlegte, und keineswegs solche von Rosen, wenn auch nicht so eiserne wie die früheren. Und so zeigt die Reformationszeit Menschen, die sich ganz in sich zurückziehen möchten, um dort nach theosophischen Lehren Gott und sein Werk zu finden, oder die das Reich Gottes auf Erden schon gekommen[S. 316] wähnen und alles Volk zu diesem Reich berufen. Karlstadt, Sebastian Frank, Schwenkfeld, die Wiedertäufer sind einige Namen und Bezeichnungen. Etwas marktschreierisch, namentlich aber verworren, trotz allen Ernstes und aller Tüchtigkeit, wirkte der Bombastus Theophrastus Paracelsus von Hohenheim (1493 zu Einsiedeln in der Schweiz geboren, 1541 gestorben), ein höchst unruhiger Mann, dem Aberglauben aufs äußerste ergeben. Mitunter redet er durchaus wie ein moderner Naturforscher und bald darauf wie in verirrter Phantasie. Er heilt durch gute chemische Mittel und behauptet doch, daß in den Gestirnen das Schicksal des Menschen bestimmt sei. Wie vielen, ist ihm der Mensch ein Mikrokosmos, der den Makrokosmos in sich trägt. So deutet er die biblische Erzählung, daß der Mensch aus dem Staube gemacht sei, dahin, dieser Erdenkloß sei „ein Auszug aus allen Körpern und Geschöpfen, aus Himmel und Erde“ gewesen, eine „fünfte Essenz“, die wir schon kennen. Das meiste ist trivial, wenn man es aus seiner verstiegenen Sprache in einfachen Ausdruck überträgt, oder es ist unverständlich. „Und wisse,“ heißt es einmal, „daß die Seele (bei Paracelsus der unsterbliche Teil des Menschen) Blut und Fleisch ist und in Blut und Fleisch sein muß, und aber, daß da zweierlei Fleisch sind, das tödlich und das ewig.“ Das Sterbliche ist der Geist oder die Geister im Menschen. Und Geister sieht Paracelsus überall. Höchst sonderbar klingt es, wenn er die drei chemischen Elemente, die er mit Früheren unterscheidet — Quecksilber, Schwefel, Salz — mit Geist, Seele und Leib, nicht bloß formell zusammenstellt. Sein Gewährsmann ist der Allerweltsgewährsmann Hermes Trismegistos. Die ganze Welt ist ein chemischer Prozeß, in dem aus der chaotischen Verwirrung der Verbindungen allmählich das Unreine nach einer Seite, zur ewigen Qual in der Urmaterie, das Reine nach der anderen Seite, zur Verklärung und Freude in Gott, ausgeschieden wird; jenes ist das Böse, dieses das Gute. Der chemische Prozeß ist nicht bildlich gemeint, aber selbstverständlich nicht in der Beschränkung, in der wir einen solchen verstehen. Es ist nicht ohne Interesse, solche Lehren[S. 317] vorzutragen, weil aus ihnen doch erhellt, wie sich der Mensch bemüht, den Gang der Welt und des Lebens unter ein ihm verständliches Prinzip zu bringen; der Chemiker und Arzt, der Paracelsus vornehmlich war, nimmt ein chemisch-biologisches Prinzip. Der Cosentiner Bernard Telesius (1508 bis 1588) benutzte ein anderes Prinzip, den Kampf zwischen Wärme und Kälte (fast möchte man sagen Expansion und Kontraktion). Die Kälte ist in der Mitte der Welt, in der Erde, die Wärme ringsum im Himmel und in der Sonne. Gott hat sie so angeordnet, und nachdem er es getan, bedarf es keines neuen Eingreifens. An der Grenze zwischen der Wärme und der Kälte berühren sich beide und bringen dadurch alle Vorgänge hervor. Das ist physikalisch gedacht, und Telesius war Physiker, sogar mathematischer Physiker. Als solcher leugnete er auch die Leere und neigte er gar sehr zum Materialismus. Das gehört aber nicht mehr hierher. Ein anderer, wie der Illyrier Franz Patritius (1529–1597) nimmt körperliches und unkörperliches Licht für Kälte und Wärme. Doch ist ihm freilich das unkörperliche Licht, das göttliche Licht der Gnostiker und Neuplatoniker deren Anschauungen er sich anschließt. An die moderne Panspermie (S. 447) erinnert seine Annahme, daß die ganze Welt von Samen des Lebens erfüllt sei, welche vom Lichte getragen und verbreitet werden. Die Ähnlichkeit mit der modernen Panspermie ist sogar durch den Träger viel größer als es auf den ersten Blick scheint. Es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne! Selbst was ein neuzeitlichster sonderbarer Vierdimensionenschwärmer ermittelt hat, daß die Körper Schlacken (Faeces) sind, hat Patritius schon ausgesprochen. Er nennt die Erde den Auswurf (faex) in dem Flusse des Weltlebens.
Der edle Märtyrer Giordano Bruno (zu Nola um 1548 geboren und zu Rom 1600 schmachvoll verbrannt) ist hier zunächst wegen seiner Anschauung vom Zusammenhange der Welt mit Gott zu nennen. Er schließt sich darin Nikolaus von Cusa an, aber mit einer Neigung nach der mehr gnostischen Seite hin. Gott ist zwar nur sich selbst erkennbar, aber er ist nicht außer uns, und darum haben wir ein Bewußtsein von[S. 318] ihm. „In allen Dingen ist das Göttliche in verborgener Weise und die Einheit des alles umfassenden Prinzips, wenn auch in der Mannigfaltigkeit zerstreut, vorhanden.“ Dieses Prinzip ist nach Bruno die universelle Vernunft, „das innerste, wirklichste und eigenste Vermögen und der Teil der Weltseele, der ihre Macht bildet. Sie ist ein Identisches, welches das All erfüllt, das Universum erleuchtet und die Natur unterweist, ihre Gattungen so, wie sie sein sollen, hervorzubringen.“ (Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, Übersetzung von Adolf Lasson.) Diese universelle Vernunft wirkt also von Innen heraus. Sie ist der Grund aller Bewegung und Entwicklung der Welt und aller Dinge. Sie ist die Vernunft, „welche alles macht“, in der Mitte zwischen der Vernunft, welche alles ist, und der Vernunft der einzelnen Dinge, welche alles wird. Wir haben es aber bisher nur mit einem Teil der Weltseele zu tun gehabt, der Macht. Der zweite Teil ist die absolute Herrschgewalt; sie lenkt die Welt, ohne von ihr irgend beeinflußt zu werden, und verleiht ihr Leben und Vollkommenheit, beides stufenweise aufsteigend bis zu den vollkommensten Wesen. Die Welt wird als ein „gewaltiger Organismus“ bezeichnet und als „ein Abbild des obersten Prinzips“. Und es werden diejenigen getadelt, „welche nicht einsehen, noch anerkennen wollen, daß die Welt mit ihren Gliedern belebt sei; als ob Gott sein Abbild beneidete“. Alle Teile der Welt sind beseelt, und zwar „ohne allen Abzug“. Indessen sind viele, eben die, die wir unbelebt nennen, nur der Fähigkeit nach beseelt; sie enthalten wenigstens „ein Prinzip und einen Keim des Lebens“. Das bedeutet eigentlich, daß diese Dinge in ein entstehendes oder vorhandenes beseeltes Wesen eingehen können, ohne darin ein Fremdes zu sein; ihre fakultative Beseelung geht in wirkliche über, sie beleben sich. Aber doch scheint Bruno dem unbelebten Körper eine gewisse andere Beseelung zuzuschreiben, indem er sich auf die Wirkungen bezieht, welche sie auf uns, als beseelte Wesen, hervorbringen, wie Affekte, Begierden, Gefühle usf. Er beruft sich sogar darauf — und das ist für den so klaren Bruno etwas seltsam —, daß „die Nekromanten viele[S. 319] Dinge durch Totengebeine zu bewirken hoffen, und daß sie glauben, dieselben behielten, wenn auch nicht dieselbe, doch eine Art von Lebensfunktion, welche ihnen zu jenen außerordentlichen Wirkungen verhelfen können“. Lasson hat dazu eine sehr lesenswerte Bemerkung geschrieben. Bruno zahlt seiner Zeit den Zoll. So verwirft er auch nicht Krankenbehandlung durch Anhängen von Steinen und Murmeln von Beschwörungsformeln, durch Magie oder durch Fünftelessenzen neben der Behandlung durch die Apothekerheilmittel, aus dem Vernunftsatz, daß es besser ist, auf irgendeine Weise geheilt zu werden als gar nicht. Die Hauptsache ist, man weiß jetzt, was Bruno unter der Allbeseelung meint: gewisse Funktionen, die auch dann noch bestehen, wenn ein Wesen tot ist, und die überhaupt aller Materie angehören, höhere Funktionen bei Pflanzen, noch höhere bei Tieren, Menschen usf. Die Beseelung ist der Welt „immanent“. Außer der Weltseele besteht eine Materie, ein Substrat, die von uns so wenig definiert werden kann wie die Weltseele. Die Verbindung mit der letzteren gibt die Dinge. Die substanzielle Form der Dinge ist die Seele. Materie wie jede Seele „können nicht zerstört und vernichtet werden, so daß sie das Sein durchaus und in jedem Sinne verlören“.
So ist die Welt ein dreifaches Unvergängliches: Universelle Vernunft oder allgemeine Weltseele, Macht der universellen Vernunft oder eigentliche Weltseele, Materie oder Substrat. Bei Gott nun ist Vermögen und Wirklichkeit das gleiche, er ist „Urvermögen“ und „Urwirklichkeit“. Die Welt aber, deren jeder einzelne Teil ja etwas anderes sein könnte, wie ein Stein auch Holz, ein Mensch dieser oder ein anderer, verbindet Vermögen und Wirklichkeit nicht; ersteres ist bei weitem umfassender. So ist alles expliziert, zerstreut, unterschieden. Darum wird die Welt als Schatten, auch Ebenbild, des Urvermögens und der Urwirklichkeit bezeichnet. Aber dieses Ebenbild „ist in spezifischer Wirklichkeit alles das, was es seinem spezifischen Vermögen nach ist“. „Deshalb“, wird dann noch gesagt, „wird es nicht schwierig und nicht bedenklich sein, schließlich anzunehmen, daß das[S. 320] Ganze der Substanz nach eines ist.“ Beim Herabsteigen auf der Stufenleiter der Natur gibt es zwar eine doppelte Substanz, eine geistige und eine körperliche; aber schließlich gehen beide „auf ein Wesen und eine Wurzel zurück“. Dieses wird in der mannigfachsten Weise variiert, so indem in der Materie eine körperliche und eine unkörperliche unterschieden wird, die beide aber doch nur Materie sind. Die Materie, in diesem Sinne aufgefaßt, entfaltet alles, was sie unentfaltet enthält, „darum muß man sie ein Göttliches, die gütigste Ahnfrau, die Gebärerin und Mutter der natürlichen Dinge, ja der Substanz nach die ganze Natur selber nennen“. Sie ist das Universum und ein „Einiges, Unendliches, Unbewegliches“. Diese Eigenschaften des Universums werden nach allen Richtungen ausgeführt, indem immer das Gegensätzliche als mit dem Universum gleich vereinbar dargelegt wird (S. 311). Da es alles vereinigt, kann es nicht ein Einzelnes sein. Also hat es keine Gestalt, keine Bewegung, nicht Größe noch Kleinheit, nicht Zeit noch Ewigkeit, nicht Zentrum noch Umgebung. Es ist unveränderlich; die einzelnen Dinge ändern nur die Art des Seins, nicht das Sein selbst, und das Universum umfaßt alle Arten des Seins. So ist das Universum in allem. Von diesem Standpunkt aus ist auch das Sterben nur ein Wechsel der Art des Seins oder des Ortes im Universum. Und so gibt es auch nichts Neues im Universum; was ist, war schon, und was kommt, war schon; ein Gedanke, der sich auch bei dem Cusaner findet, und der im „Prediger“ so oft ausgeführt wird. „Da seht ihr also wie alle Dinge im Universum sind und das Universum in allen Dingen, wir in ihm, es in uns, und so alles in eine vollkommene Einheit einmündet.“ Und diese Einheit ist stetig und dauert immer, dieses Eine ist ewig. Jedes Ding im Universum, weil es das, was alles in allem ist, in sich hat, umfaßt in seiner Art die ganze Weltseele. Diese Weltseele ist also in jedem Teile des Universums ganz. Auch sind die Welten nicht etwa wie in einer Ausdehnung oder einem Orte, sondern „wie in einer umfassenden, erhellenden, bewegenden wirkenden Kraft, welche von jeder dieser Welten ebenso umfaßt wird wie die[S. 321] ganze Seele von jedem Teile derselben“. Wichtig ist auch die Bemerkung, „daß es eine und dieselbe Stufenleiter ist, auf welcher die Natur zur Hervorbringung der Dinge herabsteigt, und auf welcher die Vernunft zur Erkenntnis derselben emporsteigt, indem sie durch die Vielheit der Mittelglieder sich bewegen“. Fast darwinistisch aber klingt es, „daß die Vernunft die Vielheit und Verschiedenheit der Arten auf eine und dieselbe Wurzel zurückführt“. Und so faßt die Urintelligenz alles aufs vollkommenste in einer Anschauung. Und diesem hat der Mensch nachzustreben, um zum „Unterschiedslosen“ zu gelangen.
Es ist schwer zu sagen, in welche Kategorie wir des großen Nolaners Lehre einzutragen haben; sie ist ebensowohl theosophisch als emanistisch, als panpsychistisch, als physisch (Bruno war Anhänger des Kopernikanischen Systems), je nach der Deutung, die man seinen Bezeichnungen gibt. In anderen Schriften tritt das Theosophische mehr hervor als in der hier besonders benutzten Hauptschrift. Also darf man vielleicht glauben, daß das ganze System eine Erhebung des Physischen aus seiner Natur in das Göttliche ist oder eine Durchstrahlung des Physischen durch das Göttliche; beides eine Art Pandeismus. Und so zeigt sich auch der Begriff Gottes von dem des Universums nicht getrennt; Gott ist naturierende Natur, Weltseele, Weltkraft. Da Bruno durchaus ablehnt, gegen die Religion zu lehren, so hat man solche Angaben wohl umgekehrt zu verstehen: Weltkraft, Weltseele, naturierende Natur, Universum sind in Gott. Gott ist Kraft der Weltkraft, Seele der Weltseele, Natur der Natur, Eins des Universums. Bruno spricht ja auch von mehreren Teilen der universellen Vernunft, des Urvermögens und der Urwirklichkeit. Und damit hängt zusammen, daß für ihn die Welt unendlich ist und ohne Anfang und Ende; sie ist in demselben Sinne allumfassend wie Gott. Aber nicht ganz wie Gott. Gott sei in allem und im einzelnen allumfassend, die Welt jedoch wohl in allem, aber nicht im einzelnen, da sie ja Teile in sich zuläßt. „Ich sage,“ heißt es in einer Schrift über das Unendliche, „das ganze Uni[S. 322]versum ist unendlich, denn es hat weder Rand noch Grenze noch Oberfläche; doch sage ich, daß das Universum nicht ganz und gar (totalmente) unendlich ist, daß, was wir davon auch nehmen mögen, endlich ist.“ Und an dieser Endlichkeit liegt die Verschiedenheit der Dinge und ihr Gegensatz zueinander. Für die Übel, Tod und Böses, hat Bruno keine andere Erklärung als Mangel und Unvermögen. „Sie finden sich in den explizierten Dingen, weil diese nicht alles sind, was sie sein können, und durch äußeren Zwang werden, was sie sein können. Da sie daher nicht zugleich und auf einmal so vieles sein können, so geben sie das eine Sein auf, um das andere zu erlangen.“ Das ist im Grunde nur eine Darlegung des Tatsächlichen.
Bei Giordano Brunos universalistischem Gesinnungsgenossen, dem Kalabrier Thomas Campanella (1568 bis 1639, Dominikaner wie jener; wenn auch nicht verbrannt, aber in allen Kerkern Spaniens heimisch, und alle Torturen fast gewohnt), tritt das Theosophische etwas stärker in den Vordergrund. Die Welt ist eine Mischung aus Sein und Nichts. Dem Sein, Gott, wohnen drei Primalitäten inne: Allmacht, Allweisheit und Allwille; dem Nichtsein Unmacht, Unbewußtheit, Bosheit. Die göttlichen Primalitäten äußern sich in der Welt als Notwendigkeit, Vorsehung, Harmonie. Wie die Mischung zustande kommt, ist ein transzendentes Geheimnis. Gott ist das schlechthin Seiende, ein Überseiendes, eine Übersubstanz. Er hat von seinem Sein und von seinen Primalitäten (als Liebe, Erkennen, Wollen) den Geschöpfen mitgeteilt, wie eine Emanation. Und so sind alle Geschöpfe ihrer Wahrheit nach in Gott, nur daß ihnen das Nichtsein als ein Mangel anhaftet, davon Gott selbstverständlich frei ist. Und es gibt Welten, die sich zu immer höheren Stufen erheben, wie Emanationen, und von denen jede die niederen einschließt und von den höheren eingeschlossen wird, bis zu Gott, der alles umfaßt. Selbst die Engel stehen noch viel näher dem Nichts als Gott. Das Unterscheidende der Welt als Welt, da es durch das Nichts gegeben ist, bildet also das Übel und das Böse, sonst wären die Geschöpfe Gott, und alles bestände[S. 323] unterschiedslos. Der Mensch ist frei zum Guten wie zum Bösen. Da jede Primalität von der höheren eingeschlossen ist, geht das Tun vom Willen aus, muß gelenkt werden durch das Erkennen und seine Richtung nehmen zur Liebe. Alles dieses fließt aus der Natur der Geschöpfe. Wie in diesen Rahmen die Materie, die als gänzlich eigenschaftslos angesehen wird, paßt, kann ich nicht sagen. Es hat aber Gott zuerst den Raum geschaffen, der als die Substanz der Materie anzusehen sei, dazu die Materie als solche, als begrenzte Einheit und Grundlage für alle Verschiedenheiten. Zuletzt zwei Kräfte, die, wie bei Telesius, als Wärme und Kälte angenommen werden, die beide die ganze Materie angreifen und so in Streit geraten. Durch sie aber entstehen im einzelnen lebendige Wesen, im ganzen die Ordnung und Harmonie der Welt unter Leitung Gottes oder der Engel. Dabei müssen den Wesen die Primalitäten mitgeteilt werden, direkt oder indirekt. Das Ganze ist hier so wenig wie bei Telesius zu durchschauen. Überhaupt sind alle allgemeinen Angaben noch verständlich, während die Ausführungen im einzelnen für uns wenig mehr als unverständlich verlaufen. Das liegt in dem Mangel an Kenntnissen. Und solche und ähnliche Ausführungen fußen auch meist auf den Annahmen der ionischen Naturphilosophen, die, weil sehr lückenhaft überliefert, nicht anders als unklar wiedergegeben werden konnten.
Wir kehren zu unseren deutschen Theosophen zurück. Nikolaus Taurellus und Valentin Weigel übergehen wir, um uns sofort zu unserem größten Mystiker Jakob Böhme zu wenden. Dieser ebenso sonderbare wie höchst bedeutende und liebenswerte Mann ist 1575 zu Altseidenberg bei Görlitz geboren, hütete erst das Vieh und ward dann ehrsamer Schuster. Als solcher lebte er bis 1624, seinem Todesjahre, in Görlitz. Schreiben und Lesen verstand er nur notdürftig. Er wurde von wunderbaren Gesichten und Verzückungen heimgesucht, war also vielleicht ein armer kranker Mensch. Sie gaben ihm aber Anlaß, 1612 seine erste Schrift „Morgenröte im Aufgang“ (Aurora) zu verfassen. Die Theologen, überall unduldsam, eiferten gegen ihn, und so wurde ihm vom Magistrat das[S. 324] Schreiben untersagt. Nach sieben Jahren, da sein Anhang wuchs und sein Leben sich als ein frommes und unsträfliches erwies, ließ man es zu, daß er weiterschrieb. Der einfache Mann muß viel gehört und gelesen haben; er stand auch mit vielen in Verbindung. Wie der frühere Schuster Hans Sachs ist er ein gewaltiger Poet, aber in seiner innig-tiefen Weise, indem er sich eine außerordentliche Welt erdichtet und in außerordentlicher Bildersprache redet. Dabei ist er von allen Theosophen der konsequenteste, vielleicht der einzig konsequente.
Mittel zur Erkenntnis ist ihm fast allein das Schauen. Gleich wie das Auge des Menschen in die Gestirne sieht, so auch die Seele in das göttliche Wesen, darinnen sie lebt. Und aus diesem Schauen hat seine „Feder geschrieben“. Und da er eine tiefsittliche Natur ist, gewinnt alles bei ihm sittliche oder gegensittliche Bedeutung. So ist Licht: Freundlichkeit und Liebe, Wärme: Grimm, ist Haß: Finsternis und — Paracelsistisch — Begierde: Salz, Angst: Schwefel. Die Naturerscheinungen sind Gutes und Böses, und Gutes und Böses sind Naturerscheinungen. Geist und Körper gehen durcheinander. Und Gott selbst wird körperlich aufgefaßt, nur von ganz außerordentlicher Feinheit. „Die harte Qualität, die zeucht das ganze körperliche Wesen der Gottheit zusammen und hält es und vertrocknet es, daß es bestehe.“ Das Auffallende einer solchen Behauptung schwindet, wenn man bedenkt, daß ja auch der philosophisch und dialektisch so hochgeschulte Giordano Bruno Materie und Seele schließlich in Eins, die allgemeine Substanz, auslaufen läßt. Jakob Böhme hat dieses nur sinnlicher ausgedrückt. Und so sieht er in der Tat in Gottes Wesen das Nichts; das Unkörperliche und Eigenschaftslose, würden wir sagen. Aus diesem seinem Nichts schafft Gott die Welt, absteigend sie immer derber verhärtend, indem er sich zusammenzieht. In Gott ist zunächst die abgeschlossene Selbstheit, die absolute Einheit. Außerdem aber der Drang nach Selbstoffenbarung in der Vielheit. Gott bildet hiernach eine Polarität, eine Entzweiung mit sich selbst. Und so ist Gott auch Gutes und Böses. „Denn der[S. 325] heiligen Welt Gott und der finsteren Welt Gott sind nicht zween Götter; es ist ein einziger Gott; er ist selber alles Wesen; er ist Böses und Gutes, Himmel und Hölle, Licht und Finsternis, Ewigkeit und Zeit, Anfang und Ende; wo seine Liebe in einem Wesen verborgen ist, als da ist sein Zorn offenbar.“ So zu lesen im Mysterium magnum. Und man kann sich nicht deutlicher ausdrücken. Gerade aus dieser Polarität heraus, die ja einfach der Welt entnommen ist, erwächst die Welt durch Gott und in Gott, mit dem ethischen Endziele — man denke an einen ähnlichen Gedanken der Eranier (S. 202) —, daß im Bereich der Menschheit der Kampf zwischen Gut und Böse, Liebe und Haß, Güte und Zorn usf. zum Vorteil der ersten Pole entschieden wird. Jakob Böhme einfach den Gnostikern und Theosophen üblicher Art zuzurechnen, geht also nicht wohl an, obwohl er Ausdrücke der Gnostiker tatsächlich braucht. An ihm imponiert die vor nichts zurückschreckende Folgerichtigkeit seines Systems, die in Lehren, welche nur das Licht an der höchsten Stelle kennen und die absolute Einheit, nicht vorhanden sein kann; die auch mangeln muß, wo von der schwächlichen Unvollkommenheit der doch so derbe Teufel in der Welt sich herschreiben soll. Als Feuer wird dieses Böse bezeichnet, verzehrend und peinigend, wenn es sich im Menschen geltend macht. Auch ist der Teufel „in Kraft des Zornes Gottes“. Diese Eigenschaft wird in zwei Eigenschaften zerlegt, in Trieb, Begierde und in Aufnahme böser Befriedigung.
Wir haben bis jetzt zwei Eigenheiten Gottes kennen gelernt, „Quellgeister“, wie Jakob Böhme sie außerordentlich schön und bezeichnend nennt. Ein dritter Quellgeist ist das In- und Gegeneinanderwirken der beiden ersten Geister, wodurch alles aus der Selbstheit drängt und in die Selbstheit zurückfließt, ein ewiger Prozeß im Kreise. Hiernach scheint die Welt ständig auszuströmen und zurückzuströmen, also immer zu werden und zu vergehen, wie bei den Systemen, die in Gott nur das „Jetzt“ anerkennen, nicht Vergangenheit noch Zukunft (S. 287, 303). In diesen drei Quellgeistern sieht[S. 326] Jakob Böhme furchtbarste Zerrissenheit, Unruhe und Pein, als kosmogonische Begriffe. Der vierte Quellgeist, der Feuerblitz, soll die Enge in der Welt zersprengen, aus dem Bösen in das Gute, aus dem Übel in das Heil führen. Er ist also eine Art Erleuchtung durch Gottes lichte Gnade. Als fünfter Quellgeist steht das himmlische Liebesfeuer, „der wahre, der heilige Geist, der alles in Liebe eint“. Heinrich Schmitt (S. 267) vergleicht ihn mit der himmlischen Weisheit der Gnostiker. Den sechsten Quellgeist bezeichnet Jakob Böhme als Hall oder Schall. Er ist wohl das Wort, der Logos, bedeutet jedoch auch die Harmonie der Geister, „gleich einer himmlischen Musik von vieltausend Instrumenten, gegen deren göttlichen Schall, der von Ewigkeit zu Ewigkeit aufgeht, die künstlichste irdische Musik nur wie ein Hundegebell erscheint.“ „Hier herzet der Bräutigam die Braut und entstehet das wahre Leben aller Kreatur, in jedem Ding nach seiner Eigenschaft.“ Also ist es wohl auch die allgemeine Vernunft, die alles in sich in Einklang ordnet. Endlich der siebente Quellgeist führt aus dem Himmlischen ins Irdische, als irdische Vernunft und irdisches Leben und alles Heilige in sich fassend. Aber im Leben sind alle Quellgeister, bis auf die Feuer-Quellgeister, geschwächt und verdunkelt, und nur in innerlichster Anschauung hinreichend erkennbar. Dem Menschen sollen fünf von ihnen als Kampfmittel gegen die Feuer-Quellgeister dienen, die in ihm das Böse bedingen. „So sich ein Feuer in einem Quellgeiste erhebet, so ist’s der Seele nicht verborgen; sie mag alsbald die anderen Quellgeister aufwecken, die dem angezündeten Feuer zuwider sind, und mag löschen. Will aber das Feuer zu groß werden, so hat sie (die Seele) ihr Gefängnis, da mag sie den angezündeten Geist einschließen, als nämlich die herbe, harte Qualität (Entbehrung und Kasteiung, Selbstzucht), und die anderen Geister müssen ihre Stockmeister sein, bis ihm der Zorn vergehet und das Feuer verlischt.“ Mitunter freilich scheint es, als wenn das „Feuer“ ein besonderes ist, nicht ein Quellgeist. Über das Schauen der Quellgeister heißt es: „Du sollt aber nicht denken, daß das himmlische Licht in dieser Welt[S. 327] in den Quellgeistern gar erloschen sei; nein, es ist nur eine Dunkelheit, welches wir mit unsern verderbten Augen nicht ergreifen können. So aber Gott die Dunkelheit wegtäte, die über dem Lichte schwebet, und würden dir deine Augen eröffnet, so sähest du auch hier an der Stelle, wo du in deinem Gemache stehest, sitzest oder liegest, das schöne Angesicht Gottes (ein kabbalistischer Ausdruck, oder aus der Daniel-Apokalypse) und die ganze himmlische Pforten. Du darfst deine Augen nicht erst in den Himmel schwingen; denn es stehet geschrieben: das Wort ist dir nahe, nämlich auf deinen Lippen und an deinem Herzen.“ Eine schöne und höchst charakteristische Stelle für die reine Innerlichkeit der Anschauung! Der Mensch wird dreifach geboren; in der ersten Geburt (der siderischen) voll der Herrlichkeiten der guten Quellgeister, in der zweiten (animalischen) gleich einem Tiere; in der dritten, am Ende der Tage, zu Himmelreich oder Hölle. Die Engel haben nur das Gute, die Teufel nur das Böse. Aber beide nicht ausschließlich, da sie von Gott kommen und „Gott wider Gott steht“. Eine Art doppelte Prädestination ist nicht zu verkennen, doch liegt es in dem umfassenden Quellgeist, daß die Seele das Gute gegen das Böse in Kampf rufen kann. Der Weltentstehung geht der Abfall der Engel vor. „Das Wesen der verstoßenen Geister entzündet und verdichtet sich, um die neue Welt zu gebären.“ Der Mensch tritt an Stelle Luzifers. Adams Fall beginnt mit seinem ersten Schlaf im Paradiese, was für Eva nicht sehr schmeichelhaft wäre, wenn Böhme nicht meinte, daß schon das Sichüberlassen der Untätigkeit ein Zeichen der Fleischlichkeit sei. Denn das Leben denkt er sich durchaus energisch geführt, als einen Kampf des Guten in uns mit dem Bösen in uns, zum Siege des Guten.
Unter den mehreren Anschauungen Schellings, denen wir später noch begegnen werden, finden sich auch solche, die ganz auf dem Boden der Anschauungen Jakob Böhmes erwachsen sind. Gott ist die absolute „Indifferenz“, der „Ungrund“, ohne jedes Prädikat. Aber Gott ist gleichwohl potentiell eine Dualität, weil nämlich Gott auch den Grund seines Seins in sich haben muß. Dieser Grund ist in ihm als[S. 328] gesonderte Existenz. Und als Grund des Seins ist er zugleich ein Begehren nach Sein. Da er aber Gott selbst angehört, so schaut Gott hieraus sein Ebenbild, den Logos, eine Vereinigung von Vernunft und Seins-Begehren, die sich als Schaffens-Wille äußert und nun die Welt schafft und ordnet. Man sieht, wie Schelling die „Selbstentzweiung Gottes“ auffaßt. Die Vernunft geht nach oben, dem Vollkommenen, das Begehren nach unten, dem Niederen. Das Weitere, das Böhme ethisch entwickelt, behandelt Schelling mehr historisch, unter Benutzung seiner naturwissenschaftlichen und Geschichtskenntnisse. Erst überwiegt das Begehren, und es werden rohe Produkte geschaffen und erhalten, wie die ausgestorbene Vorwelt sie zeigt. Allmählich kommt die Vernunft mehr und mehr zur Geltung, es entstehen die höheren Wesen; der Mensch tritt auf, erst roh, barbarisch, dann edler. Vernunft und Begehren stehen immer in Kampf; das Fortschreiten der Vernunft ist kein stetiges, aber ihre Wirkung geht, mit Schwankungen, doch aufwärts. Das Endziel ist die Oberherrschaft der Vernunft, das Schwinden des Begehrens, die Vereinigung der Welt mit dem Göttlichen zu einer Identität.
Auch Krause (1781–1832) scheint sich dem Hauptprinzip Böhmes angeschlossen zu haben, indem er das Dasein der Welt aus einer „inneren Entgegensetzung der Wesenheit in Gott“ ableitet. Und obgleich er Pantheist ist, überträgt er doch alles in Gott, so daß seine Lehre eine All-in-Gott-Lehre sein soll, und verleiht Gott Eigenschaften, die nicht weit ab von den Quellgeistern Böhmes liegen. Manches aber freilich paßt sich den Anschauungen der Zeit an, und einzelnes, wie es scheint, dem Spinozaschen Pantheismus. Überhaupt werden wir sehen, daß Jakob Böhmes Entzweiung Gottes mit sich sehr oft benutzt wird, noch bis in die neueste Zeit hinein und in Systemen, die vom Böhmeschen weit abzuliegen scheinen, wie zum Beispiel in dem dialektischen System Hegels.
Wir gehen in der Zeit stark zurück und führen von anderen Theosophen noch besonders an den Brüsseler Arzt Johann Baptist van Helmont (1577–1644), der in Visionen und Träumen die Wahrheit suchte und Logik und Vernunft[S. 329]wissenschaft, wie alle Intuitiven, verachtete, und der dabei doch zugleich ein nicht unbedeutender Naturforscher war, indem er das Reich Gottes von dem Reich der Natur scharf trennte. Er sah aber überall Leben und glaubte, daß jede natürliche Kraft als Archeus sich selbst ihren Körper bilde. „Aber in der Tat sind so viele Arten (species) lebender (von Gott in die Natur gelegter) Lichter, als Arten lebender Kreaturen. Und so ist in diesen Lichtern selbst alle und jede Unterscheidung der Arten.“ Die Materie ist das zweite Prinzip der Natur. In jedem Dinge ist ein Samen, daraus es sich entwickelt. Die Entwicklung wird aber durch eine innere Anlage, ein „Ferment“, eingeleitet und weitergeleitet. Eigenartig ist seine Annahme einer Wirkung in die Ferne, einer Art Strahlung — er hat dafür das wunderliche Wort Blas geprägt — die von den Gestirnen nicht minder wie von den Wesen ausgeht und nach Außen und Innen wirken soll, was ja mit astrologischen und mit modernen Ideen übereinkommt. Außer Archeus und Blas wird noch, als an einem Punkt im Körper konzentriert, die Seele angenommen. Diese sitzt im Magenmund, der Archeus in der Milz. Gehirn und Nerven sind Werkzeuge der Seele, der Archeus ist ihr ausführendes Organ, für das körperliche Leben. Dazu kommt der Geist als das Gotteslicht. Es sind etwas viel Distinktionen: Archeus, Seele, Geist, Samen, Ferment, und man weiß zuletzt doch nicht recht, wie all diese Dinge miteinander zusammenhängen. Namentlich konkurrieren Archeus und Ferment, Seele und Geist. Zu Jakob Böhme bildet van Helmont insofern einen Gegensatz, als er den energischen Kampf in der Natur, den jener so dichterisch und geistvoll vertritt, ablehnt. Die Natur ist ihm vielmehr ein geordnetes Ganzes mit selbständigen einzelnen Wesen. Den Engländer Fludd (1574–1637), einen ganz gehörigen Mystiker, erwähne ich, nicht weil er Wärme und Kälte als weltbildende Prinzipe benutzt, wie schon viele vor ihm getan, sondern weil er sich auf Versuche mit einem Thermometer beruft, dessen Beschreibung er in einem wenigstens 500 Jahre alten Manuskript gefunden haben will. Die Ergebnisse der Versuche sind zutreffend. Blaise Pascal[S. 330] (1623–1662) hat mit Jakob Böhme einige Ähnlichkeit, er zeigt sich als tiefsinniger, religiöser Mystiker und zugleich doch als Skeptiker. Montaigne (1533–1592) ist als Mystiker nur zu erwähnen, mehr noch ist er Skeptiker. Aber Swedenborg (1689–1772) ist ganz und gar Mystiker.
Die Theosophie zieht sich wie ein roter Faden noch lange durch alle Systeme, wie wir sehen werden. In unserer Zeit konnte sie sogar einen sehr bedeutenden Aufschwung erfahren, mit allem Zubehör von Mystizismus und Okkultismus. Dem veränderten Verhalten der Menschen den besonderen Religionen gegenüber entspricht es, daß sie sich wesentlich der indischen Auffassung angeschlossen hat. Ein anscheinend für die betreffenden Kreise bestimmtes grundlegendes Werk hierüber, „The Key to Theosophy“, von der klugen Helene Petrowna Blavatsky (Carl Bleibtreu hat über sie ein Buch veröffentlicht, das leider durch unnötige Ausfälle gegen Andere und durch Übertreibungen entstellt ist), arbeitet ganz im Fahrwasser der schon mitgeteilten Lehren des Wundervolkes der Indier. Ebenso im Grunde das Werk von Franz Hartmann „Mysterien, Symbole und magisch wirkende Kräfte“. Die Hauptgedanken erhellen bereits aus den S. 223 mitgeteilten Ansichten über die Seele, und auch das Prinzip, daß alles, ausnahmslos, Eines ist, der Theos, das Brahma usf., ist uns schon bekannt. Ebenso die Lehre von der Reinkarnation und das Karma-Gesetz, daß jeder erntet, was er gesäet hat. Ferner, daß die Erkennung des „Ich-selbst“ die Erkennung von allem bedingt, auch die des Dinges hinter den Erscheinungen, des Transzendentalen im Sinne Kants (S. 350). „Das Selbst des Universums und das Selbst jeden Wesens im Universum ist ein und dasselbe Selbst“, lautet der Hauptsatz dieser Theosophie. Und dieses Selbst ist eben der Theos. Wir selbst sind es. Alles dieses entspricht durchaus dem, was wir von indischer Theosophie wissen. Die Durchführung dieser Hauptgedanken darzulegen muß ich mir versagen, ebenso muß ich die Schilderung der sieben Reiche (im Anschluß an die sieben Seelen, S. 223) und die Erklärung der Symbole und Mysterien übergehen, zumal mir sehr vieles allzudunkel[S. 331] geblieben ist. Nur weniges ist gnostischen Anschauungen entnommen und noch weniger kirchlich-christlichen. Und es läßt sich ja nicht bestreiten, daß, so poetisch schön die letzteren, und namentlich die gnostischen, Anschauungen sind, sie philosophisch den tiefdurchdachten und bis ins äußerste scharf getriebenen Lehren der indischen Schulen zurückstehen. Und nach dem wirklich großen Jakob Böhme ist ja auch kein christlicher Theosoph erschienen, der ein befriedigendes System hätte aufstellen können. In Böhme aber haben wir mehr den sittlich hohen und phantasiebegabten Mann zu verehren als den unumwundenen Dialektiker. Er war rücksichtslos in seiner Entzweiung Gottes mit sich selbst, sein frommer Sinn aber führte ihn auf geschlungenen Pfaden immer wieder zurück zu dem einzig gnädigen und gütigen Gott, wie ihn die Fülle der Menschheit ja allein als Gott des Trostes und der Verheißung brauchen kann, wie ihn aber der spekulative Menschenteil nicht ohne inneren Widerspruch, angesichts des so unglaublich verbreiteten und fast unser ganzes Leben durchquälenden Schlimmen und Üblen, auf sich wirken lassen kann. Wo die Persönlichkeit verloren geht, schwindet die Poesie, und man mag uns Gott noch so erhaben schildern, noch so gewaltig und unendlich, er wird uns immer fremder und kälter und unverständlicher. Der strafende und der liebende Vater geht verloren. Es kommt ein geheimnisvolles Etwas hinter grauen Schleiern. Das Leben wird verschwommen, wie die Anschauung zerfließt. Es ist überall ein Verstecktes da, nirgend doch ein Greifbares, und die Gesellschaft muß sich schließlich mit einem feinen Schatten begnügen und einem ethischen Kodex, mit einem ewigen marklosen Leben, wenn nicht einem absoluten Tod. Diese Reaktion ist gegenüber den unsäglichen Albernheiten, die so viele mit der persönlichen Religion treiben, gegenüber den selbstsüchtigen Pachtungen des lieben Gottes, dessen sich so viele erdreisten, gewiß durchaus gerechtfertigt. Eine solche Reaktion hat die Philosophie von je gegen die Theologie geübt, daher die eigentlich so unwahre doppelte Wahrheit. Gegenwärtig aber, wo ein dritter gewaltiger Kämpe auf[S. 332] den Plan getreten ist, die kalte, beweiskräftige Naturwissenschaft, die allen Glauben überhaupt hinwegzuschwemmen droht, ist es nur wohl zu verstehen, wenn manche, abhold dem Zerstörlichen, sich in ein Reich flüchten, das der Naturwissenschaft nicht angreifbar zu sein, den Gedanken keinen Zwang zu tun und für Phantasie und Gefühl Befriedigung zu bieten scheint. Kommt noch dazu, daß das Geheimnis vor der Grenze dieses Reiches wandelt und jedem Nahenden mit dunklen Reden Wunderbares zu schauen verheißt. Indessen scheint der anglo-amerikanische Stamm besonders geneigt, sich dort einzubürgern; in Deutschland sind wir noch sehr mißtrauisch den Verheißungen gegenüber. Die Menschheit verhält sich gegenwärtig fast synkretistisch in bezug auf die Religion. Und wenn gar einer Hochreligion, dem Christentum, das Wichtigste, Christi Leben und Leiden auf Erden für die Menschheit, also sein persönliches Erlöserwerk, fast mit Übereifer abgestritten wird, was bleibt vielen da übrig, als zum Unerforschlichen in seiner Unnahbarkeit zurückzukehren und, wie Jakob, mit der geheimnisvollen Erscheinung zu ringen, um ihren Namen zu erfahren! Oder, unbekümmert um eine Gottheit, ein irdisches Leben in ethischen Regeln als den alleinigen Zweck des Menschen zu betrachten, wenn man dieses Leben nicht überhaupt als ein Übel unter gleicher Voraussetzung zu überwinden hat! Wunderbar ist, wie dabei die größten Gegensätze nebeneinander bestehen. Der mitunter fast halluzinierende Theosoph und Spiritist hat den kühl abwägenden und alles Supernaturalistische abweisenden Ethiker, Optimisten oder Pessimisten zum Nachbarn. Wie sich allmählich aber eine Anschauung mehr und mehr zur Herrschaft emporringt, die den Theismus (auch als Deismus) mit dem sogenannten Atheismus versöhnt und verbindet, der spinozistische Pantheismus, der mit der Theosophie die Idee eines alles umfassenden, alles begreifenden Etwas, mit dem Atheismus die der Selbständigkeit der Welt, ihr Freisein von einem persönlichen außer und über ihr stehenden Herrscher, ihr Wurzeln auf sich selbst gemein hat, werden wir später sehen. Einstweilen können wir vom Deismus noch nicht scheiden.
39. Deistischer Rationalismus.
Die weitere Entwicklung der Philosophie und Wissenschaft war jedoch zunächst der intuitiv-religiösen Auffassung der Welt und des Lebens an sich nicht günstig und mußte zu kühlerer Betrachtung der Dinge führen und so an Stelle der Intuition den vernunftgemäßen Rationalismus, die festen Regeln der Vernunft, setzen. Rationalistisch ist schon die Sokratische Ethik, ebenso zu einem sehr großen Teil die Aristotelische Philosophie und vieles andere von dem, was ich schon vorgetragen habe („Nichts Größeres als Vernunft, denn sie ist die Seele der Seele“, soll Scaligers Wahlspruch gewesen sein). Der moderne Rationalismus beginnt mit dem Urheber der modernen Philosophie, René Descartes, Renatus Cartesius (1596 zu La Haye bei Tours geboren, 1650 zu Stockholm gestorben). Er muß aber bei diesem noch durchaus als mit Deismus gemischt bezeichnet werden, weil Gott ganz und gar noch in der Mitte der Anschauung steht. Sein Rationalismus beruht auf Gottbeweisen. „Der formale Grund,“ sagt Descartes, „woraus wir den Glaubenssachen zustimmen, besteht in einem gewissen inneren Licht, mit dem, von Gott erleuchtet, wir vertrauen, daß was uns zu glauben gelehrt wird, von ihm enthüllt ist, und daß er nicht lügen kann, da jenes Licht sicherer ist als das ganze Licht der Natur.“ Das ist zunächst noch durchaus theosophisch gesprochen. Und Descartes ist gläubiger, sogar wundergläubiger Katholik. Gleichwohl ist er Rationalist, er will überall mit Vernunftgründen beweisen. Mit dem „Licht der Natur“ will er wissenschaftlich in alles Natürliche hineinleuchten und nur beim Allerletzten dem übernatürlichen Licht, der inneren Offenbarung, Intuition, sein Vertrauen schenken. Dieses lehrt ihn aber, daß Gott in jedem Augenblicke Grund der Welt ist, daß diese ins Nichts versinkt, sobald er sie verläßt. Und so ist auch das natürliche Licht von Gott in der Natur entzündet, denn Gott kann nur wahr sein, selbst in seinen Werken. Diese Wahrheit ist an sich eine relative, sofern Gott die Welt auch ganz anders hätte schaffen und einrichten können, als[S. 334] geschehen ist; für uns jedoch bedeutet sie eine absolute nach unserer Art. Unter solchen Umständen nimmt es sich sonderbar aus, daß Descartes gleichwohl, mit anderen vor ihm, sich noch nach Beweisen für das Dasein Gottes umschaut. Diese sind eben ein Teil seines Rationalismus. Er geht von dem berühmten Satz aus: „Je pense, donc je suis“; cogito, ergo sum; Ich denke, also bin ich; einem Satze, der sich lange vor ihm schon ausgesprochen findet. Das ist also eine Gewißheit: „Ich bin“. Aus dieser Gewißheit schöpft er die weitere: Was ich für sicher weiß, oder einfacher, was in mir keinen Widersprüchen begegnet, ist auch wahr. Und wie so viele vor ihm und nach ihm vertauscht er das Wahre mit der Existenz. Wir haben in uns eine Idee von einem unendlichen, absolut vollkommenen und absolut realen Wesen. Nun sind wir selbst endlich, unvollkommen und zeitlich beschränkt. Und alles um uns ist es gleichfalls. Also können wir jene Idee weder aus uns noch aus der Natur geschöpft haben. Und folglich ist sie absolute Wahrheit, und Gott besteht. Offenbar ist dieser psychologische oder anthropologische Beweis einzig ein intuitiver. Er ist nicht falsch, wie man oft behauptet hat; er ist nur, als intuitiv, unserer discursiven Vernunft, die rein logisch schließt und sagt, weder ein Unendliches noch ein Absolutes liege fertig in unserem Geiste, sondern nur als stetig fortgeführte Abstraktion, unzugänglich. Der andere Beweis heißt der ontologische. Im Grunde ist er eine Ergänzung zum psychologischen. In diesem wurde die absolute Realität Gottes vorgesetzt. Descartes meint, diese gehöre schon zum absolut Vollkommenen; was absolut vollkommen ist, muß auch wirklich sein. Die Wurzel steckt in der so oft gemachten Annahme, daß alles Unvollkommene aus einer Beimischung von Nichtwirklichem, Nichtseiendem herstamme, die der Leser im Voraufgehenden so oft hat hinnehmen müssen. Aber dieser Zusatzbeweis ist an sich nicht nötig. Der psychologische Beweis genügt für die Intuition völlig. Und wer keine Intuition zugibt, dem hilft der Zusatzbeweis auch nicht, denn wie Kant nachgewiesen hat, gehört das Dasein nicht zu dem Begriff eines Dinges,[S. 335] wie die übrigen Merkmale. Hat nun Gott auch keine Merkmale, was bleibt dann übrig, wenn ihm auch das Sein entzogen wird?
Im Menschen erkennt Descartes eingeborene Begriffe (ideae innatae, apriorische), sodann empirisch erworbene, auch abgezogene Begriffe (ideae adventitiae, aposteriorische), zuletzt hervorgebrachte Begriffe (ideae factae). Die ersteren umfassen die Hochbegriffe Gott, Wahrheit, Freiheit usf.; die mittleren dienen zur Erkenntnis der Natur; die letzten zum Hinausgehen über das unmittelbar in der Natur Gegebene, im Anschluß daran. Vor allem ist der Mensch ein geistiges Wesen. Descartes sieht aber in der Welt, wie Gott sie geschaffen hat, einen Dualismus: Geist und Materie. Begrifflich werden beide als „Substanz“ bezeichnet. Jedes von ihnen hat ein „Attribut“: der Geist stetiges Denken, die Materie Ausdehnung. Die Einzelnen sind „Modi“: im Geist die Gedanken, in der Materie die Körper mit Figur, Größe, Bewegung, Ruhe usf. Diese beiden Substanzen sind absolut getrennt; und jede besteht nach ihrer Art, der Geist nach geistiger, die Materie nach mechanischer Art. Dinge ohne Geist haben nur mechanistisches (besser physisches) Leben. So unser Körper, in dem alles rein mechanisch geschieht, wie in unbelebten Körpern, in Maschinen. Tiere und Pflanzen sind den unbelebten Dingen gleich, sind Maschinen. Der Mensch hat noch den unsterblichen Geist. Die Welt, ohne die Geister, ist hiernach auch eine gewaltige Maschine. Geschaffen wurde sie als eine harte Masse. Gott zerschlug diese Masse und setzte ihre Teile (wie bei Anaxagoras der Nus) in wirbelnde Bewegung. Nun stießen und rieben diese Teile aneinander, und es entstand so eine feine, gröbere und ganz grobe Materie. Die feine zerstreute sich am weitesten in das All und bildete in inneren Wirbeln allmählich die Sonne und die Fixsterne. Die gröbste Materie gab Erde, Planeten, Monde, Kometen usf. Die mittlere Materie wirbelt noch um Sonnen und Planeten und andere Körper und reißt die Planeten um die Sonnen, die Monde um die Planeten herum. Eine gewisse Ordnung unter allen Körpern[S. 336] entsteht durch das Stoßen und Reiben; wie auch die drei Materien sich durch Stoßen und Reiben voneinander geschieden haben. Descartes ist, wie wir sehen, in seinem Dualismus theosophischer Deist in bezug auf Gott und Geist, Mechanist in bezug auf die Körperwelt nach ihrer Entstehung und der ihr eingeprägten Bewegung.
Wie wirkt aber die Seele auf den Körper? An sich kann eine solche Wirkung nicht stattfinden. Was Descartes darüber sagt, ist lediglich seinen mechanistischen Anschauungen nachgebildet. Die Seele sitzt in der Zirbeldrüse, in der Mitte des Gehirns. Die zu dieser Drüse führenden Nerven werden von feinstem Blut (spiritus animalis) durchströmt. Dadurch kommt die Drüse in Schwingungen, die die Seele aufnimmt. Umgekehrt muß diese die Drüse in Schwingungen versetzen, die den Gang des feinsten Blutes regulieren und so auf den Körper mittelbar wirken. Diese Vergrobsinnlichung kann einen modernsten Mechanisten erfreuen, aber die Frage nicht lösen. Darum ruft Geulincx (aus Antwerpen 1625–1669) Gott zu Hilfe. Jedem körperlichen Vorgang entsprechend veranlaßt Gott einen seelischen, und jedem seelischen entsprechend einen körperlichen. So lenkt Gott die Seele nach dem Körper und den Körper nach der Seele. Frei ist nur immer je der erste Vorgang, je der zweite ist von Gott veranlaßt, ausgelöst. Also wirkt Gott gelegentlich, es ist ein Okkasionalismus, der eine höhere Bedeutung gewinnt, wenn Gott nicht jedesmal regulierend eingreift, sondern von vornherein Seele und Körper so gegeneinander abgestimmt hat, daß sie, obwohl sich gegenseitig absolut fremd, doch aufeinander antworten. Der Pariser Malebranche (1638 bis 1715) faßt das Verhältnis, nach Geulincx’ Vorgang, in dieser Weise auf. Aber beide haben in Descartes’ Philosophie noch die Wendung gebracht, daß der Geist überhaupt von Gott ist, die Materie freilich nicht. Dieser Dualismus geht dann in einen solchen zwischen Gott und Welt über; und er ist wenigstens insoweit pandeistisch, als Gott in den geistigen Dingen vorhanden ist, vielleicht auch in den nichtgeistigen, sofern es sich um Vorgänge handelt.
Es ist üblich, an diese Betrachtungen Spinozas Lehren anzuschließen, gewissermaßen als letzte Ausbildung der Cartesischen. Allein Spinozas Anschauungen sind rein monistisch und auch in keiner Weise deistisch. Spinoza selbst hat Cartesius’ Schriften interpretiert und mag auch sein System als aus dem Cartesischen erwachsen angesehen haben. Es ist aber nicht mehr daraus hervorgegangen als des Cartesius’ System aus irgendeinem der früheren Systeme mit Gott, Geist und Materie. Und das rationalistische ist bei Cartesius kaum wo zu finden als in solchen „Beweisen“, deren einer oben angeführt ist und seinen Grund doch allein in der Intuition hat. Denn wiewohl Cartesius, wie schon bemerkt, auch das natürliche Licht, die Erkenntnis aus dem Vorhandenen, auf Gott zurückführt, ist er doch voller Zweifel an der Wirksamkeit dieses Lichtes. Fürchtet er doch mitunter, daß dieses Licht von einem bösen Dämon herrühren möchte, welcher uns Falsches für Gewisses vorspiegelt. So daß ihm zuletzt nur das Intuitive bleibt, als das einzig Sichere, wozu zunächst sein Grundsatz vom Dasein Gottes gehört und damit in Verbindung der vom eigenen Dasein, der demnach lauten müßte: Ich schaue Gott, also bin ich (contemplor deum, ergo sum). Und in der Tat ist Descartes auch nicht übel geneigt, den Geist als eine Emanation Gottes anzusehen. Mit Descartes’ Deismus hängt auch zusammen, daß er die Welt unendlich im Raume und unendlich in der Dauer, aber endlich in der Entstehung auffaßt, und daß, wo er seinem Mechanismus abhold wird, er Gott nicht allein die Schaffung der Welt, sondern auch ihre stete Erhaltung und Leitung zuschreibt. In der Frage des freien Willens verhält er sich sehr unsicher. Als Mechanist muß er ihn leugnen. Als Deist kann er ihn bis zu einem gewissen Grade zulassen. Und in dem Schwanken zwischen Mechanismus und Deismus ist wohl das Unsichere und Sichwidersprechende in Descartes’ Anschauungen überhaupt zu suchen. Spinozas System, das wir später kennen lernen werden, ist durchaus konsequent. Und die Kunstausdrücke, die er nach Cartesius’ System verwendet, besitzen ganz andere Wertgebung.
40. Prästabilierte Harmonie, Determinismus, Monaden, Korpuskeln, Realen, Samen.
Wir haben bereits an mehreren Stellen von der Anschauung einer „Sympathie der Dinge“ gesprochen, durch die der Zusammenhang zwischen den Dingen in der Welt erklärt werden sollte. Den Gipfel solcher Lehren bildet die prästabilierte Harmonie in Verbindung mit der Monadologie. Eine erste Fassung finden wir bei Franz Mercurius van Helmont (1618–1699), dem Sohn des uns schon bekannten Arztes. Wie er die Seele stoisch betrachtet, so hat er sich im Grunde auch eine Art Pandeismus zurecht gelegt, indem Gott zwar von allen Dingen verschieden, aber doch nicht von allen Dingen abgetrennt oder geteilt sein soll. Da Gott selbst ohne Zeit, ohne Raum, ohne Änderung, ohne Vielheit ist, so läßt sich sein Zusammenhang mit den Dingen nur so verstehen, daß er die Welt ständig ohne Ende schafft, indem er immer weiter zu dem Vorhandenen Neues hinzubringt und zugleich alles zur Veränderlichkeit bestimmt. Gedacht ist dieses emanistisch; der Mittler ist das feinste von Gott ausgehende und das All erfüllende Licht, die Welt ist ein davon abgeschwächtes. Und Christus ist insofern in der Tat die Mitte, als er nur zum Guten veränderlich ist, nicht zum Bösen, während die Geschöpfe zum Guten und Bösen sich neigen. Indessen ist auch den Geschöpfen verliehen, sich dem Guten unendlich zu nähern, und darin beruht die Unendlichkeit der Schöpfung. Die Geschöpfe enthalten von Gott das Gute als Keim, und jedes Geschöpf ist eine Unendlichkeit für sich, indem es eine geistige Reihe ohne Ende bildet. So spiegelt jedes Geschöpf in gewisser Hinsicht Gott selbst ab, nur unendlich unvollkommener als Gott. Wie Licht bemerkt wird, wenn es an einem Körper reflektiert, (wir müssen sagen in uns, an der Retina auftrifft), so kommt Gottes Licht zum Bewußtsein, indem es auf eine dunkle Substanz trifft, die Materie des Körpers. Darum ist der Körper notwendig auch zum Bewußtsein Gottes; als wenn das Licht seiner selbst bewußt wird, indem es auf einen[S. 339] hemmenden Körper stößt. Lehren, wonach Gott sich nur in der Schöpfung kennt, sind bereits erwähnt. Und von Gott strahlt es auch ins Unendliche nach allen Seiten aus. Dadurch ist die Verbindung aller Dinge bewirkt, indem eben jedes Ding zu jedem Ding und durch jedes Ding geistige Emanationen sendet. So wäre jedoch nur eine Art allgemeine Statik erreicht. Zur Dynamik in der Welt kann van Helmont nur durch Mitwirkung Gottes gelangen. Die Welt besteht aus unzähligen, unteilbaren Monaden, die das physische Leben bedingen, deren jede aber für sich absolut ein Individuum ist. Verbunden sind die Monaden durch gottentstammte, allgemeine Sympathie (wohl emanistisch so gedacht wie die Verbindung von Gott mit der Welt), und ihre Wirkung aufeinander geschieht durch von Gott eingepflanzte Bewegungsmöglichkeit der einen Monade zu der anderen. Also rührt alles von Gott her, Unendlichkeit jedes Individuums zum Guten, Endlichkeit zum Bösen, Sympathie Jedes gegen Jedes, Wirkung Jedes gegen Jedes. Die körperlichen und geistigen Dinge sind Aggregate von Monaden, die unter der Herrschaft einer Monade, der Seele, stehen, die als Zentralgeist alle einzelnen Monaden in sich faßt, insbesondere des betreffenden Dinges, aber auch der übrigen Welt (durch Sympathie?). Und wie keine Monade, nachdem sie geschaffen, untergehen kann, so erst recht nicht die Seele. Was noch von mehreren Welten gesagt wird, reicht ins Mystische. Vier sind vorhanden: die oberste Welt ist Christus als Lichtall. Die folgende, Welt der Schöpfung, ist wohl als eine Art platonischer Ideenwelt gedacht. In der dritten Welt, Welt der Bildung, wird in der oberen Schicht das Gute der Ideen verwirklicht, in der unteren das Unvollkommene. Die Festigkeit nehmen die unvollkommenen Verwirklichungen in der vierten, mechanischen körperlichen Welt der Gestaltung. So gehört der Körper der vierten, der Geist der dritten, die Seele der zweiten Welt an. Das stellte die eigentliche Welt (Mundus factionis) wieder sehr niedrig, wenn eben nicht Gottes Strahlen bis in sie hineinreichten und so eine Entwicklung nach oben ermöglichten. Diese Entwicklung aber schließt die Seelenwanderung, „Re[S. 340]volution der Seelen“, ein. Jede Seele bildet sich ihren Körper aus den Monaden nach der durch ihren Zustand bestimmten Herrschermacht. So entwickelt sich ihr Leib mit ihrer eigenen Entwicklung, und sie kann so aus den niedrigsten Existenzen zu den höchsten steigen, aber auch von höchsten zu niedrigsten fallen. Hat sie auf Erden die höchste Existenz erreicht, so geht sie in die erste Welt ein und kommt nicht wieder; dort entwickelt sie sich noch weiter. Die Seelen der Kinder sind Monaden der Eltern, daraus die Vererbung des Guten wie des Bösen. Sehr verständlich ist die ganze Lehre offenbar nicht; sie enthält zuviel nach einer Seite, der der Vollkommenheit, und zu wenig nach der anderen, der des Schlimmen; das letztere ein Mangel, den wir ja überall getroffen haben, außer bei Jakob Böhme. Eine wirkliche Harmonie haben wir hier nicht, viel weniger eine prästabilierte. Aber die Anlage ist zweifellos vorhanden, namentlich in den lebensvoll aufgefaßten Monaden.
Wir kommen zu einem der Größten, Gottfried Wilhelm Leibniz. Er ist zu Leipzig am 21. Juni 1646 als Sohn des Moralprofessors Leibniz geboren. Gestorben ist er am 14. November 1716. Seine Bedeutung für fast alle Zweige der Wissenschaft ist außerordentlich. Hier haben wir es nur mit einer seiner Leistungen zu tun, die aus seiner Welt- und Lebenanschauung fließt. In einer der vielen Auslassungen über seine Anschauung, in der Schrift „De la nature en elle-même“, bezieht sich Leibniz auf die bekannten Eigenheiten der Körper, die der „Trägheit“ zugeschrieben werden, und meint mit Recht, daß diese allein aus der Ausdehnung der Dinge oder ihrer Masse nicht zu verstehen sei, daß es sich vielmehr um etwas handle, das außerdem den Dingen noch zukomme. „Und dieses substantielle Prinzip,“ sagt er, „das in den lebenden Wesen Seele heißt, in den anderen substantielle Form, und die zusammen mit der Materie eine wirkliche Substanz bildet, aber schon durch sich eine Einheit darstellt, dieses Prinzip nenne ich eine Monade.“ Die Monaden sind einfach, ohne Teile, nicht bildbar und nicht vernichtbar, außer durch Gott. Jede Monade ist ein Gegenstand für sich;[S. 341] irgendeine Einwirkung auf ihr Wesen und in ihrem Wesen durch ein Äußeres, außer durch Gott, ist absolut ausgeschlossen. „Die Monaden,“ heißt es in der Monadologie, „haben keine Fenster, durch die etwas eindringen und hinaussteigen könnte.“ Alle Änderungen einer Monade kommen aus ihrem eigenen Inneren. Die Monaden sind erschaffen und dabei mit ihren Änderungen begabt. Sie sind jede eine Einheit einer Vielheit von Einzelheiten, die hiernach eine Beziehung bilden. Diese jedesmalige Vielheit in der Einheit, wechselnd in den vorübergehenden Zuständen, ist die Perzeption, und was den Wechsel von einer Perzeption zur anderen bewirkt, bildet die Appetition. Solches muß aus unserem Seelenleben erschlossen sein, da wir uns unserer Einheit bewußt sind, zugleich aber auch der Vielheit in unseren Seelentätigkeiten. Perzeption wäre also die jeweilige Wahrnehmung aller inneren Tätigkeiten, Appetition die des Wechsels der Tätigkeiten. Hiernach kann man die Monaden auch als Seelen ansehen oder als Entelechien (S. 250); letzteres, weil sie eine gewisse Vollkommenheit der Zwecklichkeit besitzen. Doch reserviert Leibniz die Bezeichnung „Seele“ für diejenigen Monaden, deren Perzeptionen mehr unterschieden und von Gedächtnis begleitet sind. Die Monaden weichen nämlich voneinander ab in Perzeption und Appetition. Aber selbst jede Seele verhält sich bald deutlich, bald undeutlich bewußt, nur daß bei ihr die undeutlichen Perzeptionen vorübergehend sind, die bei den einfachsten Monaden dauernd. Monaden ohne jede deutliche Perzeption werden als „ganz bloß“ bezeichnet (Monades toutes nues). So stufen die Monaden sich ab von gänzlicher Bloßheit bis zum Menschenseelischen, mit der Kenntnis der notwendigen und ewigen Wahrheiten, und mit dem Bewußtsein von sich selbst und von Gott. Alle Monaden haben die Gründe ihrer Vollkommenheit und Unvollkommenheit in sich. Dem Grade der Vollkommenheit entspricht die Tätigkeit (actio), dem der Unvollkommenheit das Leiden (passio). Jede Monade hat ein Bewußtsein von demjenigen, was in den anderen Monaden enthalten ist; sie gilt um so vollkommener, je mehr sie sich a priori Rechenschaft geben kann von dem, was in den anderen Monaden vorgeht; und darin besteht ihre[S. 342] Wirkung auf sie. Leidend verhält sie sich, sobald der Grund von dem, was in ihr vorgeht, in demjenigen sich befindet, das es deutlich in einem anderen, eben in ihr, kennt.
Die gegenseitige Wirkung ist hiernach nur eine ideelle. An sich liegt sie in Gott, indem Gott bei Schaffung der Dinge überhaupt für jede Monade mit Bezug auf alle anderen Monaden bedacht war. In diesem Bedachtsein Gottes bei der Schaffung jeder Monade auf alle anderen Monaden, wodurch deren geordnete Wirkungen aufeinander nach ewigen Gesetzen sich erklärt, ist die prästabilierte Harmonie begründet. Jede Monade wirkt zwar nur nach ihrer Art, aber diese Art ist von vornherein so beschaffen, wie es die Rücksicht auf alle anderen Monaden erforderte, so daß jede Monade nach ihrer Art ihre bestimmte Stellung in der Welt von vornherein einnimmt. So hat jede Monade Bewußtsein vom ganzen All. Indessen doch immer wieder in ihrer Art. Und so schaut die Welt vom Gesichtspunkte (point de vue) jeder Monade anders und anders aus. Aber wie eine Stadt von verschiedenen Standpunkten verschiedene Anblicke bietet und doch nur immer dieselbe Stadt ist, so die Welt. Sie ist nur eine, wenn auch von den verschiedenen Monaden verschieden aufgefaßt. Gott ist aber der allgemeine Grund aller Dinge, in ihm erscheint jedes wie es ist. Und wie es ist, mußte es aus der Natur Gottes sein, der die Welt nicht nach einem willkürlichen Plan so oder anders hätte schaffen können, sondern wie er sie geschaffen hat, als Gott schaffen mußte. Denn Gott ist absolut vollkommen; sein Können, sein Wissen, sein Wollen — bei den Monaden: Subjekt (Eigen), Perzeption, Appetition — sind absolut unbeschränkt. Und weil sie absolut sind, konnte es sich nicht um die „Wahl eines Besseren“ handeln, das ja ein endliches Wissen bedeutet.
Alle Dinge sind aus Monaden zusammengesetzt. Da die Wirkung der Monaden aufeinander nur eine gedachte ist, so besagt die Zusammensetzung nicht ein Zusammenhalten, sondern ein deutlicheres Bewußtsein dieser Monaden von einander als von anderen Monaden, die nicht dem betreffenden Dinge angehören. In dem Wechsel des Bewußtseins von dem[S. 343] anderen ist es begründet, wenn Monaden aus den Dingen ausscheiden. So ist alles Wachsen nur ein Zunehmen von Monaden mit Bewußtsein vom Vorhandenen und im Bewußtsein des Vorhandenen. Und umgekehrt, alles Schwinden eine Abnahme von Monaden mit solchem Bewußtsein und in solchem Bewußtsein. Und so sind auch räumliche Form und Materie nur solche Bewußtseinszustände. Alles dieses liegt in den Monaden und der prästabilierten Harmonie. Und die Welt ist ein „Phainomenon bene fundatum“, eine gewaltige Maschine, deren einzelne Teile, die Monaden, gleiche Maschinen sind. Im Kleineren werden wir diese Vergleichung später bei dem philosophischen Biologen Driesch wiederfinden. Die Welt ist nirgend und niemals unterbrochen, sie ist kontinuierlich und lebt kontinuierlich nach Gottes Harmonie. Die Unvollkommenheiten liegen in der Endlichkeit der Monaden, hinsichtlich ihres Subjekts, ihrer Perzeption und ihrer Appetition, die ja notwendig war, sollte überhaupt eine Welt vorhanden sein, da, wenn diese Endlichkeit aufgehoben wird, alles ja Gott ist. Dem Preis Gottes und dem Verhältnis des Menschen zu ihm ist die berühmte Théodicée gewidmet. Diejenige Monade in einem Ding, welche namentlich Bewußtsein von allen anderen Monaden hat, ist die Zentralmonade, bei den Lebewesen die Seele. Nur sofern eine solche Zentralmonade vorhanden ist, darf von einem „Körper“ gesprochen werden, der im übrigen nichts bedeutet als Monaden, hauptsächlich im Bewußtsein der Seele. So gibt es keinen Leib ohne Geist. Aber auch keinen Geist ohne Leib, denn das würde bedeuten, daß eine Monade überhaupt von anderen Monaden kein Bewußtsein hätte. Freilich besagt dieses, daß im Grunde jeder Leib unendlich ist wie das All, so daß an sich die ganze Welt, jedes darin Seele und Leib wäre, und das was wir Leib nennen, nur den Teil bedeutete, der besonders zum Bewußtsein gelangt ist. Dieser Schwierigkeit kann man nur entgehen, wenn man annimmt, daß die Monaden von gewissen Monaden so gut wie gar kein Bewußtsein haben. Sie ist aber auch allen panpsychistischen und pandeistischen Anschauungen inhärent. Da die Monaden[S. 344] keine Ausdehnung haben, und da die Welt als Kontinuum besteht, so sind die Dinge nicht bloß dem Gedanken nach ins Unendliche teilbar, sondern tatsächlich ins Unendliche organisiert. Charakteristisch aber für Leibniz, in dem wir ja auch einen großen Mathematiker und Physiker besitzen, ist, daß er nach Prästabilierung der Harmonie nur die Weltgesetze walten und ein stetes Eingreifen Gottes, wenn es vorhanden ist, immer nur in den Weltgesetzen sich äußern läßt. Und seine Naturerklärung ist eine mechanische; unvermittelte Wirkungen lehnt er ab, so die Newtonsche Attraktionswirkung in die Ferne, die er für ein stetes Wunder erklärt. Das gehört schon in das folgende Buch. Wie man von der Leibnizschen Anschauung zur Unsterblichkeit der Seele kommen muß und zur Seelenwanderung kommen kann, ist klar. Wie aber die Unsterblichkeit hier eine ganz andere Bedeutung hat als die theologische, ist ebenso klar. Die irdische Persönlichkeit kann ja gar nicht bestehen bleiben, wenn die Zentralmonade sich von den anderen Monaden, dem Körper, getrennt und so das deutliche Bewußtsein ihrer verloren hat. Sie kann dann von ihnen kein anderes inneres Bewußtsein haben als im Leben von den ihrem Körper nicht gehörigen Monaden, also nur das allgemeine Weltbewußtsein, das gegenüber dem Bewußtsein vom Körper so gut wie gar nicht besteht.
Zum Schluß noch eine Bemerkung. Es ist mehrfach behauptet worden, daß die von Leibniz eingeführte Perzeption im Gegensatz zur Apperzeption ein rein unbewußtes Vorstellen sein soll. Das ist, wie ich glaube, nicht richtig. Leibniz scheint mir unter Perzeption nur eine passive, automate Art des Vorstellens zu verstehen, die stufenweise von völliger Unbewußtheit zu Höchstbewußtsein steigt. Leibniz hat sich freilich nicht bestimmt genug ausgedrückt. Allein seine ganze prästabilierte Harmonie hätte ja gar keinen besonderen Wert neben der einfacheren Mechanistik, wenn er unter Perzeption in der Tat nur ein absolutes Unbewußtes verstanden hätte. Außerdem könnte man nicht, wie Leibniz es tut, von verschiedenen Perzeptionen sprechen; was unbewußt ist, kann nicht verschieden sein. Ich glaube, es ist[S. 345] verwechselt worden das Eintreten der Vorstellung, das allerdings unbewußt sein soll, mit der Vorstellung selbst, die alle Stufen der Deutlichkeit durchlaufen kann.
Die Monadenlehre Leibniz’s ist von Droßbach in zwei lesenswerten Büchern: „Die persönliche Unsterblichkeit“ und „Die Genesis des Bewußtseins“ ins Atomistische übertragen und nicht unerheblich ausgebaut worden. Ich muß mich aber auf diesen Hinweis beschränken. Eine „Harmonie der Welt“ hat der große Kepler (1571–1630) an die Spitze seiner Anschauungen gestellt, freilich mehr in pythagoreisch-mathematischem Sinne.
Daß des „Professors der Menschheit“ und großen philosophischen Systematikers und Polyhistors Christian Wolff (geboren zu Breslau 1679, gestorben 1754) letzte Elemente, Corpuscula derivativa, der Dinge mit Leibniz’s Monaden und sein Determinismus mit dessen prästabilierter Harmonie übereinkommen, ist schon zu Lebzeiten des bedeutenden Mannes erkannt worden. Nur will er den Monaden statt des geistigen Weltbewußtseins, -vorstellens, -kennens mehr Kräfte zuschreiben, durch die sie wirken und leiden; Kräfte jedoch, die mit dem, was wir gewöhnlich Kraft nennen, keine Ähnlichkeit haben, überhaupt sich nicht aus der physischen Natur verstehen lassen. Es findet also gegen Leibniz eigentlich nur ein Namentausch statt, der aber nicht zum Vorteil des Systems ausschlägt. Diese Philosophia corpuscularis soll aber die wahre Ratio der besonderen Phänomene beibringen, denn diese sind begründet in den Qualitäten der Korpuskeln und der Art, wie diese untereinander verbunden sind. Die schöne Poesie des Leibnizschen Systems fehlt hier, im Grunde auch die Konsequenz. Sobald es sich jedoch um die Wirkung zwischen Körper und Seele handelt, erkennt Wolff die prästabilierte Harmonie als die beste Erklärung an.
Determinist im Leibnizschen Sinne, soweit seine Rechtgläubigkeit es zuließ, war auch Moses Mendelssohn (1729 zu Dessau geboren, 1786 in Berlin gestorben). Indessen war er es nur unter der Bedingung der Unsterblichkeit. Wenn die Hoffnung dieser nicht wäre, sei der Mensch das elendeste Tier auf Erden und bliebe ihm nichts übrig, als in Betäubung[S. 346] dahinzuleben und zu verzweifeln. Und wie er bemüht war die Unsterblichkeit zu erweisen und zu ihr mit aller Kunst eines gottgläubigen und edlen Gemütes zu überreden, zeigt sein Phädon, der erst als Übersetzung des gleichnamigen Gesprächs des Platon beabsichtigt ist, dann aber das Vorbild verläßt und schärfer noch als dieses, und mit besseren Waffen, für unsere Seele kämpft. Aber überall tritt bei ihm der Deismus hervor und spielt die Contemplatio eine viel größere Rolle als die Ratio. Seltsam ist, daß, obwohl er selbst pandeistische Neigungen verrät, die außerordentliche Philosophie seines geistesgewaltigen Glaubensgenossen Spinoza ihm so zuwider war, daß der Kampf gegen die Meinung, sein Freund Lessing sei in den letzten Lebensjahren Spinozist gewesen, ihm das Herz brach und ihn früh ins Grab senkte.
Es ist möglich, das Lessing in der Tat zuletzt sich dem Pantheismus Spinozas zugewandt hat; ursprünglich aber war er Leibnizianer, namentlich in bezug auf die letzten Wesen und die Harmonie. Was Gott denkt, ist; dachte er sich selbst insgesamt, so ward der ihm identische Sohn, Christus. Stellte er sich in seinen Vollkommenheiten zerteilt vor, so ward die Welt. Diese muß darum von allen möglichen Welten die vollkommenste sein, die vollkommene Stufenleiter der Vollkommenheiten darstellen. Der unmittelbare Gegenstand dieser schöpferischen Tätigkeit sind einfache Wesen, alles Zusammengesetzte ist nur eine Folge dieser Schöpfung. Alles was in der Welt vorgeht, ist aus der Harmonie der einfachen Wesen zu erklären. Die einfachen Wesen sind „gleichsam eingeschränkte Götter“. Sie sind voneinander unterschieden durch größeres oder geringeres Bewußtsein ihrer Vollkommenheit. Das Gesetz des Menschen sei: „Handle deinen individualischen Vollkommenheiten gemäß“. Im Grunde steckt schon hier ein Stück Pandeismus, denn die Welt ist: die Vollkommenheiten Gottes zerteilt gedacht. Und Lessing sagt auch, daß er sich die Wirklichkeit einer Welt außer Gott nicht denken könne. Aber Spinozas Pantheismus ist das gleichwohl nicht. Die Unsterblichkeit betrachtet er wie Platon, die Indier u. a., als Mittel zur steten Vervollkommnung. Und[S. 347] gleicherweise die Seelenwanderung. Paragraph 93 und folgende in „Die Erziehung des Menschengeschlechts“ heißt es: „Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne Mensch (der früher, der später) erst durchlaufen haben... Warum könnte jeder einzelne Mensch auch nicht mehr als einmal auf dieser Welt gewesen sein?... Warum sollte ich nicht so oft wiederkommen, als ich neue Kenntnisse, neue Fertigkeiten zu erlangen geschickt bin? Bringe ich auf einmal so viel weg, daß es der Mühe, wieder zu kommen, etwa nicht lohnet? Darum nicht? — Oder weil ich es vergesse, daß ich schon dagewesen?... Und was ich auf jetzt vergessen muß, habe ich denn das auf ewig vergessen? Oder weil so zuviel Zeit für mich verloren gehen würde? — Verloren? — Und was habe ich denn zu versäumen? Ist nicht die ganze Ewigkeit mein?“ Das wiegt tausend Räsonnements eines trockenen Theologen auf. Schwierig damit, daß nämlich der Einzelne sich fortschreitend vervollkommnet, zu vereinen ist Lessings Ansicht, daß die Vollkommenheit der Welt keine fortschreitende sondern eine (durchschnittlich) stabile ist, was eben daraus folgen würde, daß Gott sie geschaffen hat. Ob dem Fortschritt Rückschritte entsprechen? Daß ein Lessing die Leibnizschen Lehren von Himmel und Hölle des Orthodoxen entkleiden mußte, versteht sich von selbst. Lessing wird auch zu den Popularphilosophen, Aufklärungsphilosophen gerechnet.
Von Herbart (1776 in Oldenburg geboren, 1841 gestorben) gehören wenigstens die Realen hierher. Darin, daß sie absolute Einheiten, unteilbar, zeitlos, raumlos sein und Aggregate von ihnen die Dinge bedeuten sollen, gleichen sie den Leibnizschen Monaden. Sie sind auch uranfänglich voneinander verschieden. Jede Reale soll ihre Qualität stetig und in Ewigkeit behalten. Das einzige, ihr inneres Leben Bedeutende ist lediglich die „Selbsterhaltung“. Diese macht sich geltend den „Störungen“ anderer Realen gegenüber, und in dieser Selbsterhaltung besteht alles Leben und Vergehen in der Natur. So sind alle unsere seelischen Tätigkeiten wie Denken, Fühlen, Wollen usf. nur Selbsterhaltungen gegen[S. 348] Anderes; und das Bewußtsein ist der Inbegriff all dieser Selbsterhaltungen. Die Dinge sind wie bei Leibniz ein Zusammensein von Realen, aber nicht in dessen geistigem Sinne, da die Realen keine Vorstellung haben, sondern ein mehr zufälliges. Wenn verschiedene Reihen von Realen einen gleichen Ausgangspunkt haben, so fassen wir sie als Ding auf. Gegenüber der Klarheit des Leibnizschen Systems weiß man sich hier kaum durchzufinden. Da die Realen absolut einfach und ohne jede Vorstellung von Anderem sein sollen, namentlich ohne jeden Wechsel in ihrem Inneren, wie erfährt da eine Seele die „Störung“, also die Gegenwart einer anderen Seele? Was kann Selbsterhaltung anderes bedeuten als Tätigkeit zur Erhaltung eines Vorhandenen, eben des Selbst? Wie ist das aber mit der absoluten, einfachen Wechsellosigkeit zu vereinigen? Was führt die Realen zusammen? Herbart spricht auch von Vorstellungen. Zeller (Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz) meint, die Konsequenz dieses Systems wäre, „daß die Form, unter der uns die Realen erscheinen, ihre Verbindungen und die Änderung dieser Verbindungen, nicht in ihnen selbst und ihrem objektiven Verhältnis, sondern nur in unserer subjektiven Auffassung begründet sei“. Aber auch das geht nicht. Wir sind ja selbst Reale; wie kommen wir denn zu Auffassungen, ob subjektiven oder objektiven? In Herbarts Naturphilosophie machen sich die Übel dieser Unbegreiflichkeiten so schwer geltend, daß zuletzt — eben aus absolutem Mangel an jedem ideellen oder wirklichen Zusammenhang zwischen den Realen, wodurch auch ein Raum und eine Zeit, selbst nur gedacht „intelligibel“, ausgeschlossen wird — sogar Möglichkeiten von Zusammensein von Realen, erst als Bilder und dann als Reale selbst, behandelt werden, wie geometrische Konfigurationen, und daß auch teilweise Durchdringlichkeit der Realen angenommen wird. Ich darf hier aufhören, weil ich doch nicht weiß, wie eine deutliche Anschauung zu gewinnen ist. Nur das möchte ich noch erwähnen, daß Herbart Gott aus teleologischen Gründen setzt. Bringt Gott den Zusammenhang hinein? Und wie?
DRITTES BUCH.
Metaphysische und physische Welt- und Lebenanschauungen.
Wir sammeln in diesem Buche alle diejenigen Anschauungen von Welt und Leben, bei denen von Gott als Weltschöpfer und Welterhalter entweder ganz abgesehen oder der geringst mögliche Gebrauch gemacht wird. Vielfach widerstreitet hier die Theorie der Praxis; und so bestehen Anschauungen, bei denen von Gott entweder nur nicht gesprochen wird, indeß er im Hintergrunde doch mindestens als erste Ursache waltet, oder bei denen, was theoretisch wegdisputiert ist, praktisch wieder eingeführt wird. Es soll dieses im einzelnen erhellen. Viele aber nehmen in der Tat lieber einen blinden Zwangsmechanismus als einen unumschränkten Herrn, der so viel Übel in der Welt geschehen läßt. Die Gesamtheit der Anschauungen teilt sich in metaphysische und physische. Jene erwachsen aus Untersuchungen über die letzten Dinge, über das was wahr ist, diese aus der umgebenden Wirklichkeit. Die Unterscheidung besteht jedoch nur für die Extreme, sonst geht Metaphysisches und Physisches durch und ineinander.
SECHSTES KAPITEL.
Welt- und Lebenanschauungen des Idealismus.
Wenn wir die Dinge, und uns mit, so nehmen, wie sie uns erscheinen, und nichts weiter hinter ihnen als Anderes setzen, so sprechen wir von einem Realismus. Betrachten wir aber die Dinge nur als von uns verdinglichte Erscheinungen, hinter denen ein Anderes entweder gar nicht vorhanden, oder[S. 350] eben als ein Anderes vorhanden ist, so sprechen wir von einem Idealismus, und das was etwa hinter den Dingen steht, bedeutet das Transzendente. Dinge sind dann für uns objektivierte Transzendente; entweder Nichts oder unserem Begreifen entzogene Gegenstände, transzendente Wirklichkeiten. Die zahlreichen Arten und Abarten des Idealismus besonders zu erklären, darf ich hier unterlassen, sie werden bald in der Behandlung hervortreten.
41. Phantomismus (Illusionismus), Eleaten, Skeptiker.
Die Indier hatten auch die Anschauung, daß die ganze Welt, einschließlich aller Lebewesen, nur ein Traum Brahmas sei. Mit dem Traum ist alles entstanden, und wenn Brahma erwacht, ist alles geschwunden, wie die Bilder unserer Träume kommen und spurlos verwehen. Denn Traumgestalten sind wir, und Traumgestalten sind Himmel, Gestirne und Erde. Eine Milderung dieser Anschauung bedeutet es, wenn, in einer anderen Anschauung, dieser Traum nur in den Menschen verlegt wird, es also heißt, die Welt ist nur in uns als ein Traum. Wir bestehen, die Welt aber besteht nur in uns. Unser irdisches Leben ist Träumen. Sind wir von diesem Leben befreit, so ist keine Welt, nur wir sind. In dieser, dem Verständnis aus der Analogie unserer wirklichen Traumwelten leichter zugänglichen Form ist die Lehre weit verbreitet. Wir finden sie selbst bei den realistischen Chinesen. Lao-tsse sagt, das Leben sei ein Gaukelspiel eines wirren Traumes.
Indessen gibt dieses letztere kein philosophisches System, weil es gar zu sehr metaphorisch unernst wirkt. In der ersten Wendung aber finden wir bei den Indiern Lehren, die durchaus einem solchen philosophischen System angehören. Eines nur ist: Brahman (S. 230). Dieses Eine ist ewig und unveränderlich, ohne jede Qualität, ein absolutes Eins. Zu diesem Eins kommt das Unwissen (Avidyiâ), oder das Sichtäuschen (Mâyâ), ein Unbegreifliches; und unter diesem ist das Eins Mannigfaltigkeit, Welt geworden, mit allen Dingen und allen Veränderungen. Das ist ein Pan[S. 351]theismus, aber nur als Phänomen, nicht als Wirklichkeit; die transzendente Wirklichkeit ist allein das Eins, Brahman. Die Dinge und die Vorgänge sind als Täuschung praktisch real, als transzendente Wirklichkeit Nichts, oder vielmehr Brahman. So lautet die Illusionslehre des Sankara in der Vedantaphilosophie (S. 259):
Und so besteht ein doppelter Brahman, die absolute transzendente Wirklichkeit, das Eins, Param Brahman, und die Illusionswirklichkeit, das phänomenale Brahman, Aparam Brahman. Damit hat die Welt Realität und hat auch keine. Praktisch ist sie aber durchaus real. Letzteres mußte Sankara lehren, denn sonst fielen ja alle ethischen Grundsätze und alle Religion mit allen Göttern fort, und für Sankara war die Veda eine heilige Schrift. Warum die Illusion hinzukommt, wird nicht gesagt, noch woher sie stammt. Sie wird aber mitunter neben Brahman (oder in Brahman?) so real bezeichnet, daß sie als Mâyâ Persönlichkeit erlangt, gar als Gattin Brahman sich zugesellt.
Der Leser, dem die griechische Philosophie bekannt ist, wird schon bemerkt haben, welche außerordentliche Ähnlichkeit die obigen Darlegungen mit denen der Schule der sogenannten Eleaten haben. Als Stifter dieser Schule wird Xenophanes (S. 231) bezeichnet, ein Ionier, der sich in Elea in Unteritalien niederließ. Er ist es, von dem der berühmte Ausspruch stammt, daß, wenn Rosse und Ochsen „malen könnten und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse roßähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und Werke bilden, wie jede Art gerade selbst das Aussehen hätte“. Und so tadelte er die Griechen nicht bloß wegen ihrer Anthropomorphie der Götter, sondern auch wegen ihrer Götter-Vielheit. Nur einen Gott gibt es, ein Eins, ein Ewiges, Unvergängliches. Und dieses ist das Weltganze. Mehr ist von seinen allgemeinen Lehren mit[S. 352] Zuverlässigkeit nicht bekannt. Selbst daß er in Gott das Weltganze gesehen hat, dürfte mehr Vermutung sein, da, was er sonst von der Welt sagt, rein physisch ist und der Würde der Gottheit kaum entspricht. Sicherer ist was Parmenides (um 544 v. Chr. geboren) aus Elea lehrte: „Nötig ist dies zu sagen und zu denken, das Seiende existiert, denn das Sein (τὸ ἐόν) ist, das Nicht ist nicht.“ „So bleibt nur noch Kunde von einem Wege, daß das Seiende existiert. Darauf stehen gar viele Merkpfähle. Weil ungeboren, ist es auch unvergänglich, ganz, einziggeboren (μονογενές), unerschütterlich und ohne (zeitliches) Ende. Es war nie und wird nicht sein, weil es jetzt ganz alles ist.“ „Auch teilbar ist es nicht, weil es ganz gleichartig ist. Und es ist auch nirgend etwa ein intensiveres, das seinen Zusammenhang hindern möchte, noch ein geringeres; es ist ganz vom Seienden erfüllt... Sodann liegt es unbeweglich in den Schranken starker Fesseln, ohne Anfang, ohne Ende... Als Selbiges in Selbigem verharrend, ruht es in sich selbst und verharrt so standhaft alldort. Denn der starke Zwang (ἀνάγκη, Ananke) hält es in den Banden der Schranke, die es rings umgibt. Darum darf das Seiende nicht unabgeschlossen sein, denn es ist mangellos, und es wäre gänzlich mangelhaft, wär’s anders...“ (Diels: Fragmente der Vorsokratiker. Ich habe hier und im folgenden, sowie im voraufgegangenen, die Übersetzungen dabei benutzt, jedoch, meinem Zweck entsprechend, sie möglichst genau an den Wortlaut des Originals angepaßt.) Schon der Abschluß zeigt, daß Parmenides sich das Seiende als eine Realität dachte. Was er weiter sagt, rückt diese Realität fast ins Materielle: „Aber da eine letzte Grenze vorhanden ist, so ist das Seiende abgeschlossen nach allen Seiten hin, vergleichbar der Masse einer wohlgerundeten Kugel, von der Mitte nach allen Seiten hin gleich stark“. Das wäre auch der Sphairos des Empedokles (S. 231). Es ist aber nichts weiter als dieses in sich gleiche, in sich ruhende, rings umschränkte, zeitlose, absolut Seiende. „Und so ist auch alles leerer Schall, wovon die Menschen sprechen, überzeugt, es sei wahr: nämlich Werden sowohl als Vergehen, Sein sowohl als[S. 353] Nichtsein, Veränderung des Ortes und Wechsel der Farbe, überhaupt der Eigenschaften.“ In diesem letzteren Satze liegt das Schwergewicht der eigentlichen Lehre. Und dieser Satz hat die Philosophen unendlich geplagt, und plagt sie noch jetzt. Er besteht im Grunde aus zwei Sätzen: „Aus Nichtsein kann kein Sein werden“ und „Aus Sein kann kein Nichtsein hervorgehen“. Indem ein jedes Entstehen bedeuten soll, daß vorher Nichtsein war, wo jetzt Sein ist, und ein Vergehen, daß jetzt Nichtsein ist, wo vorher Sein war, dürfte es überhaupt keine Änderung geben, da nur das Sein da sein soll. Es ist bekannt, wie der Hauptdialektiker der Eleaten, Zenon (etwa nach 500 v. Chr. geboren), gleichfalls aus Elea, mit diesen Sätzen bewies, es gäbe in der Tat nicht die geringste Änderung in der Natur. Nicht einmal Bewegung sei möglich, denn alles setze sich aus Ruhe zusammen, und Ruhe sei keine Änderung; der Übergang aus einer Ruhe in eine andere aber sei undenkbar, weil dabei ein Seiendes schwände und ein Nichtseiendes entstehe. „Das Bewegte bewegt sich weder in dem Raume, in dem es sich befindet, noch in dem es sich nicht befindet.“ Das gehört nicht hierher; es kommt im Grunde alles darauf hinaus, daß ein „Werden“ und „Vergehen“ als für sich begrifflich nicht faßbar angesehen wird und durchaus aus Nichtsein und Sein oder aus Sein und Nichtsein soll zusammengesetzt sein müssen. Herakleitos ist gerade vom entgegengesetzten Standpunkt ausgegangen (S. 238), für ihn gab es nur „Werden“ und „Vergehen“. Auch die Spitzfindigkeiten der Eleaten — wie die berühmte Schlußfolge, Achill könnte nie eine Schildkröte einholen, weil, so oft er einen Weg mache, die Schildkröte doch auch einen zurücklege, also ihm immer voraus sei — beruhen auf solchen Unfaßbarkeitsannahmen, die dann Zusammensetzungen aus Widersprechendem bedingen. Seltsamerweise spukt die Formel: Werden = Sein + Nichtsein noch heute in vielen Köpfen. Die Eleaten leugneten auch alle Größe und alle Teilung ab, kurz alles, was die Welt als Mannigfaltigkeit in Raum und Zeit darstellt. Nur das Sein erkannten sie an. Was ist dann die Welt? — Lediglich Schein,[S. 354] nichts als Schein, ganz im Sinne der Indier. Und wenn beispielsweise Parmenides ziemlich eingehend von der Entstehung und Ordnung der Welt spricht, so bemerkt er, daß es sich doch um ein „Wahngebild“ handelt und um „Wahngedanken“. Melissos aus Samos (um 440) sagt, weil der Dinge viele sind und sie sich ändern. Woher aber der Schein, der Wahn? Darüber haben die Eleaten keine Vermutung ausgesprochen, und so stehen sie den Indiern erheblich nach, die wenigstens ein Prinzip dafür aufgestellt haben, wenn dieses auch nichts anderes besagt, als daß der Schein, als Unkenntnis und Täuschung, ein Etwas für sich sei, das zusammen mit dem Absoluten die Welt gebe. In der Tat ist auch die eleatische Lehre nur nach Worten monistisch, an sich verfährt sie dualistisch, denn der Schein ist nicht Sein, und doch sind beide vorhanden. Hierher gehört im Grunde auch die sogenannte Megarisch-Elische Schule (von Eukleides aus Megara, einem Verehrer des Sokrates begründet), die nur ein Seiendes anerkannte, das Gute, alles andere in der Welt für nichtseiend, Schein erklärte und sich der eleatischen Dialektik zum Nachweis einer solchen Behauptung bediente. Im übrigen ist der eleatischen Lehre Großartigkeit nicht abzusprechen. Melissos sagt: „So ist es (das Seiende) denn ewig, und unendlich, und eins, und ein in sich gleiches Alles. Und es könnte nicht irgend einmal untergehen, noch empfindet es Schmerz oder Leid.“ „Auch gibt es kein Leeres, denn das Leere ist nichts; demnach kann das, was ja nichts ist, nicht vorhanden sein.“ Also Eins nur besteht, zeitlich und räumlich überall, nie sich ändernd, in sich ohne jede Unterscheidung.
An diese Lehren schließen sich sachlich die des Skeptizismus (Skepsis, Zweifel) an. Sie können hier kurz behandelt werden, da sie nicht eigentlich eine Welt- und Lebenanschauung geben. Die Erfahrung, wie vieles unsicher und widersprechend ist, führt zu der Meinung, daß man nichts mit Bestimmtheit behaupten könne, und in der Übertreibung, deren sich die Sophisten schuldig gemacht haben, daß man von allem alles behaupten könne, was sie in ihrer Streitmethode, Eristik, zu so scharfsinnigen Auseinandersetzungen,[S. 355] aber auch zu so verderblichen Lehren geführt, hat. Protagoras (480–410 v. Chr.), Gorgias (zwischen 484 und 375), Prodikos, Hippias sind die hervorragendsten Vertreter der noch wissenschaftlichen und ethischen Schule der Sophistik. Das Heer der übrigen Sophisten darf übergangen werden. Der ungeheure Einfluß der Sophisten als Lehrer, namentlich der praktischen Staatskunst, ist bekannt. Manche unter ihnen haben Macchiavelli nichts nachgegeben. Von Protagoras rührt der Spruch her: „Aller Dinge Maß ist der Mensch, das Seiende für sein Sein, das Nichtseiende für sein Nichtsein“. Dieser Satz ist offenbar von Wichtigkeit für den Idealismus überhaupt, namentlich in dessen Form als Kritizismus. Skeptizismus findet sich naturgemäß überall in der Philosophie. In die Akademie eingeführt hat ihn Pyrrhon aus Elis (365–275 v. Chr.). Ein bedeutender Vertreter ist Arkesilaos (315 bis 240 v. Chr.), der jede Möglichkeit, durch Erfahrung oder Nachdenken zu Erkenntnissen zu gelangen, bestritt, also für die Wahrheit kein Merkmal in der Welt fand, und dem so die Wahrscheinlichkeit (Eulogon) als Richtschnur aller Behauptungen und Handlungen dienen mußte. Das eigentliche Haupt der so genannten Neuen Akademie war aber Karneades aus Kyrene (224–155 v. Chr.), der unerbittliche Kritiker den Dogmatikern gegenüber, die sich wesentlich aus der stoischen Schule rekrutierten. Ein höchst scharfsinniger Mann, vermochte er alle dogmatischen Lehren von Gott und Wahrheit mit guten Gründen anzugreifen und zu bekämpfen, indem er überall Widersprüche und nicht zu beweisende Annahmen aufdeckte. Nun, die Menschheit leidet ja von je daran. Wäre dem nicht so, so gäbe es ja keine Wissenschaft von Welt und Gott, sondern ein Wissen. Darum gerade retten sich die einen in die Dogmatik, andere in den Glauben, noch andere in die Wahrscheinlichkeit, und viele in die Intuition. „Was ist Wahrheit?“ soll Pilatus gefragt haben. Das wird eben immer und von je gefragt. Und die Untersuchungen der neueren Philosophie richten sich eben auf die Kriterien der Wahrheit, und darauf, eine Wahrheit aufzustellen, um alles andere daran anschließen zu können, wie Descartes eine solche in dem Aus[S. 356]spruch „Ich denke, also bin ich!“ gefunden zu haben glaubte und Fichte in seinem Ich-Satz. Wir werden noch vielen Skeptikern begegnen.
42. Phänomenaler Idealismus.
Die Idee, daß die Dinge nicht so sind wie sie uns scheinen, findet sich vom Altertum durch das ganze Mittelalter mehr oder weniger deutlich ausgesprochen. In der neueren Zeit zuerst in ein System verarbeitet hat sie der in Irland geborene Engländer George Berkeley (1684–1753), ein großer Denker und Naturkenner. Er ist ein heftiger Gegner des Materialismus und Spinozismus und bezeichnet seine Lehre als Immaterialismus. In der Tat hat sie auch viel Theosophisches, wie er auch so manches von den mittelalterlichen Theosophen und Mystikern einfach übernahm. Er ist von der Wahrhaftigkeit Gottes im Cartesischen Sinne überzeugt. Also können Wahrnehmung und Vernunft nicht absolut lügen und trügen. Darum ist er auch Nominalist. Nun aber meint er, Wahrnehmung sei durchaus von dem Wahrgenommenen zu trennen. „Da wir wahrnehmen, daß verschiedene von den Empfindungen einander begleiten, so werden diese durch einen Namen umgrenzt und so für ein Ding ausgegeben.“ „Sinnliche Dinge sind hiernach nichts anderes als so viele sinnliche Qualitäten oder Kombinationen von sinnlichen Qualitäten.“ Alle diese Qualitäten sind aber, da wir wahrnehmen, nur in unserer Seele. Außerhalb Gottes und der Seele gibt es keine Erscheinungen. Da nun eine Erscheinung ganz ein Inneres ist, so können die Dinge den Erscheinungen nicht gleichen, die Erscheinungen sind keine Kopien der Dinge. Berkeley beruft sich überall auf physikalische und physiologische Erkenntnisse, die durchaus zutreffend sind. Und so ist es auch richtig, wenn er meint, daß wir unsere Wahrnehmung der Ausdehnung nicht den Dingen zuschreiben können, denn ein anderes ist die Ausdehnung in den Wahrnehmungen des Sehens, ein anderes in denen des Tastens; sie werden nur konfundiert, weil sie sich stets begleiten. Berkeleys Sensualismus ist hiernach ein innerer, ein Phänomenalismus. Und so[S. 357] ist zu verstehen, daß er Dinge ohne Erscheinungen in uns als Fiktionen bezeichnet, wie die abstrakten Figuren und Zahlen in der Mathematik. Ich darf auf entsprechende Ausführungen in meinem Buche „Philosophische Grundlagen der Wissenschaften“ hinweisen. So kämpft er auch gegen die Annahme einer absoluten Substanz, Materie, die niemand kennt und niemand kennen kann, und der man, um zu einer Welt zu gelangen, gezwungen ist, eine Menge verborgener Eigenschaften zuzuschreiben, die anderweit wieder abgestritten werden müssen; so Bewegung aus sich heraus, der doch die Trägheit widerspricht. Nur der Geist ist absolute Substanz, er allein ist tätig und wo er sich leidend verhält, folgt dieses aus der Schranke, die ihm gesetzt ist. Die Körper sind nicht, sondern sie werden: durch unsere Wahrnehmungen. Und so existieren sie nur „sekundär und abhängig“.
Gleichwohl ist Berkeleys System kein solches des reinen Scheines, noch weniger des Nichts. Das Kausalitätsprinzip greift bei ihm ein. Die Wahrnehmungen müssen doch irgend einen Grund haben. Diesen sieht er nicht wie Indier und Eleaten in uns selbst, sondern außer uns, in einem Geist außer unserem Geiste; und das ist der göttliche Geist. Seiner sind wir sicher, eben aus den Wahrnehmungen in uns, nämlich aus den Naturerscheinungen und ihrer Ordnung. „Der große Beweger und Urheber der Natur offenbart sich ständig selbst den Augen der Menschen durch sinnliche Intervention willkürlicher Zeichen (wie der Mensch durch willkürliche Zeichen, Sprache, seinen Geist offenbart), welche keine Ähnlichkeit noch Verbindung mit den bezeichneten Dingen haben.“ Das ist von vielen vor ihm schon gesagt und wird auch in der Bibel in der mannigfachsten Weise variiert. Aber hier handelt es sich um den kosmologischen Beweis Gottes. Und so ist Gott die naturierende Natur, und der überall und jederzeit wirkt. Wahrhaft ist alles nur in Gott als Eins. Was wir kennen und erkennen, sind Abbilder dieses Wahrhaften. Unser Geist wirkt wie Gott. Nur daß Gott ohne jede Beschränkung ist, so daß er beliebig schafft, und was er schafft der Ewigkeit angehört. Aus unserer Gottähnlichkeit folgt dann ein gewisser freier Wille. Wie aber[S. 358] das bewußt Böse? Das ist nicht gesagt, wenn es nicht als zur Ordnung der Dinge gehörig angesehen wird. Trotz allem Schein ist die Welt real. „Alle Dinge zusammen mögen ein Universum sein, Eines durch die Verbindung, Beziehung und Ordnung zu ihren einzelnen Teilen, welches das Werk des Verstandes ist.“ Rein intelligibel betrachtet aber sind die Dinge unbeweglich und unveränderlich. Man sieht: nur die Intervention Gottes, der absolut wahrhaft ist, macht es, daß hinter dem Schein eine transzendente Wirklichkeit vorhanden sein könnte. Und aus der gleichen Intervention ergäbe sich Berkeleys Rationalismus und die Möglichkeit der Wissenschaften, im Grunde wie bei Descartes. Die transzendente Wirklichkeit aber, soweit sie zugestanden sein sollte, wird fast pandeistisch aufgefaßt, und unser Verhältnis zu ihr, und damit zu Gott theosophisch. Im wesentlichen aber ist Berkeleys Phänomenalismus wirklicher Schein. Kant nennt das empirischen oder dogmatischen Idealismus.
Mit dieser Berkeleyschen Anschauung hat die spätere Fichtesche große Ähnlichkeit. Gott wird unmittelbar gesetzt als das absolute Sein, wie die Eleaten sich dieses Sein dachten. Alles andere ist nur Wissen als Bild des göttlichen Seins: Ein Sein Gottes außer seinem Sein, nicht Gott selbst, sondern sein Schema. In diesem Bilde ist das Sein ein Mannigfaltiges. Indem es aber, wenn auch ein Bild, doch ein Göttliches ist, muß es eine göttliche Weltordnung darstellen. Gleichwohl ist wie bei Berkeley die Natur nur die Schranke des Bewußtseins, und an sich eine nichtige und wesenlose Erscheinung, die ihr Dasein nur in unserer Vorstellung hat. Wieder ganz wie bei Berkeley steht die Natur zwischen Gott und Geist, Bewußtsein. Wir werden später sehen, daß in seiner ersten Philosophie Fichte umgekehrt Gott aus der Weltordnung abgeleitet, eigentlich die Weltordnung für Gott erklärt hat. Dieser Idealismus, der die äußere Welt in einen Schein auflöst und sie nur retten kann durch die Annahme Gottes und dessen absoluter Wahrhaftigkeit, ist sogleich nach Berkeley von dem Schotten David Hume (1711–1776) vollends auf die Spitze getrieben worden, indem auch die Autorität unserer[S. 359] eigenen Vernunft in Zweifel gesetzt ist. Denn unsere Vernunft ist nichts Bleibendes, sondern stetig Wechselndes, eine Folge von Bewußtseinsinhalten, kein seiender Bewußtseinsinhalt, so daß ein ständiges seiendes Ich nicht behauptet werden kann. Nur die zusammenhängende Kette dieser Folge erweckt den Schein eines solchen Ich, in Wahrheit leben wir ein solches Leben ohne Ich. Unsere Psychologie hat kein Subjekt, keine Seele, sie besteht lediglich aus assoziierten inneren Erscheinungen, ein Satz, den wir später bei modernen Psychologen wiederfinden werden. Es gibt also nirgend ein Wirkliches in der Welt, nicht außer uns, nicht in uns; alles ist Schein und Erscheinung, hier wie dort. Was die Erscheinungen und ihre Assoziation, Vergesellschaftung, in uns hervorbringt, wissen wir nicht. Wie auf einer Schaubühne treten die inneren Erscheinungen auf; Bühne und Regisseur sind uns aber unbekannt, von ihnen ist nichts aussagbar. Und was darüber ausgesagt wird, ist pure Einbildung. Es ist eine Art Deutung der Heraklitischen Lehre in eleatischem Sinne, und Hume kann sehr wohl auf diesem Standpunkte seiner Philosophie als Skeptiker bezeichnet werden. Gleichwohl hat er auch ein realistisches System begründet, das wir später (S. 407 ff.) kennen lernen werden, indem er das Unerschaubare beiseite ließ, sich an den Schein hielt, und diesen gleich einem festen Gegebenen behandelte.
43. Kants transzendentaler Idealismus.
Organisierte Wesen und Naturzweck.
„Wir haben also sagen wollen: daß alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei: daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse an sich selbst so beschaffen sind, als sie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt, oder auch nur die subjektive Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte in Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren können. Was es für eine Be[S. 360]wandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, die uns eigentümlich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, obzwar jedem Menschen zukommen muß.“ (Kritik der reinen Vernunft, S. 66, ich zitiere dieses Werk nach der ausgezeichneten Reclam-Ausgabe). Diese Auffassung nennt Kant selbst Idealismus, und sofern gleichwohl alles als wirklich angesehen wird, den transzendentalen oder formalen Idealismus, während vom materialen der dogmatische Idealismus die Dinge leugnet, der skeptische sie bezweifelt. Kant ist transzendentaler oder formaler Idealist. Raum und Zeit (besser Räumlichkeit und Zeitlichkeit) sind die berühmten beiden „Anschauungsformen“ der Vernunft. „Sie hängen unserer Sinnlichkeit schlechthin notwendig an, welcher Art auch unsere Empfindungen sein mögen.“ Der Raum ist die Anschauungsform des nach Außen gerichteten Sinnes, die Zeit die des nach Innen gerichteten Sinnes. Die Bedeutung dieser Feststellungen habe ich in meinem früher genannten Buche, ich glaube auf das sorgfältigste, zergliedert, und ich habe nachgewiesen, daß die Eigenschaften des Raumes sich ohne den Begriff der Ursächlichkeit nicht erschöpfen lassen, und daß die Besonderheit der Zeit in den Geschehnissen als Projektion des inneren Bewußtseins vom Wechsel in unserer Seelentätigkeit nach Außen aufzufassen ist. Ich muß auf dieses Buch verweisen, darin der Leser auch gewisse andere Distinktionen hinsichtlich der verschiedenen Arten von Raum und Zeit finden wird. Obwohl nun Raum und Zeit unausweichliche Formen unserer Anschauung nach Außen und nach Innen sein sollen, können sie uns doch nichts, weder über die Welt noch über die Seele, lehren. Sie sind als Stammbegriffe, Räumlichkeit und Zeitlichkeit, a priori, „das ist, vor aller wirklichen Wahrnehmung“, vorhanden; sie sind „reine Anschauung“. Wogegen Empfindung ist „das in unserer Erkenntnis, was da macht, daß sie Erkenntnis a posteriori, das ist empirische Anschauung heißt“.
Die apriorischen Stammbegriffe, deren Bedeutung als apriorische so oft und so energisch geleugnet worden ist und noch geleugnet wird, spielen bei Kant eine große Rolle. Ich selbst halte sie für ganz unerläßlich; ein äußeres oder inneres Leben ohne beispielsweise den Stammbegriff der Ursächlichkeit, scheint mir absolut ausgeschlossen. Kein Tier würde essen oder trinken ohne diesen Stammbegriff, kein Tier auf einen Reiz irgendeine Wahrnehmung haben. Daß die Stammbegriffe uns nicht immer bewußt sind, ist zwar richtig, tut aber nichts zur Sache. Das Bewußtsein gehört überhaupt nicht zu allen physischen Handlungen. Wir wenden viele Tätigkeiten der Seele, z. B. das Wollen, mehr oder weniger bewußt, zuweilen ganz unbewußt an. Zwar geschieht sehr vieles bewußt, was uns nachher unbewußt geschehen erscheint, weil wir kein Interesse daran hatten, es zu behalten, wie namentlich animalische Handlungen, Gehen, Essen usf., und auch logische, wie das Rechnen aus „Gewohnheit“. Aber mögen auch die Handlungen vom Tiere oder vom Kinde unbewußt geschehen, aus „Instinkt“ oder „Trieb“, so bleibt doch zweifellos der Grund für diesen Instinkt oder Trieb. Und will man keinen Grund angeben, so sind Instinkt oder Trieb apriorisch, angeboren, und man hat nichts gewonnen außer etwas, das man bei entwickeltem Verstande wieder fallen läßt. Es ist etwas nötig, das die Wesen animalisch, weltlich und geistig überhaupt leben läßt. Damit müssen sie von vornherein ausgerüstet sein, sonst ist keines dieser Leben als Leben möglich, wenigstens nicht für den, der in den Wesen nicht pure Zwangsmaschinen sieht. Dieser braucht allerdings keine apriorischen Seelentätigkeiten. Es sind — ich will mich vorsichtig ausdrücken — gewisse apriorische Seelentätigkeiten nötig, die von den untersten Wesen nach oben und vom Geborensein nach dem Alter, phylogenetisch und ontogenetisch, mehr und mehr ins Bewußtsein treten, deutlicher und deutlicher werden, wie ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Wille, eine Empfindung usf., die ja auch verschwommen beginnen und zuletzt scharfstrahlig leuchten können. „Erworben“, „erlernt“ sind hier nur leere Rede[S. 362]wendungen, denn man wird immer fragen müssen, woher die Fähigkeit zum Erwerben, Erlernen kommt, und wird dann eben auf das Apriorische zurückgelangen. Einer Puppe kann man die menschliche Gestalt geben und sie so oft zum Gehen anleiten als man will, sie geht doch nicht von selbst, sie hat im Inneren die Fähigkeit dazu nicht. Diejenigen aber, die auch in den lebenden Wesen zwangsmäßige äußere und innere Automaten sehen, dazu eigentlich auch die Okkasionalisten gehören, brauchen freilich, wie bemerkt, Apriorisches nicht, sie brauchen dann auch keine abgeleiteten Begriffe, keine Erfahrung, überhaupt gar nichts. Ich werde später diese Ausführungen vervollständigen (S. 474 f.), auch mich auf sie zu berufen haben, und verweise nur noch auf das früher (S. 222 f.) von der kategorischen oder regulativen Seele Gesagte. Denn das Apriorische ist kategorisch, regulativ. Es gehört zu den größten Verdiensten Kants, daß er das Angeborene von dem Erworbenen so scharf zu unterscheiden gelehrt hat, indem er nachwies, wie ersteres durchaus die unausweichliche Voraussetzung für letzteres ist. Die Notwendigkeit für das Leben überhaupt hat er nicht betont, sie folgt aber unmittelbar.
Also, es besteht eine Welt. Sie ist transzendental. Die Seele faßt sie nach ihren Kategorien auf. Welches diese Kategorien außer Raum und Zeit noch sind, habe ich hier nicht auseinanderzusetzen. Nach der reinen Vernunft gehören die ethisch-religiösen Begriffe, wie Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, nicht zu diesen Kategorien. Sie unterliegen mit anderem den Antinomien (Gegensätzlichkeiten) und Paralogismen (Vorspiegelungen, Einbildungen, Erschleichungen) der Vernunft. Darauf kommen wir noch zurück. Daß die Welt tatsächlich ist und sich nicht, wie bei Berkeley, in einen von Gott in uns eingeimpften Schein auflöst, hat Kant oft betont. „Wenn ich sage: im Raum und in der Zeit stellt die Anschauung, sowohl der äußeren Objekte, als auch die Selbstanschauung des Gemüts, beides vor, so wie es unsere Sinne affiziert, das ist, wie es erscheint, so will das nicht sagen, daß diese Gegenstände ein bloßer Schein wären. Denn in der Erscheinung werden jederzeit die Objekte,[S. 363] ja selbst die Beschaffenheiten, die wir ihnen beilegen, als etwas wirklich Gegebenes angesehen, nur daß, sofern diese Beschaffenheit nur von der Anschauungsart des Subjekts in der Relation des gegebenen Gegenstandes zu ihm abhängt, dieser Gegenstand als Erscheinung von ihm selber als Objekt an sich unterschieden wird. So sage ich nicht, die Körper scheinen bloß außer mir zu sein, oder meine Seele scheint nur in meinem Selbstbewußtsein gegeben zu sein, wenn ich behaupte, daß die Qualität des Raumes und der Zeit, welcher, als Bedingung ihres Daseins, gemäß ich beide setze, in meiner Anschauungsart und nicht in diesen Objekten an sich liege. Es wäre meine eigne Schuld, wenn ich aus dem, was ich zur Erscheinung zählen sollte, bloßen Schein machte. Dieses geschieht aber nicht nach unserem Prinzip der Idealität aller unserer sinnlichen Anschauungen“, sondern, wie Kant nun weiter ausführt, gerade nach dem Prinzip der objektiven Realität der Anschauungsformen. Und er wundert sich nicht, daß Berkeley aus Widerspruch gegen diese objektive Realität der Anschauungsformen zur Aufhebung aller Objektivität der Gegenstände gekommen sei, indem er sie für einen Schein erklärte. Er hätte sogar die eigene Existenz für Schein erklären müssen. Kant meint, die letztere Ungereimtheit hätte sich noch niemand zu Schulden kommen lassen; den Indiern war sie keine Ungereimtheit. Für die Wirklichkeit, wenn auch transzendente, von uns nicht zu erfassende, der Welt hat sich Kant oft in gleicher und nachdrücklicher Weise ausgesprochen. Der vierte Paralogismus bezieht sich ja unmittelbar auf Ablehnung der Schein-Welt (s. unten). Es gibt also Dinge-an-sich, Noumena; wie diese uns erscheinen, sind sie Phänomena. Alle unsere Erfahrungen beziehen sich auf letztere, ob es Dinge außer uns sind oder in uns. Aus der Übertragung unserer Kenntnisse und Meinungen von den Phänomena auf die Noumena entstehen jene berühmten vier kosmologischen Antinomien, die sich im Satz, der Thesis, wie in dem Gegen-Satz, der Antithesis, mit gleicher Evidenz beweisen lassen, wie: Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raum; Die Welt hat keinen[S. 364] Anfang in der Zeit und keine Grenzen im Raum. Alles besteht aus einfachen Teilen, und nur das Einfache ist; Nichts besteht aus einfachen Teilen und nirgend existiert Einfaches. Außer Gesetzen ist Freiheit notwendig; Es ist keine Freiheit, nur Gesetze sind. Zu der Welt gehört ein schlechthin notwendiges Wesen, Gott; Es existiert kein zur Welt schlechthin notwendiges Wesen. Im Gebiete des inneren Lebens führt jene Übertragung zu den vier Paralogismen, den Erschleichungen wie: Die Seele ist etwas, das zur Bestimmung keines Dinges gebraucht werden kann, absolute Substanz. Die Seele ist einfach. Die Seele ist persönlich. Das Dasein aller Gegenstände äußerer Sinne ist zweifelhaft (skeptischer oder dogmatischer Idealismus). Die Antinomien beziehen sich der Reihe nach auf: Schöpfung und Ende oder Nicht-Schöpfung und Nichtende der Welt, und Nichtgrenzen oder Grenzen der Welt; Eins oder Mannigfaltigkeit der Welt; Verantwortlichkeit oder Nicht-Verantwortlichkeit des Menschen (oder Gut und Böse und Nicht-Gut und Nicht-Böse) in der Welt; Gott ein Schöpfer und Herr der Welt oder Gott Nicht-Schöpfer und Nicht-Herr. Und die Paralogismen auf: Vorhandensein einer von allen wahrnehmbaren Objekten auszunehmenden Seele; Unsterblichkeit der Seele; Seele als Sonderwesen; Nichtwirklichkeit der Welt. Es sind die Kardinalfragen, um die es sich handelt. Und nur der vierte Paralogismus führt zu einem positiven Ergebnis, daß die Nichtwirklichkeit der Welt nur eine Erschleichung des Verstandes ist. Die Antinomien sind nicht lösbar; die drei ersten Paralogismen ergeben ein Negatives. In der Tat ist auch hier mit der Dialektik nichts auszurichten; die Naturwissenschaft aber bietet einiges zur Lösung dieser Fragen in dem einen oder anderen Sinne, was später zur Sprache kommt.
Gehen wir noch einmal zurück auf die kosmologischen Verhältnisse. Die vier Antinomien betreffen in der Thesis Vollkommenheiten, nämlich: der Dauer und Grenzen, der Zusammensetzung, des Daseins, des Absoluten. Kant spricht so von vier transzendentalen Ideen. Sie sind kosmologisch, solange sie die Vollständigkeit der Bedingungen[S. 365] in der Sinnenwelt betreffen, also in der Welt der Erscheinungen, Phänomene. Sobald wir sie jedoch auf dasjenige beziehen, was außerhalb dieser Sinnenwelt steht, auf die Noumena, so werden sie schlechthin transzendent. Schon die kosmologischen Ideen sind an keiner Erscheinung in concreto vorzustellen, da sie die Vollendung einer empirischen Reihe bedeuten. Die transzendenten aber trennen sich überhaupt von der Erfahrung; sie beruhen allein auf Begriffen a priori. Gleichwohl, meint Kant, drängt uns vieles zunächst die vierte Idee, von Gott, wenigstens auf eine transzendente Wirklichkeit zu beziehen, also eine solche anzunehmen. Sofern etwas durch die Idee allein, in individuo, also als ein Einzelnes, bestimmbar oder gar schon bestimmt ist, nennt Kant es Ideal oder Prototypon. Gewisse Ideen haben nun, wenn auch nicht wie Platons Idee der göttlichen Kraft, schöpferische, aber doch praktische Kraft als regulative Prinzipe, und die ihnen entsprechenden Ideale sind „Urbilder“ für diese Regeln. „Diese Ideale,“ sagt nun Kant (Kritik der reinen Vernunft, S. 453), „ob man ihnen gleich nicht objektive Realität (Existenz) zugestehen möchte, sind doch um deswillen nicht für Hirngespinste anzusehen, sondern geben ein unentbehrliches Richtmaß der Vernunft ab, die des Begriffes von dem, was in seiner Art ganz vollständig ist, bedarf, um darnach den Grad und die Mängel des Unvollständigen zu schätzen und abzumessen.“ Und er warnt ausdrücklich, sie etwa mit den Geschöpfen der Einbildungskraft zu verwechseln, „welche mehr eine im Mittel verschiedener Erfahrungen gleichsam schwebende Zeichnung, als ein bestimmtes Bild ausmachen“, Monogramme, wie er sagt. Ein solches transzendentales Ideal ist nun das Ding-an-sich als Allbesitz der Realität, das ens realissimum, indem es der durchgängigen Bestimmung, die notwendig bei allem was existiert angetroffen wird, zugrunde liegt. Dieses Ideal „ist aber auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig; weil nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt, und als die Vorstellung von[S. 366] einem Individuum erkannt wird.“ So ist dieses Ideal das Prototyp aller Dinge, welche insgesamt als Nachbilder (Ektypa) den Stoff zu ihrer Möglichkeit von ihm nehmen, und indem sie demselben mehr oder weniger nahekommen, dennoch unendlich weit daran fehlen, es zu erreichen. Es ist in der Vernunft die „Möglichkeit aller Dinge“, und so das „Urwesen (ens originarium)“, „höchste Wesen (ens summum)“, „Wesen aller Wesen (ens entium)“. „Der Begriff eines solchen Wesens ist der von Gott in transzendentalem Verstande gedacht.“ Indessen doch wieder alles nur in der Vernunft; die objektive Existenz eines „Wesens von so ausnehmendem Vorzuge“ ist uns völlig ungewiß. Und nun bringt Kant, wiewohl er also in der Vernunft die Notwendigkeit eines solchen Ideals, das aber im Grunde nichts anderes ist als die einzige Idee aller Realität, zugesteht, seine berühmten Gründe gegen alle vermeintlichen „Beweise“ einer Existenz Gottes. Und dabei bleibt es der reinen Vernunft gegenüber. Daß wir „diese Idee vom Inbegriffe aller Realität hypostasieren, kommt daher, weil wir die distributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs des Verstandes in die kollektive Einheit eines Erfahrungsganzen dialektisch verwandeln, und an diesem Ganzen der Erscheinung uns ein einzelnes Ding denken, was alle empirische Realität in sich enthält, welches dann vermittelst der... transzendentalen Subreption, mit dem Begriffe eines Dinges verwechselt wird, was an der Spitze der Möglichkeit aller Dinge steht, zu deren durchgängiger Bestimmung es die realen Bedingungen hergibt“. Die Reihe ist: Realisierung, Hypostasierung, Personifizierung. „Die Vernunft wird durch einen Hang ihrer Natur getrieben, über den Erfahrungsgebrauch hinauszugehen, sich in einem reinen Gebrauche und vermittelst bloßer Ideen zu den äußersten Grenzen aller Erkenntnis hinaus zu wagen, und nur allererst in der Vollendung ihres Kreises, in einem für sich bestehenden systematischen Ganzen Ruhe zu finden.“ Damit ist aber eben keine objektive Existenz gegeben, das heißt, nicht bewiesen. Manche, namentlich Materialisten, haben nun gemeint, Kant hätte Gott, Seele usf. überhaupt abgelehnt, er hätte bewiesen, daß sie vor der reinen Vernunft[S. 367] nicht existieren. Das ist völliges Mißverständnis. Er hat nur erklärt, daß die Existenz dieser Dinge sich aus der reinen Vernunft nicht beweisen lasse. Daß diese Dinge auch als Dinge-an-sich überhaupt nicht vorhanden sind, hat er nirgend gesagt; es würde auch seinem transzendentalen Standpunkt, den er so oft betont, widersprechen. Denn dieses alles gehört ja zur transzendenten Wirklichkeit. Wenn er daher in der „Kritik der praktischen Vernunft“ davon Gebrauch macht, und von jenen Dingen als von praktisch-regulativen Prinzipien handelt, so ist er ganz innerhalb seines Systems geblieben und keineswegs von ihm abgewichen. Charakteristisch dafür ist, wie er vom freien Willen spricht. Wenn wir alle menschlichen Handlungen bis auf den Grund verfolgen könnten, würden wir eine stetige Kette von Ursache und Wirkung finden, und jede Handlung aus ihren Bedingungen als notwendig sogar voraussagen können. Also „in Ansehung unseres empirischen Charakters gibt es keine Freiheit“. Allein wir haben auch den transzendenten „intelligiblen Charakter“; und da hier von einer Naturkausalität keine Rede ist, so können dieselben Handlungen ihrer Ursache nach vollkommen frei sein. Wir können nur nicht beweisen, daß, so aufgefaßt, sie es sind, weil das Transzendente außerhalb aller Erfahrung liegt. Aber beweisen, daß sie es, transzendent aufgefaßt, nicht sind, können wir aus gleichem Grunde auch nicht. Und das gilt von allen Hoch-Ideen und Hoch-Idealen, und hat auch Bezug auf Kants „Kategorischen Imperativ“, Schillers „Du kannst, denn du sollst“. Daß sein System ein Dualismus ist, hat übrigens der große Philosoph selbst anerkannt; es ist ein solcher in der Unterscheidung der transzendenten Welt von der empirischen, in der Annahme beider Welten, praktisch auch in der Annahme von Gott und Welt oder von Geist und Welt usf.
Auch die dritte große Kritik, die „Kritik der Urteilskraft“, enthält ein kosmologisches Regulativ: die Teleologie, den Begriff der Zweckmäßigkeit. Es bezieht sich auf die Ordnung der Dinge — z. B. in Familien, Rassen, Arten, Gattungen usf. — und den Übergang der Abteilungen ineinander,[S. 368] die Ordnung der Geschehnisse — z. B. staatliche, individuelle, elektrische usf. —, endlich die Ordnung der Ursachen. Der Begriff bezweckt hiernach wesentlich Vereinfachung der Naturübersicht durch Zusammenziehung und Zusammenhang, Auffassung der Weltordnung vom Standpunkte einer Einheitlichkeit und eines Zweckes. Vom Verstand selbst wird ein solcher Begriff nicht gefordert, wohl aber von der Urteilskraft; und sofern er eine Bedingung a priori feststellt, unter der allein Dinge Objekte unserer Erkenntnis werden können, bedeutet er ein transzendentales Prinzip. Er ist aber ein subjektives Prinzip der Urteilskraft; denn nicht der Natur als solcher wird der Begriff der Zweckmäßigkeit unterlegt und vorgeschrieben, sondern die Urteilskraft ordnet sich selbst ein Gesetz für die Reflexion über die Natur vor. „Es ist nicht ein Prinzip der bestimmenden, sondern bloß der reflektierenden Urteilskraft. Man will nur, daß man — die Natur mag ihren allgemeinen Gesetzen nach eingerichtet sein wie sie wolle — durchaus nach jenem Prinzip und den sich darauf gründenden Maximen ihren empirischen Gesetzen nachspüren müsse, weil wir nur so weit als jenes (Prinzip) stattfindet, mit dem Gebrauche unseres Verstandes fortkommen und Erkenntnis erwerben können.“ Man sieht, wie außerordentlich vorsichtig Kant dieses Prinzip der Teleologie einführt. Keineswegs gibt er es als ein Prinzip der Natur selbst aus. Nicht einmal den Kategorien zählt er es zu. Die Zweckmäßigkeit ist kein konstitutives Prinzip der Ableitung der Produkte der Natur, keine neue Kausalität, als welche sie der reinen Vernunft angehören und zur Anschauung dienen würde, sondern lediglich ein regulatives Prinzip, nur für die reflektierende Beurteilung. Unter dem Begriff der Kausalität müssen wir die Natur betrachten, unter dem der Zweckmäßigkeit beurteilen wir sie nur. Soweit das Urteil auf Empfindungen (Lust, Unlust, Schön, Unschön usf.) zurückgeht, ist die Zweckmäßigkeit subjektiv (oder formal) und Gegenstand der ästhetischen Urteilskraft. Begründet es sich aber auf Verstand und Vernunft, indem es sich um bestimmte Bedingungen handelt, „unter denen etwas, (z. B.[S. 369] ein organisierter Körper) nach der Idee eines Zweckes der Natur zu beurteilen sei“, so wird die Zweckmäßigkeit objektiv (auch real) genannt. Wir wissen, daß die Menschheit sich von je mit beiden Arten von Zweckmäßigkeit beschäftigt hat: die Welt und das Leben einerseits einer harmonischen Schönheit, andererseits einer zielstrebigen Entwicklung und Ordnung zuzuführen. In anderer Form wird das Prinzip auch in drei Prinzipe zerlegt: Gesetzmäßigkeit, engere Zweckmäßigkeit, Zweck, und wird die Anwendung dem Verstand, der Urteilskraft, der Vernunft zugewiesen. Alle fließen aus dem allgemeinen transzendentalen Prinzip. Die weiteren, ungemein scharfen und schönen Distinktionen muß ich übergehen.
Nur einen Begriff möchte ich hervorheben, den der organisierten Wesen, diese sind „Dinge als Naturzwecke“. Ein solches Ding muß „sich zu sich selbst wechselseitig als Ursache und Wirkung verhalten“. Ein Ding ist aber Naturzweck, wenn seine Teile „nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich sind“, so daß ein jeder Teil, „sowie er nur durch alle übrigen da ist, auch als um der anderen und des Ganzen willen“, als ein „hervorbringendes Organ“ besteht. Diese Definition schließt alle Kunstprodukte aus. Wir können uns eine Maschine vorstellen, samt Kessel, Heizung und Regulatoren, die sich selbst in Gang erhält, indem sie selbst Wasser in den Kessel nachpumpt, Kohlen in die Heizung nachschüttet und auch ihren Gang selbst reguliert; ein vollständiger Automat. Sie wirkt und verursacht (indirekt) ihre Wirkung. Ja, wir können uns sogar die Maschine so eingerichtet denken, daß sie auch physikalisch und chemisch Teile ersetzt, entfernt und ansetzt. Ist sie nach der obigen Definition ein organisiertes Wesen? Keineswegs! Sie gleicht einem solchen, zum Beispiel dem Menschen, in äußeren Tätigkeiten, etwa Gehen, Drehen usf., sodann in der Stoffaufnahme und -abgabe, in der Regulierung der äußeren Tätigkeiten, obzwar hier schon nur noch, soweit Kraft erforderlich oder überflüssig ist und durch die Stoffaufnahme oder -abgabe geregelt wird. Zuletzt auch etwa in Dingen wie Ankleidung, Entkleidung, Ersatz von[S. 370] Teilen durch künstliche Teile. Aber die Hauptsache fehlt: das Hervorbringen jedes Teiles aus sich selbst, die Schaffung der Form, ihr Wachstum und ihre Erhaltung an jeder Stelle aus sich selbst. Indem Kant gerade dieses fordert, erhebt er den organisierten Körper, der eine Maschine ja auch ist, zum organisierten Wesen, zum belebten Wesen, das keine Maschine sein kann. Viel unnötiger Streit würde vermieden sein, wenn die modernen Automatenanhänger unter Materialisten und Philosophen die lichtvollen Darlegungen unseres Kant sich recht zu Gemüte führen wollten. Automat ist nicht einmal das geringfügigste Lebewesen, geschweige der Mensch. Cartesius hatte durchaus Unrecht, die Pflanzen und Tiere dafür zu erklären, und moderne Mechanisten und Sensualisten irren bei weitem mehr, auch den Menschen hinzuzuziehen. Driesch in seinem belehrenden Buche „Philosophie des Organischen“, ist viel zu gelinde verfahren, als er erklärte, daß, wenn ein Lebewesen eine Maschine sein sollte, jeder, auch der kleinste ihrer Teile die gleiche Maschine sein müßte, und daß, in Verbindung mit dem Zusammenhang dieser Teile miteinander, eine solche aus unendlich vielen gleichen Maschinen zusammengesetzte, ihnen gleiche Maschine nicht denkbar sei. Die Wirksamkeit der organisierten Wesen von Innen heraus und auf sich selbst, auf ihre eigene Form, ihr eigenes Sein, ihr eigenes Leben — das ist das Entscheidende; das leisten auch die kleinen Maschinen, die man etwa für jede Zelle setzen wollte, oder gar, wie bei den einzelligen Wesen, für jeden Teil einer Zelle, nicht, und — was die Hauptsache ist — eine Maschine, die das leisten müßte — etwa eine Lokomotive, deren Räder, Kolben, Kessel, Regulatoren usf. ganz und in jedem Teil gleichfalls Lokomotiven sind —, ist auch nicht vorstellbar für uns. Denn, wie wiederum Kant hervorgehoben hat, da unser Denken ein diskursives, kein intuitives ist, vermögen wir am Fertigen den Aufbau nicht nach Gesetzen abzuleiten. Da tritt eben der Zweck ein, und wir haben für die Urteilskraft im Fertigen einen Naturzweck, als organisiertes Wesen, wenn es den obigen Bestimmungen Kants entspricht, ein nicht organisiertes, wenn Entstehung, Wachstum,[S. 371] Erhaltung von außen positiv oder negativ erfolgt, wie bei einem Kristall oder bei den Pseudozellen. Es ist immer auf das fertige, stabile Lebewesen Bedacht genommen, nicht auf das entstehende und sich entwickelnde und sich erhaltende. Im Fertigen mag manches maschinenmäßig aussehen, Entwicklung und Erhaltung aber schließen die Maschine gänzlich aus.
Diese Betrachtung, die ich an Kants Erklärungen anlehne, ist von ungemeiner Wichtigkeit für die grundsätzliche Unterscheidung zwischen der lebenden und der unbelebten Welt, mag auch die erstere durchaus wie die letztere von äußeren Umständen abhängen, selbst wenn dieses nach Darwinschen Prinzipien geschieht, in ihrer allerübertriebensten Form. „Aber innere Naturvollkommenheit,“ sagt Kant (Kritik der Urteilskraft, Ausgabe von Kirchmann, S. 249), „wie sie diejenigen Dinge besitzen, welche nur als Naturzwecke möglich sind und darum organisierte Wesen heißen, ist nach keiner Analogie irgendeines uns bekannten physischen, das ist Naturvermögens, ja, da wir selbst zur Natur im weitesten Verstande gehören, selbst nicht einmal durch eine genau angemessene Analogie mit menschlicher Kunst, denkbar und erklärlich.“ Und das gilt, trotz aller Phrasen von mechanistischer und anderer Seite und aller Hinweisungen auf Maschinen allerwunderbarster Art und Vollkommenheit und auf Kristalle und künstliche Zellen. Das Von-innen-heraus, das Aus-sichselbst-heraus (wenn auch unter Benutzung aufgenommener Stoffe) fehlt immer und kann nach unseren Begriffen nicht vorhanden sein, wenn nicht ein Neues zu dem Physischen hinzukommt, eben das Psychische, das den Naturzweck von innen heraus vollbringt. Driesch unterscheidet eine dreifache Harmonie in der Entwicklung der Wesen: Harmonie der Konstellation — die Teile entwickeln sich zu einem individuellen Ganzen, selbst wenn sie sich unabhängig voneinander entwickeln, wie bei dem Menschen Muskeln und Nerven; Harmonie der Kausalität — die bildenden (formativen) Ursachen treffen genau die sich entwickelnden Teile nach der Richtung der Endform, obwohl diese Teile sich[S. 372] jedes nach ganz verschiedenen Richtungen entwickeln können; Harmonie der Funktion — alle Funktionen greifen ineinander zu einer einheitlichen Wirkung ein. Diese drei Harmonien sind Kants Naturzweck. Ihr Erfolg sieht physisch aus, ihren Gang aber in der Entwicklung und Erhaltung wird man unter keinen Umständen als physisch im gewöhnlichen Sinne des Wortes erklären können. Selbst eine Maschine ist ein Automat nur als fertiger Gegenstand; gebaut aber hat sie sich nicht selbst, der Mensch hat sie hergestellt und muß sie auch erhalten. Wenn man das Psychische auch zum Physischen rechnen will, so mag das geschehen. Zur Welt gehört es ja. Das berührt aber die Sonderstellung des Psychischen nicht, daß es eben von Innen heraus schafft, nach Innen und nach Außen schafft, da alles andere nur von Außen nach der Oberfläche heranzieht, von der Oberfläche nach Außen abgibt. Höchstens spontane physikalische und chemische Umsetzungen könnten als ein Ähnliches erwähnt werden. Aber abgesehen davon, daß auch hier die Ähnlichkeit nur eine höchst oberflächliche ist, wie sich jeder selbst zurechtlegen kann, werden wir später sehen, wie grundverschieden der Lebensvorgang ist von den bezeichneten Umsetzungen, ja wie er ihm zum Teil geradezu entgegenläuft. Und dieses erhellt auch schon daraus, daß jene Umsetzungen eben Umsetzungen sind, die Organisierung aber das Gegenteil bezweckt und erreicht: fortdauernde Schaffung des Gleichen und Erhaltung des Gleichen, wenn auch durch physikalisch-chemische Assimilation und Dissimilation. Wir sprechen von dieser Angelegenheit später noch mehr.
Naturzweck darf nicht verwechselt werden mit Zweckmäßigkeit; es kann etwas sehr Unzweckmäßiges gleichfalls Naturzweck sein, wie das ohne Hilfe gänzlich hilflose Kind der ersten Zeit. Das liegt daran, daß der Zweck tatsächlich noch nicht erreicht ist, oder nur so weit erreicht ist, als es dieses Ding selbst betrifft, noch nicht aber so weit, als sein Verhältnis zur äußeren Welt erfordert. Auch hier drückt sich Kant, wenn auch bestimmt, doch sehr vorsichtig aus. Das Beispiel der organisierten Natur führt dazu, daß die an sich[S. 373] subjektive Maxime des Naturzwecks ausgedehnt und gesagt wird: „Alles in der Welt ist irgend wozu gut, nichts ist in ihr umsonst; und man ist durch das Beispiel, das die Natur an ihren organischen Produkten gibt, berechtigt, ja berufen, von ihr und ihren Gesetzen nichts als was nur zweckmäßig ist zu erwarten.“ Und er meint, insgesamt aufgefaßt; denn er führt als Beispiele an, auch was für Einzelnes unzweckmäßig ist, wie Gifte, Ungeziefer usf. Also in toto sei man berufen, Zweckmäßigkeit zu erwarten. Was Kant zu seiner Zeit vermißte, nämlich die Einbeziehung der Zweckmäßigkeit in die Naturwissenschaft, das konnte in unserer Zeit zum Teil nachgeholt werden. Er selbst hat ja schon allein durch sein unübertroffenes und in seiner Vollständigkeit (soweit selbst gegenwärtig nur möglich) und allumfassenden Tiefe noch heute einzig stehendes Werk über den Weltbau gewaltig vorgearbeitet. Und er hat auch der modernen Entwicklungs-Naturwissenschaft vorgearbeitet, daß er sogar als Vorläufer Darwins bezeichnet und in Anspruch genommen werden konnte. Wir verlassen diesen Größten, dessen System als Kritisches zu jedem System gehört und gehören muß. Was Eugen Dühring von ihm sagt, ist eine schwere Unbegreiflichkeit dieses doch geistig selbst so bedeutenden Mannes.
44. Ich, Nicht-Ich; Thesis, Antithesis, Synthesis; Naturphilosophie.
Unter dieser Überschrift besprechen wir Anschauungen unmittelbarer Nach-Kantianer. Wir können aber sehr kurz sein, denn es handelt sich nicht um eine fruchtbare Fortbildung der Lehre des Meisters, sondern eigentlich um eine Verschleppung in das Gestrüpp der Dialektik. Fichte (1762–1814), in seiner ersten Philosophie, stellt sich idealistischer als Kant. Er geht allein vom Ich aus, als erstem Grundsatz; diesem muß ein Nicht-Ich als zweiter Grundsatz entsprechen, und als dritter Grundsatz steht die Reaktion des Ich gegen das Nicht-Ich. Nun haben wir eine unbedingte Wahrheit: Ich ist Ich, oder Ich bin. Das gibt die Identität oder Realität;[S. 374] die Thesis der Identität (Realität). Diese enthüllt alle innere Tätigkeit. Das Ich setzt sich selbst, allein durch sich selbst. Die zweite Wahrheit lautet: Nicht-Ich ist nicht Ich, also führt sie zur Verneinung (Negation). Diese Wahrheit ist nicht mehr, wie die erste, unbedingt, da außer dem Nicht-Ich ein Ich gesetzt ist, das vorhanden sein muß; sie ist aber unbedingt der Form nach, und dem Inhalt nach, sobald eben das Ich gesetzt ist. Die dritte Wahrheit gibt die Umgrenzung (Limitation), indem die Gegensätzlichkeit, die zwischen den beiden ersten Wahrheiten besteht — es wird sogar Widerspruch gesagt; ich sehe aber nicht einmal eine Gegensätzlichkeit, die Wahrheiten sind doch lediglich koordiniert und stehen in gar keiner Verbindung zueinander —, aufgehoben wird, sie lautet: Ich zum Teil Nicht-Ich, wenn Nicht-Ich zum Teil Ich. Es ist die reine symbolische Mathematik. Wert gewinnt sie nur durch die empirischen Bestimmungen, und so wird sie auch aus dem empirischen Bewußtsein entnommen und versachlicht. Das Nicht-Ich ist entweder ein eigenes Tätiges und kausal der Grund des „Leidens“ des Ich. Oder es ist an sich nicht vorhanden, aber das Ich wechselt in seiner Tätigkeit, ist begrenzt, und faßt diese Begrenztheit als Leiden durch ein Nicht-Ich auf. Der letztere Fall gibt den dogmatischen Idealismus, der erstere soll dogmatischer Realismus sein; ich vermag aber nicht einzusehen, warum er nicht den transzendentalen Idealismus soll konstruieren können. Das Gefühl der Begrenztheit (S. 338) ist wie eine Reflexion der Ich-Tätigkeit nach dem Ich zurück. Und dadurch kommt die Anschauung, als wenn außer dem Ich noch etwas wäre, gegen das das Ich nicht ausgedehnt werden kann. Indem nun Fichte sich für diese Auffassung des Idealismus entschließt, verlegt er Kants Ding-an-sich zwar in das Ich selbst, bringt aber dafür das Unbegreifliche der Begrenztheit des Ich als ein Neues, wodurch für die Vereinfachung der Anschauung nichts gewonnen ist. Außerdem fragt man vergeblich, wie ein allein bestehendes Ich je von einer solchen Begrenztheit soll Bewußtsein haben können. Wenn es allein besteht, ist es ja absolut vollkommen. Wahr[S. 375]scheinlich ist Fichte deshalb zuletzt ganz zum Berkeleyschen deistischen Idealismus gedrängt worden, seiner späteren Philosophie, von der schon gesprochen ist (S. 358). In seiner ersten Philosophie aber geht er in mancher Hinsicht noch radikaler vor als Kant; er sieht sogar von Gott ganz ab. „Die moralische Weltordnung ist das Göttliche, das wir annehmen.“
Von den vielen Anschauungen Schellings (1775–1854) schließt sich die erste, ganz an Fichtes Entwicklungen an. Später gestand er im Sinne Kants dem Ding-an-sich eine objektive Existenz zu, und ging sogar so weit, die Identität dieses Dinges mit der Vorstellung in uns zu behaupten. Richtete er nun die Vorstellung nach dem Ding, so kam er zum gewöhnlichen dogmatischen Realismus. Tat er das Umgekehrte, indem er das Ding der Vorstellung anpaßte, so folgte der Kantische Idealismus; verhielt er sich aber zwischen beiden indifferent, so geriet er auf Spinozas Anschauung. Er hat das letztere getan, und so in der Identitätsphilosophie auch Spinozas Anschauung, die wir noch kennen lernen werden, vertreten. Wir haben gesehen, daß Schelling in der weiteren Entwicklung sich auch dem Mystizismus und Jakob Böhmes Theosophie angeschlossen hat. Zuletzt ist er auch positiver Philosoph geworden. Aus allem darf man ihm keinen Vorwurf machen; es hat ihn eben keine Anschauung befriedigt, und selbst eine sich zu schaffen, reichte seine Begabung, die wesentlich nach dem Methodischen ging, nicht hin. Mehr kann man ihm, wie auch dem bald zu nennenden Hegel und auch Herbart, das etwas wüste Wirtschaften mit den naturwissenschaftlichen Kenntnissen und die willkürlichen Analogisierungen des Geistigen mit dem Physischen verdenken, wodurch bekanntlich diese ganze Philosophie und namentlich ihr bedeutendster Teil, die Naturphilosophie, aufs höchste in Verruf gekommen ist, so daß gerade die Naturforscher sich von ihr voll Widerwillen abwandten, und daß, fast bis in unsere Zeit, Naturphilosophie verpönt war. Wertvoll noch jetzt ist, gleichfalls nach Fichte, Schellings Unterscheidung zwischen dieser Naturphilosophie und der Transzendentalphilosophie. In jener ist die Natur zum Ersten gemacht, und es wird gefragt, wie sie[S. 376] in das Intelligente des Subjekts dringt; in dieser ist die Intelligenz des Subjekts das Primäre, und es ist zu entscheiden, wie aus ihr die Natur entsteht. Die Antwort für die erste Frage ist in Kants Prinzip der Urteilskraft enthalten (S. 367), die für die zweite in dessen transzendentem Idealismus. Schelling geht empirischer vor; er erhebt einen Erfahrungssatz, dessen innere Notwendigkeit erkannt ist, zu einem apriorischen Satz: „Empirismus, zur Unbedingtheit erweitert, ist Naturphilosophie“. Es wird nicht viele geben, die mit dieser Definition einverstanden sind. Oder es muß eine theoretische Naturphilosophie unterschieden werden von einer praktischen; jene ist wieder Transzendentalphilosophie, da überhaupt alles Unbedingte transzendent ist. Schelling freilich behauptet, daß man in der Natur auch das Absolute erkennen kann. Ich wüßte nicht, wie das empirisch geschehen soll. Selbst wir, die wir die Einheitlichkeit der Vorgänge und der Stoffe in der Natur so bis ins Einzelne verfolgt haben, können keine absolute Einheit in der Natur feststellen; nicht einmal für alles, das Psychische eingeschlossen, auch nur wahrscheinlich machen. Man denke, wie jetzt sogar das Trägheitsgesetz wankt, wie die allgemeine Gravitation zweifelhaft wird, selbst das Substanz- und Energiegesetz nicht mehr sichere Wahrheit ist. Wissen von der Natur kann eben nie zur Unbedingtheit gelangen; nicht etwa allein, weil die Erfahrungen immer unvollständig sind, sondern einfach, weil die Welt sich stetig wandelt und uns immer nur das Jetzt zur Verfügung steht, nicht das Vor noch das Nach. Eine Naturphilosophie kann also nur transzendent oder empirisch sein. Im ersteren Falle gehört sie mit der Transzendentalphilosophie überhaupt zusammen, im zweiten ist sie eine gewöhnliche empirische Wissenschaft. In unseren „Naturphilosophien“ vereinigen wir beide Arten, aber nur um möglichst vollständig zu sein, und wegen der Zweckmäßigkeitsmaxime der Urteilskraft, die jedoch, wie wir wissen, nichts bedingt, sondern nur leitet.
Hegels (1770–1831) Entwicklung der verschiedenen Stufen des Geistes ist sehr lehrreich, hat aber auch bei ihm mehr[S. 377] methodischen Wert, wie überhaupt sein ganzes philosophisches System im Grunde Methodik ist. Die reale und ideale Welt sind auch hier gesetzt. Ihr Wirken für sich und ihr Verhalten zueinander wird aber aus der logischen Idee, die der Welt zugrunde liegt, und der Entwicklung nach dieser Idee erklärt. Diese logische Idee ist nicht der Nus des Anaxagoras, noch der sonst bekannte Logos. Er wirkt in besonderer Weise, nämlich zufolge den drei Grundsätzen Fichtes, vielleicht richtiger nach denen Jakob Böhmes. Wir sahen, wie bei diesem Manne Gott sich mit sich selbst entzweite, und wie dann das Entzweite sich in der Entwicklung zur Identität wieder erheben sollte. Hegel meint ganz entsprechend, jeder Begriff entzweie sich mit sich selbst und schlage so in sein Gegenteil um, um dann in einer höheren Einheit sich mit ihm auszugleichen. Der gesetzte Begriff ist die Thesis, der durch Umschlagen erzeugte die Antithesis, die Ausgleichung in der höheren Einheit die Synthesis. So geht das Universum in stetiger Entwicklung von Thesis zur Antithesis, Synthesis, von dieser zu neuer Antithesis, Synthesis usf. Solche Kreisvorgänge sind dem Naturforscher wohl vertraut. So meinte es aber Hegel nicht. Seine Ansicht ist rein transzendent: die Idee schlägt um in Natur, ganz oder, soweit in der Natur Nichtnaturgesetzliches vorhanden ist, etwa Zufälliges, zum Teil, wobei dieses Zufällige Idee ist. Beide, Idee und Natur, vereinigen sich in der höheren Einheit Geist, der von der Natur abhängig, zur Natur im Gegensatz und die Natur erkennend ist. Der Geist bedeutet hiernach die aus ihrer Entäußerung in sich zurückgekehrte Idee. Wie, infolge der Abhängigkeit von der Idee, das Wesen der Natur Notwendigkeit und Zufälligkeit ist, so das des Geistes Freiheit, Unabhängigkeit von allem Äußeren. Er entwickelt sich aber in drei Stufen als: subjektiver Geist, hinsichtlich seines Verhaltens zur Natur (neutral, leidend, gegensätzlich); objektiver Geist, der das Allgemeine in den Äußerungen menschlichen Zusammenseins betrifft (Moral, Sittlichkeit, Recht, Verhalten zu Staat, Gesellschaft und Familie usf.), absoluter Geist, der als Anschauung auf Kunst und Wissenschaft, als Vorstellung auf[S. 378] Religion, als Vernunft auf Begriffsbildung (Philosophie) sich bezieht. So gut diese Distinktionen sind, so lehren sie doch für das Wesentliche nichts. Mit Sätzen wie: Die Natur ist die „Idee in der Form des Anderssein“ ist nichts anzufangen. Woher stammt die Idee? Wie ist sie aufzufassen? Als transzendentaler Grund alles Seins und Denkens, etwa wie die „Vernunft Gottes“? Wie ist ihr Umschlagen in Natur zu verstehen? Hat man dabei die gnostisch-theosophischen Vorstellungen anzuwenden oder ist das Ganze einfach ein Gesetztes? Mehr bedeutet es, wenn Religion als Denken des Absoluten, als „Inseinswissen mit Gott“ bezeichnet wird, so daß ein Wissen von Gott erfolgt. Wenn dann noch näher bestimmt wird, Religion sei „Wissen des göttlichen Geistes von sich durch Vermittlung des endlichen Geistes“, so muß der göttliche Geist in uns stecken; und wäre nicht die „Idee“, die so unvermittelt steht, so hätte man einen üblichen Pandeismus. Ich habe schon hervorgehoben, daß im Hegelschen System die Methodik die Hauptsache ist, und in dieser hat Hegel höchst Bedeutendes geleistet. Auch seine naturwissenschaftlichen Systematisierungen sind nicht von der Hand zu weisen. Das gehört aber alles nicht hierher.
Den edlen Schleiermacher (1768–1834) erwähne ich sogleich hier. Denn er spricht gleichfalls von etwas wie These und Antithese, jedoch empirischer, indem er meint, daß, da unser Denken an Wahrnehmungen gebunden ist, es sich immer in Gegensätzen bewegt und das Gegensatzlose, also die letzte Synthese in Hegels Sinn, nie erreicht. Einen transzendentalen Grund alles Seins und Denkens erkennt er mit Kant an, doch weiter mehr in der Bedeutung von Spinozas System, das er sehr hochstellt. Seine Individualitätslehre ist aber wie ein Ausschnitt aus Leibniz’ Monadologie. Jedes Individuum, jeder Mensch bedeutet ein Wesen für sich, eine „eigentümliche und ursprüngliche Darstellung der Welt“. Deshalb ist der Mensch aber auch ein „Kompendium“ seiner ganzen Gattung, der Menschheit, so daß er in dieser Menschheit „sein eigenes vervielfältigtes, deutlicher ausgezeichnetes und in allen seinen Veränderungen gleichsam verewigtes Ich anschaut“.[S. 379] „Der Geist ist das Erste und Einzige, die ganze Welt nur sein selbstgeschaffener Spiegel (S. 370), nur der große gemeinschaftliche Leib der Menschheit.“ Es ist schwer zu verstehen, was das besagen soll, vielleicht ist es spinozistisch zu deuten.
45. Die Welt als Wille und Vorstellung; Pessimismus, Philosophie des Unbewußten, moderner Idealismus.
Arthur Schopenhauer, dieser ganz außerordentliche Mann (1788 in Danzig geboren, 1860 zu Frankfurt a. M. gestorben), ist eigentlich der einzige, der Kants System erfolgreich bereichert hat. Die Welt ist wie bei Kant ein transzendentes Objekt. Wir haben von ihr nur unsere Vorstellungen. Diesen Standpunkt glaubt Schopenhauer energischer zu vertreten als Kant. Die Vorwürfe, die er diesem macht, er hätte in der zweiten Ausgabe seiner Kritik der reinen Vernunft seinen transzendental-idealistischen Standpunkt verlassen, sind jedoch ungerechtfertigt. Auch in der zweiten Auflage des Grundwerkes ist das Ding-an-sich kein Objekt, das je an Anschauung und Kategorien gebunden ist, sondern das Transzendentale hinter den Vorstellungen, und das Wirkliche. Schopenhauer reduziert alle Kategorien auf Kausalität, Ursächlichkeit; es ist in der Tat die Grundkategorie (S. 361). Ursächlichkeit mit Raum und Zeit sind so die Bedingungen a priori aller Vorstellungen. Und die Welt ist zunächst Vorstellung unter diesen Bedingungen. „Die Welt ist meine Vorstellung“, leitet sich das Hauptwerk Schopenhauers: „Die Welt als Wille und Vorstellung“ ein. Indessen damit kann der Gegenstand nicht erschöpft sein. Der Philosoph geht als Naturforscher, der er zugleich ist, auf den Teil der Welt zurück, der unser Leib ist. Und da findet er denn, daß diesem gegenüber, außer der Vorstellung, doch noch etwas anderes vorhanden ist, wodurch er in toto genere verschiedener Art aufgefaßt wird. In meinem Buche „Philosophische Grundlagen usf.“ habe ich für diese Auffassung die Bezeichnung „Körperbewußtsein“ gewählt. Nach Schopenhauer ist es Wille. Der Körper ist durchaus dem unterworfen, was[S. 380] wir in uns als Wille kennen, namentlich: er bewegt sich, und Teile von ihm bewegen sich. Aber dieses ist nicht so zu verstehen, daß der Wille als Ursache die Bewegung des Körpers zur Folge hat, keineswegs, sondern beide sind absolut miteinander verbunden; Bewegung und Wille sind ein Akt. „Der Willensakt und die Aktion des Körpers sind nicht zwei objektiv erkannte verschiedene Zustände, die das Band der Kausalität verknüpft, stehen nicht im Verhältnis der Ursache und Wirkung; sondern sie sind eins und dasselbe, nur auf zwei gänzlich verschiedene Weisen gegeben: einmal ganz unmittelbar und einmal in der Anschauung für den Verstand. Die Aktion des Leibes ist nichts weiter als der objektivierte, das heißt in die Anschauung getretene Akt des Willens.“ Ja, der ganze Leib ist nichts anderes als der objektivierte, das heißt zur Vorstellung (= Anschauung) gewordene Wille. Und so erklärt Schopenhauer den Leib als die „Objektität des Willens“. Der Leib ist also ein Doppeltes: eine bloße Vorstellung in Raum, Zeit und nach Kausalität, und eine Objektität des Willens. In diese Objektität des Willens zieht Schopenhauer auch anderes hinein, denn er rechnet zu der Objektivation des Willens auch Gefühle wie Lust und Unlust, Schmerz, Behagen usf. „Man hat aber gänzlich Unrecht, wenn man Schmerz und Wollust Vorstellungen nennt: das sind sie keineswegs, sondern unmittelbare Affektionen des Willens in seiner Erscheinung, dem Leibe: ein erzwungenes augenblickliches Wollen oder Nichtwollen des Eindruckes, den dieser erleidet“. Vorher meint er: es ist „andererseits jede Einwirkung auf den Leib, unmittelbar auch Einwirkung auf den Willen: sie heißt als solche Schmerz, wenn sie dem Willen zuwider; Wohlbehagen, Wollust, wenn sie dem Willen gemäß ist“. Ich gestehe, daß ich nicht recht folgen kann; mir scheint das Nichtwollen und Wollen des Eindruckes, das zweifellos vorhanden ist, doch sehr verschieden zu sein von der Empfindung selbst, mehr eine Begleiterscheinung als der Gegenstand selbst. Doch mag das sein, da Schopenhauer offenbar Wille in einer sehr weiten Bedeutung faßt, neben Verstand, der die Vorstellungen ist,[S. 381] als ein Zweites im Ich. Ob die Objektität zwischen Leib und Willen nicht auch als eine gegenseitige angesehen wird: Leib Objektität des Willens, Wille Objektität des Leibes, weiß ich nicht. Es dürfte aber wohl anzunehmen sein. Denn es heißt weiter: „Ich erkenne meinen Willen nicht im Ganzen, nicht als Einheit, nicht vollkommen seinem Wesen nach, sondern ich erkenne ihn allein in seinen einzelnen Akten, also in der Zeit, welche die Form der Erscheinung meines Leibes, wie jedes Objektes, ist: daher ist der Leib Bedingung der Erkenntnis meines Willens. Diesen Willen ohne meinen Leib kann ich demnach eigentlich nicht vorstellen.“ Und so wären Leib und Wille allerdings eines des anderen Objektität, oder doch Bedingung. Diese Erkenntnis kann nur nachgewiesen, „zum Wissen der Vernunft erhoben, oder in die Erkenntnis in abstracto übertragen werden“. Sie kann aber ihrer Natur nach nicht bewiesen werden, da sie selbst „die unmittelbarste ist“. Und sie ist um so bedeutender als sie zwei ganz inkommensurable Dinge betrifft: den Leib, der „eine anschauliche Vorstellung“ ist, und den Willen, der „gar nicht Vorstellung ist, sondern ein von dieser toto genere Verschiedenes“. Wie sonst das Verhältnis zwischen Körper und Geist. Er nennt jene Erkenntnis „die philosophische Wahrheit κὰτ’ ἐξοχήν“. Mit der Objektität des Willens bringt er auch, was Kant als Naturzweck bezeichnet hat, in Verbindung; und es ergibt sich hieraus vielleicht noch schärfer, wie gar nicht zu vergleichen Maschinen mit organisierten Wesen sind (S. 369). „Die Teile des Leibes müssen den Hauptbegehrungen, durch welche der Wille sich manifestiert, vollkommen entsprechen, müssen der sichtbare Ausdruck desselben sein: Zähne, Schlund und Darmkanal sind der objektivierte Hunger; die Genitalien der objektivierte Geschlechtstrieb; die greifenden Hände, die raschen Füße entsprechen dem schon mehr mittelbaren Streben des Willens, welches sie darstellen. Wie die allgemeine menschliche Form dem allgemeinen menschlichen Willen, so entspricht dem individuell modifizierten Willen, dem Charakter des Einzelnen die individuelle Korporisation, welche daher durchaus und in allen Teilen charakteristisch und aus[S. 382]drucksvoll ist.“ Noch mehr gilt letzteres natürlich bei Übergang von Art zu Art, von Gattung zu Gattung usf.
Es ist bis jetzt von Dingen gesprochen mit Vorstellung und Willen. Wie verhält es sich mit den anderen Dingen, die wir unbelebt nennen? Dazu bedarf es einer genaueren Auseinandersetzung dessen, was „Wille“ bedeutet. Wille ist ein absolut Unbedingtes, Grundloses. Er ist weder der Kausalität noch einer Anschauung unterworfen außerhalb seiner Objektivation. „Ding-an-sich aber ist allein der Wille.“ „Er ist es, wovon alle Vorstellung, alles Objekt, die Erscheinung, die Sichtbarkeit, die Objektität ist.“ Wille ist also das Transzendente Kants. Objektiv möglichst deutlich gedacht ist er das, was wir gewöhnlich Wille nennen, Wille des Menschen. Diese Unterscheidung zwischen Willen an sich und objektivem Willen in der Objektivität gibt Schopenhauer die Möglichkeit, in der gleichen Weise wie Kant die transzendente Freiheit mit der objektiven Unfreiheit zu vereinen. Ferner, da Wille an sich grundlos ist, so wird er nicht von Vorstellungen geleitet, obzwar von ihnen begleitet. Wille-an-sich darf also nicht mit dem objektiven bewußten Willen verwechselt werden. Er ist Wille, ob in bewußten oder unbewußten Handlungen. Das ist von großer Bedeutung wenn wir bedenken, wie viel in unserem Körper unbewußt vor sich geht und selbst in unseren geistigen Tätigkeiten. Was wir also Trieb und Instinkt nennen, ist auch nur in Erscheinung getretener Wille-an-sich. Nun hat man immer den objektiven Willen mit den Kräften in der Natur verglichen. Schopenhauer kehrt das Verhältnis um und stellt die Kräfte unter die Erscheinungen des transzendenten Willens. Er will „jede Kraft in der Natur als Wille gedacht wissen“. Er meint damit ein Unbekannteres auf ein Bekannteres zurückgeführt zu haben. Das muß man ohne weiteres zugestehen. Indem nun, wiewohl beim transzendenten Willen weder von Freiheit noch von Unfreiheit gesprochen werden kann, doch bei dem objektivierten Willen Freiheit ausgeschlossen ist, da er ja das Objekt eines Anderen ist, wirken auch die Kräfte unfrei nach festen Gesetzen. Nun ist der Weg zu der übrigen Natur[S. 383] offen. Wie der Leib sich zu dem Willen verhält, so verhält sich die Natur überhaupt zu dem Willen, der in Erscheinung als objektiver Wille oder als Kräfte auftritt. Also die ganze Natur ist Objektität des Willens in seinen verschiedenen Erscheinungen. Und wie Leib und Wille an sich inkommensurabel sind, so auch die Natur überhaupt und Wille. „Denn in jedem Ding in der Natur ist etwas, davon kein Grund je angegeben werden kann, keine Erklärung möglich, keine Ursache weiter zu suchen ist; es ist die spezifische Art seines Wirkens, das heißt eben die Art seines Daseins, sein Wesen. Zwar von jeder einzelnen Wirkung des Dinges ist eine Ursache nachzuweisen, aus welcher folgt, daß es gerade jetzt, gerade hier wirken mußte; aber davon, daß es überhaupt und gerade so wirkt, nie.“ Ein Ding zeigt als Schwere, Undurchdringlichkeit, Magnetisierung usf. „jenes unergründliche Etwas“: „dieses (Etwas) aber, sage ich, ist ihm (dem Ding), was dem Menschen sein Wille (der transzendente) ist, und ist, so wie dieser, seinem inneren Wesen nach, der Erklärung nicht unterworfen, ja, ist an sich mit diesem identisch“. Der Philosoph vergleicht dann den Charakter des einzelnen Menschen mit der wesentlichen Qualität (forma substantialis) eines einzelnen Dinges und erklärt letztere wie ersteren. Der Wille ist nur eins, das Ding-an-sich, „das Wesen-an-sich“, sagt Schopenhauer auch; die Vielheit in unserer Anschauung, die Erscheinungen, sind aus den Anschauungsformen Raum und Zeit gegeben. Und so hat die Objektivation des Willens unzählige Stufen, die in den zahllosen Individuen ausgedrückt sind, und die „als die unerreichten Musterbilder dieser oder als die ewigen Formen der Dinge dastehen, nicht selbst in Zeit und Raum, das Medium der Individuen, austretend, sondern feststehend, keinem Wechsel unterworfen, immer seiend, nie geworden; während jene (Individuen) entstehen und vergehen, immer werden und nie sind“. Und diese Stufen der Objektivation, sagt Schopenhauer, sind nichts anderes als Platons Ideen, was er des Genauern noch ausführt. Die Stufen der Objektivation aber führen vom Tiefsten zum Höchsten, vom Leblosen durch Pflanze, Tier[S. 384] zum Menschen. Und die Weltordnung, im Einzelnen wie in bezug Jedes zu Jedem, rührt daher, daß es ja ein Wille ist, dem alle Stufen der Objektivation angehören, der sich in allem objektiviert. Von diesem Wesen, „was immer es auch sein möchte“, wird gesagt, daß die unendliche Ausdehnung der Welt ganz allein seiner Erscheinung angehört, „es selbst hingegen in jeglichem Dinge der Natur, in jedem Lebenden, ganz und ungeteilt, gegenwärtig ist“. Schopenhauer steht nicht weit von den drei größten Metaphysikern Platon, Spinoza, Kant. Sein unsterblicher Ruhm aber ist, daß er dem transzendenten Wesen bekanntes Leben einhauchte durch den „Willen“.
Und so ist die ganze Natur ein gewaltiges Leben, und durch und durch erfüllt von Willen zum Leben. „Alles drängt und treibt zum Dasein“, heißt es. Namentlich an der tierischen Natur wird es augenscheinlich, „daß Wille zum Leben der Grundton ihres Wesens, die einzige unwandelbare und unbedingte Eigenschaft derselben ist“. Sogar eine generatio aequivoca, nach den Kenntnissen seiner Zeit, schreibt Schopenhauer diesem ungestümen Drange, namentlich zum organischen Leben, zu. Und gleichfalls „den entsetzlichen Alarm und wilden Aufruhr desselben (des Stoffes), wenn er in irgendeiner einzelnen Erscheinung aus dem Dasein weichen soll, zumal, wo dieses bei deutlichem Bewußtsein eintritt. Da ist es nicht anders, als ob in dieser einzelnen Erscheinung die ganze Welt auf immer vernichtet werden sollte“. So ist der Wille zum Leben „das nicht weiter Erklärliche, sondern jeder Erscheinung zugrunde zu Legende“. Und dieser Wille ist weit entfernt, „wie das Absolutum, das Unendliche, die Idee und ähnliche Ausdrücke mehr, ein leerer Wortschwall zu sein“. Er ist das „Allerrealste“, das wir kennen, ja der „Kern der Realität selbst“. Aber grundlos wie der Wille, ist auch dieses Streben und Hasten zum Leben. Und so wirkt die Lebenswut nie befriedigt, nie zu befriedigen, und blind drängend durch die Flut der Erscheinungen. Daher ist die Welt unvollkommen. Noch mehr, sie ist ein Übel, nicht die beste, nach Leibniz, sondern die allerschlechteste. So[S. 385] tönt diese Philosophie in den so eigenartigen Pessimismus Schopenhauers aus, in seinen Lebenshaß. Er ist scheinbar durch sein System begründet, aber doch wohl namentlich durch seine trübe Gemütsverfassung, die er ja mit so vielen Großen teilt, welche das Treiben der Welt anwidert und die darum einsam ihre Wege durch die Tage gehen. Auch seine Bekanntschaft mit den Upanishadenlehren muß zu diesem Pessimismus beigetragen haben. Er war von diesen Lehren hochbegeistert, wie jeder es sein muß, der ihre Tiefe erkennt. Aber in seinem System kann er keinen Trost gefunden haben, wie der Indier und namentlich der Buddhist. Denn wenn er auch Bekämpfung des Willens zum Leben lehrte, sein System zeigt, daß diese Bekämpfung aussichtslos ist. Die Welt ist eben Wille zum Leben, von je in je. Und das „Wunder“, das diesen Willen zur Ruhe brächte, kann nur die Vernichtung des Willens selbst sein, die ja bei einem transzendenten Ding-an-sich ohne ein noch höheres Wesen, davon Schopenhauer aber die Welt nicht abhängen läßt, unmöglich ist.
Die Schopenhauersche Lehre ist Identitätsphilosophie, aber kein wirklicher Monismus. Beziehungen zu Fichtes Philosophie, die behauptet worden sind, kann ich überall nicht finden. Auch ist bekannt, wie ablehnend sich Schopenhauer zur Trias Fichte-Schelling-Hegel verhalten hat und mit seiner Leben-Philosophie gegenüber der fast inhaltleeren Dialektik dieser Vorgänger, über die er oft genug spottet, sich verhalten mußte. Der gewaltige Richard Wagner darf als Schopenhauerianer bezeichnet werden.
In Fr. Nietzsches (1844 zu Röcken geboren, gest. 1900) System spielt bekanntlich der Wille eine sehr hervorragende Rolle. Aber wie dieser Dichter unter den Philosophen fast ausschließlich sich mit dem Menschen und dem Leben beschäftigt, hat der Wille bei ihm nur Bedeutung mit Bezug auf den Menschen und mit Bezug auf das Leben. Und selbst hier betrifft er nur das Verhalten des Menschen im Leben und das Verhalten der gesamten Menschheit. Was der Große hier Außerordentliches gedichtet hat, gehört jedoch nicht zu unserem Thema. Im rein Philosophischen[S. 386] rechnet man Nietzsche wohl auch zu den Phänomenalisten und zu den Naturalisten, von denen wir später sprechen werden. Er hat sogar die innere Welt für phänomenalistisch (S. 356) erklärt, falls das nicht bildlich dichterisch gemeint ist. Mir jedoch scheint er mehr zu den Mystikern nach indischer Art, namentlich in der Auffassung Schopenhauers, zu neigen. Was er von der periodischen Wiederholung der Welt sagt, klingt dahin. Freilich nicht ganz in dem Sinne der Indier, den wir kennen, denn nach ihm soll die Welt sich in genau derselben Weise ständig wiederholen, so daß alles die gleiche Existenz innerhalb der Ewigkeit immer und immer würde durchmachen. Auf seinem eigentlichen Gebiete wird ihm Max Stirner (für Kaspar Schmitt, gest. 1856) als Vorläufer zugewiesen.
In der Einleitung zu seiner „Philosophie des Unbewußten“ sagt Eduard v. Hartmann (geboren zu Berlin 1842, gestorben 1906): „Ich bekenne freudig, daß die Lektüre des Leibniz es war, was mich zuerst zu den hier niedergelegten Untersuchungen angeregt hat“. Wenn das ad verbum zu verstehen ist, so würden wir, nach dem was auf S. 344 vom Unbewußten in Leibniz’ Lehre gesagt ist, Hartmanns Philosophie einem Mißverständnis zu verdanken haben. In der Tat ist diese Philosophie auch keine Fortbildung der Leibnizschen Lehre, namentlich nicht in dem Hauptpunkte; sie ist die Lehre Schopenhauers, mit einem, allerdings bei diesem nicht enthaltenen, aber darum sie gerade sehr komplizierenden, weiteren Prinzip, dem der Zweckmäßigkeit des Ganzen, während der volle Ausdruck des Willens im Einzelnen durchaus Schopenhauerisch ist, da er ja diesen Ausdruck auch den Platonschen Ideen gleichsetzt (S. 383). Die beiden Prinzipe Schopenhauers, Vorstellung und Wille, sind auch Hartmanns Prinzipe. Nun unterscheidet er in der Welt das Bewußte und das Unbewußte und findet, daß das Bewußtsein „die Möglichkeit der Emanzipation des Intellektes vom Willen“ ist, während im Unbewußten Vorstellung und Wille „in untrennbarer Einheit verbunden“ sind. Es kann im Unbewußten „nichts gewollt werden, was nicht vorgestellt wird, und nichts vorgestellt werden, was nicht gewollt ist“. Dabei[S. 387] sind Wollen und Vorstellung beide unbewußt. Es bedeutet ein zweifellos hohes Verdienst Hartmanns, die Rolle des Unbewußten so sorgfältig durch die organische Welt, die ja hier hauptsächlich in Betracht kommt, verfolgt und untersucht zu haben. Alle Kenntnisse der Physiologie, Biologie, Anatomie, Physik usf. werden dabei zu Rate gezogen und mit größter Gründlichkeit verarbeitet. Das Ergebnis ist: 1. Das Unbewußte bildet, erhält und ergänzt den Organismus und leitet alle seine Tätigkeiten und den Gebrauch für den bewußten Willen. 2. Es gibt dem Lebewesen die Instinkte zur Sinneswahrnehmung, Sprach- und Staatenbildung usf., wozu ein bewußtes Denken nicht ausreicht. 3. Es erhält das Geschlecht durch den Geschlechtstrieb, paßt die Lebewesen ihren Bedingungen und den Menschen insbesondere seiner Geschichte an und führt zur möglichsten Vollkommenheit. 4. Es leitet oft die Handlungen durch Ahnungen und Gefühle. 5. Es fördert das bewußte Denken durch Eingebungen (Intuition?). 6. Es beglückt durchs Gefühl für das Schöne und durch künstlerische Produktion. Es kommt darauf an, ob dieses alles zutrifft, denn wir sind oft genug in Zweifel, was an uns unbewußt geschieht, was bewußt. Und wenn Hartmann meint, das Bewußte werde von Gedächtnis begleitet, das Unbewußte nicht, so ist das selbstverständlich ein sehr täuschendes Kriterium. Die anderen Kriterien aber können wir entweder nicht brauchen, als unkontrollierbar, wie z. B., daß das unbewußte Denken nur unsinnlicher Art sein kann. Oder sie sind nicht zutreffend, wie „das Unbewußte irrt nicht“. Es irrt sehr oft, wie wir an Fehlgeburten, Fehlbildungen, Fehlschlüssen im Traum, Fehleingebungen im Wachen usf. reichlich sehen. Ist aber gemeint: es irrt nicht unter den gegebenen Verhältnissen, so ist das zwar richtig, aber dann haben wir nur wieder ein Unkontrollierbares. Und so sind alle Kriterien nicht immer zutreffend oder nicht kontrollierbar. Und wenn nun gar gesagt wird (Philosophie des Unbewußten, 9. Aufl. Bd. II, S. 4), „das unbewußte Denken kann nur von unsinnlicher Art sein“, und dann (S. 30) „denn auch das Unbewußte muß die Form der Sinnlichkeit gedacht haben“,[S. 388] sonst hätte es nämlich diese Form „nicht so zweckmäßig schaffen können“, so weiß man eigentlich nicht mehr, was nun das Unbewußte ist. Sein Denken soll unsinnlich sein, und es soll doch die Form der Sinnlichkeit gedacht haben? Und so zieht Hartmann zwischen dem Bewußtsein und dem Unbewußten zuletzt die grobe materialistische Grenze: „die Gehirnschwingungen, allgemeiner die materielle Bewegung, als conditio sine qua non des Bewußtseins“. Während das Unbewußte „notwendig als ein Immaterielles angesehen werden muß“.
Die Sache wird aber noch dadurch verwickelter, daß „Wille und Vorstellung“ zwar im Unbewußten sind, aber nicht das Unbewußte. Es wird angenommen, daß Wille und Vorstellung „das unbewußter und bewußter Vorstellung Gemeinschaftliche“ sind. Die Form des Unbewußten wird als „das Ursprüngliche“ gesetzt, „das des Bewußtseins aber als ein Produkt des unbewußten Geistes und der materiellen Einwirkung auf denselben“. Hartmann entscheidet sich aus einer Alternative für diese Annahme. Das zweite Glied dieser Alternative ist: „daß zwar der unbewußte Geist ein von der Materie unabhängiges selbständiges Dasein habe, der bewußte aber ein ausschließliches Produkt materieller Vorgänge ohne jede Mitwirkung unbewußten Geistes sei“. Dieses Glied lehnt er ab, wegen der „Wesensgleichheit der bewußten und unbewußten Geistestätigkeit“, übersieht aber, daß er dafür Materie auf ein Immaterielles wirken läßt. Wenn er dann später die „Wesensgleichheit von Geist und Materie“ dartut, so hebt er eben jeden wirklichen Unterschied zwischen Bewußtem und Unbewußtem, außer in Worten, auf. Es ist, wie ich glaube, nicht möglich, in diese Distinktionen Hartmanns Konsequenz und Schärfe hineinzubringen; das System läuft im Kreise in sich zurück. Und das folgt eben, weil das Unbewußte für das Bewußte und das Bewußte für das Unbewußte als Kriterium benutzt werden muß. Läßt man also das alles fort, so bleibt nur der transzendente „unbewußte Geist“ als, im Schopenhauerschen Sinne, weltbildend. Aber während bei Schopenhauer für diesen Geist nur Wille steht, ist ihm hier Vorstellung hinzugenommen, die, bewußt oder[S. 389] unbewußt, kaum anders als sinnlich gedacht werden kann. Vielleicht ist das der Grund, daß Hartmann sein System als transzendentalen Realismus ausgibt. Nach Kant ist solcher Realismus dogmatisch.
Es wäre damit eine ganz bedeutende Verschlechterung des Schopenhauerschen Systems herbeigeführt, wenn es sich nicht um die „Zweckmäßigkeit“ und den „Zweck“ der Welt handelte. Für Hartmann ist zwar die Welt auch so schlecht als möglich, sie ist eine „unselige“. Allein sie ist hervorgetreten, wenn auch nicht als Selbstzweck, doch als Zweck, und zwar das zu erreichen, was, wie wir gesehen haben, im Schopenhauerschen System nicht möglich ist, nämlich, „den Willen von der Unseligkeit seines Wollens zu erlösen“. Es wird nämlich im Willen selbst ein Blindes, ein „Alogisches“ gesehen, im Vorstellen dagegen ein „Logisches“, das in der höchsten Potenz als bewußte Vernunft die höchste Intelligenz wird. Der Weltprozeß erscheint hiernach „als ein fortdauernder Kampf des Logischen mit dem Unlogischen, der mit der Besiegung des letzteren endet“. Diese Besiegung kann aber erst „mit dem zeitlichen Ende des Weltprozesses, dem jüngsten Tage, zusammenfallen“. Die Weltdauer ist begrenzt; am Ende der Tage kommt die Welterlösung, das Ende der Illusion, „die Aufhebung alles Wollens ins absolute Nichtwollen“. Dazu ist erforderlich, daß möglichst viel Menschheit vorhanden sei, weil diese allein imstande ist, Willensverneinung durchzuführen, die Vernunft über den Willen zu erheben. Und ferner, daß diese Menschheit mehr und mehr „von der Torheit des Wollens und dem Elend des Daseins durchdrungen sei, daß dieselbe eine so tiefe Sehnsucht nach dem Frieden und der Schmerzlosigkeit des Nichtseins erfaßt habe“, und so alles für Wollen und Dasein Sprechende als Eitelkeit und Nichtigkeit erkannt werde. Das ist alles offenbar aus der Menschheit selbst entnommen. Wie das auf den transzendentalen unbewußten Geist Anwendung finden soll, kann man nicht einsehen, wenn man nicht die ganze Lehre in die reine pandeistische Theosophie überträgt, aus dem unbewußten Geist Gott macht und aus Wille und Vor[S. 390]stellung zwei Manifestationen von ihm, über die er besonders schaltet. Sobald der Welt ein Ende gegen ein Anderes vorausgesagt wird, muß eben etwas da sein, das dieses Ende herbeiführt. Außerdem bemerkt man übrigens, daß, wenn nicht die Welt zuletzt ganz aus vernünftigen Wesen besteht, alles Leblose überhaupt in Vernunftbegabtes übergegangen ist, ein solches Ende nicht möglich ist. Oder soll das Ende der Welt ein gemeiner Kadaver sein? Dann wäre diese ganze Philosophie überhaupt nur auf die belebte Welt zu beziehen. Im letzten Kapitel aber werden wir das Ende der Welt von ganz anderen Gesichtspunkten betrachten und sehen, daß eine allmähliche Entwicklung des Alls nach reiner Beseelung in der Tat nicht ausgeschlossen ist (S. 479 f.). Die Hartmannsche Philosophie aber ist inkonsequent und im ganzen keine Verbesserung der Schopenhauerschen, in mancher Hinsicht sogar eine Trübung dieser.
Auf dem Boden des Idealismus stehen auch viele von den modernen Philosophen, wir werden sie im folgenden kennen lernen. Ihr Verfahren ist ein mehr naturwissenschaftlich-induktives, das, im Gegensatz zu dem analytischen, deduktiven Vorgehen der älteren Metaphysiker, Kant schon eingeleitet und oft angewendet hat. Gleichwohl wird dem Geist, wie z. B. von R. Eucken geschieht, eine außerordentliche Vormacht eingeräumt, vermöge deren er zum Absoluten aufsteigt, als ein Selbständiges in der Welt.
SIEBENTES KAPITEL.
Spinozismus und Neuspinozismus sowie Neuidealismus.
Der Spinozismus ist im Wesen aufs äußerste getriebener Idealismus. Er hat trotz seiner Bezeichnung als Pantheismus mit religiösen Überzeugungen nichts zu tun. Gott ist hier allein das transzendente Ding-an-sich. Und wenn man sich vor dem Spinozismus als einem Atheismus gefürchtet hat und von gewissen Seiten noch fürchtet, so hat das seine Berechtigung für diejenigen, welche sich Gott nur mit per[S. 391]sönlichen Eigenschaften begabt denken konnten und nur denken können. Der Spinozismus in seiner reinen Form schließt einen persönlichen Gott völlig aus. Aber gerade deshalb konnte sich ihm die moderne Naturwissenschaft anpassen. Und so hat er in unserer Zeit eine Bedeutung erlangt, die in Verbindung mit Kants und Schopenhauers transzendenten Anschauungen die aller anderen Philosophien weit überragt und in der Form des Neuspinozismus allmählich sich zur wissenschaftlichen Herrschaft aufschwingt. Dieses ist auch mit ein Grund, warum der Spinozismus erst an dieser Stelle behandelt wird. Außerdem wollte ich ihn auch äußerlich vom Cartesianismus ablösen, mit dem er, wie früher ausgeführt (S. 337), gar keine Beziehung hat, außer etwa, daß er auf ihn folgt und daß der Urheber sich mit ihm eifrig beschäftigt hat und seiner öfter gedenkt und seiner Nomenklatur sich bedient.
Der Neuidealismus ist vom Spinozismus schwer zu trennen, er ist darum mit diesem zusammen behandelt.
46. Spinoza und der Pantheismus.
Baruch (Benedikt) Spinoza ist 1632 in Amsterdam geboren und 1677 im Haag gestorben. Er ist Sohn eines portugiesisch (oder spanisch, aus Espinoza stammend?) -jüdischen Mannes und gehört zu den nicht vielen, von denen Eugen Dühring in seiner zwar sehr scharfsinnigen, aber mitunter überscharfen Geschichte der Philosophie mit hoher Achtung auch vor dem Menschen spricht. Das für uns in Betracht kommende Hauptwerk (ich benutze die Ausgabe von Berthold Auerbach) Spinozas ist die „Ethik“; sie ist nach seinem Tode von seinem Lebensfreunde, dem Arzt Ludwig Meyer, herausgegeben und enthält eine Darstellung seines Systems in völlig mathematischer Form. Sie beginnt mit Definitionen der wichtigsten Begriffe. Ursache seiner selbst ist das, dessen Wesen das Dasein in sich schließt, oder das, dessen Natur nicht anders als daseiend begriffen werden kann. Substanz ist, was in sich ist und aus sich begriffen wird, das also keines anderen[S. 392] bedarf, um daraus gebildet zu werden. Attribut ist, was der Verstand von der Substanz als ihr Wesen ausmachend erkennt. Modi sind die Affektionen der Substanz, oder das was in einem Anderen ist, wodurch man dieses Andere auch begreift. Gott ist das schlechthin unendlich Seiende, „das heißt die Substanz, die aus unendlichen Attributen besteht, von denen jedes ein ewiges und unendliches Wesen ausdrückt.“ Das sind die fünf Hauptbegriffe des Spinozaschen Systems. Was unendlich ist, wird negativ durch das, was endlich ist, festgestellt: dasjenige heißt in seiner Art endlich, was durch ein anderes von gleicher Natur begrenzt werden kann. Ewigkeit ist das Dasein selbst, sofern es allein aus der Definition des ewigen Dinges begriffen wird. Die Attribute Gottes sind hiernach durch nichts begrenzt, und ewig aus dem Sein Gottes. Frei ist ein Ding, wenn es allein aus der Notwendigkeit seiner Natur da ist, und allein von sich zum Handeln bestimmt wird; unfrei, was von einem anderen zu sein, oder in bestimmter Weise zu sein und zu wirken gezwungen ist. Nach den Definitionen folgen Axiome; eines enthält den Satz der Kausalität: Eine bestimmte Ursache hat notwendig eine Wirkung, eine Wirkung ohne Ursache kann nicht erfolgen. Die Erkenntnis der Wirkung schließt die Erkenntnis der Ursache in sich. Von den Sätzen müssen wir gleichfalls einige anführen. Dinge, die nichts miteinander gemein haben, können nicht gegenseitige Ursache sein. Eduard v. Hartmann, wenn er diesen so klaren Satz beachtet hätte, wäre nie zu seiner so inkonsequenten Weltendetheorie gekommen. Zu der Natur einer Substanz gehört notwendig das Dasein und die Unendlichkeit (Nicht-Begrenztheit durch ein anderes gleicher Natur). Attribute einer Substanz können nur aus sich begriffen werden.
Gott ist notwendig da. Außer Gott kann es keine Substanz geben und läßt sich keine begreifen. Alles was ist, ist in Gott, und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden. Gott ist absolut frei, handelt nur aus den Gesetzen seiner Natur. Gottes Dasein, Gottes Macht und Gottes Wesenheit sind ein und das[S. 393]selbe, Gott ist nicht nur die wirkende Ursache des Daseins, sondern auch der Wesenheit der Dinge. Die Welt ist notwendig so wie sie ist, kein Ding ist frei, nichts in der Welt geschieht frei, noch zufällig. Alles ist aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, auf gewisse Weise da zu sein und zu wirken. Die Dinge sind die Modi, Existenzweisen Gottes, nach zwei Attributen: Ausdehnung (Körperlichkeit) und Vorstellung (Geist), die ihre formale Wesenheit sind. Diese gesperrt gedruckten Sätze enthalten das gewaltige, so konsequente und darum in seiner Starrheit fast unheimliche System Spinozas. Es ist, wie der Leser sieht, in der Tat pantheistisch; ein jedes Ding wird nur begriffen aus den Attributen Gottes, und bedeutet nur eine Existenzweise Gottes. Dabei handelt es sich um ein Zwangsystem; daß nichts anders ist als es sein muß, nichts anders wirkt als es wirken muß; und die Kette der Ursachen wird ins Unendliche geführt. Ein Zweck findet in der Welt nicht statt. Die Ordnung und Verknüpfung der Vorstellungen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge. Aus diesem wichtigen Satz ergibt sich die Parallelität zwischen Körper und Geist. Es ist an sich kein Zusammenhang zwischen den beiden formalen Wesenheiten der Welt und des Menschen vorhanden, außer daß die entsprechenden Attribute, deren Existenzweisen die Dinge sind, Attribute Gottes, der einen und einzigen Substanz, sind. Weil sie aber dieser einen Wesenheit angehören, können sie nur in paralleler Art Existenzweisen sein. Und so sind Körper und Geist parallele Erscheinungen und wirken parallel. Dieses ist so streng ausgedrückt, daß sogar gesagt wird: „Der Körper kann den Geist nicht zum Denken, noch der Geist den Körper zur Bewegung oder Ruhe, noch zu etwas anderem bestimmen“. Nur die Parallelität zeigt Körper und Geist als in Abhängigkeit voneinander. An sich ist der Geist nur Geist, der Körper nur Körper. Aber vermöge der Parallelität und der Zugehörigkeit der Attribute zu dem Einen, sind im Geiste adäquate Vorstellungen von dem Körper und der Körperwelt vor[S. 394]handen. Darum konnte Spinoza auch behaupten: der Gegenstand der Vorstellung, welche den menschlichen Geist ausmacht, ist der Körper, oder ein gewisser, in der Wirklichkeit vorhandener Modus der Ausdehnung. Und darum konnte er weiter feststellen, daß alles wirklich da ist, insbesondere auch unser Körper da ist, wie wir ihn wahrnehmen. Hier berührt sich Spinozas Philosophie mit der der Positivisten, der Wirklichkeitsphilosophen. Und wenn Spinoza weiter folgert: Der menschliche Geist faßt einen äußeren Körper nur durch die Vorstellungen der Affektionen seines Körpers als wirklich daseiend auf, so haben wir einen Hauptsatz der Sensualisten vor uns. Auch das Transzendentale finden wir in diesem System, sofern die Vorstellungen in Gott der Existenzweisen als Essenzen (essentia) von den tatsächlichen Existenzweisen als Existenzen (existentia) und damit Idealdinge von Realdingen getrennt werden. Die Dinge unterscheiden sich in der formalen Wesenheit gar nicht voneinander, sondern nur in ihren Existenzweisen. So ist also der Geist überall wie der menschliche, der Körper überall wie der menschliche; nur die Weise, wie beide die Dinge ausmachen, ist von Ding zu Ding abweichend. Also ist die Welt an sich durchaus einheitlich. Spinozas System ist hiernach ein Monismus. Es werden zwar Körper und Geist unterschieden und sogar absolut auseinandergehalten; sie sind jedoch Parallel-Existenzweisen des gleichen einen Urwesens, um so zu sprechen, nach absoluten Gesetzen, so daß sie durchaus wie eine Einheit bilden, und ihre formalen Wesenheiten fließen aus den Attributen des gleichen einen Urwesens. Auch ist der Mensch nur ein Teil der Natur und leidet auch als ein solcher, und lebt und stirbt als ein solcher. Nur aus sich heraus sich zu verändern, ist ihm nicht gegeben, da er ja bloß eine Existenzweise bedeutet.
Spinozas System ist die einleitende Begründung zu seinem eigentlichen Thema, eben der Ethik. Von dieser zu sprechen, ist nicht unsere Aufgabe. Sie ist viel angegriffen und viel geschmäht worden, wegen des kühlen Verstandes, der in ihrer Auffassung herrscht. In seinem stillen Kämmerlein[S. 395] wird aber kaum jemand umhin können, zu gestehen, daß sie das enthält, was eine von Phrasen und leeren Einbildungen freie Menschenethik enthalten muß. Eher kann man ihr den Vorwurf machen, daß sie dem System selbst nicht immer folgt und aus dem Pantheismus zuweilen in einen Deismus übergeht. Wer hat in solchen Dingen je ganz konsequent gedacht? Für uns von Bedeutung ist, daß Spinoza auch die Unsterblichkeit lehrt. Er sagt: „Der menschliche Geist kann mit dem Körper (d. h. mit dem Leben des Körpers) nicht gänzlich vernichtet werden, sondern es bleibt etwas von ihm übrig, das ewig ist“. Dieses folgt schon daraus, daß eben der Geist, wenn auch nur eine Existenzweise, doch jedenfalls in einem Attribut, in einer Vorstellung Gottes enthalten ist. Und es gilt selbstverständlich ebenso für den Körper. Weil aber der Geist im Dasein eben nur eine Existenzweise ist, kann er sich dessen, was er vorher gewesen, nicht erinnern können. „Die Vorstellung,“ sagt Spinoza, „welche die Wesenheit des Körpers unter der Form der Ewigkeit ausdrückt, ist ein gewisser Modus des Denkens, der zum Wesen des Geistes gehört und notwendig ewig ist. Demnach ist es unmöglich, daß wir uns erinnern, vor dem Körper dagewesen zu sein, da es ja in dem Körper keine Spuren davon geben, noch die Ewigkeit durch die Zeit definiert werden oder irgendeine Beziehung auf die Zeit haben kann“. Das hebt die persönliche Unsterblichkeit auf. Aber „nichtsdestoweniger denken und erfahren wir, daß der Geist ewig ist. Denn der Geist bemerkt diejenigen Dinge, die er durch den Verstand begreift, nicht minder als diejenigen, die er im Gedächtnis hat. Denn die Augen des Geistes, womit er die Dinge sieht und beobachtet, sind eben die Beweise. Wenn wir uns daher auch nicht erinnern, vor dem Körper dagewesen zu sein, so bemerken wir doch, daß unser Geist ewig ist, insofern er die Wesenheit des Körpers unter der Form der Ewigkeit enthält, und daß dieses sein Dasein (des Körpers) nicht durch die Zeit definiert oder durch Dauer erklärt werden könne“. Es ist nicht leicht, sich in diesen Gedankengang hineinzufinden. Er soll aber wohl besagen, daß, weil wir[S. 396] den Begriff der Ewigkeit der Materie als zu ihrem Wesen gehörig in uns haben, auch die Ewigkeit des Geistes gewährleistet ist, wohl aus dem Parallelverhalten der zwei in Einem zusammenlaufenden Attribute in den Existenzweisen. Die Ethik faßt auch Gott persönlicher auf, als dem System entspricht. Sie hat jedoch aus den Grundlagen recht, wenn sie alle Erkenntnis auf die Erkenntnis Gottes richtet und diese Erkenntnis als wahr ansieht. Wir sind ja Existenzweisen Gottes, die Seele ist eine begrenzte Weise des allgemeinen Denkens als Attribut Gottes.
47. Neuspinozismus und Neuidealismus.
Spinozas System hat wegen seiner unerbittlichen Strenge und Konsequenz, wie bemerkt, der Menschheit lange widerstrebt. Es ist wohl auch nicht immer recht verstanden worden. Daß aber große Geister zu ihm neigten, sehen wir an Goethes Beispiel, der schon früh sich mit ihm beschäftigte. Lavater erzählt (Gespräche Goethes, Bd. I, S. 75) vom 28. Juni 1774, wie eifrig Goethe ihn von Spinoza und Spinozismus unterhalten und wie bedeutend er von ihm gesprochen habe. Später hat Goethe dem Spinozismus mehr und mehr seine interessierte Aufmerksamkeit geschenkt, so daß er sogar als Spinozist bezeichnet worden ist. In der neuesten Zeit hat der Spinozismus großen Zuzug aus den Kreisen namentlich der Naturforscher und seltsamerweise auch aus den Kreisen der Materialisten unter ihnen erfahren. Ich kann hier nur auf einiges eingehen, da Entscheidendes dem letzten Kapitel vorbehalten bleiben muß. Schon von Schleiermacher habe ich erwähnt, daß er in wesentlichen Anschauungen Spinozist gewesen ist. Der Neuspinozismus aber knüpft sich vor allem an die Namen Fechner, Wundt und Häckel. Zuerst jedoch ein spiritualistischer Spinozist.
Lotze (1817 in Bautzen geboren, gestorben in Berlin 1881) ist, als Naturforscher und Mediziner, Atomistiker und Physiker, jedoch nur, soweit es sich um die Körper, auch unseren Körper, und die Vorgänge zwischen und in ihnen handelt.[S. 397] Die Seele ist aber vom Körper durchaus verschieden, obzwar Körper und Seele aufeinanderwirken. Letzteres müßte unverständlich bleiben, wenn die Dinge nicht Modi einer Allsubstanz, eines Weltgeistes wären. Dessen Verhalten zu den Dingen entspricht unserem Verhalten zu unseren inneren Tätigkeiten; es ist also immanent, Eigenheit des Weltgeistes. Der Weltgeist ist in sich folgerichtig, und dieses bedeutet in der Welt der Erscheinungen die Ordnung. So ist die Einheit der Dinge trotz der Vielheit ihrer Eigenschaften in dem Gesetz begründet. Das wäre alles allenfalls noch Spinozistisch. Spinozistisch ist auch noch die Korrespondenz der Zustände und Änderungen in den Dingen an Stelle der Abhängigkeiten, denn sie erinnert an Spinozas Parallelismus, zumal auch alle einheitlichen Dinge als Seelen oder Geister aufgefaßt werden. Abweichend wird jedoch einerseits der Weltgeist, Gott, über die Dinge erhoben, und andererseits werden die Dinge mehr verselbständigt. So geht der straffe Monismus Spinozas fast in einen theistisch-deistischen Dualismus über. Und indem noch Leibniz’ Monadenlehre Verwendung findet, haben wir mehr einen geistvollen Eklektizismus von Materialismus, Spinozismus, Cartesianismus und Monadenlehre als ein einheitliches festes System. Aber alles ist innig und fein verarbeitet. Das zeigt sich namentlich darin, daß die Monaden einerseits mehr physikalisch aufgefaßt werden mit wirklichen Wechselwirkungen zwischen ihnen, die bei den Leibnizschen Monaden als wirklich nicht vorhanden sind, auch nicht bei Spinozas Modi, andererseits sie in Spinozas Art als Modi der Allsubstanz betrachtet werden, so daß sie nach drei Richtungen strahlen würden. In jeder Monade sind beide Attribute der Allsubstanz zu erkennen. Die Seele ist nur eine Monas, der Körper besteht aus vielen Monaden. Aus der teilweisen Unabhängigkeit der Monaden von der Allsubstanz — wie diese Unabhängigkeit entsteht, soll eine nicht zu beantwortende Frage sein — ergibt sich eine gewisse Freiheit des Willens und damit eine freiere Ethik, die in Verbindung mit einer Zwecklichkeit der Welt den teleologischen Idealismus bildet. Die Einheit wird dadurch gegeben, daß[S. 398] alles sich auf die Ethik beziehen soll, selbst Logik und Metaphysik. Darin spricht sich der Zug der modernen Zeit aus.
G. Th. Fechner (1801–1887) ist Naturforscher, induktiver Idealist, Spinozist und Mystiker in einer Person. Mit dem als Astrophysiker so bedeutenden Zöllner hat er eine Zeitlang auch dem Spiritismus gehuldigt. Das tut nichts. Er war ein hervorragender Forscher und hat die Wissenschaft der Psychophysik begründet und mit einem berühmt gewordenen Gesetz bereichert. Seele und Körper sind Formen einer Substanz, eines Realen. Er führt aber diesen Spinozismus in das Kant-Schopenhauersche Transzendentale. Die Welt ist für uns nicht die Modi selbst, sondern die Erscheinungen dieser in unserem Bewußtsein. Spinoza hatte schon zwischen Essenzen und Existenzen unterschieden. Die letzteren wären die Erscheinungen. Gleichwohl ist die Welt nicht etwa ein Traumbild, ein Phantom, sondern eine Wirklichkeit, wenn auch eine transzendente. Das wird erwiesen durch die in unserem Bewußtsein von der Welt vorhandene Ordnung und Gesetzmäßigkeit. Ordnung und Gesetz sind das Wesen der Erscheinungen. Das Bewußtsein davon ist das höhere Bewußtsein, die Vernunft. Und da wir in Spinozas Sinn Existenzweisen Gottes sind, so ist Gott das höchste Wesen, dessen Bewußtsein alle Erscheinungen und alle Zusammenhänge umfaßt. In der von Fechner verfolgten Wechselbeziehung von Körper und Seele, die auch Wilhelm Wundt (S. 399) lehrt, sehen manche einen Widerspruch gegen Spinozas System. Das ist nicht der Fall, da ja eine solche Wechselbeziehung als Parallelsein von Körper und Seele gerade nach Spinozas Anschauung, eben der psychophysische Parallelismus, unvermeidlich ist. Es ist nur ein Streit um Worte, wenn man Wechselbeziehung von Parallelbeziehung unterscheiden und trennen will. Ist jene so unveränderlich wie diese, so gelten beide gleich viel. Spinozas Theorie hat ja gerade darin ihren Vorzug, daß wirkliche Beziehungen zwischen zwei absolut verschiedenen Attributen nicht angenommen werden, sondern Parallelbeziehungen, aus der Zugehörigkeit der Attribute zu dem All-Einen. Fechner frei[S. 399]lich bezeichnet seine Lehre wegen dieser Wechselbeziehungen auch als materialistisch. Überdem soll nicht nur kein Geist ohne Körper sein, sondern auch kein Gott ohne Welt, ein Gedanke, dem wir schon öfter begegnet sind. Sein Mystizismus drückt sich in der Annahme von Wesen höher als der Mensch aus, von Geistern. Solche sollten zum Teil mit den Weltkörpern Wesen bilden, oder noch höher, mit den Weltsystemen. Die Erde als großes Tier hat auch der französische Astronom Flammarion angesehen. Man bemerkt aber, daß man so zuletzt überhaupt die Welt als Ganzes, wie ein Lebewesen betrachten würde, mit untergeordneten Weltsystemen, Welten usf. als Einzel-Lebewesen, die die Welt zusammensetzen, wie ja die organischen Wesen in der Tat aus Lebewesen, sichtlich oder verborgen, aufgebaut sind. Diese Konsequenz hat, auf die Erde, auch Fechner gezogen; und weiter, daß immer die umfassendere Seele von den eingeschlossenen Seelen weiß, während sich ausschließende Seelen voneinander ohne Wissen sind. Die Bedeutung einer Seele aber richtet sich nicht nach dem Umfang, und so bleibt die Menschenseele auf ihrer Höhe auch den umfangreicheren Seelen gegenüber. Denn entscheidend ist die Größe des Bewußtseins, im Leibnizschen Sinne: ihre Deutlichkeit, und diese braucht mit dem Umfang nicht zusammenzuhängen. Es kommt hier die Lehre von der Schwelle des Bewußtseins in Betracht, aus der eine Art Bewußtseinsleiter, wie eine Tonleiter aufgebaut wird. Fechner hat auch über die Pflanzenseele eine Schrift: „Nanna oder über das Seelenleben der Pflanzen“ verfaßt, deren Ideen sich gerade jetzt mehr und mehr Bahn brechen. Aber den kleinsten Teilen der Materie, den Atomen, hat Fechner Leibniz’ Monadenleben doch abgesprochen.
Wilhelm Wundt (geb. 1832 zu Neckarau), der geistvolle Führer in der Psychophysiologie, den wir schon genannt haben, steht, abgesehen vom Mystizismus Fechners, ungefähr auf gleichem Boden. Er ist als Physiolog und Psycholog sehr ins Einzelne gegangen und hat in allen Seelenfunktionen nachzuweisen versucht, daß sie mit Körperfunktionen zusammenhängen. Persönlich halte ich einen solchen Nachweis nur im Gröbsten[S. 400] für möglich, und namentlich den Hauptnachweis, als Ursache und Folge, überhaupt nicht für erbringbar, da in solchen transzendenten Fragen die Zeit ausscheidet. Für die Erfahrung ist aber sehr viel durch solche Untersuchungen gewonnen, und der Nachweis, daß Körper und Geist als Erscheinungen in der Tat untrennbar sind, ist von höchster Bedeutung. Wir kommen im letzten Kapitel noch darauf zu sprechen. Das gesamte Leben sieht Wundt als nie rastendes inneres Geschehen an, das kein Beharrendes besitzt. Zum Beharrenden glaubt er, kommen wir lediglich durch Projektion der Außenwelt in unsere innere Welt; zum Bewußtsein wie für die Außenwelt zum Raum, indem wir für das aus jener Projektion fälschlich gewonnene Beharrende einen Ort brauchen und ihn uns einbilden, eben das Bewußtsein. An sich drückt Bewußtsein nichts aus, als daß wir ein inneres Leben führen, und es ist nicht von den anderen inneren Erscheinungen des Lebens verschieden. Kaum daß der Wille herausgehoben wird. Offenbar kann ebenso auf das ganze Gebiet dessen, was auf S. 222 f. als regulative oder kategorische Seele bezeichnet ist, geschlossen werden. Eine solche Seele wäre also nicht ein Besonderes, und wir hätten eine assoziative Psychologie (S. 359). Die Verneinung alles Beharrenden ist heraklitisch. Ich weiß aber nicht, wie sie sich für das innere Leben soll durchführen lassen, ohne dieses in ein völliges Schattenspiel aufzulösen, denn mit der Verneinung des Bewußtseins als eines Beharrenden — ich glaube eines Organs für die innere Welt, wie die Sinnesorgane für die äußere — ist auch die Verneinung der Individualität gegeben, damit auch die Verneinung der Anschauungsformen. Und so wäre auch die Welt zu verneinen. Dann bliebe nur noch die indische Maja. Wir haben auch davon noch zu sprechen. Gleichwohl wird die Welt als eine Totalität aufgefaßt, nämlich als Ganzheit der Willenstätigkeiten. Diesen entsprechen die Vorstellungstätigkeiten und ordnen sich nach ihnen. Der Gedanke ist spinozistisch mit genauerer Angabe der Attribute. Allein die Gottesidee scheint gesondert behandelt zu sein. Von Bedeutung ist noch Wundts Unterscheidung[S. 401] zwischen einer quantitativen Transzendenz, wie wenn der Umfang eines Gegenstandes oder einer Vorstellung über die Grenzen hinaus erweitert wird, und der qualitativen Transzendenz, wenn das Hinausgehen zu überhaupt Verschiedenem erfolgt. In allen metaphysischen Problemen haben wir es mit beiden Transzendenzen zu tun. Offenbar hängen sie mit den Attributen zusammen. Die große Bedeutung Wundts als Ordner der philosophischen Wissenschaften habe ich nur zu erwähnen. Zu den Neu-Spinozisten ist wohl auch A. Riehl (geb. 1844) zu rechnen, jedoch mit einer starken Neigung zum Transzendental-Idealistischen, da er die „gemeinsame Quelle von Natur und Verstand“ für transzendent erklärt und außerdem die psychische Welt durchaus von der physischen scheidet. Aber der Parallelismus vermittelt ihm einen „philosophischen Monismus“. Ähnlich verhält es sich mit dem freundlichen Adolf Lasson (geb. 1832). Über Häckels Spinozismus kann ich nur im Zusammenhange mit dem Energismus reden.
ACHTES KAPITEL.
Empirismus, Sensualismus, Realismus, Naturalismus, Positivismus.
Wir nähern uns der physischen Anschauung von Welt und Leben. Den wenn auch nicht zeitlichen, aber sachlichen Übergang bilden die in der Überschrift verzeichneten Anschauungen. Die Namen besagen schon, um was es sich dabei handelt. Nur ist hervorzuheben, daß unter Sensualismus der äußere Sensualismus verstanden ist, nicht der innere, der der Phänomenalismus ist, und den wir schon untersucht haben (S. 356 ff.). Diese Anschauungsweisen sind die sich von selbst darbietenden; eine Besprechung verdienen sie nur, soweit sie philosophisch durchdacht sind. Wir finden sie selbstverständlich bei allen Völkern und zu allen Zeiten, so auch bei den Griechen (unter den Zynikern, Epikureern, Stoikern usf.). Zu einem System ausgebildet sind sie jedoch erst in den neueren Zeiten, und von denen allein wollen wir hier sprechen. Den Idealismus haben wir fast ganz in Deutsch[S. 402]land behandeln können; was wir jetzt vortragen werden, betrifft wesentlich englische und französische Denker, deutsche kommen erst in neuerer Zeit und, hinsichtlich der Originalität, in zweiter Reihe in Betracht. Dafür haben wir freilich in Ernst Mach einen der konsequentesten Sensualisten.
48. Die englische Trias: Bacon, Locke, Hume.
Von dem englischen Dreigestirn ist Francis Bacon von Verulam (1561–1626), der bekannte Begründer der naturwissenschaftlichen Erfahrungsmethoden, für uns von geringerer Bedeutung; er hat eine neue, besondere Anschauung von Welt und Leben nicht entwickelt. Nur auf die Notwendigkeit der Beurteilung der Welt und ihrer Geschehnisse auf Grund der Erfahrung hat er scharf hingewiesen. Die neuere Empirie, als Untersuchungsmethode, nimmt mit ihm namentlich in den Naturwissenschaften ihren eigentlichen Anfang. Endursachen lehnt er ab, weil mit ihnen nichts anzufangen sei, sie gehörten in die Gotteslehre, nicht in die eigentliche Wissenschaft. Die Natur müsse aus ihren eigenen Vorgängen und Ursachen erklärt werden, also empirisch, nicht metaphysisch, ein Standpunkt, den schon viele vor ihm vertreten haben, auf dem wir auch Aristoteles finden. Seine Methode ist die der Induktion. Reiner Empirist ist aber Bacon nicht, eher empirischer Panpsychist, da er die ganze Materie belebt sein läßt. Auch nimmt er ein allgemeines Gesetz an, das die Natur beherrschen soll. Er gesteht sogar Intuition zu. Und doch schreckt er uns mit den Trugbildern, Idolen, die uns aus unserer allgemeinen Natur, doch auch aus unserer individuellen Art und aus gedankenloser Einbildung, als Tradition und Anlernung, stetig verfolgen sollen.
John Locke (1632 in Wrington geboren, gestorben 1704) gehört zu den Größten im Reiche des Gedankens. Sein Meisterwerk: „An essay concerning human understanding“ (ich zitiere nach der Reclam-Ausgabe) ist das Hauptalles des Empirismus. Locke ist aber nicht bloß Empirist; wir finden auch Idealismus, Sensualismus und Realismus bei ihm vertreten. Empirist ist er hinsichtlich unserer Ideen, Idealist in be[S. 403]zug auf die Materie, und zwar transzendentaler, Sensualist, wo es sich um Verbindung der Ideen mit der Erfahrung handelt, Realist in bezug auf Körper und Vorgänge. Die Ideen (Empfindung, Vorstellung, Begriff usf.) sind sämtlich aus der Erscheinung erworben; keine Idee ist uns angeboren, ist a priori, alle sind a posteriori. „Bei manchen Leuten,“ sagt er, „steht die Ansicht fest, daß der Verstand gewisse ihm angeborene Grundbegriffe enthalte, gewisse ursprüngliche Vorstellungen, κοιναὶ ἔννοιαι, dem menschlichen Bewußtsein gewissermaßen aufgeprägte Schriftzüge, die die Seele bei ihrem ersten Eintritt in das Dasein empfange und mit sich in die Welt bringe.“ Das soll also nicht der Fall sein: „Sie sind dem Geiste nicht von Natur eingeprägt, weil sie den Kindern, Idioten usw. nicht bekannt sind.“ Alle Kinder und Idioten hätten nicht den geringsten Begriff von ihnen. Und es scheint ihm „fast ein Widerspruch darin zu liegen, wenn man sagen wollte, es gäbe der Seele eingeprägte Wahrheiten, die sie nicht bemerke oder verstehe.“ „Denn daß dem Geiste etwas eingeprägt werde, ohne daß es ihm zum Bewußtsein käme, scheint mir kaum verständlich zu sein.“ Die Vernunft entdeckt auch die Ideen nicht, sie bildet sie nur allmählich aus den Eindrücken, die sie empfängt. Locke unterscheidet nun die innere Erfahrung (reflection) von der äußeren (sensation). Aber eine innere Erfahrung ohne äußere erkennt er nicht an. Wie bei den Stoikern und vielen andern, ist die Seele für ihn erst eine tabula rasa, ein „leeres Kabinet“. Die Sinne lassen „erst Vorstellungen ein, der Verstand einverleibt sie dem Gedächtnis und versieht sie mit Zeichen, Namen. Dann, im weiteren Fortschreiten abstrahiert er aus ihnen Begriffe und lernt allmählich allgemeinere Namen. So gewinnt er Materialien für sein Denkvermögen.“ Wir haben also nur die Fähigkeit Ideen zu bilden, nicht besitzen wir diese Ideen von vornherein. Nicht einmal die logischen Begriffe sind angeboren; Kinder kennen weder den Satz der Identität, noch den des Widerspruchs. Die Idee Gottes ist nicht angeboren. Ebensowenig die Idee der Materie. Das Kind und der Idiot wissen von beiden nichts. Alles an Ideen[S. 404] ist allein aus den Eindrücken abgeleitet, die Ideen sind empirisch gewonnen. Das wird nun auch mit stärkerem Grunde von den praktischen Grundsätzen behauptet, ebenfalls zum Teil von den moralischen und ethischen. Diese sind erst recht nicht angeboren. Die Beweise dafür werden aus dem Leben des Einzelnen und der Menschen eingehend geführt. In der Tat ist ja das Material für solche Beweise scheinbar groß genug. Alle Ideen sind aus Sensation und Reflexion gewonnen. „Äußere Gegenstände versehen den Geist mit den Ideen sinnlicher Eigenschaften, die aus allen den verschiedenen Wahrnehmungen bestehen, die sie in uns hervorbringen, und der Geist versieht den Verstand mit den Ideen seiner eigenen Tätigkeit.“ Die Ideen der Reflexion werden aber später erworben, und die Seele fängt an, Ideen zu haben, wenn sie mit der Wahrnehmung beginnt. Die Wahrnehmung ist das eine, das der Geist tut, und die Reflexion an diesen Wahrnehmungen ist das zweite. Aber ohne Wahrnehmungen gibt es auch keine Reflexion. So sind die Wahrnehmungen das Grundlegende. Das ist reiner Empirismus. Nun aber sind Wahrnehmungen solche doch nur insoweit, als wir sie bewußt erfassen. Daher ist unsere innere Tätigkeit Voraussetzung der Wahrnehmungen. Und so entsteht ein gegenseitiges Sichbedingen: ohne Sensation keine Reflexion, und ohne Reflexion keine Sensation. Das letztere aber liegt auf dem Gebiete des Sensualismus. Unser Inneres erst macht die Wahrnehmungen zu dem, was sie sind. Und als solche sind sie in unserem Inneren durchaus real.
Ob sie auch objektive Realität haben, muß die Verbindung der Wahrnehmungen unter dem Einfluß der Reflexion entscheiden. Dann zeigt sich, daß manche Wahrnehmungen nicht den Dingen selbst anhaften, sondern nur durch Eindrücke von ihnen auf uns hervorgebracht werden, wie Farben, Töne, Gerüche, Wärme, Kälte usf. Anderen dagegen, wie Festigkeit, Ausdehnung, Figur, Ruhe, Bewegung, schreibt Locke objektive Wahrheit zu, sie sind wirklich. Selbst Raum, Zeit und Zahl gehören dazu. Hier haben wir einen Realismus und Positivismus. „Weil unsere Sinne außerstande sind,[S. 405] irgendwelche Ungleichheit zwischen der in uns entstandenen Idee und der Beschaffenheit des sie hervorbringenden Objekts (das Objekt selbst, nicht das Ding-an-sich, wie der Herausgeber meint) zu entdecken, so sind wir zu der Vorstellung geneigt, daß unsere Vorstellungen Ebenbilder von etwas in den Objekten Enthaltenem und nicht die Wirkungen gewisser in der Modalität ihrer primären Eigenschaften liegender Kräfte seien, mit welchen primären Eigenschaften die in uns entstandenen Ideen keine Ähnlichkeit haben.“ Das letztere klingt freilich idealistisch gesprochen. Und an einer weit davon entfernten Stelle wird gesagt: „Offenbar erkennt der Geist die Dinge nicht unmittelbar, sondern nur vermittelst der Ideen, die er von ihnen hat. Unser Wissen ist deshalb nur so weit real, als eine Übereinstimmung zwischen unseren Ideen und der Realität der Dinge besteht. Was soll aber hierfür als Kriterium dienen? Woran soll der Geist, wenn er nichts als seine eigenen Ideen wahrnimmt, deren Übereinstimmung mit den Dingen selbst erkennen?“ Locke glaubt sich helfen zu können, indem er die Art der Ideen in Betracht zieht. Er hatte gleich im Anfang seines Werkes einfache Ideen (simple ideas) von komplexen (complex ideas) unterschieden und zu jenen alle Ideen gerechnet, denen Wahrnehmung durch die äußeren Sinne (einen Sinn oder mehrere Sinne zugleich) entspricht, oder durch den inneren Sinn allein (Denken, Fühlen usf.), oder durch beide Sinnenarten zusammen (Lust, Schmerz, Kraft, Existenz, Einheit). Auf diese einfachen Ideen stützt er sich. Nach seiner Lehre kann der Geist keine von ihnen aus sich selbst hervorbringen; er ist nur reflexiv beteiligt, ihre Entstehung verdanken sie Eindrücken (s. oben). Also müssen sie „notwendigerweise das Erzeugnis von Dingen sein,“ „die auf natürlichem Wege auf den Geist einwirken und an ihm eben die Wahrnehmung hervorbringen, wofür sie durch die Weisheit und den Willen des Schöpfers bestimmt und eingerichtet sind. Daraus folgt, daß die einfachen Ideen nicht Erdichtungen unserer Phantasie, sondern die natürlichen und regelmäßigen Erzeugnisse von Dingen außer uns sind, die tatsächlich auf uns einwirken, und daß[S. 406] sie also die ganze beabsichtigte oder für unseren Zustand erforderliche Ähnlichkeit an sich tragen.“ Die Einführung Gottes zum Beweise der Realität der Dinge entspricht dem Verfahren des Descartes (S. 337). Selbst die komplexen Ideen, mit Ausnahme der Idee von der Substanz (Materie) sollen zu dem gleichen Schluß führen. Unserer eigenen Existenz sind wir intuitiv gewiß. Gottes Dasein können wir mit Gewißheit erkennen. Und der Beweis dafür wird wie immer aus den ihm zugeschriebenen Eigenschaften entnommen. Indessen auch von der Welt; er ist also ontologisch und kosmologisch. Sonst entscheidet überall einzig die Vernunft in Verbindung mit der Wahrnehmung.
Der Raum wird als ein eigenes Reales angesehen, also ist auch ein von Körpern freier Raum zugestanden. Die Zeit wird durch die Folge unserer eigenen Ideen gewonnen. Hier ist der Gedankengang von hohem Interesse. Erst haben wir in unserem Inneren die Idee der Sukzession; in unser Bewußtsein kommt einiges, anderes verschwindet. Ein Abstand zwischen den Teilen der Sukzession ist die Dauer. Indem wir ferner „gewisse Erscheinungen in bestimmten regelmäßigen Dauern sinnlich wahrnehmen, erlangen wir die Ideen von bestimmten Längen oder Maßen der Dauer, wie Minuten, Stunden, Tagen, Jahren usf.“ Nun können wir in unserem Sinn Dauern wiederholen, so kommen wir dazu, „uns eine Dauer vorzustellen, wo nichts wirklich fortdauert oder besteht“. Indem wir Maße von Dauern immer weiter aneinanderfügen, gelangen wir zu dem Begriff der Ewigkeit. Endlich: „durch die Betrachtung irgendeines Teiles der unendlichen Dauer, als abgegrenzt durch periodische Maße, kommen wir zu der Idee dessen, was wir im allgemeinen die Zeit nennen“. Hier wirkt Inneres und Äußeres. Und ich glaube, nichts zeigt so klar, wie wenig angeborene Ideen entbehrt werden können, als diese mühsame und nach Außen und nach Innen schwingende Ableitung der Zeit. Sofern die Reflexion nur an Wahrnehmung anschließen soll, möchte man der Zeit Realität zusprechen. Aber sie scheint mit gleichem Rechte auch idealistisch aufzufassen zu sein, da ja die Reflexion wieder Bedingung der[S. 407] Wahrnehmung ist, also auch der Folge in den Wahrnehmungen. Von der Materie (Substanz) wird gesagt, daß wir von ihr „im allgemeinen keine klare Idee“ haben. Weil wir von körperlichen Substanzen, „wie Pferd, Stein usf. reden und an sie denken, so ist zwar unsere Idee von jeder derselben nur die Verknüpfung oder Zusammenfassung einer Mehrzahl einfacher Ideen von sinnlichen Eigenschaften, die wir gewohnt sind in dem Pferd oder Stein genannten Dinge vereinigt zu finden; weil wir uns aber nicht denken können, wie sie jede für sich oder eine durch die andere bestehen sollten, so setzen wir voraus, daß sie durch ein gemeinschaftliches Subjekt existieren und getragen werden, und diese Stütze bezeichnen wir mit dem Namen „Substanz“, obgleich wir sicherlich von dem Dinge, das wir voraussetzen, keine klare oder deutliche Idee haben.“ Also ist die Substanz als solche idealistisch gedacht. Dagegen haben wir vom „Geiste“ „eine ebenso klare Idee wie vom Körper“. Mit demselben Recht, mit dem wir dem Körper Realität zuschreiben, können wir auch die Realität des Geistes behaupten. Der Geist scheint fast substantiell gedacht zu sein, denn es wird ihm Bewegungsfähigkeit zugeschrieben. Es heißt: „Denn da meine Seele, so gut wie mein Körper, ein reales Wesen ist, so ist sie gewiß ebensogut wie der Körper imstande, ihren Abstand von einem anderen Körper oder Wesen zu verändern, und also der Bewegung fähig.“
Von David Hume (bei Edinburg 1711 geboren, 1776 gestorben), der als der bedeutendste Philosoph Englands anerkannt wird, haben wir in anderem Zusammenhange bereits gesprochen (S. 358). Hier kommt es auf seinen Empirismus und Sensualismus an. Er geht insofern nicht so weit wie Locke, als er Begriffe auch a priori anerkennt. Sein für uns in Betracht kommendes Hauptwerk ist „Enquiry concerning human understanding“ (ich zitiere nach der deutschen Ausgabe der Philosophischen Bibliothek). Für Humes Anschauungen von Wichtigkeit ist seine Unterscheidung zwischen Eindrücken und Gedanken oder Vorstellungen. Eindrücke (impressions) sind „alle unsere lebhafteren Auffassungen,[S. 408] wenn wir hören, sehen, tasten, drücken, wünschen, wollen.“ Gedanken oder Vorstellungen (ideas, perceptions) sind die weniger lebhaften Auffassungen, „deren wir uns bewußt werden, wenn wir uns auf eine jener oben erwähnten Wahrnehmungen oder Regungen besinnen“. Vorstellungen sind also immer „einem gleichartigen Eindruck nachgebildet“. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel, indem die Einbildung Vorstellungen in einer Reihe von Vorstellungen auch ohne voraufgegangenen Eindruck aus benachbarten Vorstellungen zu ergänzen vermag, zum Beispiel eine besondere, nie gesehene Farbe in einer Farbenskala, wo sie fehlt. Hume führt diesen Fall selbst an; aber er legt diesen Ausnahmen kein Gewicht bei, vielleicht weil die Ergänzung lediglich eine Mittelung aus den einschließenden bekannten Vorstellungen ist. Versteht man nun unter angeboren das, „was ursprünglich, das heißt von keiner vorangegangenen Auffassung das Abbild ist, dann können wir wohl behaupten, daß alle unsere Eindrücke angeboren und unsere Vorstellungen nicht angeboren sind“. Wir würden uns im Kreise bewegen, wenn wir nicht umgekehrt sagen wollten: Es gibt Seelentätigkeiten, die angeboren sind, wie die Wahrnehmungen, der Wunsch, der Wille (Humes Ausdrucksweise ist zu unbestimmt, um die Reihe in seinem Sinne selbst fortsetzen zu können), diese nennen wir Eindrücke; und es gibt weiter Tätigkeiten, die nicht angeboren, sondern Abbilder jener Tätigkeiten sind, diese heißen Gedanken oder Vorstellungen. Hume legt aber auf die Unterscheidung zwischen angeboren und nichtangeboren anscheinend gar keinen Wert. Wie Eindrücke die Grundlage der Vorstellungen sind, so können sie ihrerseits wieder Eindrücke hervorrufen, diese wieder Vorstellungen veranlassen usf. Aus den Eindrücken folgen die Tatsachen. Alle Denkakte, die Tatsachen betreffen, „scheinen sich auf die Beziehung von Ursache und Wirkung zu gründen“. Aber Hume sagt: „Ich wage es, als einen ausnahmlosen Satz hinzustellen, daß die Kenntnis dieser Beziehung in keinem Falle durch Denkakte a priori gewonnen wird; sondern daß sie ganz und gar aus der Erfahrung stammt, indem wir finden, daß gewisse Gegen[S. 409]stände beständig in Zusammenhang stehen.“ Die Beispiele, die Hume wählt — ein Mann, dem ein gänzlich fremder Gegenstand vorgelegt wird, würde nicht imstande sein, trotz genauester Prüfung, „irgendwelche von seinen Ursachen oder Wirkungen zu entdecken“. Adam hätte „aus der Flüssigkeit und Durchsichtigkeit des Wassers nicht herleiten können, daß es ihn ersticken, noch aus der Helligkeit und Wärme des Feuers, daß es ihn verzehren würde“ — zeigen aber deutlich, daß es sich für Hume nicht um den Ursächlichkeitsbegriff handelte, sondern allein um objektive Ursache und Wirkung. Seine Behauptungen enthalten also keineswegs eine Ableugnung des Kausalitätsbegriffes, sondern nur der Möglichkeit, besondere Ursachen und Wirkungen allein aus der Vernunft zu erkennen. Und darin muß jeder beistimmen. Die Kausalität außer der Erfahrung sagt ja nicht, das und das wird aus dem und dem geschehen, sondern: was geschieht, geschah und geschehen wird, ist eine Folge von irgend etwas; wir sehen alles als Folge von etwas an; nicht, wir erwarten Dieses als Folge von Jenem. Letzteres kann selbstverständlich nur durch Erfahrung gerechtfertigt werden. Ja, man muß Hume beipflichten, wenn er weiter meint, wir hätten auch aus der Erfahrung noch kein Recht, aus bestimmten Ursachen auf bestimmte Wirkungen zu schließen, selbst wenn wir so und so oft die Wirkungen haben eintreten sehen. „Vergeblich behauptet man, die Natur der Körper aus vergangener Erfahrung kennen gelernt zu haben. Ihre verborgene Natur und alle ihre Wirkungen können wechseln, ohne jeden Wechsel in ihren sinnlichen Eigenschaften“. Und er sagt ferner: „Diese Verknüpfung also (daß wir in einer Reihe von Fällen Ereignisse stets im Zusammenhange sehen), die wir im Geist empfinden, dieser gewohnheitsmäßige Übergang von einem Gegenstand zu seinem üblichen Begleiter, ist das Gefühl oder der Eindruck, nach dem wir die Vorstellung von Kraft oder notwendiger Verknüpfung bilden. Weiter steckt nichts dahinter“. Gleichwohl glaube ich, daß diejenigen zu weit gehen, welche Hume den Ursächlichkeitsbegriff als solchen ablehnen lassen; von diesem Begriff ist bei ihm, wie bemerkt, gar keine[S. 410] Rede; er lehnt nur ab, daß wir je ohne Erfahrung Verknüpfung zwischen Erscheinungen ermitteln können, und daß wir je, wo wir Verknüpfungen festgestellt haben, mit Gewißheit sie auch für nicht festgestellte Fälle in der Vergangenheit oder für die Zukunft behaupten können. Deshalb wird Ursache auch noch anders definiert, als ein „Gegenstand, dem ein anderer folgt, und dessen Erscheinen stets das Denken zu jenem anderen führt“. Somit ist das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung entweder reine Tatsachenbehauptung — auf diese Schwingung folgt dieser Ton, und allen gleichgearteten Schwingungen sind gleichgeartete Töne gefolgt — oder eine Denkfolge — auf diese Schwingung folgt dieser Ton, beim Erscheinen dieser Schwingung greift der Geist vor und bildet die Vorstellung des Tones —. Außer diesen beiden Gesichtspunkten, meint Hume, haben wir für die Beziehung von Ursache und Wirkung keine Vorstellung. Der erste Gesichtspunkt geht auf unmittelbar Erfahrenes, der zweite auf Erwartetes. Letzterer betrifft selbst nach Hume einen geistigen Akt. Die beiden Gesichtspunkte sollen in gleicher Weise auch für psychische Erscheinungen gelten. Eine Art gewohnheitsmäßiges Schließen des Geistes sei es, das beide Fälle umfaßt. Von denselben Gesichtspunkten aus ist, was Hume über das „Wunder“ sagt, höchst interessant und bedeutend. Die Vernunft spricht hier gar nicht mit, sondern nur der Glaube. Er nennt die Leute gefährliche Freunde oder versteckte Feinde, die es unternommen haben und unternehmen, die christliche Religion mit den Prinzipien der menschlichen Vernunft zu verteidigen. „Unsere allerheiligste Religion gründet sich auf Glauben, nicht auf Vernunft.“ Die gleiche Ruhe des Denkens trägt die Untersuchungen über Vorsehung und zukünftiges Dasein. Beides wird in das Gebiet des Glaubens verwiesen. Vernünftigerweise haben wir kein Recht, sie zu behaupten. Bei der Vorsehung, die die Weltordnung umfaßt, sind es nur Tatsachen, die wir vor uns haben, und die zurück auf eine allgemeine Ursache zu führen wir durch nichts rechtfertigen können. Zu der Annahme eines Jenseits veranlassen uns gleichfalls nur Tatsachen, daß[S. 411] nämlich vieles nicht genügend belohnt oder bestraft wird, sogar Gutes bestraft, Übles belohnt sich findet. „Daher all die fruchtlosen Bemühungen, Rechenschaft über die Erscheinungen des Übels in der Natur zu geben und die Ehre der Götter zu retten (Hume läßt einen Athener sprechen), während wir doch die Tatsache des Bösen und des Wirrens, woran die Welt so überreich ist, anerkennen müssen.“ Außer Ursache und Wirkung haben wir als Vorstellungsverknüpfungen noch Ähnlichkeit (und Kontrast) und Berührung in Zeit oder Raum. Es sind dieses die drei Assoziationsprinzipe.
Die ganze Anschauung ist eine Tatsachenanschauung, sowohl in bezug auf das äußere wie auf das innere Leben, ein Positivismus. Der reinen Vernunft wird fast nichts eingeräumt. Alles ist eine Häufung von äußeren assoziierten Erscheinungen und inneren assoziierten Erscheinungen. Wie für die äußeren Tatsachen keine allgemeine Ursache behauptet wird, so für die inneren keine allgemeine Seele. Von dieser subjektlosen Psychologie habe ich bereits gesprochen (S. 359, 400). Nur eine Art „Ich“ wird anerkannt und die Welt so gesetzt, wie sie sich bietet. Sensualistisch ist diese Anschauung, weil alle Vorstellungen durchaus nicht ohne Eindrücke sein sollen. Freilich werden zu diesen Eindrücken auch psychische gerechnet, so daß der Sensualismus in der Tat kein vollständiger ist, sondern mit Idealismus sich überdeckt.
49. Die weitere Entwicklung.
Die in gewaltigen Strömen sich ergießenden Anschauungen des Materialismus und des Idealismus hemmten die weitere Entwicklung der vorstehend behandelten Ansichten. So haben wir denn aus früherer Zeit nur noch einen namhafteren Sensualisten vorzuführen, der nicht zugleich Materialist gewesen ist, Etienne Bonnot de Condillac (in Grenoble 1715 geboren, 1780 gestorben). Und selbst er gehört nicht ganz hierher, da er nicht allein sensualistisch, sondern auch idealistisch urteilt. Unser Geist entwickelt sich aus[S. 412] unseren Lebensbedürfnissen, zu denen noch das Bedürfnis der Erfüllung unserer Neugier kommt. Angeborene Begriffe haben wir nicht; die Begriffe dienen überhaupt nur zur Klassifikation der Dinge. Eigenheiten unseres Geistes, wie Wahrnehmen, Denken, Wollen usf., als Ursprüngliches gibt es nicht, nur erworbene Fertigkeiten, Gewohnheiten (habitudes acquises). Unsere Sinne sind das Prinzip unserer Kenntnisse; mit den Sinnen beginnen sie und durch die Sinne vervollkommnen sie sich. Die Aufmerksamkeit ist eine im Gewirr von Empfindungen hervortretende Empfindung, also ein höherer Grad der Lebhaftigkeit einer Empfindung. Das ist auch das Bewußtsein in seinen beliebigen Abtönungen. Unsere Empfindungen können nicht bloß einmal zugleich sein, sondern auch beisammen hintereinander, indem eine ihre Spur zurückläßt; alsdann haben wir die Erinnerung. Diese aber ist eine Vergleichung. Und so kommen wir zu Lockes Reflexion neben der Sensation. Condillac will also über Locke hinaus vereinfachen, die Reflexion aus der Sensation entstehen lassen. Daß dieser Versuch als ein mißglückter bezeichnet werden muß, ist klar, denn: „eine lebhafte Empfindung ist Aufmerksamkeit“ und „Empfindungen lassen Spuren zurück“ sind doch nur Redewendungen. Das erhellt noch mehr, wenn unserem Geist Freiheit in der Kombination der Empfindungen gelassen wird. Wir haben aber nur den Sinnen und dem, was sie uns zuführen, der Natur, zu folgen. Somit können wir nie auf den Grund der Erscheinungen kommen; die einzigen Grundlagen aller Wissenschaft sind nur Tatsachen. Auch unsere Empfindungen durch die Sinne sind nur solche Tatsachen; die einfachen Ideen, die sie bieten, lassen sich nicht erklären. Nur die komplexen Ideen können wir auseinanderwickeln, analysieren. Alle Empfindungen sind nur Modifikationen unseres Ich. Hier spielt ein innerer Sensualismus als Phänomenalismus hinein, „die Seele ist es, die empfindet, ihr allein gehören die Empfindungen an“. „Unsere Empfindungen existieren außer uns nicht.“ Und so verbindet sich Condillacs Positivismus auch mit Dualismus, sogar mit Deismus, da einerseits zwischen Körper und Geist[S. 413] unterschieden wird und andererseits alles Bestimmende, der Materie wie der Seele, von Gott kommen soll. Da nun Körper und Geist absolut verschieden sein sollen und in Gott auch nicht Vereinigung finden, so gelangt Condillac zu einem okkasionalistischen (S. 336) Sensualismus und einem freien Psychismus. Man sollte nun glauben, daß das Ich eine besondere Bedeutung hat. Keineswegs! Das Ich wird erst erkannt aus der Folge der Empfindungen, und es ist nur „eine Sammlung von Empfindungen, die es erfährt, und solcher, die das Gedächtnis ihm in Erinnerung bringt“. Für die Erkenntnis der Außenwelt hat er sein berühmtes Beispiel der Statue erfunden, die er allmählich mit allen Sinnen begabt. Er findet, daß nur das Tastgefühl uns eine Außenwelt gewiß macht, die übrigen Empfindungen können es nicht tun. Nicht einmal unser eigenes Körperbewußtsein vermöge uns unseren Körper zu sichern; nur wenn wir ihn betasten, haben wir ihn. Trotz dieser sehr mangelhaften Erweisung der Körperwelt, sieht Condillac diese als sicher an; er ist darin dogmatischer Realist. Es ist erstaunlich, was man alles als Sensualist sein kann! Selbst wenn man ein so methodischer Kopf ist, wie Condillac sich anscheinend überall durch seine fast minutiösen Analysen und Synthesen zeigt.
Zu den Sensualisten werden noch Hemsterhuis, Montesquieu, ja Rousseau gezählt, aber mehr in der Weise wie Männer, die sensualistisch denken, nicht sensualistische Systeme errichten. Vielleicht ist bei Rousseau (1712 zu Genf geb., 1778 gest.) aus seinem Sensualismus seine berühmte Vorliebe für den Naturzustand abzuleiten und seine Feindschaft gegen die Reflexion, die er weit gegen die Sensation zurückstellt und der er doch bei jeder Gelegenheit so huldigt, wie dem menschlichen Gefühl und Hochdenken. Im 19. Jahrhundert haben wir zunächst in Beneke (1798–1854) einen Realisten nach Art der vorgeführten zu sehen. Auch für ihn gibt es keine angeborenen Begriffe an sich, wohl aber die Fähigkeit, Begriffe herzustellen. Man hat bisher darin gefehlt, meint er, „daß man die in der ausgebildeten Seele hervortretenden Formen als schon vor der Erfahrung, oder bestimmter, vor der Entwicklung der Seele[S. 414] gegebene (angeborene) voraussetzt. Dies ist falsch: Die Formen, welche für die Erkenntnis zunächst vorliegen, sind erst in der Entwicklung der Seele entstanden, vor derselben nur prädeterminiert in angeborenen Anlagen und Verhältnissen, welche ganz andere Formen an sich tragen“.
Diese, übrigens nicht neue, Auffassung hat viele begeisterte Anhänger gefunden, namentlich in der neuesten Zeit, da der Führer der modernen Sensualisten, Ernst Mach, sie anerkannt hat. Aber wie wenig sie erklärt und wie sehr sie eigentlich nur ein Spiel mit Worten ist, erhellt, glaube ich, genügend aus dem bisher Vorgetragenen. Seit Aristoteles seine potentiellen Eigenschaften erfunden und in die Welt gebracht hat, spuken sie in allen Wissenschaften, selbst in den exakten, trotz der so bestimmten Aufklärungen, die Kant uns über sie gegeben hat. Ich setze mit einem Wirklichen nicht mehr als mit einem Potentiellen, das Wirklichkeit wird. Und ein Potentielles, das Wirklichkeit nicht wird, hat für Erklärungen, für Einsichten gar keinen Wert. Es ist nur ein Streit um Worte, veranlaßt durch das Mißverständnis, als wenn wir von allem, was wir enthalten, in jedem Moment durchaus die gleiche intensive Kenntnis haben müßten. Auf diese Weise ist für uns alles potentiell, und zwar in jedem Moment; wir, die Welt, die Eindrücke, unser Gehen, Stehen usf., denn dies alles ist uns durchaus nicht immer in gleicher Weise gegenwärtig, und es lohnt nicht, überhaupt über etwas nachzudenken. Wir wenden im ausgebildetsten Zustand immer nur einzelnes an, sind uns mitunter unseres Körpers, der ganzen Umgebung nicht bewußt, folgen einem fremden Wollen, einem verborgenen Fühlen. Gleichwohl ist doch alles in unserer Seele da, und wir benutzen es sofort, sobald wir dazu gezwungen werden oder es wollen. Sofort empfinden wir dann, und empfinden wir räumlich und zeitlich und kausal. Sofort bei der Geburt empfindet das Kind Hunger, Durst, Schmerz, Sättigung usf. Es urteilt noch nicht logisch, aber schon kausal; es hat den Raumbegriff, denn es führt Gegenstände zum Mund und sucht die Brust der Mutter. Das gilt alles[S. 415] für das Kind wie für das Tier, und das nennt man eben angeboren. Die Fähigkeiten würden dem Kinde gar nichts nützen, es wüßte selbst nach dem ersten Schluck aus der Mutter Brust nicht, daß es weitersaugen soll, um den Hunger zu stillen, wenn es den Kausalbegriff nicht hätte. Daß wir lange Zeit nicht darauf kommen, was wir besitzen anzuwenden, hat mit dem Besitz nichts zu schaffen. Erwerbung sagt rein gar nichts, sondern drückt nur die Tatsache aus, daß Gleiches allgemein Gleichem gleicht. Es gibt eben Dinge in der Welt, die man nicht ableiten kann, weil sie schon das Einfachste sind. Etwas muß doch da sein; wenn auch nur die Mittel, daß wir überhaupt existieren, überhaupt wahrnehmen, fühlen, denken usf. Wenn dieses Etwas nicht von vornherein vorhanden ist, so kann ja niemals ein Anfang gemacht werden, denn zu diesem Anfang, so unbestimmt und dunkel er sein mag, gehört ja schon das Etwas. Es mag einer noch so schlecht gehen, so muß er seine Beine doch dazu haben; hat er sie nicht, oder nur potentiell, indem sie ihm im Körper stecken, so kann er nicht einmal auf die miserabelste Weise auch nur den kleinsten Schritt tun. Ohne angeborene Eigenheiten gibt es gar keinen Anfang des Lebens, das Leben würde sofort zu Grunde gehen. Welche Eigenheiten man als angeboren annehmen soll, und ob bei allen Wesen die gleichen, darüber kann gestritten werden; aber nicht, ob überhaupt Eigenheiten als angeboren anzunehmen sind (S. 362).
Um auf unseren Philosophen zurückzukommen, so leitete er alle psychischen Vorgänge aus Grundvorgängen ab: aus Reizaneignung, das heißt Empfindung und Wahrnehmung, den „Urvermögen“ der Seele; aus Umbildung zu neuen Urvermögen; aus Assoziation und Nachklang der Reizaneignung; aus Kombination. Diese Vermögen, ihr Wirken und Zusammenwirken sind die Seele. Es ist also abermals eine Art assoziative Psychologie, aber doch mit einem, wenn auch im Hintergrund wirkenden Ich.
In dem gleichen Jahre wie Beneke ist auch Auguste Comte (zu Montpellier) geboren, der eigentliche Positivist des 19. Jahrhunderts, ehe er durch Krankheit in Mystizismus[S. 416] verfiel, in dem er 1859 zu Paris starb. Seine „Philosophie positive“ ist ein Grundwerk. Die Metaphysik mit ihren Ideen und Kategorien wird von vornherein abgelehnt; sie ist nur eine Scheinwissenschaft, eine Art Theologie. Drei Folgen des Denkens nennt Comte. Zuerst sieht der Mensch in und hinter den Dingen Persönlichkeiten. Wir kennen diesen Zustand schon und haben ihn im ersten Buch eingehend dargelegt. Später verlieren die Persönlichkeiten das Persönliche allmählich und gehen zuletzt, soweit sie noch übrig gelassen werden, in metaphysische Begriffe über. „Sie (die Scheinwissenschaft) setzt ihre Kategorien an die Stelle der Dämonen; aber sie hört nicht auf, Entitäten, das heißt erdichtete Wesenheiten, im Hintergrunde der Erscheinungen vorauszusetzen“ (E. Dühring, Geschichte der Philosophie). Das soll sich wohl auf die Dinge-an-sich beziehen. Im dritten Stadium wendet sich das Denken dem zu, was ist, der rein positiven Betrachtung der Welt. Comte hat von diesem Gesichtspunkt aus die bekanntesten Wissenschaften: Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Astronomie, Physiologie, Gesellschaftslehre behandelt. Es ist eine „Hierarchie der positiven Wissenschaften“, die Wissenschaften werden positiv-induktiv vorgeführt. Für die Welt- und Lebenanschauung ergibt sich fast nichts; nur daß Comte das geistige Leben von der Physik und Chemie doch geschieden hat, verdient besondere Erwähnung. Er erkennt bloß an, daß in diesem Leben physische Vorgänge als Momente eintreten. Das Leben selbst aber ist etwas anderes als diese Vorgänge, aus ihnen nicht zu begreifen und als etwas für sich nach seinen Positiven zu studieren. Comte hat viele Nachfolger in Frankreich, England wie Deutschland gehabt.
Bei uns der bedeutendste Positivist ist Eugen Dühring (geb. 1833) ein Mann, so scharfsinnig in kritischen Untersuchungen wie wissenschaftlichen Entdeckungen; die Physik verdankt ihm eines ihrer sichersten und schönsten Gesetze. Seine „Wirklichkeitsphilosophie“ betrachtet alles: Raum, Zeit, Welt wie wir es uns vorstellen, nach Maßgabe wohl des Zusammenwirkens aller Sinne. Aus dem „Gesetz der bestimmten Anzahl“ wird geschlossen, daß, wenn der Raum[S. 417] unbegrenzt sein sollte, doch die Welt der Dinge begrenzt ist, und auch, daß sie zeitlich einen Anfang gehabt hat, soweit wenigstens es sich um Vorgänge handelt. Vor diesem Anfang bestand also ein vorgangloses Sein. In diesem Urzustande können gleichwohl Verschiedenheiten in den Dingen und Zuständen vorhanden gewesen sein, nur zeitliche Folgen davon nicht. Diese sind aus diesem Zustande heraus entstanden und entwickeln sich nun immer weiter. Aber alles Beharrliche oder nach Beharrung strebende haben wir als aus diesem Urzustande noch überkommen oder zurückgeblieben anzusehen. War einmal ein Anfang zu den Geschehnissen unserer Welt, so können sich Anfänge zu neuartigen Geschehnissen noch einstellen. Das Ganze stellt aber eine Entwicklungsreihe dar, und zwar aus der Natur selbst heraus, ohne Zuhilfenahme einer höheren Macht. Und die ganze Natur ist eine Einheit. Man wird unwillkürlich an die Anschauungen der ionischen Naturphilosophen erinnert. Dem Anfang kann ein Ende entsprechen, etwa ein Zustand analog dem Urzustand. Jedoch sei ewige Wiederholung des Gewesenen nicht ausgeschlossen. Eine Seele als Sondergegenstand wird nicht zugestanden, wohl aber werden Kräfte in der Natur angenommen. Zwischen der inneren Welt und der äußeren Welt besteht ein Parallelismus. Manches wird mechanistisch aufgefaßt, wie daß alle Subjektivität aus Widerstandsempfindungen und das Bewußtsein aus einem Antagonismus mechanischer Kräfte stammen soll. Das eigenartigste ist der „Urzustand“. In einer Wirklichkeitsphilosophie darf man über ihn nicht hinausgehen. Aber wer kann sich dabei beruhigen? Wir sprechen noch davon. Auf weiteres in Dührings Philosophie einzugehen, muß ich mir versagen, sie betrifft mehr die Lebensbetrachtung.
Von den modernsten Sensualisten und Positivisten nenne ich nur Ernst Mach (geb. 1838) als den tonangebenden. Seine Schriften sind, wie die des ihm ähnlichen Poincaré, voll Geist und einer erdrückenden Menge von Tatsachen. Worin er bestimmt ist, folgt er namentlich Hume, Kant, Beneke und Wundt. Indem er aber die tieferen Untersuchungen als „Scheinprobleme“ ablehnt, kann er trotz seines Positivismus[S. 418] und Sensualismus doch kein befriedigendes System geben. Und wenn er so viele Nachbeter hat, so ist der Grund, daß seine „wissenschaftliche Ökonomie“ so bequem ist. Der Mann selbst hat sie gar nicht geübt; er ist nicht einmal den Scheinproblemen aus dem Wege gegangen — das kann nämlich überhaupt kein ernst denkender Mensch, der nicht einfach Heusammler sein will —. Aber es folgt eine Koterie seinen Spuren, die, den Lehrer mißverstehend und übertreibend, fast alles verdammt, was wie Verletzung der „wissenschaftlichen Ökonomie“ ausschaut, und alle Theorie und Spekulation mit der törichtesten Ironie verfolgt, weil sie den Freipaß des Meisters zu haben glaubt, nicht über das Positive hinaus gehen zu brauchen, ja nicht hinaus gehen zu sollen. In der Beurteilung des Machschen Positivismus und Sensualismus kann ich mich nur Max Planck (S. 442) anschließen. Wir wollen aber erst einiges darüber sagen. Das meiste werde ich der Hauptschrift Machs „Erkenntnis und Irrtum“ entnehmen. „Wir sind ebensolche Dinge wie die Dinge der physikalischen Umgebung, die wir durch uns selbst auch kennen lernen.“ Es wird uns aber eine gewisse Stabilität zugeschrieben, also eine Art Ich. Dieses Ich ist die Gesamtheit der untereinander zusammenhängenden Vorstellungen, also „dasjenige, was nur für uns allein vorhanden ist“. Das wäre innere, assoziative Auffassung. Die Stabilität der Gedanken, also das Ich, aber wird erklärt, indem sie auf die Stabilität der Tatsachen schließen läßt, diese Stabilität voraussetzt, von dieser Stabilität ein Teil ist. Daß diese drei Bestimmungen nicht das gleiche besagen, ist klar. Die dritte steht sogar im Gegensatz zu den beiden ersten, denn wenn etwas ein Teil von einem anderen ist, so kann es dieses nicht voraussetzen, noch darauf schließen lassen. Ein Stück eines Körpers ist ein Teil von ihm; aber von dem Stück kann ich weder auf den Körper schließen, noch ihn voraussetzen. Die Schwierigkeit und Unbegreiflichkeit liegt hier genau da, wo sie sich bei den materialistischen Anschauungen allgemein befindet. Ich verweise, um nicht zweimal dasselbe zu sagen, auf die Ausführungen im letzten Abschnitt dieses Buches.
Ich und die Welt werden in Eins betrachtet: „Ein iso[S. 419]liertes Ich gibt es ebensowenig, als ein isoliertes Ding.“ Ding und Ich sind provisorische Fiktionen gleicher Art. Das Physische und Psychische enthalten gemeinsame Elemente. Zwar wird die „solipsistische Position“, das heißt der Phänomenalismus als solcher abgelehnt. Aber wir haben „die Elemente der realen Welt und die Elemente des Ich zugleich vor uns. Was uns allein noch weiter interessieren kann, ist die funktionale Abhängigkeit (in mathematischem Sinne) dieser Elemente voneinander“. Diese funktionale Abhängigkeit kann ein Ding genannt werden. Also wir und die ganze Welt, wir können beides Dinge nennen, sind eine funktionale Abhängigkeitsreihe. Die Grundlage bilden die Sinnesempfindungen; von ihnen geht alles intellektuelle Leben aus, und zu ihnen kehrt es zurück. Die sinnlichen Vorstellungen sind die „psychischen Arbeiter“; die Begriffe, aus ihnen und ihrem Zusammenhang stammend (sie sind auch Zusammenfassung der Tatsachen), sind die „Ordner und Aufseher“, welche die Scharen jener Arbeiter „auf ihren Platz stellen und ihnen ihr Geschäft anweisen“. „Die Sinnesempfindungen sind eben die eigentlichen ursprünglichen Motoren, während die Begriffe sich nur auf jene (die Sinnesempfindungen), oft nur durch andere begriffliche Zwischenglieder berufen.“ Wenn das nicht bloß Poesie sein soll, so muß das innere Leben mit dem äußeren automatisch aufgefaßt werden. In der Tat sagt auch Mach: „Das fest Bestimmte, Regelmäßige, Automatische ist der Grundzug des tierischen und menschlichen Verhaltens“, a fortiori natürlich des Verhaltens der Welt. Automatisches paßt sich an Automatisches, das es durch die Sinne zugeleitet erhält, automatisch an. Eine freie Seele läßt sich zwar nicht widerlegen, aber sie als „wissenschaftliche Hypothese“ anzunehmen oder nach ihr zu forschen, ist eine „methodologische Verkehrtheit“. Über angeborene Ideen und Kausalität denkt Mach ganz wie Hume. Über Raum und Zeit, soweit ich zu sehen vermag, wie Kant. Seine Unterscheidung der verschiedenen Raum- und Zeitauffassungen, begrifflich, physiologisch, mathematisch usf. ist von Interesse; ich habe darüber in meinem Buche „Philosophische Grundlagen usf.“ eingehend[S. 420] gehandelt. Die Folgen der Machschen Lehren sind die jedes übertriebenen Sensualismus; es ist alles rein subjektiv, niemand kann für sich, noch weniger natürlich für einen anderen etwas behaupten, noch ihm widersprechen. Jeder reine Sensualismus vernichtet sich notwendig selbst. Und das tut der Machsche durchaus. Verworn, dessen Auseinandersetzungen über Nerven und Gehirn man mit Interesse liest, scheint ihm philosophisch nachzufolgen.
Wir haben es mit einem Agnostizismus zu tun von der Art etwa des von Herbert Spencer vertretenen. Aber dieser steht in seinem, trotz Positivismus und Materialismus fast kirchlichen Deismus weit ab von Mach. Als Positivist ist er Evolutionist im Sinne Darwins, jedoch in bezug auf die ganze Natur, und mit starker Neigung zu den Ansichten der ionischen Naturphilosophen, indem bei ihm Konzentration und Dissipation (auch Evolution und Dissolution) eine große Rolle spielen. Das Absolute ist das Unerkennbare, eine transzendente Substanz an sich. Überhaupt ist das Wesen der Welt unerkennbar.
NEUNTES KAPITEL.
Physische Welt- und Lebenanschauungen.
Trennen wir Welt und Leben, so haben wir also eine Anschauung in bezug auf die Welt und eine solche in bezug auf das Leben. Wenn wir aber die ganze Natur, unbelebt und belebt, nur unter dem einen Gesichtspunkt des Materiellen und der in und zwischen den Materien wirkenden Kräfte und Vorgänge betrachten, so schließen wir uns an die allgemeine physische Welt- und Lebenanschauung an. Übernatürliche und geistige Wirkungen und Vorgänge werden weder für die Welt noch für das Leben angenommen, ebensowenig Stoffe, die andere Eigenschaften besitzen, als die wir an der Materie kennen. Sollten Elektrizität, Magnetismus und elektrischer Strom nicht unter der gewöhnlichen trägen Materie einzubegreifen sein, so fügen wir sie trotzdem an diese an, indem wir unter Materie als Stoff alles das[S. 421] verstehen, wovon wir rein physische Eigenschaften, also physikalisch-chemische, kennen und in unveränderlicher Weise finden. Was aber die Vorgänge anbetrifft, so dürfen wir sie zunächst in drei Typen einreihen: Bewegungen, Induktionen, chemische Umsetzungen. Über Bewegungen und chemische Umsetzungen ist nichts zu sagen. Zu den Induktionen rechnen wir solche Vorgänge, wie das Hervorrufen oder Vernichten von Elektrizität, Magnetismus, Strom. Indem wir von Umsetzungen allgemein sprechen, wollen wir diese Induktionen mit den chemischen Umsetzungen vereint denken. Und sollten wir alle drei Typen zusammen nehmen, so sprechen wir von mechanistischen Vorgängen, ohne damit sagen zu wollen, daß sie der gewöhnlichen Mechanik angehören, sie könnten auch dem Elektromagnetismus oder einem anderen Erscheinungsgebiet zuzuschreiben sein. Neuerdings hat man auch die Energien in Rücksicht gezogen, und so müssen wir von einem weiteren Typus handeln, dem der Energieumwandlungen. Ob diese, nun vier, Typen in einen Typus übergeführt werden können und in welchen, etwa in den der Bewegung oder der Energieumwandlung, hat die Wissenschaft zu ermitteln; einstweilen wissen wir noch nichts Sicheres und bleiben die Typen besser noch getrennt. Es macht auch für die folgenden Untersuchungen nichts aus, ob wir von einem Typus oder von allen Typen ausgehen. Das allein Wesentliche ist das Physische. Indessen bietet der Typus der Energieumwandlungen soviele Besonderheiten, und hat er in der Wissenschaft eine so umfassende Eigenwichtigkeit erlangt, daß wir ihn später für sich untersuchen werden. Und so wollen wir, jene drei ersten Typen vereinigend, von einer mechanistischen Welt- und Lebenanschauung sprechen, hinsichtlich des vierten Typus aber von einer energetischen, und, wo beide Anschauungen verbunden sind, von einer mechanistisch-energetischen. Materialistisch nennen wir eine Anschauung, in der alles auf Materie begründet ist. Eine solche Anschauung müssen wir, je nachdem die Seele als ein Besonderes, wenn auch gleichwohl Stoffliches, behandelt wird oder nicht, indem im letzteren Falle eine Seele überhaupt nicht[S. 422] in Frage kommt, in zwei Klassen trennen, in psychischen und in physischen Materialismus. Alle diese Namen sind nicht sehr bezeichnend; aber da sie eben erklärt sind, mögen sie, als gewohnt, so stehen bleiben. Die Geschichte des reinen Materialismus ist bekanntlich von F. A. Lange (1828–1875) in einem umfangreichen Werke behandelt. Ich darf mich darum auf die allerwichtigsten Angaben beschränken und den Raum mehr zu kritischen Bemerkungen verwenden.
50. Materialismus und Mechanismus, Atomistik.
Als bereits untersucht ist derjenige psychische Materialismus auszuscheiden, der aus naturmenschlichen Anschauungen entspringt. Wissenschaftlichen solchen Materialismus finden wir zuerst bei den Griechen. Auch davon habe ich bei mehreren Gelegenheiten schon gesprochen, und es genügt hervorzuheben, daß die Seele als stofflich angesehen wird, wie der Körper, wenn auch als feiner stofflich. So sind alle Wirkungen zwischen Seele und Welt die gleichen wie zwischen den Körpern der Welt. Und indem noch die Wirkungen zwischen den letzteren als rein mechanistisch betrachtet werden, ohne jede unmittelbare oder mittelbare Beeinflussung durch ein außer- oder übernatürliches Wesen, auch ohne jeden Vernunftgrund, erhalten wir das konsequenteste materialistische System, das von Demokritos (aus Abdera, geboren um 470, gestorben um 390 v. Chr.) begründete, einen fast vollständigen materialistischen Monismus. Stoß und Druck sind die Kräfte, Lösung und Verbindung, zusammen mit Bewegung, sind die Vorgänge. Nicht Zweck noch Zufall sind vorhanden, einzig Grund (λόγος) und Notwendigkeit (ἀνάγκη) herrschen. Andere Griechen haben Liebe und Haß, Anziehung und Abstoßung als wirkende Ursachen angenommen und Verhängnis (εἰμαρμένη) als Grund. Die Angaben sind meist sehr dunkel und unbestimmt. Da die Griechen für keine Kraft eine Regel ihrer Wirkung kannten, waren die Namen schließlich nicht mehr als Namen, wenn sie nicht aus einem allgemeinen Prinzip flossen, wie bei Empedokles, Heraklit, Anaxagoras u. a. Demokrits Druck und Stoß, oder auch Stoß allein, ist der modernen Wissenschaft wohl[S. 423]bekannt und dient noch jetzt als Grundlage für die fremdesten Kraftberechnungen.
Ehe wir weitergehen, müssen wir jedoch von der Atomistik sprechen. Sie scheint fast gleichzeitig, wenn auch in verschiedener Ausbildung, von mehreren Forschern eingeführt worden zu sein. Es ist schon von Bedeutung, daß Empedokles (aus Akragas 483–423) die Stoffe in vier Elemente (Stoicheia) Feuer, Luft, Wasser, Erde einteilte, die ihrer Beschaffenheit nach verschieden voneinander sein sollten, und aus deren Mischung er alle Körper bestehen ließ, während er die Vorgänge als Mischungen und Entmischungen ansah, veranlaßt durch Liebe und Haß. „Denn zuerst vernimm die vierfache Wurzel aller Dinge: Zeus (Feuer) der Schimmernde und Here (Luft) die Lebenspendende und Aidoneus (Erde) und Nestis (Wasser), die ihren Tränen sterblichen Lebensquell entfließen läßt.“ „Denn aus diesen Elementen entsproßt alles, was da war, ist und sein wird, Bäume und Männer und Weiber und Tiere, Vögel und wassergenährte Fische.“ Sogar Götter „langlebige an Ehren reichste.“ „Geburt gibt es bei keinem einzigen von allen sterblichen Dingen und kein Ende in verderblichem Tod. Nur Mischung gibt es vielmehr und Austausch des Gemischten“: Wäre Empedokles nicht zugleich ein großer Mystiker, so könnte er für die Welt- und Lebenanschauung als der erste ganz klare mechanistische Materialist angesehen werden. Denn Mischung und Entmischung sind mechanische Vorgänge, und Liebe und Haß (oder Streit) bedeuten kaum etwas anderes als Anziehung und Abstoßung. Das alles soll aber die Grundlage der ganzen Weltentwicklung bilden, das Leben eingeschlossen. Indessen, die Elemente wie die Kräfte werden eben mystisch dargestellt, wie ja im Grunde auch die sogenannte Ionische Naturphilosophie eine mystische ist (S. 231). Anaxagoras (S. 243) ging in der Unterteilung der Körper viel weiter. Alle Stoffe sollten aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt sein. Diese Teilchen, Samenteilchen (Spermata, σπέρματα), später Homoiomerien (ὁμοιομερῆ) genannt, sollten alle gleich groß sein, in der Be[S. 424]schaffenheit aber den Körpern gleichen, denen sie angehörten; also bei Fleisch Fleischteilchen, bei Luft Luftteilchen usf. sein. Leukippos (Zeitgenosse des Anaxagoras) faßte diese Teilchen entgegengesetzt auf; sie sollten in der Beschaffenheit gleich, in den Massen und Formen verschieden sein. Er setzte auch für sie Unteilbarkeit fest und gewann so die Atome, deren wir uns noch jetzt bedienen, und aus denen, wenn auch in ganz neuer Wendung, auch die Monaden, Realen usf. hervorgegangen sind, falls sie nicht eher den Anaxagorischen Samenteilchen entsprechen. Ich darf nicht vergessen hinzuzufügen, daß auch in Indien Atome (Paramanu) bekannt gewesen sind; das Lehrsystem des Vaiseshika führt sie als die wahrnehmbaren Körper zusammensetzend auf. Auch diese scheinen jedoch den Anaxagorischen Homoiomerien zu gleichen. Die Atomistik ist von arabischen und anderen Forschern sogar auf die Zeit übertragen worden (S. 287).
Kehren wir zu Demokritos zurück. Die Atome sind durch Leere getrennt. Ihre Zahl ist unendlich, ebenso unendlich verschieden ist ihre Schwere und ihre Form. Die feinsten Atome sind kugelig. Aus solchen feinsten Atomen ist die Seele zusammengesetzt, die darum ein äußerst Dünnes und Bewegliches darstellt. Die eigentlichen Körper sind Aggregate von Atomen, auch Mischungen von solchen, selbst mit jenen feinsten Atomen, daher auch die Körper überhaupt als mehr oder weniger belebt angesehen werden. Die Atome halten sich durch Rauheiten, Zacken, Ärmchen usf. zusammen, da Molekularkräfte noch nicht bekannt waren. Alle Wirkungen beruhen auf Bewegungen der Atome gegeneinander, also in Stoß und Druck. Auch die Wirkung des Körpers auf die Seele und der Seele auf den Körper ist keine andere. Demokritos soll sehr viel geschrieben haben; wir besitzen auch einiges von ihm, namentlich zum Teil sehr schöne Sprüche (Diels Fragmente der Vorsokratiker I2, S. 398 ff.), aber leider fast nichts von seiner Naturphilosophie. Und so sind wir auf die Berichte Anderer angewiesen, die zwar reichlich fließen, aber das Wichtigste doch unentschieden lassen, namentlich die Frage, woher die Atome ihre unregelmäßige seitliche Be[S. 425]wegung haben, da die ungleichen Massen nur geregelte Bewegungen in parallelen Linien oder nach Zentren ergeben, nicht beliebige nach allen möglichen Richtungen, die ja angenommen werden müssen, weil wir Wahrnehmungen aus allen möglichen Richtungen empfangen, und weil wir nach allen möglichen Richtungen wirken, und ja auch Bewegungen nach allen möglichen Richtungen sehen. Demokrits System, mit oder ohne Seele aus besonderen Atomen, hat im Altertum sehr viele Anhänger gefunden, namentlich unter den Sophisten und Epikureern. Epikuros, ein Samier (341–271 v. Chr.), und durchaus edel denkend und edel lehrend, übernahm zur Stütze seiner bekannten Lebensansicht jenes System fast unverändert. Doch brachte er einige Verbesserungen an. Wir sahen, daß zur Wirkung die Stöße der Atome notwendig sind. Nun kannten die Alten die allgemeine Gravitation nicht, ebensowenig die molekularen Anziehungen, sondern nur den Fall der Körper. Da aber dieser Fall im leeren Raum, wie der scharfsinnige Naturforscher Aristoteles erkannte und einwandte, für alle Atome, trotz ihrer abweichenden Massen und Formen, gleich schnell vor sich gehen muß, so können Zusammenstöße nicht erfolgen, also gerade das kann nicht stattfinden, was notwendig ist. Epikuros verlieh deshalb den Atomen eine Neigung, aus sich heraus von der geraden Bahn ein wenig abzuweichen. Alsdann können sie allerdings zusammenstoßen, Wirbel bilden usf. Der Lehre Demokrits angehörig war es auch, wenn er eine unendliche Zahl von Welten für zulässig hielt, da ja bei unendlich vielen Atomen unendlich viele Bewegungsverteilungen und Aggregationen möglich sind, nicht bloß solche wie sie unsere Welt zusammensetzen. Teleologisches schlägt Epikur so sorgfältig aus wie sein Vorgänger. Die Entstehung der Lebewesen aus der Erde, dem Schlamm, lehrte er mit so vielen anderen. Im übrigen ist er reinster Sensualist, so daß er sogar nicht anstand, Sonne und Mond für gerade so groß oder nur wenig größer, als sie gesehen werden, zu behaupten.
Seine Vollendung hat das empedokleisch-demokritisch-epikureische System durch den römischen Dichter Titus[S. 426] Lucretius Carus (wahrscheinlich 99–55 v. Chr.) erhalten, der in seinem Lehrgedicht „De rerum natura“ Anschauungen entwickelt, die von denen der modernen kinetischen Theorie der Körper sich nur noch in wenigem unterscheiden. Bernhardy, in seiner Geschichte der römischen Literatur, erklärt jenes Lehrgedicht für „eins der edelsten Denkmäler jener Literatur“, den Dichter als „einen Geist, den an Reichtum der Gedanken und der Tiefe wenige übertreffen“. Der Begriff der Zweckmäßigkeit, des Anfanges und des Endes ist völlig entfernt, entfernt ist auch der Begriff einer außer- und überweltlichen Macht und einer besonderen Seele. Einzig und allein die Atome mit ihren ewigen Bewegungen und Zusammenstößen bilden die Welt. Die Atome werden wie von Demokritos angenommen, Trennungen und Verbindungen wie von Empedokles, die Körperzusammenballungen wie von Epikuros. Alle Unterschiede zwischen den Körpern werden aus der Zahl der Atome, ihren Formen und ihren Aneinanderlagerungen erklärt. Die Atome sind auch in den Körpern in steter Bewegung, die wir nur wegen der Kleinheit dieser Atome nicht sehen; ähnlich, wie wir auch bei einer Herde aus weiter Entfernung die Bewegung der einzelnen Tiere nicht unterscheiden. Auch hinsichtlich der Entwicklung und Auflösung von Welten nach Welten, infolge der ständigen Bewegung der Atome, folgt der Römer dem Griechen. Er läßt die Welten sich stetig weiter bilden, denn im Raume überall um uns und neben uns und zwischen uns sind noch unzählige Atome, die noch nicht zu Körpern sich zusammengefunden haben. So bilden die Welten eine unendliche Kette von stetem Werden und Vergehen, wie wir das auch bei Herakleitos und anderen gesehen haben. Unendlichkeiten und Unendlichkeiten streiten gegeneinander und führen zu Unendlichkeiten. Die Seele (anima) und der Geist (animus) sind selbst körperlich, aus den feinsten, rundesten und beweglichsten Atomen bestehend. Die Seele ist in der Wärme und Lebensluft des Körpers enthalten, der Geist bedeutet einen besonders feinen Teil von ihr. Im Tode verlassen diese Atome den Körper ganz oder größtenteils; im Leben nehmen sie[S. 427] besonders alle Atomstöße von außen auf und geben ihrerseits Stöße nach außen. Da die Atome nur physikalisch betrachtet werden, so kann kein Atom für sich seelische oder geistige Eigenschaften aufweisen, also auch nicht Empfindungen haben. Woher nun die Empfindung der Lebewesen? Das wird allein aus der Ansammlung der Atome zum Körper erklärt. Diese Ansammlung erhält Eigenschaften, die den einzelnen Atomen nicht zukommen, wie auch ein Atom keine Farbe hat, ein Körper aus Atomen aber Farbe aufweist. Solche und viele ähnliche Analogien kann man allerdings anführen. Dann muß alles aus den Ansammlungen selbst erklärt werden. Da sogar unsere Wissenschaft solche Erklärungen kaum für einige der einfachsten Eigenschaften der Körper aus der Atomlehre abzuleiten weiß und sich meist mit der Angabe begnügen muß, daß Bewegung und Verteilung der Atome und Atomverbände diese Eigenschaften bewirken, wie schon die alten Atomisten behaupteten, so darf es nicht wundernehmen, wenn diese schließlich einfach auch sagten: Bewegung der Atome ist Empfindung. Auf dieses Hauptdogma kommen wir noch zu sprechen. Daß Lucretius die persönliche Unsterblichkeit ablehnen mußte, versteht sich von selbst. Der Tod hebt die Persönlichkeit, die ja durch den besonderen Komplex des Körpers mit den feinen Seelenatomen begründet ist, vollständig auf. Sobald die Seelenatome ausgetreten sind, können sie nicht mehr auf den Körper und kann der Körper nicht mehr auf sie wirken. Beide bedeuten nun zwei getrennte Atomhaufen. Nur als sich diese Atomhaufen durchdrangen, zeigte das Ganze was wir Leben nennen, eben als Ganzes. Und so gibt es auch kein Jenseits. Alle Furcht, alles Bangen, aller Schmerz und alles Leid, mit dem Tode sind sie vorbei, nichts bleibt vom Leben im Leben zurück. Daher ist die Todesfurcht so töricht und zu verwerfen. Ein Trost ist die Einsicht in den Gang der Natur, in ihre unausweichliche Notwendigkeit und absolute Gleichgültigkeit gegen alles ohne Ausnahme. Selbstverständlich gibt es weder Gott noch Götter in irgendeiner persönlichen Gestalt. Die Menschen sind nur aus Unkenntnis der wahren Grundlagen[S. 428] der Welt zur Annahme der Götter gekommen. Lucretius ist geneigt, die Religion aus der Naturbewunderung abzuleiten, und schreibt darum der ursprünglichen Religion große Reinheit zu. Die Verschlechterung sei erst später hervorgetreten. Wie weit das richtig sein kann, wissen wir bereits. Vieles andere, was sein Gedicht noch sehr Schönes und Tiefgedachtes enthält, müssen wir übergehen.
Was im Mittelalter von materialistischen und mechanistischen Anschauungen geäußert worden ist, habe ich bereits im zweiten Buche angeführt. Ein System ist nicht ausgebildet worden, weder unter Christen noch unter Arabern oder Juden; Religion und Mystizismus waren gleich hinderlich. Daß aber manche Systeme stark ans Mechanistische streiften, haben wir dort gesehen. Die neuere und die moderne Zeit haben an der Grundlage des alten Materialismus und Mechanismus nur wenig geändert und sie, und die sich anschließenden Betrachtungen, nur mehr den mittlerweile gewonnenen naturwissenschaftlichen Kenntnissen angepaßt. Hier müssen wir nun den Unterschied zwischen belebter und unbelebter Welt schärfer betonen. Seit der großen Anschauung des Kopernikus vom Bau der Welt, seit Keplers und Newtons Berechnungen der Himmelsbewegungen sind für die unbelebte Welt der Materialismus und Mechanismus zu immer allgemeinerer Anerkennung gelangt, soweit sie das Bestehende betreffen. Gegenwärtig hält es wohl jeder, der die Natur kennt, für töricht, unkontrollierbare außerirdische und überirdische Eingriffe in ihren Gang anzunehmen. Aber schon für die unbelebte Welt werden die Verhältnisse andere, sobald es sich um ihren Anfang und ihren Plan handelt. Kennzeichnend für den Materialismus ist dann, daß ein Anfang überhaupt nicht zugegeben wird und ebensowenig ein Plan. Das erstere besagt, die Welt ist von je, sie ist nicht entstanden. Das zweite lehnt jede Zwecklichkeit ab, die Welt ist ein Mechanismus, der ewig läuft. Es ist mit ihr und in ihr nichts beabsichtigt, und sie führt nicht zu einem Ziele. Wir würden bei einer ewiggehenden Uhr, ohne Zeiger und Stundenblatt, auch nicht von Plan und Zwecklichkeit sprechen. Und wenn wir gleichwohl[S. 429] sehen, daß Ordnung in der Welt herrscht, Vorgänge nach bestimmten Regeln sich richten, Welten sich entwickeln usf., so gehört das eben alles zur Welt und ihrem Gange, gerade so wie die regelrechte Anordnung der Räder, Federn usf. einer Uhr, wie das Eingreifen aller ihrer Teile ineinander, wie das von Zeit zu Zeit in Wirksamkeittreten besonderer Teile u. a. Es ist nur konsequent, wenn aus einer solchen Anschauung heraus auch das Vorhandensein von besonderen Kräften abgelehnt wird. Die Welt ist eine Anordnung und ein Vorgang; alle Einzelvorgänge sind nur dieser eine Vorgang, wie alle Teile der Uhr die Uhr sind und Einzeldrehungen, Schwingungen usf. darin, der Gang der Uhr. So wie die Räder sich drehen, müssen sie sich drehen, so wie andere Teile schwingen, müssen sie schwingen, alles aus dem Gang der Uhr. Und das ist ohne weiteres auf die Welt zu übertragen. Manche möchten im Gang selbst den Plan und die Zwecklichkeit sehen. Allein das verfliegt ebenfalls, wenn kein Anfang und kein Ende vorhanden ist. Auch diesem mechanistischen Monismus in bezug auf die unbelebte Welt haben sich vom Altertum ab sehr viele angeschlossen. Und ein unverkennbarer und sehr schwerwiegender Vorzug von ihr ist, daß sie eben keiner Kräfte bedarf, auch nicht derjenigen, die wir natürliche, physische Kräfte nennen. Die Kräfte werden nur symbolisch zugelassen, Zufälligkeiten kommen überhaupt nicht in Frage. Wenn wir so manches voraussehen und voraussagen können, so verhält es sich damit, um beim Beispiel zu bleiben, wie mit der Uhr, wo wir auch vorher wissen, welche Zähne der Räder in welche andere Zähne eingreifen werden, daß und wann ein Stift irgendwo etwas mitnehmen oder auslösen oder hemmen wird, weil wir die Teile kennen und den Zwang durchschaut haben. So kennen wir auch die uns erreichbaren Teile der Welt und haben den Zwang in ihnen durchschaut. Und damit operieren wir. Wir stehen der Welt wie einer Uhr gegenüber; sie ist bei weitem komplizierter als eine Uhr, sie ist unendlich an Vorgängen und Körpern. Aber das berührt das Wesentliche nicht. Wir können sie gleichwohl wie einen Zwangsmechanismus ansehen.
Nun aber wir, die Lebewesen. Hier scheiden sich die Wege der nur Welt-Mechanisten von den Wegen auch der Leben-Mechanisten. Jene sehen im Leben, wie wir schon wissen, doch ein Besonderes, das nicht mechanisch ist; diese einbeziehen das Leben in den Mechanismus der Welt überhaupt. Das Leben ist gleichfalls der Vorgang der Welt, ein Zwangsvorgang wie alle anderen Einzelvorgänge dieses Allvorganges, und von diesen Einzelvorgängen nicht im Wesen, sondern nur in der Erscheinung verschieden; letzteres ganz so, wie wir unzählige Bewegungsarten haben, die doch alle nur Bewegung sind, sogar solche, die nicht im geringsten mehr wie Bewegung erscheinen — zum Beispiel die molekularen Bewegungen in den Körpern als Wärme u. a. Was wir als freie Lebensäußerungen ansehen, sind nur Einzelvorgänge, die im Vorgang der Welt kommen und gehen müssen, wie die Weltkörper sich bewegen müssen. Was wir Denken, Wollen und Fühlen nennen, sind auch nur solche Vorgänge, etwa — und das haben fast alle Materialisten und Scheinidealisten, wie Eduard von Hartmann (S. 388), bis auf unsere Zeit, wo die energetische Auffassung vorwiegt, von den alten Mechanisten dogmatisch übernommen — Bewegungen bestimmter Teile in unserem Körper, im Gehirn, in den Ganglien. Daß wir nicht imstande sind, hier wie in der unbelebten Welt, den Zwang aufzuweisen, daß wir hier noch von Zweckmäßigkeiten und von Freiheit reden müssen, liegt an der Unvollständigkeit unserer Kenntnisse, wie wir auch den gewöhnlichen Zufall noch stehen lassen, weil wir die Gründe seines Eintretens nicht überschauen, obwohl selbst ein Psychist Zufälle als solche nicht zugestehen mag. Daß weiter uns die Erkenntnis der Welt zwar wie selbstverständlich erscheint, die Nichterkenntnis des Lebens aber gleichfalls, ist nur Einbildung. Die Welt ist trotz ihrer Ungeheuerlichkeit als Ganzes einfach, das Leben aber schon für sich überkompliziert. Sobald wir jedoch ins Einzelne gehen, scheint uns auch von der Welt vieles nicht erkennbar zu sein, zum Beispiel ihr atomistischer Bau. Und derartige Aufstellungen sind um so entscheidender, als ein fundamentaler Unterschied zwischen[S. 431] Lebewesen und nichtbelebten Dingen überhaupt nicht zugegeben wird; die Lebewesen sollen auf der niedrigsten Stufe in die nichtbelebten Wesen übergehen. Oder das Leben beginnt unendlich schwach und uncharakterisiert, so daß es vom Nichtleben nicht mehr zu unterscheiden sei; die Reihe der unbelebten Dinge bilde mit der der belebten eine Folge. Nur die Extreme unterschieden sich so sehr; aber sie seien gleichwohl durch eine stetige Kette verbunden, die nach unten allmählich zu Dingen wie Steine führt, nach oben in wachsender Komplikation und Verzweigung zu so gearteten Vorgängen, die als seelische und geistige Tätigkeiten erscheinen, wie Bewußtsein und Denken, die abwärts jedoch allmählich auf nichts zusammenschrumpfen. Das ungefähr ist die Anschauung der konsequenten Welt- und Leben-Mechanisten. Wir werden sie später besprechen und dann auch sehen, welcher Annahmen sie noch bedarf. Daß auch ideale Philosophien, wenn auch nicht in physischen Zwangsmechanismus, doch in einen Welt- und Leben-Zwang auslaufen können und ausgelaufen sind, wissen wir schon. Selbst die rein religiöse Anschauung, konsequent aufgefaßt, führt zu einem solchen Zwang und muß dazu führen. Hier handelt es sich aber um den physischen Zwangsmechanismus, nicht um den göttlichen oder geistigen oder transzendentalen.
Pierre Gassendi (1592 in der Provence geboren, gestorben 1655) ist noch kein vollständiger Materialist im vorbezeichneten Sinne. Wie sehr er bibelgläubig sich verhält, zeigt, daß er trotz besserer Einsicht das tychonische Weltsystem dem Kopernikanischen vorzog, weil nach der Bibel die Sonne sich bewegen soll. Und so läßt er auch die Welt mit Allem von Gott erschaffen sein. Nach der Erschaffung jedoch gibt er allein physische Vorgänge zu, namentlich nach Muster der Alten: Verbindungen und Trennungen der Atome. Diesen teilt er eine innere Fähigkeit mit, sich zu bewegen. Ebenso verhält er sich zu der Welt des Lebens. Er gesteht einen unsterblichen Geist zu, nimmt aber zugleich eine Demokritische Seele an und sucht sogar zu erweisen, daß diese in der Tat das leisten kann, was von ihr gefordert wird. Also teilt er mit[S. 432] der einen Hand aus und nimmt mit der anderen; eine wunderliche Mischung von Spiritualistischem und Materio-Mechanistischem aus der „doppelten Wahrheit“. Sein Hauptkampf galt dem Cartesianismus; hier ist er erfolgreich. Seine eigene Lehre ist aber so inkonsequent als möglich, wahrscheinlich, weil er sie nicht konsequent aussprechen durfte. Das Kopernikanische System verdankt ihm ein schönes Experiment. Die Gegner hatten eingewandt, wenn die Erde sich bewegte, könnte ein in die Höhe geworfener Stein nicht auf dieselbe Stelle herabfallen, von der aus er geworfen ist. Der Einwand ist zutreffend, wenn von der Trägheit abgesehen wird, die es veranlaßt, daß der Stein die Bewegung der Erde auch dann noch mitmacht, wenn er in die Höhe fliegt und zurückkehrt. Gassendi aber bewies das, indem er einen Gegenstand auf einem in der Tat sich bewegenden anderen Gegenstand, einem Schiff, aus der Höhe, von der Mastspitze, herabfallen ließ, mit dem erwarteten Erfolg, daß der Gegenstand am Fuße des Mastes ankam, nicht hinter ihm.
In diesem Zusammenhang ist auch der in seiner Staatsraisonauffassung noch den harten Vormund der Antigone übertreffende Thomas Hobbes (geboren in Malmesbury 1588, gestorben 1679) zu nennen. Die Wahrnehmungen werden mechanistisch so erklärt, wie die klassischen Materialisten sie auffaßten: Bewegungen pflanzen sich zu den Sinnesorganen fort und verursachen dort Bewegungen, die ins Gehirn und von da ins Herz gehen. Erinnerung und Gedächtnis sind nur Reste der Bewegungsaffektion, ebenso ist Ideenassoziation Verkettung solcher Bewegungsaffektionen. Jede Materie hat in sich Anlage zur Empfindung. So ist es wohl zu verstehen, wenn Hobbes, was vielen ein Widerspruch gegen seine mechanistische Ansicht zu sein scheint, die Vernunft auch als etwas Angeborenes erklärt. Angeborenheit einer Fähigkeit steht durchaus nicht im Gegensatz zu Mechanismus; sie ruht ja schon in der Grundannahme einer besonderen atomistischen Seele; die belebten Wesen haben mit dieser körperlichen Seele eben die Anlage zum „Leben“ bekommen. Und so brauchte Hobbes selbst angeborene Begriffe und Fähigkeit, solche zu[S. 433] fassen und zu bilden, nicht ohne weiteres abzulehnen. Die Angeborenheit liegt in den Atomen, die sich zu Seele und Geist vereinigt haben, in ihrer Form, Bewegung und Anordnung — wenn man das versteht. Doch mag Hobbes selbst in der Tat in Inkonsequenzen verfallen sein. Alle Materialisten, gerade die ernsten und ernst denkenden, können den Faden nicht ganz festhalten, ebenso wie die Idealisten ihren Faden mitunter fallen lassen, sobald sie hinreichend Naturforscher sind. Beurteilung von Empfindungen beruhe auf Wechsel der Bewegungen bei gleichzeitiger Fortdauer, Erfahrung auf Beurteilung von solchen Bewegungen nach Gleichheit oder Ungleichheit mit früher in die Seele Gedrungenem und dort an den Atomen noch nicht Verklungenem. Ein Bewegungssystem muß ein anderes als sich gleich erkennen oder ungleich; vielleicht, indem es sich zu ihm widerstandslos addiert oder Widerstand leistet. Solche Beurteilungen fixieren wir in Namen, und diese erst geben uns die Mittel einer geordneten Folge von Vorstellungen. Wie, ist eigentlich nicht zu verstehen. Jedenfalls ist alles Seelische und Geistige aus Veränderungen im Körper abzuleiten (Mens nihil aliud erit praeterquam motus in partibus quibusdam corporis organici; die Vernunft wird nichts weiter sein, denn eine Bewegung in gewissen Teilen des organischen Körpers). Und so ist auch alles von außen durch Bewegung verursacht. „Nichts nimmt von sich selbst Beginnen, sondern von der Wirkung eines unmittelbaren Tätigen außerhalb seiner.“ Die Fähigkeit dazu hat aber Alles in sich selbst, sofern Bewegung nur Bewegung hervorruft. So ist denn Erkenntnis Erkennen der Bewegungen und ihres Zusammenhanges. Wir müssen wohl sagen, Sicherkennen. Raum und Zeit werden von Materialisten im allgemeinen als real angesehen. Hobbes aber sagt: „Raum ist das Phantasma eines existierenden Dinges, als existierend“. „Zeit das Phantasma einer existierenden Bewegung, als existierend.“ Also beständen beide außer den Dingen nicht. Wenn nun Hobbes weitergehend behauptet: ein Mensch würde die Welt aus sich, aus den Bewegungen seiner Seelenatome heraus nach außen projizieren, auch[S. 434] wenn eine solche Welt nicht da wäre, so kann er das nur für den Fall meinen, daß der Mensch Bewegungen aus einer Welt schon empfangen hat, sonst würde sich sein Materialismus in reinen Phantomismus auflösen, und er könnte von den Bewegungen ganz absehen, die ja gerade zum Verständnis des Zusammenhanges unserer mit einer wirklichen Außenwelt nötig sein sollen. Weiter läßt Hobbes noch Gott gelten als ein besonders feines und reines, unendliches körperliches Wesen. Und mit dieser Annahme ist eine Art Deismus verbunden. Ein solcher Deismus kann auch unbeschadet des Materialismus bestehen, da ja Gott als körperliches Wesen nur selbst zur Welt gehört. Ob das freilich die Ansicht von Hobbes war, möchte ich nicht entscheiden. Aber zuzutrauen wäre es schon diesem rücksichtslosen Forscher. So erklärt er ja auch: „Die Furcht vor unsichtbaren Mächten sei es, daß diese aus Erdichtungen oder aus Erzählungen ihre Öffentlichkeit hernehmen, diese Furcht ist Religion; sind die Mächte nicht öffentlich angenommen, so ist die Furcht Aberglaube“. Die Religion hat also kein Kennzeichen, außer daß sie vom Staat anerkannt ist, sonst ist sie eben purer Aberglaube. Rücksichtsloser denkt der modernste Materialist auch nicht. Nur daß dieser nicht wie Hobbes jeden hängen würde, der die Staatsreligion abweist. Gleichwohl ist der Gottesbegriff bei Hobbes ein hoher. Die Atome sah Hobbes nicht bloß als nach Form und Größe verschieden an, sondern auch im Wesen, so daß sogar Atome ohne Schwere, Imponderabilien, vorhanden sein sollten, als die feinsten für Geist und Gott körperlich in Betracht kommenden.
Robert Boyle (1627–1691) gehört hierher nur als Atomist, der die Atome in die Chemie und Physik in exakter Weise eingeführt hat. Seine Atome sind, wie die Descartes’, Trümmer einer zersplitterten Materie. Newton (1642–1727) haben wir lediglich als den großen Begründer der Mechanik des Weltalls zu nennen. Beide waren keine materialistischen Mechanisten.
Die übertriebenste Ausbildung hat der materialistische Mechanismus im 18. Jahrhundert erfahren. Die Aufklärungsphilosophie, die in Deutschland in Lessing,[S. 435] Herder u. a. zu so schönen idealen Blüten ersproßte, zeitigte in Frankreich, dicht neben den so bedeutenden Bestrebungen Rousseaus und Voltaires, auch den Enzyklopädismus. Diderot und d’Alembert sind noch gemäßigte Naturalisten und Materialisten. Aber der Pfälzer Baron Holbach und die Franzosen Mirabaud und de la Mettrie gehören zu den extremsten Materialisten, ohne daß die Naturkenntnisse der damaligen Zeit sie dazu eigentlich berechtigte. Materialistische Werke schossen damals wie Pilze aus der Erde. Sie wären nicht so schlimm gewesen, wenn sie sich nicht zum Teil auch bemüht hätten, die Lebensanschauungen auf fast gemeinen Egoismus und Utilismus zu lenken, die an sich gar nichts mit einer materialistischen Betrachtung von Welt und Leben zu tun haben. War der Materialismus bei denen, die ihn nicht kannten, schon oft in den Verdacht eine Lehre der Unmoral und des Eigennutzes zu sein, geraten, so schien er gegen Ende des 18. Jahrhunderts diesen Verdacht zu rechtfertigen. Aber die Revolution schwemmte mit anderem auch diesen ethischen Materialismus hinweg; und die Menschheit hat ihr zweifellos dafür zu danken. Der Materialismus konnte wieder reine Wissenschaft werden, was er im Altertum war und in unserer Zeit ist. Als ernsteres Hauptwerk des enzyklopädischen Materialismus wird das „Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde morale“, 1770 in London gedruckt, angesehen. Als Verfasser ist Mirabaud angegeben; aber es ist längst fest ausgemacht, daß der Pfälzer Baron Holbach der Verfasser war. Die Schrift ist zwar gegen die übliche Religion gerichtet, scheint aber im übrigen weder Eigennutz noch Unmoral zu lehren, sie bricht sogar für die Tugend eine Lanze. Der Materialismus darin bewegt sich in den Bahnen, die wir schon kennen; er folgt anscheinend namentlich Hobbes. Doch ist er stark mit Mystizismus versehen, denn die Atome werden nicht bloß mit Ausdehnung und Masse begabt, sondern auch mit besonderen geheimnisvollen Kräften und Eigenheiten, wie Sympathie und Antipathie, Liebe und Haß. Die Atome sind selbst noch zusammen[S. 436]gesetzt aus kleinsten Körperchen; in diese werden wohl die Besonderheiten verlegt. Übrigens hat unsere Wissenschaft die Atome zwar der Häkchen, Vorsprünge, Ärmchen usf. zum gegenseitigen Anhalten und Verketten beraubt, aber dafür notgedrungen Eigenschaften bei ihnen eingeführt, die nicht weit ab von den eben genannten liegen, wie Anziehung, Abstoßung, Polarität, Affinität usf. Und noch sind unsere Bemühungen, für diese Eigenschaften einen allgemeinen Ausdruck zu finden, nicht gelungen, obwohl wir überzeugt sind, daß ein solcher vorhanden sein wird, und wir auch den Weg, der zu ihm führt, zu kennen glauben dürfen. Auch die Zerteilung der Atome in noch kleinere Teilchen, wir nennen sie Corpusceln, entspricht modernen Anschauungen. Mystischer ist, wenn den Atomen auch eigenes inneres Streben zur Bewegung zugeschrieben wird. Hier kommt auch etwas wie die Herbartsche „Selbsterhaltung“ zum Vorschein. Es heißt: „Die Erhaltung ist also der allgemeine Zweck, nach dem alle Energien, alle Kräfte, alle Fähigkeiten der Wesen ständig gerichtet zu sein scheinen.“ Sie wird mit der Trägheit identifiziert und gehört tatsächlich einem allgemeinen großen Naturgesetz an. Die Natur ist ganz Leben, Leben aus den materiellen Kräften der Natur, wofür auch das berühmte Phlogiston herangezogen wird. Denn nur Materie und Bewegung sind da; ohne Anfang, ohne Ende, ohne Zufall, ohne Freiheit, ohne Schöpfer, wie es bei einem Materialisten strenger Observanz sein muß. Und keine Ausnahme gibt es; der Mensch bildet sich nur ein, ein anderes zu sein als die Natur überhaupt. Auch er und alle seine körperliche und seelische und geistige Tätigkeit ist nur Materie und Bewegung, und ganz nach der gleichen Notwendigkeit geregelt wie bei jedem Ding der Natur. Götter und Gott hat nur der Aberglaube erdacht, und damit Gedankenträgheit, Vorurteil, Unduldsamkeit und Verfolgungssucht in der Welt heraufbeschworen. Wer die Natur kennt, braucht keine Gottheit, so wenig wie er einer Seele und eines Geistes als etwas Besonderen bedarf. Spricht man aber von einer bewegenden Ursache in der Natur, so mag man wohl Gott meinen. „Wenn wir dem Worte „Gott“ einen Sinn[S. 437] unterlegen wollen, so werden wir finden, daß es nichts anderes bezeichnen kann als die Summe der unbekannten Kräfte, welche das Universum beleben.“ So ist denn die Natur auch „die Notwendigkeit ihrer selbst“, was sonst genau so von Gott ausgesagt wird. Und von gleichem Standpunkt werden Tugend, Vernunft und Wahrheit die „verehrungswürdigen Töchter der Natur, der Souveränin aller Wesen“ genannt und als „unsere einzigen Gottheiten für immer“ bezeichnet. Es ist also eine Hypostasie der Natur, bei aller Auffassung als nur Materie und Bewegung. Aus dieser Natur heraus fließen alle sittlichen Vorschriften als auf Selbstliebe begründet. Hier geht das Ganze in eine Art edlen Epikureismus über, und unter Wahrung des frohen Lebensgenusses. Holbach spricht in dieser Beziehung wie unsere modernen Materialisten, die eine Ethik aus sich selbst heraus lehren, welche neben gesundem Egoismus verbindlichen Altruismus enthält, nicht die fast zuchthausmäßig zwingenden Religionen von Hobbes, oder einen Krieg aller gegen alle. So ist dieses Système ein ganz modernes Werk, und ein menschlich gesundes dazu, wo nicht die Grenzen nach der einen und der anderen Seite überschritten werden. Und wo nicht solche Unentschiedenheiten herrschen wie in der wichtigsten Frage, ob die Atome auf sich selbst beruhen und die Natur ein Vieles aus diesen Einzelnen darstellt, oder ob die Natur eine absolute Einheit ist, von der noch die Atome eine Art Scheinleben haben, so daß für Eigenleben nirgend Platz und, wie im Pandeismus und Pantheismus, alles Zwang und Fatalismus ist.
Rücksichtslose Krönung fand das Werk des mechanistischen Materialismus in Julien Offraye de la Mettries Werk: „L’homme machine“, der Mensch eine Maschine. Sein System ist älter als das eben behandelte Holbachsche, aber fast noch konsequenter. Der Mensch ist durchaus von seinem Körper abhängig. „Ein Nichts, eine kleine Fiber, irgend etwas, das die subtilste Anatomie nicht entdecken kann, hätte aus Erasmus und Fontanella zwei Toren gemacht“. Das ist Binsenwahrheit, die Lamettrie durch eine Unzahl von Beispielen in der oben genannten Schrift und dem älteren[S. 438] Werke: „Histoire naturelle de l’âme“ oder „Traité de l’âme“ belegt hat. Und in dieser Hinsicht unterscheidet sich der Mensch vom Tiere (oder der Pflanze) in keiner Weise. Sind nach Descartes die Tiere Maschinen, so sind es auch die Menschen. Und nun wird das Maschinelle des Menschen im einzelnen verfolgt. Wir brauchen das nicht genauer darzutun. Indessen scheint Lamettrie nicht den Menschen als Ganzes als Maschine angesehen zu haben, sondern in allen seinen Teilen; denn er findet das Leben in allen Teilen des Organismus und gibt Erläuterungen dazu, wie das Weiterleben von abgetrennten tierischen Teilen, die Ergänzung zerschnittener Polypen usf. Zu der hieraus folgenden Idee, daß ein Lebewesen eine in jedem Teile gleiche Maschine ist (S. 369 f.), gelangt er aber nicht; er unterscheidet die Wesen nur nach Kompliziertheit der maschinellen Einrichtung. „Der Mensch verhält sich zu den Tieren, wie eine Planetenuhr von Huyghens zu einem gemeinen Uhrwerk.“ Auf die Zahl der Teile, Räder usf. kommt es bei ihm an. Wir wissen aber, daß es darauf allein nicht ankommt. Keine noch so komplizierte Maschine kann einem Lebewesen verglichen werden; gerade aus Lamettries Gründen für das Leben überall im Körper. Was er sonst in seiner Schrift noch mit gewisser „absichtlicher Frechheit“ (Lange, Geschichte des Materialismus) ethisch vorbringt, müssen wir übergehen. Im übrigen darf ich auf die eingehende Würdigung dieses, immerhin sehr merkwürdigen, Mannes in dem genannten Werk von Lange hinweisen, dem hiernach in der Tat viel bitter Unrecht geschehen ist, als eine Art „Prügeljungen des französischen Materialismus“.
Ganz im Sinne Lamettries klingt der Satz Ludwig Feuerbachs: „Was der Mensch ißt, das ist er“, obwohl Feuerbach mehr Positivist und Empirist, als Materialist gewesen ist, trotz Ablehnung der Unsterblichkeitslehre. Im übrigen brauchen wir den modernen mechanistischen Materialismus nicht weiter zu verfolgen. Er knüpft sich an die Namen Karl Vogt, Büchner, Moleschott, Czolbe, Dubois-Reymond in seiner ersten Zeit usf. Weder ist er so konsequent wie der klassische oder englisch-französische,[S. 439] noch bietet er neue Gesichtspunkte, oder konnte er solche bieten. Lediglich aus den vermehrten Kenntnissen in Astronomie, Physik, Chemie, Physiologie und beschreibenden Naturwissenschaften sind festere Stützen für die materialistische Anschauung gewonnen worden. Wir sprechen davon im Zusammenhang mit dem folgenden. Was aber allzu seicht ist, wie beispielsweise die Belehrungen von Büchner, werden wir übergehen. Des geistvollen und tiefen David Friedrich Strauß’ Materialismus in „Der alte und der neue Glaube“ kann ich nur aus einer Art Vergnügen an Errungenschaft aus fremdem Gebiete und aus Überschätzung der, ihm naturgemäß nicht hinreichend geläufigen, Ergebnisse der Naturwissenschaften erklären.
51. Allgemeine und besondere Naturgesetze, Entwicklungslehre.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß alle Erscheinungen und Vorgänge der physischen Welt zunächst von drei allgemeinen Gesetzen beherrscht werden, die wir als kosmische Regulative bezeichnen wollen: dem Gesetz der Erhaltung der Massen, dem der Erhaltung der Energien und dem der Trägheit und des gleichsinnigen Strebens nach einem bestimmten Endzustande. Die beiden ersten Gesetze sind einfach, wenn man die Begriffe von Masse und Energie aufgefaßt hat. Ich muß diese Begriffe als bekannt voraussetzen. Der dritte Satz, soweit er von Trägheit spricht, ist ebenfalls einfach; er besagt nur, daß Zustände, welche bestehen, sich nur durch Anlaß oder dauernde Kraft ändern. Wenn ein Anlaß schon ausreicht, den Zustand dauernd zu ändern, in einen anderen überzuführen, so ist jener Zustand labil gewesen. Bedarf es einer stetig wirkenden Kraft, so daß die Änderung immer nur der Kraft nachgebend geschieht, so war jener Zustand stabil. Ob ein Zustand stabil oder labil ist, hängt ab sowohl von diesem Zustand selbst als auch von dem, der in der Umgebung, also allgemein in der Welt herrscht, wenn wir die Welt als eine Einheit auffassen. Hiernach ist auch der zweite Teil des dritten Satzes leicht zu verstehen, denn der darin[S. 440] enthaltene Endzustand wird ein stabiler Zustand sein. Daß es kein labiler sein kann, folgt daraus, daß ein stabiler Zustand sich wiederherstellen kann, wenn die ihn ändernde Kraft aufgehört hat zu wirken, ein labiler Zustand dagegen nicht. Eine Kugel in dem tiefsten Punkt eines vertikal gestellten Kreiskanals ist in stabilem Zustand; schiebt man sie aus diesem Punkt heraus, so kehrt sie in ihn zurück oder schwingt um ihn hin und her. Die gleiche Kugel auf den höchsten Punkt des Kanals gelegt, kann dort ebenfalls ruhen, beim geringsten Anlaß aber fällt sie herab und kehrt nicht wieder zurück. Die Wissenschaft hat für den Endzustand auch eine gewisse mathematische Bestimmung gefunden, nämlich, daß etwas, das Entropie genannt wird, den höchstmöglichen Wert erreicht, so daß alle Änderungen in der Natur zur Vermehrung dieser Entropie dienen, wenn sie dieselbe nicht ungeändert lassen. Es heißt darum der dritte Satz auch der Entropiesatz. Der Satz wird noch in anderer Weise ausgesprochen. Die Vorgänge in der Natur vermögen wir uns so vorzustellen, daß sie auch rückwärts durchlaufen werden können, wie ein Körper in die Höhe steigen und von da herabfallen kann; oder so, daß dieses nicht zulässig ist, wie der Ofen einen Raum erwärmt, aber dieser Raum seine Wärme an den Ofen nicht zurückzugeben vermag. Demnach sind die Vorgänge umkehrbar, reversibel, oder nicht umkehrbar, irreversibel. An sich kennen wir keinen Vorgang, der vollständig umkehrbar ist. Genau genommen sind alle Vorgänge in der Natur nicht umkehrbar. Aber wie dem auch sein mag, so besagt jener dritte Satz, daß aus allen Vorgängen immer ein Rest bleibt, der nicht umgekehrt werden kann. Die Welt kommt also allmählich in einen Zustand, der sich nicht redressieren läßt.
Endlich sei noch ein Ausspruch des Satzes erwähnt, der von Boltzmann und Planck herrührt, nämlich: Die Natur führt alle Änderungen in der Weise, daß zu jeder Zeit derjenige Zustand herrscht, der unter den gegebenen Verhältnissen der wahrscheinlichste ist. Von allen Zuständen, die die Welt erreichen könnte, strebt sie demjenigen zu, der für[S. 441] sie, wie sie sich nun einmal eingerichtet zeigt, der wahrscheinlichste ist. Es kommt also darauf an, wie wir sie eben als eingerichtet ansehen müssen. Tiefe Untersuchungen der genannten Forscher haben ergeben, daß diese Einrichtung so angenommen werden muß, daß in den letzten Einzelnen räumlich wie zeitlich absolute Nichtordnung besteht. Die letzten Einzelnen sind die Atome oder Molekeln der Materie in ihrer Bewegung, oder auch solche Erscheinungen, wie eine Unzahl von unendlich rasch aufeinanderfolgenden Lichtschwingungen aller möglichen Art, welche einen Strahl natürlichen Lichtes ausmachen u. ä. Bei den Atomen oder Molekeln bezieht sich die Nichtordnung auf die Bewegungen in den Körpern, Atom- und Molekularbewegungen; diese Bewegungen dürfen für alle Atome oder Molekeln im Raume, sowie für eine Molekel in der Zeit, keine Ordnung aufweisen, weder in der Richtung noch in der Geschwindigkeit. Bei Erscheinungen wie dem natürlichen Licht müssen die unzähligen es zusammensetzenden, unendlich rasch aufeinanderfolgenden Einzelstrahlen in keiner ihrer Eigenschaften, wie Farbe, Polarisation, Schwingungskurve, Stärke usf. Ordnung zeigen. Absolute Nichtordnung muß herrschen, so daß alles zu erwarten und nichts vorauszusetzen ist. Das betrifft aber, um es nochmals hervorzuheben, die letzten Einzelnen, die ein Ganzes (Körper, natürlicher Strahl, Wärme usf.) zusammensetzen. Daher von elementarer Nichtordnung gesprochen werden kann. Das ist ein etwas wunderliches Ergebnis für die Einrichtung unserer Welt: Ordnung in den Ganzen, Nichtordnung in den Elementen. Aber Lucretius Carus hat schon für die Atome von der Nichtordnung gesprochen, und Bernouilli, Krönig, Clausius, Maxwell u. a. haben diese besondere Nichtordnung zur Begründung der bekannten kinetischen Theorie der Körper und der Wärme benutzt, wie sie für Strahlen schon von Fresnel in der Theorie des natürlichen Lichtes Anwendung gefunden hat. Alle elementaren Einzelnen sollen in ihrer Nichtordnung auch voneinander völlig unabhängig sein. Findet das nicht statt, sind Systeme von ihnen zusammenhängend im Wechsel ihrer Zustände, kohärent, wie[S. 442] zwei Strahlen, die von derselben Lichtquellenstelle ausgehen, so bleibt zwar auch für sie im gesamten der Erscheinungen und Vorgänge das dritte Gesetz bestehen, aber im besonderen kommen Änderungen hinzu, welche den Erfolg dieses Gesetzes aufhalten, also verzögern, indem sie gegen dieses Gesetz verlaufen. Zwei Lichtstrahlen gleicher Temperatur sollten nach diesem Gesetz, wenn man sie in andere Strahlen umwandelt, auch dann keinen Temperaturunterschied zeigen; sie lassen jedoch gleichwohl einen solchen hervortreten, falls sie kohärent sind. Ich darf auf den kurzen, aber sehr gehaltvollen Aufsatz von Max Planck, „Die Einheit des physikalischen Weltbildes“ verweisen.
Das Recht, diese Sätze, die selbstverständlich nur auf der Erde geprüft werden können, auf das ganze uns bekannte Weltall auszudehnen, nehmen wir aus der, namentlich durch die Spektralanalyse erwiesenen Tatsache, daß die Himmelskörper aus den Stoffen bestehen, die auch unsere Erde bietet. Es wäre ein Verfahren ins Blaue hinein und ganz unwissenschaftlich, wenn jemand behaupten wollte, daß die Grundeigenschaften der Stoffe und der Vorgänge zwischen ihnen auf den Himmelskörpern andere sind und anderen Gesetzen folgen als auf der Erde. Freilich müssen wir zugeben, daß wir gewisse Zustände, unter denen sie sich auf den Himmelskörpern befinden, auf der Erde noch nicht herzustellen vermögen. Aber jene Gesetze nehmen wir eben als von den besonderen Zuständen unabhängig an, da sie sich so auf der Erde erweisen, soweit hier Prüfung möglich ist. Das Bestehen etwaiger Kohärenz hat auf diese Gesetze keinen Einfluß, auf die beiden ersten Gesetze in keiner Beziehung, auf das dritte Gesetz in seinem Enderfolge nicht, wenn es auch, wie bemerkt, den Gang nach diesem Gesetz aufhalten und verzögern kann.
Regieren diese drei Gesetze alle physischen Erscheinungen und Vorgänge der Welt ausnahmslos, so bestehen für die Einzelerscheinungen und Einzelvorgänge noch besondere Gesetze und Regeln. Manche von diesen sind von so allgemeiner Bedeutung, daß sie wieder die ganze Welt betreffen. So[S. 443] die Massenanziehung nach der Newtonschen Formel, von der keine greifbare Substanz ausgenommen ist und die absolut unveränderlich scheint. So die Regel, wonach für alle nicht kohärenten Systeme die Wärme immer nach den kälteren Körpern von selbst hinströmt und strahlt, und nie umgekehrt nach den wärmeren. Andere dagegen sind Spezialgesetze, wie die Formeln, nach denen Körper sich anziehen oder abstoßen oder drehen, wenn elektrische oder magnetische oder Stromeinflüsse sich geltend machen, oder wie diejenigen, welche die Beugung, Reflexion und Brechung von Licht- und Schallstrahlen, die Zusammendrückbarkeit der Körper, zum Beispiel der Gase, feststellen usf. Solche Gesetze können in ihrer Wirkung auch von der Umgebung abhängen. Wie dem aber auch sei, so nehmen wir uns doch die Freiheit, auch sie auf das Weltall auszudehnen, das heißt, ihre Gültigkeit überall anzusetzen, wo sich Gelegenheit zu ihrer Geltendmachung bietet, nicht bloß auf der Erde. Von dem Gesetz der Massenanziehung und dem der Zerstreuung der Wärme nach den kälteren Stellen sind wir ja der Allgemeingültigkeit fast sicher.
So können wir uns hiernach die Welt aufbauen, so daß sie unserer irdischen entspricht, und dürfen aus dem, was wir für diese wissen, auf das All übertragen: alle Stoffe, alle Erscheinungen, alle Vorgänge, alle Gesetze. Und in dieser Weise ist der mechanistische Materialismus für das physische All zunächst zu verstehen. Aus dem gleichen Grunde dürfen wir die systematische Ordnung am Himmel, in Raum und Zeit, wiederum aus irdischen Erfahrungen ableiten. So ist die gewaltige Lehre Kants vom Weltsystem und seiner Entwicklung entstanden, nachdem seit dem Altertum ein solches System aufzubauen die Bemühungen nicht geruht haben und Descartes schon ein sehr eigenartiges, aber nicht den Tatsachen hinreichend entsprechendes System aus seiner Theorie der Himmelswirbel abgeleitet hatte. Wir haben hier die Geburt, das Leben, den Untergang, das Wiederaufleben usf. der einzelnen Systeme im Weltall nach bestimmten Prinzipien.
Das alles gilt von der physischen Welt. Wie steht es mit der lebenden Welt? Soweit die Körper der Lebewesen[S. 444] in Betracht kommen, nicht anders als mit der physischen Welt; sie sind den Weltgesetzen unterworfen wie allen Einzelgesetzen, und kein lebendes Wesen kann seinen Körper diesen Gesetzen entziehen, sie gelten hier so streng wie in der unbelebten Natur. Hinsichtlich der Körper dürfen wir die lebenden Wesen dem All ohne weiteres einverleiben. Wie es hinsichtlich der Psyche steht, wird später besprochen. Hier erwähnen wir nur das, für die Psyche Unbedeutende, aber für das Leben und seine Entwicklung sehr Bedeutende. Im Bereiche dieser Erscheinungen kennen wir außer jenen kategorischen Gesetzen noch zwei andere Gesetze: das der Selbsterhaltung und das der Erhaltung der Art (Vererbung), das heißt der Erhaltung des individuellen Körpers und Geistes und der Erhaltung der Nachkommen in der besonderen Gestaltung dieses Körpers und Geistes. Sehen wir von allen psychischen Wirkungen ab, so würden in einer absolut unveränderlichen Umgebung beide Gesetze streng zur Ausführung gelangen können. Wir vermögen uns sehr wohl einen Zustand zu denken, in dem ein Wesen nach seiner Einrichtung lebt und vergeht und genau entsprechende Wesen produziert, so daß die Kette der Wesen immer aus gleichen Ringen zusammengesetzt ist. Alsdann ist auch nur eine einzige Wesenart vorstellbar, und von je in je. Ob das irgendwo in der Welt stattfindet, wissen wir nicht; sollte das der Fall sein, so dürfte es sich entweder auf Wesen beschränken ohne geistige Tätigkeit, oder auf solche mit höchster Vernunft. Die Gründe sind leicht einzusehen. Genug, ein solcher Zustand ist durchaus vorstellbar. Wie nun die Verhältnisse auf der Erde sind, steht die Selbsterhaltung wie die Erhaltung der Art in einem steten Kampf mit der ganzen Umgebung. Die Lebewesen suchen instinktiv oder planmäßig die Umgebung ihrer Art anzupassen, aber auch sich selbst der Umgebung anzupassen. Letzteres geschieht größtenteils nur instinktiv, unbewußt — wir werden später die Bedeutung davon kennen lernen. Unter Umgebung ist dabei nicht allein die unbelebte Natur verstanden, sondern auch die belebte. Aus der Anpassung an die Umgebung aber folgt, daß die beiden Erhaltungsgesetze[S. 445] nur bedingt erfüllt werden können, nämlich mit Rücksicht auf diese Umgebung. Und so treten schon im Leben des Individuums Änderungen seines Selbst ein und folglich nach dem zweiten Erhaltungsgesetz Änderungen der Art. Auf diesen Grundgedanken — von den Einzelheiten müssen wir hier absehen — ist die Entwicklungslehre der belebten Wesen aufgebaut worden, namentlich von Lamarck und Darwin, nachdem Geister wie die ionischen Naturphilosophen, Kant, Goethe und andere sie schon mehr oder weniger bestimmt gedacht haben. Ob diese Entwicklungslehre, Phylogenie, in der Paläontologie und in der Wachstumslehre, Ontogenie, eine durchaus sichere Stütze hat, ist gegenwärtig wieder etwas zweifelhaft geworden. Daß aber die Arten sich ändern müssen, wo die Umgebung sich ändert, ist ganz unausweichlich, wenn auch daraus noch lange nicht folgt, daß alle Arten wie die Zweige eines Baumes aus einem Lebewesen hervorgegangen sein müssen. Das hängt mit der Entstehung der Lebewesen überhaupt zusammen.
Ich will darüber und über die Abstammungs-, Deszendenzlehre nur einiges sagen. Erstens ist es sehr wohl möglich, daß große Klassen von Lebewesen aus verschiedenen Urwesen ihren Ursprung genommen haben. Der Bau eines Insektes ist trotz der entsprechenden Organe, wie Magen, Lunge, Füße, Augen usf. so himmelweit von dem eines Säugetieres verschieden, daß, wenn nicht absolut zwingende Gründe der Paläontologie vorhanden sind, die irgendwann in der Geschichte der Erde ein Wesen nachweisen, das sich ebensogut zu der Stufe der Säugetiere wie zu der der Insekten entwickeln konnte, man noch wissenschaftlicher verfährt, Insekt und Säugetier auf verschiedene Urwesen zurückzuführen. Man verliert ja dadurch gar nichts hinsichtlich des Hauptsächlichen, der Entwicklungslehre. Auch eingeschränkt auf Arten, die wirklich einander entsprechen, hat sie immer noch ihre hohe Bedeutung und braucht auch nicht so sehr mit dem Mangel an Zeit zu kämpfen. Doch mag das sein, es hat mehr ein Interesse des Kennens als des Erkennens, denn das Psychische berührt es gar nicht. Und die törichten Exklamationen von[S. 446] Leuten, die fürchten, ihre Gottähnlichkeit würde ihnen durch die Entwicklungslehre genommen werden, beruhen auf zu geringer Überlegung. Wir sind Gott ähnlich mit und ohne Entwicklung, wenn wir uns dessen bewußt sind. Die Entwicklungslehre für sich kann den Geist, die Seele nicht aus der Welt schaffen. Und wenn sie eine Art Mechanistik darstellt aus den physischen Einwirkungen von außen, so sagt sie damit an sich nichts Neues, sondern etwas, das der Mensch seit je gewußt hat, daß er nämlich von solchen Einwirkungen durchaus abhängig ist. Wir können also die Entwicklungslehre ruhig bestehen lassen, ohne unserer Seele etwas anzutun. Selbst ein Nachweis, daß die seelische Organisation mit der körperlichen in der Entwicklungsreihe wächst, würde von keinem Belang sein. Aber ein solcher Nachweis, wie soll er wohl geführt werden, ohne auf die auffälligsten Widersprüche und Unbegreiflichkeiten zu stoßen? Die Pflanzenwelt besteht so lange wie die Tierwelt; hat aber die höchste Pflanze — mögen auch die Pflanzen, wie die neusten Untersuchungen gelehrt haben, nicht ohne Sinnesorgane und Nerven, vielleicht auch nicht ohne Vorstellungen sein — psychisch Ähnlichkeit auch nur mit einer Schnecke? Eine Ameise, die in der körperlichen Organisation so vielen Insekten nachsteht, von den Säugetieren gar nicht zu reden, besitzt eine viel größere geistige Rührigkeit als manches höchste Säugetier. Körperlich ganz benachbarte Arten zeigen durchaus verschiedene geistige Äußerungen. Die geistigen Verschiedenheiten selbst innerhalb derselben Art sind auch dann noch ungeheuer, wenn wir von pathologischen Verhältnissen absehen, nur das Normale nehmen.
Viel wichtiger ist das zweite. Woher kam das Urwesen, oder woher kamen die Urwesen? Die beiden Hauptansichten darüber sind schon im Altertum geäußert worden. Nach den Mechanisten müßte es sich gerade so gebildet haben wie jeder unbelebte Körper. Damit hängt die sogenannte generatio equivoca, die Selbstzeugung, zusammen, an die noch Schopenhauer geglaubt hat. Ließen doch manche Griechen die Lebewesen einfach aus Schlamm oder Erde unter der Einwirkung der[S. 447] Hitze der Sonne auf diesen Schlamm oder die Erde erwachsen sein. Gerade die moderne Naturwissenschaft hat die Selbstzeugung als nichtig erwiesen. Unter den Umständen, die wir nur herzustellen vermögen, sagen die Materialisten strenger Observanz; aber unter anderen Umständen? — Darüber läßt sich nicht streiten, es liegt außerhalb der wissenschaftlichen Methode. Ich verweise aber, um Mißverständnissen vorzubeugen, durchaus auf die Definition der Lebewesen, wie wir sie unserem Kant verdanken und die wohl auch für den Materialisten allerstrengster Observanz gültig sein wird. Die zweite, schon im Altertum bekannte Annahme ist die neuerdings als Panspermie bezeichnete. Keime aller Dinge, auch der belebten Wesen, sollten durch das ganze Weltall verteilt sein, und wenn letztere in geeignete Verhältnisse kamen, sollten sie sich zu den betreffenden Lebewesen entwickeln. Die Entwicklung wurde mitunter nach der Evolutionslehre gedacht, deren neuerer intensiver Vertreter Albrecht von Haller gewesen ist. In jedem Keim (nach der Hauptansicht in der Eizelle, nach anderen Ansichten in der Samenzelle) steckt schon das Wesen in kleinster Gestalt, in diesem eingehüllten Wesen ein von ihm eingehülltes usf., so daß jeder Keim eine unendliche Zahl immer ineinander eingekapselter Wesen einer Art enthielte. Ein Keim ist so in der Lage, durch stete Fortpflanzung eine unbegrenzte Reihe von Wesen einer Art herauszuwickeln, und es genügte, wenn von jeder Art auch nur ein Keim von je vorhanden war. Wir wissen jetzt (bereits seit Caspar Friedrich Wolff 1759), daß diese Evolutionslehre in dieser Form nicht zutrifft. Auch in einer anderen Form, die Weismann ihr gegeben hat, und die lange in der Biologie großes Ansehen genoß, daß nämlich zwar nicht die vollständigen Wesen, aber doch die letzten Teile, aus denen sie sich bilden, in den Keimen schon vorhanden seien, so daß es sich um eine Trennung dieser Teile und dann um ein Wachstum handelt, muß die Evolutionslehre gegenwärtig abgelehnt werden. Denn gegenwärtig meint man: die Wesen entwickeln sich durch Sprossung oder Teilung aus einer Zelle, unter sehr verwickelten Erscheinungen[S. 448] auf Grund des Stoffwechsels, eine Lehre, die als Epigenesis bezeichnet wird, indem alles erst in der Entwicklung entsteht, aus gewissen Eigenschaften der Keimteile. Aber die Panspermie behält gleichwohl ihre Bedeutung. Eine Hauptschwierigkeit für sie kannten die Alten nicht, nämlich die sehr tiefe Temperatur des Weltalls, die wohl 150° C unter Null beträgt. Moderne Forscher, wie W. Thomson und Helmholtz, haben darum mehr gelegentlichen Transport von Keimen durch Meteorite für nicht ausgeschlossen gehalten und so Verbreitung von Weltkörper zu Weltkörper. Arrhenius hat dann, nach den Forschungen der neuesten Zeit über Strahlen- und Elektrizitätsdruck, gezeigt, daß kleine Keime auch ohne Meteorite von Weltkörper zu Weltkörper geschleudert werden können, und daß die Fluggeschwindigkeit dabei so groß sein kann, daß die Keime zwischen Körper und Körper die furchtbare Kälte des Weltraumes überdauern können. Das alles muß man jetzt zugeben; und so ist in der Tat die Verbreitung von Leben durch das Weltall möglich, zumal wenn man Keime aller Art zuläßt, namentlich auch solche, die unter ganz anderen Verhältnissen sich entwickeln können als auf der Erde herrschen, etwa unter solchen auf dem Monde, wo atmende Wesen in unserem Sinne nicht vorhanden sein können usf. Ich wüßte nicht, was dem entgegenstehen sollte. Atome werden ja auch von allen möglichen Arten angenommen, und wie wenig bei Keimen in ihrer Struktur dazu gehört, sie nach ganz verschiedenen Richtungen sich entwickeln zu lassen, ist ja bekannt; die Keimzellen (z. B. Ei und Sperma) differentester Lebewesen sind für uns mitunter kaum zu unterscheiden. Gleichwohl müssen sie jede ein Eigenes haben, das sie veranlaßt, sich gerade zu dem bestimmten Wesen zu entwickeln. Sind einmal Keimzellen gegeben, so hat es weiter keine Not, denn nun entwickeln sich solche Zellen im Laufe des Lebensprozesses immer weiter, wie gesagt, durch Sprossung oder Teilung; der Intervention einer neuen Urzelle bedarf es dann nicht.
Das alles betrifft die Entwicklung der Wesen-Reihe, die Phylogenie. Die Entwicklung der Einzelwesen, die[S. 449] Ontogenie, wäre sehr einfach, wenn die Evolutionstheorie sich als zutreffend erwiesen hätte; die Keime mit ihren ins Unendliche ineinandergekapselten Wesen gleicher Art wären von je, oder geschaffen, das Weitere beträfe nur die Auswicklung, sozusagen aus der Hülle, wobei der betreffende Urkeim von Geschlecht zu Geschlecht weiter und weiter gegeben würde. Nur die Umstände, unter denen die Auswicklung erfolgt und die Art, wie sie erfolgt und wie das Wachstum geschieht, böten, freilich recht bedeutende, Schwierigkeiten. Allein wir sollen es mit der Epigenesis zu tun haben, und da handelt es sich nicht bloß um diese Schwierigkeiten, sondern auch um die Frage, warum sich aus Ei und gegebenenfalls Samenzelle jedesmal ein den Eltern gleiches Wesen entwickelt. Hier gilt nun, wie man sagt, das Gesetz der Vererbung; und es wird darum als erwiesen angesehen, daß die Entwicklung der Einzelwesen in den ersten Stadien die der Wesenreihe bis zu einem gewissen Grade wiederholt. Die Phylogenie spiegelt sich in der Ontogenie wieder, oder noch schärfer: Die Ontogenie ist eine Rekapitulation der Phylogenie. Die Untersuchungen darüber sind außerordentlich verwickelt. Ich darf wegen dieses biogenetischen Grundgesetzes namentlich auf unseres greisen, dem Vaterlande zum Stolz gereichenden Forschers Häckel Schriften verweisen, denen nur grobe Unbedachtheit, um nicht ein härteres Wort zu benutzen, aus kleinen Irrtümern und Versehen, wie sie bei sorgfältigster Arbeit sich nicht vermeiden lassen, absichtliche Unrichtigkeiten unterschieben konnte. Wie weit die Ontogenie als Palingenesie in der Tat Phylogenetisches wiederholt, ist wohl noch strittig. Häckel selbst hat hervorgehoben, daß manche Stufen in der Ontogenie fehlen, andere abgekürzt auftreten und viele Stufen nachträgliche Erwerbungen, zenogenetisch sind, die sich in der Phylogenie nicht finden. Aber alles würde immer nur beweisen, daß Bestehendes möglichst erhalten wird, selbst wenn es längst vergangen ist, um so mehr, wenn es noch blüht. Tatsachen der Vererbung gibt es aber unzählige, sie sind durch die Deszendenztheorie fast Gemeingut geworden. Was veranlaßt aber die Vererbung, daß Wesen verschiedener Art nicht einmal[S. 450] Nachkommen hervorbringen können? Der Grund muß in den Elementen, aus denen die Lebewesen sich entwickeln, liegen, in Ei und Samen. Aber worin er besteht, wissen wir nicht. Der Inhalt von Ei und Samenzelle (Protoplasma, Nukleus, Chromatin, Zentrosom und vielleicht noch anderes) ist außerordentlich kompliziert gebaut. Noch komplizierter, abgesehen von den Einzelligen und den Amöben, trotz Feststellung typischer Vorgänge, wie namentlich der Gastrulation, ist die Entwicklung selbst. Es scheinen auch polare Kräfte mitzuspielen, für die wir noch keinen Ausdruck haben, und Struktur- und Beschaffenheitsdifferenzen in den Inhalten der Elemente. So ist das Gesetz der Vererbung einstweilen nur eine Umschreibung für eine Reihe von Tatsachen. Es muß aber mit außerordentlicher Energie wirken, da es aus einer unendlichen Zahl von Möglichkeiten immer nur ein Bestimmtes zuläßt und selbst noch Dinge, rudimentäre Organe, erhält, die für das Wesen nutzlos oder gar schädlich sind, worüber Darwin so eingehend geschrieben hat. Und dabei wirkt die Vererbung, indem sie sich nicht bloß auf das Ganze erstreckt, sondern sogar auf die kleinsten Einzelheiten; alle Organe, alle Gliedmaßen, alle Nerven, Muskeln, Knochen usf., und alles dieses in den feinsten histologischen Feinheiten, werden vererbt. Wir wollen diese Vererbung die morphologische nennen und setzen ihr an die Seite die biologische, indem die Vererbung auch die Folge in der Entwicklung der einzelnen Teile betrifft, sowie die funktionale, welche sich auf die Tätigkeiten der einzelnen Teile bezieht.
Allein die Vererbung geht selbst auf die Stellen des Eies, aus denen die Entwicklung geschieht; bestimmte Stellen entwickeln sich in bestimmter, immer gleicher Weise, wenn die Entwicklung ungestört geschieht. Das ist eine Lokalisationsvererbung. Driesch spricht darum von einer morphologischen Bedeutung der einzelnen Stellen im Ei, indem die Bedeutung dasjenige ist, was aus dieser Stelle bei ungestörter Entwicklung hervorgeht. Die Vererbung sorgt, daß auch hier immer das gleiche folgt; das nun ist um so wunderbarer, als die neuere Biologie wohl unzweifelhaft nachgewiesen[S. 451] hat, daß aus derselben Stelle sich sehr vieles andere entwickeln kann und unter Umständen in der Tat sich entwickelt, daß Stellen die Entwicklung anderer Stellen übernehmen und durchführen können. Der gleiche Forscher spricht deshalb auch von einer morphologischen Potenz dieser Stellen, welche viel umfassender ist als die morphologische Bedeutung. Unter allen Potenzen einer Stelle treibt die Vererbung bei normalen Verhältnissen also immer nur eine in die Aktualität, in die Bedeutung hinaus. Und nun kommt noch das weitere Wunderbare, daß, wenn die Verhältnisse bei der Entwicklung anormal sind, diese Entwicklung, trotz des dadurch bedingten Wechsels der in die Wirklichkeit gebrachten Potenzen der einzelnen Stellen des Eies, doch ein durchschnittlich normales richtiges Wesen zutage fördert. So mächtig ist das Gesetz der Vererbung im Kleinsten wie im Großen. Es ist ein morphologisches Gesetz von zwingender Gewalt. Also regelt die Vererbung Gestalt, Entwicklung aus dem Kleinsten in das Kleinste und Große, und in das Ganze, den Gang der Entwicklung, die Wirksamkeit aller Teile, ja auch Geistestätigkeit, wie jeder weiß. Es ist ein großzügiges Gesetz, da es Abweichungen zuläßt, ohne das Wesentliche zu beeinträchtigen. Als Erhaltungsgesetz steht es in einem gewissen Gegensatz zu dem Anpassungsgesetz, wirkt aber auch mit ihm zusammen, indem es immer das erhält, was nach dem Anpassungsgesetz eingetreten ist.
Zu der morphologischen Potenz möchte ich selbst noch folgende Bemerkung machen. Sie ist zunächst ontogenetisch verstanden, bezieht sich also auf dieselbe Wesensart, eigentlich auf eine bestimmte Zelle. Wenn man aber beachtet, daß die Ontogenie der Phylogenie entspricht, so möchte man fast glauben, daß die morphologische Potenz noch eine viel allgemeinere Bedeutung hat, nämlich auch eine phylogenetische. Alsdann würde sie besagen, daß aus dem Eiinhalt an sich überhaupt jedes mögliche Wesen entstehen kann. Von vornherein hätte der Eiinhalt die Eigenschaft, nicht bloß aus jeder Stelle jedes zu dem betreffenden Individuum Gehörige hervorzubringen, sondern auch jedes beliebige Individuum jeder[S. 452] beliebigen Art. Er sei morphogenetisch gänzlich universell, und die phylogenetische Entwicklung bedeute lediglich ein immer weiteres Zutagetreten der Potenzen des Eiinhaltes zu immer neuen Formen. Es wäre dieses eine Art phylogenetische Evolution, jedoch nicht vorhandener Formen, auch nicht von Differenzierungen vorhandener Bausteine, sondern von Potenzen, die dem protoplasmatischen Stoffe, der den Eiinhalt bildet, von vornherein innewohnen, Potenzen, wie im Individuum zu allen seinen Teilen, so in der Wesenreihe zu allen Wesen beliebiger Art. Eine derartige Anschauung würde den Zusammenhang zwischen Ontogenie und Phylogenie ins klare setzen und die Entstehung der verschiedenen Wesenformen in den Gang der Entwicklung eines Wesens und den durch äußere oder andere Einflüsse herbeigeführten Abschluß dieser Entwicklung verlegen. Die bestehenden Wesen wären nicht die vollendeten Entwicklungen, sondern Stufen in der allgemeineren Entwicklung der Gesamtpotenz des protoplasmatischen Stoffes. Und das Steigen in der Reihe der Wesen wäre bedingt durch das immer später eintretende Abschließen der Stufen. Kennen wir doch Lebewesen, die unmittelbar Stufen in einer bestimmten Entwicklung sind und als solche ihr ganzes Dasein verbringen, wenn sie nicht später die Entwicklung fortsetzen. Manche halten sogar das Weib für ein Wesen, das gegenüber dem Mann auf einer früheren Stufe der Entwicklung stehen geblieben ist. Vielleicht ist nicht bloß eine Art des betreffenden Stoffes vorhanden, sondern es bestehen zwei Arten, mit abweichenden phylogenetischen Potenzen; eine für die Reihe der Tiere, die andere für die Reihe der Pflanzen. Vielleicht sind auch selbst für die Reihe der Tiere mehrere Arten des protoplasmatischen Stoffes anzunehmen. In einer so ungemein verwickelten Sache hat man das Recht, auch allgemeine Ideen zu äußern. Doch mag es bei dieser Äußerung selbst verbleiben; der Phantasie sei es überlassen zu träumen, wie viele neuartige Wesen noch als weiterer, später eintretender Abschluß der Entwicklung aus dem protoplasmatischen Stoff entstehen können.
Ein ferneres Erhaltungsgesetz können wir in der Restitu[S. 453]tion, die als Sonderfall die Regeneration enthält, sehen, wonach Lebewesen ihren Körper ergänzen und erneuen, vollständig oder wenigstens zum Teil. Die Beispiele hierfür streifen mitunter das Verblüffende; so wenn von manchen Tieren abgeschnittene Stücke sich zu ganzen, gleichen Tieren wieder auswachsen, unmittelbar oder nachdem sie zuvor eine Rückverwandlung fast in den ersten Zustand erfahren haben, so weiter, wenn von gewissen Zellen einer Pflanze neue Zweige oder Blätter oder gar eine ganze neue gleiche Pflanze hervorwächst usf. Je höher wir in die Reihe der Lebewesen kommen, desto mehr verliert allerdings der Körper die Fähigkeit, sich zu ergänzen. Aber selbst bei dem Menschen ist sie noch nicht ganz erloschen. Und wo die unmittelbare körperliche Restitution, hier oder bei anderen Wesen, fehlt, tritt wenigstens Nebenbildung, Umbildung, Weiterbildung oder Funktionsübertragung ein. Für Nebenbildung sind Beispiele die adventiven Restitutionen, indem in der Nähe eines verlorenen Organs ein anderes entsteht wie bei Pflanzen, wozu auch die Bildung von neuen Organen neben nur teilweise entfernten Organen gehört wie „der Gliedmaßen und des Schwanzes bei Amphibien, des Kopfes der Planarien, der Wurzelspitze der Pflanzen“; für Umbildung bei Pflanzen die Umwandlung von Schuppen in Blätter oder die Umbildung von verletzten Augen bei gewissen Krebstieren in Antennen; Weiterbildung durch kompensatorische Hypertrophie zeigt sich in der Vergrößerung von Organen, wenn das Gegenorgan verloren ist, wie einer Niere nach Verlust der zweiten Niere; endlich Funktionsübertragung finden wir oft bei Gehirnkrankheiten, wenn zum Beispiel bei Lähmung des Sprechzentrums andere Stellen des Gehirns allmählich die Sprechermöglichung übernehmen.
Zu diesen Erhaltungsgesetzen kommt noch ein morphologisch-biologisches Ordnungsgesetz, das schon erwähnte und in Kants Auseinandersetzungen vom Naturzweck (S. 369) behandelte Gesetz der Harmonie, das die Zusammenstimmung aller Teile in der Ordnung, der Ursache und Folge und in der Wirksamkeit vermittelt. Doch es ist in einem so außerordentlich dunkeln und schwierigen Gebiet, auf dem[S. 454] sogar die speziellen Fachleute, weil eben die Beobachtungen noch nicht entfernt hinreichen und darum die mannigfachste Deutung zulassen, gefährlich, von bestimmten Gesetzen nach bestimmten Richtungen zu sprechen.
Ich habe darum nur dasjenige vorgebracht, was mir gegenwärtig noch am sichersten zu sein scheint, wenngleich es wohl sehr vieles andere gibt, das nicht minder bedeutungsvoll ist. Und alles betrifft, wie der Leser sieht, meist den Körper und dessen Funktionen. Und die Gesetze sind Regulation für den Körper und dessen Funktionen, morphologisch-biologische Regulation, und zwar nicht bloß für die Einzelwesen, sondern auch für die Wesenreihe, also ontogenetisch und phylogenetisch. Wie es sich mit der Psyche verhält, werden wir noch sehen. Aber auch das obige wird noch zu ergänzen sein.
52. Energetische Anschauungen; Ostwald und Häckel.
Es muß hervorgehoben werden, daß kein Vorgang in der Natur ohne Änderung von Energien in ihrer Menge oder Umwandlung in andere Energien vorhanden ist. Wir sprechen allgemein von Umwandlung von Energien. Ein Stein, den ich halte, hat Schwereenergie; lasse ich ihn fallen, so geht ein Teil dieser Energie in Bewegungsenergie über, ist der Stein auf die Erde gestürzt, so wandelt sich die Bewegungsenergie in Wärme oder Energie beim Zerschlagen usf. um. Die Schule der Energetiker, deren Führer Wilhelm Ostwald ist, setzt an Stelle aller Vorgänge Energieumwandlungen. Die Welt enthält eine gewisse Zahl von Energien in bestimmter Gesamtmenge; das Leben der Welt bedeutet die stetige Umwandlung dieser Energien hier und überall, unter Wahrung der Gesamtmenge, die unveränderlich ist. Bewegungsvorgänge, Lichtvorgänge, Wärmevorgänge, chemische Vorgänge usf., alles ist nur Energieumwandlung. Das soll nun ebenso für die Vorgänge des Lebens gelten, und zwar nicht bloß des animalischen, sondern auch des seelischen und geistigen. Ostwald, in seinem Buche „Die Energie“, sagt: „Dieses Verhältnis (des Begriffes der Energie zu dem des Geistes) glaube[S. 455] ich so auffassen zu dürfen, daß die geistigen Geschehnisse ebenso sich als energetische auffassen und deuten lassen, wie alle übrigen Geschehnisse auch.“ Diese Theorie wird an den Tatsachen des Lebens erläutert. Zunächst das rein Animalische bietet keine Schwierigkeit, die Vorgänge im Körper sind ja die gleichen wie sonst in und an beliebigen Körpern. Sind die Vorgänge in der physischen Welt überhaupt nur Energieumwandlungen, so sind sie es auch im Körper der Lebewesen. Die Sinneswahrnehmungen sollen gleichfalls nur solche Umwandlungen bedeuten. Energien gelangen an und in unsere Sinnesorgane, dort werden sie in andere Energien umgewandelt (z. B. wie die Lichtenergie im Sehpurpur des Auges auch in chemische Energie), dann findet eine Leitung durch den Nerv (seinen Achsenzylinder) statt, als „Nervenenergie“, deren Art Ostwald selbst als noch nicht bestimmbar angibt. Im Zentralorgan, Gehirn oder Rückenmark (in den Ganglien) angelangt, erfährt die Energie eine abermalige Umwandlung in „psychische Energie“ (vielleicht Energie chemischer Zersetzung, Dissimilation). Ein Teil wird Wahrnehmung, der andere geht als Nervenenergie zurück, wandelt sich in den Organen des Körpers um und veranlaßt dort die Energieumwandlungen, die wir in der Bewegung, Ausscheidung usf. sehen. Also nur Umwandlung von Energien in Energien. Und Ostwald sagt ausdrücklich: „Daß die geistigen Vorgänge in all ihrer Mannigfaltigkeit eben nicht als Begleiterscheinungen der betreffenden Energie, sondern als diese Energie selbst aufgefaßt werden müssen“. Also die ganze psychische Tätigkeit ist Energie und deren Umwandlung. (Übrigens behaupten die Mechanisten das gleiche in bezug auf Bewegung: die psychistische Tätigkeit ist Bewegung und deren Umwandlung. Ostwald faßt die Mechanistik anders auf: die psychistische Tätigkeit soll danach Begleiterscheinung der Bewegung sein; das ist aber, wie ich glaube, nicht die Ansicht Demokrits und seiner Nachfolger.) Was dazu zu sagen ist, werde ich im nächsten Abschnitt beibringen.
Hier will ich nur einen der interessantesten Punkte dieser Energetik hervorheben. Ostwald meint, die wesentlichste Ener[S. 456]gie in uns sei die chemische. Nun lassen sich chemische Anordnungen ersinnen und aufweisen, welche wiederholte Vorgänge leichter ausführen als erstmalige. Dieses vergleicht Ostwald mit dem Gedächtnis in den Lebewesen sowohl hinsichtlich des Eigenlebens als hinsichtlich der Vererbung, also die chemische Erinnerungsfähigkeit mit der psychischen. Indem er dann weiter das Bewußtsein des Ich gleichfalls in die Erinnerung und die Erinnerungsmöglichkeit setzt, gewinnt er einen Zusammenhang dieses Bewußtseins mit der chemischen Erinnerung. So sagt er dann: „Hier schützt uns die Energetik alsbald gegen die kindliche Vorstellung von der ‚Aufbewahrung der Erinnerungsbilder‘ in den Zellen des Gehirns, indem sie an die Stelle der Bilder die entsprechenden Vorgänge, das heißt an die Stelle einer gedachten räumlichen Mannigfaltigkeit, für welche kein Substrat nachzuweisen ist, eine zeitliche Reaktionsfolge setzt, die allein dem zeitlichen Charakter der geistigen Vorgänge gerecht wird“. Ostwald hat mit der Ersetzung des Raumes durch die Zeit sicher recht, wenn jemand die Bilder im Raume annehmen würde. Der Psychiker tut das aber nicht; er setzt sie in die Seele, die mit dem Raum gar nichts zu tun hat. Der Mechanist muß freilich die Bewegungen im Gehirn verteilt annehmen. Der Energetiker hebt — so muß man wohl Ostwald verstehen — den Begriff des Raumes überhaupt auf, da er den der Masse auflöst. Darüber später. Gleichwohl ist es schwer einzusehen, wie aus der Reaktionsfolge Erinnerung und Erinnerungsvermögen sich ergeben sollen. Jeder Schritt in einer Reaktion ist ja geschwunden, sobald er beendet ist; er hat ja kein Bleibendes eben als Folge. Wie soll da im Laufe einer Reaktionsfolge ein vergangener Schritt zum Vorschein kommen? Wir entwickeln einen Gedankengang, das wäre eine Reaktionsfolge. Wir können ihn nur entwickeln, wenn wir alle Schritte dieses Ganges uns fortwährend vorhalten; sobald ein Schritt uns nicht gegenwärtig ist, haben wir den Faden verloren, wie wir sagen. Also soll eine physische Reaktionsfolge bei jedem Schritt die ganze voraufgegangene Reaktion zugleich darstellen. Das ist notwendig; die einfache Nachwirkung von[S. 457] Reaktionen, wie sie in der Physik und Chemie bekannt sind — ein Kautschukfaden dehnt sich anders, wenn er vorher schon gedehnt gewesen ist, als wenn er das nicht war — genügt nicht. Die ganze verflossene Reaktion muß bei jedem Schritt der Reaktion immer wieder da sein. Es ist dieses ein Seitenstück zu der Darlegung der organisierten Körper als Maschinen mit ganz gleichen Maschinen als kleinsten Teilchen derselben. Ich weiß nicht, wie man das verstehen soll. Nun gar das Erinnerungsvermögen. Hier soll irgendeine Reaktion längst verflossene Reaktionsfolgen hervorrufen, die mitunter mit ihr nicht die geringste Ähnlichkeit haben, wie wenn man einen Ton hört und sich dabei einer Farbe erinnert oder eines Gegenstandes oder einer Begebenheit. Die Vorstellungen ohne Substrat müssen ja nach dieser Theorie gleichfalls Reaktionsfolgen von Energien sein. Ich hebe diese Bedenken schon hier hervor. Über die Auffassung unserer geistigen Tätigkeiten, unserer Gefühle, unserer Anschauungsformen, unserer Kategorien (ob erworben oder nicht erworben) im Sinne der Energetik, hat sich Ostwald nicht ausgesprochen; er hat selbst anerkannt, daß das meiste noch sehr dunkel sei.
Ostwald hat in seiner Energetik den Begriff der Materie in den der Energien aufgelöst. Ich muß auch darauf hier schon eingehen, da wir wissen müssen, was diese Auflösung eigentlich bedeutet. Auch ist sie für seine Theorie von größter Wichtigkeit. Jede Energie ist zwiespältig, ein Produkt von zwei Faktoren, der Intensität und der Kapazität. Der nicht physikalisch vorgebildete Leser wird mich am besten an einem Beispiel verstehen. Lebendige Kraft (Masse mal Quadrat einer Geschwindigkeit) ist eine Energie. Steigen wir auf einen Turm und lassen da ein Kilogramm aus freier Hand herunterfallen, so bekommt dieses, an der Erde angelangt, eine bestimmte Geschwindigkeit und eine bestimmte lebendige Kraft, Energie. Nehmen wir statt ein Kilogramm ein Stück von zwei Kilogramm, so langt dieses an der Erde mit der gleichen Geschwindigkeit an, aber seine lebendige Kraft ist doppelt so groß. Bei drei Kilogramm ist die Geschwindigkeit wiederum die näm[S. 458]liche, aber die lebendige Kraft dreimal so groß usf. Also richtet sich die Aufnahmefähigkeit, Kapazität, für diese Energie nach der Masse. Diese ist der eine Faktor. Nun besteigen wir einen anderen, viermal so hohen Turm und lassen wieder das eine Kilogramm frei fallen. Wir finden jetzt die Energie unten am Boden, indem die Geschwindigkeit, mit der das Kilogramm dort anlangt, jetzt doppelt so groß ist, aufs vierfache gesteigert. Bei einem neunmal so hohen Turm würden wir unten am Boden das Kilogramm mit der dreifachen Geschwindigkeit ankommen sehen und bei ihm eine neunfache Energie bemerken usf. Also ist hier die Geschwindigkeit entscheidend. Diese, oder vielmehr ihr Quadrat, ist das zweite an der Energie, ihr Intensitätsfaktor. Was hat nun Masse mit Geschwindigkeit zu tun? Wir können jeder Masse jede beliebige Geschwindigkeit erteilen. In der behandelten Energie sind aber Masse und Geschwindigkeit zu einem Produkt vereint. Entsprechendes gilt für alle Energien ausnahmslos. Alle führen ein zwiespältiges Dasein nach zwei Richtungen.
Wir haben gewissermaßen eine Spinozasche Substanz mit zwei Attributen: Intensität, Kapazität. Das wäre ganz gut. Aber diese Attribute sind voneinander absolut unabhängig; jedes kann für sich beliebig konstant bleiben, wenn das andere variiert, oder variieren, wenn das andere konstant ist; und variieren beide, so variiert jedes durchaus nur für sich, ohne jede Beziehung zum anderen. Nicht einmal eine Parallelvariation, wie bei den Spinozaschen Attributen der Substanz, ist hier vorhanden. Auch die Abhängigkeit von der Energie ist nur eine relative, denn wenn letztere variiert, braucht nur eines der Attribute mit zu variieren, und wenn beide Attribute reziprok variieren, bleibt die Energie konstant. Daraus folgt, daß keines der Attribute in Energie aufgelöst ist. Beide Attribute, Kapazität und Intensität, stehen neben Energie durchaus selbständig da. Nun ist in den wichtigsten Vorgängen Masse eine solche Kapazität. Somit bleibt die Masse. Sie hat nur ihren Namen geändert; sie ist als Kapazität einem allgemeinen Begriff untergeordnet, zu dem Volumen, Form, Elektrizitätsmenge usf. gehört. Eine wirkliche[S. 459] Vereinfachung hat so wenig stattgefunden, wie bei mechanischen Vorgängen, wenn man das Bewegungsmoment einführt, das gleichfalls Kapazität und Intensität hat, Masse und Geschwindigkeit. Und alle Schwierigkeiten, die aus dem Begriff der Masse erwachsen, namentlich alle Dualismen, sind in der Energetik nicht vermieden; sie bleiben als solche und müssen sofort zutage treten, sowie man die Energieumwandlungen in physischen Vorgängen wirklich verfolgt. Was wandelt sich da, Kapazität oder Intensität? Oder wandeln sich beide? Was bedeuten im einzelnen Vorgang Kapazität und Intensität? Fragt man darnach nicht, so weiß man nicht, wie die Energie sich wandelt; ob sie in ihrer Art unverändert bleibt oder in eine neue Art übergeht, das heißt, ob wir innerhalb der einen Erscheinung bleiben, und diese nur intensiv steigt oder fällt, oder ob wir überhaupt eine andere Erscheinung erhalten. Also vom Wichtigsten bleibt man ununterrichtet. Geht man aber in das Einzelne, so sitzt man sofort wieder fest mit der Kapazität und Intensität, zum Beispiel der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit usf. Und das ewige Problem: wie kann Variation einer Masse psychische Vorgänge auch nur beeinflussen, zum Beispiel sie stärken oder schwächen? bleibt so ungelöst, wie überhaupt in der materialistischen Theorie. Denn die Antwort: weil die Masse Kapazität der Energie ist, besagt gar nichts für das Problem, sie ändert nur den Namen, Kapazität für Masse. Die Energetik leistet, von diesem Gesichtspunkte betrachtet, nicht mehr als die Mechanistik; die Hauptfragen läßt sie offen.
Gleichwohl darf man zugestehen, daß, wenn sonst nichts gegen sie vorläge, sie der Mechanistik vorzuziehen ist, da sie ja bei weitem allgemeiner sich darstellt und alles Physische umfaßt, und da Arbeit, Energie viel mehr an Psychisches anklingt als Bewegung. Nur was sie zu leisten verspricht, das leistet sie tatsächlich nicht: Kapazität (darunter auch Masse) und Intensität bleiben jede für sich und jede neben der Energie, ganz so, wie in der Mechanistik Masse und Geschwindigkeit jede für sich stehen und jede neben dem Bewegungsmoment. Sagt der Mechanistiker, alle psychischen[S. 460] Vorgänge sind Umwandlungen von Bewegungsmomenten, so spricht er gerade so wie der Energetiker. Aber das Erhaltungsprinzip, das doch für Energien immer, für Bewegungsmomente nur ausnahmsweise gilt? Das Prinzip hat für die Art der Vorgänge gar keine Bedeutung. Man kann aus ihm für diese Art absolut nichts entnehmen. Es ist für die Grundfrage völlig irrelevant. Die Energetik sagt: psychische Vorgänge sind Energieumwandlungen. Wir erfahren damit, daß sie dem Prinzip der Erhaltung unterworfen sind. Aber was da wandelt, wie es wandelt, erfahren wir durchaus nicht, da wir es doch erfahren müssen, wenn wir nicht ein Wort für ein anderes setzen, und wenn wir zwischen den verschiedenen psychischen Vorgängen unterscheiden wollen. Meint man, daß wir das jetzt noch nicht können und daß die Zukunft uns das aufdecken muß — wohl! Aber die Rollen der Kapazitäten und der Intensitäten muß die Energetik so gut wie die Mechanistik sogleich aufdecken. Sogleich muß sie zeigen, warum, wenn im Gehirn eine Masse variiert, zum Beispiel Wasser austritt, Ermüdung und Bewußtlosigkeit entstehen können. Die Antwort, weil damit eine Energieänderung verbunden ist, belehrt nicht. Denn erstens braucht das gar nicht der Fall zu sein, da der zweite Faktor, die Intensität, die Energieänderung durch die Stoffänderung sowohl nach Stärke als nach Art aufheben kann. Zweitens ist eine solche Antwort nur eine Antwort in Worten, gerade so wie in der Mechanistik. Über der Energie sind ihre beiden Faktoren zu sehr vergessen worden. Obwohl sie doch so variieren können, daß die Energie überhaupt nicht variiert, weder nach Stärke noch nach Art. Was dann wirklich geschieht, werden wir uns ja leicht vorstellen, es kann das ganze Leben zerstört werden. Was geschieht dann aber psychisch nach der Energetik? Gar nichts!
Ich habe dieses alles erwähnen müssen, nicht um die Mechanistik gegenüber der Energetik hervorzuheben — die Mechanistik ist meines Erachtens noch bei weitem unbrauchbarer auf psychischem Gebiete als die Energetik —, sondern um klarzulegen, was wir an der etwas stark prätentiös auftretenden Lehre der Energetik haben, worin sie uns gerade[S. 461] so in Stich läßt wie alle physischen Theorien. Was im nächsten Abschnitt zu sagen ist, wird das Vorstehende noch sehr verstärken.
Häckel ist nicht so weit gegangen wie Ostwald, er hat der Materie ihr Recht gelassen und möchte alles aus Umwandlungen von Materie und Energie erklären. Häckel ist materialistischer Spinozist. Mit Spinoza nimmt er ein Ding-an-sich an, und an diesem Ding Attribute. Für das eine Attribut setzt er, entsprechend der Ausdehnung nach Spinoza, die Materie. Als zweites Attribut nimmt er die Energie an. Indessen fühlt er selbst sich gezwungen, dieses Attribut in zwei Attribute zu zerlegen: in Energie, nach Art dessen, was wir gewöhnlich Energie nennen, nämlich die gewöhnliche physikalisch-chemische, oder physische, wie wir kürzer sagen, und in Energie, die er als Psychom bezeichnet. Letztere ist etwa die psychische Energie nach Ostwald. Allein während Ostwald diese Energie nur so bezeichnet, weil er frei lassen will, daß in psychischen Vorgängen auch andere Arten von Energie mitwirken als die wir vorläufig kennen, haben Häckels Psychome eine selbständigere Bedeutung. Sie wandeln wie die anderen Energien und mit den anderen Energien, jedoch sie erhalten sich selbst, ohne diese anderen Energien. Dadurch aber sind sie scharf von ihnen geschieden, und sie sind ein drittes Attribut des Ding-an-sich, der allgemeinen Substanz. Häckel sagt in seinem an Sich ausgezeichneten und höchst edel geschriebenen Buche „Die Welträtsel“, einem Buche, das übrigens den einzigen wirklichen Versuch einer Enträtselung der Welt auf Grund der modernen Naturwissenschaft unternimmt: „Die drei fundamentalen Attribute der Substanz (des Ding-an-sich): a. Raumerfüllung oder Ausdehnung, Stoff (= Materie); b. Bewegung oder Mechanik, Kraft (= Energie); und c. Empfindung oder Weltseele, Geist (= Psychom) sind demnach ganz allgemeine Grundeigenschaften aller Körper.“ Und — was also besonders bedeutungsvoll ist — das Erhaltungsgesetz, das er für die beiden ersten Attribute, Materie und Energie, für jedes besonders, annimmt, läßt er in ganz gleicher Weise für das dritte Attribut,[S. 462] das Psychom abermals besonders, gelten, denn gesperrt gedruckt stellt er den Satz hin: „Die Summe der Empfindung im unendlichen Weltraum ist unveränderlich.“ Also die drei Attribute stehen nebeneinander; es handelt sich um eine Trinität der Welt, die Häckel auch nennt. Materialist ist er nur darin, daß er dem dritten Attribut die Eigenschaft der zwei anderen Attribute zuschreibt, was aber gleichfalls Spinoza entsprechen würde. Indem er aber bei diesem dritten Attribut von stufenweiser Verschiedenheit in der Reihe der Körper spricht, von Erwerbung in der Entwicklung (der ontogenetischen wie der phylogenetischen) und von Vererbung, stellt er es noch weiter ab von der physischen Energie, bei der nichts von derartigem zu finden ist, als allein aus der Verselbständigung folgen würde. Seine Lehre ist aber durchaus eine Entwicklungslehre. Was also von dieser gesagt ist und von ihrem Verhältnis zu den psychischen Eigenheiten, trifft hier in jeder Hinsicht völlig zu. Und Häckel selbst kommt ja dem entgegen durch die Sonderstellung des Psychomattributs. In allem aber, was er von der Entwicklung des Bewußtseins spricht, so schön es ist, kann man im Grunde nur eine Verfolgung der Bewußtseinszustände durch die organische Reihe sehen. Wie aber diese Zustände physisch entstanden sind, wie sie sich physisch entwickeln, davon wird nichts gesagt. Und das gerade ist doch für uns die Hauptsache. Die geringste seelische Regung zeigt sich so grundverschieden von jeder physischen Kraft, jedem physischen Vorgang, jeder physischen Umwandlung, daß sie schon ein Wunder dünkt, und daß es uns gar nichts hilft, wenn man uns erklärt, daß zwischen unserer geistigen Tätigkeit und der der tiefststehenden Lebewesen eine kontinuierliche Stufenleiter ist. Wir können das zugeben. Aber woher selbst nur die erste tiefste Seelentätigkeit? Die Frage bleibt unbeantwortet wie die: woher das erste tiefste organisierte Wesen (nach Kant)? Hätte Häckel das nicht selbst gefühlt, so würde er das Psychom als drittes Attribut nicht von der Energie absolut abgesondert haben in seinem Wesen, es sogar für vererblich erklärt haben.
Ostwald und Häckel sind die originalen Schöpfer der[S. 463] Energetik der Psyche, nach zwei recht verschiedenen Richtungen. Ihre Schüler haben nichts Wesentliches hinzugefügt, nicht selten aber die Lehren ihrer Meister höchst mißverstehend angewendet. Nur den bekannten Physiker Felix Auerbach muß ich hervorheben, doch spreche ich von ihm später.
53. Über die physischen Welt- und Lebenanschauungen überhaupt; Weltende, Unsterblichkeit.
Wir kommen zu einer letzten Besprechung der vorstehend dargelegten Anschauungen und nehmen erst die unbelebte Welt. Es handelt sich allein um den Anfang, da nur hier etwas Außer- und Übernatürliches in Frage kommen kann, für alles Folgende aber wir auf dem physischen Standpunkt durchaus bleiben dürfen. Von dem Anfang nun wissen wir, bestimmt, nichts. Aber wir können auf ihn schließen aus dem Ende, falls wir annehmen, daß die Welt nicht unendlich ist an Stoff und Energie. Diese Annahme der Begrenztheit an Stoff und Energie — sie entspricht der Anschauung von E. Dühring (S. 417) — wollen wir machen; ob sie sich rechtfertigen läßt, ist später untersucht. Wir haben drei regulative Prinzipe kennen gelernt, nur das dritte kommt in Betracht. Dieses Prinzip hat zur Folge, daß alle Vorgänge, erzwungene und freie zusammen, die in einem absolut abgeschlossenen System stattfinden, dahin gerichtet sind, in diesem System einen bestimmten Zustand herzustellen, in dem nur noch in sich genau zurücklaufende und rückgängig zu machende Vorgänge möglich sind, wie zum Beispiel Bewegung von Körpern in stets gleichen Bahnen. Wo nun Widerstände vorhanden sind und wo Energien mitspielen, die nur beschränkt sich in andere Energien umwandeln, besteht keine Möglichkeit für genau rückgängig zu machende Vorgänge. In diesen Fällen geht der Endzustand in einen solchen über, in dem überhaupt keine Vorgänge mehr vorhanden sind; das System ist, wie wir sagen können, physisch tot. Und — das ist das Wichtigste — allein aus sich heraus kann dieses System niemals wieder zu Leben gelangen, es bleibt in Ewig[S. 464]keit in dem gleichen Beharrungszustand, wenn von außen nicht etwas eingreift. Dehnen wir diesen Satz auf das Universum aus, so würde er bedeuten, daß, wenn jene genannten Bedingungen erfüllt sind, auch das Universum einmal physisch absterben, in einen bestimmten Beharrungszustand übergehen muß. Nun kennen wir in der Tat Energien, die, nach den Verhältnissen, wie sie eben im Weltall bestehen, nur beschränkt verwandelbar sind. Dazu gehört als die wichtigste Energie die Wärme. Ob auch im Weltenraume überall Widerstände vorhanden sind oder nur in beschränkter Zahl auftreten, wissen wir natürlich nicht. Wir wissen aber, daß überall ungeheure Massen von kleinen Körpern und von Staubwolken verbreitet sich finden. Wir wissen, daß sehr oft Himmelskörper zusammenstoßen. Endlich sind wir mehr und mehr gezwungen, anzunehmen, daß der Weltenraum mit einem Stoff erfüllt ist, dem Äther, der ganz außerhalb alles Materiellen stünde, wenn er nicht der Bewegung der Körper durch ihn einen — wenn auch noch so geringen — Widerstand leistete. Über die Natur des Äthers wird freilich noch viel zwischen den Gelehrten gestritten. Jedenfalls haben wir Widerstände im Weltall, und wenn etwa irgendwo ein System sich in der Tat absolut widerstandslos in Ewigkeit bewegen sollte, wofür aber kaum eine Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, so würde eben der Endbeharrungszustand die Bewegung dieses Systems einbegreifen. Von den verlorenen Vorgängen könnte aber keiner allein aus der Welt heraus wieder erstehen. Ich habe mich hier absichtlich sehr vorsichtig ausgedrückt. Andere fassen das „Ende der Welt“ viel schärfer. Hier betrifft das Ende entweder alle Vorgänge oder wenigstens gewisse Vorgänge.
Wenn aber ein Vorgang ein Ende hat, so muß er in einer endlichen Welt einmal begonnen haben. Er kann aus anderen Vorgängen erwachsen sein, wie Wärmebewegung aus dem Zusammenstoß von Körpern. Dann sind es diese anderen Vorgänge, an die wir uns zu halten haben. So können wir in der Reihe weiter zurückgehen. Ist nun die Welt endlich, so müssen wir in endlicher Zeit auf etwas gelangen, hinter[S. 465] dem die Reihe nicht mehr fortgesetzt werden kann, da in einer endlichen Welt die Zahl der Zustände nicht unendlich sein kann. Das bedeutet aber, daß irgend wann Vorgänge geschaffen sein müssen, aus denen heraus sich alle Vorgänge unserer Welt entwickelt haben, die zuletzt wieder zur Beharrung führen. Wieviele Vorgänge geschaffen sein sollen, ist gleichgültig, denn eine Schöpfung ist eine solche, ob es sich um Millionen von Vorgängen handelt oder nur um einen Vorgang. Das gilt für die gesamte Welt, auch wenn Kohärenzen (S. 441) stattfinden. Also für eine endliche Welt kommt man — so lehrt die Naturwissenschaft — nicht ohne einen Anfang aus, das heißt, nicht ohne einen Schöpfungsakt der Vorgänge. Eugen Dühring nimmt, wie wir wissen (S. 417), gleichfalls einen vorgangslosen Urzustand der Welt an. Er lehnt einen Schöpfungsakt für die Vorgänge, oder wenigstens für einen Vorgang, ab. Wie er aber dann zu einer Welt mit Vorgängen kommen will, ist rein naturwissenschaftlich absolut nicht zu ersehen. Eine Schöpfung, ob durch Gott oder eine Weltseele, ist ganz unausweichlich. Ein absoluter Ruhezustand kann aus sich niemals einen Vorgang hervorbringen. Es bedarf dazu durchaus eines Einwirkens von Außen.
Es ist begrifflich gleichgültig, ob wir von einer Schöpfung der Vorgänge, oder der Körper, oder einer Materie im Sinne eines Chaos sprechen. Doch ist es zweckmäßig, nicht mehr zu sagen als die Lehre ergibt. Gleichwohl möchte ich noch folgendes hinzufügen. Die neuere Wissenschaft führt mehr und mehr zu der Anschauung, daß, was man letzte Teilchen der Materie nennt, Atome, Korpuskeln usf., Ungleichheiten im Weltäther bedeuten, wie kleine Wirbel Ungleichheiten in einem Wasser. Die Körper wären Ansammlungen solcher Ungleichheiten. Ungleichheiten aber können entstehen und vergehen. Sind in dem Stoff, in dem sie sich finden, hier der Weltäther, Widerstände vorhanden, so müssen die Ungleichheiten einmal entstanden, das heißt geschaffen sein. Dann reduzierte sich der Anfang auf den Äther allein, außer der Schöpferkraft. Und zuletzt müssen die Ungleichheiten schwinden. Zusammen bedeutet dieses, daß die Welt der Materie[S. 466] geschaffen ist und allmählich sich auflöst. Mit dem Prinzip der Erhaltung der Materie steht das nicht im Widerspruch, wenn wir den Äther in Rücksicht ziehen, denn die Ungleichheiten lösen sich eben nur auf, der Äther in ihnen bleibt. Was die Energien anbetrifft, so müssen sie am Anfang alle sogenannte Spannungsenergien gewesen sein, und zwar, wenn auch die Materie geschaffen ist, solche im Äther. Der große englische Physiker Maxwell hat derartige Energien im Äther angenommen. An die Materie knüpfen sie sich entweder nur scheinbar oder tatsächlich, wenn die Materie selbst nur Äther in besonderem Zustand ist. Aus diesen ursprünglichen Spannungsenergien sind dann durch die Geschehnisse die anderen Energien hervorgegangen, und in diese Spannungsenergien werden diese anderen Energien zurückkehren, wenn die körperliche Welt das bezeichnete Ende, auch der Körper, gefunden hat. Das Ende ist der Anfang. Eine Idee, die übrigens schon bei den Alten sich findet.
Ist nun die Welt wirklich endlich? Darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Die meisten werden der Ansicht sein, daß das nicht der Fall ist. Indessen haben William Thomson (Lord Kelvin) und Ritter Berechnungen über die möglichen Geschwindigkeiten der Himmelskörper im Weltall aufgestellt, aus denen sich ergibt, daß die materielle Welt nicht wohl unendlich angenommen werden kann. Ich darf auf mein Buch „Die Entstehung der Welt“ usf. verweisen. Wäre diese Welt unendlich, so müßte sie entweder erst seit endlicher Zeit bestehen, geschaffen sein, oder die Himmelskörper sollten außerordentlich viel größere durchschnittliche Geschwindigkeiten aufweisen, als sie solche zeigen. William Thomson geht so weit, die Zahl der Himmelskörper, an der Größe der Sonne gemessen, auf höchstens Tausend oder zehntausend Millionen zu schätzen. Selbstverständlich ist eine solche Schätzung nicht entscheidend, da wir einerseits nicht bis in die unendlichen Tiefen des Raumes tauchen können, andererseits unsere Kenntnisse von den Geschwindigkeiten der Gestirne doch nur sehr beschränkt sind. Aber während die Antinomie der Vernunft an sich Unendlichkeit[S. 467] und Endlichkeit gleich wahrscheinlich läßt, ist für die Endlichkeit doch wenigstens ein Argument aus der Wirklichkeit beigebracht, während die Unendlichkeit nur durch eine Meinung vertreten werden kann. Das Argument müssen wir anerkennen. Und so ist die Endlichkeit der Welt wahrscheinlicher als die Unendlichkeit, und damit die Schöpfung wahrscheinlicher als die Anfangslosigkeit.
Um einer solchen, für den Materialismus ja verhängnisvollen, Schöpfung (als Folge des Endes) zu entgehen, hat Häckel gemeint, jenes dritte Weltprinzip gelte zwar für isolierte endliche Systeme, nicht aber für das Universum, denn in der Unendlichkeit könne manches vorkommen, was das Prinzip durchbricht. (Ich weiß nicht, ob er dabei an die Boltzmann-Planckschen Kohärenzen gedacht hat, die ja aber das Prinzip gerade im Universum nicht durchbrechen.) Das heißt doch eigentlich, Vorgänge im Universum zugestehen, die man für irgendwelche endliche Teile der Welt absolut leugnet. Nun wissen wir freilich nicht viel vom Universum, aber seine Einheitlichkeit ist doch gut erwiesen. Und ferner: will man hier besondere, in dem uns bekannten Teil der Welt verbotene Vorgänge zugestehen, dann fallen alle Naturgesetze, namentlich auch die beiden Erhaltungsgesetze für Materie und Energie, die wir doch auch nur in sehr beschränktem Gebiete prüfen können. Es liegt also hier eine arge Inkonsequenz vor. Man kann nicht monistisch-materialistisch auf einer Seite die absolute Gleichheit in der Natur behaupten, und auf der anderen Seite ein Gesetz, das für noch so große und noch so gelegene Systeme der Welt Geltung haben soll, für die ganze Welt ableugnen, ohne gerade das einzuführen, was ja der Materialist am meisten bekämpft, außerweltliche Eingriffe.
Wir wenden uns zu der belebten Welt. Über die Mechanistik selbst, wie sie vorzustellen sein möchte, ist nichts zu sagen; Bewegung, Stoß, Druck, Strahlung sind allen bekannt. Zehnder hat in einer Schrift: „Das Leben im Weltall“ vielleicht das vollständigste und durchgearbeitetste materialistisch-mechanistische System für die Struktur und die Bildung der Lebe[S. 468]wesen gegeben. Ich kann die Lektüre dieser ausgezeichneten und anregenden Arbeit nur auf das angelegentlichste empfehlen. Doch wird der Leser an der Hand der vorstehenden und der noch folgenden Auseinandersetzungen bald ersehen, daß für die Lösung unserer Fragen, trotz der tiefen Untersuchung, nichts gewonnen ist, wie meines Erachtens auf diesem Wege auch gar nichts gewonnen werden kann. Den Ansichten Zehnders über die Fistillen(Röhrchen-)struktur der kleinsten Elemente der organischen Gewebe dürfte aber neben der von Quincke und anderen vermuteten Schaumstruktur des Protoplasma vielleicht dauernder Wert zukommen.
Eingehender muß ich von der Energetik sprechen. Was da zu entwickeln ist, werden wir auf die Mechanistik anwenden, soweit über diese noch etwas bemerkt werden muß. Das physische Leben soll also Energieumwandlungen sein. Über die Art der Energien und ihrer Umwandlung ist nichts gesagt. Etwas kann aber darüber festgesetzt werden, und muß es auch, wenn die Energetik nicht von vornherein abgewiesen werden soll. Es stehen nämlich die Folgen der einwirkenden Energien mitunter in gar keinem Verhältnis zu der Stärke dieser Energien, was sie doch nach dem Prinzip der Erhaltung tun müßten. Hier hilft nur die Erfahrung aus, daß ungeheure Wirkungen durch geringe Ursachen ausgelöst werden können, wie die Explosion eines Pulverfasses durch einen Funken. Der Funke reißt vielleicht nur zwei Atome des Pulverhaufens auseinander, aber das genügt, daß nunmehr alle Atome des Haufens auseinanderfahren. Der Funke hat mit seiner Energie die Spannungsenergie im Pulverhaufen frei gemacht, daß sie sich in furchtbare Explosionsenergie verwandelt.
Ich glaube nun, daß, wenn man die Seelentätigkeiten überhaupt als Energien ansehen will, man sie als auslösende Energien betrachten muß. Daß der Wille wie eine auslösende Tätigkeit wirkt, ist schon lange vermutet und behauptet worden. Ich meine aber, daß alle anderen Seelentätigkeiten gleichfalls nur auslösend sich kundtun. Es seien zur Klarstellung einige Beispiele angeführt. Ein Riß, ein Schnitt[S. 469] in unseren Körper kann keine größere physikalisch-chemische Energie bedeuten, als zum Zerteilen des betreffenden Gewebes erforderlich ist. Diese Energie bringt das Gefühl Schmerz hervor. Und welche enormen physikalisch-chemischen Energien kann dieser Schmerz zur Äußerung bringen: Schreien, Weinen, Umsichschlagen, Krampf aller Muskeln, selbst Selbstverletzung usf., Energien, die schon jede für sich die ursprünglich angewandte Energie beim Riß oder Schnitt bei weitem überragen. Fände nur eine Umwandlung statt, so dürften sie alle zusammen nur höchstens so intensiv sein wie diese letztere Energie. Also sind durch die Seelentätigkeit Schmerz ganz neue physikalisch-chemische Energiemengen ins Leben gerufen, sie können nur ausgelöst sein. Dazu denke man noch, daß wir diese Energien bis zu einem gewissen Grade durch unseren Willen ja auch zu unterdrücken vermögen; wir halten uns tapfer oder wir schämen uns, uns so gehen zu lassen, die Energien sind dann nicht ausgelöst, ein Antagonist gegen den Schmerz, der Wille, hat ihre Auslösung gehemmt. Beispiele entsprechender Art ließen sich unzählige anführen; man denke an die ungeheuren Energieentwicklungen, welche das Ehrgefühl, das Rachegefühl, die Liebe usf. im Gefolge haben können und haben, während die auf uns einwirkende physikalisch-chemische Energie — ein Wort, also ein Schall, der unser Gehör trifft, oder Licht, von der Geliebten Gestalt in unser Auge gestrahlt, und ähnliches — äußerst geringfügig sein kann. Ferner, wir sind imstande, eine Unzahl von Bewegungen mit demselben Willen gleichzeitig auszuführen. Als Knabe habe ich in meinem Heimatorte fahrende Musikanten bewundert, die ein ganzes Orchester waren; Hand und Fuß, Kopf und Mund, kurz, fast jeder Körperteil bearbeitete ein Instrument, und nicht selten klangen alle Instrumente zugleich und machten einen Heidenlärm. Wir vermögen ja auch von einer Zentrale beliebig viele Sprengungen zugleich zu vollführen, alles auslösend. Man könnte im letzten Beispiel freilich sagen, um mehr oder viel zu tun, bedarf es einer entsprechend vergrößerten Willensleistung, wie in dem analogen physikalischen Beispiel die[S. 470] Zahl der erforderlichen elektrischen Funken wächst wie die Zahl der Sprengungen. Wir besitzen noch kein entscheidendes objektives Maß für die Intensität unserer Seelentätigkeiten; was davon nach außen zum Vorschein kommt, steht in gar keinem Verhältnis zu ihnen, wie ja schon daraus erhellt, daß wir bei noch so heftiger innerer Erregung jede Äußerung unterdrücken können, so daß wir wie innerlich völlig tatlos erscheinen. Es ist möglich, daß man noch Mittel und Wege finden wird, auch die im Inneren verlaufenden Seelentätigkeiten physikalisch-chemisch festzustellen und zu verfolgen. Die Wirkungen von Reizen auf das Zentralnervensystem werden ja bereits nach geistvollen Methoden untersucht. Einstweilen aber wenden wir uns noch am besten an uns selbst. Und da glaube ich, daß man zwar seinen Willen stärken und schwächen kann, aber nicht, indem man ihn verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht usf. oder unterteilt, sondern indem man mit dem gleichen Willen andere Seelentätigkeiten wie Gleichgültigkeit, Trägheit, Abschweifung, Bedenken, Furcht usf., kurz, Antagonisten oder Hemmer aus dem Wege schafft. Der „Geübte“ braucht ja auch nur eines relativ kleinen Willens, um die physikalisch-chemische äußere Energie zu entwickeln, die der Ungeübte bei noch so heftigem Wollen nicht zustande bringt, weil eben die Seelentätigkeiten einander nicht beliebig weichen, von den bekannten physiologischen Verhältnissen zu schweigen, da sie im letzten Grunde — selbst wenn für „gewohnte Nervenbahnen“ andere histologische Struktur oder chemische Zusammensetzung oder physikalisches Verhalten nachgewiesen sein sollten, wie für die ungewohnten — doch wieder auf psychologische Verhältnisse zurückführen.
Die obigen Auseinandersetzungen mögen noch Zweifel lassen, im ganzen werden sie aber wohl die aufgestellte Behauptung rechtfertigen, daß die psychischen Energien auslösende sind. Über die Frage, wie sich die psychischen Energien gegeneinander verhalten, wird später gesprochen werden.
Indessen haben die psychischen Energien noch ganz andere Aufgaben zu erfüllen, als nur Energien auszulösen. Vier Klassen von Zusammenwirkungen zwischen physischen und[S. 471] psychischen Energien sind zu unterscheiden: physische Energien gegen physische, psychische Energien gegen physische, physische Energien gegen psychische, psychische Energien gegen psychische.
Die erste Klasse bietet gegenwärtig grundsätzlich kein besonderes Interesse mehr. Es besteht, wie schon oft hervorgehoben, kein Zweifel, daß alle physikalischen und chemischen Vorgänge im Körper der Lebewesen ganz nach den Gesetzen der physikalisch-chemischen Vorgänge überhaupt, wie sie in der unbelebten Welt sich abspielen, erfolgen. Das haben unsere großen Physiko-Physiologen Johannes Müller, du Bois-Reymond, Helmholtz und viele andere unzweideutig nachgewiesen.
Die zweite Klasse ist schon schwieriger zu übersehen. Es handelt sich hier um die Wirkungen der Psyche auf den Körper. Wir nennen sie, nur dem Brauch folgend, motorische Wirkungen. An sich sind sie nicht bloß bewegend, sondern überhaupt auch der Art nach sehr mannigfaltig. Wir haben Bewegungen, wie die der einzelnen Gliedmaßen, mancher Eingeweide, des Herzens, der Augen usf. Der Wille löst hier lebendige Kräfte aus. Dann kommen Ausscheidungen, Sekretionen, wie die in den Verdauungsorganen und den Drüsen. Mit solchen Wirkungen verbinden sich die Vorgänge bei der Aufnahme von Stoffen in den Körper, durch unmittelbare Einführung, durch Absorption, Osmose usf. Kurz, alles was zum Wachstum, zur Ernährung und zur Erhaltung des Körpers dient. Diese Wirkungen sind nicht mehr rein motorischer Art, hier spielen chemische und besondere physikalische Energien mit, aber immerhin handelt es sich noch um Auslösung von Energien. Nun aber kommen Wirkungen der Psyche auf den Körper, die rein regulierend sind. Wir können hierher schon Hunger, Durst, Atemnot, Sekretionsdrang und ähnliches rechnen, die analog den Zentrifugalregulatoren unserer Dampfmaschinen wirken. Sie regulieren den Stoffgehalt, also auch den Energieinhalt des Körpers. Noch wichtiger ist, daß Seelentätigkeiten die physischen Energien zwingen, sich in ganz bestimmter Weise[S. 472] zu äußern und zu wandeln. Das wichtigste Beispiel der morphologisch-biologischen Regulierung haben wir behandelt (S. 453 f.). Andere Beispiele geben die regulierenden Tätigkeiten mittels des Nervus vagus und anderer Nerven auf Herz, Zwerchfell, Drüsen, Eingeweide usf. Hier handelt es sich also nicht mehr um Umwandlungen von Energien ineinander, sondern um Herbeiführung von bestimmten Verhältnissen in diesen Umwandlungen. Die Psyche, so können wir zunächst sagen, verhält sich hier dem Energieprinzip gegenüber ganz so wie das physische Regulativ, welches gleichfalls die Energieumwandlungen innerhalb jenes Prinzips beherrscht. Die Energien als solche regulieren ihre Umwandlungen selbst nicht, nur daß ihre Summe konstant bleibt, ist gesichert. Aber eine Summe kann aus den verschiedensten Summandenreihen hervorgehen; daß eine bestimmte Summandenreihe sie bildet, erfordert ein eingreifendes Prinzip. Das ist in der Physik und Chemie eben das dritte physische Prinzip. Man könnte sagen, in die Lebenserscheinungen greife ebenfalls das dritte Weltprinzip ein. Das tut es gewiß. Allein wozu sind die regulierenden Gefühle und Nerven vorhanden? Die äußeren Umstände sollten doch, wie in physikalischen und chemischen Vorgängen, allein genügen, die Umwandlungen zu regulieren. Aber immer, wenn die Umwandlungen einen für die Entwicklung oder Erhaltung des Lebens ungeeigneten Verlauf einschlagen, tritt die Regulierung durch besondere Seelentätigkeiten ein. Wir haben eben zwei Regulierungen, eine rein physische Regulierung nach dem physischen Prinzip, bestimmt durch den Zustand des Körpers, die rein mechanisch wirkt, wie in einem unbelebten Körper, ganz ohne Bezugnahme auf das Leben, und eine Regulierung, die unmittelbar auf das Leben gerichtet ist. Diese kommt bei belebten Wesen als neue hinzu. Unser Denken ist diskursiv, nicht intuitiv. Wenn wir Teile haben, die sich vor uns zu einem Ganzen zusammensetzen, so wissen wir, wie das Ganze aus ihnen hervorgegangen ist, haben wir aber nur ein Ganzes, so ist uns die Entstehung aus den Teilen verborgen. Kant begründet damit in der Kritik der Urteils[S. 473]kraft das Prinzip der Zweckmäßigkeit. Das wollen nun die Materialisten nicht anerkennen, sie lehnen es als Einbildung ab. Aber ich weiß nicht, wie man rein mechanistisch oder energetisch die psychische Regulierung bei Entwicklung des Körpers aus den unzähligen Möglichkeiten nach der ganz bestimmten Richtung (S. 450 f.), und im Körper sich verständlich machen will, die zweifellos ein Besonderes neben der physischen ist, die, ich möchte sagen, immer die Umstände so wandelt, daß das physische Regulativ so reguliert, wie es für die Erhaltung des Körpers erforderlich ist. Das zeigt sich ja schon bei der chemisch-physikalischen Assimilation und Dissimilation der Stoffe in den Zellen (z. B. den Ganglien), die immer im Gleichgewicht gehalten werden, und bei dem Ruhebedürfnis, sobald durch körperliche oder geistige Tätigkeit die Dissimilation vorherrschend geworden ist. Wenn also die psychischen Tätigkeiten physische Energien auslösen, so würden sie auch das physische Regulativ für die Vorgänge zwischen den Energien stetig auslösen. Kann man da die psychischen Tätigkeiten überhaupt noch als physische Energien ansehen? In der Physik und Chemie tun Energien, wie bemerkt, nichts dergleichen. Nur auszulösen vermögen sie und sich ineinander zu wandeln, weiter nichts. Das ist noch der entgegenkommendste Ausdruck für das Verhältnis der psychischen Regulierung zur physischen. Manche werden sogar geneigt sein, die erstere als Kampfregulierung gegen die letztere zu betrachten. Und sie hätten recht, da, sobald die psychische Regulierung fehlt und die physische frei waltet, der Körper zugrunde geht.
Zu dieser Klasse gehören auch noch diejenigen Auslösungen, welche als Ausdruck unserer Seelentätigkeiten nach Außen dienen, wie die der physischen Energien beim Sprechen zum Ausdruck der Gedanken und Wünsche, beim Wechseln der Gesichtszüge zum Ausdruck der Empfindungen, bei vielen anderen Bewegungen zum Ausdruck der Triebe, Gefühle usf. Hier liegen die Verhältnisse anscheinend wieder einfach, physische Energien treten als Folge von psychischen auf. Die Bedeutung, die diese Vorgänge haben, beruht zum großen[S. 474] Teil auf Übereinkommen, wie bei der Sprache. In anderen Fällen ist es naturgemäße Abwehr oder Flucht. In noch anderen, wie bei Schreien aus Schmerz, das so weit in der Tierreihe verbreitet ist, bei Lachen und Singen aus Vergnügen und bei Weinen ist es schwer, die Bedeutung abzuleiten.
Wir kommen zur dritten Klasse; sie umfaßt das Tätigkeitsgebiet der sensiblen Nerven; Reize der physischen Energien bringen psychische Erscheinungen, und zwar fast alle — die Physizisten sagen, überhaupt alle — hervor. Teilen wir die psychischen Erscheinungen ein in: Wahrnehmen (physisch und psychisch), Vorstellen (Anschauen, Phantasieren, Erkennen, Erinnern usf.), Empfinden (Fühlen, Begehren usf.), Denken (Schließen, Glauben usf.), Wollen, so würden also im Extrem alle diese Erscheinungen von physischen Energien hervorgerufen werden können. Dagegen läßt sich nichts sagen, jeder weiß es. Und wenn der Körper mit der Außenwelt in Verbindung sein soll, muß es ja auch selbstverständlich so sein. Es fragt sich nur wie? Wenn jemand unsere zur Faust geschlossene Hand ergreift und öffnen will, so löst diese Energie unseren Willen aus, und dieser löst die physische Gegenwirkung unserer Muskeln gegen den Angriff aus. Das ist einfach: ein explodierender Pulverhaufen kann von Feuererscheinungen begleitet sein, die den erloschenen Funken, der ihn zur Explosion gebracht hat, wieder entzünden. Ähnlich brächten physische Energien in den Sinnesorganen psychische Sinneswahrnehmungen hervor, wie die fünf bekannten, dazu noch Kälte- und Wärmeempfindung, Schmerzempfindung, Gleichgewichtsgefühl, Körpergefühl usf., wobei nicht entschieden zu werden braucht, ob spezifische oder nur graduelle Verschiedenheiten zwischen einigen dieser Wahrnehmungen bestehen. Schwieriger ist es schon, zu begreifen, wenn Reize Erkennen, Erinnern, Denken, Fühlen auslösen, und noch mühevoller, wenn dieses mit mehreren Seelentätigkeiten der verschiedensten Art zugleich geschieht.
Ich habe bei den bisherigen Betrachtungen die unbewußten Seelentätigkeiten von den bewußten nicht getrennt; um so mehr aber muß jetzt ein Unterschied gemacht werden. Über[S. 475] das Verhältnis der ersteren zu den physischen Energien kann man die Behauptungen nicht prüfen, denn es fehlt hier auch die innere Untersuchung, von der äußeren ganz zu schweigen. Bei den bewußten Seelentätigkeiten aber haben wir die innere Prüfung zur Verfügung. Hier glaube ich nun behaupten zu dürfen, daß zwischen Reiz und ausgelöster Seelentätigkeit stets ein anderes sich schiebt, die Kausalität. Es ist bekannt, daß die physische Anschauung apriorische Eigenschaften der Psyche nicht anerkennt. Mit allen Kategorien soll die Kausalität erworben, aus der Erfahrung jedes einzelnen oder ganzer Geschlechter erschlossen, abstrahiert sein. Die Kausalität ist dann, wie alle Kategorien, selbst psychisch wesenlos, denn die Seelentätigkeit ist das Schließen, nicht das Ende des Schließens, der Schluß. Und eine andere Ansicht kann die physische Anschauung vom Leben auch gar nicht haben. Von diesem Standpunkte aus folgt die Kausalität, wie jede Kategorie, den durch Reize ausgelösten Seelentätigkeiten. Der Gegenstand ist außerordentlich schwierig. Ich glaube aber, wie schon bemerkt, in meinem Buche „Philosophische Grundlagen der Wissenschaften“ naturwissenschaftlich das getan zu haben, was Kant philosophisch geleistet hat: erwiesen zu haben, daß Reize bewußte Seelentätigkeiten gar nicht auslösen ohne Mitwirkung der Kausalität, daß diese Mitwirkung — wenn nicht gar Vorwirkung — die unausweichliche Bedingung ist für jedes bewußte Leben in der physischen Welt. In dieser Hinsicht nimmt die Kausalität für das Leben die gleiche Stellung ein wie das Bewußtsein selbst. Ja, man könnte wohl sagen: es gibt gar kein Bewußtsein von der Einheit des Ich im Verhältnis zur äußeren Welt und zu der Mannigfaltigkeit der inneren Welt ohne Kausalität, denn ohne Kausalität ist ein Erkennen sowohl des Verschiedenen als des Gleichen völlig ausgeschlossen, also das Erkennen überhaupt und jeder Zusammenhang. Ich glaube sogar erwiesen zu haben, daß selbst die Anschauung, die wir von den Besonderheiten des Raumes haben, nicht ohne die Kausalität hat gewonnen werden können, gerade wenn naturwissenschaftlich gesprochen wird. Ist dies aber alles zutreffend[S. 476] (man vgl. auch S. 409, 414 f.), wie soll man sich dann die Verbindung zwischen Kausalität — und das gilt auch für alle anderen Kategorien — und physischen Energien vorstellen? Kann da auch nur von einer Auslösung gesprochen werden? Ich glaube, so wenig wie bei der Zeit- und Raumanschauung. Und diese haben wir ununterbrochen im bewußten Zustande, die Kausalität tritt aber hier jedesmal erst auf, wenn ein Reiz ausgeübt wird, und dann folgt die betreffende Seelentätigkeit als Erkennung des Reizes.
Endlich die vierte Klasse, die Verbindung der psychischen Tätigkeiten miteinander. Häckel sagt geradezu: „Jede Psychomform kann in eine andere übergeführt werden“. Also Umwandlung der psychischen Energien ineinander. Hierfür scheint manches zu sprechen. Wir haben die Empfindung „Hunger“; wir essen, und allmählich schwindet diese Empfindung, und es wächst die Empfindung „satt“ heran, die bis zu „übersatt“ steigen kann, die eine oder andere als Äquivalent für die verlorene Empfindung Hunger. So wandelt sich auch mitunter das Gefühl der Verehrung in das der Gleichgültigkeit oder gar der Verachtung, das der Liebe in Haß usf. Indessen kennen wir auch Fälle, in denen von einer Umwandlung des einen in das andere doch wohl nicht die Rede sein kann. Es scheint, als ob die Seelentätigkeiten in Gruppen zu teilen sind, die sich getrennt voneinander halten, sich nicht ineinander wandeln. Worin soll sich das Bewußtsein wandeln, da es doch überall dabei sein muß und, wie das Auge die Gegenstände, so die anderen Seelentätigkeiten wie ganz außer und über ihnen betrachtet? Wer Kategorien, wie die Kausalität, anerkennt, wird auch wegen ihrer in Verlegenheit sein. Sie sind die Regulative für alle inneren Seelentätigkeiten, wie Wahrnehmen, Denken usf. Nehmen wir noch ein handgreiflicheres Beispiel. Es meint ein Mensch, aus Unwissenheit oder aus Aberglauben, oder aus besonderer Stimmung heraus, ein Gespenst zu sehen. Es ist eine innere Wahrnehmung. Bangen, Furcht und Angst ergreifen ihn und dauern mit der Wahrnehmung. Eine Umwandlung der Wahrnehmung in diese Gefühle hat nicht statt[S. 477]gefunden, die Wahrnehmung kann diese Gefühle sogar überdauern. Aus solchen und ähnlichen Beispielen glaube ich entnehmen zu sollen, daß auch die psychischen Energien, um wieder energetisch zu reden, sich nur auslösen, und daß die Umwandlungen nur scheinbar sind, indem immer ein anderes dazwischen tritt, so der Reiz, den die Speisen ausüben, der die eine Empfindung, Hunger, aufhebt und die andere, „satt“ oder „übersatt“, auslöst, neue Wahrnehmungen über den Gegenstand der Verehrung oder Liebe usf. Daß aber außerdem, auch hier wie bei der dritten Klasse, Erscheinungen auftreten, Regulierungen, die keiner physischen Energie zukommen.
Überblicken wir alles bisher Gesagte, so ergibt sich folgendes:
1. Werden die Seelentätigkeiten als physische Energien betrachtet, so hat man sie als auslösende Energien anzusehen. Sie können dann ihr Äquivalent nur ineinander finden, was allgemein nicht zutrifft. Oder sie haben ihr Äquivalent in den physischen Energien der betreffenden Nervenzellen (Ganglien und Ganglienanhäufungen im Gehirn, Rückenmark, Sonnengeflecht), im Psychoplasma, wie Häckel sagt. Das letztere zu behaupten sind die Materialisten und Energetiker naturgemäß am meisten geneigt. Aber haben sie die Behauptung auch schon experimentell bewiesen? Man kann darauf nur mit Nein antworten. Die feststehende Tatsache, auf die sie sich immer berufen, daß Körper und Geist sich stets beeinflussen, ist kein Beweis. Es ist richtig, daß das Gehirn eines müden Menschen durch Dissimilation gewisse Stoffe mehr enthält und andere weniger als das eines nicht müden. Müssen darum diese Umwandlungen Äquivalente der Gedanken- oder Gefühlsenergien sein, können sie nicht indirekt entstanden sein? Man denke an folgenden Fall. Der Wille zwingt einen Muskel, sich zusammenzuziehen oder zu strecken. Während des Zustandes der Kontraktion oder Streckung bildet sich im Muskel als störender Stoff Milchsäure aus, und der Muskel ermüdet und zehrt zuletzt gewissermaßen den Willen auf. Aber unter wie anderen Ernährungsverhältnissen steht der[S. 478] kontrahierte oder gestreckte Muskel gegenüber dem normal liegenden! Diese Änderung der Ernährungsverhältnisse hat die Änderung in der Zusammensetzung des Muskels herbeigeführt, die Änderung ist kein Äquivalent des Willens. Ähnlich ist kaum eine Seelentätigkeit ohne Beeinflussung des Herzens und anderer Teile des Körpers vorhanden. Die dadurch herbeigeführten physischen Änderungen müssen auch die Ernährung der Zellen ändern. Dies alles kann man, wie ich glaube, mit großem Rechte jener apodiktischen Behauptung so lange entgegenhalten, als nicht Beweise im einzelnen beigebracht sind. Und diese fehlen noch, wenn auch zugestanden werden kann, daß die Untersuchung namentlich der Stromschwankungen in den Nerven und der Stoffumsetzungen in den Ganglien einiges in Aussicht stellen mag.
2. Die Seelentätigkeiten bieten Erscheinungen, die bei keiner physischen Energie anzutreffen sind, indem sie namentlich, zur Entwicklung und Erhaltung des Körpers als lebenden Gegenstandes, auch regulierend wirken. Hierüber ist nach dem Gesagten nichts hinzuzufügen.
3. Es gibt Seelentätigkeiten, denen der Charakter von Energien beizumessen nicht angängig ist. Dahin gehört vor allem die Anschauung der Zeit und gehören die Kategorien, wie namentlich die Kausalität, Regulative des inneren Lebens und des Lebens in und mit der äußeren Welt. Auch das Bewußtsein würde ich hierher rechnen als Organ zur Wahrnehmung des inneren Lebens.
Endlich bedenke man noch folgendes: Was haben wir von den physischen Erklärungen der psychischen Tätigkeiten noch außerdem zu verlangen?
4. Alle physischen Vorgänge müssen sich zusammengefaßt als ein Gesamtes erkennen; es entspricht das unserem Bewußtsein von unserem Ich und dem was auf S. 455 f. davon und von den Ostwaldschen Reaktionsfolgen gesagt ist.
5. Jeder physische Vorgang muß sich außerdem für sich in sich erkennen.
6. Jeder physische Vorgang muß jeden anderen Vorgang kennen und erkennen, da jeder jeden anderen hervorruft und[S. 479] korrigiert, zum Beispiel die Empfindung Schmerz den Willen Schreien.
7. Kein physischer Vorgang darf durch Hinzutreten neuer Vorgänge oder durch Schwinden vorhandener gestört werden. Das könnte man physisch noch am ehesten verstehen.
8. Jeder physische Vorgang muß andere Vorgänge, beliebiger Art, selbst entgegengesetzte, voraussehen, denn wir kennen unsere inneren und äußeren Handlungen und wissen, was auf jeden Vorgang in uns folgt, bis zu bestimmter Vorstellung oder gar Wahrnehmung.
Wer das alles von physischen Vorgängen glaubt zugestehen zu können, mag die Welt der Psyche der Welt der Physis gleich machen. Ich persönlich halte ein solches Zugeständnis für ganz undenkbar. Automaten, selbst solche unseres phantastischesten Dichters E. T. A. Hoffmann wird wohl niemand mehr als Beispiele anführen. Oberflächliche Analogien kann man überall finden. Darum handelt es sich nicht. Um bestimmte Verständlichmachung handelt es sich, daß man mit Einsicht sagen kann: Jawohl, so kann es sich in der Tat verhalten. Davon aber sind Mechanistik und Energetik unendlich weit entfernt, selbst wenn man von den Widersprüchen absieht, in die sie sich gegen sich selbst verwickeln und von denen der bedeutendste der der Gegenwirkung des physischen und des psychischen Regulativs ist. Die physikalisch-chemischen Gesetze wirken im Leben ganz so wie in der unbelebten Welt. Aber sie sind im Leben nicht die einzigen Gesetze, es kommen noch andere Gesetze hinzu, namentlich regulierende, die in der unbelebten Welt nicht bestehen, soviel wir wissen, und deren Aufgabe in Gegenwirkungen gerade gegen jene physikalischen Gesetze besteht. Auch die physikalisch-chemischen Erscheinungen erschöpfen das Leben nicht; es sind im Leben noch andere Erscheinungen vorhanden, die wir in der unbelebten Welt nicht treffen, wie die wunderbaren der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung aus den unzähligen Möglichkeiten (S. 448 ff.). Das Leben enthält eben mehr als das Unbelebte, und zwar Eigenes, Besonderes.
Nun noch einige Worte. Die physischen Anschauungen bringen es anscheinend mit sich, daß weder von Gott noch von Freiheit oder Unsterblichkeit gesprochen werden kann. Ich will nur über das letztere etwas sagen, die Unsterblichkeit. Als Ganzes kommt sie physisch nicht in Betracht. Aber vielleicht zum Teil? Wir wissen, daß in der Natur Wärme unsterblich ist. Alle Vorgänge in der Natur sind irgendwo mit Wärmeentwicklung verbunden. Wärme ist nur beschränkt in andere Energie verwandelbar, also muß insgesamt immer eine Wärmezunahme erfolgen. Und so steigt die Menge Wärme im Weltall zu bestimmtem Höchstbetrag, der dann bleiben muß (vgl. jedoch S. 440). Wenn in den psychischen Energien solche vorhanden sein sollten, die gleichfalls nur beschränkt verwandelbar sind, so müssen diese stetig zunehmen. Ohne Umwandlungen sind solche Energien Leben ohne Tätigkeit; also dieses Leben muß im Weltall stetig wachsen. Am Ende sind diese Energien allein von allen psychischen Energien vorhanden, und wir haben nur Leben ohne Tätigkeit, kein anderes. Das erinnert frappierend an das buddhistische Nirwana-Leben. Es ist ein Leben, nur ohne Tätigkeit. Und sollten etwa gar selbst die sonst beschränkt verwandelbaren Energien der Natur diesen psychischen Energien gegenüber unbeschränkt verwandelbar sein, was ja in keiner Weise ausgeschlossen ist, so würden überhaupt die letzten Energien nur Leben sein, ohne Tätigkeit. Das Nirwana-Leben würde in den Äther versinken, wo es zum Beginn der Welt war und durch einen gewaltigen Akt in physisches Leben übergeführt worden ist, um am Ende der Tage in den Äther zurückzukehren. Kaum brauche ich hervorzuheben, daß diese Unsterblichkeitslehre nicht die spiritualistische ist, die sich ja auf das Individuum bezieht, während es sich hier um das Gesamte handelt, wofür Häckel in seinem Psychom-Erhaltungsgesetz sie unmittelbar feststellt. Aber etwas Individuelles haftet ihr doch auch an, wenn die Psychome eben nur beschränkt verwandelbar sind. Fast ist es schade, daß man eine Theorie ablehnen muß, die zu so bedeutenden Unsterblichkeitsfolgerungen führen kann. Aber gegenwärtig scheint[S. 481] mir jede Anschauung auf rein physischer Grundlage aussichtslos.
In letzter Stunde ist mir eine Schrift von Felix Auerbach bekannt geworden, „Ektropismus oder die physikalische Theorie des Lebens“. Der zweite Titel hätte besser fortgelassen werden sollen, denn eine physikalische Theorie des Lebens wird nicht gegeben, nicht einmal angedeutet. Nur daß der Verfasser der Ostwaldschen Energetik anhängt, möchte aus der Schrift hervorgehen. Doch spricht er von Geist und Willen wie von etwas Besonderem — er nennt sie das „Göttliche“ im Menschen — gegenüber den Erscheinungen in der unbelebten Natur. Es handelt sich also nur um den Ektropismus. Ektropismus nun ist der Gegensatz zum Entropismus. Letzterer bedeutet, wie wir wissen, und Auerbach namentlich feststellt, die Ausgleichung, Zerstreuung und Entwertung der Energie. Ektropismus bezieht sich also auf Sonderung, Konzentrierung und Werthebung der Energie. Von selbst tritt allein Entropismus ein, Ektropismus dagegen immer nur durch Wirkung von außen. So ist der Vorgang des Falles schwerer Körper entropisch, die Körper fallen von selbst. Das Steigen schwerer Körper aber ist ektropisch, in jeder höheren Lage haben sie mehr Energie. Und von selbst steigen sie nicht, sie müssen von außen gehoben oder heraufgedrückt werden. Auerbach ist nun der Ansicht, daß die belebten Wesen ektropisch wirken. Das ist an sich nicht neu; denn daß die lebenden Wesen Energien vor der Zerstreuung wahren und aufspeichern, z. B. die Pflanzen in ihrem Körper, wer weiß es nicht? Aber Auerbach gibt dieser Tatsache eine höhere Bedeutung, und zwar analog derjenigen der Regulation (S. 451). Das Leben ist eine Regulation gegen den Tod des Weltalls, der nach dem Entropieprinzip unvermeidlich eintreten soll; ist es kein absolut abhelfendes Prinzip — verstehe ich Auerbach recht, so möchte er sogar so weit gehen — so ist es doch jedenfalls ein retardirendes. Daß Anfang und Ende aufs genaueste zusammenhängen, stellt auch er fest, und so will ich seinen Hauptsatz, soweit er hier in Betracht kommt, im Wortlaut anführen. Er setzt einen Urzustand etwa im Sinne[S. 482] Eugen Dührings voraus, Chaos nennt er ihn, in dem also alle Energie entropisch war (oder war gar keine Energie da?), da keine Vorgänge bestanden. Dieser Urzustand wurde plötzlich durch einen Schöpfungsakt zur höchstmöglichen Ektropie gebracht: „Am Anfange wurde aus dem Chaos der Kosmos (also die Welt der Vorgänge). Das Chaos war schlaff und träge, der Kosmos ist gespannt und bewegt. Das Chaos ist leer, der Kosmos ist gefüllt mit Energie. Ihre Quantität bleibt immer dieselbe, aber ihre Qualität unterliegt fortwährendem Wandel; und was die Rolle der Wandlungen durchgemacht hat, ist für den Kosmos verloren. Spannung und Bewegung lassen nach, die Energie wird gebunden und zerstreut, verwirrt und entwertet, die Energie strebt einem Maximum zu. Da tritt eine neue Erscheinung auf den Plan: das Leben. In der leblosen Natur herrscht der Ablauf, nur schwach gedämpft durch den Aufzug. In der lebendigen Natur herrscht die Entwickelung, und sie versucht, dem auch hier tätigen Ablauf die Spitze zu bieten. Der Versuch gelingt nur allmählich und nur in bescheidenen Grenzen. Aber die ordnende, auslösende und ektropische Begabung kommt und reift mählich und heimlich. Und im Menschengeschlechte feiert sie mit strahlendem Glanze das Fest ihrer Befreiung.“ Das Leben ist wie ein „Wächter“, der unablässig eingreift und das „Schädliche“ (das Entropische) „absiebt“. Wenn der Leser das in unsere einfache Sprache überträgt, so findet er es nicht weit von den hier geäußerten Ideen, wenigstens nach einer Richtung, denn die anderen, fast noch bedeutungsvolleren Regulationen kommen bei Auerbach nicht zur Behandlung. Eigenartig ist noch, daß Auerbach an die Entstehung des Kosmos aus dem Chaos die Entstehung auch der größten Ordnung anschließt, die allmählich entropisch in die Un-Ordnung übergeht (S. 441). Das Leben greift wieder regulierend ein, es schafft Ordnungen aus den Un-Ordnungen. Wie das Leben dieses tut, wie es überhaupt den Kampf gegen den Entropismus durch Ektropismus führt, darüber sagt der Verfasser nichts Bestimmtes. Aus einigen Nebenäußerungen möchte man schließen, daß er das Leben in gewissen selektiven Eigenschaften der protoplasmati[S. 483]schen Stoffe sucht, analog etwa der selektiven Eigenschaft mancher als halbdurchlässig bezeichneten Stoffe, die zum Teil von einer Zuckerlösung wohl das Wasser, aber nicht den Zucker durchlassen. Aber freilich sollte die grobe Mechanistik seinem System sehr fern stehen. Wegen der weiteren Schlüsse in bezug auf das Verhalten des Menschen und der Menschheit, darf ich auf die sehr interessante Schrift verweisen. Der Satz „Der Kosmos — und mit ihm sein Vertreter, der Staat — hat ein direktes Interesse nur an dem starken und ektropischen Individuum“, klingt ganz nach Nietzsche.
Alles was in diesem Abschnitt ausgeführt ist, hängt mit dem Vitalismus und Neuvitalismus, z. B. nach Reinke, zusammen. Ich habe diese Bezeichnungen zu benutzen vermieden; ihre Bedeutung geht nach der einen Seite, nach der physischen, zu weit, nach der anderen Seite, nach der psychischen, hier geistigen, viel zu sehr in die Enge. Man soll auch keine Worte auffrischen, die nun einmal, und mit Recht, eine so unwissenschaftliche Nebenbedeutung bekommen haben wie der Vitalismus. Ich schließe dieses Buch mit einigen Bemerkungen über die Welträtsel im allgemeinen.
Du Bois-Reymond, in seiner berühmt gewordenen Ignorabimusrede, die Häckel einer psychologischen Metamorphose zuschreibt, die aber aus einer allmählich gewachsenen Erkenntnis geflossen ist, daß der Materialismus in keiner Form ausreicht, die „Welträtsel“ zu lösen, wie sie ja bei vielen anderen Forschern gleichfalls allmählich sich geltend machen mußte, hat sieben solche Welträtsel aufgestellt. Drei davon sollen überhaupt unlösbar, „transzendent“ sein: der Ursprung der Materie und der Kraft, der Ursprung der Bewegung, die Entstehung der einfachen Sinnesempfindung und des Bewußtseins. Drei andere sollen lösbar sein, wenn auch schwer: die Entstehung des Lebens, die (anscheinend absichtsvolle) Zweckmäßigkeit der Natur, das vernünftige Denken und der Ursprung der damit verbundenen Sprache. Eines bleibt unentschieden: die Frage nach der Willensfreiheit. Hat die spätere Entwicklung der physischen An[S. 484]schauungen dem Manne Unrecht gegeben? Ich glaube nein! Im Gegenteil, mir scheint sie die Rätsel noch mehr transzendent gemacht zu haben als er sie auffaßte. Wir sehen, selbst mit den bei weitem besseren Mitteln der Energetik kommt man der Lösung jener Rätsel nicht einen Schritt näher, höchstens, daß man sie auf andere Dinge bezieht, etwa das erste Welträtsel statt auf Materie und Kraft, auf Energie mit seinen beiden Faktoren; das zweite Rätsel statt auf Bewegung auf Energieumwandlung. Nur das Ignorabimus möchte ich ablehnen. Es ist gar kein Ignorare, wenn man sich davon überzeugt hat, daß es in der Welt doch etwas mehr gibt als ein Einzelnes im ewigen Einerlei der Existenz und des Wechsels. Wir suchen zwar überall nach Vereinfachung und sollen danach suchen. Wenn aber Vereinfachungen zu nichts führen als zu Redewendungen, ohne die Einsicht in das Wesen der Sache irgend zu fördern, und nur Rätsel und Unverständliches zu Rätseln häufen, so sind sie kein Gewinn und müssen fallen gelassen werden, sobald ihre Untauglichkeit erkannt ist. Bei den rein physischen Anschauungen ist dieses, glaube ich, der Fall. Die rein materialistische mag schon kein Mensch mehr. Die energetische, so bestechend sie ist, wird, davon bin ich überzeugt, ihr Schicksal teilen. Spinozas Anschauung in Verbindung mit Kants Transzendentalismus, scheint mir allem am besten gerecht zu werden, soweit menschliche Voraussicht und Einsicht etwas behaupten darf. Sie bietet noch den ungeheuren Vorteil, daß wir sie so leicht fortführen und erweitern können, wie Häckels Beispiel zeigt. In der Tat müssen wir jetzt schon sagen, daß der allgemeinen Substanz für unsere Welt mindestens drei Attribute zukommen: Geist, Energie, Materie (oder was für Materie stehen kann). Die allgemeine Substanz soll ja unendlich viele Attribute haben. So ist es durch nichts ausgeschlossen, daß unsere Welt in der Tat diese drei oder vielleicht noch mehr Attribute ausmacht. Und andere Welten, von denen schon die Alten träumten, können mit diesen noch andere Attribute bedeuten in beliebiger Zahl. Wer also ein Ding-an-sich mit unendlich vielen[S. 485] Attributen annimmt, muß unendlich viele Welten zugestehen und vielleicht noch Übergänge und Überdeckungen zwischen ihnen. Und er darf sogar die Leben-Reihe (S. 221) durch diese verschiedenen Welten führen. Auch eine solche Auffassung bildet einen Monismus und gehörte in die Anschauungen des so umfassenden Monistenbundes. Aber freilich verirrt sich schon manches ins Mystische, wohin Kant auch seine „Träume eines Geistersehers“ geführt haben, da wir von nichts wissen als allein von unserer Welt.
Namen- und Sachregister.
- A
- Aberglaube 27, 434.
- Abspiegelung, die Welt als 300, 379.
- Abwehrformeln 190.
- Achamoth 273 ff.
- Adam 150.
- Adam von Bremen 93.
- Afrika 20 ff., 57 ff. u. a. a. O.
- Agnostizismus 420.
- Agrippa Cornelius 312.
- Ägypter 100 ff., 129, 132, 155, 158, 165, 180, 184, 188, 198, 219, 228 u. a. a. O.
- Ahnenkult 43 ff., 46 u. a. a. O.
- Aion 271 u. a. a. O.
- Akademie 248, 355.
- Akzidens 289.
- Alanus 303.
- Albertus Magnus 294.
- Alchemie 290.
- d’Alembert 435.
- Allegorie 98.
- Alte vom Tage 291.
- Altruismus 437 u. a. a. O.
- Amerika 17 ff. u. a. a. O.
- Ammonios Sakkâs 277.
- Amulett 40.
- Ananke, ἀνάγκη 250, 352, 422.
- Anaxagoras 243, 269, 423.
- Anaximandros 237, 269.
- Anaximenes 236.
- Andrée 164.
- Animismus 36 ff. u. a. a. O.
- Anschauungsformen 360 ff., 475 f. u. a. a. O.
- Anselm 300.
- Antinomien 363 ff.
- Apokastase 253.
- Apollonios von Tyana 256.
- A posteriori 360 ff.
- Appetition 341 ff.
- A priori 360 ff.
- Araber 108, 208.
- Archeus 329.
- Archonten 257, 273.
- Archytas 242.
- Ariost 18.
- Aristoteles 249 ff. u. a. a. O.
- Arkesilaos 355.
- Arnobios 269.
- Arrhenius 179, 448.
- ἀρχαί 7 ff.
- Aschariten 288.
- Äschylos 185.
- Assimilation 372, 473.
- Assoziationsprinzipe 359, 400, 411, 415, 418.
- Assyrier 108 ff.; s. a. Babylonier.
- Astrologie 109, 188, 290.
- Atheismus 154.
- Äther 465 f.
- Atomistik 422 ff., 465 f. u. a. a. O.
- Attribute 335, 392 ff., 461 f., 484 u. a. a. O.
- Auerbach, Felix 463, 482 f.
- Auferstehung 192 ff.
- Aufklärungsphilosophie 347, 434 ff.
- Augustinus 281, 315.
- Australien 17 u. a. a. O.
- Automatisches 419, 428, 479 u. a. a. O.
- Averroes 288, 295.
- Avicebrol 291.
- Avicenna 288.
- Avidyia 350.
- Awatars 169.
- B
- Babylonier 108 ff., 130, 134, 153, 158, 160, 161, 178, 183, 196.
- Bacon Roger 299.
- — von Verulam 402 ff.
- Barden 95.
- Basilides 268 ff.
- Bastian Adolf 66 ff.
- Baur 267.
- Begriffsgottheiten 141 f.
- Belebung 32 ff., 424, 436 u. a. a. O.
- Beneke 413.
- Berkeley 356 ff.
- Bernhardy 426.
- Bernouilli 441.
- Beschwörung 54, 190.
- Beseelung 36 ff., 319, 382 ff., 390, 424, 436 u. a. a. O.
- Besessene 56.
- Bessarion 309.
- Bewegungsmoment 459.
- Bewußtsein 400, 474 ff. u. a. a. O.
- Bewußtseinsleiter 399.
- Bewußtseinsschwelle 399.
- Bhagavad-Gîtâ 115 u. a. a. O.
- Bibel 106 f., 157, 177, 184 u. a. a. O.
- Biogenetisches Grundgesetz 449.
- Blavatsky, Helene Petrowna 330.
- Böhme, Jakob 323 ff. u. a. a. O.
- Boltzmann 440.
- Bonaventura 303.
- Boyle, Robert 434.
- Brahmaismus 120.
- Brugsch 100, 146 u. a. a. O.
- Bruno Giordano 317 ff. u. a. a. O.
- Büchner 438.
- Buddha 215 u. a. a. O.
- Buddhismus 120, 122, 214.
- Bürger 55.
- C
- Calvin 315.
- Campanella 322.
- Cartesius 333 ff.
- Cäsar 88 f., 94, 97, 216.
- Centrosom 450.
- Chachma 266.
- Chamberlain 83.
- Chauvinismus 83.
- Cherubim 280.
- Chinesen 120 f., 143, 164, 210, 235.
- Christian Science 257.
- Chromatin 450.
- Chrysippos 233.
- Cicero 99, 253.
- Civitas dei 294.
- Claudius, Kaiser 95.
- Clausius 441.
- Comte 40, 415 ff.
- Condillac 411.
- Constant, Benjamin 29.
- Contemplatio 304.
- Cooper 23.
- Curtis 50 f.
- Cusanus, Nikolaus 306.
- Czolbe 438.
- D
- Dämonenglaube 43 ff., 53, 257.
- Dante 206, 297.
- Darwin 445 ff., 450 ff.
- Deismus 253 ff.
- Delitzsch, F. 153.
- Demiurg 268 f. u. a. a. O.
- Demokritos 423 f.
- Dennis 205.
- Derwische 261.
- Descartes 333 ff. u. a. a. O.
- Deszendenzlehre 445 ff., 449.
- Determinismus 296.
- Dharma 215.
- Diderot 435.
- Diels 352 u. a. a. O.
- Dies fasti et nefasti 191.
- Ding-an-sich 365, 390 ff., 461 ff. u. a. a. O.
- Diogenes von Apollonia 236.
- Dionysios Areopagita 280.
- Dissimilation 372, 455.
- Doketen 276.
- Driesch 343, 370, 450 f.
- Droßbach 345.
- Dualismus 13, 148, 267, 458 ff. u. a. a. O.
- Dubois Reymond 438, 471, 483.
- Dühring, Eugen 416 ff., 463, 481.
- Duns Scotus 298.
- E
- Eckehart, Meister 303.
- Edda 93 f.
- Egoismus 435.
- Ei 450 ff.
- εἴδωλον 37, 193.
- Einheitlichkeit der Welt 16 ff.
- Eklektiker 261.
- Ektropie 480 ff.
- Eleaten 351 u. a. a. O.
- Elemente 423.
- Elysium 204.
- Emanationslehre 253 ff., 263 f., 278 u. a. a. O.
- Empedokles 220, 423.
- Empirismus 376, 401 ff., 454 ff., 483.
- Endlichkeit 363 f., 464 f.
- Energetiker 454, 483.
- Energie 421 ff., 454 ff. u. a. a. O.
- — psychische 455 ff.
- Energismus 420 ff.
- Engel 261 u. a. a. O.
- Entelechie 250 u. a. a. O.
- Entropie 440 u. a. a O.
- Entwicklungslehre 443 ff.
- Enzyklopädismus 435.
- Epigenesis 448.
- Epikuros 425.
- Eranier 110, 131, 139, 148, 159, 162, 166, 174, 202, 216.
- Erhaltungsprinzipe 440.
- Eristik 354.
- Eschatologie 71 ff., 192 ff.
- Eschmunazar, König 108.
- Essäer 276.
- Ethische Gottheiten 138 f.
- Etrusker 205.
- Eucken 390.
- Euemeros 52, 97.
- Eukleides aus Megara 354.
- Euripides 96 f., 183, 244.
- Evolution 258, 269, 282, 295, 420, 447 f., 452.
- F
- Fakire 261.
- Fananybrauch 42.
- Fatalismus 138, 234, 437.
- Faust 54, 266.
- Fechner 398 f.
- Fegefeuer 192 ff.
- Ferment 329.
- Fervers 111, 208.
- Fetische 39 ff., 90, 104 u. a. a. O.
- Fetischismus 36 ff.
- Feuerbach, Ludwig 438.
- Feuth, Ludwig 113.
- Fichte 358, 373 f.
- Flammarion 399.
- Florenz, Karl 124.
- Fludd 329.
- Flutsagen 161 ff.
- Fohi 121.
- Foismus 122.
- Formen 249, 383 u. a. a. O.
- Frank, Sebastian 316.
- Franziskus der Heilige 300.
- Freiheit 182 ff., 367, 393, 479 u. a. a. O.
- Fresnel 441.
- Frobenius 5, 42, 57 ff., 74, 79.
- Frohars 111, 208.
- Funktionsübertragung 453.
- G
- Ganglien 455, 473.
- Gassendi 431.
- Gastrulation 450.
- Gegengottheiten 148 f.
- Gegenstandsgottheiten 127 ff.
- Geheimbünde 57, 254.
- Geheimlehre 189.
- Geister 55.
- Geisterglaube 48 ff., 53.
- Geistige Vorgänge 455 ff.
- Generatio equivoca 384, 446.
- Germanen 88 ff., 136 f., 140, 156, 158, 167, 173, 206.
- — Nord- 92 ff.
- Gerson, Johann 303.
- Gespenster 53.
- Geulincx 336.
- Gilgamesepos 109, 188, 196.
- Gleichartigkeit der Menschheit 11 f.
- Gnostiker 267 ff., 277 u. a. a. O.
- Goethe 266, 275, 277, 307, 396, 445.
- Gorgias 355.
- Götterglaube 56.
- Götterneid 185.
- Götzenbilder 48.
- Götzendienst 43 ff.
- Graßmann 103 u. a. a. O.
- Grey 4, 53.
- Griechen 50, 95 ff., 130, 137 f., 143, 162, 167, 171, 203, 230 u. a. a. O.
- Grimm, Jakob 37, 45, 73, 75, 90 ff.
- Gruppe 255 f.
- Gubernatis 114.
- H
- Häckel 401, 449, 461 ff.
- Hades 204.
- Hafis 261.
- Halbkulturvölker 4.
- Haller, Albrecht v. 447.
- Hammurabi 110.
- Hanusch 86.
- Harmonie 241.
- — Gesetz der 453.
- — Prästabilierte 338 ff.
- Harnack, Adolf 267 ff., 274.
- Harpyen 73.
- Hartmann, Eduard v. 386 ff.
- — Franz 330.
- Hebräer 49, 106 ff., 144, 156, 177, 192.
- Hegel 376.
- Heimarmene, εἰμαρμένη, 239, 422.
- Hel 206 f.
- Helmholtz 448, 471.
- Helmont, Baptist van 328.
- — Franz van 338.
- Hemsterhuis 413.
- Henotheismus 144, 147 ff.
- Herakleitos 238, 353.
- Herbart 347.
- Herder 435.
- Hermogenes 269.
- Herodot 45 f., 50, 89, 106.
- Hesiod 158, 172.
- Hexen 53 ff.
- Hierarchie 280.
- Himmel der Erde gleich 17 ff.
- Himmelskörper 466 u. a. a. O.
- Hinduismus 119.
- Hippias 355.
- Hobbes 432 f.
- Hoffmann, E. T. A. 479.
- Holbach 435 ff.
- Hölle 78, 192 ff., 208.
- Homa 96, 155 f., 171.
- Homer 112.
- Homoiomerien 423.
- Horatius 188.
- Hugo von St. Victor 300.
- Hume 358, 407 ff.
- Hylodeismus 236 ff.
- Hylopsychismus 235 ff.
- Hylozoismus 235 ff.
- Hypostasie 366, 437.
- I
- Ideale 365.
- Idealismus 349 ff., 360 ff. u. a. a. O.
- Idealphilosophie 253, 349 u. a. a. O.
- Ideen 244 ff., 264, 335, 364, 405 u. a. a. O.
- Ideenassoziation 432 u. a. a. O.
- Identitätsphilosophie 385 ff. u. a. a. O.
- Idololatrie 50 f.
- Illusionslehre 350.
- Indier 113 ff., 132, 135, 139, 156 f., 161, 162, 166, 176, 187, 200, 211, 228, 258, 350 f., 424.
- Indifferentismus 234.
- Individuation 295.
- Induktion 402.
- Inkarnationen 169.
- Intelligenzen 288.
- Intelligible Dinge 282 u. a. a. O.
- Intensität 457.
- Intuition 263 u. a. a. O.
- Irreversibilität 440 f.
- Isaak 302.
- Istars Höllenfahrt 197.
- Italiker 158.
- J
- Jamblichos 277.
- Japaner 123 f., 133, 164, 210, 235.
- Jehuda Halevi 293.
- Jenseits der Kulturvölker 192 ff.
- — — Naturvölker 71 ff.
- Jeremias, Alfred 110 u. a. a. O.
- Jezira 291.
- Johannes, Apostel 265.
- K
- Kabbala 290 ff.
- Kalpa 201.
- Kant, Immanuel 359 ff., 484 u. a. a. O.
- Kapazität 457.
- Karäer 293.
- Karlstadt 316.
- Karma 215, 330.
- Karneades 355.
- Katasterismen 34.
- Kategorien 222 f., 360 ff. u. a. a. O.
- Kategorischer Imperativ 367.
- Kausalität 409, 414 f., 474 ff. u. a. a. O.; s. auch Kategorien, Regulative.
- Keimteilchen 423, 447.
- Kelten 94 ff., 208, 216.
- Kepler 345.
- Kiesewetter 293.
- Kismet 138, 288.
- Klopstock 150.
- Kohärente Systeme 441, 467.
- Konstitutionsprinzip 366 ff.
- Kopernikus 321, 428, 432.
- Kosmos, κόσμος 238, 240, 481 u. a. a. O.
- Kräfte als Wille 382 ff.
- Krause 328.
- Kritizismus 355 u. a. a. O.
- Krönig 441.
- Kultur 80 ff.
- Kulturvölker 4, 6, 80 ff.
- Kyrenaiker 355 f.
- L
- Labilität 439 ff.
- Lactantius 270.
- Lamaismus 122.
- Lamarck 445.
- Lamettrie 435 ff.
- Lange, F. A. 422, 438.
- Lao-tsse 210, 220, 235, 350.
- Lasson, Adolf 319, 401.
- Lavater 396.
- Leben 16 ff., 482 u. a. a. O.
- Lebenanschauung, Erklärung 1 ff.
- Leben-Reihe 220 ff.
- Lebensschicksal 182 ff.
- Leere 240, 424.
- Leibniz 340 ff. u. a. a. O.
- Lessing 346, 434.
- Leukippos 424.
- Liber scriptus 299.
- Liber vivus 299.
- Lichtreich 272.
- Lilith 150.
- Lippert 40 ff., 84 ff., 90 ff., 102 f., 112, 124 ff., 131.
- Littauer 85, 87, 164.
- Livingstone 74.
- Locke, John 402 ff.
- Logos 142, 262, 265 ff., 422 u. a. a. O.
- Longfellow 21.
- Longinus 277.
- Lotze 396 f.
- Lucanus 95.
- Lucretius Carus 426 ff., 441.
- Lullus, Raimundus 305.
- Luther 265, 314.
- M
- Mach, Ernst 414, 417 ff.
- Magier 112.
- Maimonides 293.
- Malebranche 336.
- Mandäer 276.
- Manichäer 270 ff.
- Manu 213, 217.
- Märchen 22.
- Marsilius Ficinus 309.
- Maschinen 369, 457.
- Materialismus 420 ff., 467 f., 477 ff. u. a. a. O.
- Materie 246, 279 u. a. a. O.
- Maui 4 ff., 21.
- Maxwell 441, 466.
- Maya 350.
- Mayavölker 125.
- Mechanismus 420 ff. u. a. a. O.
- „Medizin“ 42 ff.
- Melanchthon 314.
- Melissos aus Samos 354.
- Mendelssohn, Moses 345.
- Menschenopfer 46 u. a. a. O.
- Messiasidee 169.
- Metamorphosen 37.
- Metempsychose 214 f.
- Metensomatose 214 ff.
- Mexikaner 124.
- Meyer, Ludwig 391.
- Milton 150.
- Mirabaud 435.
- Modus 335, 392.
- Mohammedanismus 208.
- Moleschott 13 u. a. a. O.
- Monaden 339, 340 ff., 397 u. a. a. O.
- Monismus 13 u. a. a. O.
- Monistenbund 484.
- Monolatrie 70.
- Monotheismus 151 ff.
- Montaigne 330.
- Montesquieu 413.
- Morphologisch-Biologisches Ordnungsgesetz 453.
- Morphologisches Gesetz 451.
- Mose de Leon 291.
- Motakhallim 287.
- Muatazile 287.
- Müller, Johannes 470.
- — K. O. 205.
- — Max 20, 24 ff., 33 f., 38, 81, 115, 211, 217, 265.
- Multismus 13.
- Mysterien 57.
- Mystiker 290 f., 293 ff., 300 ff. u. a. a. O.
- Mystizismus 254 u. a. a. O.
- Mythologie 56.
- N
- Natur 251.
- Naturalismus 401 ff.
- Naturgesetze 439 ff.
- Naturphilosophen 231 u. a. a. O.
- Naturphilosophie 376.
- Naturreligion 56 f.
- Naturvölker 4, 16 ff.
- Naturzweck 369 ff.
- Nekromantie 254.
- Nephesch 292.
- Neschamah 292.
- Neuplatonismus 277 ff.
- Neupythagoräer 255 ff.
- Neuspinozismus 396.
- Neuvitalismus 483.
- Newton 428, 434.
- Nichtordnung, elementare 441, 482.
- Nichtumkehrbarkeit 440 f.
- Nietzsche 385.
- Nikolaus Cusanus 306.
- Nirvana 211 ff., 226, 480 u. a. a. O.
- Nominalisten 293 f. u. a. a. O.
- Noumena 363.
- Nukleus 450.
- Nus, νοῦς 243 u. a. a. O.
- O
- Objektivation 379 ff.
- Occasionalismus 336, 413 u. a. a. O.
- Occultismus 254.
- Offenbarung 30, 294.
- Ontogenie 445 ff., 449.
- Ophir 61.
- Ophiten 276.
- Orakel 189.
- Orcus 205.
- Organisierte Dinge 369.
- — Wesen 369 ff.
- Orphiker 255 f.
- Ossian 95.
- Ostwald, Wilhelm 454 ff., 462 u. a. a. O.
- Otto III., Kaiser 300.
- Ovid 100.
- Ozeanier 17 ff.
- P
- Palingenesie 449.
- πᾶν, τό 231, 255.
- Pan 255.
- Pandämonismus 56.
- Pandeismus 227 ff., 254 u. a. a. O.
- Panpsychismus 235 ff. u. a. a. O.
- Panspermie 317, 447.
- Pantheismus 227, 390 ff.
- Pantheos 234.
- Paracelsus 316.
- Paradies 78, 159, 192 ff., 208.
- Paraklet 270.
- Parallelen, anthropologische 10 ff.
- Parallelismus, psychophysischer 393, 397 ff. u. a. a. O.
- Paralogismen 363 ff.
- Parmenides 352.
- Pascal, Blaise 329.
- Patristische Philosophie 281.
- Patritius 317.
- Paulus Diaconus 45.
- Pausanias 97.
- Peraten 276.
- Peripatetiker 253.
- Peruaner 125.
- Perzeption 341.
- Pessimismus 384 ff.
- Peters, Carl 61.
- Phänomenalismus 356 ff. u. a. a. O.
- Pherekydes 256.
- Philolaos 242.
- Philon 261 ff.
- Philostratos 257.
- Phönizier 108.
- Phylogenetische Evolution 452.
- Phylogenie 445 ff., 449.
- Physische Energien 468 ff., 473 u. a. a. O.
- Physizismus 420 ff.
- Pico Giovanni 310 f.
- Pistis Sophia 274.
- Planck, Max 418, 440, 442.
- Platon 217 f., 221, 244 ff. u. a. a. O.
- Pleroma 272.
- Plethon Gemistos 309.
- Plotinos 277 ff.
- Pluralismus 13.
- Plutarchos 257.
- Poincaré 417.
- Polarität 324, 450.
- Polygnotos 204.
- Polylatrie 70 f.
- Polynesier 66 u. a. a. O.
- Polytheismus 127 ff.
- Porphyrios 277.
- Positivismus 394, 401 ff.
- Potentialität 250, 414.
- Potenz, morphologische 451.
- Prana 223, 230.
- Prädestination 285 u. a. a. O.
- Prädetermination 414 u. a. a. O.
- Prediger 186.
- Preußen 87.
- Primalitäten 322.
- Prinzipe 7 ff., 367 ff.
- Prodikos 355.
- Propheten 107.
- Protagoras 355.
- Protoplasma 450 ff., 468.
- ψυχή 36 ff. u. a. a. O.
- Psychische Energien 454 ff., 468.
- Psychologie, assoziative 359, 397, 400, 411, 415, 418 u. a. a. O.
- Psychom 461.
- Psychophysik 398.
- Psychophysiologie 399.
- Psychoplasma 477.
- Pyramidentexte 198.
- Pyrrhon 355.
- Pythagoräer 217, 239.
- Pythagoras 239.
- Q
- Qualitates occultae 313.
- Quellgeister 325 ff.
- Quincke 468.
- Quinta essentia 313, 316.
- R
- Rabbaniten 293.
- Ramanuga 258.
- Rationalismus 333.
- Ratzel 61.
- Raum 246, 360, 433 u. a. a. O.
- Realen 347.
- Realismus 349 ff., 401 ff. u. a. a. O.
- Realisten 293 f. u. a. a. O.
- Regeneration 453.
- Regulation 454, 481.
- — biologische 454.
- — morphologische 454.
- Regulative 360 ff., 365 ff., 439 ff. 471.
- Reinkarnation 211 ff.
- Reinke 483.
- Religionsursprung 23 ff., 434 ff.
- Rephaim 193.
- Restitution 452 f.
- Resurrektion 79.
- Reuchlin, Johann 311.
- Reversibilität 440 f.
- Richard von St. Victor 302.
- Riehl 401.
- Rigveda 20 u. a. a. O.
- Ritter, Heinrich 466.
- Römer 50, 98 ff., 129, 143, 172, 203.
- Rousseau 413.
- Ruach 292.
- Rudimentäre Organe 450.
- Runen 94.
- Ruysbroek 304.
- S
- Salomon ben Gabirol 291.
- Samenteilchen, Keimteilchen 423 ff.
- Sankara 260, 351.
- Sankhya 259.
- Satan 149 ff.
- Schamanismus 39, 44 ff., 122.
- Scheible 293.
- Schelling 327, 375.
- Schicksalsgottheiten 136 ff.
- Schiller 367.
- Schleiermacher 378.
- Schmitt, Heinrich 267, 271, 274.
- Scholastiker 293 f., 305 u. a. a. O.
- Schopenhauer 379 ff.
- Schöpfer 131 u. a. a. O.
- Schöpfung 464 u. a. a. O.
- Schwartz, W. 132.
- Schwenkfeld 316.
- Scotus Erigena 283 f.
- Seele 36 ff., 45, 71 ff., 343 u. a. a. O.
- Seelenarten 221 ff.
- Seelenkult 43 ff. u. a. a. O.
- Seelentätigkeiten 221 ff., 473 ff. u. a. a. O.
- Seelenwanderung 211 ff. u. a. a. O.
- Selbsterhaltung 347, 436, 444.
- Sensualismus 356, 394, 401 ff., 425 u. a. a. O.
- Seraphim 280.
- Shintoismus 123.
- Sigê 271.
- Simon Magus 276.
- Sirenen 73 f.
- Skeptizismus 354 ff. u. a. a. O.
- Slawen 85 ff., 208 u. a. a. O.
- Sohar 294.
- Sokrates 219, 248.
- Soma 117.
- Sophia 267 ff., 272.
- Sophisten 354 f.
- Speiseverbote 191.
- Spektralanalyse 442.
- Spencer, Herbert 420.
- Speusippos 249.
- Sphärenharmonie 242.
- Spieß 77.
- Spinoza 337, 390 ff., 484 u. a. a. O.
- Spinozismus 390 ff. u. a. a. O.
- Spiritismus 254.
- Stabilität 439 ff.
- Stammannahmen 7 ff.
- Stammbegriffe 360 ff.; s. auch Kategorien.
- Stephens, John 126.
- Steresis 251.
- Sterne, Carus 113 u. a. a. O.
- Stirner, Max 386.
- Stoff 250.
- Stoiker 232 ff.
- Strabon 112.
- Stuhlmann 52.
- Substanz 335, 392 ff.; s. auch Ding-an-sich.
- Sufismus 258.
- Sundainseln 17 f. u. a. a. O.
- Sündenfall 159 f.
- Supranaturalismus 254.
- Swedenborg 330.
- Sympathie der Dinge 277 u. a. a. O.
- Synesius 269.
- Syzygien 271.
- T
- Tabu 48.
- Tacitus 88 ff.
- Tangaroa 69 ff.
- Tao 121, 143, 210.
- Taurellus 323.
- Teleologie 251 f., 367, 397.
- Telesius 317.
- Teufel 37 u. a. a. O.
- Thales 236.
- Themistokles 97.
- Theogonie 131 u. a. a. O.
- Theosophie 223, 253 ff., 286 ff., 330 u. a. a. O.
- Therapeuten 276.
- Theophanie 284.
- Theromorphie 101 ff.
- Theurgie 254.
- Thomas von Aquino 296.
- Thomson, William 448, 466.
- Thronen 280.
- Totemismus 39, 47.
- Totenbehandlung 41 f. u. a. a. O.
- Totenbuch 199 u. a. a. O.
- Totenkahn 72 ff.
- Totenkult 72 ff. u. a. a. O.
- Totenland 73 ff.
- Totenrichter 192 ff.
- Totenvögel 73 ff.
- Trägheit 340, 436, 439 ff.
- Transzendentalismus 359 ff., 484 u. a. a. O.
- Transzendenz 350 ff., 400 f. u. a. a. O.
- Träume 43 ff.
- Twesten 138.
- Tylor 34 f., 49.
- U
- Überlebsel 55.
- Umkehrbarkeit 440.
- Unbewußtes 386 ff., 474 ff.
- Unendlichkeit 363 f., 464.
- Universalien 293.
- Unsterblichkeit 192 ff., 204, 220 ff., 395, 479 u. a. a. O.
- Unterwelt 171 ff., 192 ff.
- Upanishaden 201, 211 f., 385.
- Urwesen 446 ff.
- Urzustand 417, 481.
- Utilismus 435.
- V
- Vaiseshika 424.
- Valentinus 271.
- Vedantaphilosophie 212 f., 258 ff.
- Vedareligion 119.
- Vererbung 444 ff.
- — biologische 450.
- — funktionale 450.
- — Lokalisations- 450.
- — morphologische 450.
- Verworn 420.
- Virgil 206.
- Vischer, Friedrich 35.
- Vitalismus 483.
- Vogt, Karl 438.
- Volksetymologie 98.
- Voltaire 435.
- Vorstellung, die Welt als 379 ff.
- W
- Wahrheit, doppelte 285, 331.
- Wahrsagung 189.
- Walhalla 207.
- Weigel 323.
- Weinstein 150.
- Weismann 447.
- Weissagungen 107.
- Weltanfang 416 ff., 464 ff. u. a. a. O.
- Weltanschauung, Erklärung 1 ff.
- Weltbau 170 ff., 252.
- Weltbaum 110, 132.
- Weltentstehung 63, 67 ff., 155, 240, 335.
- Welterlösung 389 u. a. a. O.
- Weltgang 440 ff.
- Weltgesetze 439 ff., 467.
- Welträtsel 461 ff., 483.
- Weltseele 247, 278, 313, 321.
- Weltuntergang 166 ff.
- Weltvernunft 243, 278 u. a. a. O.
- Weltwiederholung 237, 346, 386, 416, 425 f. u. a. a. O.
- Widergott 267.
- Wiedertäufer 316.
- „Wilde“ 70.
- Wille, die Welt als 379 ff.
- Windischmann 174.
- Wirklichkeitsphilosophie 398, 416.
- Wirklichkeit, transzendente 350 ff., 360 ff. u. a. a. O.
- Wolff, Caspar Friedrich 447.
- — Christian 345.
- Wollheim da Fonseca 200.
- „Wort“ 265, s. Logos.
- Wunderglaube 21, 283.
- Wundt, Wilh. 399 ff.
- X
- Xenokrates 249.
- Xenophanes 231, 351.
- Y
- Yamazaki-Ansai 235.
- Yelch 62, 73.
- ὕλη 236.
- Yoga 260.
- Z
- Zahl 240 ff.
- Zalmaweth 193.
- Zauberer und Zauberwesen 53 ff.
- Zehnder 46 ff.
- Zeit 360, 406 u. a. a. O.
- Zeitatome 287.
- Zenogenesie 449.
- Zenon 353 f.
- Zöllner, Friedrich 398.
- Zufall 182 ff.
- Zwangsmechanismus 428 ff., 435 f. u. a. a. O.
- Zweckmäßigkeit 372, 472 f.
- Zwingli 315.
Land und Leute
Monographien zur Erdkunde
Land und Leute
Monographien zur Erdkunde
In Verbindung mit hervorragenden Fachgelehrten
herausgegeben von
A. Scobel
VIII.
Deutsche Nordseeküste
Friesische Inseln und Helgoland.
Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1900
Deutsche
Nordseeküste
Friesische Inseln und Helgoland.
Von
Professor Dr. H. Haas
Mit 166 Abbildungen nach photographischen Aufnahmen
und einer farbigen Karte.

Bielefeld und Leipzig
Verlag von Velhagen & Klasing
1900
Alle Rechte vorbehalten.
Druck von Fischer & Wittig in Leipzig.
Inhalt.
| Seite | ||
| I. | Allgemeines | 3 |
| II. | Etwas von der Nordsee | 5 |
| III. | Geologisches | 17 |
| IV. | Sturmfluten | 26 |
| V. | Land und Leute | 39 |
| VI. | Geschichtliches | 58 |
| VII. | Von Husum nach Tondern und an die Grenze Jütlands | 62 |
| VIII. | Die nordfriesischen Inseln | 74 |
| IX. | Eiderstedt | 98 |
| X. | Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona | 102 |
| XI. | Hamburg-Altona | 114 |
| XII. | Helgoland | 129 |
| XIII. | Die Marschlande am linken Elbufer | 137 |
| XIV. | Das Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser | 142 |
| XV. | Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser | 147 |
| XVI. | Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands. Die ostfriesischen Inseln | 158 |
| Litteratur | 172 | |
| Register | 173 | |
Deutsche Nordseeküste.
I.
Allgemeines.
Thalatta, Thalatta!
Gekannt hatte ich ihn zwar schon von meinen Schülerzeiten her, den Freudenruf der Zehntausend, die nach langem Umherstreifen in der Fremde den wogenden Ocean wieder erblicken durften. Gekannt wohl, aber nachempfunden? Nein! Man wird’s wohl bei den Tertianern einer Gelehrtenschule in einer weit von den Gestaden der See belegenen Binnenstadt verzeihlich finden, daß ihnen das nötige Verständnis für den Jubelschrei der griechischen Söldner und noch für sonstige andere Schönheiten in des Xenophon Anabasis gemangelt hat. Das lag so in der Natur der Sache, und die Gründe dafür mögen hier besser nicht erörtert werden. Viele Jahre später aber, an einem hellen und sonnigen Junimorgen, sollte mir dieses Verständnis für den Erlösungsruf des umherirrenden Griechenvolkes desto gewaltiger aufgehen, und sicherlich mit nicht geringerer Ergriffenheit, als des jüngeren Cyrus Waffengefährten sie vor Zeiten hinausgeschmettert haben in die schöne Gottesnatur, hat auch mein Mund damals die Worte hervorgestammelt: „Thalatta, Thalatta!“
Auf den Höhen des roten Kliffs bei Wenningstedt auf der Insel Sylt ist’s gewesen, als ich zum erstenmal die brausende Nordsee erblickte (Abb. 3). In meinem Leben habe ich viel Schönes gesehen und manches herrliche Landschaftsbild im Norden und[S. 4] Süden, im Westen und Osten bewundert. Nichts aber von dem allem hat mir jemals wieder einen so großartigen Eindruck gemacht, nichts meine Sinne wieder in solchem Maße gefangen genommen, als diese meine erste Bekanntschaft mit dem brandenden und tosenden nordischen Meere. Noch ebenso lebendig, als ob es gestern gewesen wäre, steht heute, nach mehr als zwanzig Jahren, jenes herrliche Bild in meiner Erinnerung. Vor mir am Rande des steil wie eine Mauer abfallenden Kliffs die stark bewegte, wild aufschäumende See, zu meinen Füßen das lang dahingestreckte, wie ein Schild gegen den unermeßlichen Ocean vorgeschobene Eiland mit seinen weiß schimmernden Dünenketten, seinen freundlichen Dörfern und seiner braunen Heide, im Norden die klargezeichnete Insel Röm, tief am südlichen Horizont der Leuchtturm von Amrum und die Umrisse von Föhr, und hinter mir die grauen, schlammigen Fluten des Wattenmeeres, begrenzt im fernen Osten von der nur leicht angedeuteten Küstenlinie Schleswigs. Und das alles beschienen von der warmen Sonne eines schönen nordischen Sommertages, während um mich herum die Bienen summten und die Möven in den Lüften umherflogen, fürwahr ein Bild, an dem sich mein schönheitstrunkenes Auge nicht genugsam satt sehen konnte! Ganz im fernen Westen aber, auf den Wellen schaukelnd und nicht größer als wie Nußschalen erscheinend, die rauchenden und hochmastigen Panzerkolosse unserer zu jenen Zeiten noch in ihren Kinderschuhen steckenden deutschen Flotte, die auf einer Übungsfahrt in den heimischen Gewässern begriffen waren.
Nichts von der leuchtenden Farbenpracht, welche den blauen Spiegel des Mittelmeeres verklärt, nichts von der Lieblichkeit und Anmut der vom Schatten der Buchenwälder und vom schwellenden Grün der Wiesen umrahmten Ostsee zeigen die Gestade des nordischen Meeres. Grau in grau, nur selten unbewegt und meist gepeitscht von schäumenden Wellen liegt es da. Keine großen Städte, keine üppigen Fluren spiegeln sich in seinen Fluten, allein der von einer dünnen Grasnarbe bewachsene Deich oder der blinkende weiße Sand der Dünen rahmen seine weiten Ufer ein. Eine gewisse Öde und Einförmigkeit schwebt auf dem Wasser, aber eine Öde und Einförmigkeit, welchen der Stempel der Erhabenheit und Gewaltigkeit aufgeprägt ist. Wie ein überirdischer Schimmer, wie ein mystischer Schleier liegt’s über dem Gebrüll und Getobe der Nordseewellen. Freilich, die menschliche Sprache ist zu arm, um das in Worten ausdrücken zu können, aber die Tonkunst vermag’s. Einer ihrer größten Meister hat es fertig gebracht, den Zauber, den die Nordsee auf ihren Beschauer ausübt, in Töne zu bannen: Richard Wagner in den gespensterhaften Akkorden seiner Einleitung zum Fliegenden Holländer. Ob sie mit ihrer wellendurchfurchten Fläche im Sonnenschein daliegt, ob das scheidende Abendrot sie rosig erglühen läßt, oder ob aus schwarzer Wolkenwand der zackige Wetterstrahl rasch aufleuchtet über das wüste, wogende Wasser, wenn der Donner weithin rollt und des Boreas weiße Wellenrosse dahinspringen, die Nordsee bleibt sich doch immer gleich in ihrer eigenartigen Pracht, ein Abglanz der Unendlichkeit und der Allmacht Dessen, der sie ins Dasein gerufen hat.
Goethe hat einmal gesagt: „Das freie Meer befreit den Geist.“ Wohl auf wenige Stellen auf unserem Planeten dürfte dieses Wort bessere Anwendung finden, als auf dasjenige Gebiet, dessen Beschreibung dieses Büchlein gewidmet ist. Die Unbeugsamkeit und der Freiheitsdrang des steifnackigen Friesenvolkes, das seine Wohnplätze an den Ufern der Nordsee hat, sie sind zweifellos Produkte jenes fortgesetzten und harten Kampfes, den es seit mehr denn zweitausend Jahren mit den wilden Meeresfluten um seine Heimat führen mußte. Denn nur durch unausgesetzte Anstrengungen sind die Bewohner der Nordseeküste im stande gewesen, das ihnen von der Vorsehung angewiesene Land dem Meere abzugewinnen und dasselbe vor dem Untergang zu bewahren.
Deus mare, Friso litora fecit,
so lautet ein alter stolzer Spruch des friesischen Stammes. Seine Richtigkeit werden wir im Verlaufe der nun folgenden Schilderungen kennen lernen, zugleich aber auch die Wahrheit der Verse vom alten Vater Homer:
Denn nichts Schrecklicheres ist mir bekannt,
als die Schrecken des Meeres.
Ist doch die Nordsee zugleich auch eine Mordsee!
II.
Etwas von der Nordsee.
Unter allen Meeresräumen unserer Erde nimmt die Nordsee insofern eine Ausnahmestellung ein, als ihre Grenzen genau so wie die politischen Areale der civilisierten Welt auf diplomatischem Wege vereinbart und festgesetzt sind. Das ist in dem internationalen Vertrage zu Haag geschehen, der am 6. Mai 1882 von den sechs Nordseemächten: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Dänemark über die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee außerhalb der Küstengewässer abgeschlossen wurde.

(Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
Nach den Bestimmungen dieses Vertrages werden die Grenzen der Nordsee gebildet:
- im Norden: durch den 61. Grad nördl. Breite,
- im Osten und im Süden:
- durch die norwegische Küste zwischen dem 61. Grade nördl. Breite und dem Leuchtturm von Lindesnäs (Norwegen),
- durch eine gerade Linie, die man sich von dem Leuchtturm von Lindesnäs (Norwegen) nach dem Leuchtturm von Hanstholm (Dänemark) gezogen denkt,
- durch die Küsten Dänemarks, Deutschlands, der Niederlande, Belgiens und Frankreichs bis zum Leuchtturm von Gris-Nez (Frankreich);
- im Westen:
- durch eine gerade Linie, die man sich vom Leuchtturm von Gris-Nez (Frankreich) nach dem östlichen Feuer von South Foreland (England) gezogen denkt,
- durch die Ostküsten von England und Schottland,
- durch eine gerade Linie, welche Duncansby Head (Schottland) mit der Südspitze von South Ronaldsha (Orkneyinseln) verbindet,[S. 6]
- durch die Ostküsten der Orkneyinseln,
- durch eine gerade Linie, welche das Feuer von North Ronaldsha (Orkneyinseln) mit dem Feuer von Sumburgh Head (Shetlandinseln) verbindet,
- durch die Ostküsten der Shetlandinseln,
- durch den Meridian des Feuers von North Unst (Shetlandinseln) bis zum 61. Grad nördl. Breite.
Der deutsche Anteil der Nordseeküste gleicht in seiner Grundform einem rechten Winkel, dessen Scheitel etwa bei Brunsbüttel an der Elbe zu suchen ist, und dessen beide Schenkel gleiche Länge besitzen, und einerseits bei Borkum, andererseits bei Hvidding in Nordschleswig endigen. Ihr westlichster Punkt ist die Westspitze der äußersten der ostfriesischen Inseln, des Eilands Borkum, der unter 6° 40′ östl. Länge und 53° 35′ nördl. Breite liegt, ihr nördlichster ist da zu suchen, wo die deutsch-dänische Grenze zwischen dem dänischen Grenzorte Vester-Vedstedt und dem deutschen Dorfe Endrup bei Hvidding in Nordschleswig das Wattenmeer erreicht, und zwar unter 8° 40′ östl. Länge und 55° 17′ nördl. Breite. Der südlichste Punkt der deutschen Nordseeküste ist zugleich der südlichste des deutschen Dollartufers, da, wo die deutsche Westgrenze den Dollart erreicht, an der Mündung des Grenzflüßchens zwischen Deutschland und Holland, der Westerwoldschen Aa, und befindet sich unter 7° 13′ östl. Länge und 53° 14′ nördl. Breite. Als der östlichste Punkt präsentiert sich Meldorf in Ditmarschen unter 9° 2′ östl. Länge und 54° 29′ nördl. Breite.
Zwei Inselguirlanden umsäumen das deutsche Nordseegestade, und auf diese Weise entsteht eine Doppelküste, deren innerer Teil von der eigentlichen Festlandsküste gebildet wird, während der äußere der Inselküste mit der Westspitze von Borkum und der Nordspitze von Röm als Eckpfeiler angehört.
Der nordsüdlich verlaufende Teil unseres Küstengebietes zeigt in seiner nördlichen Hälfte drei Einbuchtungen, diejenige von Husum, von Tönning und von Meldorf, denen die Halbinseln Eiderstedts, der Landschaft Wesselburen und Dieksands entsprechen. Die Buchten des Dollart und der Jade und die Mündungen der Weser[S. 7] und der Elbe gliedern den ostwestlich verlaufenden Küstenteil.
Eine selbständige Flutwelle besitzt die Nordsee bekanntlich nicht, sondern ihre Gezeitenbewegung erhält sie durch zwei aus dem Atlantischen Ocean nördlich von Schottland und durch den Ärmelkanal eintretende Flutwellen. So entstehen eine Anzahl von Strömungen, welche die Gezeitenbewegungen an der Nordseeküste zu recht komplizierten machen. Sechs Stunden braucht die Flutwelle, um von der britischen Ostküste bis zu den nordfriesischen Inseln zu gelangen, sechs Stunden lang läuft der Ebbestrom denselben Weg zurück. Wenn sich der Meeresspiegel am Ostrande des Beckens hebt, sinkt er an dessen Westrande, und umgekehrt.
An der dem offenen Meere zugewandten deutschen Nordseeküste schwankt der Flutwechsel zwischen 2,5 und 3,5 Meter, und wird im Mittel als 3,3 Meter angenommen. Den höchsten Betrag zeigt Wilhelmshaven mit 3,5 Meter, dann folgen Geestemünde und Bremerhaven mit 3,3 Meter, Brake mit 3 Meter, Emden mit 2,8 Meter, Borkum und Wangeroog mit 2,5 Meter u. s. f. Das Minimum aller unmittelbar am Meere gelegenen deutschen Orte weist Helgoland aus, 2,8 Meter zur Springzeit, 1,8 Meter zur Nippzeit.
Von den Gezeiten unabhängige, also selbständige Strömungen sind nur in demjenigen Teile der Nordsee vorhanden, in welchem die Gezeitenerscheinungen nahezu verschwinden, kommen also für unser Küstengebiet nicht in Betracht. In den geringen Tiefen der Nordsee, wo die Wellenbewegung sich bis auf den Grund fortpflanzt, vermögen die Windströmungen die ganze Wassermasse in Bewegung zu setzen. Sobald aber der Wind wieder aufhört, müssen auch diese ganzen Wallungen derselben wieder verschwinden. Von der Erregung beständiger Strömungen in der mittleren Windesrichtung kann in der Nordsee keine Rede sein. Dagegen bedingt die Gestaltung der Küsten Veränderungen des Meeresniveaus, sobald der Wind das Wasser vor sich hertreibt, und dieser Windstau gibt dann zu Strömungen Veranlassung, welche noch andauern können, wenn sich die Windrichtung bereits geändert hat.
Zu den charakteristischen Erscheinungen der Nordsee gehören die Sturmfluten, die dann eintreten, wenn auf einen starken und anhaltenden Südweststurm, der das Wasser durch den Kanal in die Nordsee gepreßt hat, plötzlich ein Nordweststurm folgt, der die vereinigten Wassermassen gegen die deutschen Küsten treibt. Vernichtende Wirkungen von grausiger Art, beträchtliche Verluste an Land und Menschenleben haben diese Sturmfluten zuweilen hervorgebracht, wenn auch diese Verheerungen von der Sage manchmal ins Maßlose und Ungeheuerliche übertrieben worden sind. An den Küsten, und besonders an deren sich verengenden Winkeln und Buchten steigt die Flut dann am höchsten. Nach den von Eilker angestellten Untersuchungen fällt die Mehrzahl der sämtlichen Sturmfluten, von denen man bisher überhaupt Kunde erhalten hat, in den Monat November, etwa ein Viertel der Gesamtsumme! Dann folgen Januar, Dezember und Oktober, die geringste Zahl zeigen Juni und Juli. Auf die sechs Wintermonate Oktober bis März kommt eine fünfmal[S. 8] größere Zahl schwererer Sturmfluten, als auf die Sommermonate. Das wird erklärlich, wenn man bedenkt, daß es heftige Stürme, förmliche Orkane sind, welche diese Katastrophen herbeiführen. Ungewöhnlich heftige Stürme und Orkane sind aber weiter nichts, als abnorme Gleichgewichtsstörungen des Luftmeeres, und die an unserer Nordseeküste gemachten Beobachtungen zeigen, daß gerade in den Wintermonaten die extremsten Barometerschwankungen vorkommen. Unser Gebiet ist in dem Zeitraum von 1500–1800 durchschnittlich von 50 schweren Sturmfluten in jedem Jahrhundert heimgesucht worden.
Weiter oben ist bereits betont worden, daß die Überlieferungen von den durch diese Katastrophen hervorgerufenen Verheerungen in vielen Dingen zuweilen gar sehr übertrieben sind. Ganz besonders gilt dies von den Chronisten des Mittelalters, deren Zahl keine geringe ist. Ihre Erzählungen bedürften daher erst einer recht gründlichen kritischen Sichtung, bevor man dieselben als Grundlagen für eine Gesamtdarstellung der Sturmfluten an unserer Nordseeküste benutzen könnte. Für Nordfriesland ist das durch die schönen Untersuchungen Reimer Hansens geschehen, und es soll deshalb in einem der folgenden Abschnitte ein kurzer Überblick über die hier in Frage kommenden Ereignisse an der schleswig-holsteinischen Meeresküste mit eingehender Berücksichtigung der soeben angeführten Forschungen gegeben werden.
Die Temperatur an der Wasseroberfläche der Nordsee folgt der Temperatur der Luft, unter Abstumpfung der Extreme, wegen der großen Wärmeabsorption des Wassers. Die Temperaturschwankungen des Oberflächenwassers sind in der Nähe des offenen Oceans am geringsten, da, wo das Wasser vom Lande eingeschlossen ist, am größten, und das Maximum der Temperatur fällt in die Mitte August, das Minimum in die erste Hälfte des Monats März. Mit zunehmender Tiefe nehmen die Temperaturschwankungen des Wassers ab.
Die Schwankungen des Salzgehalts im Nordseewasser sind weniger groß und weniger ungleichmäßig als die der Lufttemperatur folgenden Wassertemperaturen. Im nördlichen tiefen Teil der Nordsee treffen wir das schwerste, salzigste Wasser an, mit 3,56–3,52% Salzgehalt.
Als dem Nordseewasser in seinem mittleren, von fremden Zuflüssen wenig berührten Becken zukommend kann ein Salzgehalt von 3,52–3,48% gelten. In der deutschen Bucht erleidet das Seewasser durch die Zuflüsse der deutschen Ströme eine Verdünnung, die sich sehr weit bemerkbar macht. Das Maximum der Dichtigkeit fällt hier in den Sommer und Herbst, das Minimum in den Winter und in das Frühjahr, entsprechend den schwankenden Wassermengen, welche von den Flüssen abgeführt werden. Für die Zeit vom November bis einschließlich[S. 9] April betragen die Abflußmengen der Elbe und Weser mehr als das Doppelte (1 : 0,45) derjenigen für die Sommerzeit vom Mai bis Oktober. Die Weser erreicht im Februar, die Elbe im März ihren höchsten, beide Flüsse im September ihren niedrigsten Wasserstand. Für die Weser verhält sich die Abflußmenge des wasserärmsten Monats zu der des wasserreichsten (bei Minden) wie 1 : 4, für die Elbe (bei Torgau) wie 1 : 5,2.

(Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
Folgende Jahreszeitenmittel des Salzgehaltes an der Oberfläche des Nordseewassers sind in den Jahren 1874–1876 festgestellt worden:
| Beobachtungsort | Winter | Frühling | Sommer | Herbst | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Borkum (Feuerschiff) | 3,25 | 3,25 | 3,28 | 3,31 | 3,28 |
| Weser (Außenfeuerschiff) | 3,46 | 3,31 | 3,28 | 3,35 | 3,35 |
| Helgoland | 3,42 | 3,29 | 3,26 | 3,41 | 3,34 |
| List auf Sylt | 2,97 | 3,03 | 3,24 | 3,08 | 3,08 |
Nach den Mitteilungen von Arends enthalten 7680 Teile Nordseewasser:
| Chlornatrium | 197,5 | Teile |
| Chlormagnesium | 28,362 | „ |
| Chlorkalium | 4,446 | „ |
| Schwefelsaure Talkerde | 10,2 | „ |
| Schwefelsaure Kalkerde | 4,926 | „ |
| Kieselerde | 0,782 | „ |
Nach Pfaff zerfällt der Salzgehalt des Nordseewassers, zu 3,44% angenommen, in:
| Chlornatrium | 74,20 | Teile |
| Chlormagnesium | 11,04 | „ |
| Chlorkalium | 3,80 | „ |
| Bromnatrium | 1,09 | „ |
| Schwefelsaurer Kalk | 4,72 | „ |
| Schwefelsaure Magnesia | 5,15 | „ |
Der starke Salzgehalt und die hohe Temperatur ihres Wassers lassen ein Zufrieren der Nordsee auf hoher See niemals zu. Dagegen sind Eisbildungen an den Küsten und im Wattenmeer nicht selten; wir werden noch im folgenden Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. Unsere Abb. 7 u. 8 veranschaulichen die besonders im Winter erhöhte Schwierigkeit des Verkehrs im Wattenmeer.
Bezüglich der dem deutschen Küstengebiete der Nordsee zugehörigen Schiffe mögen hier einige genaue Mitteilungen gemacht werden. Dieselben sind der Statistik des Deutschen Reiches entnommen und gelten für den 1. Januar 1897. An diesem Tage waren in den Häfen des gesamten deutschen Nordseegebietes beheimatet:
| 2043 | Segler | mit | 550258 | Registertonnen br. Rauminh. | |
| 737 | Dampfer | „ | 1200348 | Registertonnen br. Rauminh. | |
|
|
|||||
| Zus.: | 2780 | Seeschiffe | mit | 1750606 | Registertonnen br. Rauminh. |
Auf die einzelnen Teile der Nordseeküste verteilen sich diese Zahlen wie folgt:
Nordseeküste Schleswig-Holsteins:
| 383 | Segler | mit | 16985 | Rt. br. | |
| 29 | Dampfer | „ | 10608 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 412 | Schiffe | mit | 27593 | Rt. br. |
Hamburg und die zu diesem Freistaat gehörigen Häfen:
| 430 | Segler | mit | 205842 | Rt. br. | |
| 388 | Dampfer | „ | 764146 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 818 | Schiffe | mit | 969988 | Rt. br. |
Provinz Hannover, u. zw. Elbe- und Wesergebiet:
| 422 | Segler | mit | 17843 | Rt. br. | |
| 51 | Dampfer | „ | 30468 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 473 | Schiffe | mit | 48311 | Rt. br. |
Freie Stadt Bremen:
| 221 | Segler | mit | 199982 | Rt. br. | |
| 218 | Dampfer | „ | 369072 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 439 | Schiffe | mit | 569054 | Rt. br. |
Großherzogtum Oldenburg:
| 219 | Segler | mit | 78063 | Rt. br. | |
| 19 | Dampfer | „ | 11303 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 238 | Schiffe | mit | 89366 | Rt. br. |
Provinz Hannover, u. zw. Emsgebiet und Regierungsbezirk Aurich:
| 365 | Segler | mit | 31010 | Rt. br. | |
| 23 | Dampfer | „ | 3305 | „ | |
|
|
|||||
| Zus.: | 388 | Schiffe | mit | 34315 | Rt. br. |

(Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
In betreff der Schiffsunfälle, welche etwa durchschnittlich in Jahresfrist auf der 295 Seemeilen langen Küstenstrecke des deutschen Nordseegebietes stattfinden, geben die Mitteilungen des kaiserlichen statistischen Amtes ebenfalls interessante Aufschlüsse.
Die Aufstellung für das Jahr 1896 weist aus:
| 51 | Strandungen, | |
| 7 | Kentern, | |
| 5 | Sinken, | |
| 65 | Kollisionen, | |
| 37 | andere Unfälle. | |
|
|
||
| Zusammen: | 165 | Unfälle. |
Der Verlust an Schiffen betrug 31, Verluste an Menschenleben werden 22 verzeichnet.
Diese Zahlen beziehen sich natürlich nicht nur auf deutsche Schiffe allein, sondern auch auf solche anderer seefahrender Nationen, also auf sämtliche Schiffsunfälle an der deutschen Nordseeküste überhaupt. Betrachten wir die Verunglückungen, die nur deutsche Schiffe betroffen haben, so finden wir in der Statistik für das Jahr 1896 folgende Daten:
Der Gesamtverlust an deutschen Schiffen in sämtlichen Meeren dieser Erde zusammen betrug 79. Darunter befanden sich 35 Strandungen und 10 verschollene Schiffe.
Auf das Gebiet der Nordsee mit dem Skagerak fallen hiervon: 28 Schiffe mit 36 verlorenen Menschenleben, auf dasjenige der Ostsee, einschließlich der Belte, des Sundes und des Kattegats: 20 Schiffe mit 20 verlorenen Menschenleben!
Auch in Bezug auf die Verluste an Schiffen und Menschenleben, mit welchen die Schiffsunfälle verbunden waren, steht das deutsche Nordseegebiet dem Ostseegebiet im Verhältnis zu seiner Küstenlänge bedeutend voran. Besonders stark ist dort der Verlust an Schiffen und Menschenleben im Küstengebiet zwischen Eider und Elbe mit den Mündungen und Gebieten dieser Flüsse, an welch letzterem Küstenteile sich zugleich der stärkste Verlust an Menschenleben zeigt. Ziemlich groß ist auch die Zahl der verlorenen Schiffe an der Küste von Ostfriesland mit den ostfriesischen Inseln nebst dem Dollart und dem Emsgebiet bis Papenburg, dann im Mündungsgebiet der Weser und Jade, und schließlich an der Westküste von Schleswig-Holstein von der dänischen Grenze bis zur Eidermündung mit den dazu gehörigen Inseln.
Untersucht man das Verhältnis der Totalverluste zur Gesamtzahl der von Unfällen betroffenen Schiffe, so war im Jahre 1896 die Strecke zwischen der dänischen Grenze und der Eidermündung die verlustreichste. Ihr stand an Gefährlichkeit am nächsten die Küstenstrecke zwischen Wangeroog und der niederländischen Grenze. Dann folgt das Mündungsgebiet der Weser und Jade. Der verhältnismäßig geringste Verlust entfiel auf die Westküste Schleswig-Holsteins zwischen Eider und Elbe.
Es wäre nicht angängig, von der deutschen Schiffahrt in der Nordsee zu sprechen, ohne nicht auch etwas der im blühenden Aufschwunge begriffenen deutschen Hochseefischerei zu gedenken. Am 1. Januar 1898 betrug die im Dienste der deutschen Hochseefischerei stehende Flotte der Nordsee:
563 Fahrzeuge mit 94898 cbm Raumgehalt und 3503 Mann Besatzung. Darunter waren 117 Dampfer[S. 13] mit 48027 cbm Raumgehalt und 1185 Mann Besatzung.
Der Wert der Hochseefischereifahrzeuge im deutschen Nordseegebiet und ihrer Ausrüstung, unter Abrechnung von 10–25% vom Anschaffungswert betrug für 1897 etwa 12660000 Mark. Heute kann man nach der Begründung großer Gesellschaften für Hochseefischerei in den Jahren 1897 und 1898 jedoch einen wesentlich höheren Kapitalsanlagewert annehmen.
Zu den Zeiten der alten Hansa beherrschte Deutschland in Wisby, Bergen, Schonen und vor allem in Island den Fischmarkt. Dann aber wurden die deutschen Fischer und Händler überall von den Engländern und Schotten, Franzosen, Holländern, Skandinaviern und Dänen zurückgedrängt. Vor achtzig Jahren machte man in Bremen nach langer Zeit wieder einen Versuch, die Heringsfischerei neu zu beleben, doch konnte sich die zu diesem Behufe gegründete Aktiengesellschaft nicht lange halten, weil der Zoll für deutsche Heringe höher war als derjenige für holländische, und so ging das Unternehmen wieder ein. Später und besonders in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts wurde dann von Bremen aus ein lebhafter Walfischfang sowohl im nördlichen wie im südlichen Eismeer betrieben.
Im Jahre 1866 erwachte in weiteren Kreisen der Nation auch wieder der Sinn für die Förderung der deutschen Seefischerei, und zu Beginn der siebziger Jahre war bereits in Blankenese und Finkenwerder eine nennenswerte Hochseefischerei im Betrieb, welche über 139 kleine Segler mit 437 Mann Besatzung verfügen konnte und, je nach der Güte des Jahres, Erträgnisse von 100000 bis 250000 Mark aufwies. Der eigentliche Aufschwung der deutschen Hochseefischerei stammt jedoch erst aus dem Ende des neunten Jahrzehnts. Wie groß dieselbe für das deutsche Nordseegebiet zur Stunde schon geworden ist, das haben wir weiter oben schon gesagt.
Bedeutende kapitalistische Hochseefischereiunternehmungen der neueren Zeit sind die Aktiengesellschaft Nordsee in Nordenham, die mit 26 Dampfern und drei Millionen Mark Kapital Fischfang betreibt, sodann eine große Herings- und Hochseefischereigesellschaft in Geestemünde, welche den Heringsfang mit zehn Dampfloggern statt mit Segelloggern betreibt, ferner neue Heringsfischereigesellschaften in Emden, in Vegesack, in Elsfleth und in Glückstadt. Man hofft,[S. 14] damit der großen Einfuhr von Heringen aus dem Auslande eine erfolgreiche Konkurrenz bieten und die hohen Geldsummen, welche für dieses wichtige Volksnahrungsmittel fremden Nationen zufließen, dem Reiche erhalten zu können, namentlich wenn entsprechende Zollveränderungen durchgeführt würden. Im Zeitraum von fünf Jahren hat Deutschland nicht weniger als 355 Millionen Mark für eingeführte frische und zubereitete Seefische an das Ausland bezahlt, darunter für Salzheringe und frische Fische, meist sogenannte grüne Heringe, 330 Millionen Mark!

(Nach einer Photographie von W. Dreesen in Flensburg.)
Die Fischkutter der verschiedenen Hochseefischereigesellschaften gehen in der Regel als Flottillen von zwanzig, dreißig und noch mehr Schiffen in See. Die Dampfer sind[S. 15] etwa 31 Meter lang, besitzen 150 Tonnen Rauminhalt und Maschinen von 259 Pferdekräften. Etwa acht Tage bleiben die Fahrzeuge in der Regel dem Heimathafen fern, und es kommt vor, daß ein solcher Dampfer 30000 Kilogramm und noch mehr Fische an den Markt bringt. Sie sind bestrebt, am Sonntag zurück zu sein, Montag und Dienstag findet alsdann die Versendung der gefangenen Fische statt, um vor Freitag, dem Haupttage für den Fischgenuß, die gesamte Beute auf die Märkte zu schaffen.
Mangelnder Absatz hat ursprünglich die gedeihliche Entwickelung des Fischhandels gehemmt, so daß der Verbrauch von frischen Seefischen eigentlich nur auf die Küstenstriche beschränkt gewesen ist. Erst die fortschreitende Organisation des Fischhandels, besonders vermittelst großer Fischauktionen in Hamburg, Altona, Geestemünde und Bremerhaven, der verbesserte, mit praktischen neuen Verpackungs- und Kühlvorrichtungen versehene Transportdienst der Fische ins Binnenland u. dergl. Dinge mehr konnten die Fortentwickelung unseres Fischhandels in gedeihlicher Weise fördern, so daß im Jahre 1896 die Bruttoerträge der deutschen Hochseefischerei in der Nordsee bereits zehn Millionen Mark erreichten. Der dauernd steigende Umsatz der Fischauktionen betrug im Jahre 1898:
| in Hamburg | 1295139 | Mark, |
| in Altona | 1993632 | „ |
| in Geestemünde | 3459908 | „ |
| in Bremerhaven | 729946 | „ |
was an diesen vier Plätzen einem Gesamtumsatz von 7478625 Mark entspricht, gegenüber 6938902 Mark im Vorjahre. Doch ist hier zu bemerken, daß den Auktionsmärkten auch von ausländischen Fischereien und Fischern Waren zugeführt werden. Dagegen aber ist in der Gesamtsumme ein fünfter Fischmarkt, Nordenham, nicht verzeichnet, wo Auktionen nicht stattfinden, der aber jährlich für mindestens 1500000 Mark Fische anbringen dürfte.
Sowohl das Reich, als auch dessen dabei interessierte Einzelstaaten suchen die Seefischerei in Deutschland nach Kräften zu fördern, wobei der Deutsche Seefischereiverein wirksame Unterstützung bietet. Von Reichs wegen werden gegenwärtig 400000 Mark im Jahre für diese Zwecke aufgewendet, abgesehen von verschiedenen wissenschaftlichen Forschungen und Unternehmungen, die aus dem Reichssäckel bezahlt werden und der Erweiterung unserer Gesamtkenntnisse von der Tiefsee, also damit auch den Fischverhältnissen[S. 16] dienen (Plankton- und Valdiviaexpedition).
Die deutsche Hochseefischerei wird bekanntlich alle Jahre von einem Kreuzer der Kaiserlichen Marine überwacht. An Bord desselben war in den jüngstverflossenen Jahren eine Fischereischule eingerichtet, in der eine Anzahl von Berufsfischern — 1897 waren es deren 14 — durch einen besonders ausgebildeten Offizier und einen Arzt Unterricht in Navigation, über Wissenswertes aus ihrem Gewerbe und über den menschlichen Körper nebst Anleitung für das Verhalten bei Unglücksfällen erhielten. Dieser Kreuzer dient zugleich als Sanitätswache für die Fischer, und er hilft auch den Fischereifahrzeugen, die bei schwerem Wetter in Seenot wrack geworden sind. Für den allgemeinen Reiseplan dieser Marinefahrzeuge sind die Wünsche des Deutschen Seefischervereins angehört worden.
Vom 29. März bis zum 18. November 1898 versah die „Olga“ den Schutzdienst der Nordseefischerei; 1899 haben „Zieten“ und „Blitz“ diese Arbeit besorgt.
Wer müßte nicht an Bürgers Verse denken, wenn er der Rettungsstationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ansichtig wird, die, 116 an der Zahl, allenthalben an der deutschen Meeresküste verbreitet sind. 51 davon sind sog. Doppelstationen, mit Boot und mit Raketenapparat ausgerüstet, 49 Boots-, 16 Raketenstationen. 44 dieser Stationen entfallen auf das Gebiet der deutschen Nordseeküste, 72 auf das Gelände an der Ostsee. Seit der Begründung der Gesellschaft im Jahre 1865 sind 2510 Menschenleben durch ihre Stationen und Geräte dem grausigen Tod in den Fluten entrissen worden, und zwar 2169 Personen in 388 Strandungsfällen durch Boote und 341 Menschen in 75 Strandungsfällen durch die Raketenapparate. Allein im Jahre 1898–1899 wurden auf solche Weise 96 brave Seeleute vor dem Untergang bewahrt (Abb. 4 u. 5).
Aus dem gesamten deutschen Vaterlande fließen diesem Unternehmen warmer Nächstenliebe milde Gaben zu, und ein über das ganze Reich ausgespanntes Netz von Vereinigungen ist thätig, um diese Hilfsquellen nicht versiegen zu lassen, deren Totalbetrag im Rechnungsjahre 1898/1899 151064 Mark 62 Pfennige betrug, wozu noch 87107 Mark[S. 17] 81 Pfennige außerordentlicher Einnahmen hinzukamen, so daß sich die Gesamtsumme der Einnahmen in der besagten Zeit, incl. der Zinsen von belegten Kapitalien, auf 301714 Mark 20 Pfennige belaufen hat, denen 199846 Mark 32 Pfennige Ausgaben gegenüber standen. Seit ihrer Begründung, also in den verflossenen 35 Jahren, hat die Gesellschaft 4674254 Mark 37 Pfennige für ihre edlen Zwecke verausgabt.
Freilich, neben diesen Aufwendungen an klingender Münze hat es noch ganz anderer an Aufopferung und kühnem Mute von seiten der Männer von der Waterkante bedurft, die furchtlos ihr Leben einzusetzen gewohnt sind, wenn es gilt, die armen Schiffbrüchigen aus schwerer Todesnot zu erretten. Aber diese Dinge lassen sich ja nicht in gemünztes Gold und Silber umwerten!
III.
Geologisches.
„Wie viele der Reisenden, die die Nordsee auf den großen Post- und Passagierrouten kreuzten, mögen sich wohl gefragt haben, wie lange diese merkwürdige See schon existiere, d. h. wann die jetzt von ihren Wogen überspülte Fläche sich so weit gesenkt habe, daß sie so viel niedriger liegt, als ihre Umgebung?“ So fragt der bekannte Kieler Geograph und Oceanograph Otto Krümmel in einem kleinen Aufsatz über die geographische Entwickelung der Nordsee, aus dessen reichem Inhalte wir hier Verschiedenes schöpfen wollen.
Die Nordsee ist ein sehr seichtes Gewässer — sie besitzt nur eine durchschnittliche Tiefe von 89 Metern —, und eine Hebung des Bodens um hundert Meter würde völlig genügen, ihren ganzen südlichen Teil in trockenes Land umzuwandeln, das dann England,[S. 18] Dänemark und Holland verbände. Nun ist wohl kaum eine Stelle auf unserem Erdballe vorhanden, welche, wenn sie heute vom Ocean überspült wird, im Verlaufe der Äonen nicht auch einmal festes Land gewesen wäre, und umgekehrt. Das ist so auch mit dem von der Nordsee der Gegenwart eingenommenen Areale der Fall gewesen. Während der cretaceischen Periode zog sich wohl ein ziemlich tiefes Meer vom Atlantischen Ocean her über Frankreich, die Britischen Inseln, die Nordsee, das südliche Skandinavien und die baltischen Gebiete hin, dessen Absätze — die Kreideschichten — hier überall bekannt sind. Mit Beginn der Tertiärzeit war das Bild wohl schon ein etwas anderes. Der Norden unseres Gebietes war zum größeren Teil Festland, das von Skandinavien nach Schottland und von dort über die Britischen Inseln nach Frankreich herüberreichte und ein flaches, von sumpfigen Küsten umgebenes Meer über dem jetzigen unteren Themsengebiete, der südlichen Nordsee und Belgien im Norden und Westen abschloß. Im nördlichen Teile des Landes erhoben sich mächtige Gebirge und Hochländer, Vulkane rauchten dort, und große Flüsse strömten dem Meere zu. Etwas später, zur Zeit als die Londonthone abgesetzt wurden, griff dieses flache Binnenmeer nach Nordwesten hinüber, und am Ende des Eocäns stand es auch durch Flandern, Nordfrankreich und die Gegend des jetzigen Ärmelkanals durch einen schmalen Zugang mit dem damaligen Atlantischen Ocean in Verbindung.
Wiederum verschieden gestalteten sich die Verhältnisse während des Oligocäns, indem sich wieder ein Abschluß in Gestalt eines Isthmus von Dover nach Flandern und den Ardennen hinüber gebildet hatte, welcher die holländisch-ostenglische Bucht dieses Oligocänmeeres von einem Golfe des Atlantischen Oceans trennte.
Von nun an beginnt eine allmähliche allgemeine Trockenlegung unseres Areals, und gegen Schluß der Miocänzeit griff das miocäne Meer nur noch durch einen verhältnismäßig schmalen Arm über Belgien, Schleswig-Holstein und Hannover bis in das baltische Gebiet hinüber, ohne jedoch den Osten Deutschlands und Skandinavien noch zu erreichen. Jukes-Browne ist der Ansicht, daß sich damals auch die bekannte tiefe Rinne ausgebildet habe, welche die Uferlinien Norwegens gegen die jetzige Nordsee abgrenzt und dem Skagerrak so erhebliche Tiefe gibt. Sie soll zu jener Zeit das breite Thal eines großen, aus den baltischen Landflächen hier den Weg ins[S. 19] Nordmeer sich suchenden und mit der fortschreitenden Hebung des Landes sich immer tiefer einschneidenden Riesenflusses gewesen sein.
In der Pliocänzeit war im anglo-belgischen Gebiete wiederum Meer, das im Westen durch das Festland begrenzt wurde, welches sich noch ungebrochen von England nach Frankreich hinüberzog. Die damals abgelagerten Diesterschichten enthalten eine große Überzahl von mediterranen Fossilien; von 250 Arten haben 205 unzweifelhaft ihre Hauptverbreitung in den südeuropäischen Gebieten, und 51 davon sind noch im heutigen Mittelmeer lebend zu finden. Doch reichte dieser Golf wärmeren Wassers sicherlich nicht weit nach Norden, wo noch das alte schottisch-skandinavisch-baltische Festland eine gewaltige Schranke gegen das Nordmeer hin bildete. Dieses Festland genoß lange Zeit hindurch ein warmes und feuchtes Klima, unter dessen Einwirkung die Gesteine seiner Oberfläche zu lateritischem Detritus verwitterten. Und aus diesem dürfte wiederum das Material zu den tertiären marinen und vielleicht auch noch andersgestaltigen Ablagerungen in dem hier in Frage kommenden Areale genommen worden sein.
Noch in die Pliocänzeit hinein fallen wohl die großartigen Bodenbewegungen, welche den völligen Zusammenbruch dieses soeben erwähnten, Schottland mit Skandinavien und Finland verbindenden Festlandes zur Folge hatten und auch einen sehr großen, wenn nicht gar den allergrößten Teil des heutigen Norddeutschlands in Mitleidenschaft gezogen haben. Dadurch trat eine Verbindung mit dem nördlichen Ocean ein, und es entstand ein Meeresgebilde, das unserer heutigen Nordsee in vielem wohl schon recht ähnlich gesehen haben mag, doch noch etwas kleiner war, als diese. Die Shetlandsinseln waren damals noch mit Schottland landfest, die Ostküste Englands reichte etwa 100 Kilometer weiter nach Osten, dagegen waren wieder die östlichen Teile von Norfolk und Suffolk vom Meere bedeckt, ebenso auch Belgien, das untere Rheingebiet, die Küste Ostfrieslands, jedenfalls aber nicht viel mehr vom schleswig-holsteinischen Lande. Der Süden Englands war noch im landfesten Zusammenhang mit Frankreich. Diese erste, pliocäne Nordsee hatte also die Gestalt eines allein nach Norden zum arktischen Gebiet hin geöffneten Golfes. Groß wurde ihr Alter jedoch nicht. Schon am Schlusse der Pliocänzeit wurde der belgisch-niederländische Teil wieder trockenes Land, vielleicht zugebaut von den Anschwemmungen des Rheines,[S. 20] der damals, wie aus seinen Schottern und Ablagerungen im sogenannten Cromer-forest hervorgeht, an der Küste Nordenglands nach Norden strömte und die Themse als linken Nebenfluß aufnahm, um irgendwo in der Höhe von Norfolk in einer see- und sumpfreichen Deltalandschaft zu münden.
Dann kam die Eiszeit. Mächtige Eisströme zogen von Skandinavien her über die wieder ganz festländisch gewordene Nordsee, überall ihren Moränenschutt ausbreitend. Und als diese Kälteperiode auch zum Abschluß gelangte und die gewaltigen Eismassen zum Schmelzen gebracht worden waren, lag an der Stelle der heutigen Nordsee wiederum ein ausgedehntes Festland. Ein milderes Klima herrschte über dieses von Mitteleuropa aus überall zugängliche Gebiet, und die Vertreter derselben Flora und Tierwelt, die wir heute noch finden, gediehen auf seinem Boden neben vielen anderen seitdem ausgestorbenen Formen, wie Mammut, Nashorn, Löwen, Bären u. s. w. Gleichzeitig hielt der paläolithische Mensch seinen Einzug in das eisfrei gewordene Land. Abermals ließ der Rhein als Hauptsammler der atmosphärischen Niederschläge Mitteleuropas seine gewaltigen Fluten nach Norden strömen. Die Doggerbank, unseren Fischern als Fischgrund wohlbekannt, bildet das Überbleibsel eines alten Höhenrückens, der durch keine jüngeren Ablagerungen sich hat verdecken lassen, und hier scharren die Fischer, mit ihren Grundnetzen nach Plattfischen jagend, die Überreste vom Mammut, vom Bison, vom wollhaarigen Rhinoceros, von Rentieren, Elchen, Hyänen, Wildpferden und noch anderen Tieren mehr auf. Diese Knochenansammlungen werden als die Ablagerungen und Schotter des alten Rheinlaufes gedeutet, die hier zusammengeschwemmt zur Ruhe gelangt sind.
Die zweite, und zwar die heutige Nordsee folgte dann durch allmähliche Senkung auf dieses letzte angloskandinavische Festland. Allenthalben drang das Meer vor, dessen Wellen erst die Doggerbank als eine Insel umspülten und in später Zeit ganz überflutet haben. Von der Nordspitze Jütlands bis zum Isthmus von Calais-Dover zog sich, auf erhöhtem Vorlande belegen, ein großartiger Dünenwall dahin, der einem hinter ihm vorhandenen weiten von Hügeln, Heiden, Mooren und Sümpfen bedeckten Gebiete Schutz gewährte. Größere und kleinere, von dem hohen Geestrücken der cimbrischen Halbinsel herabkommende Wasserläufe mögen dasselbe durchzogen haben. An dem höher belegenen Küstensaume brachen sich die Seewinde, so daß sich auf dem Hinterlande eine kräftige Waldvegetation entwickeln konnte. Dem gewaltigen Andrange der Meereswogen von Norden und Westen her konnte die immer schmaler gewordene anglogallische Landenge nicht länger mehr widerstehen. Sie zerriß, und[S. 21] die Verbindung zwischen Kanal und Nordsee entstand. Ein allgemeiner Senkungsprozeß im fraglichen Gebiet begünstigte wohl diesen Vorgang. Damit war aber auch die das Festland schützende Dünenkette preisgegeben. Die Fluten brachen in das Land ein und zerstörten die Dünenwälle mehr und mehr, so daß im Laufe der Zeit nur noch die Inseln davon übriggeblieben sind, welche heute die äußere Umsäumung unserer Nordseeküste bilden. Auch diese sind durch den stetigen Anprall der Wellen immer geringer an Umfang und Ausdehnung geworden, und jedes Jahr bringt hier neue Zerstückelungen mit sich. Die Überreste der zerstörten Waldungen und Moorbildungen sind uns in den unterseeischen Wäldern und in den Dargmassen erhalten geblieben, die sich in großartiger Ausdehnung längs der ganzen deutschen Nordseeküste finden und die Unterlage des Watts bilden. An gewissen Stellen, so in den Marschen von Jever in Ostfriesland, besitzen diese Moore sogar an 16 Meter Mächtigkeit. Ohne Ausnahme zeigen sie deutlich, daß sie von Süßwasserpflanzen gebildet wurden; Eichen, Birken, Espen, Erlen, Weißdorn, Haselstaude und mehrere Arten von Nadelhölzern nehmen an dieser Zusammensetzung teil. Die Bäume stehen teilweise noch frei und aufrecht im Meerwasser, teilweise sind dieselben von einer zwei bis drei Meter mächtigen Schlickschicht bedeckt; in den meisten Fällen sind sie, jedenfalls unter der Einwirkung der Stürme und Fluten, denen sie einst ausgesetzt waren, in der Richtung nach Südost überkippt. Es sind, wie schon vor Jahren von dem schleswig-holsteinischen Geologen Ludwig Meyn ausdrücklich betont worden ist, keine brackischen oder salzigen Lagunenmoore, sondern vollkommene Festlands- und Süßwasserbildungen, welche mit diesen ihren Eigenschaften nur entstehen konnten in einem wesentlich über der See erhabenen, hügeligen Terrain und unter einem Klima, das der natürlichen ungepflegten Baumvegetation mehr hold ist, als das gegenwärtige Klima unserer Westküste mit ihren ungebrochenen Sturmwinden.
An der Westküste von Sylt liegen sogar noch solche untermeerische Torfbänke, über welche die äußere Landgrenze längst zurückgeschritten ist. Ungewöhnliche Sturmfluten zerreißen die äußersten derselben und werfen ihre losgelösten Schollen ans Land, ein Umstand,[S. 22] der auf der Insel stets als eine Wohlthat und eine dankenswerte Gabe des Meeres betrachtet wird, da dieselbe an Brennmaterial arm ist.
Man wird kaum fehlgehen, wenn man sich das Landschaftsbild an der deutschen Nordseeküste nach dem Eindringen des Meeres in das obenerwähnte Areal nicht viel anders vorstellen will, als dasselbe in der Gegenwart erscheint. Natürlich nur dem Typus, dem Charakter nach, denn was die Umgrenzungen des damaligen Festlandes und der Inselwelt jener vergangenen Tage betrifft, so waren dieselben grundverschieden von denjenigen der Jetztzeit. Der westliche Rand der Inseln lag sicherlich viel weiter seewärts, als dies nunmehr der Fall ist, und die Konturen der Festlandsküste, so wie sie sich heutzutage darstellen, sind nach vielen Peripetien größtenteils die Produkte der späteren Zeiten und das Werk menschlicher Arbeit und unablässigen Fleißes. Aber gerade so wie heute haben wohl auch dazumal größere und kleinere Eilande aus dem seichten Meere hervorgeragt, die Überreste der hügeligen Partien des untergesunkenen Landes, geradeso wie heute füllte das Watt mit seinen Tiefen und Prielen den Zwischenraum zwischen diesen Inseln und dem Festlande aus, geradeso vollzog sich schon damals jener eigentümliche Wechselprozeß der Zerstörung des Küstenlandes durch das Meer und das Wiederabsetzen dieses losgelösten Materials an einer anderen Stelle, jener Vorgang, dem das Watt und die daraus hervorgegangenen Marschen ihr Dasein verdanken. Denn was die See an einer Stelle nimmt, das schenkt sie an einer anderen wieder her. Allerdings, sehr einfach ist dieser Prozeß der Landneubildung nicht, es ist derselbe vielmehr ein kompliziertes Ding, bei welchem vielerlei noch nicht gehörig aufgeklärt ist. Das Material, das hierbei in Betracht kommt, ist ein sandiger und glimmerreicher Schlick, welcher unter der Einwirkung von Ebbe und Flut abgesetzt wird, und zwar nicht vom Meere allein, sondern auch von den verschiedenen Zuflüssen der Nordsee. Er besteht aus den feinerdigen Stoffen, welche die Flüsse mit sich führen, aber mehr von zerstörten älteren Flußalluvionen als von zerstörtem Gebirge herrührend, dann aus den mineralischen Teilen, die von den Abnagungen des Meeres an den benachbarten tertiären, diluvialen und alluvialen Küsten stammen, aus dem feinen Meeressande, welcher durch die Brandung mit in Suspension gebracht wird, aus den unzähligen Resten von winzig kleinen Lebewesen der marinen Tier- und Pflanzenwelt und der ins Meer geführten Süßwasserbewohner, und den Humussäuren der von allen Seiten kommenden Moorwässer, welche sich mit den Kalk- und Talkerdesalzen des Meeres niederschlagen. „Letztere liefern so den Schlamm, das wichtigste Bindemittel für die Sandmassen und übrigen Stoffe, welche vom Meere und den Flüssen an den Mündungen angehäuft werden. Die humussauren Salze bilden den Hauptfaktor für die Entstehung der Watten und der Marschen. Hieraus erklärt sich auch in gewisser Hinsicht das Fehlen der Wattenbildungen in anderen Meeren, wie z. B. in der salzarmen Ostsee“ (Haage).
Die Watten sind nun, wie man sie treffend genannt hat, ein amphibisches Übergangsgebilde zwischen Wasser und Land, ein Gebiet, das für das gewöhnliche Auge vom übrigen Meere nicht zu unterscheiden ist, wenn das Wasser seinen Höhepunkt erreicht hat, das aber bei niedrigem Wasser in der Gestalt von trockenen gelben Sandflächen erscheint, die nur nach dem Festlande hin und in der Umrandung der Inseln mit grauem Schlick bekleidet sind. Eine Unmenge von Wasserrinnen, sog. Tiefe, Baljen, Priele u. s. f., umsäumen und gliedern die Watten und vereinigen sich zu größeren Tiefen, in welchen Strömungen cirkulieren, die, wie Meyn sagt, „mit der Geschwindigkeit des Rheinstromes dem Meere zuschießen, allen eingewehten Sand vor sich herfegend und den größten Schiffen Einfahrt räumend“. Der eingeborene Fischer und Schiffer, dessen Erwerb, ja dessen Leben von der richtigen Beurteilung der Wasserfläche abhängen, gewahrt bei Hochwasserstand mit Leichtigkeit diese Tiefen und vermag dieselben von den ausgedehnten Untiefen zu unterscheiden, auch wo sie nicht durch die in Wind und Wogenschlag schwankenden jungen Birkenstämme bezeichnet sind, die überall als Zeichen des Tiefs in seinen untiefen Rändern versenkt sind und die Binnenschiffahrt erleichtern. Das Areal dieser amphibischen Grenzzone der Watten zwischen dem deutschen Festlandsboden und der Nordsee ist[S. 24] 3655,9 Quadratkilometer groß; hiervon bilden 3372 Quadratkilometer = 92¼% einen geschlossenen Grenzsaum, die übrigen 283,9 Quadratkilometer = 7¾% liegen als Exklaven innerhalb des Meeresgebietes. Es sind diese letzteren isolierte Wattinseln, die mit dem geschlossenen Wattensaum nicht in fester Berührung stehen und sich nicht wie dieser an dauernd trockenes Land anlehnen. Vereinzelt tauchen sie als „Sande“ vor den Friesischen Inseln und innerhalb der zahlreichen Buchten, die das Meer in das Wattland hineinsendet, aus dessen Wassern auf. Auf die Watten an der Küste Schleswig-Holsteins entfallen insgesamt 2023,4 Quadratkilometer, auf diejenigen an der Küste von Hannover und Oldenburg 1632,5 Quadratkilometer.

(Nach einer Photographie von Bernh. Lassen in Westerland-Sylt.)
Die großen Flächen der Watten sind sandig und fest zu betreten, dagegen sinkt man tief in dieselben ein, wenn sie schlammiger Natur sind. Der Marschbewohner Nordfrieslands geht bei Ostwind an vielen Stellen von Insel zu Insel, sogar von Sylt nach dem Festlande. Doch ist eine solche Wanderung, ein Schlicklauf, nicht immer ohne Gefahr, und Vorsicht thut hier besonders not (Abb. 6–8).
In früheren Zeiten hat der auf den Watten häufig vorkommende Bernstein bei den Bewohnern der umliegenden Küsten zur Beleuchtung gedient. Nach jeder höheren Flut wirft die See Bernsteinstücke verschiedenen Formates aus und diese bleiben dann, wie Meyn bemerkt, „mit einem schwarzen Brockenwerk aus Braunkohlenstückchen, Schiffstrümmerchen, Torfstückchen und zerriebenem Torfholze, teilweise auch glattgerollten größeren Holzstücken aus dem Torfe, dem sog. ‚Rollholz‘, in langen braunen Streifen als äußerste Wattenkante an Hochsanden, Hochstranden und sonstigen erhabenen Stellen liegen, wo sie von den Schlickläufern gesammelt, weiter südlich durch die abenteuerlichen ‚Bernsteinreiter‘ gefischt werden“. Über die mit diesem Bernsteinsammeln verbundenen Gefahren hat vor 112 Jahren der Pastor Heinrich Wolf zu Wesselburen eine belehrende Darstellung in den schleswig-holsteinischen Provinzialberichten gegeben, worin derselbe u. a. mitteilt, daß oft Stücke von 24 Lot gefunden würden und kurz vorher sogar ein solches von dritthalb Pfund aufgelesen worden sei. „Man will mir sagen,“ schreibt er weiter, „daß ein gewisser Mann in einer benachbarten Gegend jährlich über tausend Mark auf diese Weise umgesetzt habe.“ Tausend Mark Banko waren aber im Jahre 1788 eine recht beträchtliche Summe.
Ludwig Meyn hat den Beweis dafür erbracht, daß hier an ein originales Bernsteingebirge nicht gedacht werden kann, sondern daß das Material aus dritter, vierter oder fünfter Lagerstätte kommen müsse, und daß seine Anwesenheit demnach als das Zeichen eines zerstörten Miocän- resp. Diluviallandes zu gelten habe.
Aber nicht nur vom geologischen Standpunkte aus, auch von demjenigen des Altertumsforschers ist das Vorkommen des Bernsteins in größerer Menge an den deutschen Nordseeküsten von Wichtigkeit. Es ist bekanntlich ein lange Zeit hindurch strittiger Punkt gewesen, woher die Römer ihren Bernstein bezogen hätten, und wo die von Pytheas von Massilia geschilderte Bernsteininsel Abalus zu suchen sei. Der eben genannte Reisende hat zu Alexander des Großen Zeiten, den Schritten der Phönicier und Karthager folgend, die britannische Küste[S. 25] und auch zuerst das germanische Nordseegestade besucht, von dem er die Schilderung eines Ästuars — Mentonomon nennt er es — von 6000 Stadien Ausdehnung gibt. „Dort,“ so lautet sein durch Aufzeichnungen des Timäus von Müllenhoff ergänzter Bericht, „wohnen die Teutonen und vor ihrer Küste liegt im Meere außer mehreren unbenannten Inseln in der Entfernung von einer Tagefahrt die Insel Abalus, wohin im Frühjahr die Fluten den Bernstein, der eine Absonderung des geronnenen Meeres ist, tragen und in großer Menge auswerfen. Die Einwohner dort sammeln ihn und haben so reichlich davon, daß sie ihn statt des Holzes zum Feuern gebrauchen“ u. s. f. Oberhalb der Elbe im Gebiete der Eidermündungen wird noch jetzt der meiste Bernstein an der Nordsee gefunden und in dieser Gegend mag wohl die mythische Bernsteininsel gelegen haben, die, wie Müllenhoff meint, Pytheas wohl mit eigenen Augen erblickt hat, was mehrfach in Zweifel gezogen worden war. Er war der erste namhafte Mann, der wohl die Germanen in ihrer Heimat aufsuchte und von Angesicht sah, und jedenfalls der erste, der von ihnen eine Kunde erlangt und Nachricht gegeben hat. Wenn es auch unzweifelhaft erscheinen dürfte, daß ein großer Teil des von dem römischen Volke verbrauchten Bernsteins, besonders seit Domitian, aus dem Samland kam, so ist es doch wohl nicht minder sicher, daß schon in früheren Zeiten auch von der Nordseeküste aus dieses edle Harz seinen Weg an den Tiberstrom gefunden hat.
In eigentümlicher Weise geschliffen, von den rollenden Wellen zu Kugeln, Ellipsoiden, Doppelkugeln, Spindeln u. s. f. geformt, stellt sich das Rollholz dar, das aus den submarinen Mooren und Wäldern stammt. Seine Spalten sind erfüllt von Sandkörnern, Foraminiferen und winzigen Tierresten, als kleine Echinitenstacheln u. s. f. Es zeigt uns, daß Moore und Wälder unter dem Sande jetzt bis an die äußerste, vor der Brandung liegende und sich verzehrende Kante reichen, daß also jetzt die Brandung bereits innerhalb des ehemaligen hochbelegenen Küstensaums im Bereich des vormaligen Niederlandes aufschlägt.
Die Unterlage der Watten besteht, wie gezeigt worden ist, aus einem untergetauchten und von den Wellen teilweise zerstörten, mannigfaltig gegliederten Festlande, und damit hängt auch der Umstand zusammen, daß sich auf ihrem Gebiete Süßwasserquellen vorfinden, wodurch wiederum der geologische Zusammenhang mit dem naheliegenden Küstenlande bewiesen wird. So soll vormals bei der Hallig Nordmarsch eine solche Quelle gewesen sein, eine andere nördlich von Langeneß, wo „ein Brunnen mit frischem Wasser mitten in dem salzen Meere hervorquillt“, wie Lorenz Lorenzen, der Halligmann, in Camerers Nachrichten von merkwürdigen Gegenden der Herzogtümer Schleswig und Holstein erzählt. Dann ist in früheren Zeiten nicht selten berichtet worden, daß Tuulgräber im Watt ertrunken seien, weil plötzlich in der unterseeischen Torfgrube das süße Wasser aufsprudelte.
Die Watten und ganz besonders diejenigen Nordfrieslands verdienten eigentlich als ein großer Kirchhof bezeichnet zu werden. Denn alsbald, nachdem die Anschlickung an die Überreste des zusammengerissenen und teilweise von den Wogen verschlungenen alten Festlandes wieder begonnen und die erste[S. 26] Marschbildung sich vollzogen hatte, mag es auch nicht an Menschen gefehlt haben, welche von dem so gebildeten Neulande Besitz nahmen und in diesem Gebiete ihre Ansiedelungen erbauten. Neue Meereseinbrüche, veranlaßt durch die von den Sturmfluten auf das nunmehr schutzlos gewordene Land hinaufgetriebenen Wassermassen, brachten neue Zerstörungen mit sich, denen wiederum neue Anschlickungen und neue Besiedelungen folgten, die ebenfalls ein Opfer der Wellen wurden. Und so ist es zweifellos von den ältesten Zeiten her gegangen, in denen der Mensch im Lande erschien; ein immerwährender Wechsel war es, der die Oberfläche des Gebietes immer und immer wieder anders gestaltete, allerdings aber so, daß der Landverlust den Landgewinn durch Anschlickung schließlich um ein sehr Bedeutendes überwog. Erst als der Mensch gelernt hatte, sich vermittelst der Deiche Schutzwehren gegen den vernichtenden Anprall und den alles zernagenden Zahn der Meereswogen zu bauen, wurde es besser. Aber auch in dieser Beziehung hat der Marschbewohner mit Leib und Leben, mit Hab und Gut gar oft Lehrgeld bezahlen müssen, und bis er die Kunst des Deichbaues so erfaßt hatte, daß ihm die grünen an der Küste aufsteigenden Wälle nicht nur bei der nächsten besten Sturmflut von der Brandung wieder zusammengerissene Brustwehren waren, sondern zum mächtigen Schild wurden, hinter dem er sein Eigentum und sein Leben in Sicherheit barg, hat es gar lange und bis in unser Jahrhundert hinein gedauert! Millionen von Menschen, Tausende von Wohnstätten haben bis dahin dem wütenden Elemente zum Opfer fallen müssen, ganze Kirchspiele sind von der Erdoberfläche verschwunden, große Landareale von den nassen Wogen verschlungen worden, bedeutende Städte mußten „vergehen“, wie die Chronisten aus früheren Zeiten sich ausdrückten, bevor dies geschah. Über diese weiten großen Flächen, in deren Tiefen dies alles versunken ist, rollt heute die salzige Welle der Nordsee dahin und nur Pfahlstümpfe, Mauertrümmer, verwitterte Leichensteine und dergl. Dinge mehr, welche die tiefe Ebbe bisweilen auf dem Watt bloßlegt, erinnern daran, daß ehemals hier menschliche Wohnstätten gestanden und menschliche Wesen hier gelebt, geliebt, gehofft und auch gelitten haben.
IV.
Sturmfluten.
Plinius berichtet schon von einer gewaltigen Sturmflut, welche den größten Teil der Cimbern und die Teutonen gezwungen haben soll, sich nach gesicherteren Wohnstätten in Südeuropa umzuschauen. Wie wir aus Mitteilungen des eben genannten Schriftstellers und aus solchen des Ptolemäus wissen, lag die Heimat des cimbrischen Volkes im äußersten Norden des germanischen Landes, im cimbrischen Chersonesus, also in dem heutigen Jütland und wohl auch im nördlichen Teil des Herzogtums Schleswig. Das erste Erscheinen der Cimbern im Lande der Taurisker, in der Umgegend von Klagenfurt, fällt in das Jahr 113 v. Chr., woraus zu schließen wäre, daß die obenerwähnte Wasserflut wohl einige Jahre früher stattgehabt hätte. Nach Eugen Traeger ist jedoch die erste historisch festgestellte Flut diejenige gewesen, welche 445 Jahre später, anno 333 nach des Heilands Geburt, die germanische Nordseeküste verheert hat. In den darauf folgenden Jahrhunderten haben sich derartige Ereignisse mehrfach wiederholt, so um 516, wo in den friesischen Landen über 6000 Menschenleben von den Wasserfluten vernichtet wurden, und im Jahre 819, das den Untergang von 2000 Wohnstätten an der Nordsee gesehen hat. In jene fernen Zeiten fallen auch die ersten bedeutenderen Versuche, die Küsten durch besondere Schutzbauten, durch Deiche, vor der Zerstörung durch die See zu bewahren, zumal die von den Fluten immer mehr und mehr zerrissenen und zu Grunde gerichteten Dünensäume nicht länger mehr dem Anprall der Wogen stand zu halten vermochten. Aber erst vom Jahre 1100 ab wurden die Deichbauten mit größerem Eifer betrieben, insbesondere in den Dreilanden, dem jetzigen Eiderstedt und auf Nordstrand.
Von den zahlreichen Fluten, über welche uns von den verschiedenen Chronisten Frieslands, insbesondere von Anton Heinreich in seiner nordfriesischen Chronik berichtet wird, ist, wie in neuerer Zeit von Reimer Hansen an der Hand kritischer historischer Forschung dargethan wurde, bei weitem der größere Prozentsatz zu streichen. Im zwölften Jahrhundert[S. 28] kommen für Dithmarschen und Nordfriesland in Betracht die Flut vom 16. Februar 1164 und vielleicht auch diejenige von 1158. Für das dreizehnte Säkulum ist wohl die Katastrophe vom 17. November 1218 verbürgt, bei welcher nach Peter Sax „im Oldenburgischen Jadeleh, Wardeleh, Aldessen in Rustringen vergangen; in den Nordländern volle 36000 Menschen ertrunken“. Vielleicht ist damals auch die Lundenburger Harde durchgerissen worden, wie Heimreich erzählt. Ebenso wird die Flut vom 28. Dezember 1248 von nordalbingischen Chronisten so ziemlich sicher bezeugt. 1277 und 1287 entstand durch die Zerstörung von 385 Quadratkilometern des fruchtbarsten Landes mit 50 Ortschaften der Mündungsbusen der Ems mit dem Dollart, und mit dem Jahre 1300 begann dann eine Periode, die im Bereich der friesischen Lande mit Recht die Elendszeit genannt worden ist. Eine wenig günstige Schilderung der Charaktereigentümlichkeiten des Friesenvolkes jener Zeit haben uns, allerdings erst einige Jahrhunderte später, einige Chronisten gegeben. Es heißt da, sie seien durch ihren Reichtum hochmütig gewordene und das Wort Gottes und die heiligen Sakramente verachtende Menschen gewesen, die sich durch ihre Sündhaftigkeit diese schrecklichen Strafen Gottes zugezogen hätten. Es mag hier dahingestellt bleiben, ob dieses harte Urteil nicht sehr durch Parteilichkeit getrübt ist, und inwiefern die Ursache der Unfolgsamkeit des sonst so schlichten, wenn auch derben friesischen Volkes nicht in einem gegründeten Verdachte oder in Mißtrauen gegen seine katholischen Priester zu suchen war, denn, wie Petrejus in seiner Beschreibung des Landes Nordstrand sagt: „Die Papisterey und Mönnicherey ist ihnen vielleicht verdächtig gewesen.“
Unsicher ist die Flut vom 1. Mai 1313, sicherer eine solche aus dem Jahre 1341, wahrscheinlich eine weitere am 1. Mai 1380, am sichersten[S. 29] aber diejenige vom 16. Januar 1362, die schlimmste von allen vor der zweiten großen Manndränke am 11. Oktober 1634. Damals stieg das Wasser über die höchsten Deiche Nordfrieslands, richtete in den Außenlanden furchtbare Verwüstungen an und riß an der Südseite der Insel Nordstrand einen beträchtlichen Teil des Landes hinweg, so daß ein bedeutender Meerbusen an dessen Stelle entstand. Die überaus reiche Stadt Rungholt und noch sieben andere Kirchspiele auf dem ebengedachten Eiland wurden zerstört, an der Hever und ihren Enden sollen 28 Gemeinden untergegangen sein, und 7600 Menschen haben dabei ihren Tod in den mörderischen Wellen gefunden. Der Rungholter Sand zwischen Pellworm und dem heutigen Nordstrand erinnert jetzt noch an die versunkene Stadt, deren Missethaten der Sage nach den Zorn des Herrn besonders heraufbeschworen haben sollen. Als die Rungholter gar ein Schwein betrunken gemacht und dasselbe in ein Bett gelegt hatten und hierauf ihren Priester rufen ließen, damit dieser dem Kranken das heilige Abendmahl gebe, war das Maß göttlicher Langmut voll. Der Bitte des gesalbten Mannes, der ob jener Zumutung aufs höchste empört in die Kirche gelaufen war, um dort Gottes Strafe auf die gottlosen Leute herabzuflehen, wurde von oben stattgegeben, und es erfolgte, wie uns Jonas Hoyer überliefert hat, „in der Nacht ein so erschrecklich Erdbeben und gräulich Wetter“, daß Rungholt gänzlich umkam und in den Tiefen des Meeres versank.
Am gleichen Tage sollen auf Sylt das alte Wendingstadt und der Friesenhafen der Zerstörung anheim gefallen sein. Den letzteren haben der Überlieferung nach die Angelsachsen auf ihren Zügen ins britannische Land als Abfahrtshafen benutzt.
Zeitgenossen haben die Zahl der an jenem Unglückstage zwischen Elbe und Ripenersfjord umgekommenen Menschen auf etwa 200000 geschätzt, weshalb diese gewaltige Flut auch den Namen „Manndränke“ oder „Manndrankelse“ bekommen hat, eine Bezeichnung, die übrigens noch für andere ähnliche Ereignisse in Anspruch genommen worden ist. „Wenn man nun,“ so äußerte sich Traeger, „fortwährend von solchen Zahlen hört, so drängt sich die Vermutung auf, daß die Schätzungen damaliger Zeit wiederholt nur pessimistischer Abrundung eine so erschreckende Höhe verdanken. Wo hätten denn immer wieder in den sicherlich nicht dicht bevölkerten Küstengebieten die Menschen herkommen sollen, um allein von den Meeresfluten so massenweise verschlungen zu werden!“ Man darf ja nicht vergessen, daß, wie solches von Reimer Hansen ausdrücklich hervorgehoben wird, die Chronisten des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts über die Fluten des zwölften, dreizehnten, vierzehnten und zum Teil auch des fünfzehnten Jahrhunderts außerordentlich wenig sichere Mitteilungen machen und, daß Heimreichs zahlreiche Angaben fast ganz wertlos sind.
Größere Fluten des fünfzehnten Jahrhunderts waren am 22. November 1412, am 29. September 1426, am 1. November 1436, am 6. Januar 1471, am 16. Oktober 1476, am 4. Dezember 1479 und am 16. Oktober und 22. November 1483. Die bedeutendsten davon scheinen die vom 1. November 1436 und vom 16. Oktober 1483 gewesen zu sein.
Am Allerheiligentage 1530, und am gleichen Tage genau zwei Jahre später brachen die Wogen der Nordsee von neuem mit besonderem Ungestüm in Nordfriesland ein. Dann begann mit den ersten Novembertagen 1570 wiederum eine neue Periode großen Elends in der langen Leidensgeschichte des Friesenvolkes, die ebenfalls eine ungeheure Anzahl Menschenleben zum Opfer gefordert haben soll.
Genauere und bestimmtere Darstellungen von dem durch die Sturmfluten verursachten und heraufbeschworenen Unglück besitzen[S. 32] wir erst aus späteren Jahrhunderten, und das erste derartige Ereignis, von dem sich einigermaßen zuverlässige Mitteilungen bis auf unsere Tage erhalten haben, ist wohl die Sturmflut vom 11. Oktober 1634 gewesen. Diese bildet, um hier Traegers Worte zu gebrauchen, einen entscheidenden Zeitpunkt in der Geschichte der schleswigschen Westküste. In seiner im Jahre 1652 erschienenen großen neuen Landesbeschreibung der Herzogtümer Schleswig und Holstein erzählt der ehrenwerte Kaspar Danckwerth von dieser „überaus argen und grausamen Flut, so anno 1634 auf Burchardi durch Gottes Verhängnis inner fünf oder sechs Stunden alle diese Nordfriesische Marschländer übergangen, und den Nordstrandt schier ganz dahin gerissen hat, also daß nur das Kirspel Pillworm wieder errettet worden: und ist zu verwundern, daß man zu der Zeit in Holland von überaus großem Sturm weniger von erfolgetem Schaden durch Einbrüche des Meeres nicht gehöret“. Und Adam Olearius, der Sekretarius, Mathematikus, Antiquarius und Rat Friedrichs III., Herzogs von Holstein-Gottorp (1600–1671), schreibt darüber in seinem kurzen Begriff einer Holsteinischen Chronik: „Es halten ihrer viel davor, daß dies erschreckliche Unglück und Garauß sie (die Bewohner Nordstrands) unter anderen ihren groben frevelhafften Sünden, auch mit dem Ungehorsam und Rebellion wider ihren frommen Landesfürsten durch einen Fluch ihnen über den Hals gezogen. Matthias Boetius, ihr eigen Landsmann und Pfarrherr gedenket bei Beschreibung des Cataclismi, so sie anno 1615 auch erlitten, ihrer groben Laster, Wildheit und Frechheit mit vielen Worten: daß sie den Todtschlag eines Menschen nur eines Hundes gleich geachtet, daher sie auch damahls solche Straffe wol verdienet hätten.“
Es mag hier wohl am Platze sein, etwas bei dem Berichte über jene verhängnisvolle Sturmflut zu verweilen, welchen uns C. P. Hansen in seiner Chronik der friesischen Uthlande in warmempfundener und poetischer Sprache hinterlassen hat. Derselbe fußt größtenteils auf Niederschriften von Augenzeugen und von Zeitgenossen der Katastrophe.
„Endlich kam,“ so beginnt der Autor, „der jüngste, der schrecklichste Tag des alten Nordstrands, und ich möchte sagen, des alten Nordfrieslands. Noch am 10. Oktober 1634 lag es da, das grüne, von Fett und Fruchtbarkeit erfüllte Tiefland inmitten der finsteren, grollenden See, die Freude, die Kraft, der Stolz und Mittelpunkt der Uthlande, nicht ahnend dessen, was ihm bevorstand, nach hundert trüben Erfahrungen noch immer fest bauend auf den Schutz seiner erst vor kurzem wieder errichteten Deiche. Ringsum lag ein Kranz von Halligen und Hallighütten, die wie seltsam gestaltete und gruppierte Felsen aus der Wasser- und Wattenwüste hervorragten; weiterhin, jenseits derselben, glänzte ein Schaumgürtel der sich brechenden Wellen an den äußeren Sandbänken und Inseln. Im Westen und Süden zogen finstere Wolkenmassen am Himmel herauf, obgleich der Wind noch ruhte. Es war die Totenstille, die oft dem Sturm vorhergeht. Im fernen Westen blitzte es, und als es Abend wurde, die finstere lange Nacht heranschlich, da flüchtete ahnungsvoll der Schiffer wie die Seemöve ans Ufer, die vorsichtige Krähe aber aufs Festland. Die Nacht verging, der Morgen des 11. Oktober kam, der letzte, welchen das altberühmte Nordstrand erlebte. Blutrot stieg die Sonne im Südost hinter Eiderstedt herauf, beschaute noch einmal das schöne, fruchtbare Eiland mit seinem goldenen Ring, mit seinen grünen Wiesen und weidenden Viehherden, mit seinen gesegneten Äckern, seinen Kirchen und Mühlen, seinen stillen Dörfern und zerstreuten Bauernhöfen, seiner emsigen, tüchtigen, Gott und sich selber vertrauenden Bevölkerung; dann verbarg sie sich wie weinend hinter die dichten Wolken, die für den Tag ihr die Herrschaft stahlen. Noch einmal läuteten die Kirchenglocken die gläubigen Christen zum Gottesdienst in die Kirchen — denn es war eben Sonntag. Noch einmal scharten sich die Schlachtopfer betend in den heimatlichen Gotteshäusern, stimmten noch einmal ein Loblied dem Herrn an, während der Donner schon über ihre Häuser rollte und der Regen sich in Strömen ergoß. Noch einmal sammelten sich die Familien an ihrem freien Eigentumsherd und um den gefüllten Tisch im Frieden, nicht ahnend, daß es das letzte Mal sein würde.“
Ein ungeheurer Sturmwind aus Südwesten kommend brach los, dessen Ungestüm sich den Tag über immer mehr und mehr[S. 33] steigerte, und gegen neun Uhr abends geschah das Entsetzliche, daß im Verlaufe einer einzigen Stunde das Meer durch 44 Deichbrüche in die Köge stürzte. Schon um zehn Uhr war die Insel vernichtet, und Nordstrand hatte aufgehört zu sein. „Da waren mehr als 6200 Menschen und 50000 Stück Vieh dort ertrunken; da waren die Deiche der Insel an zahllosen Stellen zerstört; da lagen 30 Mühlen und mehr als 1300 Häuser zertrümmert danieder; da war vernichtet die Heimat und das Glück von mehr als 8000[S. 34] Menschen. Nur die Kirchtürme und Kirchen ragten, obgleich auch beschädigt, aus diesem wilden Chaos, aus diesem großen Kirchhofe wie kolossale Grabmäler hervor. Der kalte Nordwest hatte unterdessen in der Nacht über die Trauerscene geweht, jedoch der Sturm sich allmählich gelegt. Nur 2633 Menschen hatten diese Schreckensnacht, hatten den Untergang ihrer Heimatinsel überlebt, blickten aber jetzt trostlos auf die verödeten Land- und Häusertrümmer, auf die zerrissenen Deiche und das frei ein- und ausströmende erbarmungslose Meer, auf die im Wasser und Schlamm umherliegenden Menschen- und Tierleichen, auf die zerstörten und verdorbenen Geräte und Vorräte und vor allem auf den nahen Winter mit seinem Frost und Schnee, mit neuen Stürmen und Fluten und neuem Elend, und auf ihr eigenes nacktes Dasein inmitten dieser Wasserwüste und dieser wilden Elemente.“

(Nach einer Photographie von Waldemar Lind in Wyk auf Föhr.)
Der gelehrte und in diesen Blättern schon genannte friesische Chronist Anton Heinrich Walther, der 30 Jahre lang (1656–1685) Prediger an der Kirche der Hallig Nordstrandisch-Moor gewesen ist, fügt seinem eigenen Bericht über den 11. Oktober 1634 noch die Worte hinzu: „Es ist aber der Wasserfluth nicht genug gewesen, sondern es hat auch Gott der Herr viele daneben mit der Feuerruthe gestrafet, indem eines Theils aus Unvorsichtigkeit, anderen Theils aus Ungestümigkeit der Winde ihr Feuer ihre eigenen Häuser, darauf sie gesessen und den Tod stündlich erwartet, hat eingeäschert, also daß sie einen zwiefachen Tod vor ihren Augen haben sehen müssen, auch wol, wie man Exempel weiß, aus Furcht vor dem Feuer selbst in’s Wasser gesprungen und sich also ersäuft, da man sonst noch das Leben hätte retten können. Und ist nicht ungläublich, daß mehrermeldeter ungeheurer Sturmwind mit einem Erdbeben vermenget gewesen.“
Von der Mitte der Insel Nordstrand waren nur einige Halligen übriggeblieben, die im Laufe der Zeit bis auf wenige Überreste nach und nach gänzlich von den Meereswogen verschlungen worden sind. Eines dieser Überbleibsel bildet die heutige Hallig Nordstrandisch-Moor, ehemals ein in der Mitte des alten Nordstrand befindliches, hoch belegenes Moor, auf welches sich ein Teil der Einwohner geflüchtet hatte. Sie bauten sich hier Werften, Häuser und 1656 sogar eine eigene Kirche und nährten sich in der Folge von Fischfang, Schiffahrt, Schafzucht und Torfgraben. Auch Nordstrandisch-Moor hat hernach noch viele böse Zeiten erleben müssen, mehrfach sind die brandenden Wogen der Nordsee wieder über die Hallig hinweggezogen und Elend und Not haben sie in noch mannigfacher Weise heimgesucht. Ihre letzten Unglückstage waren der 1. Dezember 1821 und dann wieder der 4. Februar 1825, an denen die Meereswellen die Kirche zusammengerissen haben, die seither nicht wieder aufgebaut worden ist. Die Kirchwerft steht heute verlassen da. Der letzte Geistliche, welcher in dem zerstörten Gotteshause seines Amtes gewaltet[S. 35] hat, war Johann Christoph Biernatzki, der berühmte Verfasser der Novelle „Die Hallig“. Seine darin niedergelegte ergreifende Schilderung der Sturmflut von 1825 ist längst ein Gemeingut des deutschen Volkes geworden.
Das westliche Ende des alten Nordstrand, Pellworm, wurde später mit Hilfe der Holländer wiedergewonnen, das östliche, das jetzige Nordstrand, erst viele Jahre nachher wieder eingedeicht. Von den 40000 Demat, welche die Insel eben vor der Flut noch maß, sind jetzt, nach 276 Jahren, kaum der dritte Teil wieder dem Meere entrissen.
Es mangelt uns hier an Raum, um weiter von den Zerstörungen zu berichten, welche die Sturmflut von 1634 noch an anderen Stellen der deutschen Nordseeküste angerichtet hat. Die Schätzung Hansens, daß dieselbe in allen ehemaligen nordfriesischen Uthlanden etwa 9089 Menschen, in ganz Nordfriesland ca. 10300 menschliche Wesen, in allen Marschländern der cimbrischen Halbinsel jedoch deren an 15000 zum Opfer gefordert habe, dürfte kaum zu hoch gegriffen sein.
Im achtzehnten Jahrhundert verzeichnet die Chronik eine ganze Anzahl von Unglückstagen, welche das stürmische und wildbewegte Meer über die friesischen Lande heraufbeschworen hat. Da war es der Christtag 1717, an dem, fünf Tage nach dem Vollmond, bei heftig wütendem Südwestwinde, der in der Nacht nach Nordwesten umsprang, das Wasser an der Küste um eine ganze Elle höher gestanden haben soll als im Jahre 1634. Schon um die dritte Stunde des Weihnachtsmorgens war das ganze Land überschwemmt, aber erst gegen acht Uhr hatte die Flut ihren höchsten Stand erreicht. Die Halligen, die Inseln Föhr und Sylt, Dithmarschen und das Land nördlich der Eider mußten alle gewaltig unter dem Andrang des Wassers leiden. Auf Langeneß durchwühlten die Wogen den Kirchhof und rissen die Särge aus ihren Gräbern. In Süderdithmarschen kamen 468 Menschen und 6530 Stück Vieh um, 1067 Häuser wurden zerstört. Man begann überall sofort, soweit das bei der Witterung im Winter angängig war, die entstandenen Schäden wieder auszubessern, allein schon zwei Monate später, am 25. Februar 1718, entstand abermals ein entsetzliches Unwetter, das eine neue Überflutung zur Folge hatte. Der Sturm[S. 36] trieb das Wasser der Nordsee in ungewöhnliche Höhe über die Inseln und Marschen Frieslands hinweg, zerbrach die Eisdecke des inneren Haffes, schob die Eistrümmer aufeinander und führte sie mit sich gegen die Ufer und Deiche, ja zum Teil weit in das Land hinein, so daß die Wirkungen dieser Sturmflut teilweise noch viel zerstörender wurden, als diejenigen der Weihnachtsflut.
Eine weitere Katastrophe ereignete sich in den Tagen des 9. zum 11. September 1751, wobei unter anderen die Insel Föhr durch einen fünffachen Deichbruch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dann ist der Oktobersturm von 1756 (7. Oktober) nicht zu vergessen, der von gewaltigen Deichbrüchen und Unheil aller Art begleitet gewesen ist. „Auf Gröde,“ so erzählt Hansen, „schien eine Auferstehung der Toten vor sich zu gehen. Die aus den Gräbern des dortigen Kirchhofes durch die tobenden Wellen herausgespülten Särge stießen die Wand des dortigen Pastorates ein und stürzten in die Stube desselben.“
Nachdem schon der Dezember 1790 sehr sturmreich gewesen war — allein während dieses Monats werden sieben Sturmtage gezählt —, brachte das Jahr 1791 eine wahre Unzahl von Stürmen, deren stärkster mit einer großen Wassersflut am 21.–22. März erfolgte. Noch gewaltiger tobten aber die aufgeregten Wellen der See in der Zeit vom 4. zum 11. Dezember 1792, bei vorherrschendem Südwest- und nachher wieder, wie gewöhnlich nach Nordwesten umspringendem Winde. Die friesischen Deiche litten überall in hohem Maße; nur noch „wie Klippen ragten die besonders arg mitgenommenen Deiche Pellworms aus dem wogenden und schäumenden Meere hervor“, und die dortigen Köge sollen sogar meist sechs Fuß unter Wasser gestanden haben. Von Föhr und von verschiedenen Stellen des Festlandes werden ebenfalls viele Deichbrüche gemeldet, und die Marschen blieben dort noch geraume Zeit vom salzigen Wasser bedeckt, das sich nur langsam verlief. Übrigens ereigneten sich schon wieder am 18., 19. und 21. Dezember neue, wenn auch viel schwächere Stürme.
Kaum waren die so arg heimgesuchten Bewohner wieder etwas zur Besinnung gekommen, als bereits am 3. März 1793 und am 26. Januar 1794 neuer Schrecken und Not über Nordfriesland hereinbrachen.
Traeger hat die Höhen einzelner Fluten des achtzehnten Jahrhunderts zusammengestellt. Sie betrugen:
| Anno | 1717 | 20 | Fuß | ||
| „ | 1751 | 20 | „ | 2 | Zoll, |
| „ | 1756 | 20 | „ | 5 | „ |
| „ | 1791 | 20 | „ | 2 | „ |
| „ | 1792 | 20 | „ | 6 | „ |
Zum letztenmal in größerem Umfang ist die friesische Küste am Ende des neunzehnten Jahrhunderts der Tummelplatz der zerstörenden Wellen gewesen. Das ist in der denkwürdigen Nacht vom 3. zum 4. Februar 1825 geschehen. In vielen Dingen soll dieses grausige Ereignis den Sturmfluten von 1634 und 1717 ähnlich gewesen sein. Auch diesmal kam der Sturm erst aus Südwesten und drehte dann nach Nordwesten um. Sylt, Amrum, Föhr, am meisten aber die Halligen und Pellworm wissen von dieser Unglücksnacht zu erzählen. In mehr als 100 Häuser auf der erstgenannten Insel drangen die Wasserströme ein, viele davon wurden zerstört, und das kleine, verarmte Dorf Rantum ging fast ganz verloren. Föhrs Deiche brachen an fünf verschiedenen Stellen; seine Marschen wurden überschwemmt, zwei Menschenleben, viele Kühe und 4000 Schafe kamen in den Wellen um. Auf den Halligen standen vor dieser Sturmflut 339 Häuser; davon waren 79 ganz verschwunden und 233 durch das Wasser unbewohnbar geworden. Auf Hooge ertranken 28 Menschen, 30 auf Nordmarsch und Langeneß, 10 auf Gröde. Die von den Wellen verschont gebliebenen Halligbewohner saßen durchnäßt, hungernd und frierend auf den Trümmern ihrer Wohnstätten, fanden aber durch die Barmherzigkeit der Föhringer fast alle Obdach und freundliche Aufnahme in Wyk auf Föhr. Manche blieben für immer dort, andere siedelten sich auf dem Festlande an, die übrigen kehrten bald wieder auf ihre verödeten Heimstätten zurück und fingen von neuem an zu bauen an Werften und Häusern. Nur Norderoog ist nach dieser Flut nicht wieder bewohnt worden. Im Sommer 1825 ist König Friedrich VI. von Dänemark selbst nach den nordfriesischen Inseln gekommen, um sich persönlich von dem unhaltbaren Zustand an den Westmarken seines[S. 38] Reiches zu überzeugen. Das Königshaus auf der Hallig Hooge erinnert heute noch an diesen seltenen Besuch. Seither ist manches geschehen, um den bestehenden Übelständen abzuhelfen und das gefährdete Land vor neuem zerstörenden Anprall der Nordseewogen zu beschützen. Im Laufe der Jahre hatte man gelernt, daß die Eindeichung des Landes die größte Gefahr bringt, solange sie nicht auch gegen die höchste Flut Sicherheit zu gewähren vermag. „Während selbst das empörteste Meer und die höchste Flut machtlos über den uneingedeichten ebenen Rasen rollt, vernichtet die Sturmflut, welche den Deich zerbricht, nicht bloß diesen, daß er in ruinenhaften Trümmern stehen bleibt und maßlose Erdopfer zu seiner Wiederherstellung braucht, sondern an der Stelle des Bruches entsteht auch durch den Wasserfall ein ausgewühlter, tiefer Kolk, eine Wehle, die sich wohl immer und immer wieder als neue Angriffsstelle darbietet. Auch das innerhalb des Kooges beackerte, also seiner Rasendecke beraubte Land wird bis zu jener Tiefe abgeschält, die dem Aus- und Einlaufen der Fluten entspricht, und geht dadurch, wenn neue Eindeichung nicht bald möglich ist, gänzlich verloren, wird wieder zu Watt. Leider ist diese Erfahrung so spät gewonnen, daß der größte Teil des alten Nordfrieslands verloren war, als man lernte, die Kraft des ganzen Hinterlandes zu verwenden, um den Schutz gegen das Meer zu einem wirklich vollständigen zu machen“ (Meyn).
Die heutigen, gegen die verflossenen Zeiten so sehr veränderten Verkehrsverhältnisse ermöglichen das Heranziehen großer Arbeitermengen, und dadurch ist nach dem Landesbaurat Eckermann, aus dessen Geschichte der Eindeichungen in Norderdithmarschen wir citieren, der Deichbau der Jetztzeit gegen die früheren Jahrhunderte in außerordentlich günstiger Lage. In alter Zeit war jede Kommune bei den Eindeichungen auf ihre eigenen Kräfte angewiesen; nur bei ganz außergewöhnlichen Aufgaben wurden die benachbarten Harden und Kirchspiele auf fürstlichen Befehl mit zu der Arbeit herangezogen. Dammbauten zwischen den Halligen und dem Festlande helfen neuerdings zur Befestigung und Rettung der Inseln.
V.
Land und Leute.

Bei Endrup, gegenüber der kleinen dänischen Insel Manö, beginnt der deutsche Teil der Nordseeküste und zieht sich in etwa nordsüdlicher Linie bis zu der Elbmündung hin. Von hier nimmt ihr Verlauf eine westöstliche Richtung und erreicht an dem Einfluß der Ems ins Meer und am Dollart die holländische Grenze. Wie wir schon weiter oben gesehen haben, trägt das deutsche Gestade an der Nordsee den Charakter einer Doppelküste, indem der mannigfach gegliederten Festlandsküste eine Inselküste vorgelagert ist, der Überrest eines großen, im Laufe der Äonen zerstörten und vormals bis weit nach Westen reichenden Areales. Zwischen beiden Küstenlinien dehnt sich das Watt aus, das vor den Einmündungen der Eider, Elbe, Weser und Ems Unterbrechungen erleidet, aber längs der Unterläufe dieser Ströme seine Fortsetzung in das Flachland hinein in der Gestalt der Flußwatten besitzt. Neben diesen Wasserläufen ergießen sich noch eine beträchtliche Anzahl von kleineren Flüssen in das deutsche Meer, so von Schleswig-Holstein her die Bredau, die Wiedau bei Hoyer, die Husumer Au, die Miele bei Meldorf u. s. f., und die zahlreichen Küstenflüsse in Hadeln und Wursten, Butjadingen, im Gebiete der Jade und in Ostfriesland.
Es ist in allerneuester Zeit die Ansicht ausgesprochen worden, daß in den sogenannten Baljen, welche die einzelnen ostfriesischen Inseln voneinander trennen, die Fortsetzung etlicher dieser Gewässer zu suchen sein könnte, ebenso, wie an der Westküste von Schleswig-Holstein die dort ins Meer fallenden Wasserläufe in Verbindung mit den ihren Mündungsstellen entsprechenden Tiefen stehen dürften, so die Brönsau im äußersten Norden unseres[S. 40] Gebietes mit dem Juvrer Tief, die Wiedau mit dem Römer Tief, die Eider mit dem Süderhever, die Miele mit dem Norderpiep u. s. f.
Die Inselküste gliedert sich in die zur cimbrischen Halbinsel gehörige Kette der nordfriesischen Eilande. Röm oder Romö ist das nördlichste derselben, dann folgen das lang gestreckte Sylt und Amrum, mehr landeinwärts und von Amrum gedeckt, Föhr, hierauf die Gruppe der Halligen mit Nordstrand und Pellworm. Vor dem linken Ufer der Elbemündung erhebt sich Neuwerk aus den Fluten und weit draußen, rings von der offenen Nordsee umspült, steigt der rote Felsen Helgolands mit seinen Riffen aus dem Wasser empor. Wangeroog eröffnet den ostfriesischen Inselkranz, den weiter Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum bilden, und der sich jenseits der deutschen Meeresgrenze längs der niederländischen Küste über die Zuidersee hinaus fortsetzt. Von der vielgestaltigen Gliederung der Festlandsküste mit den Halbinseln Eiderstedt, Dieksand u. s. f. ist schon weiter oben kurz die Rede gewesen.
Was nun das Klima anbetrifft, so schreibt Penck darüber, daß nicht die Bodengestaltung die klimatischen Verschiedenheiten einzelner Teile Norddeutschlands bedinge. Die geographische Breite im Verein mit der mehr oder minder großen Nähe des Meeres erweist sich dagegen als Hauptfaktor bei der Bestimmung der Temperatur und Regenverhältnisse eines Ortes. Die wärmsten Gegenden sind im Westen, im Bereiche der großen Moore belegen, und längs der Ems findet man mittlere Jahrestemperaturen von 9° und darüber. Die Regenmenge auf den nordfriesischen Inseln erhebt sich bis auf 1000 mm; in den Moorgegenden beträgt dieselbe an 800 mm.
In politischer Beziehung gehören die Lande an dem deutschen Nordseegestade mit alleiniger Ausnahme des Gebietes der freien Städte Hamburg und Bremens, sowie des oldenburgischen Küstenstriches dem Königreich Preußen, und zwar den Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover an.
Mit Ausnahme einiger weniger Stellen, an denen anstehendes Gestein zu Tage tritt (Helgoland, Stade, Hemmoor, Umgebung von[S. 41] Altona und an anderen Orten, Lägerdorf bei Itzehoe, Schobüller Berg bei Husum), das dem Zechstein, der Trias, der Kreide und dem Tertiär angehört, nehmen ausschließlich nur Diluvium und Alluvium, in den Dünen und dem Flugsande auch Gebilde äolischer Art an dem Aufbau der Lande an der deutschen Nordseeküste teil. Aus dem Diluvium besteht der innere Kern des Küstenlandes, der wiederum in der Tiefe auf älteren Formationen aufruht. Da und dort tritt diese Quartärbildung hervor, jedoch wird sie auch vielfach von Alluvium und zwar von Mooren und Marschen, oder von Dünen überlagert. Vom geographischen Standpunkte aus sind zu unterscheiden: die Geest und die Marsch. Schon vor 50 Jahren hat Bernhard von Cotta den zwischen den beiden ebengenannten Bildungen bestehenden Gegensatz also definiert: „Die Marsch ist niedrig, flach und eben, die Geest hoch, uneben und minder fruchtbar. Die Marsch ist kahl und völlig baumlos, die Geest stellenweise bewaldet, die Marsch zeigt nirgends Sand und Heide, sondern ist ein ununterbrochener fetter, höchst fruchtbarer Erdstrich, Acker an Acker, Wiese an Wiese; die Geest ist heidig, sandig und nur stellenweise bebaut. Die Marsch ist von Deichen und schnurgeraden Kanälen durchzogen, ohne Quellen und Flüsse, die Geest hat Quellen, Bäche und Ströme.“ Der eigentliche Geest- oder Heiderücken, ursprünglich nur mit Heide, Brahm und verkrüppelten Eichen bestanden und Roggen als Ackerfrucht tragend, wird von einem schwach lehmigen, aber sehr eisenschüssigen Sande bedeckt, der gewöhnlich reich an Grand und stark abgerundeten Geröllen ist. Nicht selten liegen einzelne Riesenblöcke umher, welche von den germanischen Ureinwohnern zu ihren Steinsetzungen und zur Herstellung ihrer Hünengräber verwendet worden sind. Breite Thäler unterbrechen zuweilen den Geestrücken, von grobem Sande ohne Rollsteine erfüllt oder auch wirkliche Moorsümpfe tragend. Man hat diese Erscheinungen zum Unterschiede von der eigentlichen Geest auch als Blachfeld bezeichnet. Der Sand des letzteren ist alluvialen Alters, während die sandigen Lagen der eigentlichen Geest, der Geschiebedecksand, noch dem Diluvium zugerechnet werden müssen, wie auch der an manchen vom letzteren freien Stellen des Bodens zu Tage tretende Geschiebe- resp. Moränenmergel. Weiter nach der Küste zu entwickelt sich aus dem Blachfelde die von steinleerem, mehligem Sande bedeckte Heideebene oder Vorgeest, deren unfruchtbarste Teile durch die unzugänglichen Einöden der Hochmoore gebildet werden oder von Binnenlandsdünen durchzogen sind, Sandschollen und Sandhügel, die der Wind aus dem Heidesand aufgetürmt hat. Solche Hochmoore befinden sich in ganz besonders großartiger Entfaltung im westlichen Teil der deutschen Nordseeküstenländer, am stärksten im Gebiete zwischen den Mündungen der Weser und Ems. Im Regierungsbezirk Aurich entfallen 748,8 Quadratkilometer = 24,6% der Bodenfläche auf Moor,[S. 42] im Regierungsbezirk Osnabrück 1249,9 Quadratkilometer = 20,5%, im Regierungsbezirk Lüneburg 776,4 Quadratkilometer = 7%, im Regierungsbezirk Stade 1877,6 Quadratkilometer = 28,2%, im Großherzogtum Oldenburg 945,4 Quadratkilometer = 18,6%. Etwa 27500 Quadratkilometer Moorlandes befinden sich innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches, und davon kommt auf die Provinz Hannover mit Oldenburg zusammen allein beinahe der vierte Teil, ungefähr 6525 Quadratkilometer. Schleswig-Holsteins Moorflächen schätzt man auf 1500 Quadratkilometer, von denen etwa ein Drittteil auf das eigentliche Areal der Nordseeküste zu stellen wäre, und wenn man die Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee als östliche Grenzlinie unseres Areals ansehen wollte — was in rein geographischem Sinne seine Richtigkeit hätte —, so müßte der weitaus beträchtliche Teil dieser Zahl dazu gerechnet werden.
Man hat in unserem Gebiet zweierlei Moorbildungen zu unterscheiden, nämlich die Grünlands-, Wiesen- oder Niederungsmoore und die Hochmoore. Die ersteren bestehen vorwiegend aus den Resten von Gräsern, Scheingräsern, Moosen und Sumpfwiesenpflanzen und sind reich an wichtigen Pflanzennährstoffen, so an Stickstoff und Kalk. Wir finden diese Art Moore in den Niederungen, den Thälern träge fließender Gewässer, die zur Versumpfung des Geländes Anlaß geben. Ihre Erhebung über den Wasserspiegel ist nur sehr gering. In den weiten Flußthälern des Nordwestens sind sie in großer Ausdehnung vorhanden, so beispielsweise im Gebiet der Wümme und Hamme, die vereint als Lesum in die Weser fließen.
Die verbreitetste Moorart im deutschen Nordwesten stellen jedoch die Hochmoore dar, die dort ungeheure Flächen bedecken. Sphagneen (Torfmoose), einzelne grasartige Pflanzen, als Simsen und Wollgräser und heidekrautartige Gewächse nehmen an ihrer Zusammensetzung teil. Die Hochmoore zeigen[S. 43] eine Art von Schichtung, indem deren untere Lagen gewöhnlich sehr dicht, ziemlich stark zersetzt, dunkel gefärbt und nicht selten reich an Holzresten sind, während die oberen häufig hell, locker, faserig und mit bloßem Auge schon als Reste von Torfmoosen erkennbar sind. „Diese letzteren besitzen ein außerordentlich hohes Vermögen, das Wasser aufzusaugen und festzuhalten, sie bilden einen ungeheuren, wassererfüllten Schwamm, Generationen auf Generationen wachsen empor, solange die Feuchtigkeit ausreicht, und gehen unter, um dem eigentümlichen Prozeß der Vertorfung zu verfallen; nicht selten erheben sich die centralen Teile des Hochmoors merklich über die Umgebung, was zur Entstehung des Namens Veranlassung gegeben haben mag. In unberührtem, jungfräulichem Zustand trägt die Oberfläche unserer Hochmoore ein dichtes, üppiges Torfmoospolster, in dem spärlicher oder zahlreicher Simsen und Wollgräser, und nach dem Grade der natürlichen Abwässerung Heidekräuter eingestreut erscheinen. Hin und wieder fristet eine Kiefer oder eine Birke ein kümmerliches Dasein. In unzähligen Lachen und Rinnsalen steht das braune Moorwasser; ein Beschreiten des schwankenden Bodens ist unmöglich oder mit großer Vorsicht nur zu sehr trockener Zeit oder im Winter, bei Frost ausführbar“ (Tacke).
Da, wo das Gebiet der Vorgeest von Bächen durchzogen wird, die vom Blachfeld herkommen, tritt die Heidebildung zurück, und ihre Stelle nimmt eine dem Acker- und Wiesenbau zugängliche Grasvegetation ein, die zur förmlichen Sandmarsch wird und an manchen Stellen in die eigentliche Marsch übergeht. Dieser Übergang wird nicht selten durch graswüchsige Grünlandsmoore vermittelt.
Ohne ihre landschaftlichen Reize ist die Heide übrigens nicht, und sie bietet dem Beschauer gar oftmals ganz herrliche Stimmungsbilder, denen eine gewisse schwermütige Färbung zu eigen ist. Meisterlich hat es der schleswig-holsteinische Schriftsteller und Dichter Wilhelm Jensen verstanden, in seinen Werken die eigentümlichen, düsteren Reize der Heide in seiner Heimat zu schildern, und ein wundervolles Bild davon rollt uns Theodor Storm in seinem „Abseits“ betitelten Gedicht auf:
Wenn uns so der große Sohn Husums die Heide in der Schwüle eines heißen Sommertages zeigt, im rotvioletten Schimmer ihrer blühenden Erica, so hat uns Herman Allmers, der Friesendichter, eine nicht minder herrliche Beschreibung der Heidelandschaft gegeben, wenn sie mit ihren weiten Flächen im Zwielicht der Dämmerung oder in der gespenstigen Beleuchtung des Mondscheins daliegt:
Ein Marschgürtel von verschiedener Breite (an der Küste Schleswig-Holsteins von 7 bis 22 Kilometer) umgibt das deutsche Küstenland an der Nordsee von Hoyer in Nordschleswig bis zu den Grenzpfählen der Niederlande. Es ist das dem Meere wieder abgerungene und durch Deiche vor seiner Zerstörungswut geschützte Land, Watt, das urbar gemacht und in kulturfähigen Zustand übergeführt worden ist. Dies wird bewirkt durch geeignete Vorrichtungen, als die zapfenförmig in das Meer hineinreichenden, sogenannten Schlengen oder Lahnungen, lange mit Pfählen befestigte Buschdämme und durch Auswerfen von sehr breiten, aber ganz flachen Gräben, in denen sich bei richtiger Anlage und unter günstigen Verhältnissen der Schlick rasch ablagert. „Im Frühling,“ sagt L. Meyn, „sieht man das sonst schwarzgraue Watt auf weite Flächen vom Lande aus mit dunkelgrüner Farbe bedeckt. Der Landmann sagt: das Watt blüht. Im Sonnenschein wird das Grün heller, es trocknet ein und wird schließlich zu einer gelben oder braunen Kruste, aus unzähligen Fäden einer Konserve zusammengefügt, welche vorher während der Bedeckung lang hingestreckt mit dem Ebbe- oder Flutstrom im Wasser schwanken.“
Die zarten, schnell wachsenden Keime dieser Kryptogamen, welche unendlich verbreitet sind, finden ihren Halt, indem sie sich auf die weichen Teile des Schlicks heften. Mit jeder neuen Flut aufgeweicht oder neugesät, erscheinen sie von neuem, beitragend zur Vermehrung der Masse und zur Befestigung des neuen Bodensatzes. Mit bezeichnendem Namen ist diese nur in Massen sichtbare Pflanze als „landbildend“ (Conferva chtonoplastes) in der Naturgeschichte eingeführt.
Wenn die Anschlickung nun schon so hoch geworden ist, daß die gewöhnliche Flut sie täglich nur noch kurze Zeit bedecken kann, so erscheint ein Gewächs, das „zu den auffallendsten[S. 46] Gestalten im ganzen deutschen Pflanzenschatze gehört“. Das ist der Queller oder Quendel (Salicornia herbacea, L.). Dasselbe besitzt das Aussehen eines fetthenneartigen, fausthohen, vollsaftigen Pflänzchens mit vielen Ästen und Abzweigungen, das vermöge dieser letzteren besonders geeignet ist, den Schlick festzuhalten. Noch im Bereiche der Wellen, als wären sie künstlich in den Sand gesteckt, finden sich bereits einige Individuen des Quellers; landaufwärts zeigen sich immer mehr und gehen dann ziemlich rasch, aber immer nur der Böschung gerecht werdend, in einen ganz geschlossenen buschigen Rasen über.
Durch stetiges Auffangen des Schlammes erhöhen und festigen die Quellergewächse die Wattflächen, und in stillen Buchten, wo keine heftige Strömung oder große und stürmische Fluten diesen Prozeß störend unterbrechen, kann der Anwuchs bis zu 50 Meter im Jahre groß werden, während das geringste Maß auf 2 Meter geschätzt wird. Allmählich stellen sich dann noch andere Pflanzen ein, darunter fleischige Salzpflanzen (Salsola Kali, L., Atriplex arenaria, Woods, u. s. f.), Sandkräuter von kleinem Wuchse (Lepigonum marinum, L., Plantago maritima, L., Armeria maritima, Willd.), das Seegras, die Meergrasnelke, der Strandwermut u. s. f.
Ihnen allen gelingt es aber nicht, den Queller zu verdrängen; das vollbringt nur die sich nun in gewaltiger Masse ausbreitende Binsenlilie (Juncus bottnicus, Wahlenb.), „die den bezeichnenden Namen Drückdahl erhalten hat, weil sie alles Höherwachsende niederdrückt“.

(Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
Nun wächst die Anschlickung immer mehr und mehr, bis sie jene Höhe bekommen hat, wo sie durch das Regenwasser genügend von den immer seltener werdenden salzigen Überflutungen der See ausgesüßt werden kann. Wenn das der Fall geworden ist, müssen die vorgenannten Gewächse dem Graswuchse weichen. Bald entstehen denn auch auf dem so dem Meere entstiegenen Vorlande dichte Rasen von zwei Gräsern, Glyceria distans, Wahlenb. und Glyceria maritima, Drej, der Andel, die reiches Futtergras und äußerst wertvolles Heu liefern. Wenn sich nun im Laufe der Jahre der Boden noch mehr erhöht und seinen Salzgehalt fast gänzlich verloren hat, so ist die Zeit gekommen, sein[S. 48] Areal vor dem ferneren Eindringen des Meeres dauernd zu schützen. Es hat nun alle hierzu erforderlichen Eigenschaften erhalten, es ist „deichreif“ geworden, und das deutsche Küstenland kann einen Koog (an der schleswig-holsteinischen Küste) oder Polder (westlich der Elbe) mehr zu seinem Gebiete zählen.

(Nach einer Photographie von Th. Backens in Marne.)
Die Deiche, in einigen Gegenden auch Kaje genannt (das französische Wort quai ist ja bekannt), welche im Landschaftsbild als hohe, grasbewachsene Wälle erscheinen, die jede Fernsicht abschneiden und den Horizont der Marsch recht einförmig begrenzen, umranden das ganze Gebiet unserer Nordseeküste und ziehen sich bis weit in die Unterläufe der großen Wasserläufe hinein. Nur an wenigen Stellen, auf der langen Linie zwischen dem Dollart und Hoyer und zwar da, wo Geest oder Dünen bis an den Meeresstrand vorrücken, setzt diese Deichumwallung aus. Dies ist der Fall beim Dorfe Dangast am Jadebusen, in der Nähe von Cuxhaven, an der Hitzbank bei St. Peter in Eiderstedt und am Schobüller Berg bei Husum. Nach der Seeseite zu sind diese 6–8 Meter über der gewöhnlichen Fluthöhe sich erhebenden, grasbewachsenen Deiche sanft abgeböscht, und zuweilen ist hier ihr Fuß mit starken Pfählen berammt oder mit großen Steinsetzungen bewehrt, um sie widerstandsfähiger gegen den Andrang der Wogen zu machen. Förmliche Steindossierungen an besonders exponierten Stellen kommen ebenfalls vor. Nach dem Lande zu fällt der Deich ziemlich steil ab, etwa mit 45° Neigung. Im allgemeinen dürfte die Breite des Deichfußes 15–40 Meter betragen, diejenige des Kammes oder der Kappe ungefähr 2–4 Meter.
Um dem Binnenwasser Abfluß zu verschaffen, ebenso um dessen Wasserläufe in schiffbarer Verbindung mit dem Meere zu erhalten, sind die Deiche mit Schleusenanlagen, mit Sielen versehen, deren Thore durch die ankommende Flut geschlossen, bei Niedrigwasser jedoch durch den Druck der davor angesammelten Binnengewässer wieder geöffnet werden.
Die Unterhaltung ihrer Deiche ist eine der Hauptsorgen der Marschbewohner und eine nicht minder kostspielige Sache, als deren Aufbau. Nach Jensen waren zur Eindeichung eines Kooges in der tondernschen Marsch von 670 Hektar Größe 6,5 Kilometer Deich notwendig, zu rund 700 Mark Kosten für das Hektar. Nach dem Genannten erforderte der 14,32 Kilometer Gesamtlänge besitzende Osterlandföhrer Deich in dem Zeitraum von 1825–1880 etwa 300000 Mark für Verstärkung und Verbesserung, außerdem noch jährlich an 37318 Mark für Strohbestrickung und ähnliche Dinge, ein Betrag, der von den Besitzern der 2591,56 Hektare deichpflichtiger Marschländereien aufgebracht werden mußte. Durch die Deichverbände wird für diese Instandhaltung bestens gesorgt. Das Herzogtum Schleswig hat beispielsweise drei solche Vereinigungen, deren eine die Marschen des früheren Amtes Tondern, 32 Köge mit 32500 Hektaren, die zweite diejenige des vormaligen Amtes Bredstedt, 40 Köge mit 20500 Hektaren, und die dritte diejenige des früheren Amtes Husum, Eiderstedt u. s. f. mit ungefähr 31800 Hektaren Marschlandes umfaßt. Holsteins Marschen sind in sechs größere Deichverbände eingeteilt, so derjenige der Wilstermarsch, der Süderdithmarschens, derjenige Norderdithmarschens u. s. f.
Übrigens darf nicht zu früh zur Eindeichung geschritten werden, und Hand in Hand mit derselben muß auch eine rationelle Entwässerung des neueingedeichten Landes vor sich gehen, damit das letztere nicht unter allzu großer Nässe zu leiden hat, wie dies z. B. mit dem Stedinger Lande am linken Weserufer der Fall ist.
Dem „blanken Hans“, so nennt der Nordfriese die Nordsee, hat man im Verlaufe der Jahrhunderte an der Westküste Schleswigs etwa 120 Köge abgerungen, die in ihrem gegenwärtigen Bestand ungefähr 900 Quadratkilometer umfassen. „Von den 20000 Hektaren,“ sagt Jensen, „welche Nordstrand 1634 verloren, sind 6700 Hektare wieder gewonnen worden, während im übrigen seit 1634 an der ganzen schleswigschen Westküste etwa 130 Quadratkilometer eingenommen worden sind. Seit 1860 haben 2252 Hektare Fläche mit 2476000 Mark Wert dem Überschwemmungsgebiete des Meeres entzogen werden können. Wie demnach die Watten der ausgebreitete Kirchhof der Marschen sind, so sind also die Marschen Koog an Koog ein ebenso langer Triumphzug des Menschen über die Natur.“
Der auf diese Weise gewonnene Boden, der Marschklei, ist von äußerster Fruchtbarkeit; derselbe besitzt eine zu ungewöhnlichen Tiefen reichende, fast gar nicht schwankende Zusammensetzung der tragfähigen Krume und ist in ausgezeichneter Weise für den Anbau des Korns, der Öl- und der Hülsenfrüchte geeignet. Natürlich ist dementsprechend auch der Wert des Landes in den Marschen ein hoher. So sind im jüngsten Kooge an der Westküste der Herzogtümer, im Kaiserin Auguste Viktoria-Kooge im April 1900 für 367 Hektare 1038850 Mark erzielt worden, so daß der Durchschnittspreis für 1 Hektar 2617 Mark beträgt. Der höchste Preis für 1 Hektar war 3000 Mark, der niedrigste 1500 Mark.
Innerhalb des vom großen See- resp. Außendeich umwallten Landes liegen vielfach kleine Erdwälle, die Sommerdeiche, welche größere Landkomplexe umschließen und gegen Überschwemmung von seiten der die Marschländereien durchziehenden Kanäle schützen sollen, teilweise auch ehemalige durch Gewinnung vom neuen Vorlande außer Dienst gesetzte Seedeiche sind. Windmühlen und andere derartige Anlagen schaffen das überflüssige Wasser aus den Gräben und kleineren Kanälen fort und dann durch die Schleusen bei Ebbezeit in die See. Wie schon weiter oben bemerkt wurde, trägt die Marsch keinerlei größere Holzungen, dagegen sind die Wohnstätten oftmals von ansehnlichen, wohlgepflegten Baumgruppen umgeben, welche von der Ferne gesehen den Eindruck kleiner, schattiger Haine beim Beschauer erwecken.
Schon Plinius erwähnt in seiner Naturgeschichte jene von Menschenhand aufgeworfenen Hügel, worauf das armselige Volk an den Gestaden des germanischen Meeres seine Hütten erbaut hatte. Auf solchen Erhöhungen, die entweder aus gewachsenem Boden bestehen, also natürliche Erhebungen des Erdreiches darstellen, oder künstlich gemacht worden sind, steht die größte Mehrzahl der menschlichen Ansiedelungen in den Marschlanden. Man nennt diese Hügel Warfen, Warften, Würten, Worften, Werften und Wurthen.
In seinem interessanten Werke über die Städte der norddeutschen Tiefebene in ihren Beziehungen zur Bodengestaltung hat der Königsberger Geograph Hahn auf die Lage der Städte in unserem Areale, als Randstädte[S. 50] an der Grenze zwischen Geest und Marsch aufmerksam gemacht. Der Boden der eingedeichten Marschlande mit seinem hohen Wert war offenbar kein günstiger Bauplatz für größere Ortschaften und Städte. Man wollte das kostbare Land nicht durch Bebauung der Kultur entziehen, andererseits aber auch Haus und Hof vor etwaigen Überschwemmungen schützen, und darum suchte man sich besonders dort, wo das Marschgebiet nicht mehr so breit war, den nahebelegenen Geestrücken zur Errichtung der Ansiedelungen aus. Von dort ließen sich die Marschareale gut übersehen und ebenso bequem bewirtschaften. So liegt z. B. Hoyer auf einem Geesthügel, der rings von Marschwiesen umgeben ist, dagegen macht Tondern eine Ausnahme, und seine niedere Lage ist wohl mit Rücksicht auf die Ausnützung der Schiffahrtsgelegenheit gewählt worden. Bredstedt, Husum, Garding in Eiderstedt, Lunden, Heide, Meldorf, Itzehoe gehören zu dieser Art von Randstädten, hinwiederum sind Wesselburen und Marne typische Marschorte. Ebenso ist Hamburg ursprünglich auf der schmalen Geestzunge erwachsen, welche Elbe und Alster trennt. Erst später griff sein Weichbild über auf das Marschland. Dann müssen links des Elbstroms Harburg, Buxtehude, Horneburg an der Lühe, Stade, Varel und Jever hier genannt werden, ebenso in Ostfriesland Wittmund, Esens und Norden. Zu denjenigen Randstädten, welche zwar auf Geestboden erbaut sind, der aber mehr von Moor als von Marsch oder ganz von ersterem umgrenzt wird, wären Aurich, Weener und Bunde, alle drei in Ostfriesland, zu zählen.
Sehr verschieden ist die Größe der Volksdichte im Geest-, Moor- und Marschland. Auf den Geestflächen Schleswig-Holsteins beträgt sie 30–40 Seelen auf den Quadratkilometer, in den Gegenden der großen Moore sinkt sie sogar öfters unter 30 herab, während in den Marschen an 80 Menschen den Quadratkilometer Land bewohnen. Der Stader Marschkreis weist eine Volksdichte von 75 Einwohnern für den Quadratkilometer auf, der Stader Geestkreis nur eine solche von 42 Seelen für die gleiche Fläche.
Dänen im Norden, Friesen, Sachsen, eingewanderte Holländer in den Marschen, Sachsen auf der Geest, das sind die Volksstämme, welche die deutsche Nordseeküste bewohnen. Die ursprünglichen Landsassen[S. 51] waren wohl die germanische Völkerschaft der Chauken, welchen Tacitus das Lob gespendet hat, der edelste Stamm unter den Germanen zu sein, gerechtigkeitsliebend, ohne Gier nach fremdem Hab und Gut, mann- und wehrhaft. Die großen Sachsenzüge nach England im fünften Jahrhundert entvölkerten das Land, und die Friesen nahmen, von Westen her vordringend, die leer gewordenen Wohnplätze der Chauken ein. Noch zur Römerzeit reichten die Ansiedelungen dieses ersteren Volkes im Osten nur bis zur Ems. So kamen die Friesen auch auf die cimbrische Halbinsel und machten die Treene und Wiedau zur Grenze ihrer Ansiedelungen. Von Hattstedt bei Husum bis nach Hoyer und auf den nach ihrer Bevölkerung benannten nordfriesischen Inseln ist heute noch dieses Element unter den eigentlichen Einwohnern des Landes vorherrschend. Jenseits der Elbe hat Kehdingen eine aus Sachsen und Friesen gemischte Bevölkerung, Wursten, das Vieland, Wührden und Osterstade sind ganz friesisch, und bis oberhalb Bremen läßt sich am rechten Weserufer der friesische Charakter, wenn auch nicht allgemein, so doch da und dort nachweisen. Auch an der linken Seite der Weser finden sich mitten im Sachsenlande friesische Enklaven. Stedingerland, Stadland, Butjadingen und die ganze Provinz Ostfriesland mit Ausnahme des Lengener Landes gehören völlig den Friesen an. Dithmarschen und die Geestgebiete der cimbrischen Halbinsel sind sächsisch, ebenso wird links der Elbe das Land Hadeln von Sachsen bewohnt, während im Alten Lande und teilweise in den Elbmarschen eingewanderte Holländer sich niedergelassen haben.
Diese Verschiedenheit in der Abstammung der Bewohner unserer Nordseeküste kommt naturgemäß auch in ihrem Körperbau und ihrem Charakter, in ihren Sitten und Gebräuchen, ihrer Sprache, Tracht und in der Art ihrer Wohnstätten zum Ausdruck. So ist beispielsweise der Marschfriese von breitschultriger, nicht über das Mittelmaß der Höhe hinausgehender Gestalt, stark, mit breiten Händen und feinem, schlichtem hellfarbigen Haar, hellblauen oder grauen Augen, weißer Gesichtsfarbe und rundlichem Antlitz, meist ohne scharf ausgeprägte Züge. Sein Charakter ist ernst, zuweilen sogar finster, er wird nicht leicht fröhlich, wenn er aber lustig wird, so hat seine Heiterkeit leicht etwas Gewaltsames. Das Sprichwort: „Frisia non cantat“ ist ja bekannt. Schwer geht der Friese aus sich heraus, zeigt aber großen Hang zum Aufwand und zur Pracht, ist von peinlicher Sauberkeit und stolz auf seinen von seinen Vätern dem[S. 52] Meere abgerungenen Besitz. Dagegen ist der Sachse schmächtiger und hagerer gebaut, hat lange Beine und einen kurzen Oberkörper, ein schmales Gesicht und ausgeprägte Züge. Bewunderungswürdig ist die Heimatsliebe der Friesen. Wie weit sie auch in der Welt herumkamen, wie groß auch der Wohlstand war, zu dem sie es dort gebracht hatten, Länder und Städte draußen hatten keinen Reiz für sie, immer und immer wieder zog sie ihre meerumspülte Heimat an. Hier war es am schönsten und besten; nach langem Umherfahren auf den Meeren dieser Erde hier ausruhen und in Frieden sterben zu dürfen, das war ihr Wunsch vor Zeiten, das ist auch heute noch die Sehnsucht, die jeder Nordseefriese in den geheimen Falten seines Herzens birgt. Das mag wohl, so hat schon vor anderthalbhundert Jahren der Halligmann Lorenz Lorenzen gesagt, darin seinen Grund haben, weil sie auf der ganzen Welt keinen besseren Fleck finden konnten, als ihr Heim, wo sie geboren und erzogen waren!

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Dem Friesen wird eine hervorragende Begabung für die Mathematik nachgerühmt, ein Umstand, der übrigens wohl auch für den Niedersachsen volle Geltung hat. Eine Reihe großer Männer in Litteratur und Wissenschaft sind dem deutschen Volke in den Ländern an der Nordsee erwachsen. In Heide in Norderdithmarschen kam der Sänger des Quickborn, Klaus Groth, zur Welt, Wesselburen darf sich rühmen, der Geburtsort eines der Größten unter unseren Großen im Reiche der Geister, Friedrich Hebbels, zu sein, in Husum, der grauen Stadt am Meer, hat Theodor Storm die Sonne zum erstenmal gegrüßt. Zu Rechtenfleth in Osterstade weilt noch heute Hermann Allmers, der Friesendichter, und Garding in Eiderstedt hat den weltbekannten Historiker Theodor Mommsen zum Landsmann. In Jever in Ostfriesland sind der Geschichtsschreiber Schlosser und der Chemiker Mitscherlich geboren. Die schaffende Tonkunst hat an den deutschen Nordseegestaden weniger ihr Heim gefunden, doch hat auch sie unter den hier zur Welt gekommenen Männern einen hoch bedeutenden Namen zu verzeichnen, denjenigen von Johannes Brahms, der zwar von Geburt Hamburger, aber, wenn wir nicht irren, von dithmarsischer Abkunft ist. Dagegen ist unser Areal unter den ausübenden Tonkünstlern recht gut vertreten. Für die plastischen Künste ist von jeher viel Sinn an unseren Nordseeküsten gewesen; die wundervoll geschnitzten Schränke und[S. 54] Truhen, die man allenthalben in wohlhabenderen Häusern noch finden kann, der berühmte Swynsche Pesel aus Lehe, jetzt in Meldorf, und des großen Bildschnitzers Hans Brüggemann Werke, so das Altarblatt im Schleswiger Dom, legen beredtes Zeugnis dafür ab. Prächtige Schilderungen von den Halligen und aus dem Volksleben der Friesen, die wir dem Pinsel der noch jetzt wirkenden Meister Alberts und Jessen verdanken, haben weit und breit die verdiente Anerkennung gefunden, und die Worpsweder Schule durfte in der Darstellung ihrer stimmungsvollen Bilder aus dem Moor nicht minder große Erfolge verzeichnen. Die Städte und Ortschaften an der Westküste Schleswig-Holsteins haben leider mit der Zeit so manche Gebäude, die ihrer Architektur einen bestimmten Stempel aufgedrückt hatten, verloren. Doch wird dem Auge des aufmerksamen Beschauers auch in Husum oder Tondern noch vielerlei Schönes und Beachtenswertes auffallen. Durch den großen Brand von 1842 erhielt Hamburg eine veränderte Physiognomie, und ein großer Teil der alten Stadt fiel den Flammen zum Raub. Andere alte, wenn auch vom Standpunkte der Baukunst nicht besonders in Betracht fallende Stadtviertel mußten den neuen Hafenanlagen weichen, und so ist denn heute Deutschlands reichste und größte Handelsstadt durchweg eines besonderen architektonischen Charakters bar. Hinwiederum bietet Bremens Altstadt desto mehr, und da und dort in den Städten links der Elbe und in Ostfriesland sind noch manche Bauten erhalten geblieben, die an vergangene Pracht und Herrlichkeit erinnern und wohlthuend von dem modernen Kasernenstil abstechen, der sich auch hier, wie anderswo, breit zu machen anfängt.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Auf dem Lande dagegen und in den kleineren Ortschaften tragen die Wohnstätten auch heute noch ihr eigentümliches Gepräge. Da treffen wir in den von den Sachsen eingenommenen Gebieten auf die sächsische Bauart der Häuser. Lange, schornsteinlose Gebäude, deren Ende der Straße zugekehrt liegt, und die am Giebelende eine Einfahrt haben, charakterisieren dieselbe. Wenn wir das Haus durch die letztere betreten, kommen wir auf die Diele, die auch als Tenne dienen muß; rechts und links davon befinden sich die Ställe, in denen das Vieh mit seinen Köpfen nach[S. 55] innen zugekehrt steht. Der Einfahrt gegenüber erblicken wir den oben gewölbten, schornsteinlosen Herd, dessen Rauch unter der Decke hinzieht und zum Einräuchern von Speckseiten, Würsten etc. benützt wird. Dahinter, am anderen Ende des Hauses, sind die Wohn- und Schlafräume der Familie. Zuweilen, so in Dithmarschen, tritt am oberen Ende der Diele noch ein großer Raum, der Pesel, hinzu. Hölzerne Pferdeköpfe am Ende der First schmücken meist noch das Haus.
Der Hauberg, Heuberg oder kurzweg „Berg“ ist friesischen Ursprungs. Sein Name will so viel besagen als Bergeplatz des Heus. Hauberge kannte man schon im Mittelalter in den Niederlanden, und gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts tauchten sie bereits in der Gegend zwischen Ems und Weser und in Dithmarschen auf. Von hier aus breitete sich diese Bauart über Eiderstedt aus, wo dieselbe vor einem Menschenalter noch die herrschende war, und ging sogar auch noch weiter nach Norden bis in die Umgegend von Tondern. Das charakteristischste Merkmal am Hauberg ist der von vier bis sechs hohen Pfosten getragene Vierkant, westlich von der Elbe Gulf genannt, ein Raum von sechs bis acht Metern im Quadrat, bei den älteren Gebäuden hoch wie eine Kirche. Selbst an sonnenhellen Sommertagen ist er düster, da Licht nur durch ein einziges Loch im First einfällt, das zuweilen 50 Fuß über dem Fußboden angebracht ist. Der gewaltige Dachraum wird zum Unterbringen des Heues oder auch als Kornmagazin benutzt. Um den Vierkant liegen, wie die Seitenschiffe einer Kirche um das Hauptschiff, vier weitere langgestreckte Räume, deren vorderster, meist nach Süden gekehrt, die Wohnung des Besitzers und seiner Familie birgt. Auch hier trägt die größte Stube den Namen Pesel. Gegen Osten und Norden befinden sich die Ställe, gegen Westen die Tenne. Zumeist ist der Hauberg auf einer Werft erbaut, die wiederum von einem fünf bis acht Meter breiten Graben umgeben ist und in vergangenen Zeiten durch eine Zugbrücke mit der Umgebung verbunden war, die in der Gegenwart durch feste Stege ersetzt wird.
Die anglisch-dänische Bauart, die wir im Norden finden, ist wiederum anderer Gestalt. Hier stellen die Gebäude eines Hofes ein Viereck dar, das den Hofplatz einschließt. Eine Seite des Vierecks bildet das mit einem ebenfalls als Pesel bezeichneten Raume versehene Wohnhaus, welches Schornsteine besitzt, und von dem Stall,[S. 56] Scheune und andere Nebengebäude streng gesondert sind. Das Vieh steht in den Ställen mit den Köpfen der Außenwand zugekehrt.
Selbstverständlich kommen in den verschiedenen Landstrichen wiederum mancherlei Abweichungen in der Bauart der Häuser vor, und in der neueren Zeit gar verwischt sich da und dort der landesübliche Stil, und Wohnungen moderner Art treten an seine Stelle. Das alte Strohdach verschwindet mehr und mehr, mit Schiefer oder Dachpfannen gedeckte Dächer kommen dafür auf, und die von den Ureltern herstammenden Schränke, Truhen und andere Haushaltungsgeräte kunstvoller Art werden verschachert und müssen modernen Möbeln und neumodischem Tand weichen.
Ebenso ist es mit den Trachten, die nur noch bei besonderen Gelegenheiten getragen werden oder auch überhaupt gar nicht mehr. Hier ebenfalls hat die städtische Kleidung das Alte und Schöne fast schon ganz ersetzt, und die Zeit ist vielleicht nicht mehr allzu ferne, in der auch der letzte Rest davon von dem Moloch Mode verschlungen sein wird. Und so geschieht es noch mit vielen anderen Dingen, auf die wir wegen Mangels an Raum nicht mehr näher eingehen können.
Was die Sprache anbetrifft, so hat das Plattdeutsche die friesische Mundart heutzutage fast vollständig verdrängt. Friesisch wird heute nur noch im oldenburgischen Saterlande, auf den ost- und den nordfriesischen Inseln gesprochen und ist aber auch hier im Aussterben begriffen. In konfessioneller Beziehung gehören die Bewohner unserer deutschen Nordseeküste fast durchgängig dem protestantischen Glauben an.
„Marsch, Geest und Moor,“ so sagt Hermann Allmers einmal in seinem Marschenbuch, „vergegenwärtigen uns gewissermaßen die menschlichen Temperamente. Die Marsch repräsentiert, auf den ersten Blick erkennbar, das Phlegmatische. Die leichte Geest dagegen ist durch und durch sanguinisch. Hier ist alles Wechsel, bald ernst, bald heiter, bald dürr, bald fruchtbar, bald Thal, bald Hügel, hier dämmeriger Wald, dort schattenlose Sandwüste; hier grünender Wiesengrund und wallende Kornfelder, dort steiniges unfruchtbares Heideland; hier rauschende Mühlenbäche, dort stille, rohrumflüsterte Teiche — alles in schroffen Gegensätzen, wie der Ausdruck eines sanguinischen Gemüts. Wie das Geestvieh leichter und lebhafter ist, als das Vieh der Marsch, so oft auch der Menschenschlag. Im Moor endlich findet die tiefste[S. 58] Melancholie ihren Ausdruck, welche der köstlichste Frühlingsmorgen und der sonnigblaueste Sommertag nicht ganz verscheuchen können, der aber bei trübem, wolkigem Himmel, im Spätherbst und zur Winterszeit wahrhaft grauenerregend auf die Seele zu wirken vermag.“

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
VI.
Geschichtliches.
Es leuchtet ein, daß ein von so verschiedenartigen Volksstämmen bewohntes und im Laufe der Jahrhunderte so vielen verschiedenen Herren unterthan gewesenes Areal wie das Land, welches die deutsche Nordseeküste umsäumt, auch eine höchst wechselvolle Geschichte hat. Nun ist es nicht unseres Amtes, eingehendere Ausführungen darüber zu machen, ganz abgesehen vom Mangel an Platz dafür, so daß wir uns hier auf einige allgemeine Bemerkungen über dieses Thema zu beschränken haben werden.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Die cimbrische Halbinsel hat schon im grauen Altertum mannigfache Schicksale über sich ergehen lassen müssen. Der eherne Tritt der römischen Legionen wird wohl ihren Boden kaum berührt haben, wenn ihre Adler auch an den Mündungen des Elbstroms aufgepflanzt gewesen sein dürften. Um so mehr Unruhe hat aber die Zeit der Völkerwanderung in das schleswig-holsteinische Land getragen. Von hier aus wanderten die Cimbern und Teutonen in den sonnigeren Süden, von hier aus zogen Hengist und Horsa mit ihren Mannen nach Britannien hinüber. Als es in der germanischen Welt wieder etwas ruhiger geworden war und die einzelnen Volksstämme dauernd seßhaft wurden, da kamen von Norden und von Osten her andere Eindringlinge ins Land. Hier Slaven, dort Dänen. Erstere berührten freilich die Gegenden an der Nordsee kaum, dagegen hat es bis in die Gegenwart hinein von seiten der dänischen Nachbarn nicht an stetig erneuten und nie erlahmenden Versuchen gefehlt, sich des meerumschlungenen Landes zu bemächtigen. Und diese Umstände sind nicht zum geringsten Teil maßgebend geworden für die ferneren Geschicke der Herzogtümer. Am Maria-Magdalenentage 1227 schlug der Holsteiner Graf Adolph IV.[S. 59] den Dänenkönig Waldemar II. aus dem Felde, und bei Oldenswort und Mildenburg mußte König Abel der friesischen Streitmacht, die er zu unterjochen gedachte, durch eilige Flucht weichen. Jahrhunderte hindurch folgte dann noch Fehde auf Fehde bis in die neuere Zeit hinein. Die Bauernrepublik der Dithmarschen war den Holsten und den Dänen schon lange ein Dorn im Auge, und mit vereinten Kräften zogen sie los, um den kleinen Staat zu vernichten. Der aber war auf der Hut, und beim[S. 60] Dusenddüvels-Warf bei Hemmingstedt in Dithmarschen kam es am 17. Februar 1500 zur blutigen Schlacht. Zwar blieben die Bauern dieses Mal noch Sieger, aber die Stunde, welche ihrer Unabhängigkeit ein Ende machen sollte, war nicht mehr fern, und im Entscheidungskampf bei Heide wurde ihnen durch Heinrich Rantzau ihre Selbständigkeit für immer genommen.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Von den Schreckensjahren des großen Religionskrieges ist Schleswig-Holstein schwer heimgesucht worden. Als Kreisoberster von Niedersachsen rückte bekanntlich Christian IV. von Dänemark, Herzog von Schleswig-Holstein, ins Feld und zog sich nach dem verhängnisvollen Tage bei Lutter am Barenberge in seine Stammlande zurück. Tilly und der Friedländer folgten ihm eilends nach, und so wurde Schleswig-Holstein ein großes Schlachtfeld. Dann kamen nach dem Frieden zu Lübeck die Zeiten des dänisch-schwedischen und hierauf die Tage des großen nordischen Krieges; Steenbock verheerte das Land. Mit Anbeginn des Jahrhunderts sahen die Herzogtümer wiederum fremde Söldnerscharen innerhalb ihrer Grenzen. Das Jahr 1848 brachte die erste Erhebung, und die Totenglocken Friedrichs VII. am 15. November 1863 waren zugleich das Grabgeläut für die dänische Herrschaft im Lande. Am Morgen des 18. April 1864 hat der Danebrog zum letztenmal auf dem schleswig-holsteinischen Festlande geweht, am 29. Juni des gleichen Jahres wurde auch Alsen, die letzte Insel des Landes, über der er noch flatterte, frei vom dänischen Joch.
Einige der wichtigsten Begebenheiten in der Geschichte der beiden Hansastädte Hamburg und Bremen werden wir bei der Besprechung und Schilderung dieser letzteren selbst bringen.
Mancherlei Ähnlichkeiten mit der Geschichte der Herzogtümer Schleswig-Holsteins hat diejenige der Herzogtümer Bremen und Verden. Hier waren es die Bischöfe, die fast in ständiger Fehde mit den Bewohnern der Marschlande links der Elbe lagen. Die Macht der Kirchenfürsten verfiel aber immer mehr und mehr im fünfzehnten Jahrhundert, und das sechzehnte Säculum brachte die Reformation, die 1521 bereits in Hadeln, 1522 durch Heinrich von Zütphen in Bremen eingeführt wurde. Erzbischof Christoph von Verden wollte zwar ihrer Verbreitung mit allen Mitteln Einhalt thun, doch hinderten ihn seine langen Kämpfe mit den Wurstern daran, dies mit[S. 61] Erfolg zur Ausführung zu bringen. 1567 trat Eberhard von Holle, Bischof von Verden, zum evangelischen Glauben über, kurz darauf that Erzbischof Heinrich III. von Bremen ebenso. Von nun ab folgte die fast hundertjährige Periode der protestantischen Bischöfe, und nur kurze Zeit über wurde gemäß dem Restitutionsedikt der katholische Gottesdienst in Verden und Stade wiederhergestellt. Der Westfälische Friede verwies die Herzogtümer an Schweden, unter dessen Scepter sie bis 1719 blieben. Hierauf nahm Hannover Besitz davon, wie denn auch das Land Hadeln um 1773 nach Aussterben der Herzöge von Lauenburg an diese Regierung kam. Während der Napoleonischen Herrschaft zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wurden bekanntlich alle deutschen Küstenländer an der Nordsee dem französischen Kaiserstaate einverleibt. 1811 wurden dieselben mit dem Königreich Westfalen, später abermals mit Frankreich vereinigt. Nach dem Sturze des korsischen Eroberers fielen diese Lande wieder ihren rechtmäßigen Fürsten zu und blieben unter deren Scepter, bis 1866 Hannover eine preußische Provinz geworden ist.
Der in der Geschichte berühmt gewordenen Kämpfe der Stedinger gegen die Erzbischöfe von Bremen im dreizehnten Jahrhundert mag hier ebenfalls mit einigen Worten Erwähnung gethan werden. Letztere veranstalteten förmliche Kreuzzüge gegen die Stedinger, die zuvor als Ketzer erklärt und vom Papst in den Bann, vom Kaiser in die Reichsacht gethan worden waren. Erst war der Erfolg auf seiten der braven Bauern; mehrfach schlugen sie den gegen sie aufgebotenen Heerbann zurück, mußten aber am 27. Mai 1234 bei Altenesch unterliegen, und damit war auch ihr Schicksal besiegelt. Ein im Jahre 1834 errichteter Obelisk erinnert heute noch an diesen Kampf, in dem die tapferen Stedinger für Freiheit und Glauben gefallen sind.
Unter den Vasallen Heinrichs des Löwen werden bereits Oldenburger Grafen genannt. Nach deren Aussterben gegen die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts fiel ihr Land in den Besitz der dänischen Könige und der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorp. Als Herzogtum Holstein-Oldenburg erscheint es im Jahre 1777 zuerst, Friedrich August von Holstein-Gottorp,[S. 62] Bischof von Lübeck, eröffnet die Reihe seiner selbständigen Fürsten. Zu Beginn des Jahrhunderts war Oldenburg französisches Land, 1813 wurde das Herzogtum aber wiederhergestellt, und 1829 nahm Paul Friedrich August den Titel eines Großherzogs an.
Ostfriesland, das sogenannte Emder Land, war ehemals eine unabhängige Grafschaft, die seit dem Jahre 1454 unter der Regierung des Cirksena stand. Seine Herrscher erhielten 1654 den Rang von Reichsfürsten. 1744 starb der letzte Cirksena, der Fürst Carl Edzard, und nach dessen Tode nahm Friedrich der Große das Land für Preußen in Besitz. 1807 kam aber Ostfriesland an Holland, wurde dann auf kurze Zeit wieder preußisch, hierauf nochmals an Hannover abgetreten, bis es 1866 wieder unter Preußens Oberhoheit kam. Heute bildet Ostfriesland den Regierungsbezirk Aurich.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
VII.
Von Husum nach Tondern und an die Grenze Jütlands.
So hat ein großer Sohn Husums, so hat der am 14. September 1817 hier geborene Dichter von Immensee und vom Schimmelreiter seine Vaterstadt mit wenigen Strichen gekennzeichnet. In einer seiner Novellen entwirft Theodor Storm allerdings ein etwas heitereres und sonnigeres Bild von der grauen Stadt am Meer. „Es ist nur ein schmuckloses Städtchen, meine Vaterstadt; sie liegt in einer baumlosen Küstenebene und ihre Häuser sind alt und finster. Dennoch habe ich sie immer für einen angenehmen Ort gehalten, und zwei den Menschen heilige Vögel scheinen diese Meinung zu teilen. Bei hoher Sommerluft schweben fortwährend Störche über der Stadt, die ihre Nester unten auf den Dächern haben; und wenn im April die ersten Lüfte aus dem Süden wehen, so bringen sie gewiß die Schwalben mit,[S. 63] und ein Nachbar sagt’s dem anderen, daß sie da sind.“ Ein schmuckloses Städtchen am Rande von Geest und Marsch! Je nun, aber mit Einschränkungen! Denn es hat etwas an sich, was manchen anderen Städten und Städtlein Schleswig-Holsteins fehlt: es heimelt einen an, um einen süddeutschen Ausdruck für dieses Gefühl zu gebrauchen. Und dann birgt das kleine Husum doch noch einige Erinnerungen an die alte Zeit seines nunmehr verblichenen Glanzes in seinen Mauern, an die dahingeschwundenen Tage, da „die vor Kurtzem so florisante Stadt“ noch nicht in „Decadence“ geraten war, wie in seinem Theatrum Daniae Erich Pontoppidan berichtet. Da stehen noch etliche schöne alte Häuser, deren Zahl freilich mit jedem Jahr geringer wird, und dann das Schloß, welches Herzog Adolph I. von 1577–1582 an der Stelle eines alten Franziskanerklosters errichten ließ, „mit großen Kosten und dessen verwittibten Hertzoginnen des Gottorfischen Hauses zur Residentz gewidmet“.
Durch die Größe und Schönheit ihrer Hallen und den reichen Schmuck ihres Inneren erfreute sich die gotische Marienkirche in verflossenen Jahrhunderten eines großen Ruhmes. Im Jahre 1474 erbaut, um 1500 vergrößert, wurde sie, angeblich wegen Baufälligkeit, zu Beginn des neunzehnten Säculums abgebrochen. Damals machte im Volksmund der Spottvers die Runde:
1829 wurde die Kirche durch ein Gotteshaus ersetzt, dem man besonders Schmeichelhaftes leider nicht nachsagen kann. Die schönste Zierde der Marienkirche war das vom großen Bildschnitzer Hans Brüggemann, der ein Sohn Husums gewesen sein soll, gefertigte Sakramentshäuschen, welches leider verschwunden ist. Vor hundert Jahren soll es noch in irgend einem Winkel des Städtchens in sehr verdorbenem Zustand herumgestanden sein.
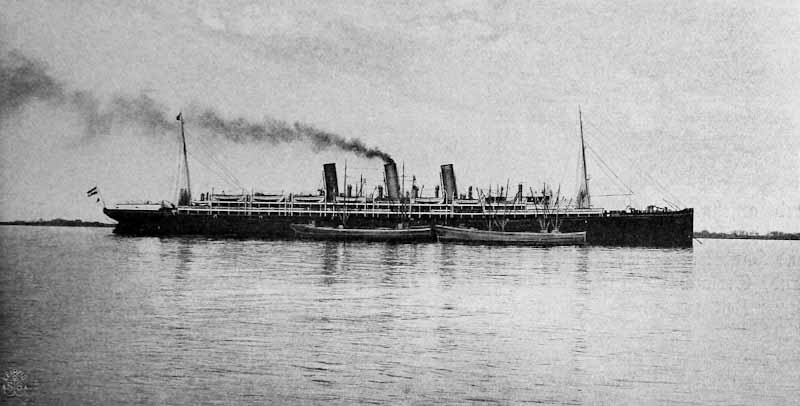
(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Ja, Husum hat bessere Tage gesehen, und wenn es auch heute noch der bedeutendste Ort an Schleswigs Westküste ist, weithin bekannt durch seine großen Viehmärkte und die bedeutende Ausfuhr von Rindern und Schafen — der jährliche Geldumsatz auf dem Viehmarkt dürfte gegenwärtig 28–30 Millionen Mark betragen —, so will das doch nichts sagen gegen die hohe Blüte, in welcher die Stadt im sechzehnten und bis ins siebzehnte Jahrhundert hinein gestanden hat. Heinrich Rantzau schreibt im Jahre 1597 von Husum: „Eine reiche[S. 64] und ansehnliche und mit Flensburg wetteifernde Stadt, mit berühmtem Seehafen und Handel aus Schottland, England, Holland, Seeland durch viele eigene Schiffe, in kurzer Zeit zu hohem Wohlstand erwachsen. Ihr Aussehen zeugt von erstaunlichem Reichtum; darin und auch an Größe übertrifft sie eigentlich alle Städte des Herzogtums.“
Im siebzehnten Jahrhundert haben auch „die zwei vortrefflich gelahrte Männer“ Caspar Dankwerth und Johannes Meyer hier gelebt, der erstere als Bürgermeister und als „Geographus, der das große und rühmenswürdige Werk: Landes-Beschreibung der beyden Herzogthümer Schleswig und Holstein genannt, abgefaßt, der zweyte aber als Mathematicus, der die dabey befindliche viele Speciale Land Karten und Grund Risse der Städte verfertiget“.
Eine Aue fließt an der Stadt vorbei und mündet in den Hever. Trotz des zur Ebbezeit fast wasserleer daliegenden Hafens, der nur von Fahrzeugen mit geringem Tiefgang benützt werden kann, ist die Schiffahrt, welche Husum auf dem Wattenmeere mit Nordstrand, Pellworm und den Halligen unterhält, durchaus nicht unbedeutend.
Wenn wir uns von Husum nordwärts begeben, sehen wir vor uns einen breiten Geestrücken, den Schobüller Berg. Ein Spaziergang auf denselben lohnt sowohl in landschaftlicher, als auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht aufs beste. Es ist ein ganz eigenartiges Bild, das sich auf diesem Wege vor uns aufrollt. Langsam steigt die sandige Straße an, und bald tritt zur Rechten der hohe Kirchturm von Hattstedt hervor, dessen Einwohner viele Jahre hindurch so sehr von den großen Deichlasten bedrückt wurden, daß das Sprichwort entstand:
Zur Linken aber blicken wir erst auf den grünbewachsenen Außendeich, dessen gerade Linie bis zu dem an die See vorgeschobenen Schobüller Geestrücken reicht. Hier verläuft er dann in diesem Vorsprung. Ueber dem hohen Schutzwall aber erscheint eine graue einförmige, kaum bewegte Fläche, auf der die verschiedensten Lichter spielen, das Wattenmeer. Fern am Horizont hebt sich, wie über dem Wasser schwebend, ein Streifen Landes heraus: klar sind darauf eine Windmühle und die Dächer einiger Häuser zu erkennen. Es ist die Insel Nordstrand. Je mehr wir ansteigen, um so größer wird auch der Raum, den unser[S. 65] Gesichtskreis umspannt, und wenn wir etwa an der kleinen Schobüller Ziegelei angelangt sind, so dünkt uns derselbe grenzenlos. Dunklere Punkte, kleine Eilande im Westen und Nordwesten gewähren dem Auge einige Ruhepunkte. Je nach der Beleuchtung tritt ihr Umriß bald nur ganz licht, wie Luftspiegelung hervor, bald aber so scharf und klar gezeichnet, daß wir die Häuser auf ihren Werften ganz deutlich zu erkennen vermögen. Das sind die Halligen. An regentrüben Sommertagen jedoch, wenn Flut und Land am Horizont miteinander verschwimmen und die See regungslos daliegt,

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Der Eindruck, den solche Anblicke bei ihren Beschauern hinterlassen, ist ein unbeschreiblich großartiger, zumal wenn man das Glück hat, dieses einzig in seiner Art dastehende Landschaftsbild bei wechselnden Farben genießen zu können. Für denjenigen aber, der sich auch für geologische Dinge interessiert, bietet dieser Geestvorsprung noch eine ganz besondere Überraschung. Die schon weiter oben erwähnte kleine Ziegelei ist nämlich auf anstehendem Gestein erbaut, das sich an der Oberfläche als eine rötliche, zuweilen von helleren Adern durchzogene thonige Masse darstellt, nach der Tiefe zu jedoch steinhart wird und zweifelsohne ein Analogon des thonigen Gesteines ist, von welchem die Basis der roten Felsen Helgolands zusammengesetzt wird. Aber nicht nur dieser am Strande des Wattenmeeres anstehende Zechsteinletten ist von großer Merkwürdigkeit, sondern auch das Vorkommen der gequetschten und wiederverkitteten Kalksteingeschiebe, die sich an der oberen Grenze des roten Thones mit dem darüber liegenden diluvialen Moränenmergel finden und besondere Curiosa im Gebiete der norddeutschen Diluvialablagerungen sind.
Von Wobbenbüll bis Hattstedt, wo der Deich nordwärts zu wieder seinen Anfang nimmt, bis hinauf nach Hoyer tritt die Geest nicht wieder an die Meeresküste heran.[S. 66] „In alter Zeit war hier ein sich stets veränderndes und für uns unentwirrbares Labyrinth von Halligen, Meeresarmen und Geestinseln. Hier finden sich auch die tief ins Land hineingehenden Auen, welche das Wasser der Geest in die unbedeichten und später auch in die bedeichten Niederungen gesandt haben, denn erst hart am Rande der Ostseebuchten liegt die Wasserscheide.“ Eindeichungen, die sich an die Geest anschlossen, oder auch solche, welche von den Inseln selbst ausgegangen sind, schufen die jetzige Küstenlinie. Eine, wenn auch nicht sehr starke Bevölkerung bewohnte schon vor dieser Landfestigung die Niederungen auf künstlich aufgeworfenen Wurthen. Die Nutzung der sich neu bildenden Landflächen fand aber von der Geest aus statt, deren Rand hier stark besiedelt ist. Hier befinden sich das stattliche Bredstedt mit dem nahebei belegenen Missionsort Breklum, Bordelum, Bargum, Stedesand, Leck und noch andere Flecken und Dörfer mehr. In der Marsch selbst treffen wir zuweilen auf einsam liegende Geestinseln, auf denen sich dann ebenfalls stattliche Ansiedelungen erheben. Lindholm, Riesum, Niebüll-Deezbüll mögen hier als Beispiele dafür angeführt werden. Die Marschen und deren erste Eindeichungen sind zweifelsohne schon sehr alt. Bereits im zwölften Jahrhundert beschreibt Saxo Grammaticus die Friesische Marsch als einen von niedrigen Wällen umgebenen gesegneten Boden, eine Bezeichnung, die sie heute noch in vollem Maße verdient. Steht doch der alte Christian-Albrechts-Koog bei Tondern im Rufe, das fruchtbarste Land im gesamten Marschgebiete zu sein! Bei der Eindeichung der rückliegenden Ländereien ist aber in früheren Zeiten bisweilen etwas zu rasch verfahren und unreifes Marschland mitgenommen worden. Der Gotteskoogsee ist ein warnendes Beispiel hierfür.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Der vorspringende Teil unserer Küstenlinie, welcher etwas südlich von Emmelsbüll beginnt und sich über Horsbüll und[S. 67] Klauxbüll bis etwas nördlich von Rodenäs hinzieht und heute noch den Namen der Horsbüll- oder Wiedingharde führt, war jahrhundertelang eine erst uneingedeichte, später aber nur ungenügend eingedeichte feste Marschinsel, die von der Geest zwischen Hoyer, Tondern u. s. f. durch niedrige Ländereien, große Wasserflächen und Meeresarme getrennt gewesen ist. Ihre Bewohner konnten die westlichen Grenzen des Eilands aber nicht gegen den Ansturm des Meeres behaupten, und die Deiche mußten mehrfach zurückverlegt werden, während viel Land verloren ging. So versanken die Kirchen von Wippenbüll und Alt-Feddersbüll; ebenso wurde am 1. Dezember 1615 die Rickelsbüller Kirche im Norden der Harde, welche damals schon mit ihrem Kirchdorf im Haffdeich lag, in den Meeresfluten begraben. Die Särge[S. 68] sind dabei aus den Gräbern getrieben worden. Es hat in das siebzehnte Jahrhundert hinein gedauert, bis die Horsbüllharde mit dem schleswigschen Festlande verbunden war, nachdem mehrere Versuche immer und immer wieder gescheitert waren.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Als weiteres Beispiel für die Verhältnisse dieser verwickelten Marschlandschaft mag hier noch die merkwürdige, inselartig aus den Marschalluvionen herausragende sandige, im Kerne moorige Fläche des Risummoor, auch Kornkoog genannt, erwähnt werden, an deren Rändern Deetzbüll und Lindholm belegen sind. Noch im Jahre 1624 war dies abgesonderte Ländchen so sehr Insel, daß eine schwedische Flottille an ihr landen konnte. Tempora mutantur! Heute ist Lindholm Station der Marschbahnstrecke Husum-Tondern.
Es ist wirklich eine angenehme Sache, an einem schönen Sommertage auf dieser Eisenbahnlinie, welche das nordwestliche Schleswig so recht dem Verkehr erschlossen hat, dem Rücken der Geest entlang zu fahren. Da liegen gegen Westen die grünen Marschen vor uns ausgebreitet, flach und eben wie ein Teller und durchzogen von unzähligen Gräben und Sielen. Da und dort ein einsames Gehöft oder ein kleines Stück Deich, der wie ein Festungswall erscheint, am Horizont, sonst nichts als weites Grasland, darauf unzählige Rinderherden weiden. Bisweilen scheucht die keuchende Lokomotive auch ein paar Pferde auf, die sich hier gütlich thun dürfen; beängstigt von dem so ungewohnten Lärm in der sonst so stillen Landschaft galoppieren sie in wilder Hast davon. Phlegmatisch aber steht Freund Adebar dabei und beschaut sich in philosophischer Ruhe den dahinbrausenden Eisenbahnzug. Ihn stört das alles nicht; verächtlich blickt er auf die erschrocken dahinspringenden Vierfüßer herab, die noch nicht über die Grenzen ihrer Gemarkung gekommen sind, während er, der Weltreisende, der Globetrotter unter der Tierwelt unserer Zonen, doch schon so viel gesehen hat, und ebenso zu Hause ist in südlichen Geländen, wo der Nil träge dahinflutet und die Pyramiden gen Himmel ragen, als hier, in seiner Sommerheimat an den Gestaden des deutschen Meeres. Und ihre Sommerheimat ist es wirklich, dieses Marschland, das mit seinem Reichtum an Fröschen und anderem kleinen Getier den Störchen geradezu die allergünstigsten Lebensbedingungen bietet. Im weiten Umkreis ist fast kein Giebel zu schauen, der nicht wenigstens ein Storchennest trüge, und Meister Langbein gehört[S. 69] mindestens so gut zum vollen Landschaftsbild, wie sonst etwas darin: ja, er ist geradezu ein eigentümliches Merkmal desselben.
Dem Charakter des Landes und seiner Bevölkerung entsprechend, dem sie als Verkehrsmittel dient, geht es in gewöhnlichen Zeiten auf der Marschbahn nicht allzu lebhaft zu. Es wird eben alles, wenn auch pünktlich und genau, so doch mit einer gewissen Ruhe und Behäbigkeit besorgt. Eigentliche Schnellzüge befahren die Strecke im Winter nicht, denn die Bahn soll ja in erster Linie den lokalen Verhältnissen Rechnung tragen. Anders aber ist’s in den schönen Sommertagen, wenn in den Monaten Juli, August und September die Badezüge durch das weite grüne Feld dahinsausen und die erholungsbedürftige Menschheit aus der heißen Stickluft der großen Städte des Binnenlandes hinausführen zu dem stärkenden Odem der Nordsee. Dann ist die Physiognomie der Bahn eine gänzlich veränderte. Dann zieht das schnaubende Dampfroß nur vollbesetzte[S. 70] Wagen hinter sich her durch die saftigen Auen der Marsch, und erstaunt ob des ungewohnten Anblicks schaut der kleine Hirtenjunge da unten am Bahndamm dem mit Windesbraus an ihm vorbeirollenden und seinem Gesichtskreise alsbald wieder entschwindenden funkensprühenden Ungetüm nach, vielleicht zuweilen nicht ohne die leise Sehnsucht, es doch auch einmal so zu können und zurückgelehnt in die schwellenden Polster durch die Lande fliegen zu dürfen.
Und vollends gar, wenn die Zeit der Schulferien beginnt! In Niebüll reißt der Schaffner die Wagenthüren auf. „Niebüll,“ schreit er, „Wagenwechsel für die Reisenden nach Dagebüll und Wyk auf Föhr!“ Da stürzt es heraus aus den vollgepfropften Abteilen, ein erster Schwarm von Großen und Kleinen verläßt den Zug und stürmt die auf einem Nebengeleise schon bereitstehenden Vehikel der kleinen Bahnlinie nach Dagebüll. Von da geht’s auf das Schiff, das in einer kurzen Stunde das Wattenmeer durchquert und seine Passagiere wohlbehalten und von der bösen Seekrankheit unbehelligt im sicheren Hafen von Wyk landet.
Von Niebüll nach Tondern ist es nur eine kurze Strecke. Hier verlassen auch wir den Zug, der nach kurzem Aufenthalt weiterrast nach Hoyer und zur Hoyerschleuse. Dort entleert er seine Wagen, deren Insassen die Insel Sylt zum Reiseziel genommen haben und von hier aus zuweilen noch tüchtig von den Wellen geschaukelt werden, bevor der Dampfer sie bei Munkmarsch wieder auf festen Boden gesetzt hat. Der Geburtsort Johann Georg Forchhammers und die Heimat des Propsten Balthasar Petersen ist es aber wohl wert, daß wir ihr einige wenige Stunden der Betrachtung schenken.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Tondern ist eine kleine freundliche und saubere Stadt von etwa 3800 Seelen, an der wasserreichen Widau auf einer äußerst geringfügigen Bodenerhebung gelegen. Dieser ungünstige Bauplatz ist vermutlich darum[S. 71] gewählt worden, um von der Schiffahrt Nutzen ziehen zu können, denn die Nähe der Stadt zur See war ehedem eine viel größere, als in der Gegenwart, und Tondern besaß zahlreiche Meeresfahrzeuge. Bis zum Jahre 1554 konnten selbst größere Schiffe noch ungehindert an Tondern herankommen, als aber von 1553 bis 1555 die sich von Hoyer bis Humptrup erstreckenden und vor der Tonderner Geest gelegenen Niederungen eingedeicht wurden, versperrte die von holländischen Baumeistern erbaute neue Schleuse bedeutenderen Schiffen den Weg. Später konnten selbst kleinere Fahrzeuge nicht mehr bis zur Stadt gelangen, als nach und nach neue Anschlickungen stattfanden und immer mehr Deiche entstanden. Seiner tiefen Lage wegen hat Tondern mehrfach unter den Sturmfluten zu leiden gehabt. Im Jahre 1532 stand das Wasser drei Ellen hoch in der Stadt, 1593 brach es abermals in die Häuser herein und that großen Schaden, nicht minder anno 1615. Am stärksten aber ist Tondern von der großen und denkwürdigen Oktoberflut 1634 heimgesucht worden. Auch die Pest war in verflossenen Tagen ein mehrfacher unheimlicher Gast in der Stadt. So besonders im sechzehnten und zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts. Vielleicht, so meint Hahn, hängen diese zahlreichen Pestepidemien mit der niedrigen Lage der Stadt zusammen.
In Tondern befindet sich eins der Lehrerseminare der Provinz Schleswig-Holstein. Der schon erwähnte Propst Balthasar Petersen hat es gegen Ende des verflossenen Säculums gegründet. Dann hat, wie ebenfalls schon kurz angedeutet wurde, die Wiege eines großen Naturforschers des Landes, des im Jahre 1863 zu Kopenhagen verstorbenen Geologen Forchhammers hier gestanden. Er hat zu den bedeutendsten Männern seiner Zeit gehört und hat bis zum heutigen Tage in seinem engeren Heimatlande leider immer noch nicht die Anerkennung gefunden, die er eigentlich verdiente.
Weder in landschaftlicher noch in künstlerischer Hinsicht besitzt Tondern viel Bemerkenswertes, es sei denn eine sehr schöne, alte Kirche, deren innere im Stil der Renaissance gehaltene Ausstattung alle anderen des Landes in ihrem jetzigen Zustand an Pracht übertrifft, sodann einige gotische Giebelhäuser, die zierlichen, in Hausteinarbeit ausgeführten Barock- und Rokokoportale, welche sich an verschiedenen Wohnhäusern finden, nicht zu vergessen. Es sind dies wahre Juwele in ihrer Art.
In früheren Zeiten blühten in Tondern[S. 72] neben dem Handel besonders die Weberei und das Spitzenklöppeln. Das letztere Gewerbe soll schon gegen 1639 von Dortmund aus eingeführt worden sein und gelangte sowohl für die Stadt selbst, als auch für ihre Umgebung zu hoher Bedeutung. Im Jahre 1780 waren an 1200 Frauen damit beschäftigt, und zu Anbeginn dieses Jahrhunderts sind noch 13 Spitzenfabriken vorhanden gewesen. Seit 1825 ist die Spitzenklöppelei sehr zurückgegangen, wird aber bis in die Gegenwart noch, wenn auch in kleinerem Umfange betrieben. Die Tonderner Spitzen sind bei der Frauenwelt des deutschen Nordens auch jetzt noch ein sehr geschätzter Gegenstand.
Westlich von Tondern, an Mögeltondern und dem schon sehr alten, früheren bischöflichen Schlosse Schackenburg vorbei, führt uns die Bahn nach dem auf einem rings von Marschlanden umgebenen Geesthügel in der Nähe des Meeres erbauten Hoyer und von da in wenigen Minuten zur Hoyerschleuse, dem bereits genannten Hafenort für die Schiffahrt nach der Insel Sylt. Zieht man von hier aus am Strande nordwärts, so gelangt man über Emmerlef mit seinem hell ins Wattenmeer hinausschimmernden Kliff, einem kleinen Steilufer, über Jerpstedt nach Ballum, dem Ausgangspunkt für die Insel Röm. Über die Brede-Au hinüber führt der Weg nach Bröns, woselbst man die von Tondern über Bredebro, Döstrup und Scherrebek nach dem Norden führende Westbahn wieder erreicht. Dann folgen noch Reisby, das keine selbständige Bahnstation hat, und hierauf Hvidding. Hier ist dann die Nordgrenze des Reiches erreicht und wir betreten dänisches Gebiet. Der ganze Meeresstrand von Jerpstedt ab bis hinauf nach Jütland ist so flach, daß bei Hochfluten die Bahnlinie sogar schon überschwemmt und das Wasser bis nach Döstrup und Scherrebek hineingetrieben worden ist. Von diesen ebengenannten Ortschaften nimmt eigentlich nur das letztgenannte Kirchdorf unser besonderes Interesse in Anspruch, und zwar wegen der mannigfachen und segensreichen Bestrebungen seines geistlichen Hirten, des Herrn Pastor Jacobsen. Dieselben beruhen auf echt nationaler Basis und sind industrieller und socialer Natur, darunter ein Bankinstitut, eine[S. 73] Webeschule, mit ganz hervorragenden Leistungen, einen Arbeiterbauverein und andere die Volkswohlfahrt in hohem Maße befördernde Einrichtungen mehr.
Im Mittelalter soll fast ganz Nordschleswig vom Walde bedeckt gewesen sein, und von den Marschwiesen bei Farup nördlich von der jetzt dänischen Stadt Ripen erstreckte sich der Sage nach der Farriswald, über die ganze Halbinsel bis zum Kleinen Belt, acht Meilen lang und anderthalb Meilen breit. Im Osten sind diese Wälder noch vorhanden und ziehen sich bis Gramm, Rödding und Lintrup gegen Westen. Von hier ab fehlen aber mit nur wenigen und kümmerlichen Ausnahmen die Holzungen, weil man fortwährend Holz geschlagen, aber keine jungen Bäume zum Nachwuchs gepflanzt hat. Auch durch Heidebrand entstandene Waldbrände mögen Schuld daran tragen. Stellenweise legten die Bauern sogar selbst Feuer an, wie beispielsweise bei Scherrebek, um eine Räuberbande auszurotten, die sich im Holz verborgen hielt. Die Eiche war der wichtigste Baum; auf sumpfigem Boden jedoch hatten sich besonders die Erle und die Birke angesiedelt. In den Waldungen wimmelte es von allerhand Wild; Hirsche, Rehe und Wildschweine lebten dort in großer Zahl. Auch an Wölfen soll kein Mangel gewesen sein.
Das Land im Westen ist heutzutage nackt und kahl, bei so magerem Boden, daß selbst das Heidekraut nur niedrig bleibt und das Getreide erbärmlich steht. Aber an Wasserläufen und Bächen, wo Binsen und Seerosen wachsen, wo dichtes mit Wachtelweizen untermengtes Gras grünt und das Vergißmeinnicht und die goldgelbe Butterblume wachsen, da hat es dennoch auch seine Reize.
Schon im bewaldeten Teil des Mittelrückens Nordschleswigs, in lieblicher, holzreicher Umgebung befindet sich der Flecken Lügumkloster, von dem hier noch einige wenige Worte gesagt seien, bevor wir von dieser Gegend Abschied nehmen wollen. Seinen Namen hat der Ort von einem ehemaligen der heiligen Jungfrau gewidmeten Kloster, das um 1173 Cisterciensermönche gegründet haben. In verflossenen Jahrhunderten erfreute es sich keines geringen Ruhmes in den cimbrischen Landen, und bei mancherlei Anlässen ist das Wort seiner 23 Äbte gar gewichtig in die Wagschale gefallen. Vier Bischöfe von Ripen, deren Hirtenstab Lügumkloster vor Zeiten untergestellt gewesen ist, liegen in der spätromanischen und im Übergangsstil aufgeführten schönen Klosterkirche begraben. Nach der Marienkirche in Hadersleben wird sie für das schönste Bauwerk Nordschleswigs gehalten. Der anmutige und freundliche Flecken ist durch eine von Bredebro abgehende Zweiglinie mit der Westbahn verbunden. Die vormals auch hier, wie in und bei Tondern eifrig betriebene Spitzenklöppelei, die früher vielen Wohlstand in die Gegend brachte, hat nunmehr fast ganz aufgehört.
VIII.
Die nordfriesischen Inseln.
Röm, die nördlichste der nordfriesischen Inseln, ist ungefähr zwei deutsche Meilen lang und fünf Kilometer breit, von halbmondförmiger Gestalt, und durch das Lister Tief von Sylt getrennt. Letzteres ist eine der wenigen tiefen Wasserstraßen an der sonst so flachen deutschen Nordseeküste, und die einzige für große Schiffe zugängliche Einfahrt an diesem ganzen Areal. Die ungemein reißende Strömung verhindert auch im strengsten Winter das Zufrieren des Lister Tiefs, das sich als Römer Tief um die Südseite der Insel herum bis an deren Ostküste fortsetzt.
Der größte Teil Röms ist von Dünen bedeckt, die am Westrande auch Ketten bilden, im Inneren der Insel aber meist als Einzeldünen auftreten und an vielen Stellen dicht bewachsen sind. „Am Ostrande der Dünen, aber teilweise tief in dieselben hineingedrängt liegen die dadurch vollkommen unregelmäßig verstreuten Häuser der Insulaner, welche durch aufgeschüttete, mit Tang und Marschschlick gedeckte, durch Dünenpflanzen gefestete, hohe Wälle sich und ihre kleinen Gärten schirmend, vor dem Flugsande sich gewehrt und teilweise seiner Verbreitung andere, als die natürlichen Formen gegeben haben“ (Meyn). Dazwischen finden sich mit üppigen Früchten, so besonders mit Gerste bestandene Ackerfelder.
Kirkeby im Süden belegen, ist das Kirchdorf der Insel, welche sonst noch eine Anzahl von kleineren und größeren Gehöften als Juvre, Toftum, Bolilmark u. s. f. im Nordosten, Kongsmark im Osten u. s. f. trägt. Die Bewohner sind friesischer Abstammung, und deren männlichem Teil wird große Erfahrung und Tüchtigkeit im Seemannsberufe nachgerühmt. Ihre ursprüngliche friesische Sprache, die sich heutzutage nur noch in einzelnen Ausdrücken und Worten verrät, hat dem landesüblichen Idiom des Plattdänischen weichen müssen.
Mit dem Festlande steht Röm durch Schiffahrt über Ballum oder über Scherrebek in Verbindung. Die letztere ist neueren Datums. Nach einer Fahrt von etwa fünfzig Minuten landet man bei Kongsmark, und von hier führt eine Dampfspurbahn die Passagiere in wenig Minuten nach dem Westrande der Insel, in das Nordseebad Lakolk. Den Namen hat dieses jüngste der deutschen Nordseebäder von dem jetzt in den Fluten versunkenen Dorfe gleicher Benennung erhalten, das vor Zeiten westwärts vom jetzigen Westrande des Eilands lag, und dessen Überreste bei besonders tiefer Ebbe zuweilen noch sichtbar sein sollen (Abb. 13–15).
Sylt, die nächstfolgende Insel, zwischen 55° 3´ und 54° 44´ nördlicher Breite belegen, erstreckt sich in nordsüdlicher Richtung 35 Kilometer weit, bei einer wechselnden Breitenausdehnung von 1–4 Kilometer. Sylts Flächeninhalt beträgt 102 Quadratkilometer, 50 davon sind von Dünen bedeckt, die im Norden, bei List, über 80 Meter Höhe erreichen und sowohl am nördlichen, als auch am südlichen Teile der Insel ein Hochgebirge im kleinen darstellen, das die verschiedenartigsten Bildungen von Längs- und Querthälern aufweist und auch kleine Binnengewässer enthält. Hinter den Dünen kommt das Heideland und auf dem weit nach Osten zurückgestreckten[S. 75] mittleren Teile der Insel das fruchtbare Marschland mit den Dörfern Keitum, Archsum und Morsum. Nahe bei der äußersten Spitze dieses Vorsprungs gegen Norden liegt das Morsumkliff, an dessen Steilabhang die Schichten des oberen Miocängebirges in der Gestalt von Limonitsandsteinen, Glimmerthon und Kaolinsand zu Tage treten. Das Kliff selbst steigt im Munkehoi (Mönchshügel) bis zur Höhe von 23 Meter über den Spiegel der Nordsee auf. Auch noch an anderen Stellen der Insel, so in der Nähe des Roten Kliffs bei Wenningstedt, können diese tertiären Bildungen anstehend beobachtet werden.
Der mittlere Teil des Eilands trägt an der Westseite die beiden Ortschaften Westerland und Wennigstedt. In diesen beiden konzentriert sich auch das eigentliche Badeleben. Westerland, das 1900 das 43. Jahr seines Bestehens als Nordseebad feiert und bisher von weit über 100000 Badegästen besucht worden ist, trägt im Höhepunkt der Saison durchaus den Charakter eines Badeortes ersten Ranges. Große Gasthöfe, breite und saubere Straßen, flankiert von schön gebauten Ziegelhäusern, in jeder Beziehung gut ausgestattete Kaufläden und ein imposantes, in den Jahren 1896–1897 erbautes Kurhaus lassen uns ganz und gar vergessen, daß wir uns auf einer einsamen Insel im Wattenmeer befinden. Am merkwürdigsten ist das Leben am Strand, das auf den ersten Anblick völlig einem bunten Jahrmarkttreiben gleicht. Am Abhang der Düne und teilweise über diese selbst hin zieht sich die lange hölzerne Wandelbahn und längs derselben haben die hauptsächlichsten Gasthöfe Westerlands zur Bequemlichkeit ihrer Kurgäste besondere Strandhallen erbaut. Dort erhebt sich auch der kleine Musiktempel für die Kurkapelle, deren Töne sich freilich gegenüber der brausenden, wenn auch etwas monotonen Symphonie, welche die Wellen der Nordsee hier aufspielen, zuweilen recht ärmlich ausnehmen.[S. 76] Am Strand aber reiht sich Zelt an Zelt und Burg an Burg. So nennt man die aus dem feinen weißen Ufersande von den Badegästen aufgeführten Bauten, in ihrer primitivsten Einrichtung einfach Umwallungen, die eine Vertiefung im Sande umschließen, in welche Stühle, Bänke, Tische oder auch Zelte gestellt werden, und deren jede einen kleineren oder größeren Flaggenmast oder auch nur eine einfache Stange besitzt, von welchen herab die Fahne des Landes weht, dessen Angehöriger der Burgbesitzer ist. Ein ungemein farbenreiches, vom Lärmen und geschäftigen Treiben von Tausenden von Menschen, Großen wie Kleinen belebtes Bild ist’s, das so entsteht, und zu dem die Wogen ihr sich ewig gleichbleibendes Lied bald im gemächlichen Andante, bald im Allegro furioso singen.
Wie an vielen anderen Stellen auf unserer Erde, so berühren sich auch hier die Gegensätze. Gleich hinter dem Badestrande mit seinem frisch pulsierenden Leben steht ein dunkles Mauerviereck. „Heimatstätte für Heimatlose“ besagen die Worte an der Eingangspforte. Der stille und friedliche Raum birgt eine große Anzahl von Gräbern; jedes derselben trägt ein einfaches Kreuz, dessen Inschrift Auskunft gibt über den Tag, da der hier Bestattete in die kühle Erde gebettet worden ist, und über die Stelle, wo er gefunden wurde. Nur eine einzige Grabstätte nennt auch noch den Namen des Toten, der unter[S. 77] dem Hügel schläft, von allen den übrigen armen Schiffbrüchigen aber, welche das Meer an den Sylter Strand geworfen hat, kennt man weder „Nam’ noch Art“. Vor 45 Jahren, am 3. Oktober 1855 hat man hier den ersten Heimatlosen in die kühle Erde gesenkt, und seither sind über 40 Strandleichen an dieser Stelle geborgen worden. Wenn das so recht wehmutsvoll stimmende Fleckchen Land heute in so gutem Stande gehalten und im vollen Sinne des Wortes eine Heimatstätte für Heimatlose geworden ist, so gebührt das Verdienst hierfür in allererster Linie einer deutschen Fürstin auf einem fremden Throne, der rumänischen Königin Elisabeth. Im Sommer 1888 weilte sie auf Sylt, hat den kleinen Friedhof oft besucht, seine Gräber mit Blumen geschmückt und für denselben einen großen Granitblock gestiftet, in welchen die folgenden, vom verstorbenen Hofprediger Kögel gedichteten schönen Verse eingemeißelt stehen:

Ein schärferer Kontrast, als derjenige zwischen Westerland und dem etwa 4,5 Kilometer nördlich davon belegenen Wenningstedt ist kaum denkbar. Hier alles noch im ursprünglichen Zustande, keine großen Gasthöfe, keine Kurhäuser, keine Kurtaxe, nur etliche strohbedeckte Friesenhäuser, dort der gesamte Komfort des modernen Modebades, hier idyllische Ruhe, dort geräuschvolles Badeleben. Wenningstedt liegt am Ostabhange einer alten auf hohem Steilufer aufsitzenden Dünenkette, mitten in der Sylter Heide und etwa fünf bis zehn Minuten vom Strande selbst entfernt, zu dem eine breite und bequeme Holztreppe hinabführt. In landschaftlicher Beziehung bietet der Ort selbst nicht viel, um so schöner und herrlicher ist aber seine Umgebung. Ein kurzer Spaziergang bringt uns an diejenige Stelle, wo sich die Natur Sylts am großartigsten entfaltet, an den Steilabsturz des Roten Kliffs mit einer der wundervollsten Fernsichten, die man überhaupt an der deutschen Nordseeküste haben kann. Eine der darauf befindlichen Einzeldünen, der Uwenberg, erreicht die Höhe von 46 Meter über dem Meeresspiegel. Auf luftiger Höhe des Kliffs steht ein im großen Stil erbauter Gasthof, das Kurhaus von Kampen. Dessen Erbauung soll, wie man sich erzählt, den Westerländern[S. 78] wegen der für ihren Badeort zu fürchtenden Konkurrenz ein arger Dorn im Auge gewesen sein. Mehr landeinwärts liegt das Dorf Kampen selbst mit einer Rettungsstation für Schiffbrüchige und seinem weit auf das Meer hinaus und über die Insel dahinschauenden 35 Meter hohen Leuchtturm, dessen Fuß selbst schon 27 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Nahebei sieht man auf etliche Hünengräber, wie denn die Insel Sylt im wahrsten Sinne des Wortes mit solchen Grabhügeln aus grauer Vorzeit überdeckt ist. Der schönste davon ist der Denghoog ganz dicht bei Wenningstedt, der „Gerichtshügel“, wie sein friesischer Name besagt. Der Denghoog ist ein sogenannter Gangbau und stellt in seiner heutigen Gestalt einen etwa 4½ Meter hohen Hügel dar, dessen Erdmauern ein aus mächtigen, teilweise ganz herrliche Gletscherschrammen tragenden und glatt polierten Findlingen aufgemauertes Gewölbe, die Steinkammer, decken. Letztere war von Westen her durch einen gepflasterten Gang zu betreten. Die mannigfachen Gegenstände, welche in diesem Grab aus der jüngeren Steinzeit gefunden wurden, so Knochenreste, Thonwaren, Steingeräte, Bernsteinperlen, Holzkohlen u. s. f. befinden sich im Museum vaterländischer Altertümer zu Kiel.
Vor Wenningstedt, draußen im Meer, liegt das alte Wendingstadt mit dem berühmten Friesenhafen, das am 16. Januar 1300 (nach anderen Ansichten vielleicht erst 1362) von den Fluten verschlungen worden ist. Noch im Jahre 1640 waren die Überreste der alten Stadt etwa eine halbe Meile weit von der Küste bei tiefer Ebbe sichtbar. Heute erinnert nur noch der kleine Ort Wenningstedt an diese vergangenen Zeiten, über den Ruinen Wendingstadts aber rollen die Wogen der See.
Am Strande entlang wandern wir nordwärts, unter den Abhängen des Roten Kliffs vorbei, das seinen Namen eigentlich nicht ganz mit Recht trägt, denn die Farbe seines[S. 79] zumeist aus diluvialen Gebilden bestehenden Steilabsturzes ist eher gelblich, als rot. Bald sind wir mitten in die großartige Dünenlandschaft gelangt, die hier beginnt und sich bis an die Nordspitze der Insel hinauf zieht. Die gewaltigen, beweglichen Sandberge bildet vorzugsweise der Nordwestwind und treibt dieselben nach Südosten zu, in der vorherrschenden Windrichtung weiter. Man hat berechnet, daß ihr jährliches Vordringen bis sechs Meter betragen kann. Schon im verflossenen Jahrhundert wurde der Versuch gemacht, den Sand der Dünen durch rationelles Bepflanzen mit gewissen Gewächsen, so mit dem Halm, dem Sandhafer und der Dünengerste festzulegen. Diese Pflanzen besitzen nämlich sehr lange und ausdauernde Wurzelstöcke, die sich weit hinein in den Sand bohren und denselben binden. Derartige Dünenkulturen lagen besonders den Frauen ob. In neuerer Zeit wird diese Methode in großem Maßstabe angewendet, und seit 1867 ist diese Arbeit Sache des Staates selbst. Im verflossenen Jahrzehnt sind jährlich etwa 16000 Mark für die Bepflanzung der Sylter Dünen verausgabt worden.
Zum weiteren Schutze des Strandes führt man in der Gegenwart kostspielige Pfahl- und Steinbuhnen auf, so beispielsweise im Zeitraum von 1872–1881 20 Stück, welche allein einen Aufwand von 596550 Mark verursacht und deren Unterhaltung von 1875–1881 beinahe 60000 Mark gekostet hat. Seither sind noch eine ganze Reihe weiterer solcher Bauten hinzugekommen, und unablässig ist die Regierung bemüht, ihr möglichstes für die Erhaltung des Strandes zu thun.
Achtzehn Kilometer nördlich von Westerland zeigen sich auf einer grünen Oase die Häuser der kleinen Ortschaft List, im Westen von gewaltigen Dünenzügen geschützt, im Norden und Osten von den Wellen des Wattenmeeres bespült, das hier als tiefe Bucht in die Nordspitze der Insel eingreift, und der Königshafen genannt wird. Derselbe muß einst eine immerhin beträchtlichere Tiefe gehabt haben, denn im Jahre 1644 lagen darin die verbündeten holländischen und dänischen Flotten, welche Christian IV. von Dänemark angriff und schlug. In der Gegenwart ist der Königshafen mehr und mehr versandet. Am Ufer des Wattenmeeres selbst hat die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ein Bootshaus erbaut, und ganz dicht dabei liegt, vom Sande schon halb überdeckt, das Wrack eines größeren Fahrzeugs, das hier gestrandet ist.
Das äußerste Nordende der Insel wird von der sandigen Halbinsel Ellenbogen gebildet, welche zwei 18 und 20 Meter hohe Leuchtfeuer trägt, der Ost- und der Westleuchtturm, wichtige Orientierungspunkte für die in das Lister Tief einsegelnden Schiffe.
Den Rückweg von List nehmen wir längs des Wattenmeeres und haben nun die Gelegenheit, die zahlreichen Vögel aller Art, als Möven, verschiedenerlei Enten, Strandläufer, Eidergänse, Seeschwalben, Kiebitze u. s. f. zu beobachten, welche die weiten Dünenketten und die dazwischen[S. 80] gelegenen Thäler bevölkern. Im Frühjahr wird hier zuweilen eifrig nach Möveneiern gesucht, und die bewaffnete Staatsgewalt der Insel hat mehr als genug zu thun, um die Nester dieser Vögel vor der Ausraubung beutegieriger Eiersucher zu schützen. In verflossenen Jahren, bevor das Eiersammeln verboten war, sollen jährlich an 50000 Stück davon in den Lister Dünen aufgelesen worden sein. An der Vogelkoje, welche sich auf unserem Wege befindet — sie soll die älteste auf den nordfriesischen Inseln und schon im Jahre 1767 hergestellt worden sein —, gehen wir nicht vorbei, ohne nicht auch einen Blick hineingeworfen zu haben. Es ist, wie auch alle übrigen Einrichtungen dieser Art, ein viereckiger Teich, von dichtem Gebüsch, das aus Weiden, Eschen, Pappeln und anderen Bäumen und Gesträuchen besteht, umgeben, und an jedem Ende mit einem immer enger werdenden und schließlich mit Netzen überspannten Kanal, einer Pfeife, versehen. Gezähmte Enten verschiedener Art locken die wilden an, die in die Pfeifen und von da in die Netze geraten und dort ergriffen werden. Bis 150 Vögel sind auf ein einziges Mal in einer solchen Vogelkoje gefangen worden, deren es auf Sylt, Amrum und Föhr zusammen elf gibt. Im Jahre 1887 wurden auf diesen drei Inseln zusammen etwa 56000 Stück Enten in den Vogelkojen gefangen.

(Nach einer Photographie von H. Breuer in Hamburg.)
Einen nicht minder[S. 81] guten Einblick in das Tierleben des Wattenmeeres gewährt uns ein zur Ebbezeit von List nach Kampen oder umgekehrt unternommener Spaziergang. Da liegen leere Gehäuse des Wellhorns, dort ein wabenpäckchenartiges Gebilde, die leeren Eischalen dieser Schnecke (Buccinum undatum, L.). Hier hat ein seltsames Tier, der Einsiedlerkrebs (Pagurus Bernhardus, L.), seinen nackten Hinterleib zum Schutze in ein leeres Wellhorn gesteckt. In den von der Flut zurückgelassenen Wassertümpeln wimmelt es von kleinen Nordseekrabben (Crangon vulgaris, L.), welche die Watten bevölkern und hier in Menge gefangen werden, dichte Haufen von Muscheln aller Art, so Cardium, Pecten, und vor allem die Mießmuschel (Mytilus edulis) haben die Wellen auf dem Lande aufgetürmt und dazwischen lagern zahllose Leichen von Quallen, welchen der Rückzug des Wassers das Leben gekostet hat. Hier und da trifft man auch auf Fische, die sich nicht rechtzeitig mit den Wellen auf und davon gemacht haben, und häufig auf leere Austernschalen, welche die Wogen von den im Wattenmeere vorhandenen Austernbänken losspülten. Die Befischung dieser letzteren hat in vergangenen Zeiten den Bewohnern des Wattenmeeres reichen Erwerb gebracht. Seit 1587 hatte Friedrich II.[S. 82] von Dänemark ihre Ausbeutung als ein Recht der Krone in Anspruch genommen und vom 1. September bis zum Mai wurde der Fang dieses Schaltieres betrieben. Im Jahre 1746 betrug die von den Pächtern des Fangrechtes zu erlegende Summe noch 2000 Thaler, im Jahre 1879 mußten Hamburger Herren 163000 Mark dafür zahlen.

(Nach einer Photographie von M. Kruse in Altona-Ottensen.)
Die Austernbänke, deren es in Sylt etwa elf gibt, liegen am Rande der tiefen Rinnen des Wattenmeeres, ihre Ergiebigkeit ist aber allmählich immer geringer und geringer geworden, indem man dieselben zweifelsohne zu stark ausgebeutet hat. So ist denn im letzten Jahrzehnt ihre Befischung ganz und gar eingestellt worden. Doch sorgen die Austernzuchtanstalten bei Husum einigermaßen für Ersatz dieses Leckerbissens, den schon anno 1565 der ehrsame Johannes[S. 83] Petrejus, Pastor zu Odenbüll auf Nordstrand, „vor ein Fürsten Essen geachtet“. Allerdings ist auch hier die Nachfrage größer, als die Produktion, und meist sind schon im Januar keine Husumer Austern mehr zu haben. Noch im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts kosteten 1000 Stück Austern an der Westküste Schleswig-Holsteins eine Mark, in den letzten Fangjahren war der Preis schon auf 40–50 Mk. gestiegen und dürfte in Zukunft ein beträchtlich höherer werden, falls der Austernfang hier wieder aufblühen sollte. Im Dezember des verflossenen Jahres galten 100 Stück Husumer Austern an Ort und Stelle 18 Mk.
Auch Seehunde leben im Wattenmeere, und die Jagd auf diese klugen, den Fischgründen aber äußerst verderblichen Tiere wird von den Badegästen auf den nordfriesischen Inseln nicht selten als Sport geübt. Jährlich sollen am Sylter Strande etwa 100 Stück davon geschossen werden (vergl. Abb. 37).
Von Kampen aus schlagen wir den Weg über das Heidedorf Braderup nach Munkmarsch ein, der heutigen Landungsstelle für den Schiffsverkehr mit Sylt, nachdem der frühere Hafen der Insel bei Keitum im Laufe der Jahre so versandete und verschlickte, daß er seit 1868 nicht mehr benützt werden konnte. Mehrere Dampfer halten die Verbindung Sylts mit dem Festlande einigemal am Tage aufrecht, außerdem ist das Eiland aber auch noch von Hamburg aus auf dem direkten Seewege zu erreichen, und zwar dreimal wöchentlich über Helgoland, täglich aber für die aus dem Westen Deutschlands kommenden Reisenden über Bremerhaven-Helgoland-Wyk, jedoch derart, daß die Passagiere zur Fahrt auf dem Wattenmeere selbst auf kleinere Dampfer übersteigen müssen. Für denjenigen, welcher die Seekrankheit fürchten sollte, ist die Reise über Hoyerschleuse immer das geringere Übel, wenn auch dabei die Gefahr, Ägir opfern zu müssen, nie ganz ausgeschlossen ist. Von Munkmarsch führt eine vier Kilometer lange Kleinbahn nach Westerland.
Am Panderkliff vorbei lenken wir unsere Schritte nach dem freundlichen Keitum, einem etwa 870 Einwohner zählenden hübschen Orte, mit freundlichen Häusern, netten Gärten und schönen Bäumen in denselben, ein sonst für Sylt mit seinen baumlosen Heiden und wenigen vom Winde im Baumwuchse gedrückten Hainen ziemlich seltener Anblick, den wir nur an den vor dem Westwinde geschützten Stellen der Ostseite des Eilandes genießen können. Keitum hat eine schöne, dem heiligen Severinus geweihte Kirche, deren hoher Turm den Schiffern des[S. 84] Wattenmeeres als Merkzeichen gilt, und ist das Kirchdorf für Archsum, Tinnum, Kampen, Braderup, Wenningstedt und für Munkmarsch. Hier ist der berühmte schleswig-holsteinische Patriot Uwe Jens Lornsen geboren, dem sein Heimatsdorf ein hübsches Denkmal gesetzt hat, und hier befindet sich auch das Sylter Museum, eine Gründung des verstorbenen und um die Geschichte der nordfriesischen Inseln sehr verdienten Lehrers C. P. Hansen.
Wenige Kilometer von Keitum treffen wir das niedrig gelegene Dorf Archsum mit den Resten eines alten Burgwalles an, der Archsumburg, welche vom Volksmund dem Zwingherrn Limbek zugeschrieben wird. Das Dorf hatte unter der Sturmflut von 1825 viel zu leiden. Wenn wir von hier aus unsere Wanderung ostwärts ausdehnen, so betreten wir schon nach kurzer Zeit die hufeisenförmig angelegte Ortschaft Morsum mit ihrem bleigedeckten und turmlosen Gotteshause.
Über das uns schon bekannte Morsumkliff steigend, statten wir noch dem östlichsten Punkte Sylts, Näs Odde oder Nösse, einen kurzen Besuch ab. In Näs Odde befindet sich eine Eisbootstation, die wir etwas näher kennen lernen wollen. Wenn nämlich bei eintretendem starken Froste das Wattenmeer sich mit Eis überzieht, nicht mit einer zusammenhängenden Decke, sondern mit unzähligen, von den Wellen und den Strömungen stetig übereinander geschobenen Eisschollen, die zuweilen zu eisbergähnlichen mächtigen Bildungen werden, so hört die gewöhnliche Postverbindung der nordfriesischen Inseln, vermittelst der Postfahrzeuge und Dampfer auf, und das Eisboot tritt an ihre Stelle (Abb. 7 u. 8).
So gelangt dann die Post, zuweilen mit recht unliebsamem Aufenthalt von 13–14 Stunden, an ihr Ziel! Wenn die Eisdecke die nötige Festigkeit erlangt hat, um Pferde und Gefährt zu tragen und ein zusammenhängendes Ganzes bildet, dann kommt wohl auch der von Rossen gezogene Schlitten zur Postbeförderung in Betracht. Im Winter 1899–1900 sind zwischen Ballum und Röm in jeder Richtung 26 schwierige Eisfahrten verrichtet worden, zwischen Rodenäs und Näs Odde 28 ebensolche, zwischen Husum und Nordstrand 18, u. s. f.

(Nach einer Photographie im Verlag von Conrad Döring in Hamburg.)
Neun Kilometer südwärts von Westerland[S. 85] grüßen uns die wenigen Häuser von Rantum, dem südlichsten Dorfe auf der Insel, vor Zeiten ansehnlich und wohlhabend, aber durch die Fluten und die landeinwärts wandernden Dünen zu einem der ärmsten Dörfer herabgesunken. Die im Jahre 1757 aufgeführte Kirche Rantums, deren Vorgängerin schon einmal wegen Gefahr der Verschüttung durch die Sandberge abgebrochen werden mußte, war bereits 1802 zur Hälfte von den Dünen bedeckt und mußte ebenfalls wieder abgerissen werden. Am 18. Juli 1801 bestieg der Prediger zum letztenmal die[S. 86] schon vom Sande umgebene Kanzel. Auch die alte Rantumburg, auf welcher in den ältesten Zeiten die Sylter ihre Landtage abhielten, ist jetzt vom Sande begraben. Bei anhaltendem Ostwinde sollen die Spuren vergangener Dörfer, Kirchen, Wohnstellen und Brunnen draußen im Wasser vor Rantum noch deutlich zu erkennen sein.
Eine nicht minder großartige Dünenlandschaft, als der Nordflügel der Insel aufweist, zeigt auch deren südliches Ende, das bei Hörnum in einer Art Hochstrand endigt.
Daß Sylt einen verhältnismäßig geringen, nur in geschützter Lage gedeihenden Baumwuchs hat — einige Gehölzanpflanzungen, die jedoch auch an Verkrüppelung durch den Westwind leiden, sind der Viktoriahain und der Lornsenhain im Centrum der Insel —, das wurde schon angedeutet. Die Flora bietet aber sonst allerlei Interessantes und Schönes, und als besonderes[S. 87] Curiosum wird angeführt, daß alpine Formen von Enzian darunter sind.
In verflossenen Jahrhunderten hatten die Sylter, wie auch die Bewohner der anderen nordfriesischen Inseln ihre besondere Tracht, die in der Gegenwart ganz und gar abgekommen ist. „Die Weiber aber“, so hat in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts Herr Erich Pontoppidan in seinem Theatrum Daniae gemeint, „distinguieren sich durch ihre lächerliche Kleidung am allermeisten. Ihre Haare tragen sie ganz lang herabhangend, und zieren einen jeden Zopff, mit verschiedenen Messingen Ringen, Rechen-Pfennigen, und dergleichen Possen. Ihre Wämbse sind weit, und bestehen aus lauter Falten; und ihre Röcke sind gar nicht nach der Ehrbarkeit eingerichtet, indem sie kaum bis über die bloßen Knie hinunterreichen, gleich wie vormals an denen Spartanischen Weibern, denen sie sich auch an Muth und Herz gleichen.“ Die Bevölkerung Sylts zählt gegenwärtig etwa 4000 Seelen, die Zahl der im Jahre 1899 in Westerland und Wenningstedt zusammen anwesenden Kurgäste betrug 12695, im Jahre 1890 nur erst 7300.
Südlich von Sylt, südwestlich von Föhr, von der ersteren Insel durch das Fartrapp-Tief, von letzterer durch das Amrumer Tief getrennt, liegt das Eiland Amrum, 10 Kilometer lang, bis 3 Kilometer breit,[S. 88] und 30 Kilometer vom Westrande des schleswig-holsteinischen Festlandes entfernt. Amrum ist nicht mit Unrecht als kleines Sylt bezeichnet worden, mit dem es in seiner Beschaffenheit viel Ähnlichkeit hat. Dem hochliegenden (16–20 Meter über dem Meer) diluvialen Hauptkörper der Insel sind in dessen östlichen Buchten schmale, sandige Marschbildungen angelagert, eine Dünenkette folgt dem ganzen Verlaufe der Insel, und nördlich wie südlich bildet dieselbe, über dem Hauptkörper hinausragend, eine eigene Dünenhalbinsel. Die scharf abgebrochenen Ränder, die wir auf Sylt in den verschiedenen Kliffbildungen kennen gelernt haben, fehlen Amrum bis auf eine einzige Stelle an der Ostseite, wo das jüngere Diluvium sich kliffartig bis zur Höhe von 12,6 Meter aus dem Wattenmeer erhebt. Amrums Bewohner beanspruchen, der edelste Stamm unter den Friesen zu sein, bestehen aus ca. 900 Seelen und leben von Schiffahrt, Fischerei und Ackerbau. Für den Altertumsforscher besitzt Amrum großes Interesse, befindet sich doch nordwestlich von Kirchdorf Nebel und südwestlich von Norddorf die altheidnische Opferstelle des Skalnas-Thales dort. Es ist dies ein von hohen Dünenwällen eingerahmtes, von diesen aber auch schon verschüttet gewesenes 100 Schritt langes, und 80 Schritte breites Thal mit 22 verschiedenen Steinkreisen von verschiedener Form und Größe, mit und ohne Thorsetzungen, die — leider! — zum Teil beim Deichbau benutzt worden sind.
Ein gewaltiger Leuchtturm im Süden Amrums, dessen Laterne (Drehfeuer) in 67 Meter Meereshöhe leuchtet und 22 Seemeilen weit sichtbar ist, der höchste an der deutschen Nordseeküste, gewährt einen guten Überblick über das Eiland und seine Umgebung, über Föhr, die Halligen, die der Insel im Westen vorgelagerte Sandbank Kniepsand u. s. f. Im Norden stehen die Häuser von Norddorf, schon auf der südlichen Hälfte desselben das Haupt- und Kirchdorf Nebel mit der alten St. Clemens-Kirche und dem interessanten Friedhofe, und südlich davon das Süddorf. Auf Amrum sind in den jüngstverflossenen Jahren mit allem Komfort der Neuzeit ausgerüstete Badeetablissements entstanden. Dahin gehört Wittdün mit schönem Kurhaus und vorzüglich eingerichteten Gasthöfen an der[S. 89] Südseite. Von dort führt eine Dampfspurbahn die Badegäste an den Badestrand auf Kniepsand. Etwa 4 Kilometer nordwestlich von Wittdün treffen wir mitten in den Dünen, am Fuße der 29 Meter hohen Satteldüne das gleichnamige Hotel mit eigenem, durch eine Pferdebahn mit dem Gasthofe verbundenen, ebenfalls auf Kniepsand belegenen Badestrande (Abb. 23 u. 24).
Für eine direkte Verbindung Amrums mit verschiedenen Stellen der deutschen Nordseeküste während des Sommers ist bestens[S. 90] gesorgt. Dampfer der Nordseelinie vermitteln dieselbe, sowohl von Bremerhaven ab, als auch von Hamburg aus, beide Fahrten über Helgoland. Wer eine allzulange Seefahrt scheut, kann Amrum aber auch von Husum aus erreichen; diese interessantere Reise führt durch die Inselwelt der Halligen hindurch. Noch bequemer aber ist der Weg über Niebüll und Wyk auf Föhr. Die Landungsbrücke für alle Dampfer befindet sich in Wittdün.
Wesentlich anders als der Boden der drei nordfriesischen Inseln, die wir bisher kennen gelernt haben, ist der Untergrund der übrigen, hierher gehörigen Eilande beschaffen. Derselbe besteht nämlich größtenteils aus Marschboden. Föhr macht davon allerdings insofern eine kleine Ausnahme, als dessen südwestlicher Teil, etwa zwei Fünftel des ganzen Areals dieser Insel, hochliegendes Geestland, das übrige aber Marschland ist. Neben Föhr kommen hier in Betracht die Eilande Pellworm und Nordstrand und die zehn Halligen, als Oland, Langeneß-Nordmarsch, Gröde mit Appelland, Habel, Hamburger Hallig, Hooge, Nordstrandisch-Moor, Norderoog, Süderoog, Südfall. Pohnshallig hat seine Eigenschaft als selbständige Insel verloren infolge seiner Verbindung mit Nordstrand durch einen Damm, und ist nur mehr noch als ein Vorland dieses letzten Eilandes zu betrachten. Die südliche Begrenzungslinie dieser ganzen Inselwelt bildet der Hever.
Föhr hat einen Umfang von 37 Kilometer, einen Flächeninhalt von 82 Quadratkilometer und seine Marschen sind durch starke Deiche gegen den Anprall der Nordseewogen geschützt. Im Westen der Insel tritt an die Stelle des gewöhnlichen Deiches ein gewaltiger Steindeich, dessen Gesamtlänge zur Zeit über 3500 Meter beträgt. Zur Verstärkung der Deiche Föhrs, die voraussichtlich im Jahr 1900 beendet sein wird, sind 362000 Mark (als 4. und letzte Rate) in den Staatshaushaltsplan des Königreichs Preußen für 1900 eingestellt worden.

(Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
Der Flecken Wyk im Südosten ist die bekannteste und wichtigste Ortschaft der Insel Föhr, berühmt durch sein seit 1819 bestehendes Nordseebad, das in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts ein Sammelplatz der dänischen Aristokratie gewesen ist. Die Könige Christian VIII. und Friedrich VII. hielten sich gerne hier auf. Wyk ist noch immer im stetigen Aufschwung begriffen, und 1899 wurde das Bad von 5169 Kurgästen besucht. Der Verein für Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsten hat hier eine Kinderheilanstalt gegründet, ein Liebeswerk, das in erster Linie armen Kindern aus allen deutschen Gauen zu gut[S. 92] kommt, und in neuester Zeit ist an der Südseite von Föhr und nahe bei Wyk ein Nordsee-Sanatorium entstanden, das bezweckt, der leidenden Menschheit einen verlängerten Aufenthalt an der See zu ermöglichen und als Herbst- und Winterstation dienen soll.
Neben Wyk, das bei der Volkszählung von 1895 von 1154 Menschen bewohnt war, liegen noch eine große Anzahl von Dörfern auf dem im ganzen von etwa 5000 Menschen bevölkerten Eilande Föhr, so Alkersum, Boldixum, Goting, Nieblum, Övenum, Utersum u. s. f. Der höchste Punkt der Insel ist der 13 Meter hohe Sülwert bei Witsum am Südrande Föhrs. Etwas östlich davon, bei Borgsum ist ein alter Burgwall, dessen Errichtung ebenfalls auf den uns schon von Sylt her bekannten Ritter Claes Limbek, einen Vasallen König Waldemars von Dänemark, zurückgeführt wird. An Grabhügeln und anderen Denkmälern aus prähistorischer Zeit fehlt es auf Föhr ebensowenig als auf Sylt oder Amrum.
In Nieblum steht die große St. Johannis-Kirche, eine der größten Landkirchen des Landes, 58 Meter lang. Die Nordseite des Schiffes besitzt Stroh-, der übrige Teil des Gotteshauses Bleibedeckung. St. Johannis ist die Mutterkirche Föhrs, das außerdem noch im Westen, östlich von Utersum die St. Laurenti-Kirche und im Osten, in Boldixum ein dem heiligen Nikolaus geweihtes Gotteshaus hat. Eine Anzahl von Kirchen sind im Verlaufe der Zeiten durch die Fluten in die Tiefe gerissen worden, so beispielsweise die Hanumkirche, von der in einem Hause von Midlum noch Balken vorhanden sein sollen.
Das Föhringer Land ist gut bebaut; üppige Kornfelder und fruchtbare Wiesen bedecken es, und viel Wohlstand ist auf dem Eilande zu finden. Ihre reizende, durch schöne, große, in Filigranarbeit ausgeführte Silberknöpfe ausgeschmückte Nationaltracht haben die Föhringerinnen noch nicht in dem Maße abgelegt, wie die Frauen von Sylt. Die erheblichen Kosten bei der Neuanschaffung des Kleides mögen immerhin an dem allmählichen Verschwinden der Tracht auch auf Föhr Schuld tragen (Abb. 25–29).
Nordstrand und Pellworm sind Reste der großen Insel Nordstrand, welche die Sturmflut 1634 zerrissen und zerstört hat. Das übriggebliebene östliche Stück ist das heutige Nordstrand, das westliche Pellworm, ein Ueberbleibsel vom Mittelstück bildet die Hallig Nordstrandisch-Moor (vgl. hier den Abschnitt über die Sturmfluten, S. 26).
Das 8 Kilometer lange und ebenso breite Nordstrand wurde nach der Katastrophe von 1634 von Herzog Friedrich III. von Gottorp Brabantern und Niederländern zur Eindeichung überlassen, nachdem sich die von der Sturmflut übriggebliebenen früheren Bewohner zum Teil geweigert hatten, wieder auf die Insel zurückzukehren. Gegenwärtig besteht es aus 6 Kögen und wird von etwas über 2400 Menschen bewohnt. Von den vor 1634 vorhanden gewesenen Gebäuden ist nur noch die Vincenzkirche zu Odenbüll erhalten, zugleich das einzige, das die Fluten damals verschonten. Der in diesen Blättern mehrfach genannte Chronist Johannes Petrejus, gestorben 1608, war hier Pastor. Die Vincenzkirche ist ein turmloser Ziegelbau auf hoher Werft mit schöngeschnitztem Altar aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.
Pellworm ist 8 Kilometer lang und 7 Kilometer breit, von mächtigen Deichen, darunter im Westen ein riesenhafter Steindeich, umwallt. Es bildete früher ein sehr hohes Marschland, das aber infolge einer beträchtlichen Lagerung des Bodens in den letzten Jahrhunderten gegenwärtig unter gewöhnlicher Fluthöhe liegt. Das Moor unter der Marsch ist zusammengepreßt, und so wurde die Marscherde selbst allmählich dichter. An den in der Mitte der Insel belegenen „großen Koog“ gliedern sich 10 weitere, verschieden eingedeichte, aber, wie betont, von einem einheitlichen Außendeich umzogene Köge an.
Zwei Kirchspiele befinden sich auf der Insel, die alte Kirche und die neue Kirche. Die erstere, ein sehr merkwürdiges und mit verschiedenen, interessanten Kunstschätzen ausgestattetes Gotteshaus, aus dem Anfang des elften Jahrhunderts, hatte einen Turm von[S. 94] 57 Meter Höhe, der um 1611 einstürzte und dabei einen Teil der Kirche zerschmetterte. Seine stehen gebliebene Westmauer war lange Zeit hindurch ein wichtiges Seezeichen. Die Einwohnerzahl Pellworms betrug am 1. Dezember 1890 2406 Seelen.

(Nach einer Photographie von F. Schensky in Helgoland.)
Unter demselben Namen „Halligen“ umfaßt der heutige Sprachgebrauch „alle Grasländereien, die ohne den Schutz von Dämmen den Überschwemmungen durch die See ausgesetzt sind, also auch den ganzen Vorlandssaum längs der Außendeiche“, sagt Eugen Traeger, der beredte Schilderer und unermüdliche Anwalt der Halligenwelt. Mit diesem Autor beschränken wir hier diesen Ausdruck auf die echten Inselhalligen, die wir weiter oben schon namentlich aufgeführt haben. Eine elfte Hallig ist das erst im Laufe dieses Jahrhunderts neu emporgewachsene und noch unbewohnte Helmsand in der Meldorfer Bucht, eine zwölfte Jordsand bei Sylt, das nicht mehr bewohnt ist. Die Halligen sind insulare Reste des in geschichtlicher Zeit von den Sturmfluten, dem Eisgang und den Gezeitenströmungen zerrissenen Festlandes, welche das Meer ehemals im Schutze der äußeren Dünenkette abgelagert hatte. Eine Hallig steigt mit stark zerklüfteten und zerrissenen, ½–1½ Meter hohen Wänden senkrecht von dem Wattenplateau empor, welches um sie her bei Ebbe vom Meer verlassen, bei Flut aber wieder überschwemmt wird. Ihr Boden ist ganz eben, von größter Fruchtbarkeit und dicht bestanden mit einem feinen, kräftigen und außerordentlich dichten Gras (Poa maritima und Poa laxa), zwischen dessen Halmen weiß blühender Klee und die Sude (Plantago maritima) neben vielen anderen Kindern Floras gedeihen. Bei jeder Überschwemmung läßt das Meer eine Schicht feinen Schlicks auf dem Halligboden zurück und besorgt so dessen Düngung. Die Halligen nehmen also, ähnlich wie die Lande am Nilstrom, jährlich unmerklich an Höhe zu. Gräben von verschiedener Länge und Tiefe durchziehen die Halligen, bisweilen in solchem Maße, daß sie den Wattenfahrzeugen als Häfen dienen können. Wie freundliche Oasen liegen die Halligen in der grauen, öden Wüste der Wattengefilde da.
Die menschlichen Wohnstätten und Stallungen für das Vieh liegen auf Werften von etwa vier Meter absoluter Höhe, bald nur eine, bald mehrere an der Zahl, mit Gärtchen umgeben. Bei den Häusern befindet sich der „Fething“ genannte Teich, welcher zum Auffangen der Niederschläge dient und im Falle der Not mit seinem Wasservorrat auszuhelfen hat. Aus dem Fething werden auch die Wassertröge für das Vieh gespeist. Das Wasser für den menschlichen Gebrauch wird in etwa zehn[S. 95] bis zwölf Fuß tiefen, aufgemauerten Cisternen gesammelt (vergl. Abb. 9 u. 10, sowie Abb. 31–35).
Eigenartig ist die innere Einrichtung der mit Rohrschauben bedeckten, ziemlich hochgiebligen Häuser mit ihren holzverschalten oder mit Kacheln verkleideten Zimmerwänden, ihren durch Thüren abgeschlossenen Bettnischen, der reinlichen Küche u. s. f. Eine berühmte Hallighauswohnstube birgt das Könighaus auf Hooge, den „Königspesel“, so genannt nach Friedrich VI. von Dänemark, der hier im Jahre 1825 einige Tage zugebracht hat.
Die Halligbewohner sind von ungeheuchelter Frömmigkeit und bemerkenswerter Wohlanständigkeit, ihre Frauen züchtig, ehrbar und freundlich, dagegen von etwas schwerfälliger Bedächtigkeit, so daß es, wie Traeger bemerkt, fast unmöglich erscheint, sie zu Privatleistungen zu bewegen, bei denen gemeinsames Handeln unter Aufbietung persönlicher Opfer im allgemeinen Interesse erforderlich ist. „Das ist ihr Hauptfehler, ihr nationales Unglück, welches sie im Kampfe mit den Fluten der Nordsee durch schreckliche Verluste an Menschenleben, Land und beweglicher Habe gebüßt haben.“ Ihre hauptsächlichste Beschäftigung bilden die Viehzucht und die Schiffahrt. Die Männer der Halligen sind geborene Seeleute und sollen in dieser Beziehung von keinem Volk der Erde übertroffen werden. Im achtzehnten Jahrhundert blieb kein Mensch, der gesunde Glieder hatte, zu Haus: gleich im Frühjahr verschwand die ganze männliche Bevölkerung und ging aufs Schiff, um erst um Weihnachten heimzukehren. Mancher freilich hat die Heimat nicht wieder gesehen. Mitsamt den Männern von Amrum, Föhr, Sylt und den Nachbarinseln lieferten die Halligleute vorzugsweise die Bemannung der nach Indien, China oder ins Eismeer zum Walfischfang fahrenden Schiffe. Viele brachten es zu hohen Ehren und großem Reichtum, aber zäh und fest hingen sie doch immer mit allen Fasern ihres Herzens an ihrer Heimat.
Eine kleinere Erwerbsquelle für die Halligbewohner bildet auch der Porren-(Krabben-)fang. Jede Hallig hat ihren Porrenpriel, woselbst diese kleinen Krebse, besonders in der Zeit nach der Heuernte bis[S. 96] zu Anfang November vermittelst eines besonders dazu konstruierten Netzes gefangen werden. Man nennt diesen Vorgang das Porrenstreichen. Die Fische fängt man in sogenannten Fischgärten, Faschinenreiser, die in der Gestalt eines langschenkligen Winkels auf geneigten Wattenflächen in den Boden gesteckt werden und am Scheitelpunkte des Winkels einen mit einem Netz in Verbindung stehenden Durchlaß haben. Die in die Einhegung geratenen Fische ziehen sich bei eintretender Ebbe immer weiter nach dem Durchlaß hin zurück und geraten schließlich ins Netz. In der Gegenwart soll diese Art der Fischerei immer mehr abkommen. Dagegen pflegt man mit dem Stecheisen die Plattfische aufzuspießen, und in den schlammigen Halliggräben die darin befindlichen Fische, besonders Aale, mit der Hand zu greifen.

(Nach einer Photographie von Max Wichmann in Harburg.)
Die Jagd auf Vögel (Regenpfeifer, Austernfischer, wilde Enten, Gänse u. s. f.) wird selten mehr mit dem Netz, sondern durch Schießen ausgeübt, mit besonderem Erfolge bei Nacht, indem man die Vögel durch den Schein einer brennenden Laterne anlockt. Das systematische Einsammeln der Vogeleier (Möven, Enten u. s. f.) verschafft den Halligbewohnern gute Einnahmen. An den Rändern der Wasserflächen befinden sich zahllose Nester, und von hier holen sie sich ihre Ernte an Eiern und Jungen. Auf Süderoog soll es besonders von Vögeln wimmeln. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts war die Menge dort so groß, daß die kleinen Leute auf Pellworm fast den ganzen Sommer hindurch davon leben konnten. Ganze Massen davon wurden ferner auf das Festland gebracht und dort von den Bauern als Schweinefutter verwendet. Des weiteren sind die Halligbewohner nicht selten geschickte Seehundsjäger; der Schiffszimmermann Holdt auf Hooge hat im Jahre 1891 80 Stück davon erlegt, deren Durchschnittsertrag sechs Mark war, so daß ihm eine Bruttoeinnahme von 500 Mark daraus erwachsen ist (Abb. 36 u. 37).
Die längste der Halligen ist Langeneß-Nordmarsch; nach der Vermessung von 1882 betrug ihr Areal etwa 1025 Hektar, gegenüber 1179 Hektaren, die sie bei derjenigen von 1873–1874 noch besaß. Norderoog, mit 16,96 Hektaren (gegenüber 22,72 Hektaren 1873–1874) ist die kleinste. In der Gegenwart hat die preußische Regierung die Fürsorge für die fernere Erhaltung dieser kleinen Inseln, die schon deshalb besonders geschützt werden müßten, weil sie die Wellenbrecher für das Festland bilden, besonders im Auge. 1896 bewilligte der Landtag hierfür die Summe von 1320000 Mark. Ein großer Teil des Verdienstes, das mit veranlaßt und herbeigeführt zu haben, mag wohl dem Sekretär der Handelskammer zu Offenbach a. M., Dr. Eugen Traeger gebühren, der unablässig dafür eingetreten ist. So hat in den jüngstverflossenen Jahren Oland mächtige Dämme mit schwerer Steindecke und Busch und Pfahlbuhnen erhalten, und nicht minder großartige Dämme wurden zur Verbindung dieser Insel mit dem[S. 97] Festlande bei Fahretoft (Kosten 408000 Mark) und mit Langeneß (Kosten 207000 Mark) in die See gebaut, zum Teil unter unsäglichen Schwierigkeiten, denn die Strecke Oland-Fahretoft hat allein im Jahre 1898 infolge schwerer Beschädigung durch die Wellen an 100000 Mark Ausbesserungskosten verursacht und mußte in ihrer Anlage etwas verändert werden. Die Herstellung der Olander Dämme, deren Sohlenbreite 10 Meter beträgt, die sich zu einer Kronenbreite von 4 Metern verjüngt, an besonders exponierten Stellen aber, so am Olander Tief 7½ Meter groß bleibt, hat rund 90000 Kubikmeter Faschinen, 100000 laufende Meter Würste aus Busch- und Pfahlwerk, 200000 Stackpfähle zur Befestigung und 4000 Kubikmeter Felsbelag erfordert, von der massenhaft verwendeten Erde ganz zu schweigen. Zur Zeit haben auch die Arbeiten zum Schutze der Insel Gröde ihren Anfang genommen, und man war im Frühjahr 1900 damit beschäftigt, an denjenigen Stellen Erde auszuheben, wo die Steindossierung angelegt werden soll.
Über Hooge läuft das Kabel, das von Amrum, Pellworm und Nordstrand nach dem Festland führt. Hooge ist auch die einzige der Halligeninseln, die außer Kirche und Pfarrhaus noch ein eigenes Schulhaus besitzt. Die Kirchen sind einfache Gebäude, ohne Turm, mit dem Giebel von Osten nach Westen gerichtet, wie alle Gebäude auf den Halligen, daneben ein kleines hölzernes Glockentürmchen. Im Inneren sind Gänge und Altarraum mit Ziegelpflaster versehen, der übrige Raum ist mit Meeressand bedeckt, Bänke, Kanzel und Altar sind bescheiden ohne viel Schmuck. Dem Langenesser Gotteshaus fehlt das Glockentürmchen an der Seite; das Zeichen zum Beginn des Gottesdienstes wird hier mit der Kirchenflagge gegeben. Von besonderem Interesse sind auch die Friedhöfe mit manchen alten Grabsteinen und bemerkenswerten Inschriften darauf. Den alten Kirchhof von Nordstrandisch-Moor haben die Wellen zerstört, und aus dem tiefen Schlamm schauen die Reste der Särge und die Skelette der Toten hervor. Auf verschiedenen Halligen sind Schulen; wo das nicht der Fall ist, da werden die schulpflichtigen Kinder in Pension gegeben.
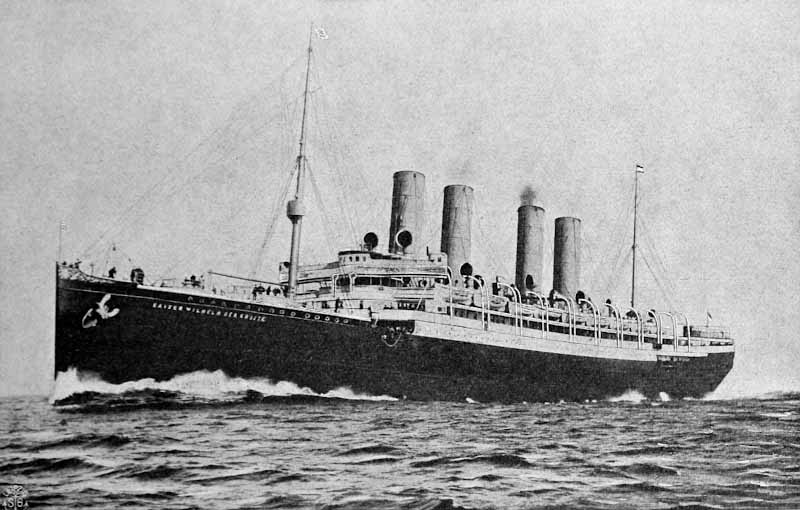
(Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
Die Postverbindung mit den Halligen[S. 98] erfolgt über Husum-Nordstrand, von hier weiter durch einen Postschiffer zwei- bis dreimal in der Woche. Bei starken Stürmen oder bei schwerem Eisgang erleidet dieselbe natürlich allerlei Unterbrechungen von kürzerer oder längerer Dauer. Dies war beispielsweise im Winter 1888 der Fall, wo man auf Hooge und Gröde noch am 22. März den 91. Geburtstag des damals schon seit 14 Tagen entschlafenen Kaisers Wilhelm I. feierte. Die Telegraphenverbindung Hooges mit der Festlandküste war damals noch nicht vorhanden.

(Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
IX.
Eiderstedt.
Südlich von Husum, zwischen dem vom Heverstrom durchzogenen Teil des Wattenmeeres im Norden und der Eidermündung in ihrer heutigen Gestalt, sowie den Ditmarscher Gründen im Süden, westlich von der Nordsee begrenzt, dehnt sich die erst in historischen Zeiten mit dem Festland verbundene Landschaft Eiderstedt aus. Politisch bildet dieselbe den 330,5 Quadratkilometer umfassenden, gleichnamigen Landkreis, dessen Bewohnerzahl nach der Volkszählung vom 2. Dezember 1895 15788 Seelen betrug, was einer Volksdichte von etwa 49 Menschen auf dem Quadratkilometer gleichkommt. Eiderstedts Boden besteht größtenteils aus dem besten Marschlande, und der dortige Klei ist, um mit Pontoppidan zu reden, „eine Mutter des wohlriechenden und großen, kräftigen Wiesen-Klees: daher in Eiderstedt die vortrefflichsten Meyereyen anzutreffen, und soll eine Kuh des Tages 16 à 18 Kannen der allerbesten Milch ausgeben können; daher die Eiderstedtische Butter und Käse in sehr großer Menge außerhalb Landes verführet wird“. Nach aus dem Anfang des siebzehnten Jahrhunderts datierenden Zollabrechnungen wurden jährlich an dritthalb Millionen Käse nach Hamburg, Bremen und sogar nach Amsterdam versandt.[S. 99] Und was der Autor des Theatrum Daniae vor nunmehr 170 Jahren schrieb, hat auch noch heute volle Geltung. Es geht die Rede, daß nach dem Garten Eden Eiderstedt der schönste Fleck auf Gottes weiter Erde sei. Für den Eiderstedter Bauern mag diese Auffassung sicherlich ihre Berechtigung haben. Behauptet doch ein landesübliches Sprichwort, daß ein solcher Landmann von echtem Schrot und Korn weiter nicht viel mehr zu thun habe, als: Slopen, Äten, Supen, Spazierengahn und — ordentlich zu verdauen. Das letzte Reimwort im Originaltext richtig wiederzugeben, verbietet mir hier der Anstand.

(Nach einer Photographie im Besitz des Norddeutschen Lloyd.)
Eigentliche Bodenerhebungen gibt es im Inneren Eiderstedts kaum. Seine Küstenlinie umzieht der grüne Wall der Seedeiche, und Binnendeiche trennen die zu verschiedenen Zeiten dem Meere abgetrotzten Köge voneinander. Ebensowenig wird man von der Natur geschaffene Vertiefungen hier finden und vergebens nach Flüssen, Bächen oder Seen suchen. Aber Graben- und Wasserzüge durchqueren Eiderstedt allenthalben und schaffen die viereckige Landeinteiluug der Fennen. Wenn der Bauer über Land geht, so führt er den „Klüwerstock“, einen vier bis sechs Ellen langen Springstock, mit sich, mit dessen Hilfe er über diese Gräben hinwegsetzt. Frauen, Kinder und Landfremde müssen aber den Fußsteigen folgen, die oftmals erst über lange Umwege zum Hause des Nachbarn führen. Einen Gang durch Eiderstedt hat Professor Meiborg in Kopenhagen in gar anziehender Weise mit folgenden Worten geschildert: „Wir gehen landeinwärts. Der Kuckuck ruft, solange der Tag währt, und die Lerche schlägt ihre Triller. Eine zahllose Menge von Pferden und Rindern grast auf den Weiden; ausgedehnte Strecken sehen von der Anzahl des Viehes aus, wie ungeheure Marktplätze. Bald fesseln das Auge einzelne Tiere, bald ziehen es einzelne Gruppen an, die sich um die Scheunenplätze gesammelt[S. 100] haben. Mehr in der Ferne sehen sie aus wie bunte Flecke auf dem grünen Teppich, die, je weiter der Blick geht, desto enger zusammenrücken. — Sonst läßt sich die Landschaft mit einem englischen Park von ungemessener Größe vergleichen: auf meilenweiter Grasfläche, die wie ein einziger wundervoll herrlicher Rasen erscheint, hingesäet liegen die Gehöfte, wie im Gehölze halb versteckt, hinter Gruppen prächtiger Eschen, und der Kranz dieser Haine vereinigt sich am Gesichtskreis wie in einen einzigen zusammenhängenden Wald.“
In der Nähe der Küste ist das Landschaftsbild zuweilen ein etwas anderes, denn die jüngsten Köge sind teilweise noch von Sümpfen eingenommen und stehen in Regenzeiten manchmal sogar unter Wasser. In trockenen Sommern aber erscheinen sie dann auf weite Strecken hin als nackte Lehmflächen, die von modernden Algen weiß und blaurot gefärbt sind und dann in grellem Kontraste mit dem sonst so üppigen Pflanzenwuchse stehen. Zahlreiche Schafherden weiden hier, und eine Menge von Möven (Abb. 39), Kiebitzen, Regenpfeifern und anderen Strandvögeln halten sich hier auf.
Große Strecken Landes haben seit undenklichen Zeiten nur als Weideplätze gedient, und da dem Landmann, welcher nur Viehzucht treibt, ein viel leichteres und angenehmeres Leben blüht, als dem Ackerbauern, so hat das weiter oben angeführte Verslein natürlich in erster Linie auf jenen Bezug. Soll doch das fette Eiderstedter Gras sogar dem Hafer an Mastwert gleichkommen. Jährlich werden hier etwa 3000 bis 4000 Stück Fettvieh und eine bedeutende Zahl von Schafen hervorgebracht, welche meistenteils nach Husum auf den Markt wandern. Bei der Zählung am 10. Januar 1883 betrug der gesamte Viehstand des Kreises 2522 Pferde, 13304 Rinder, 24453 Stück Schafe und 1322 Schweine.
In vergangenen Zeiten hatte Eiderstedts Viehzucht nicht wenig unter Ueberflutungen zu leiden gehabt, so daß das Vieh unter unaufhörlichem Gebrüll ruhelos auf den Fennen herumwaten mußte und kein trockenes Plätzchen zum Hinliegen finden konnte. Seitdem aber das Sielwesen im Lande so verbessert wurde, ist das anders geworden. Auch die Rinderpesten haben zuweilen viel Schaden gebracht, so besonders im Jahre 1745, wo wiederholt binnen wenigen Wochen fast der ganze Viehstand fiel.
Nicht minder lohnend als die Viehzucht ist aber auch der Ackerbau im Lande Eiderstedt, wenn auch sehr viel mühsamer und beschwerlicher. Denn in trockenem Zustande ist der schwere Kleiboden so hart, daß der Pflug kaum hindurchkommen kann, und bei Regenwetter wiederum wird die Erde so weich, daß es den Pferden nur bei allergrößter Anstrengung möglich ist, sich hindurchzuarbeiten. Bisweilen müssen ihrer sechs am Pfluge ziehen, und dann müssen die Schollen doch noch hier und da mit Schlägeln zertrümmert werden. Dafür steht aber in guten Jahren das Korn so dicht und stark, daß es mit der Sichel geschnitten werden muß, und der Hafer 30-, die Gerste 44fältig trägt; vom Raps geben 20 Kannen Aussaat 150–200 Tonnen Ertrag. „Wer,“ so schreibt Meiborg weiter, „von den angrenzenden Harden des mittleren Schleswigs, die den magersten Sandboden haben, herüberkommt nach Eiderstedt, dem erscheint es, als komme er in ein ganz anderes Land, und er versteht wohl die Äußerung des alten eiderstedtischen Bauern, der zu seinem wanderlustigen Sohne sagte: ‚Hier ist die Marsch; die ganze übrige Welt ist nur Geest; was willst du doch in der Wüste?‘“
Der wohlhabende Eiderstedter Bauer ist eine stattliche Erscheinung und soll noch heutzutage, wie vorzeiten seine Ahnen etwas phlegmatisch angelegt sein und mit einer gewissen Geringschätzung auf Leute anderen Berufes und anderer Herkunft herabschauen.
Große, hochgiebelige Häuser, sogenannte Hauberge, sind die Wohnstätten des Eiderstedter Landmannes. Im Verlaufe des siebzehnten und des achtzehnten Jahrhunderts kamen sie in Eiderstedt immer mehr auf und verdrängten nach und nach den bisher im Lande üblich gewesenen Haustypus, den man im übrigen schleswigischen Frieslande noch allgemeiner findet, und der in der Gegenwart im Eiderstedtischen bis auf ganz wenige vereinzelte Überreste vollständig verschwunden zu sein scheint. Ein berühmtes Beispiel eines Haubergs steht an der Nordküste, nahe bei Husum; es ist der sogenannte[S. 102] „rote Hauberg“, einer der ältesten im Lande und wohl schon in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts errichtet. Es unterscheidet sich derselbe übrigens in manchen Einzelheiten von seinen Genossen, so durch seine zwei Hauptthüren, seine beiden Dachgiebel, durch die eigentümlichen Verzierungen seiner Thüreinfassungen und noch durch anderes mehr. Im Volksmunde heißt er auch der Hauberg mit den 100 Fenstern, und die Sage nennt den leibhaftigen Satan als seinen Baumeister.
Denselben Anstrich von prunkendem Reichtum, den das eiderstedtische Haus in seinen äußeren Teilen zeigt, besitzt es meist auch in seinen inneren Räumen. Der Fremde, der dort willkommen geheißen wird, kann sich des Gefühles nicht erwehren, als ob er bei einem Landedelmann zu Gaste wäre.
Über die Sitten und Gebräuche der Eiderstedter in dahingeschwundenen Tagen ließe sich recht viel Interessantes berichten. Leider aber mangelt uns der nötige Platz hierfür. Immerhin mag hier noch die Blutrache Erwähnung finden, die noch lange Zeit nach der Einführung des jütischen Gesetzbuches Waldemars des Siegers in den Marschlanden vorgeherrscht hat. Ein vor nicht gar langer Zeit im roten Hauberg entdecktes Gefängnis, ein unterirdisches Verließ mit Pfahl, Ketten und Halseisen erinnert an diese schreckliche Sitte. Rings auf den Bauernhöfen gab es ähnliche Kerker, in denen man Angehörige des Getöteten, die man am Leben lassen wollte, in Ketten gefangen hielt, bis die Mannbuße für sie gezahlt war.
Verhältnismäßig gute Landstraßen und die Bahnlinie Husum-Tönning-Garding sind die Adern des Verkehrs in Eiderstedt. Große Städte hat es nicht; die größte, Tönning, zugleich Sitz des Landrats, hat etwa 3300 Einwohner. Sie liegt an der Eider, nur wenige Meilen von deren Mündung entfernt, und hat einen 1613 von Herzog Johann Adolph mit großem Kostenaufwand angelegten, früher recht bedeutenden Hafen, der an 100 Schiffe mittlerer Größe, deren Tiefgang nicht mehr als elf Fuß betrug, fassen konnte. In der Gegenwart kommt derselbe nicht mehr in Betracht, und von dem lebhaften Handel, den sie ehemals betrieb, ist in der recht still gewordenen Stadt wenig mehr zu merken. Am 1. Januar 1891 war ihr Schiffsbestand sechs Segler und acht Dampfschiffe groß, mit insgesamt 5081 Registertons Rauminhalt (Abb. 12). Besondere Berühmtheit in der Kriegsgeschichte Schleswig-Holsteins hat Tönning durch das Bombardement im April 1700 erlangt — die Dänen unter dem Herzog von Württemberg warfen damals 11000 Bomben und 20000 Kugeln in die Stadt — und durch die unter ihren Mauern am 16. Mai 1713 erfolgte Kapitulation des schwedischen Generals Steenbock nach seinem bekannten Übergang über die vereiste Eider.
Am Endpunkte der Bahn steht Garding, eine kleine, kaum 1700 Einwohner zählende Stadt, die Heimat des Historikers Theodor Mommsen. Von hier aus gelangt man auf guten Wegen nach Tating, dessen Umgebung von der Sturmflut im Jahre 1825 hart mitgenommen wurde, und wenn man noch weiter westwärts zieht, zu dem durch den langen Dünenwall der Hitzbank geschützten Kirchdorfe St. Peter. Hier hat sich im Verlaufe der jüngsten Jahre ein kleiner Nordseebadeort entwickelt, der zweifelsohne einer günstigen Zukunft entgegensieht. Beinahe ganz in Eiderstedts Nordwestecke treffen wir auf das Kirchspiel Westerhever, einen Teil der in den Fluten vergangenen Insel Utholm. Die älteste Kirche des Dorfes soll um 1362 von den Wellen der See weggespült worden sein.
X.
Die schleswig-holsteinische Westküste von der Eider bis Hamburg-Altona.
Die lange Küstenstrecke von der Eider bis Hamburg wird durch eine Anzahl von Eisenbahnlinien durchzogen, die meist in den letzten Jahrzehnten entstanden sind und viel dazu beigetragen haben, diese bis dahin ziemlich abgelegenen Lande dem Reiseverkehr zu erschließen. Die Hauptlinie, die Marsch- oder Westbahn, zweigt in Elmshorn von der Bahnlinie Altona-Vamdrup, der verkehrsreichsten Ader in den Herzogtümern ab. Über Glückstadt, Itzehoe, Meldorf, Heide und Friedrichstadt erreicht sie Husum, Tondern und geht jenseits der Grenze in die Bahn nach Ripen über. Von Husum bis nach Jütland hinauf ist uns die Strecke ja schon bekannt geworden.[S. 104] An die Marschbahn schließen sich nun mehrere Zweiglinien an, so in Husum diejenige nach Eiderstedt (Garding über Tönning), die uns ebenfalls schon bekannt ist, und die die Marschbahn mit der Hauptlinie bei Jübek verbindende Strecke. Bei Heide mündet ein weiterer Verbindungsstrang mit dieser letzteren, der bis Neumünster läuft und bei Grünenthal den Kaiser Wilhelm-Kanal vermittelst einer schönen Hochbrücke überquert, von der im folgenden noch einiges gesagt werden soll. Nach Westen zu setzt sich diese Linie über Wesselburen bis nach Büsum fort. In St. Michaelisdonn steigen die Reisenden für Marne und den Friedrichskoog um, eine andere nur kurze Zweigbahn verbindet die Hafenanlagen des ebenerwähnten Kanals an den Brunsbütteler Schleusen mit der Station St. Margareten, und von Itzehoe aus ist die Hauptlinie ebenfalls wieder über die Strecke Lockstedt-Kellinghusen-Wrist zu erreichen. Endlich besteht eine von Altona bis nach Wedel reichende Bahnlinie über die Ortschaften am rechten Elbufer.
Der nördliche Teil unseres Gebietes gehört noch zum Kreis Schleswig, der hier weit nach Westen übergreift, dann folgen Norderditmarschen, Süderditmarschen, Steinburg und Pinneberg. An der Zusammensetzung des Bodens nehmen sowohl Geest, als auch Marsch teil, in dem von uns zu besprechenden Küstenareal in vorwiegender Weise die letztere, die aus einer größeren Menge der fruchtbarsten Köge besteht, so der Sophienkoog, der Kronprinzenkoog, der Friedrichskoog (so genannt nach König Friedrich VII. von Dänemark) auf der früheren, jetzt zur Halbinsel gewordenen Insel Dieksand, der Kaiser Wilhelm-Koog, u. s. f. Daran schließen sich südlich die holsteinischen Elbmarschen, und zwar im Kreise Steinburg die im zwölften Jahrhundert von Holländern und Flamländern eingedeichten Wilstermarsch und die Krempermarsch, und dann noch weiter nach Süden die Haseldorfer Marschen.
An der Mündung der Treene in den Eiderstrom liegt Friedrichstadt, mit 2350 Einwohnern, 1621 nach holländischer Art im Viereck mit regelmäßigen und gerade verlaufenden Straßen von Herzog Friedrich III. von Gottorp gebaut. Die Hoffnungen ihres Begründers, daß sie einmal einer der ersten Handelsplätze in seinen Landen werden sollte, hat die Stadt im Laufe der Zeit unerfüllt gelassen. Ihre ursprünglichen Bewohner waren holländische[S. 105] Remonstranten, sogenannte Arminianer, die ihr Vaterland aus Glaubensgründen verließen, und in der Gegenwart noch gibt es hier eine remonstrantisch-reformierte Gemeinde neben der lutherischen. In den verflossenen Jahrzehnten hat Friedrichstadt einen nicht unbedeutenden industriellen Aufschwung zu verzeichnen gehabt (Knochenmehl-, Kunstdünger-, Seifenfabriken), in der Kriegsgeschichte der Herzogtümer ist es durch den Kampf, der am 4. Oktober 1850 zwischen den Dänen und den Schleswig-Holsteinern unter seinen Mauern ausgefochten wurde (der Friedrichstädter Sturm), bekannt.
Hier führt eine lange Brücke über die Eider (Ägidora, Ögysdyr, das heißt Meeresthor, Thor des Meergottes Ägir), die wir bereits von Tönning her kennen. Schon auf holsteinischem Boden liegt das alte Lunden, ein Flecken in Norderditmarschen, mit 4000 Seelen, in sandiger Gegend, am Rande der Marsch. In den vergangenen Tagen des freien Ditmarschens war es einmal ein reicher und wichtiger Punkt für Handel und Verkehr, nunmehr ist es ein stiller Ort. Joachim Rachel, der bekannte Satirendichter, hat im Jahre 1618 das Licht der Welt hier erblickt. Nicht weit davon ist das alte Kirchdorf Weddingstedt mit seiner dem heiligen Andreas geweihten Kirche, welche nächst derjenigen Meldorfs die älteste Ditmarschens ist. Heide, mit 7500 Einwohnern ist die Hauptstadt Norderditmarschens und war nach Meldorf die zweite der ehemaligen Bauernrepublik, in deren Gebiet wir uns befinden. Riesig, 27000 Quadratmeter groß, ist der Marktplatz von Heide, auf dem seit 1434 die Landesversammlungen gehalten wurden. Auch heute herrscht noch rühriges Leben in der Stadt, welche sich rühmen darf, des Landes Schleswig-Holsteins größten Lyriker, den erst 1899 zu Kiel verstorbenen Dichter Klaus Groth, hervorgebracht zu haben.
Westlich von Heide erhebt sich auf großen Werften das alte Wesselburen mit etwa 6500 Einwohnern, ein seines bedeutenden[S. 106] Kornhandels wegen wichtiger Ort. In der Geschichte der deutschen Litteratur steht Wesselburens Namen vorne an. Dort wurde am 18. März 1813 der Mann geboren
Ein einfaches Denkmal mit der Büste des Geistestitanen erinnert an Friedrich Hebbel. Das Haus seiner Eltern steht nicht mehr, wohl aber noch die ehemalige Kirchspielvogtei, in deren dumpfer Schreiberstube der Dichter geduldet und gelitten hat, bis er, einem jungen freigelassenen Adler gleich, seinen Flug anheben konnte in die weite Welt, die er mit seinem Ruhm erfüllen sollte. Draußen an der See liegt Büsum, der alte Rest eines großen Kirchspiels, das in vergangenen Jahrhunderten südwestlich sich ausgedehnt hat, aber größtenteils von den Fluten verschlungen worden ist.
Später setzte sich dafür wieder an einer anderen Stelle Land an, und mit der Zeit wurde Büsum mit dem festen Lande verbunden. Auf der ehemaligen, in der Gegenwart ebenfalls landfest gewordenen Insel Horst befindet sich ein vielbesuchtes Seebad. Es wird an der dortigen Küste der Krabbenfang in großem Maße betrieben, von Büsum allein zur Zeit durch nicht weniger als 36 Fahrzeuge, denen sich im Sommer noch ein dazu erbautes Dampfschiff zugesellen wird. Büsum ist die Heimat des bekannten Chronisten aus dem Beginn des siebzehnten Jahrhunderts, Neocorus.
Im Süden von Heide gelangen wir bei Hemmingstedt auf das bekannte Schlachtfeld vom Jahre 1500, auf welchem sich seit wenigen Monaten ein Erinnerungsdenkmal an den großen Sieg der Ditmarscher erhebt. Vor vierzig Jahren wurde[S. 107] hier auch Erdöl gewonnen, das im Jahre 1856 bei Anlaß einer Brunnenbohrung in den daselbst ziemlich nahe an die Erdoberfläche tretenden Kreideschichten zufällig entdeckt worden war. Das mit der Ausbeutung dieses Vorkommens beschäftigte Unternehmen stand längere Zeit hindurch in Blüte und das Erdöl von Heide erhielt sogar auf der Weltausstellung zu London im Jahre 1862 eine ehrenvolle Auszeichnung. Der Betrieb konnte wegen der immer mehr zunehmenden Konkurrenz des billigeren amerikanischen Petroleums später nicht mehr aufrecht erhalten werden, und auch ein weiterer, im Jahre 1880 unternommener Versuch der Erdölgewinnung mußte leider scheitern.
Meldorf ist das vormalige Melinthorp oder auch Milethorp. Noch bis in das sechzehnte Jahrhundert hinein besaß die Stadt einen Hafen, der aber nunmehr an eine halbe Meile von ihrem Weichbild entfernt ist. Das sehr gemütliche Städtchen zählt zur Zeit etwa 4000 Einwohner und ist auf der Geest, dicht am Marschrande erbaut (Abb. 40). Schon um 1259 hatte Meldorf Stadtrecht erhalten, sank aber nach der Eroberung von Ditmarschen zum Flecken herab, um 1870 aufs neue zum Range einer Stadt erhoben zu werden. Hier tagten in alten Zeiten die Landesversammlungen der Bauernrepublik. Man rühmt der Kirche Meldorfs nach, nunmehr die schönste in den schleswig-holsteinischen Landen zu sein, nachdem sie in den jüngstverflossenen Jahrzehnten einer gründlichen Reparatur unterworfen gewesen ist. Sie ist schon sehr alt, und der erste[S. 108] Bischof von Bremen, Willehad, soll sie um 780 begründet haben. Dann befindet sich in Meldorf noch der aus Lehe bei Lunden hierher gebrachte Pesel des ersten ditmarschen Landvogts Markus Swyn, mit wundervollen Schnitzereien und herrlichen Möbelstücken. Ferner ist auch die alte berühmte, aus dem sechzehnten Jahrhundert stammende Gelehrtenschule zu erwähnen, die sich heute noch des besten Rufes erfreut. Im Pastorate Meldorfs wurde der Reformator Heinrich von Zütphen gefangen genommen, um nach Heide gebracht und daselbst als Märtyrer verbrannt zu werden. Heinrich Christoph Boje, der bekannte Hainbunddichter, ist in Meldorf geboren, und der weitberühmte Reisende Karsten Niebuhr, der Vater des Historikers, hat hier gelebt.

(Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
Südwestlich von Meldorf, mitten im fetten Marschlande, an der Zweigbahn St. Michaelisdonn-Friedrichskoog liegt das[S. 109] große Kirchdorf, resp. der Flecken Marne (2600 Einwohner), der bedeutenden Kornhandel treibt, für welchen der Neudorfer Hafen an der Elbe, südlich von Marne, von Bedeutung ist. Zwei große Männer des Landes sind hier zur Welt gekommen, der Germanist Karl Müllenhoff in Marne selbst, und im ganz nahebei belegenen Fahrstedt der Theologe Klaus Harms, weiland Propst in Kiel und ein weithin bekannter Kanzelredner und Menschenfreund.
Brunsbüttel mit Brunsbüttlerhafen war bis vor wenigen Jahren ein kleiner für die Kornausfuhr wichtiger Hafenort an der Elbe, der mehr als einmal in verflossenen Jahrhunderten durch die Wasserfluten zu leiden gehabt hat. Im Jahre 1676 war der ganze Flecken mitsamt der Kirche davon zu Grunde gerichtet worden. Durch die Einmündung des Kaiser Wilhelm-Kanals in die Elbe nahe beim Orte hat Brunsbüttel nunmehr erhöhte Bedeutung gewonnen. Gewaltige Schleusenanlagen bezeichnen den Anfang dieser 98,65 Kilometer langen, durchschnittlich etwa neun Meter tiefen Wasserstraße, die mit zwei großen weit in die Elbe bis zur Fahrwassertiefe hinausgebauten Molen beginnt. Die Schleusenhäupter selbst liegen 250 Meter hinter der Deichlinie zurück, so daß dadurch ein geräumiger, nach innen trichterförmig verlaufender Vorhafen geschaffen worden ist. Um den Wasserstand im Kanal regulieren zu können und denselben von den Einflüssen der durch Ebbe und Flut hervorgerufenen Schwankungen des Wasserstandes der Elbe unabhängig zu machen — bei Brunsbüttel beträgt der Unterschied zwischen mittlerem Niedrig- und mittlerem Hochwasser 2,8 Meter —, sind große Schleusen mit zwei nebeneinander liegenden Schleusenkammern von 150 Meter nutzbarer Länge und 25 Meter Breite erbaut, deren eiserne Thore durch hydraulische Maschinen bewegt werden. Da, wo bei Grünenthal die westholsteinische Bahn Neumünster-Heide die Kanallinie überquert, spannt sich eine großartige eiserne Bogenbrücke von 156,5 Meter Stützweite, deren Unterkante 42 Meter hoch über dem mittleren Kanalwasserspiegel liegt, über diese ebengenannte Wasserstraße, mit ihrer Schwester bei Levensau, welche zur Überführung der Bahn Kiel-Eckernförde-Flensburg über den Kanal dient, wahre Wunder der Brückenbaukunst. Neben der eminenten strategischen Bedeutung des Kanals besitzt derselbe eine kaum minder große für die Handelsflotte. Der Verkehr der Handelsschiffe auf demselben nimmt seit den fünf Jahren seiner Eröffnung ständig zu und diese Wasserstraße trägt ungemein viel zur Förderung des sich mehr und mehr entwickelnden Schleppschiffverkehrs aus der[S. 110] Nord- in die Ostsee und umgekehrt bei (Abb. 41–45).
Etwas südöstlich von Brunsbüttel liegt St. Margareten. Von hier aus wird in einer knappen halben Stunde das Dorf Büttel mit der bekannten Elblotsenstation der „Bösch“ erreicht. Besteigen wir in St. Margareten wieder den Bahnzug, so erscheint bald nach Eddelak und dem flachen Kudensee die kleine in der Anlage und Bauart ihrer Häuser an Holland gemahnende Stadt Wilster (ca. 2750 Einwohner) in der Wilstermarsch. Charakteristisch für diese Landschaften sind die zahlreichen Windmühlen, welche angelegt wurden, um das von der Geest zur Marsch herniederströmende Wasser mittels Schnecken aus den Laufgräben in die Abzugskanäle zu heben. Der größte Teil der Wilstermarsch liegt nämlich auf Moorgrund, und durch die fortschreitende Entwässerung und Trockenlegung dieses letzteren senkte sich allmählich der darüber liegende Marschboden, und zwar so tief, daß derselbe jetzt unter dem Wasserspiegel der Elbe liegt. In den Häusern der Wilstermarsch läßt sich holländischer Einfluß nachweisen; dieselben nehmen insbesondere noch unser Interesse dadurch in Anspruch, als der Rokokostil Eingang darin gefunden hat, ohne jedoch die bäuerliche Behaglichkeit zu beeinträchtigen. Die übrigen Elbmarschen Schleswig-Holsteins weisen echte Sachsenhäuser auf, sogar die schönsten und reichsten in den Marschlanden überhaupt.
Wir werfen noch einen kurzen Blick auf das kleine in blauer Ferne auf hohem Geestrande thronende Burg und eilen dann weiter nach Itzehoe (Abb. 46). Ein buntes und bewegtes Bild heiteren Wallensteinischen Lagerlebens wird sich bei Nennung dieses Namens vor dem geistigen Auge unserer Leser aufrollen.
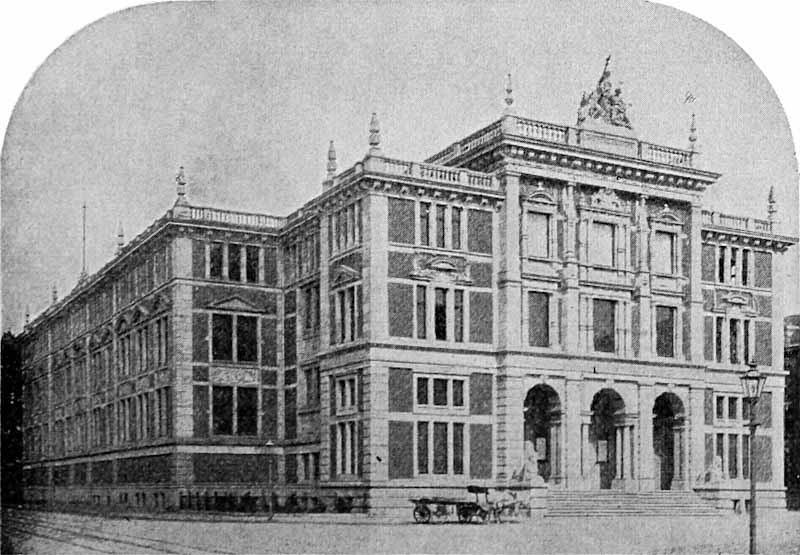
(Nach einer Photographie von Louis Koch in Bremen.)
Und dem langen Peter mag es Itzehoe wohl zu verdanken haben, wenn es in den Landen deutscher Zunge die bestbekannte Stadt an der Westseite Schleswig-Holsteins ist. In anmutiger Lage am schiffbaren Störfluß erbaut, zählt das gewerbe- und industriereiche Itzehoe (Cement- und Zuckerfabriken etc.), in der Gegenwart etwa 12500 Seelen. In früherer Zeit nahm die Stadt als der Versammlungsort der holsteinischen Stände eine besonders wichtige Stellung ein, doch hat sie dadurch, daß dies nunmehr aufgehört hat, nicht verloren, sondern ist in stetigem Aufblühen begriffen. Durch das Villenviertel hindurch führt ein schöner Spazierweg an Amönenhöhe vorbei, längs der windungsreichen Stör nach dem Schlosse Breitenburg, das von Johann von Rantzau, dem Statthalter der Herzogtümer und dem Besieger der Ditmarschen in der letzten Fehde (1559), erbaut worden ist. Hier hat sich in den Septembertagen 1627 eine Episode abgespielt, die wohl wert ist, in einigen Worten an dieser Stelle erwähnt zu werden. Damals war Breitenburg eine von starken Mauern umgebene, durch Türme und Bastionen geschützte und vom Störfluß umspülte Feste, in welcher der in dänischen Kriegsdiensten befindliche schottische Major Dumbarre mit vier Compagnien Schotten und einigem deutschen Fußvolk lag, im ganzen wohl nicht viel mehr als 600 Mann. Außerdem hatten aber die Landleute der Umgebung ihre Familien und ihren wertvolleren Besitz nach Breitenburg geflüchtet. Vor der Feste erschien nun Wallenstein mit seinen Scharen und versuchte bereits am 17. September den ersten Sturmlauf auf Breitenburg, der abgeschlagen wurde. Alsdann begann eine regelmäßige vom Friedländer selbst geleitete Belagerung, die elf Tage später zur Übergabe Breitenburgs führte, nachdem inzwischen Dumbarre getötet worden war. Alle noch am Leben befindlichen Verteidiger des Schlosses wurden von den erbarmungslosen Feinden niedergemacht, nur wenige Frauen und Kinder blieben verschont. Die ergrimmten Sieger sollen der Leiche Dumbarres das Herz aus dem Leib gerissen und in den Mund gesteckt haben. Damals wurde auch Breitenburgs Stolz, die berühmte Bibliothek des Humanisten Heinrich Rantzau, des Sohnes des Erbauers von Breitenburg, verschleppt[S. 112] und teilweise vernichtet. Wallenstein hatte dieselbe dem Beichtvater Ferdinands II., dem Pater Lamormain, zum Geschenk gemacht und nach Leitmeritz schaffen lassen.
Vom alten Breitenburg steht noch die Schloßkapelle, als Sehenswürdigkeit das einzige Stück des alten Schlosses, sonst erinnert nichts mehr, auch in der ganzen friedlichen Umgebung nicht, an die Greuel des Septembers 1627, mit Ausnahme eines ehrwürdigen Eichbaumes, der Wallensteineiche.
Etwas südöstlich von Itzehoe, bei Lägerdorf, tritt die senone Kreide zu Tage und wird daselbst in großartigem Maßstabe ausgebeutet, um teils dort, teils in Itzehoe unter Zusatz von tertiärem Thon, der bei dieser letzteren Stadt und in deren Umgebung gefunden wird, zu Cement verarbeitet zu werden. Nordöstlich von Itzehoe befindet sich das Lockstedter Lager, ein riesiger Truppenübungs- und Schießplatz, auf welchem sich das ganze Frühjahr und den Sommer hindurch reges militärisches Leben entfaltet. Lockstedt ist eine der Zwischenstationen auf der Bahnlinie Itzehoe-Wrist, die auch das kleine freundliche Städtchen Kellinghusen berührt.
Mitten im kornreichen Marschgebiete gleichen Namens liegt Holsteins kleinste Stadt, das alte Krempe. Die Gründung Glückstadts hat ihm viel Schaden gethan, denn bis dahin war es der Stapelplatz der Landschaft für den Kornhandel gewesen und soll auch keine geringe Schiffahrt besessen haben, bevor die Kremper Aue verschlammte. Als Festung genoß Krempe eines bedeutenden Rufes und ist durch die lange und schwere Belagerung von seiten der Kaiserlichen, die es im Jahre 1627 durchzumachen hatte, in der Geschichte des dreißigjährigen Krieges bekannt geworden. Später sank Krempe zum Range einer kleinen, nicht vermögenden Landstadt herab, und der Spruch: „Ein Herr von Glückstadt, ein Bürger von Itzehoe, ein Mann von Wilster und ein Kerl von Krempe“ war für die Vergangenheit charakteristisch.
Auch Glückstadt ist vormals eine starke Festung gewesen. Von dem Dänenkönig Christian IV. in der Absicht gegründet, dem Handel des emporblühenden Hamburgs erfolgreich die Spitze zu bieten, und zu diesem Zwecke mit weitgehenden Privilegien ausgestattet, hat es mit der Zeit die Hoffnungen seines Erbauers aber nicht zu erfüllen vermocht. Doch ist es in der Gegenwart eine aufstrebende Landstadt mit gutem Hafen, dessen Verkehr durch die in den jüngsten Jahren hier aufgekommene Heringsfischerei sicherlich gehoben werden wird. Die etwa von 6000 Menschen bewohnte Stadt hat ein Gymnasium, und die Korrektionsanstalt der Provinz befindet sich in ihren Mauern.
Lebhaften Handel und Industrie besitzt das an 10000 Einwohner zählende Elmshorn an der Krückau, am Rande von Geest und Marsch (Abb. 47). Nahebei, zwischen Elmshorn und dem kleinen Tornesch hat der preußische Fiskus vor 25 Jahren auf Steinkohlen gebohrt, aber vergeblich. Das Bohrloch an der Lieth hatte mehrere Jahre über die Ehre, das tiefste der Erde (1330 Meter) zu sein, bis dasselbe von demjenigen zu Schladebach überflügelt worden ist.
Ütersen an der schiffbaren Pinnau, am Rande der Haseldorfer Marsch belegen, ist ein nicht unbedeutender Industrieort von über 5300 Einwohnern, hat seit 1870 Stadtrecht und steht vermittelst einer Pferdebahn mit der eben erwähnten Station Tornesch der schleswig-holsteinischen Hauptbahnlinie in Verbindung. Das ehemalige, dem Cistercienserorden angehörige Nonnenkloster ist in der Gegenwart ein Stift für die Töchter der Ritterschaft des Landes geworden. Im Jahre 1412 soll eine Sturmflut Ütersen so sehr mitgenommen haben, daß die Klosterjungfrauen bettelnd ihre Nahrung in der Umgegend suchen mußten.
Pinneberg an der schon erwähnten, bis dahin schiffbaren Pinnau (3800 Einwohner) war lange Zeit hindurch der Sitz einer eigenen Linie der Schauenburger Grafen. Es ist mit seinen herrlichen Buchenwaldungen ein beliebter Ausflugsort der Hamburger Bevölkerung. In historischer Beziehung ist es bekannt durch die Belagerung durch Tilly im Jahre 1627, der hier verwundet wurde, und dann hat es den Ruhm, den bekannten schleswig-holsteinischen Geologen Dr. Ludwig Meyn hervorgebracht zu haben. Das Gebiet zwischen Pinnau und Krückau pflegt man auch nach dem alten Kirchdorfe Seestermühe die Seestermüher Marsch zu nennen, an die sich dann südlich die eigentliche Haseldorfer Marsch anschließt. Auf[S. 114] den geräumigen Vorlanden der letzteren, zwischen dem Deich und dem Elbstrom gedeiht die Korbweide in großer Zahl und wird als Material für Tonnen- und Faßbänder benützt. Dessen Zurichtung, das „Bandreißen“, gewährt zahlreichen Bewohnern der dortigen Gegenden lohnenden Erwerb. Auch das Rohrschilf (Phragmites communis) wird dort gezogen und verwertet.
Am schönen Haseldorfer Schloß, einem alten prächtigen Herrensitze vorbei gelangen wir nach dem etwa 2000 Einwohner zählenden Städtchen Wedel an der Wedelau, der zweitkleinsten Stadt Holsteins. Hier war in alten Zeiten eine bedeutende Fähre über die Elbe, und Wedels große Ochsenmärkte hatten eine ganz außerordentliche Bedeutung. Auf dem Marktplatz steht eine alte Rolandssäule, um deren Restaurierung sich der Stifter des Elbschwanenordens Johann Rist, der als Prediger zu Wedel geamtet hat, Verdienste erwarb. Eine eigene Bahnlinie verbindet Wedel über das an hohem Geestrücken malerisch an den Ufern der Elbe gelegenen Blankenese mit den Städten Hamburg-Altona, die wir im folgenden kennen lernen wollen.
XI.
Hamburg-Altona.
Das Areal des Freistaates Hamburg mit der dazu gehörigen, 256 Hektare großen Elbfläche, beträgt 414,97 Quadratkilometer und wird von insgesamt 681632 Seelen bewohnt (Volkszählung vom 2. Dezember 1895. Die Einwohnerzahl Hamburgs am 1. Dezember 1890 betrug dagegen 622530 Menschen). Danach kommen auf ein Quadratkilometer Landfläche 1642,61 Einwohner.
An den Mündungen der Alster und der Bille in den Elbstrom ist die Stadt Hamburg erbaut. Die erstere, deren beide seenartigen Erweiterungen, die Große oder Außenalster und die Kleine oder Binnenalster, dem Städtebild Hamburgs besondere Reize verleiht, kommt aus der Gegend von Poppenbüttel in Holstein und trägt durch ihre starke Strömung nicht wenig zum Schutze des Hamburger Hafens vor Versandung bei, während die Bille, im Amte Steinhorst entspringend, bis nahe an ihre Mündung die Südostgrenze des eben genannten Herzogtums bildet, um im letzten Teil ihres Laufes auf Hamburger Gebiet überzutreten. Die Elbe selbst durchschneidet mit zahlreichen Armen das Marschgebiet der Stadt.
Die älteste Anlage Hamburgs befand sich nämlich auf der schmalen Geestzunge, welche die Elbe von der Alster trennt. Zwischen dem ersteren Strom und der Stadt lag eine erst später eingedeichte Marschfläche, welche im Verlaufe der Zeiten dann bebaut wurde, deren tiefer belegenen Teile aber bis in die letzten Jahre hinein bei den Sturmfluten und bei starkem Hochwasser der Überschwemmung ausgesetzt waren. Nicht mit Unrecht ist darum von einem sachkundigen Manne behauptet worden, daß nicht die Nähe einer zum Weltmeer führenden großen Wasserstraße die Gründung der Stadt Hamburg bedingt habe, sondern daß der günstigen Baugrund darbietende Geestrücken, der hier erleichterte Elbübergang und das große Wasserbecken der Alster (Abb. 48 u. 49) wohl die hauptsächlichsten Ursachen dafür gewesen seien.
Nordwärts von der Stadt breitet sich ein wellenförmiges, vom Alsterthale durchschnittenes Gelände aus, die Geestlande, längs des Elbstromes dagegen fette Marschlande. In treffender Weise hat man diese Wasserstraße die Pulsader von Hamburgs Leben und Weben genannt. 135 Kilometer unterhalb der Stadt ergießt sich dieselbe in die Nordsee, welche die regelmäßigen Tagesschwankungen ihres Wasserspiegels bis nach Hamburg hinauf fortpflanzt. Von Hamburg abwärts hat die Elbe eine so bedeutende, nur hin und wieder durch Sandplatten unterbrochene Tiefe, daß Segler oder Dampfer vom größten Tiefgange bis an die Stadt herankommen können, und durch kostspielige Baggerarbeiten wird die Fahrrinne des Stromes stets offen gehalten. An der Ostseite, am Deichthor, tritt ein schmaler Elbarm in die Stadt ein und teilt sich hier in mehrere Kanäle, die sogenannten Fleete, um sich weiter unten, im Binnenhafen, wiederum mit dem Hauptstrom zu vereinigen. Diese Fleete schlängeln sich auf der Hinterseite der Häuser durch die untere Stadt, wo die großen Speicher und Magazine sich befinden, und werden mit Booten befahren, welche die eingegangenen Waren,[S. 116] die Erzeugnisse aller Zonen des Erdenrundes, aus dem Hafen holen und die zur Ausfuhr bestimmten Produkte deutscher Arbeit nach dem Hafen zum Verladen auf die Schiffe führen. Auch die Alster spaltet sich innerhalb des Weichbildes Hamburgs in mehrere Fleete, die zur Zeit der niedrigsten Ebbe allerdings halb trocken liegen, da das Wasser des erwähnten Flusses zu ihrer Speisung nicht ausreicht, dagegen bei eintretender Flut rasch von den aufsteigenden Fluten der Elbe gefüllt werden (Abb. 50 bis 58).
„Für den Verkehr auf der Elbe selbst,“ sagt Hahn, „ist Hamburg ein weit wichtigerer Grenzort zwischen Fluß- und Seeschiffahrt, als Bremen dies für die Weser ist. Die Elbe ist der Weser gegenüber fast in allen Beziehungen im Vorteil. Die Weserschiffahrt reicht kaum bis in das nördliche Hessen, die Elbe dagegen beherrscht mit ihren Nebenflüssen noch einen ansehnlichen Teil von Sachsen und Böhmen. Sie steht mit Oder und Weichsel durch die märkischen Kanallinien in Verbindung, während die Weser nur auf sich selbst angewiesen ist. Ist auch die Elbe, wie alle deutschen Flüsse, vom Ideal einer Wasserstraße ziemlich weit entfernt, so fehlen ihr doch so auffällige Schiffahrtshindernisse, wie sie an der Weser zwischen Minden und Karlshafen, namentlich bei Hameln vorkommen.“
Während im Verlaufe der Zeit die Süderelbe immer mehr dem Schicksal der Versandung anheimgefallen ist, nahm die Norderelbe zusehends an Bedeutung zu. An ihren Ufern entstanden die ersten Hafenanlagen, Kaimauern wurden gebaut, Pfahlreihen in das Flußbett geschlagen, und es entwickelte sich hier der Hafen- und Liegeplatz der Schiffe. Bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts dauerte dieser Zustand an. Immerhin war dadurch der ganze Hafenverkehr ein noch recht primitiver, zumal besondere Lösch- und Ladevorrichtungen fehlten und die Waren aus den Seeschiffen vermittelst der Schuten und Leichter nach den Lagerschuppen übergeführt wurden. Als aber bei der stetig zunehmenden Entwickelung der Seeschiffahrt diese Übelstände und besonders auch der Platzmangel sich recht merklich fühlbar machten, ging man an das Errichten von Dockhäfen und Kaianlagen mit genügender Wassertiefe, an denen die großen Fahrzeuge direkt anlegen konnten und in die Lage versetzt wurden, mit Hilfe mächtiger Kranen Löschen und Laden rasch und bequem zu bewerkstelligen. Die langen Kaistrecken wurden mit Schienengeleisen versehen und dadurch die Hafenbauten in direkte Verbindung mit den inzwischen ebenfalls entstandenen Bahnhöfen und Eisenbahnlinien gebracht.
Auch diese eben geschilderten Hafenanlagen genügten dem gewaltig emporwachsenden Bedürfnis des Verkehrs nicht mehr, und der am 15. Oktober 1888 vollzogene Zollanschluß Hamburgs mit Altona und Wandsbek an das Reich bedingte vollends gänzlich veränderte Hafenverhältnisse in diesem ersten Seehandelsplatz Deutschlands.
Die Folge dieser Umstände war eine gründliche Umwälzung der Hafenbauten Hamburgs, und es entstand das Freihafengebiet, das von 1883–1888 mit einem Kostenaufwand von über 120 Millionen Mark, von welchen das Reich 40 Millionen[S. 117] zu tragen hatte, geschaffen wurde. Ein ganzer Stadtteil des alten Hamburgs ist niedergerissen worden, um den neuen Hafenanlagen Platz zu machen, etwa 20000 Einwohner mußten anderswo untergebracht und an 1000 Häuser expropriiert werden. Durch dieses großartige Unternehmen wurde die Stadt mit ihrer ganzen Bevölkerung und ihren sämtlichen Verkehrsanlagen in das Zollinland mit eingeschlossen, ohne daß aber die freie Bewegung des Schiffsverkehrs und des großen Warenhandels dadurch preisgegeben worden ist. Auch für die Lagerung und gewerbliche Verarbeitung der dem Ausland entstammenden Rohmaterialien wurde im Freibezirk genügender Raum vorgesehen, so daß auch fernerhin die Exportindustrie ohne jede Zollkontrolle ermöglicht ist. Der Zollkanal und schwimmende Schranken im Elbstrom grenzen das Freihafengebiet gegen die Stadt hin ab; es erstreckt sich 5 Kilometer in die Länge und 2 Kilometer in die Breite und umfaßt etwa 300 Hektar Wasserfläche und 700 Hektar Land.
Und schon wieder sind abermals große Erweiterungen der Hafenanlagen Hamburgs ins Auge gefaßt worden, welche bereits die Genehmigung der maßgebenden Behörden erlangt haben und wohl in den nächsten Jahren der Verwirklichung entgegensehen werden. Das kann uns aber bei dem enormen Aufschwung, den Hamburgs Handel während der jüngstverflossenen Jahre genommen hat, nicht wundern. Einige Zahlen mögen das belegen:
Im Jahre 1897 sind — nach den Aufzeichnungen des statistischen Büreaus in Hamburg — im dortigen Hafen eingelaufen:
11173 Seeschiffe mit insgesamt 6708070 Registertonnen Rauminhalt. Davon waren 3336 Segler mit 672374 Registertonnen und 7837 Dampfer mit 6035696 Registertonnen.
Aus dem Hamburger Hafen sind während derselben Zeit ausgelaufen:
11293 Seeschiffe mit 6851987 Registertonnen, und zwar 3367 Segler mit 698303 Registertonnen und 7926 Dampfer mit 6153684 Registertonnen.
Nach der vom Deutschen Reich herausgegebenen Statistik wies Hamburgs Seeverkehr im Jahre 1898 insgesamt folgende Zahlen auf — (die angekommenen und abgegangenen Schiffe zusammengezählt, und davon die Hälfte):
11163 Schiffe mit 7273778 Registertonnen (netto).
In den zum Gebiet der freien Hansestadt Hamburg gehörigen Häfen waren am 1. Januar 1897 beheimatet:
| Segler | 430 | mit | 205842 | Registertonn. | br. | |
| Dampfer | 388 | „ | 764146 | „ | „ | |
|
|
||||||
| Summa | 818 | Schiffe | mit | 969988 | Registertonn. | br. |
Davon gehören dem Hamburger Hafen besonders:
| Segler | 275 | mit | 200276 | Registertonn. | br. | |
| Dampfer | 387 | „ | 763923 | „ | „ | |
|
|
||||||
| Summa | 662 | Schiffe | mit | 964199 | Registertonn. | br. |
Im Jahre 1900 besitzt Hamburg 690 Schiffe mit 767168 Registertonnen netto, davon 392 Dampfschiffe mit 542200 Registertonnen.
Hamburg hat die größte Seglerflotte Deutschlands, sowohl was die Zahl, als auch was den Rauminhalt der Schiffe betrifft, und ebenso ist seine Dampferflotte derjenigen der übrigen deutschen Seehäfen weit voran, indem sie mehr als die Hälfte des gesamten Dampferraumgehalts aller deutschen Küstenstaaten ihr eigen nennt. Im Jahre 1897 zählte Hamburg sieben Schiffe von mehr als 6000 Registertonnen zu seinem Flottenbestand. Innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich der Schiffsbestand Hamburgs an Zahl der Schiffe fast auf das Dreifache und an Raumgehalt der Schiffe fast auf das Fünfzehnfache vermehrt.
Einige wenige Angaben über die Größe der deutschen Kauffarteiflotte überhaupt, mögen hier wohl am Platze sein. Dieselbe nimmt unter den Handelsflotten der Erde jetzt den zweiten Platz ein und dürfte etwa 750 Millionen Mark Wert besitzen. Die Reichsstatistik vom 1. Januar 1897 ergibt an registrierten Fahrzeugen von mehr als 50 Kubikmeter Bruttoraumgehalt:
3678 Schiffe mit einem Gesamtraumgehalt von 2059948 Registertonnen brutto und 1487577 Registertonnen netto.
Davon waren:
2552 Segler mit 632030 Registertonnen brutto und 1126 Dampfer mit 1427918 Registertonnen brutto.
Der Löwenanteil dieser Flotte fällt, wie wir weiter oben schon gesehen haben, Hamburg zu. Ein Vergleich dieses seines Schiffsbestandes mit demjenigen der in dieser Beziehung drei nächstfolgenden deutschen Seehäfen ist von großem Interesse:
| Hafen | Segelschiffe | Rauminhalt, Reg.Tonnen, brutto | Dampfschiffe | Rauminhalt, Reg.Tonnen, brutto | Schiffe insgesamt | Rauminhalt, insgesamt Reg.Tonnen, brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 275 | 200276 | 387 | 763983 | 662 | 964259 |
| Bremen | 177 | 161845 | 170 | 334668 | 347 | 496513 |
| Bremerhaven | 30 | 37036 | 48 | 34404 | 78 | 71440 |
| Flensburg | 8 | 1432 | 61 | 57572 | 69 | 59004 |
Im Jahre 1897 betrug das Gewicht der Gesamteinfuhr im Hamburger Hafen 122598236 Doppelcentner und dasjenige[S. 119] der Gesamtausfuhr 79451087 Doppelcentner. Die Gesamteinfuhr und -ausfuhr betrugen also 202043323 Doppelcentner.
1851 hatte sie 15279249 Doppelcentner betragen, sie hat sich demnach seit dieser Zeit um das Dreizehnfache vermehrt.
Der Wert der Gesamteinfuhr im Hamburger Hafen war im Jahre 1897 = 3026582308 Mark, und zwar verteilte sich derselbe auf die Hauptwarengruppen, wie folgt:
| Verzehrungsgegenstände | 36,4 | % |
| Bau- und Brennmaterial | 2,0 | „ |
| Rohstoffe und Halbfabrikate | 52,0 | „ |
| Manufakturwaren | 3,4 | „ |
| Kunst- und Industriegegenstände | 6,2 | „ |
|
|
||
| 100% | ||
Der Wert der Gesamtausfuhr war = 2693445570 Mark, der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhr zusammen betrug 1897 im Hamburger Hafen also:
5720027878 Mark,
gegen 920166156 Mark im Jahre 1851, so daß sich derselbe seither also versechsfacht hat.
Wichtige Handelsartikel sind Kaffee, Zucker, Spiritus, Farbstoffe, Wein, Eisen, Getreide, Butter, Häute, Galanteriewaren, letztere fünf besonders in der Ausfuhr, und Kohlen (1897 Einfuhr von etwa 21,5 Millionen Doppelcentner von England und 9,7 Millionen Doppelcentner deutsche Kohlen). Von den bedeutenderen Industriezweigen Hamburgs selbst nennen wir Dampfzuckersiedereien, Wachsbleichen, Cigarren- und Tabakfabriken, Chemikalien, Lederwaren, Maschinen, Stöcke, Musikinstrumente, Schiffsbau (Blohm und Voß, Reiherstiegwerft) und die dazu gehörigen Gegenstände wie Ankertaue, Seile, Segeltuch, Anker u. s. f., Branntweinbrennereien, Eisengießereien, Maschinenfabriken, Manufakturen für Kautschuk- und Guttaperchawaren, Seifen- und Leimsiedereien, Konservenfabriken u. s. f.
Weltberühmt sind Hamburgs Reedereien, in erster Linie die über eine Gesamttonnage von 541083 Registertonnen brutto verfügende im Jahre 1847 gegründete Hamburg-Amerikanische-Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft, die größte Reederei der Erde. Weitere Schiffe von 116300 Registertonnen[S. 120] Rauminhalt hat die Gesellschaft z. Z. im Bau. Vergessen wollen wir hier nicht die den Schiffsverkehr zwischen Hamburg und verschiedenen Küsten- und Inselorten vermittelnde Nordseelinie, deren bequem und luxuriös eingerichtete Dampfer für die Reisenden in die Nordseebäder besonders in Betracht kommen (Abb. 59).
Daß Hamburg einer der wichtigsten Auswanderungshäfen Deutschlands ist, das ist ja bekannt, und wenn in den letzten Jahren die Auswanderung aus Deutschland auch erheblich zurückgegangen ist, so dürfte das bei der jährlichen Bevölkerungsvermehrung im Reiche doch nicht lange anhalten, und ein Wiederanwachsen des Auswanderungstriebes wird wohl bald wieder bemerkbar werden.
Der Freistaat Hamburg wird regiert vom Senat und der Bürgerschaft als gesetzgebenden Faktoren, und vom Senat als der vollziehenden Gewalt. Die Verwaltung geschieht durch die sogenannten Deputationen oder Kollegien, deren jede von einem Senator geleitet wird; die Militärhoheit übt Preußen aus. Die vorwiegende Konfession ist die protestantische, etwa 24000 Seelen der Bevölkerung bekennen sich zur römisch-katholischen Kirche, und ungefähr 18000 gehören der israelitischen Religion an. Der Rest verteilt sich auf andere Glaubensgemeinschaften. Durch ein Oberlandesgericht, ein Landgericht und verschiedene Amtsgerichte ist für die Rechtspflege gesorgt, sehr gut ist das Unterrichtswesen eingerichtet. Hervorragend ist die Rolle, die Hamburg in der Entwickelung der deutschen Litteratur und Kunst gespielt hat. Wem fielen da nicht die Namen Schröder, Lessing, Klopstock, Matthias Claudius, die Neuberin und noch andere mehr ein?
Auch Heinrich Heine gehört so etwas zu Hamburg, wenn er auch sonst nicht recht gut auf die alte Hansestadt zu sprechen war.
singt er einmal in jungen Tagen, von der Sehnsucht ergriffen, aus dieser Stadt „des faulen Schellfischseelendufts“ herauszukommen.
Vor mehr als zweihundert Jahren fand die erste deutsche Opernbühne ihr Heim in Hamburg, und der Sinn für das Musikdrama und das Singspiel hat sich in seinen Mauern seither nicht vermindert. Manches Meisterwerk dieser Gattung, das nachher seinen Triumphzug durch die weite Welt gehalten hat, erblickte hier zuerst das Licht der Lampen; wir erinnern nur an Flotows Alessandro Stradella, dessen erste Aufführung am Weihnachtstage 1844 in Hamburgs Theater erfolgte, und an den am 15. April 1845 hier begonnenen Siegeslauf von Lortzings Undine.
Hamburgs Bevölkerung ist äußerst intelligent und besitzt einen ausgesprochenen Zug für die praktischen Seiten des Lebens, ohne daß aber das Geistige nicht auch seine Rechnung dabei fände. Diese praktische Veranlagung, verbunden mit einem hohen Maße von Energie bildet einen der bezeichnendsten Charakterzüge des Hamburger Kaufmanns. Rasch und bestimmt wird alles abgewickelt, denn Zeit ist Geld. Dabei zeigt der wohlhabende Hamburger eine ausgeprägte Vorliebe für ein wohlgepflegtes Äußeres und schätzt die Genauigkeit und Pünktlichkeit nicht nur im geschäftlichen, sondern auch ebensosehr im gesellschaftlichen Leben. Letzteres ist in vielen Dingen nach englischem Muster zugeschnitten.
Harte und herbe Urteile sind bisweilen über die Hamburger gefällt worden, Pfeffer- und Kaffeesäcke hat man sie gescholten, indem man ihnen dabei jede tiefergehende Neigung für des Lebens idealere Güter von vornherein absprach. Aber das ist alles nicht wahr. Hochentwickelter Gemeinsinn, gepaart mit einem großen Wohlthätigkeitstrieb, gehört mit zu den allerbesten Eigenschaften des Hamburger Bürgers. Nicht nur die zahlreichen Anstalten und milden Stiftungen für Waisen, Arme, Kranke und die von den Schlägen des Schicksals hart Betroffenen zeugen öffentlich für diesen Hang des Hamburgers zum Wohlthun, sondern in noch viel höherem Maße ist das mit jenen thätlichen Äußerungen der Nächstenliebe der Fall, von denen die Allgemeinheit nur wenig bemerkt, und die zu jener Art von Handlungen gehören, welche die linke Hand nicht wissen lassen, was die rechte thut.
Hamburgs Gründung fällt in Karls des Großen Zeit, welcher hier eine Kirche und eine Burg errichtete. Unter Ludwig dem[S. 121] Frommen wurde der Ort der Sitz eines nordischen Metropoliten, den zuerst der berühmte Mönch von Corvey, Ansgar, der Apostel des Nordens, innegehabt hat. Von hier aus nahm das Christentum seinen Weg in die mitternächtigen Länder. Unter den holsteinischen Grafen wuchs Hamburgs Bedeutung, die nach Bardowieks Zerstörung durch Heinrich den Löwen noch mehr zunahm. Schon um 1255 besaß die Stadt ein eigenes Stadtrecht, seit 1255 die Münzgerechtigkeit, und im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert sehen wir sie als ein starkes Glied des mächtigen Hansabundes, an dessen wichtigen Unternehmungen sie lebhaften Anteil genommen hat. Seine sich immer vergrößernde Geldmacht und seine kluge Politik gewannen Hamburg den Schutz des deutschen Reiches, und neben der einsichtigen Benutzung von Handelsvorteilen aller Art, welche Örtlichkeit und die Verhältnisse darboten, dachte seine strebsame Bürgerschaft, besonders seit dem fünfzehnten Jahrhundert an den Ausbau ihres Staatsorganismus.
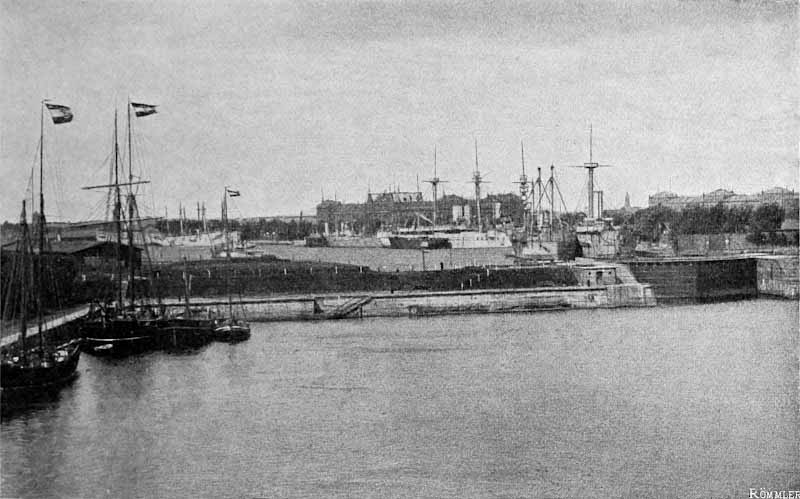
(Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
Kaiser Maximilian nahm die Stadt um 1510 in die Reihe der Reichsstädte auf, nachdem sie bereits seit 1470 zum Reichstage berufen worden war. Günstig beeinflußt wurde die Entwickelung Hamburgs durch die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Ostindien. Dagegen hatte es durch die jahrhundertelang fortgesetzten Angriffe Dänemarks, des Erben der schauenburgischen Hoheitsrechte, auf ihre städtische Selbständigkeit nicht wenig zu leiden. Erst im Vergleich von 1768 wurde die Unabhängigkeit Hamburgs vom Gesamthause Holstein dauernd festgestellt. Fast gar nicht berührt wurde die Stadt von den Schrecken des dreißigjährigen Krieges trotz des vielfachen Vorbeiziehens von allerhand Kriegsvölkern in der Nähe ihrer Mauern. Doch geriet Hamburg über den Zoll mit Christian IV. in Streitigkeiten, die zu einem Kampf zwischen hamburgischen und dänischen Schiffen auf der Elbe führten, jedoch 1643 durch Entrichtung einer Abfindungssumme an Dänemark zum Abschluß gebracht wurden. Als nun am Ende des siebzehnten Jahrhunderts viele Flüchtlinge aus Frankreich sich in der Stadt ansiedelten und Großhandel betrieben, erhöhte sich der blühende Zustand von Handel und Schiffahrt immer mehr, und neue kommerzielle Verbindungen kamen zu stande. Allerlei[S. 122] Mißhelligkeiten und Zwietracht zwischen dem Rat und der Bürgerschaft, dann ferner noch Fehden und Streit mit dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg, mit den dänischen Königen und noch anderen mehr hatten eine Zeit des Rückganges zur Folge, die jedoch mit dem zwischen Holstein und Hamburg zu Gottorp am 27. Mai 1768 abgeschlossenen Vertrage einer neuen Periode des Aufschwungs weichen mußte. Hamburg erhielt unbeschränkte Handelsfreiheit, König Christian VII. von Dänemark erkannte dessen Reichsunmittelbarkeit an, die Grenzstreitigkeiten hörten auf, und so konnte der Schluß des achtzehnten Jahrhunderts noch eine große Anzahl zweckmäßiger Anordnungen und Einrichtungen zur gedeihlichen Fortbildung des Handels und der Erwerbszweige registrieren. Die politischen Stürme und Umwälzungen, denen in den letzten Jahren des achtzehnten und in den ersten des neunzehnten Säculums Europa zum Opfer fiel, haben auch für Hamburg allerlei böse Zeiten mitgebracht. Erst zog der Landgraf Karl von Hessen mit den Dänen in seine Mauern ein, dann kam der Marschall Mortier mit seinen Franzosen, und am 18. Dezember 1810 verleibte ein Napoleonisches Dekret die deutsche Hansestadt dem französischen Reiche ein. Unberechenbare Nachteile und Zerrüttungen erlitt in jenen Zeiten die Stadt; starke Einquartierungen, Kontributionen, die Blockierung der Elbe durch die Engländer und noch anderes Elend mehr ließen Handel und Wohlstand immer tiefer sinken. So ging das bis zum März 1813; da schien es, als ob die Zeit des Unglücks vorbei wäre. Die Franzosen zogen ab, Tettenborn rückte ein, der Senat nahm die Regierung der Stadt wieder in seine Hände. Aber die Stunde der Erlösung hatte noch nicht geschlagen. Am 30. Mai mußte der russische General Hamburg wieder räumen, und die Franzosen schlugen abermals ihr Quartier darin auf. Hamburg wurde außer dem Gesetze erklärt, mußte 48 Millionen Franken Strafgelder zahlen und unter Vandamme und Davoust schwere Unbill erdulden. Napoleons Fall machte[S. 123] auch diesen bösen Tagen ein Ende, am 25. April 1814 hatten seine Truppen Hamburg geräumt, und unter großem Jubel der Einwohner zog Graf Bennigsen in die befreite Stadt ein.

(Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
Nimmer ruhender Fleiß und rastlose Thätigkeit verwischten binnen wenigen Jahrzehnten nicht nur alle Spuren, welche die Fremdherrschaft des Korsen in der Hansestadt hinterlassen hatten, sondern hoben deren Wohlstand auf eine bisher noch nicht dagewesene Höhe empor. Dank dieser zähen und trotz alles Mißgeschickes immer wieder üppigere Blüten treibenden Energie und Lebenskraft vermochte Hamburg auch das schreckensvolle Ereignis des großen Brandes überwinden, der am 5. Mai 1842 ausbrach und innerhalb einiger Tage den fünften Teils ihres Weichbildes verzehrte. Aber schon drei Jahre nachher waren die abgebrannten Stadtteile dem Phönix gleich desto schöner aus der Asche erstanden. Welchen ungeahnten Aufschwung Hamburgs Handel in den jüngstverflossenen 50 Jahren genommen hat, das haben wir schon weiter oben gesehen.
Die Stadt Hamburg selbst mit ihren ehemaligen 15 Vororten (Rotherbaum, Harvestehude, Eimsbüttel, Eppendorf, Borgfelde, Hamm, Hohenfelde u. s. f.) zählt in der Gegenwart 668000 Einwohner. Der Fremde, welcher die Stadt besichtigen will, wird seine Schritte wohl zuerst zu den Hafenanlagen lenken, die sich etwa 8000 Meter weit auf beiden Ufern der Elbe bis nach Altona hin erstrecken. Hunderte von großen und kleinen Schiffen fast aller seefahrenden Nationen liegen dort, und ihre so verschiedenfarbigen Flaggen und Wimpel bringen einen gar bunten Ton in das großartige Bild. In neuester Zeit sind von verschiedenen Unternehmern eigene Hafenrundfahrten für die auswärtigen Besucher ins Leben gerufen worden, welche Gelegenheit bieten, unter sachkundiger Führung nicht nur das großartige Leben und Treiben im Hafen selbst in den Hauptsachen kennen zu lernen, sondern auch einen der großen transatlantischen Dampfer eingehend in Augenschein zu nehmen. Auch ein Besuch des gewaltigen am Kaiserquai erbauten Staatsspeichers mit seinen ingeniösen Einrichtungen und des 32 Meter hohen Riesenkrans sollte nicht versäumt werden. Auf luftiger Höhe über dem Hafen erhebt sich das Seemannshaus, ein Asyl für alte und kranke Seeleute und ein Unterkommen für beschäftigungslose Männer dieses Berufes, und nicht weit davon ist auf einer schönen Terrasse die deutsche Seewarte erbaut, ein Institut der deutschen Kriegsmarine (Abb. 60). Es werden dort die meteorologischen Tagebücher und die nautischen Berichte über Seehäfen und dergleichen Dinge aller deutschen Kriegsschiffe[S. 124] und der größten Zahl deutscher Handelsschiffe, die freiwillige Mitarbeiter sind, gesammelt und zu großen maritim-meteorologischen Segelhandbüchern für die großen Weltmeere verarbeitet, und auch sonst besondere meteorologische Arbeiten von weittragender wissenschaftlicher Bedeutung, die Wetterkarten, welche auch in den bedeutendsten Tagesblättern Veröffentlichung finden, und dergleichen mehr veröffentlicht. Dann besorgt die Seewarte den für die Schiffahrt so äußerst wichtigen Sturmwarnungs- und Witterungsdienst.
Durch allerlei alte und teilweise recht enge Straßen und Gassen, welchen weder die Wohlgerüche des Morgenlandes noch die Reinlichkeit holländischer Ansiedelungen zu eigen sind, gelangen wir zu der St. Michaels-Kirche mit ihrem 132 Meter hohen Turm, einem Meisterwerk des bekannten Architekten Sonnin, der sie 1762–1786 erbaute, nachdem ein Blitzstrahl 1750 ihre Vorgängerin, die St. Salvator-Kirche, eingeäschert hatte. Von hier ziehen wir über den Zeughausmarkt zum Millernthor, und an Hornhardts Konzerthaus vorbei nach St. Pauli. Der Spielbudenplatz mit seinen verschiedensten Lockungen für die nach langer Seefahrt wieder festen Boden betretenden Seeleute, mit seinen Wachsfigurenkabinetten, seinen Tingel-Tangeln, Theatern, Tanzlokalen, Menagerien und solchen Dingen mehr vermag uns nicht lange zu fesseln. Wir besteigen die elektrische Ringbahn, die uns auf breiter Straße, zur linken Hand das weite Heiligengeistfeld, zur rechten schöne Anlagen an der Stelle der ehemaligen Wälle, die schon mehrfach als Ausstellungsplatz gedient haben, — so 1897 bei Anlaß der hervorragend schön gelungenen Gartenbauausstellung — rasch zum Holstenthore bringt. Hier erheben sich die neuen und weitläufigen Justizgebäude und das Untersuchungsgefängnis, die wir zur Rechten liegen lassen, um am botanischen Garten und den alten Begräbnisplätzen vorbei den Eingang zum zoologischen Garten zu erreichen, der seinesgleichen in Deutschland sucht, und zwar nicht nur wegen der Reichhaltigkeit seiner vierfüßigen, fliegenden und kriechenden oder schwimmenden Bewohner, sondern auch wegen seiner ganz wundervollen landschaftlichen Anlage. Eine prächtige Aussicht auf den Garten selbst, dann aber auf die Riesenstadt und ihre Umgebung gewährt die auf einem Hügel belegene Eulenburg. Das Aquarium, das lehrreiche Einblicke in die marine Tierwelt und in die Fauna des Süßwassers thun läßt, ist ein besonderes Schaustück.
Durch das Dammthor betreten wir die innere Stadt. Zunächst fesseln am Stephansplatz der große Renaissancebau der kaiserlichen Post- und Telegraphenverwaltung und das architektonisch nicht besonders hervorragende, aber geräumige und durch seine künstlerischen Leistungen bedeutende Stadttheater unsere Blicke, dann nimmt am Gänsemarkt Lessings Bronzebild, von Schaper modelliert, unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Dichter der Minna von Barnhelm ist auf hohem Granitsockel sitzend dargestellt: an letzterem sind die Medaillons von Eckhof und Reimarus angebracht.
Nun sind wir bis zur Binnenalster vorgedrungen. Das von Dampfschiffen, Segel- und Ruderbooten und Frachtschiffen belebte Wasserbecken, auf dem sich Schwäne und andere Wasservögel tummeln, bietet vollends vom Jungfernstieg aus gesehen, ein ganz besonders anziehendes Bild. Ein Rundgang um dasselbe lohnt der Mühe. Da ist der neuerdings verbreiterte Jungfernstieg selbst, mit einer Reihe von großartigen Baulichkeiten (Hamburger Hof, Filiale der Dresdener Bank), dann der Alsterdamm mit seiner stattlichen Häuserreihe. Bald stehen wir auf dem parkartig angelegten Platze vor der Kunsthalle und betrachten uns die von Blumenteppichen umgebene Lippeltsche Statue Schillers. Der im Stil italienischer Frührenaissance aufgeführte Ziegelbau der Kunsthalle steht offen und ladet zu einer eingehenden Besichtigung seiner zahlreichen Gemälde und plastischen Kunstwerke ein (Abb. 61–70).
Auf den in der Gegenwart schön angepflanzten ehemaligen Umwallungen spazieren wir zur Lombardsbrücke. Weit schweift von hier der Blick über die glänzende Fläche der Außenalster hin, deren grüne Ufer dicht besetzt sind von Villen, Gärten-, Baum- und Parkanlagen. An der linken Alsterseite erheben sich die Stadtteile St. Georg und die langgedehnte Uhlenhorst, während die Dächer von Winterhude und von Eppendorf dieses herrlichste aller deutschen Städtebilder im äußersten Hintergrunde abschließen. Auf dem anderen Ufer wird das Wasserbecken von den[S. 125] nicht selten schloßartig gebauten Häusern von Harvestehude und des Rabenstraßenviertels umsäumt. Hier steigt das Gelände allmählich an, während das linke Ufer flach ist, so daß beide Seiten des zur See erweiterten Flusses landschaftlich starke Kontraste bilden. Am Harvestehuder Weg wohnt das „reiche“ Hamburg, und dieses Wort will etwas heißen. Durch die Rabenstraße und den Mittelweg führt uns der Weg an das Alsterglacis und zurück auf die alten Umwallungen. Zur Zeit, als Hamburg noch eine Festung war, lagen jenseits derselben am Flusse einige Vergnügungsörter, wo man sich an den Genüssen der Tafel und des Tanzes ergötzen konnte oder unter den Klängen von Musik und Gesang auf der Alster umher gondelte. Ein deutscher Dichter aus jenen fernen Tagen, Friedrich von Hagedorn, hat uns ein Lied davon gesungen.
An der Esplanade hat Hamburg seinen im Kriege von 1870–1871 gefallenen Söhnen durch den berühmten Bildhauer Schilling ein schönes Denkmal errichten lassen. Zwei der Hauptverkehrsadern Hamburgs zweigen sich vom Jungfernstieg ab, die Große Bleichen und der Neue Wall. Großartige Läden mit reichbesetzten Auslagen hinter den hohen Spiegelglasfenstern bieten hier die verschiedensten Erzeugnisse der Kunst und Industrie zum Kaufe an.
Nahebei, am Adolphsplatze, erhebt sich die schon vor 60 Jahren erbaute, seitdem aber mehrfach vergrößerte und verschönerte Börse. Wenn man den Elbstrom die Pulsader von Hamburgs Leben und Weben genannt hat, so verdient die Börse dagegen die Bezeichnung vom Herzen seines Handels. Hier ist zwischen ½2 und ½3 Uhr die kommerzielle Welt Hamburgs versammelt, um ihre Geschäfte abzuschließen und abzuwickeln und jeden Tag viele Millionen umzusetzen. Nebendran, auf dem Rathausmarkte, befindet sich dann das politische Centrum des Freistaates, sein Rathaus. Dieser imponierende und gewaltige Renaissancebau, aus Sandstein aufgeführt, ist für das beim großen Brande von 1842 untergegangene alte Rathaus in den Jahren 1886–1897 erbaut worden. Zahlreiche Bildwerke und Wappen aus Stein und Erz schmücken sein Äußeres.

(Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
Die alte Domkirche Hamburgs, sein ältestes Gotteshaus, existiert nicht mehr.[S. 126] Im Verlaufe der Zeit wurde es baufällig und kam 1805 zum Abbruch. Seine Stelle als städtische Hauptkirche hat nunmehr St. Nikolai eingenommen, die nach dem Brande von 1842 im gotischen Stil des dreizehnten Jahrhunderts neu erstanden ist, und deren 147 Meter hohe Turm, eins der Wahrzeichen Hamburgs, zu den höchsten Bauten Europas gehört. Auch die schon um 1195 urkundlich erwähnte Petrikirche wurde bei der Brandkatastrophe ein Raub der Flammen und stammt in ihrer heutigen Gestalt erst aus dem Jahre 1849. Dagegen hat das Feuer St. Katharinen verschont; durch einige alte Gemälde in ihren Hallen, darunter ein schönes Altarblatt, ist ihre Besichtigung nicht ohne Interesse. Reichhaltige Sammlungen zoologischer, geologischer, mineralogischer und ethnographischer Natur birgt das am Steinwall neuerbaute naturhistorische Museum. Es verfügt dasselbe nicht nur über verhältnismäßig große Mittel, sondern die Munificenz der Hamburger Kaufherren und Privatleute hat auch viel zu seiner Bereicherung beigetragen. Im ehemaligen Realschulgebäude beim Lübeckerthor ist die botanische Sammlung aufgestellt, deren kolonialer Teil nicht genug gerühmt werden kann. Kein Besucher Hamburgs möge aber versäumen, dem Museum für Kunst und Gewerbe in St. Georg einige Stunden aufmerksamer Betrachtung zu schenken, das nächst seiner Schwesteranstalt in Berlin wohl das beste seiner Art im Reiche ist. Die herrlichen Fayencen und wundervollen geschnitzten alten Schränke und Truhen aus den niederdeutschen und holländischen Gebieten sind das Entzücken aller Kenner.
Zu den besichtigungswerten Dingen der Hansestadt gehören noch das große Musterkrankenhaus von Eppendorf, ganz am Ende der Außenalster, und die großartigen Friedhofsanlagen von Ohlsdorf, wo das still gewordene Hamburg von dieses Lebens Hast und Kampf ausruht. Dann werden Fachleute die Stadt nicht verlassen, ohne noch einen Blick auf die großen Sandfiltrationen auf der Elbinsel Kaltehofe bei Billwerder geworfen zu haben, welche das von der Wasserleitung Hamburgs gebrauchte Stromwasser reinigen und genießbar machen. Diese Werke wurden 1893 nach der großen Choleraheimsuchung angelegt.
Ein Zeitaufwand von nur wenig Stunden genügt, um die in nordöstlicher Richtung gelegene, holsteinische Stadt Wandsbek an der Wanse kennen zu lassen. Der 21700 Einwohner zählende Ort ist durch eine elektrische und die Bahnlinie nach Lübeck leicht zu erreichen und bot den Bankerottierern früher eine Freistatt dar, ein Umstand, welcher dem Ruf des Städtchens begreiflicherweise nicht wenig geschadet hat. Friedrich V. von Dänemark hob im Jahre 1754 aber dieses sonderbare Privilegium auf. Auf dem Friedhof Wandsbeks ist Matthias Claudius begraben, und im nahen Gehölz hat die Stadt dem Wandsbeker Boten ein einfaches, aber stimmungsvolles Denkmal gesetzt (Abb. 71).
Südlich von Hamburg ist Bergedorf, ebenfalls ein freundliches Städtchen am Ufer der Bille. Es besitzt ein von schönen Gärten umgebenes altes Schloß, das in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Der Weg dorthin zieht an den bekannten Anstalten des „Rauhen Hauses“ vorbei. Der Marschdistrikt zwischen Elbe und Bille, aus den vier reichen Kirchspielen Neuengamme, Altengamme, Kurslack und Kirchwerder, außerdem noch aus der Ortschaft Geesthacht bestehend, führt den Namen „Vierlande“; derselbe ist vortrefflich angebaut und von größter Fruchtbarkeit. Es ist Hamburgs Obst- und Gemüsegarten. Die Vierländer zeichnen sich durch ihre Obst-, Erdbeeren-, Gemüsekultur und Blumenzucht aus, die Reinlichkeit ihrer Behausungen ist sprichwörtlich geworden. Originell ist die Frauentracht in den Vierlanden, eigentümlich sind dort Sprache und Sitten (Abb. 72–77). Auch des reizend gelegenen Kurortes Reinbeck an der Bille mit seinen vielen Villen und Sommerhäusern und des nicht minder freundlich gelegenen Aumühle sei hier gedacht, sowie des nahen Friedrichsruh, wo unweit von seinem einfachen Schlosse, das die Zuflucht seiner letzten Lebensjahre war, der Alte vom Sachsenwalde in einem zwar äußerlich schmucklosen, aber würdigen Mausoleum zur Ruhe gebettet worden ist (Abb. 78–81).
St. Pauli verbindet Hamburg mit dem diesen gegenüber verhältnismäßig jungen Altona, dessen Name urkundlich erst um 1547 Erwähnung gethan wird.
Altona ist Schleswig-Holsteins größte Stadt, zählt 156800 Einwohner und liegt[S. 127] auf einem Höhenzuge, der ziemlich schroff gegen die Elbe hin abfällt, so daß die zum Hafen führenden Straßen abschüssig sind. Es besitzt eine in den letzten Jahren sich immer mehr ausbreitende Handelsthätigkeit, besonders im Export mit Nordamerika, und hat in neuerer Zeit Anstrengungen gemacht, um sich in der Hochseefischerei einen achtunggebietenden Platz zu erobern, den es in früheren Jahren schon einmal inne gehabt hatte. Sein Fischmarkt ist beträchtlich; im Jahre 1898 erzielten die in Altona abgehaltenen Fischauktionen einen Umsatz von 1993632 Reichsmark. Daneben blühen in der Stadt allerlei industrielle Unternehmungen.
In architektonischer Beziehung bietet die Stadt Altona nicht viel. Ihre Hauptstraße ist die Palmaille, eine mit schönen Linden bepflanzte Verkehrsader, in der das eherne Standbild des früheren dänischen Oberpräsidenten Grafen Konrad von Blücher steht. Ihm dankt die Stadt ihre Errettung von dem Schicksale, zur Franzosenzeit in Brand gesetzt zu werden. In der Königstraße pulsiert das gewerbliche Leben. Hier befindet sich auch das hübsche Stadttheater und eine vom Bildhauer Brütt geschaffene Statue des Fürsten Bismarck (Abb. 82–84).
Die sich an die Hamburger anschließenden Hafenanlagen Altonas sind gut und zweckmäßig eingerichtet, haben geräumige, mit Lagerschuppen versehene Kaibauten, starke Kräne neuester Konstruktion und stehen durch ein Schienennetz mit der Eisenbahn in Verbindung. 1894 sind 938 Seeschiffe aus dem Altonaer Hafen ausgelaufen und 677 darin angekommen. Die von überseeischen Ländern in gleichem Jahre eingeführten Waren besaßen ungefähr 29000 Mark an Wert, die seewärts ausgeführten 11000000 Mark.
Im Verlaufe ihrer Entwickelung hat die Stadt Altona nicht minder viele Krisen durchzumachen gehabt, als ihre Nachbarstadt Hamburg. Zu den schlimmsten Ereignissen, welche in ihren Annalen verzeichnet stehen, dürften die Brandlegung der Stadt gehören, mit welcher sie Steenbock am 9.–11. Januar 1713 wegen des durch die Dänen verursachten Brandes von Stade und einer nichtbezahlten Kriegskontribution bestraft hat. 1546 Wohnungen wurden durch Hineinwerfen von Pechkränzen und Brandfackeln ein Raub der Flammen, und nur 693 Häuser blieben vom Feuer verschont.
Trotzdem blühte aber Altona im achtzehnten Jahrhundert rasch empor, der Handel hob sich zusehends, besonders als ihm der in[S. 128] Nordamerika entbrannte Krieg neue Bahnen eröffnete. Während der Zeit der Kontinentalsperre stockten die Geschäfte aber wieder, der Wohlstand verschwand, und Altona wurde eine recht stille Stadt, bis sie in den letzten 40–50 Jahren, unter Preußens Oberhoheit, einen erneuten Aufschwung genommen hat. Im Jahre 1835 zählte sie kaum 26300 Einwohner, heute das Sechsfache dieser Zahl.
Seit dem Jahre 1889 ist Ottensen, dem ehemals der Ruhm zukam, Holsteins größtes Kirchdorf zu sein, mit Altona vereinigt. Auf seinem Friedhofe ruht unter einer alten Linde der Dichter Klopstock im gemeinsamen Grabe mit seinen beiden Frauen aus. „Saat von Gott gesäet, dem Tage der Garben zu reifen“ steht auf dem Grabstein zu lesen.
Zwei Wege stehen uns offen, um von Hamburg-Altona an die See zu gelangen. Der eine führt uns aufs Dampfboot, das uns in etwa 3½–4½ Stunden nach Cuxhaven bringt, der andere ist die Eisenbahnlinie, welche über Harburg und Stade an der linken Elbseite das gleiche Ziel erreichen läßt. Wir bestiegen einen der recht bequem eingerichteten Dampfer der Nordseelinie, der alsbald die Landungsbrücke von St. Pauli verläßt und seinen Bug elbabwärts wendet. Das rechte Stromufer ist zunächst noch von allerlei industriellen Anlagen dicht bebaut, bald aber treten diese zurück, Villen und Landhäuser mit prächtigen Parkanlagen und große Vergnügungslokale mit weiten Gärten zeigen sich im bunten Wechsel, darunter die vielbesuchten Neumühlen (Abb. 85) und Teufelsbrücke. Dann erscheint das freundliche Blankenese am Fuße des 76 Meter hohen Süllberges, eines bis an den Strom herantretenden Vorsprunges der Geest (Abb. 86 u. 87). Dem linken Ufer sind breite und flache Inseln vorgelagert, so daß dasselbe nicht besonders anziehend erscheint und von dem Alten Lande wenig zu sehen ist. Gegenüber von Nienstedten nahe bei Blankenese vereinigt sich die Süderelbe mit dem Hauptstrom. Rechts folgen bald Schulau und dann die fruchtbaren Marschen Holsteins, links bis nach Stade hin immer noch die grünen dorfbesäeten Flächen des Alten Landes, welche nordwärts von der ebengenannten Stadt in diejenigen des Landes Kehdingen und von hier noch weiter nach Norden in die Landschaft Hadeln übergehen. Bei Cuxhaven (Abb. 88 u. 89) ist die offene See beinahe schon erreicht. Nur ein kurzer Aufenthalt, schon werden die Anker wieder gelichtet, und das Schiff dampft seewärts, an Neuwerk und Scharhörn vorbei (Abb. 90 u. 91). Dann umspülen es die echten[S. 129] und rechten Nordseewellen, weit hinter uns verschwindet allmählich das Land, und um uns herum ist nichts mehr zu sehen, als das wellenbewegte Meer, über uns hängen graue Wolken am Himmel. So geht es einige Zeit fort, bis plötzlich am Horizont ein kleiner dunkler Punkt auftaucht. „Helgoland in Sicht!“ ruft der Kapitän. Unter den Passagieren wird es lebendig, selbst die armen Seekranken erheben sich von ihrem Schmerzenslager und schöpfen neuen Mut. Fernstecher und Fernrohre werden hervorgeholt, Seekarten studiert, Gepäck zurechtgelegt. Mit Macht arbeitet sich der Dampfer durch die Wogen, der Punkt wird größer und größer, rasch kommen wir ihm näher, und ebenso rasch verwandelt er sich auch in das rötlich schimmernde Felseneiland, in dessen Hafen wir in wenigen Minuten vor Anker gehen werden.
XII.
Helgoland.
Zwischen den Mündungen der Elbe und denjenigen der Weser, unter 54° 11′ nördlicher Breite und 7° 53′ östlicher Länge von Greenwich, 50 Kilometer von Neuwerk, 62 von Cuxhaven und ca. 150 von Hamburg entfernt liegt Helgoland. Senkrecht bis zur Höhe von 58 Meter steigt dieses jüngste Glied deutscher Erde aus den Fluten der Nordsee auf mit seinen bräunlichrot gefärbten felsigen Kanten, die das ungefähr 46 Hektare große Oberland tragen. Die Schichten der Insel fallen von Nordwesten nach Südosten in einem Winkel von 10–15° ein. An der Ostseite steigen die Felswände zumeist steil ab und bilden eine kahle Mauer, an der Westseite jedoch zeigt die Insel ein abwechselungsreiches Bild der Zerklüftung, mit Buchten, Felsthoren und einzeln dastehenden Pfeilern, welche vom Mutterfelsen losgenagt worden sind, so den Mönch, den Predigerstuhl und das Nathurn. Gegen Südosten ist dem Oberland das nur wenige Meter über den Meeresspiegel erhabene, aber sehr geschützte Unterland vorgelagert. Helgoland ist 0,59 Quadratkilometer groß, und gestaltet als ein langes und schmales Dreieck, dessen Spitze, das eben erwähnte Nathurn, nach Nordwesten gerichtet ist. Die größte Länge der Insel mag 1600 Meter betragen, die größte Breite 500 Meter, der Umfang des[S. 130] Oberlandes etwa 3000 Meter und derjenige des Unterlandes ungefähr 900 Meter (Abb. 1 u. 92–99).
Im Osten der Insel und etwa einen halben Kilometer davon entfernt erstreckt sich die längliche, jetzt durch weit in die See hinaus gebaute Buhnen vollkommen geschützte Düne. Ihr Untergrund besteht aus geschichteten Gesteinen (Triasformation), wird jedoch von Rollsteinen und Sanden bedeckt. Die Länge der Düne bei Ebbe mag etwa 2000 Meter groß sein, bei 300 Meter Breite. Es ist so recht der Lebensnerv Helgolands; dort befindet sich der schöne, stets steinfreie, feste und ebene Badestrand. Die auf der Insel wohnenden Kurgäste erreichen denselben vermittelst Überfahrt in Fährbooten, welche entweder durch Riemen und Segel vorwärts bewegt oder seit dem Jahre 1897 durch einen Dampfer geschleppt werden. Für diejenigen aber, welchen ein Bad in der offenen See nicht zuträglich ist, ist ein geräumiges und möglichst vollkommenes Badehaus mit hoher luftiger Schwimmhalle, warmen Seebädern u. s. f. erbaut worden, das seinen Platz an der äußersten Südseite des Unterlandes gefunden hat. Wenn stürmisches Wetter die Überfahrt zur Düne nicht gestattet, ist damit ein gewisser Ersatz für die Bäder in See gegeben. Die Düne setzt sich nach Nordwesten in riffartigen Klippenreihen fort, die bei Niedrigwasser stellenweise freiliegen, wie denn überhaupt das ganze Eiland von solchen Felsenriffen rings umgeben wird. Letztere sind zwar den nahenden Schiffen gefährlich und die Ursache zu vielen Strandungen gewesen, der Insel selbst aber bieten sie als natürliche Wogenbrecher Schutz, indem sie den Hauptanprall der Wellen von ihr fernhalten.
Unter der Zahl der Nordseebäder figuriert Helgoland seit dem Jahre 1823. Sein günstiges Inselklima und die reine, feuchte und warme Seeluft, deren Wärme während der Monate Juni bis September zwischen 14° und 15° C. schwankt, während die Nordsee als höchste und niedrigste Temperaturen während der Badezeit 20° und 12° C. aufweist, haben dem Eiland als Seebad im Laufe der Jahre immer mehr Freunde verschafft, so daß der Fremdenbesuch sich stetig hob und damit Hand in Hand auch der Wohlstand der Insulaner dauernd gestiegen ist. Die Fremdenfrequenz, welche im Jahre 1890 noch 12732 Besucher aufweist, hat im Jahre 1898 schon die hohe Zahl 20669 erreicht.
Die Straßen des Ober- und Unterlandes mit ihren vom Dach bis zum Keller blitzblanken Häusern machen einen gar freundlichen Eindruck. Ihrer großen Reinlichkeit und Sauberkeit wegen sind die Bewohner Helgolands ja bekannt. Interessant und eigenartig ist das Innere der Kirche, deren Gewölbe mit den lukenartig geformten oberen Fenstern lebhaft an das Innere eines Schiffes erinnert. Auf dem Altar stehen zwei große silberne Leuchter, welche der Gemeinde Helgoland von dem als Oberst Gustavsson bekannten entthronten König Gustav IV. Adolph von Schweden zur Erinnerung an seinen Aufenthalt auf der Insel im Jahre 1811 verehrt worden sind.
Auf dem höchsten Teil des Oberlandes befindet sich der 1810 aufgeführte neue Leuchtturm mit weiter Rundsicht; westlich davon erblickt man den „Pharus“, den alten Leuchtturm, welchen die Hamburger um 1670 errichtet haben und in den ersten Zeiten durch Kerzenlicht erleuchteten. Derselbe dient in der Gegenwart nur noch als Signalstation. Bei Anlaß seiner Erbauung zeigte sich, daß die Erderhebung,[S. 131] auf welcher er steht, ein alter Grabhügel war, der Urnen und Gebeine enthielt. Ähnliche Grabstätten aus vorgeschichtlicher Zeit dürften auch der Flaggenberg, der Bredberg und der Billberg gewesen sein; vom Moderberg steht das unzweifelhaft fest. Im letzteren hat man ein männliches Skelett, von zwei Gipsplatten eingeschlossen, gefunden, eine Bronzewaffe und zwei goldene Spiralringe.
An der Falm, der Hauptverkehrsstation, „dem Ausguck der Helgoländer“, wie sie genannt worden ist, steht das die kaiserliche Kommandantur beherbergende Regierungsgebäude. Die Straße selbst mündet auf die das Oberland mit dem Unterland vermittelst 188 Stufen verbindende Treppe; in der Nähe ihres Fußes befindet sich die heilige Quelle, ein Süßwasserbrunnen, an welchem der Sage nach die Taufen der von Liudger bekehrten heidnischen Bewohner des Eilands stattgefunden haben sollen, wie Müllenhoff in seinen Sagen, Märchen und Liedern der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg erzählt. Im Unterlande finden wir die zwecks Erforschung der Nordseefauna und -Flora im Jahre 1892 vom preußischen Staate ins Leben gerufene biologische Anstalt mit dem Nordseemuseum, das im alten Konversationshause untergebracht ist. Den Grundstock des Museums bildet die vom Deutschen Reiche angekaufte berühmte Gätkesche Vogelsammlung, welche im unteren Saale aufgestellt ist, während die oberen Räumlichkeiten der Veranschaulichung der marinen Tier- und Pflanzenwelt Helgolands und der Nordsee dienen. Besondere Berücksichtigung haben dabei die nutzbaren Seetiere, wie auch die verschiedenen Arten ihres Fanges gefunden. Die geologische Beschaffenheit der Insel wird durch eine Sammlung von Gesteinen und Fossilien erläutert.
Am 26. August 1841 dichtete hier auf dem England unterthanen Stück deutscher Erde August Heinrich Hoffmann, in der Litteratur Hoffmann von Fallersleben genannt, sein berühmtestes Lied „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“. Zur Erinnerung an diese That ist ihm 50 Jahre später am Meeresstrande Helgolands ein aus Schapers Meisterhand hervorgegangenes Denkmal gesetzt worden, nachdem kurz vorher, am 10. August 1890, Kaiser Wilhelm II. namens des Deutschen Reiches wiederum von der Insel Besitz ergriffen hatte. Sie ist dann dem schleswig-holsteinischen Landkreis Süderditmarschen zugeteilt worden. 76 Jahre lang war Helgoland englisch gewesen; von 1674 bis 1714 hatte der Danebrog darüber geweht.[S. 132] In noch früheren Zeiten war das Eiland abwechselnd Eigentum der Hansestadt Hamburg und der Herzöge von Schleswig-Gottorp, die wiederum in normännischen Seeräubern und im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung in verschiedenen Friesenkönigen ihre Vorgänger gehabt haben. Der bekannteste unter diesen letzteren war nach des Alkuins Bericht König Ratbod, der als Bundesgenosse König Dagoberts mit diesen zugleich von Pipin 689 bei Dorstedt geschlagen worden ist und auf Helgoland eine sichere Zuflucht fand. Alkuin erwähnt unser Eiland unter dem Namen Fositesland, dessen Identität mit Helgoland jedoch von Adam von Bremen (nach 1072) als „Heiligland“ ausdrücklich bezeugt worden ist. Als der schon weiter oben erwähnte Liudger, Bischof von Münster, um 785 die Insel auf Weisung Karls des Großen hin aufsuchte, war dieselbe der geheiligte Wohnsitz des Gottes Fosete, dessen Heiligtümer hier erbaut waren. Ob Helgoland bereits den Römern bekannt gewesen ist, oder ob nicht, das muß dahingestellt bleiben; nach gewissen Stellen in des Tacitus Germania sowie in dessen Annalen wäre die Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen, daß auch schon römische Augen auf die roten Felsen Helgolands geschaut und daß Wimpel römischer Schiffe, die des Germanicus Kohorten nach der Schlacht auf dem idistavischen Felde aus der Ems in die Nordsee trugen, nach Fositesland hinübergegrüßt haben könnten. Noch unbestimmter aber ist es, ob Herr Pytheas von Massilia, der um die Zeit Alexanders des Großen in das sagenhafte und vielfach und immer wieder anders gedeutete Thule eine Reise gethan hat, seinen Fuß auf Fositesland setzte. Es ist zuweilen die Ansicht laut geworden, daß die Bernsteininsel Abalus im Busen Metuonis Helgoland gewesen sei. Aber wer mag das mit Bestimmtheit wissen?
In den meisten Schriften früherer Jahrhunderte wird von unserer Insel als vom „hilligen Lunn“ gesprochen, aus welcher Bezeichnung das offizielle englische „Heligoland“ und das deutsche „Helgoland“ sich mit der Zeit herausgebildet haben. Auch der Name „Farria“ ist bisweilen dafür gebraucht worden, der nach Lindemann am richtigsten als „Far-öer“, „Schafinsel“ gedeutet wird, „denn Schafe waren früher in großer Menge auf der Insel“.
In den Blättern der neuesten deutschen Kriegsgeschichte finden wir Helgoland zweimal verzeichnet. Am 4. Juni 1848 fand hier die Feuertaufe der deutschen Flotte statt, indem drei Schiffe des Deutschen Bundes mit einer dänischen Segelkorvette ins Gefecht gerieten, und am 9. Mai 1864 kamen hier österreichische und preußische Kriegsschiffe mit einem Teil der dänischen Flotte aneinander. Der Befehlshaber des österreichischen Geschwaders, der spätere Seeheld von Lissa, Freiherr Wilhelm von Tegethoff, hat sich bei diesem Anlaß die Kontreadmirals-Epauletten geholt.
Kernig und kräftig ist der zum friesischen Stamme gehörige Menschenschlag Helgolands, die Männer sind entschlossene und willensstarke Leute, zierlich und schlank die Frauen und Mädchen. Phlegmatische Ruhe ist der Grundcharakterzug der Bevölkerung; mitten in den stürmischen Wogen des Meeres verliert der Helgoländer diese Ruhe nicht, sondern bleibt kaltblütig und gelassen, eine Eigenschaft, die für seinen Beruf als Seefahrer nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Am Althergebrachten hält er unwandelbar fest, so auch an der friesischen Mundart, welche die Kinder dort schon sprechen, bevor sie in der Schule deutsch reden lernen. Die schöne Nationaltracht der Helgoländerinnen hat allerdings mit der Zeit der modernen Kleidung weichen müssen und wird heutzutage nur noch bei besonderen festlichen Gelegenheiten angelegt. Schiffahrt, Fischerei und Lotsendienst, und nicht zum geringsten der Badebetrieb bilden die hauptsächlichsten Erwerbsquellen der Inselbewohner. In früheren Jahrhunderten pflegten gewaltige Heringszüge vor Helgoland zu erscheinen, und damit brachen Zeiten des Glanzes und besonderen Wohlstandes für das Eiland an. Die Gewässer wimmelten von fremden Schiffen, und große Faktoreien entstanden auf der Insel. Schon im sechzehnten Jahrhundert fingen die Heringszüge aber wieder an abzunehmen und waren im achtzehnten Jahrhundert beinahe ganz verschwunden.
Gebilde des Zechsteins, der Trias und der Kreide nehmen am geologischen Aufbau Helgolands teil. Die ältesten Ablagerungen der Insel bestehen aus einer einheitlichen[S. 133] Folge rotbrauner, dickbankiger, kalkhaltiger Thonschichten, die auf ihren Schichtflächen häufig Glimmerblättchen führen, nur unterbrochen durch eine etwa 20 Centimeter starke Schicht eines weißen zerreiblichen Sandes — der Katersand der Helgoländer. Eine Anzahl von Kupfermineralien, so Rotkupfererz, Ziegelerz, Kupferglanz und gediegenes Kupfer kommt in diesen Thonbänken vor, ebenso zeigen sich elliptische Kalkmandeln, im Inneren oft hohl und an den Wänden mit Kalkspatkrystallen ausgekleidet, darin. Gemäß dem Fallen und Steigen der Schichten taucht dieser untere Gesteinskomplex etwa in der Mitte der Westseite aus dem Meer empor und steigt bis zur Nordspitze derart an, daß er am Nathurn und Hengst fast den ganzen Steilabfall bildet und nur noch durch wenige Meter mächtige Schichten der darüber liegenden Gebilde der Trias überlagert wird.
Diese älteren Ablagerungen Helgolands, Äquivalente der Zechsteinletten, also oberster Zechstein, sind, auch im unteren Elbgebiet, so an der Lieth bei Elmshorn in Holstein, bei Stade in Hannover und auf dem Schobüller Berg in der Nähe von Husum bekannt geworden.
Dem unteren Buntsandstein entspricht ein Wechsel von roten, schiefrigen Thonen mit grünlich-grauen oder rot und grün gefleckten Kalksandsteinen und dünn geschichteten grauen Kalken, ohne Beimengungen von Kupfererz. Aus diesen Schichten setzt sich die Oberfläche der Insel zusammen. Aus Bildungen des Muschelkalks und wohl auch des unteren Keupers sind die Düne und die sich von dieser nordwestwärts erstreckenden Klippenzüge des Wite Klif und Olde Höve Brunnens aufgebaut. Zwischen diesen letzteren und der Hauptinsel dürfte wohl im Verlaufe der Aeonen eine etwa 370 Meter mächtige Reihe von Sedimenten verschwunden sein, welche den mittleren und den oberen Buntsandstein repräsentiert hat.
Ablagerungen des mittleren und oberen Keupers sowie der Juraformation sind auf Helgoland unbekannt, dagegen finden sich dort Schichten sowohl der unteren, als auch der oberen Kreide vertreten, teils als anstehendes Gestein, teils in der Gestalt von Geröllen. Erstere zeigt sich in dem etwa 500 Meter breiten, den ersten vom zweiten Klippenzuge trennenden Graben, im Skit-Gatt. Fossilien aus diesen als graue, schiefrige Thone oder gelbrote und gelbe thonige Kalke auftretenden älteren cretaceischen Sedimenten stellen die von den[S. 134] Helgoländern den Badegästen zuweilen zum Kauf angebotenen „Katzenpfoten“ und „Hummerschwänze“ dar, Ausfüllungen der Luftkammern von Cephalopodenschalen (Crioceras).
Auf den östlich vom Skit-Gatt sich hinziehenden, bei Ebbe hochgelegenen Klippenzügen des Krid-Brunnens (resp. des Selle-Brunnens), des Kälbertanzes und des Peck-Brunnens kommt die obere Kreide vor. Cenomane Gesteine und solche der tiefsten Zone des Turons sind nur aus Geschieben bekannt, während die Kreideschichten mit Feuerstein am Krid- und am Selle-Brunnen den Zonen des Inoceramus Bonguiarti und des Scaphites Geinitzi entsprechen, und in ähnlichem Gestein des Peck-Brunnens das untere Senon anstehend nachgewiesen ist. Aus Petrefaktenauswürflingen der See geht auch das Vorhandensein jüngerer senonen Bildungen bei Helgoland hervor.
Die Diluvialablagerungen der Insel unterscheiden sich nicht wesentlich von denjenigen Schleswig-Holsteins und des nordwestlichen Deutschlands, und das in größeren Blöcken und in kleineren Geröllen auf der Insel sowie auf der Düne herumliegende erratische Material stammt aus dem mittleren und dem südlichen Schweden.
Zwischen der Hauptinsel und den die Fortsetzung der Düne bildenden Riffen und Klippen liegt der Nordhafen. In einer — geologisch genommen — sehr jungen Zeit stellte derselbe einen Süßwassersee dar. Den Grund dieses Nordhafens bildet nämlich ein hellgrauer bis dunkelbrauner Thon, von den Helgoländern Töck genannt, wobei zu beachten ist, daß diese Bezeichnung auch noch auf die Gesteine der unteren Kreide im Skit-Gatt angewandt wurde. In dem Töck des Nordhafens nun sind zahlreiche Süßwassermollusken gefunden worden, welche sämtlich noch unter der heutigen Fauna Norddeutschlands vertreten sind, und daneben noch einzelne Pflanzenreste (Ahornblätter und anderes). Damit ist der Beweis geliefert worden, daß der rote Felsen auf einer Insel lag, welche eine Ausdehnung besaß, daß eine Süßwasserfauna und Landflora auf ihr existieren konnten, daß also das Eiland ehemals, und zwar schon in Zeiten der jetzt währenden Erdbildungsperiode — ob sonst in historischer Zeit, muß dahingestellt bleiben — größer war, als in der Gegenwart. Es ist aber nicht ein größeres Felseneiland gewesen, sondern eine Geestinsel von gleicher Beschaffenheit etwa wie Sylt und die eine Hälfte von Föhr, eine Geestinsel, aus welcher der rote Fels und das weiße massige Gestein des Witen Kliff hervorragten.

(Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
„Helgoland,“ sagt Dames, „stellt einen vorgeschobenen Posten deutschen Bodens dar. Durch seine Einverleibung in Deutschland ist auch politisch ein Zusammenhang wiederhergestellt, der geologisch seit dem Schluß der paläozoischen Formation fast ununterbrochen bestanden hat.“

(Nach einer Photographie von Römmler & Jonas in Dresden.)
Der schon früher bei der Besprechung seiner Vaterstadt Husum und a. a. O. erwähnte „königliche Geographus und Mathematicus“ Johann Meyer hat um das Jahr 1649 eine „Newe Landtcarte von der Insel Helgelandt“ gezeichnet und dazu eine höchst phantastische Darstellung dieser Insel „in annis Christi 800 und 1300“, welche dem Buche Danckwerths beigefügt ist. „Die Insel soll viel größer gewesen seyn, dann itzo“, und „der Author der Land Carten hat davon zweyerley Vorbilde des alten Heiligen Landes vorgestellet, de annis 800 und 1300, wie man sie ex traditionibus, sed humanis erhalten“, schreibt der vormalige Bürgermeister der grauen Stadt am Meere dazu. Eben diese, von der kritischen Forschung unserer Tage längst in das Reich der Mythe verwiesene kartographische Darstellung des Eilands hat nicht wenig dazu beigetragen, die alte Sage von der vormaligen gewaltigen Ausdehnung Helgolands noch bis in die neueste Zeit hinein, und sogar in wissenschaftlichen Lehrbüchern, aufrecht zu erhalten. Die Umrisse des alten, von Meyer rekonstruierten Eilands verhalten sich zu denjenigen der gegenwärtigen Insel etwa wie der Elefant zur Maus. Wenn man die zuverlässigen und geschichtlichen Zeugnisse überblickt, so kommt man zu dem bestimmten Schluß, daß das Eiland, soweit historische Nachrichten zurückreichen, immer nur eine kleine, stark isolierte Insel mit einer geringen Bewohnerzahl gewesen ist.
Daß der Umfang der Insel allmählich abnimmt und daß einmal eine Zeit kommen muß und wird, in der die Meeresfluten ungehindert über den Boden Helgolands dahinrollen werden, das ist jedoch sicher. Der Verwitterungsprozeß am Gestein, hervorgerufen durch Frost, Sonnenwärme und Niederschläge, unterstützt ferner durch die Thätigkeit gewisser Meerestange (Laminarien) nagt unaufhaltsam an den Wänden und Klippen des Eilands, und die zerstörende, am roten Felsen und seinen Riffen stetig anprallende Brandungswelle übt eine noch vernichtendere Wirkung daran aus. Wann das aber geschehen wird, das läßt sich in präzisen Zahlen nicht ausdrücken. Der Zukunft mag’s vorbehalten bleiben, und[S. 136] zweifelsohne werden noch Jahrtausende darüber hingehen bis zu dem Zeitpunkte, an dem die letzte Felsenklippe Helgolands in die Wogen hinabgestürzt sein wird.
Noch im siebzehnten Jahrhundert verband ein Steinwall, „de Waal“, die Düne mit dem Unterlande Helgolands, so daß dadurch je ein nach Norden und Süden geöffneter, halbkreisförmiger Hafen gebildet war. Im Zusammenhang mit der Düne war ferner der in ihrem Nordwesten belegene Klippenzug des Wite Klif. Um 1500 soll dieser weiße Gipsfelsen noch so hoch gewesen sein, wie die Hauptinsel selbst; er verlieh der Düne und dem Steinwall den nötigen Schutz vor dem Ansturm der Wellen, zumal die Hauptströmung des Meeres von Nordwesten her eindrang. Nicht die stark brandenden Wogen tragen aber die Schuld an der allmählichen Zerstörung des Wite Klif allein, sondern die Bewohner Helgolands selbst, indem sie Stücke von dem Felsen abtrugen und verkauften. Die alte Bolzendahlsche Chronik der Insel verzeichnet im Jahre 1615 unter anderen Begebenheiten auch noch den Umstand, daß „die Gips oder weiße Kalksteine hier bey Lande bei der Wittklippe häufig vorhanden gewesen und hat man die Last von zwölf Heringtonnen allhier verkauft vor 5 Pfund“. Am 1. November 1711, des Nachmittags um drei Uhr, wurde der letzte damals noch vorhandene Rest des Wite Klif, „so bey zwölf Jahren noch als ein Heuschober gestanden, durch eine hohe Fluth bey N. W. Wind vollends umgeworfen und absorbiert“. Nach der Vernichtung des Felsens, an den heute nur die bei tiefer Ebbe aus dem Meere hervorragende Klippe erinnert, hielt der schmale Steinwall den Andrang der Wogen nicht mehr lange aus. Ein „rechter Haupt-Sturm und hieselbst ein ungemein hohes Wasser mit so grausamen Wellen, daß auch einige Häuser und Buden bey Norden dem Lande wegspülten“, riß am Sylvesterabend und dem darauffolgenden Neujahrstag gegen zwei Uhr den Steinwall zwischen dem Lande und der Düne durch, „und war beynahe ein ganzes Jahr ein Loch darin, daß man allemal mit halber Fluth mit Giollen und Chalupen durchfahren konnte“.
Damit war die Düne für immer vom Haupteiland getrennt. Die andringenden Wogen schwemmten die Geröllmassen und den Schutt des Steinwalls an das Unterland an, welches dadurch bedeutend vergrößert wurde, so daß am Strande neue Häuserreihen entstehen konnten. Dagegen nahm die Düne besonders im Norden und Osten ab, und das blieb in der Folgezeit lange so, bis vor etwa 30 Jahren eine allmähliche Versandung der nordöstlichen Klippen und eine Änderung in der Strömung eintrat, die seither eine Verringerung der Düne im Westen und eine Zunahme im Osten bedingte. Besonders die Breite der Düne hat sich in der letzten Zeit vergrößert, wie ihre Gestaltung denn abhängig ist von Meeresströmung und Windrichtung, indem Nordostwinde sie verkleinern, Südwestwinde dagegen zunehmen lassen.
Helgolands Flora stimmt, wie auch diejenige der übrigen nordfriesischen Inseln, mit dem Pflanzenteppich der cimbrischen Halbinsel im großen und ganzen völlig überein. Doch fehlen die Heidepflanzen hier völlig.
Sämtliche Holzpflanzen sind von Menschenhand an geschützten Orten angepflanzt worden; in vergangenen Jahrhunderten war die Insel baumlos. In der Gegenwart zeigt Helgoland verschiedene, teilweise recht schöne Bäume, so den alljährlich reife Früchte tragenden, im Jahre 1814 gepflanzten Maulbeerbaum im Garten des Pastors, die Ulmen mit 1½ Fuß Stammesdurchmesser am Fuße der Treppe, die Ahornbäume der Siemensterrasse im Unterland und noch andere mehr. Auf dem Oberlande, in der Nähe des Armenhauses, dem „langen Jammer“, ist der größte Blumengarten der Insel, eine Gärtnerei, in der neben vielen anderen Zierpflanzen jährlich 4000 Rosenstöcke zur Blüte gelangen. Einen Beweis der Vorliebe der Helgoländer für blühende Blumen geben die zahlreichen Blumenstöcke und die zierlichen Gärtchen ihrer schmucken Häuser. Bekannt ist der „Kartoffelallee“ benannte Spazierweg auf dem Oberland, so benannt nach den an seinen beiden Seiten befindlichen Kartoffelfeldern. Daneben wird noch etwas Klee, Gerste und Hafer gebaut. Den Rest des Oberlandes nehmen Wiesen ein. Bei Niedrigwasser zeigen sich rings um das Eiland weite, submarine Wiesen, von grünen, roten und braunen Algen und Tangen bedeckt.
Ebensowenig, wie das auf den übrigen[S. 137] Nordseeinseln der Fall sein soll, kommen Maulwürfe oder Spitzmäuse auf Helgoland vor. Auf der Sanddüne haben früher Kaninchen in großer Anzahl ihr Unwesen getrieben. Durch Unterwühlen und Abfressen der Pflanzen thaten sie großen Schaden, so daß, wie Hallier berichtet, 1866 die Sandinsel geradezu ihres Vegetationskleides beraubt war. In der Gegenwart dürften die kleinen Tiere dort wohl vollständig ausgerottet sein. Haustiere, so Kühe und besonders Schafe, werden von den Bewohnern in dem für ihren und ihrer Badegäste Lebensunterhalt erforderlichen Verhältnis gehalten. Bei dem in verflossenen Tagen auf dem Oberlande betriebenen Kornbau sollen auch Pferde verwendet worden sein.
An Zugvögeln ist Helgoland besonders reich, und über 300 Vogelarten statten im Früh- und Spätjahr auf ihren Wanderzügen der Insel ihren Besuch ab. Unter ihnen finden sich zuweilen seltene Formen, sogar solche aus Sibirien und Nordamerika. Möven, Taucher, Seeschwalben und Strandläufer beleben das Eiland, auch Sperlinge fehlen nicht, und auf einem Felsen an der Nordküste, dem Lummenfelsen, brüten die Lummen, nordische Tauchervögel, die vom Februar bis Ende August auf Helgoland erscheinen. Die Meeresfauna ist eine überaus reichhaltige, und an schwülen Augustabenden rufen hier die zahlreich im oceanischen Wasser vorhandenen Mikroorganismen die Erscheinung des Meeresleuchtens besonders schön hervor, woran das funkelnde Leuchtbläschen (Noctiluca scintillans) wohl einen Hauptanteil hat. Bei jeder Bewegung, beim Ruderschlag, beim Hineinwerfen von Steinen ins Wasser, im Kielwasser des Bootes und auf den Kämmen der sich überstürzenden Wellen funkelt und erglänzt das Meer in phosphorischem Scheine.
Helgoland besitzt ein ausgeprägtes gleichmäßig mildes Seeklima und weist infolgedessen im Spätherbst und Winteranfang (November, Dezember und Januar) eine höhere Durchschnittstemperatur auf, als Bozen, Meran, Montreux und Lugano. In diesen erwähnten Monaten ist die Insel, mit zahlreichen, wahrscheinlich sämtlichen Städten Deutschlands verglichen, der wärmste Ort. Der Herbst ist warm, der Winter mild, das Frühjahr kalt, der Sommer kühl.
XIII.
Die Marschlande am linken Elbufer.
Ein breites Band fetter Marschländereien begleitet die linke Seite der Elbe von dem aufblühenden Harburg, das durch gewaltige Elbbrücken mit Hamburg verbunden ist (Abb. 100), an bis an die Mündungen des Stromes in die See. Da ist zuerst vom Amte Moorburg an bis an das Ufer der Schwinge das Alte Land, von den Schwingemündungen bis zu denjenigen der Oste das Land Kehdingen, dann an der Oste die Ostemarsch, als schmaler, sich südlich in die Geest hineinziehender Landstreifen zwischen Kehdingen und dem Lande Hadeln. Dieses grenzt seinerseits an das Land Wursten, das wir[S. 138] bei Besprechung der Marschen auf dem rechten Weserufer kennen lernen werden.
Das Alte Land betreibt den Obstbau im großen und im Frühjahr, wenn die zahllosen Kirschen-, Zwetschen- und Apfelbäume in Blüte stehen, bietet es ein Landschaftsbild von besonderer Pracht dar. Alle Häuser sind umgeben von den eben genannten Obstbäumen, zwischen denen auch Walnuß- und Birnbäume in geringerer Menge zu sehen sind, und wo nur ein Fleckchen frei ist, selbst auf den Deichen, werden dieselben bepflanzt. Der Export des gewonnenen Obstes ist ein ungemein bedeutender und geht neben Hamburg besonders in den Norden, so nach Dänemark, Schweden und Norwegen und nach Rußland, selbst nach London. Daneben werden Ackerbau und Viehzucht nicht vernachlässigt, von welchem etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt, — in Bezug auf das Großvieh nimmt das „Alte Land“ eine bedeutende Stellung ein — ebenso wird in einzelnen Gegenden viel Gemüse, unter anderem besonders Meerrettich kultiviert. Die Einwohner sind eingewanderte Niederländer, höchst wahrscheinlich Flamländer und die lebendigsten und rührigsten sämtlicher Marschbewohner. Ihre Frauen und Mädchen gelten als die schönsten und zierlichsten der Marschlande überhaupt. Ihre eigenartig eingerichteten Häuser mit dem farben- und formenreichen Vordergiebel, die Wahrzeichen an denselben, zwei Schwäne darstellend, deren jeder sich in die Brust beißt, ihre schön gepflegten Hausgärten und kleidsame, aber mehr und mehr in Abgang kommende Tracht, sowie eine Anzahl besonderer Gebräuche und Sitten unterscheidet die Altenländer scharf von ihren sächsischen Nachbarn.
Das Alte Land — der Sitz seines Amtsbezirkes ist Jork mit Amtsgericht und Superintendenten — wird von der unterhalb Buxtehude in dasselbe eintretenden Este und von der Lühe durchflossen. Am östlichen Rande des Alten Landes liegt das gewerbreiche Buxtehude an der schiffbaren Este. Die Stadt, welche vor Zeiten Mitglied des Hansabundes gewesen ist, zählt gegenwärtig an 3600 Einwohner. Ihre drei Thore, das Marsch-, Geest- und Moorthor, lassen die Lage der Stadt sofort erkennen, doch ist sie selbst auf Moorboden erbaut. Schöne Laubwaldungen befinden sich auf der nahen Geest und tragen dazu bei, Buxtehude zu einem hübschen Aufenthaltsort zu stempeln. Schon im siebzehnten Jahrhundert ist es „eine feine und lustige Stadt“ genannt worden, ein Ehrentitel, den sie, wie man sagt, heute auch noch verdienen soll. Buxtehude liegt an der Bahnlinie von Harburg nach Cuxhaven, die sich bis Kadenberge teils dem Geestrande entlang zieht, teils auf dieser selbst erbaut ist und erst von dort ab die Marsch des Landes Hadeln durchquert. Diese Bahnlinie berührt nördlich von Buxtehude das ebenfalls am Geestrande erbaute Horneburg an der Lühe mit einer vorwiegend Ackerbau treibenden Bevölkerung.
In großem Gegensatze mit dem obstreichen Alten Lande steht das Land Kehdingen mit seiner ausgedehnten Wiesen- und Weidenwirtschaft und seinen gut bestellten[S. 139] Äckern. Dieses lange, aber ziemlich schmale Marschgebiet wird von hohen Deichen umsäumt, denen es auch seinen Namen verdankt. Kehdingen (von Kaje-Deich) bedeutet ein gedeichtes Land. Sächsische Stämme haben vom Geestrücken bei Kadenberge her den Norden und von Stade aus den Süden besiedelt, Friesen sind später, von den Erzbischöfen zur Urbarmachung des Moor- und Buschlandes herbeigezogen, dazu gekommen. Die Bevölkerung treibt Viehzucht, in neuerer Zeit auch Pferdezucht, und Ackerbau, der des schwer zu pflügenden Bodens wegen zwar mühsam, doch um so lohnender ist. An den schlammigen Ufern der Elbe wächst viel Rohr, hier Reet oder Reit genannt, das gewonnen und zur Bedachung der Häuser verwendet wird. Auch Weiden werden gepflanzt und zu gewerblichen Zwecken verbraucht.
Der Mittelpunkt des Amtsbezirkes ist Freiburg, das durch das Freiburger Tief, einen zwei Meter tiefen Kanal, mit der Elbe in Verbindung steht. Die Ortschaften liegen entweder langgestreckt an der das Land der Länge nach durchziehenden Landstraße, so Assel, Neuland, Hammelwörden u. s. f., die jede mehr als 1000 Einwohner besitzen, oder auch am Rande des Kehdinger Moores, welches Kehdingen im Westen vom eigentlichen Geestrücken trennt.
Am Südrande dieser Moorbildung, auf einem Ausläufer der Geest gegen die Marsch treffen wir Stade an der schiffbaren Schwinge mit über 10000 Einwohnern, Hauptstadt des Regierungsbezirks und des Herzogtums Bremen, ehemals ein bedeutender Handelsort und Hansestadt. Stade hat viel industrielles Leben (Cigarrenfabrik, Eisengießereien, Maschinenfabriken) und betreibt Fischerei und Schiffahrt. Es ist Station der Eisenbahnlinie Harburg-Cuxhaven und ferner durch einen weiteren Schienenstrang von 69 Kilometer Länge über Bremervörde mit Geestemünde in Verbindung. In geschichtlicher Hinsicht ist diese Stadt durch verschiedene Ereignisse bekannt geworden, so durch die Belagerung durch Tilly, dem es sich am 5. Mai 1628 ergeben mußte, durch den großen Brand vom 26. Mai 1659, sowie durch die Belagerung der Dänen, vor denen es nach heftiger Beschießung am 7. September 1712 kapitulierte.
Um und in Stade treten Gebilde des permischen Systems, rote Zechsteinletten, auf, und fiskalische Bohrungen haben daselbst[S. 140] in etwa 180 Meter Tiefe eine sehr gesättigte Sole erschrotet. Gleiches war in der Nähe, bei Campe, der Fall, wo die Sole schon bei 162 Meter erschlossen wurde. An der Mündung der Schwinge ist die Schwinger Schanze und das Dorf Brunshausen, wo früher der 1861 abgelöste Stader- oder Elbzoll erhoben worden ist, und die transatlantischen Dampfer der Hamburger Linien zu leichtern pflegen.
Die Ostemarsch beginnt mit einer schmalen Zunge, die südlich bis in die Gegend von Kranenburg reicht, füllt anfänglich den Raum zwischen den Krümmungen des Flusses aus, um sich dann allmählich zu verbreitern, indem sie sich auf dem rechten Ufer schneller entwickelt, als auf dem linken. Zahlreiche Ortschaften, darunter welche mit mehr als 1000 Bewohnern (Hüll, Altendorf, Isensee u. s. f.), teils am Rande der Geest, teils im Marschland selbst belegen, gehören zu diesem Gebiet, das bei Neuhaus an die Elbe tritt und durch den Hadeler Kanal vom Lande Hadeln geschieden wird. Ackerbau und Viehzucht bilden die Haupterwerbszweige der Bewohner. Die untere Ostemarsch hat Neuhaus an der Oste (mit etwa 1500 Seelen) mit lebhafter Schiffahrt zum Hauptort, die obere Ostemarsch bildet einen eigenen Amtsbezirk mit Oste (etwa 850 Einwohner) als Mittelpunkt.
Vor Ablagerung der Marsch war das heutige Land Hadeln zum größten Teile ein tief in die Geest hineinschneidender Meerbusen zwischen Wingst und Hoher-Lieth. Allmählich wurde derselbe von Schlick ausgefüllt, und nur in der Innenseite, welche bei der Marschbildung immer niedriger bleibt, erhielt sich das Wasser, und in ihr bildete sich das ausgedehnte Moor, welches Hadeln im Süden bedeckt. Das abgelagerte Marschland hat die Gestalt eines Dreiecks, dessen Grundlinie nach der Elbe zu, dessen Spitze aber im Süden liegt. Der nach dem Flusse zu sich erstreckende Teil der Marsch ist höher als das innere Gebiet, und so unterscheidet man das äußere „Hochland“ von dem inneren „Sietland“ (Niedrigland), die beide heute noch politisch getrennte Gebiete bilden. Letzteres, an der Grenze der Moore mit ihren Seen belegen, war im Winter stets Ueberschwemmungen ausgesetzt und drohte zu versumpfen, da die beiden Flüsse, die Aue und die Gösche, es nicht hinreichend entwässern konnten. Um dem Abhilfe zu schaffen, wurde von 1854 bis 1856 der Hadeler Kanal gegraben, der nach Norden mit der Elbe in Verbindung steht, und 1860 begann man den Geestekanal zu schaffen, der nach Süden zur Geeste verläuft. Beide Kanäle haben ihren Ausgang im Bederkesaer See. Durch eine große Schleuse ist der Kanal mit der Medem in Verbindung, welche nördlich von Oster-Ihlienworth aus der Vereinigung der Gösche und Aue entsteht und in vielen Krümmungen den Deich erreicht. Die „torfgefärbte Mäme“ hat der Dichter J. H. Voß diesen Fluß genannt. Geeste- und Hadeler Kanal sind zusammen 43,5 Kilometer lang und dienen neben den Zwecken der Entwässerung des Landes auch der Schiffahrt, da sie bei gewöhnlichem Wasserstande 1,5 Meter Tiefe besitzen, so daß Schiffe bis zu 16 Tonnen von der Elbe zur Weser gelangen können. Durchschnittlich wird diese Wasserstraße jährlich von 700–800 Fahrzeugen benützt.
Die ausgedehnten Moorländereien des Südens (20,8% des Gesamtareals von Hadeln) sind nur teilweise entwässert und in Kultur genommen und werden nur zum Torfstich benützt. Das Wasser aus dem Westermoor führt die unterhalb Altenbruch in die Elbe fallende Bracke ab, das Wannaer Moor entwässert die Emmelcke, ein Nebenfluß der Aue. An das letztgenannte Moor grenzt die kleine gleichnamige Geestinsel mit dem Kirchspiel Wanna, aus leichtem, mit Heidekraut bewachsenem Sandboden bestehend. Der Boden der Hadeler Marsch selbst ist nicht so schwer, als derjenige Kehdingens und darum zum Ackerbau auch sehr geeignet. Sein Untergrund besteht aus einem kalkreichen Schlick, der aus der Tiefe an die Oberfläche gebracht und mit Dünger und Ackerkrume vermischt, dem Boden eine besondere Ertragsfähigkeit gibt. Man nennt diese Bodenumarbeitung das Kuhlen; trotz seiner Kostspieligkeit trägt es reichlich Zinsen. Die Viehzucht tritt in Hadeln zurück, dafür blüht der Ackerbau um so mehr, und im Sommer ist das Marschland von einem Ende zum anderen ein prächtig wogendes Saatenmeer. Raps, Weizen und Roggen bilden den Hauptbestand der Felder.
Hadelns Bewohner sind rein sächsischen Stammes, und unter allen Marschen hat dieses[S. 141] Land seine Eigentümlichkeiten und Freiheiten (Hadelnsche Provinzialstände u. s. f.) am treusten bewahrt. Politisch zerfällt das Land in drei Verbände, in die Stadt Otterndorf, Kreisstadt und Amtsgericht, der Mittelpunkt des Landes, in dem sich Hadelns Handel und Verkehr vereinigt, in das Hochland und in das Sietland. Otterndorf, ein altmodisches, aber freundliches Landstädtchen, in das noch vor einigen Jahrzehnten ein altes Burgthor führte, geschmückt mit dem lauenburgischen und dem Stadtwappen, einer Otter (Fischotter) über dem sächsischen „Rautenkranze“, wie Allmers schreibt, hat eine höhere Bürgerschule, die früher als Progymnasium existierte, und an welcher der Dichter Johann Heinrich Voß einst Prorektor gewesen ist. Die einzelnen Ortschaften,
liegen auf einen weiten Raum verteilt, die größeren Höfe vereinzelt. Noch mehr Bewohner, als Otterndorf (etwa 1760 Seelen) zählt die Gemeinde Altenbruch (2200 Seelen) mit der ältesten und bedeutendsten, einen berühmten Altarschrein aus dem Anfang des sechzehnten Jahrhunderts bergenden zweitürmigen Kirche. Neben Altenbruch sei hier noch Lüdingworth, der Geburtsort des bekannten Reisenden Karsten Niebuhr, erwähnt.
XIV.
Das Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser.
Die im vorigen beschriebenen Marschlande am linken Elbufer umschließen zusammen mit den im folgenden Abschnitte zu besprechenden Marschen von Osterstade, Wührden, Vieland und Wursten ein weites und großes Areal, das zum allergrößten Teile den ehemaligen Herzogtümern Bremen und Verden angehört hat und in der Gegenwart der Hauptsache nach unter der Verwaltung der Landdrostei resp. des Regierungsbezirkes Stade steht.
Das Teufelsmoor und die ausgedehnten Moore an der Oste trennen das Geestland unseres Areals in zwei Hälften, in eine östliche und in eine westliche, die durch einen schmalen Arm bei Bremervörde, etwa im Mittelpunkt des Landes miteinander in Verbindung stehen. Im Nordosten reicht der östliche Teil bis an die Elbmarschen, westlich wird derselbe vom Teufelsmoor und dem mittleren Thal der Oste begrenzt. Wir unterscheiden in seinem Gebiet verschiedene scharf ausgeprägte Rücken, so denjenigen von Zeven im Süden, am Oberlaufe der Oste, in der Mitte den Rücken von Harsefeld, und nördlich von diesem und durch die Schwinge getrennt, denjenigen von Himmelpforten.
Bei Bremervörde durchbricht die Oste das auf 3,5 Kilometer zusammengedrängte Verbindungsglied der östlichen und westlichen Hälfte. Letztere tritt im Süden und im Westen an den Weserstrom, während ihr nördliches Ende im Amte Ritzebüttel die Elbe erreicht und hier auf eine kurze Strecke die Deiche überflüssig macht. Ein schmaler Rücken, vom Verbindungsraume bei Bremervörde ausgehend, zieht zwischen dem langen und großen Moore hin und teilt sich wieder in die Hügelgruppen des Westerbergs und der Wingst; letztere bildet in den sie umgebenden Marschen eine weithin sichtbare Marke. Ein zweiter Zug folgt beiden Seiten der Geest; sein südlicher[S. 143] Teil dacht sich allmählich zum Vielande hin ab, der nördliche hingegen kehrt sich zwischen Geest und den Hadeler Mooren nach Norden und endet mit Sanddünen an der äußersten Landesspitze. Als öder Heiderücken der Hohen Lieth scheidet er Hadeln von Wursten. Südlich von der Lüne endlich, zwischen dem Teufelsmoor und der Weser ist ein weiterer Geestrücken entwickelt, der von Süden an in Höhe zunimmt und die Garlstedter und Brundorfer Heide trägt. Er fällt im Süden steil in das Thal der Lesum und Weser ab, letztere dadurch zur westlichen Richtung zwingend.

(Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
Das Land bildet eine 10–20 Meter hohe, von zahlreichen Bächen und Flüssen durchflossene leichtwellige Ebene, deren höchste Punkte 80 Meter nicht erreichen (Camper Höhe bei Stade 24 Meter; Litberg bei Sauensiek auf dem Harsfelder Rücken 65 Meter; Lohberg auf dem Rücken von Himmelpforten 42 Meter; Wingst 74 Meter; Hohe Lieth bei Altenwalde 31 Meter; höchster Punkt der Garlstedter Heide 45 Meter).

(Nach einer Photographie von A. Overbeck in Düsseldorf.)
Im Gebiete des Regierungsbezirks Stade werden 183576 Hektare oder 28% der Gesamtfläche des Landes von Mooren bedeckt (der Regierungsbezirk Osnabrück enthält deren nur 20,5% und der von Aurich 24,6% seines Areals). Kein einziger Amtsbezirk unseres Areals ist ohne Moore, die im Amte Lilienthal an der Grenze des Bremerlandes 80% des Flächeninhalts ausmachen, dagegen in anderen, so im Amte Jork, nur wiederum 0,7%. Die Moore, die sich zwischen Marsch und Geest oder auch zwischen zwei Marschgebieten hinziehen, nennen wir Randmoore. Es sind größtenteils Grünlands- resp. Wiesenmoore, mit scharfem Absatz gegen die Geest, aber nur allmählich durch „anmooriges Land“, welches meist tiefer liegt als das Moor und die Marsch, in diese übergehend. Hierher zu rechnen sind das Altenländer Moor, das[S. 144] Kehdinger Moor, die unteren Oste-Moore, die Hadeler Moore, die Osterstader Moore. Moore, die sich in Niederungen oder auf beinahe horizontal liegenden Flächen der Geest gebildet haben, bezeichnet man als Binnenmoore. Es sind fast nur Hochmoore. Als Beispiel dieser auf unserem Gebiete sehr verbreiteten Moore möge der größte hierher gehörige Moordistrikt dienen, das Teufelsmoor, das sich nördlich von dem flachen Bremer Gebiet keilartig in die Geest hineinschiebt.
Die von Holland zu uns herübergekommene Art der Moornutzung, das Moorbrennen oder die Moorbrandkultur, deren Wirkungen sich im weiten Umkreise durch den Moor- oder Höhenrauch in so unangenehmer Weise bemerkbar machen, hat sehr wenig segenbringend gewirkt, und da, wo solche Hochmoorsiedelungen lediglich auf Grundlage des Moorbrennens angelegt wurden, ohne vorherige Aufschließung der Moore durch Kanäle und Wege u. s. f., verfielen dieselben meist schon nach kurzer Zeit dem allergrößten Elend.
Dagegen hat eine zweite Form der Hochmoorkultur, gleichfalls holländischer Herkunft, sehr segensreich gewirkt, die Fehnkultur oder Sandmischkultur, welche den Zweck hat, die unter den Torfmooren befindlichen Landflächen urbar und der Kultur zugänglich zu machen. Es kommt dabei auch darauf an, den abgegrabenen Torf zu verwerten und ihm billige Transportwege zu eröffnen, und zu diesem Behufe legt man von dem zunächst befindlichen Wasserlaufe Kanäle in das Moor hinein an, die mit Schiffen befahren werden können, die Fehnkanäle, an die sich wiederum im Laufe der fortschreitenden Unternehmung Seiten- und Parallelkanäle anschließen. Durch dieses Netz von Wasserstraßen wird außerdem noch für die notwendige Entwässerung des in Fehnkultur begriffenen Areals gesorgt. Die abgetorften Ländereien werden mit Seeschlick, mit Kleierde, mit Sand und mit Dünger bedeckt und dann bebaut.
Die Fehnkultur ist um den Anfang des siebzehnten Jahrhunderts in Holland zuerst aufgekommen, und im Jahre 1630 brachte der Graf Landsberg-Velen diese Art der Moorbebauung bereits in Anwendung auf deutschem Boden, indem er die Kolonie Papenborg, das heutige Papenburg, anlegte, eine aufblühende Stadt im Regierungsbezirk Osnabrück, mit etwa 7000 Einwohnern, dem Muster einer Fehnkolonie. Die deutschen Fehnkanäle haben zur Zeit eine Gesamtlänge von 195,8 Kilometer.
Fehnkolonien befinden sich besonders in Ostfriesland und im Oldenburgischen. In einem gewissen Gegensatz zu denselben stehen die Moorkolonien, die nicht die Bebauung des Mooruntergrundes, sondern der Mooroberfläche selbst als Endzweck haben. Das preußische Landwirtschafts-Ministerium hat es als eine seiner vornehmsten Aufgaben erachtet, die Moorkultur immer mehr und mehr thatkräftig zu fördern. Zu diesem Zweck wurde von dieser Behörde in Bremen eine Moorversuchsstation gegründet, welche durch wissenschaftliche Forschungen die Eigenschaften und Eigenarten des Hochmoorbodens feststellen und zugleich durch praktische Versuche in den Mooren selbst neue Hilfsmittel für die Hochmoorkultur schaffen soll. An den verschiedensten Stellen des Areals zwischen Elbe und Weser und Ostfrieslands sind neue Moorsiedelungen unter der Leitung der Regierung entstanden, und im letztgenannten Lande ist diesen Unternehmungen die Erschließung der weiten Flächen durch den Ems-Jade- und den Süd-Nord-Kanal sehr zu statten gekommen. Im Jahre 1890 bestanden im deutschen Flachlande westlich der Elbe (Regierungsbezirk Stade, Osnabrück und Aurich, sowie Oldenburg) bereits über 250 Moorkolonien von 55000 Hektaren Gesamtareal und mit 60000 Einwohnern. Das Gebiet von Waakhausen am südlichen Ufer der Hamme zeichnet sich durch sein weit und breit bekanntes „schwimmendes Land“ aus. Es ist dasselbe ein Grünlandmoor von noch unsolider Beschaffenheit, an seiner Oberfläche mit einer festen Borke versehen, die aus verfilztem Wurzelgeflecht besteht, aber eine Verbindung mit dem Untergrunde noch vermissen läßt. Die zwischenliegende Schicht ist ein schlammiger Moorboden, der sich mit steigendem Wasser ausdehnt und die obere Schicht, solange sie nicht zu schwer ist, hebt. Bei eintretendem niedrigen Wasserstand senkt sich das Moor wieder und das Land erhält seine frühere Lage zurück. Die Häuser auf dem schwimmenden Lande sind auf Wurten gebaut, die auf dem festen Untergrunde[S. 145] aufgeschüttet sind, und infolge des wechselnden Wasserstandes bald auf Hügel erbaut zu sein, bald in Vertiefungen zu stehen scheinen, da sie von den Hebungen und Senkungen des schwimmenden Landes ja selbst unberührt bleiben. Da aber auch der Untergrund, der die Wurten trägt, nicht sehr fest ist, und diese letzteren erst mit der Zeit beständiger werden, so senken sich oftmals die auf neuen Wurten erbauten Häuser oder sie werden schief und müssen dann geschroben werden, meistens alle zehn Jahre. Darum sind alte Wurten gesuchte Grundstücke. Ähnliche schwimmende Ländereien haben auch das Altländer Moor (bei Dammhausen) und das Oldenburger Land an verschiedenen Stellen aufzuweisen.
Nahe bei Waakhausen liegt das Malerdorf Worpswede, von dem im nächsten Abschnitt noch etwas eingehender die Rede sein wird.
Südlich der Hamme trifft man ein weites Niederungsgebiet, das St. Jürgens-Land, ein großes Wiesenmoor, das von mehreren Kanälen und zahllosen Gräben durchzogen wird, aber auch stellenweise größere Wasserflächen neben einer Unmenge von „Braaken und Kuhlen“ besitzt. Es ist 4569 Hektare groß. Vom Oktober bis April ist das Land meist überschwemmt, und selbst im Sommer treten zuweilen noch Überflutungen ein. Das Leben der Bewohner hat sich den Verhältnissen angepaßt, und der Verkehr zwischen den einzelnen Wurten geschieht fast nur zu Boot. Die das Land durchquerende Landstraße ist im Winter meist nicht zu benutzen.
Die zahlreichen Wasserläufe, welche das hier besprochene Gebiet durchziehen, haben wir zum größten Teil schon da und dort kennen gelernt. Im Südosten tritt die Este in unser Gebiet, der weiter nördlich die Horneburg bespülende Lühe, in ihrem Oberlauf Aue genannt, folgt, hierauf die durch den Elmer Schiffgraben mit der Oste in Verbindung stehende Schwinge, die Oste und die aus Aue und Gösche entstandene Medem. Diese alle sind der Elbe tributpflichtig. Im Westen, als Nebenflüsse der Weser, treffen wir die Geeste, die Lüne und die Drepte und noch weiter südlich die Lesum, wie die Vereinigung der aus dem Moorlande herauskommenden Hamme mit der langen, unser Areal im Süden begrenzenden Wümme heißt. Größere Wasserbecken weist der Nordwesten und Norden[S. 146] des Landes zwischen Elbe und Weser auf, so den Balksee, dem der Remperbach das Wasser des nördlichen Westerberges und der südlichen Wingst zuführt. Seine öde, unwirtliche und schwer zugängliche Umgebung hat ihn beim Volke zum Schauplatz schauriger Sagen gestempelt. Durch schöne Waldungen und liebliche Umgebung ist der See von Bederkesa ausgezeichnet, die Dahlemer, Halemmer und Flögelner Seen sind mit der Hadelner Aue verbunden, in der Nähe des Hymensees war im Mittelalter ein berühmter Falkenfang.
Neben den Gebilden des Diluviums und Alluviums, welche der Hauptsache nach den Boden des Landes zwischen Unterelbe und Unterweser bilden, treffen wir noch einige ältere Formationsglieder in unserem Gebiete an. Der Zechsteinletten von Stade ist bereits Erwähnung gethan worden. Am Südostrande der Wingst, bei Hemmoor, treten die Schichten der oberen weißen Kreide auf, welche daselbst die Veranlassung einer bedeutenden Cementfabrikation geworden sind, neben verschiedenen tertiären Sedimenten (eocäner Thon u. a. m.). Tertiäre Ablagerungen sind noch da und dort im Lande zerstreut.
Die wichtigeren Niederlassungen im Osten des Landes sind bereits aufgeführt worden. Von den Ortschaften im Inneren ist das beinahe central gelegene Bremervörde an der Oste, 1852 zur Stadt erhoben, die bedeutendste. Es lebt hauptsächlich von Ackerbau. Doch treibt es auch etwas Handel. Die Flut der Oste steigt bis hierher, so daß Bremervörde für die Elbschiffe zugänglich ist, die besonders Holz aus den benachbarten größeren Waldungen und Torf verfrachten und hauptsächlich in Hamburg absetzen, jährlich etwa 4500 Ewerladungen Torf und an 300 solcher mit Holz. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 2920 Seelen. Zeven im Süden, ehemals Sitz eines Nonnenklosters vom Orden St. Benedikts, hat etwas über 1250 Bewohner. Es wird in der Kriegsgeschichte Niedersachsens oftmals genannt und ist durch den hier zwischen dem Herzog von Cumberland und dem Herzog von Richelieu am 8. September 1757 abgeschlossenen Vertrag (Konvention von Kloster Zeven) noch besonders bekannt geworden. Bederkesa, durch einen Schienenstrang mit Lehe verbunden, am gleichnamigen, schon weiter oben erwähnten See, mit einem Lehrerseminar, hat gegenwärtig etwa 1300 Einwohner. Reger Fabrikbetrieb und große industrielle Thätigkeit entfaltet das an der Süderelbe belegene, rasch aufblühende Harburg. Die gegenwärtig von 49000 Seelen bevölkerte Stadt hat einen bedeutenden Schiffahrtsverkehr; mehr als 700 Seeschiffe laufen jährlich im Harburger Hafen ein. Die Bahnlinie Hamburg-Hannover-Cassel berührt Harburg und überquert die zwischen dieser Stadt und Hamburg dahinziehenden beiden Elbarme auf zwei großen eisernen Brücken. Harburg ist ferner Knotenpunkt für die Linie nach Cuxhaven und nach Bremen. Letztere ist 114,5 Kilometer lang und führt über Buchholz und den im dreißigjährigen Kriege vielgenannten Flecken Rotenburg (2350 Einw.). Die Cuxhavener Bahn ist besonders wichtig, seit sie von Stade und von Cuxhaven Verbindung mit Bremerhaven hat. Die Lande am rechten Weserufer mit ihren Städten, Flecken und Dörfern werden wir im Anschluß an die Beschreibung von Bremen im folgenden Abschnitt kennen lernen.
XV.
Bremen und die Marschlande am rechten Ufer der Weser.
Das Gebiet der freien Handelsstadt Bremen umfaßt ein Areal von 255,56 Quadratkilometer, von denen 23,12 Quadratkilometer auf die Stadt selbst, 226,33 Quadratkilometer auf das Landgebiet des Freistaates fallen. Letzteres gliedert sich in das Blockland im Nordosten, in das Hollerland im Osten, in das Werderland im Nordwesten und das Niedervieland im Westen. Im Süden der Stadt liegt dann noch das Obervieland. Der Boden des Freistaates besteht aus Geest und aus Marschland, im äußersten Nordwesten nimmt auch Hochmoor an dessen Zusammensetzung teil.
Bremens Lebensader ist die Weser (Oberweser von Münden bis Bremen, Unterweser von Bremen bis Bremerhaven, Außenweser von Bremerhaven bis zur eigentlichen Mündung, den untersten Flußtrichter begreifend). Früher konnten nur flachgehende Fahrzeuge nach Bremen hinaufgelangen. Da der Tiefgang der Schiffe mit der Zeit zunahm, die Versandung des Weserstroms aber stärker wurde, so entstand im siebzehnten Jahrhundert der Hafen von Vegesack, 17 Kilometer stromabwärts von Bremen, aber schon bald darauf mußten größere Fahrzeuge noch weiter unterhalb, in Elsfleth und Brake, vor Anker gehen. Der aufblühende Handel der alten Hansestadt verlangte gebieterisch die Anlage eines geeigneten Hafens für Schiffe mit größerem Tiefgange, und so wurde um das Jahr 1830 ein solcher bei Bremerhaven gebaut, auf den wir später noch zurückkommen werden. Mit der Zeit trat aber der Umstand deutlich zum Vorschein, daß Bremen selbst wieder zum Seehafen werden mußte, wenn es seine Stellung auf dem Weltmarkt ebenbürtig neben Hamburg, Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen behaupten wollte. Nachdem sich Bremen 1884 zum Zollanschluß bereit erklärt hatte, ging man zuerst an die Erweiterung der Hafenanlagen der Stadt. Unter der bewährten Leitung des Oberbaudirektors Franzius erstand so in dem ein Areal von 90 Hektaren umfassenden Freibezirk der 22 Hektare große, 2000 Meter lange, 120 Meter breite und 7,8 Meter tiefe Freihafen mit seinen Verwaltungsgebäuden, Warenschuppen, hydraulischen Kränen u. s. f. Den Hafen umschließt eine große Kaimauer, deren Oberkante 5 Meter über Null, im ganzen 7,2 Meter hoch liegt, eine 5 Meter breite Sohle besitzt und auf einem Pfahlrost steht, der auf 30000 Rundpfählen von großer Stärke ruht. Die Gesamtkosten des Zollanschlusses Bremens an das Reich wurden auf 34,5 Millionen Mark berechnet, wozu das Reich selbst zwölf Millionen beigesteuert hat. Und schon wieder ist Bremen im Begriff, seine Hafenbauten mehr als zu verdoppeln und über 40 Millionen Mark für die Verbesserung seiner Verkehrsanlagen auszuwerfen. Durch die fortgesetzte Korrektion der Unter- und der Außenweser ist dieser Strom nämlich im Begriff, sich zu einer Wasserstraße ersten Ranges zu entwickeln.
Die nutzbare Wassertiefe der Unterweser[S. 148] bei gewöhnlichem Hochwasser betrug früher etwa 2,75 Meter. Infolge der nach den Plänen von Franzius ausgeführten und im Jahre 1887 in Angriff genommenen Korrektionsarbeiten war schon im Jahre 1894 eine nutzbare Wassertiefe von 5,4 Meter erreicht. Die Deckung der über 30 Millionen betragenden Kosten dieses riesigen Unternehmens wurde ebenfalls mit Beihilfe des Reiches erreicht, indem ein Reichsgesetz vom 5. April 1886 Bremen ermächtigt, auf der Strecke Bremen-Bremerhaven von allen über 300 Kubikmeter Raum besitzenden Schiffen eine Abgabe zu erheben, sobald Fahrzeuge mit fünf Meter Tiefgang dort fahren könnten. Doch darf dieselbe nur von solchen Ladungen erhoben werden, welche aus See nach bremischen Häfen oberhalb Bremerhavens bestimmt sind oder von solchen Häfen nach See gehen, also nicht von den für die oldenburgischen Häfen Brake, Elsfleth u. s. f. bestimmten Schiffen.
Mit dem 1. April 1895 konnte diese Schiffahrtsabgabe zum erstenmal erhoben werden, und der Erfolg war der, daß an Stelle der 3 Schiffe mit 4,5–5 Meter Tiefgang, welche 1891 nach Bremen kamen, dies 1896 schon 300 waren, daß die Verzinsung des Anlagekapitals nicht, wie vorsichtig veranschlagt, nach 28 Jahren, sondern schon nach drei Jahren eintrat, und daß der Handel Bremens sich schon jetzt auf das Fünffache gehoben hat.
Infolge dieses überraschend günstigen Ergebnisses schlossen Preußen, Bremen und Oldenburg ein Abkommen miteinander, dahinzielend, die Außenweser unterhalb Bremerhaven auf acht Meter unter Niedrigwasser zu vertiefen, so daß die großen Kriegs- und Handelsschiffe bei ihrem Ein- und Auslaufen nicht mehr an die Zeit des Hochwassers gebunden sein werden. Die Ausführung der Arbeiten wurde Bremen übertragen, und die bisherigen Fortschritte derselben berechtigen zu den weitestgehenden Hoffnungen. Gleichzeitig mit dieser Unternehmung ist auch eine Erweiterung der Hafenanlagen in Bremerhaven in Angriff genommen worden.
Bremen besitzt gegenwärtig 517 Schiffe mit 556665 Registertonnen, darunter 225 Dampfer mit 285500 Registertonnen. Darunter sind, wie ebenfalls in der Hamburger Flotte, die größten Oceanriesen. Deutschland besitzt über 20 Dampfer von mehr als 10000 Tonnen, mehr, als irgend eine andere Nation der Erde.
Bereits im Jahre 1773 machte man von Bremen aus den ersten Versuch einer Fahrt nach Amerika, welcher mißlang, aber zehn Jahre später einen weiteren zur Folge hatte, der so günstig verlief, daß schon um 1796 etwa 70 Bremer Schiffe in der Amerikafahrt beschäftigt waren. Den im folgenden Jahrhundert sich rasch steigernden überseeischen Verkehr nahm auch Bremen wahr und trotz der damals noch geringen Erfahrungen und des allgemein herrschenden Mißtrauens gegen eine transatlantische Verbindung mittels Dampfschiffe erkannten Mitte der fünfziger Jahre weitblickende Bremer Kaufleute, an ihrer Spitze H. H. Meyer, die weltumgestaltende Bedeutung des Dampfes und gründeten im Jahre 1857 den Norddeutschen Lloyd mit drei Millionen Thaler Gold als Kapital. Die vier in England gebauten Dampfschiffe[S. 149] „Bremen“, „New-York“, „Hudson“ und „Weser“ sind die ersten der neuen Gesellschaft gewesen, die gegenwärtig 69 Seedampfer, davon 10 im Bau, 36 Küstendampfer, davon ebenfalls 10 im Bau, 24 Flußdampfer, das Schulschiff „Herzogin Sophie Charlotte“ und 114 Leichterfahrzeuge und Kohlenprähme zählt, mit einem Gesamtraumgehalt von 506754 Registertonnen. Die großen neuesten Lloyddoppelschraubenschnelldampfer des Lloyd, „Kaiser Wilhelm der Große“ (Abb. 101–103) und „Kaiserin Maria Theresia“, werden mit Recht als ein Triumph des deutschen Schiffs- und Maschinenbaues geschildert und bilden den Gegenstand der Bewunderung der ganzen Welt. Der Norddeutsche Lloyd beherrscht heutzutage 20 Schiffahrtslinien, und zwar die Schnelldampferlinien Bremen-New-York und Genua-New-York, eine Postdampferlinie nach New-York, zwei Linien nach Baltimore, eine nach Galveston, zwei nach Brasilien, je zwei nach Argentinien und Ostasien, eine nach Australien, vier Zweiglinien im asiatischen Verkehr und vier europäische Linien. Am 1. Dezember 1899 verfügte der Norddeutsche Lloyd über ein Aktienkapital von 80000000 Mark, die Prioritätsanleihen der Gesellschaft betrugen 31050000 Mark, der Anschaffungspreis der vorhandenen Schiffe erreicht die Höhe von 143710000 Mark und deren Buchwert eine solche von 93530000 Mark.
Neben dem Norddeutschen Lloyd bestehen in Bremen zur Zeit noch sechs weitere Reedereien (Rickmers’ Reismühlen, Reederei und Schiffbauaktiengesellschaft, 13000000 Mark Aktien- und 5000000 Prioritätsanleihenkapital; Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft „Hansa“, 10000000 Mark Aktien-, 4950000 Prioritätsanleihenkapital u. s. f.).
Im Jahre 1897 betrug Bremens Einfuhr 2233212 Tonnen brutto, seine Ausfuhr 1161371 Tonnen brutto, das Gesamtgewicht seiner ein- und ausgeführten Handelswaren 3394583 Tonnen brutto, der Wert der Einfuhr 613500000 Mark, derjenige der Ausfuhr 385700000 Mark, der Wert der gesamten aus- und eingeführten Waren also 999000000 Mark. Im Jahre 1896 wanderten über Bremen aus 67040 Personen, 1897 deren 47000. Sehr bedeutend ist die Industrie und der Gewerbebetrieb Bremens, als Eisengießereien, Reismühlen, Jutespinnereien und Webereien, Cigarrenfabrikation, Segelmachereien, Seilereien, Schiffswerften u. s. f.
Bremen wurde um 789 durch den heiligen Willehad gegründet und zum Bischofssitze erhoben, der vom heiligen Ansgar um 848 mit demjenigen von Hamburg vereinigt wurde. Unter dem starken Schutz der Kirche entwickelte sich die Stadt rasch weiter, die im zwölften Jahrhundert von Heinrich dem Löwen mehrfach hart bedrängt wurde. An dem Kampf der Welfen mit den Staufern nahm Bremen als kaisertreue Stadt teil. Schon im dreizehnten Jahrhundert war die Abhängigkeit vom Bischof fast völlig beseitigt, und die Stadt fing an, sich die Verkehrsfreiheit auf der Weser vertragsmäßig zu sichern und auch mit den Waffen zu erkämpfen. Schwere innere Zwistigkeiten[S. 150] hatte Bremen im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert durchzumachen. Als Mitglied des Hansabundes hatte es zuweilen eine eigene Stellung gegenüber den übrigen Verbündeten inne, und seine Weigerung, sich dem Kampfe gegen Norwegen anzuschließen, trug ihm eine zeitweilige Ausschließung, die Verhansung, ein. Heinrich von Zütphen brachte ums Jahr 1522 die Reformation nach Bremen, das später ein Glied des schmalkaldischen Bundes wurde. 1623 errichteten die Oldenburger Grafen den Elsflether Zoll, gegen den Bremen jahrhundertelang vergebens Einspruch erhoben hat, und dessen Abschaffung erst im Jahre 1820 gelungen ist. 1646 wurde die Reichsunmittelbarkeit Bremens durch den Kaiser ausgesprochen, aber von den Schweden bestritten, denen das Erzstift durch den Westfälischen Frieden zugefallen war. Der kleine Staat führte deshalb zwei Kriege mit Schweden, die aber keinen Erfolg hatten. Als im Jahre 1741 das Erzstift in den Besitz des Kurfürsten von Hannover übergegangen war, wurde die Reichsunmittelbarkeit anerkannt, die aber durch schwere Opfer (Gebietsabtretungen) erkauft werden mußte. 1810 wurde Bremen dem französischen Kaiserreiche einverleibt und blieb bis 1813 die Hauptstadt des Departements der Wesermündungen. 1812 zählte Bremens Bevölkerung 35000 Seelen. Seit dieser Zeit hat es, wie wir auch schon weiter oben gesehen haben, einen gewaltigen Aufschwung genommen, wozu die Gründung Bremerhavens 1827–1830 den ersten bedeutenden Anstoß gegeben hat. Die jetzt in Bremen gültige Verfassung stammt von 21. Februar 1854. Die Stadt zählt jetzt 152000 Einwohner.
Die Stadt Bremen liegt 74 Kilometer von der Nordsee entfernt, am rechten Ufer die ehemals von Wällen umgebene Altstadt, am linken die Neustadt. Auf den drei Hauptplätzen der Altstadt, dem Markt, dem Domshof und der Domsheide, konzentriert sich das Leben Bremens. Vom Markt gehen auch drei der bedeutendsten Verkehrsadern der Stadt, die Langen-, Ober- und Sögestraße ab. Derselbe gewährt ein malerisches Bild; hier liegt zunächst das gotische, 1405–1410 erbaute Rathaus mit einer um 1610 hinzugekommenen Renaissancefassade an der Südwestseite. An der Westseite des Hauses ist der Eingang zu dem durch Hauffs „Phantasien“ weit und breit bekannt gewordenen Ratskeller, der mit Fresken von Arthur Fitger und mit Kernsprüchen von Hermann Allmers und anderen verziert ist (Abb. 104–116).
Vor der Südwestseite des Rathauses erblickt man die aus grauem Sandstein gefertigte Bildsäule des Roland, 5,5 Meter hoch, 1404 an Stelle einer hölzernen Statue des Paladins Karls des Großen hierhergestellt. Dem Rathause gegenüber steht das ehemalige Gildehaus der Kaufleute, 1537–1594 erbaut, jetzt der Sitz der Handelskammer, mit renovierter Fassade, und nahebei die im gotischen Stil gehaltene 1861–1864 errichtete Börse. Auf dem kleinen Platz zwischen Börse, Dom und Rathaus befindet sich der aus dem Jahre 1883 stammende Willhadibrunnen, auf dem die Statue des heiligen Willehad, von vier wasserspeienden Delphinen umgeben, zu sehen ist. An der Nordwestseite des Rathauses erhebt sich seit 1893 das von Bärwald modellierte Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I.
Der dem Alter nach bis zu den ersten Anfängen Bremens hinabreichende Dom ist mehrfach umgestaltet worden. Das dem heiligen Petrus geweihte, 103 Meter lange, 40 Meter breite und 31 Meter hohe Gotteshaus ist reich an verschiedenartigen Kunstschätzen, darunter eine von der Königin Christina von Schweden geschenkte Kanzel, ein bronzenes Taufbecken aus dem elften Jahrhundert u. s. f. Es besitzt ferner eine vorzügliche Orgel. Eigenartig ist der unter dem Chor befindliche Bleikeller, in welchem die darin aufbewahrten Leichname — der älteste soll 400 Jahre alt sein — nicht verwesen.
Nördlich vom Dom breitet sich der Domhof aus, an welchem verschiedene, in architektonischer Beziehung hervorragende Baulichkeiten liegen, so der Rutenhof und das Museum. Südlich vom Dom kommt man zur Domsheide, die das ursprünglich für Gotenburg bestimmte Denkmal des Königs Gustav Adolph von Schweden ziert. Stattliche Gebäude umgeben den Platz, so das gotische Künstlervereinsgebäude mit geräumigen Sälen, das im Renaissancestil gehaltene Reichspostgebäude von Schwalbe, 1876 bis 1878 erbaut, und das Gerichtshaus,[S. 151] ein Ziegelhausteinbau in deutscher Renaissance.
Von weiteren interessanten Bauten der Altstadt erwähnen wir hier noch die aus dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert stammende Liebfrauenkirche und die St. Johannis-Kirche, ein reingotischer Backsteinbau aus dem vierzehnten Jahrhundert, die alte Klosterkirche der Franziskaner. Am nördlichen Ende der verkehrsreichen Obernstraße treffen wir auf die 1856 restaurierte gotische Ansgariikirche (1229–1243 erbaut) mit einem schönen Altarblatt von Tischbein und einem 97 Meter hohen Turme. Davor steht eine von Steinhäusers Meisterhand geschaffene Marmorgruppe, der heilige Ansgar, der Apostel des Nordens, im Begriff, einem Heidenknaben das Joch abzunehmen. Gegenüber erblicken wir das alte Gildehaus der Tuchhändler, mit schöner Renaissancefassade. Dasselbe zeigt eine besonders schöne Eingangshalle mit den lebensgroßen Porträts bremischer Bürgermeister und Ratsherren und geräumige Säle (großer Saal und Kaisersaal). Zur Zeit ist das Haus der Sitz der Gewerbekammer von Bremen. Die Stephanikirche, eine in Kreuzform gehaltene romanische Pfeilerbasilika aus dem zwölften Jahrhundert, am nordwestlichen Ende der Altstadt, ist neuerdings renoviert worden und birgt ein schönes Marmorrelief von Steinhäuser, die Grablegung Christi. In der Langenstraße kann man noch eine Reihe interessanter Giebelhäuser beobachten, so das alte Kornhaus, das Stissersche Haus, das Essighaus u. s. f.
Die Brücken vermitteln den Verkehr aus der Altstadt in die Neustadt, im Nordwesten die auch für Fußgänger eingerichtete Eisenbahnbrücke, dann die 204 Meter lange eiserne Kaiserbrücke in der Mitte und die ebenfalls eiserne 137 Meter lange und 19 Meter breite Große Brücke im Süden. Am Rande der Altstadt ziehen sich die vom zickzackförmigen Stadtgraben umspülten und von Altmann geschaffenen Wallanlagen an Stelle der ehemaligen Festungsumwallungen hin, die, umrahmt von schönen Villen, mit den vor der Kontreskarpe belegenen Vorstädten durch sechs nach den alten Stadtthoren benannten Übergängen verbunden sind. Auf den Wallanlagen stehen das Stadttheater, die Kunsthalle mit der Gemäldesammlung, meist von der Hand moderner Meister, und schönen plastischen Kunstwerken, das Denkmal für die im Feldzuge 1870[S. 152] bis 1871 gebliebenen Söhne Bremens, das Marmorstandbild des Astronomen Olbers, die Büste Altmanns und Steinhäusers Marmorvase mit der Reliefdarstellung des sogenannten „Klosterochsenzuges“. Am südlichen Ende befindet sich ein kleiner Hügel mit schönem Blick auf die Weser und die Neustadt, die Altmannshöhe.
Jenseits des Stadtgrabens gelangt man in die von geschmackvollen Häusern und Villen — meist Einfamilienhäusern — gebildeten neuen Stadtteile mit schönen Kirchenbauten (St. Remberti, Methodistenkirche, Friedenskirche), und Brunnen (Centaurbrunnen), sowie dem großen Krankenhause (am Ende der mit Ulmen bepflanzten Humboldtstraße). Am Körnerwall, nahe bei dem an der Weser sich hinziehenden Osterdeiche steht ein Miniaturbronzestandbild Theodor Körners. In der Nähe des geräumigen Hauptbahnhofes trifft man das städtische Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde, 1891–1893 erbaut, mit den vereinigten städtischen Sammlungen, die äußerst sehenswert und sehr wertvoll sind; daneben erhebt sich die Stadtbibliothek, ein holländischer Renaissancebau, mit 120000 Bänden. Ueber dem Bahnhof hinaus führt der Weg zum Herdenthorfriedhof und zu dem 136 Hektare großen, wundervoll angelegten Bürgerpark mit herrlichen Waldpartien, Wildgehege, Meierei und dem äußerst behaglichen Parkhause, das Wirtschaftszwecken dient.
Der Freibezirk mit dem 7,8 Meter tiefen Freihafen liegt vor dem Stephanithor, im Nordwesten der Altstadt, nahebei das Haus Seefahrt, ein Asyl für alte Seeleute und deren Witwen, mit Fresken von Fitger im Hauptsaale. Über dem Thorwege liest man die Inschrift: „Navigare necesse est, vivere non necesse est.“ Am Freibezirk sind ferner eine Reihe bedeutender gewerblicher Anlagen, so die Reparaturwerkstätten des Norddeutschen Lloyd, die Werkstätten und Werft der Aktiengesellschaft Weser, Reismühlen u. s. f.
Die von 1622–1626 angelegte Neustadt weist keine große Besonderheiten auf. Im Barockstil erbaut, erhebt sich dort am Weserstrom die aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts stammende St. Pauli-Kirche und die 1822 gegründete Seefahrtsschule. In der Neustadt befinden sich auch die Kasernen.
Bremens Umgebung ist reich an großen und wohlhabenden Dörfern, welche teilweise beliebte Ausflugsorte seiner Bevölkerung sind. Mittels Dampfboot sowohl, als auch durch die Bahn ist das rechts von der Weser befindliche, über 4000 Einwohner besitzende, von den Landhäusern reicher Bremer Bürger umgebene Vegesack zu erreichen, mit bedeutender Industrie (Schiffswerften, Bootsbauereien, Tauwerkfabriken, Baumwollenspinnereien u. s. f.). Eine Fischereigesellschaft für Heringsfischerei besteht hier ebenfalls. In der Nähe sind die schöne Villen und Gärten besitzenden Orte Blumenthal und Rönnebeck. Auf der Bahnfahrt nach Vegesack erblicken wir bei Oslebshausen die große bremische Strafanstalt; bei Burglesum zweigt die Bahn nach Geestemünde und Bremerhaven ab. Osterholz-Scharmbeck mit regem gewerblichen Betriebe (Cigarren und Eisenwaren) an dieser Linie ist die Eisenbahnstation für die Malerkolonie Worpswede.
Letzteres ist ein freundlicher Ort am Weyersberge, von dessen mit einem Denkmal des Moorkommissars Findorf geschmückten Höhe man einen weiten Rundblick genießen kann. Wie eine Insel steigt die Erhebung aus der weiten Ebene auf, die im Hintergrunde von den blauen Linien der Geesthöhen begrenzt wird. Aus der Ferne winken die Türme der alten Hansestadt an der Weser herüber.
Den Künstlern, die dort schaffen, den „Worpswedern“, ist die Natur, mit welcher sie dauernd zusammenleben, aufs innigste vertraut. „Und doch ist nicht photographisch korrekte Wiedergabe, sondern die stark persönliche Auffassung, das Temperament für diese Worpsweder Bilder charakteristisch. Daher das Befremden des Beschauers, der ein solches Bild der wohlbekannten heimischen Natur verlangt, wie er es sieht. Daher die packende Wirkung auf den, welchem die Persönlichkeiten in der Kunst (und vielleicht auch in Wissenschaft und Leben) alles sind. Denn was uns sterblichen Menschen erreichbar und nötig, ist subjektive Wahrhaftigkeit, nicht objektive Wahrheit“ (Gildemeister).
Durch die so stimmungsvollen Bilder Fritz Overbecks, Fritz Mackensens, Otto Modersohns und Heinrich Vogelers ist die landschaftliche Scenerie um Worpswede weit[S. 153] in der Welt bekannt geworden. Freilich, wer etwas von der Worpsweder Malerkunst sehen will, wird in München oder in Dresden mehr davon finden, als in Worpswede selbst. „Was dort sichtbar ist,“ sagt Gildemeister, „sind die Ateliers der Maler — von außen.“
An Oldenbüttel und Stubben, sowie an Loxstedt mit seiner großen Torfstreufabrik vorbei wird die hannoversche Stadt Geestemünde am linken Ufer der Geeste, die hier in die Weser mündet, erreicht. Der 17500 Einwohner besitzende Ort ist 1857 von der hannoverschen Regierung angelegt worden, um Bremerhaven Konkurrenz zu machen, von dem es nur das Geesteflüßchen trennt. Geestemünde verfügt über einen geräumigen Hafen, 506 Meter lang, 117 Meter breit, mit hydraulischen Hebevorrichtungen u. s. f., der mit der Weser durch einen Vorhafen und eine mächtige Kammerschleuse mit Ebbe- und Flutthoren, die 67 Meter lange Schiffe aufnehmen kann, betreibt ferner eine aufblühende Hochseefischerei und besitzt Schiffswerften und Trockendocks (Abb. 117).
Bremerhaven ist an der Stelle der alten schwedischen Feste Karlsburg entstanden, die Karl XII. 1673 durch seinen Artillerieobersten Melle anlegen ließ. Dahinter sollte sich eine neue Handelsstadt mit Namen Karlsstadt erheben, von der bereits einige wenige Häuser standen, als ein vereinigtes Korps von Dänen, münsterischen, cellischen und wolfenbüttelischen Truppen vor Karlsburg erschien, dasselbe belagerte und größtenteils zerstörte. Ein späterer Wiederherstellungsversuch scheiterte, und die furchtbare Weihnachtsflut im Jahre 1717 that den Rest. Durch Vertrag vom 11. Januar 1827 trat Hannover das Gebiet des heutigen Bremerhavens an Bremen ab (für 73658 Thaler 17 Groschen 1 Pfennig), wofür Bremen sich verpflichtete, hier einen Seehafen anzulegen. Bald darauf fing man an, und am 12. September 1830 lief als erstes Schiff das amerikanische Fahrzeug Draper im neuen Hafen ein. Dem damaligen Bürgermeister Smidt von Bremen hat man im Jahre 1888 auf dem Markte des von ihm gegründeten 1853 zur Stadt erhobenen Ortes ein Denkmal aufgerichtet.
Das rasche Emporblühen Bremerhavens ist aufs innigste verknüpft gewesen mit dem großen Aufschwung, den Bremens Handel seit 50 Jahren genommen hat, wie wir weiter oben schon betont haben. Zur Zeit hat die Bevölkerung der Stadt die Zahl von 20000 Menschen erreicht. Drei mächtige, durch Deiche gegen Sturmfluten[S. 154] wohlgeschützten Dockhäfen, der Alte Hafen (jetzt 730 Meter lang und 100 Meter breit) südlich belegen und 1830 in Betrieb genommen, der 1851 eröffnete Neue Hafen in der Mitte (840 Meter lang und 100 Meter breit) und als nördlichster der 1876 dem Verkehr übergebene Kaiserhafen, der 1897 bedeutend vergrößert worden ist und den größten Schiffen Einfahrtsgelegenheit bietet — die neue Kaiserschleuse hat eine Länge von 215 Meter, 26 Meter Breite und 10,56 Meter Tiefe — bilden die 34 Hektare große Wasserfläche des Hafens. Zum Freihafengebiete, das nach dem Anschluße Bremens an den Zollverein geblieben ist, gehören der Kaiserhafen und der nördliche Teil des Neuen Hafens.
Bremerhaven ist mit breiten und regelmäßigen Straßen angelegt. Die etwa 70 Meter hohe Turmspitze seiner schönen, gotischen Kirche dient weithin auf der Weser dem Schiffer als Wahrzeichen (Abb. 118). Von großem Interesse ist auch ein Besuch im 1849 erbauten Auswandererhause, das zur Aufnahme der Auswanderer vor ihrer Einschiffung dient und von mustergültiger Einrichtung ist. Es kann 2000 Auswanderer zugleich beherbergen.
„Meine Besuche dieses Hauses,“ so erzählt Hermann Allmers, „gehören zu den interessantesten Erinnerungen meines Lebens, und manche Stunde schon trieb ich mich umher unter dem bunten Gewimmel, das von unten bis oben seine Räume füllte, mischte mich unter die Gruppen der Männer und Frauen, frischen Burschen und rosigen Mädchen, redete freundlich mit ihnen und fragte sie wohl mit Freiligrath:
Da hab’ ich denn manch tiefen Blick ins Menschenherz gethan, war’s nun in ein hoffnungsfreudiges oder in ein armes, halb verzweifelndes, und oft Niegeahntes hab’ ich vernommen.“ Unmittelbar grenzt im Norden Bremerhavens der hannoversche Flecken Lehe mit 22000 Einwohnern an die Stadt. Sowohl die Eisenbahn als auch eine teilweise elektrisch betriebene Straßenbahn verbinden beide Orte miteinander. Die Einfahrt in die Unterweser wird durch starke Befestigungen beherrscht, die auf beiden Seiten des Stromes aufgeworfen sind. Sieben Leuchttürme, zwei Leuchtschiffe und mehrere Leuchtbaken bezeichnen zur Nachtzeit das Fahrwasser des Weserstromes. Der Hohewegsleuchtturm und derjenige auf Rotesand sind besonders erwähnenswert. Der erstere von beiden erhebt sich im Dwarsgatt, und seine Laterne leuchtet aus einer Höhe von 35 Metern über das Wasser. Der Rotesandleuchtturm im offenen Meere wurde 1885 fertiggestellt und steht 14 Meter tief im Sande auf Caissons. Sein Laternendach erhebt sich 28,4 Meter über Hochwasser. Beide Leuchttürme sind mit Telegraphenstationen versehen.
Nördlich von Bremen, zwischen Lesum und Neuenkehn, tritt die Geest an das rechte Weserufer heran, alsdann begrenzt wiederum Marschland in der Breite von 5–7 Kilometer und mehr den Strom. Dieser schmale Marschstrich zerfällt in das Land Osterstade im Süden, etwa[S. 155] von Rade im Amte Blumenthal an bis zum Lande Wührden. Osterstade gehört zu Hannover, das nicht einmal eine Quadratmeile große Land Wührden dagegen ist oldenburgisches Gebiet. Dann folgt nördlich von Wührden das hannoversche Vieland, ein schmaler, aber sehr fruchtbarer Marschrand, der sich bis zum Geestefluß hinzieht. Die vier sehr wohlhabenden Dörfer, die dazu gehören, liegen alle auf der Geest selbst. Daran schließt sich wiederum weiter nach Norden zu das uns bereits bekannt gewordene Gebiet von Geestemünde und Bremerhaven, und dann kommt schließlich als nördlichstes der Marschlande am rechten Weserufer das Land Wursten.
Osterstade — der Name will so viel besagen als das östliche Stedingerland — unterscheidet sich eigentümlich auf den ersten Blick von den meisten Marschlanden. „Es trägt den Charakter einer einzigen weiten, üppiggrünen, von zahllosen Wassergräben nach allen Richtungen durchschnittenen Ebene, die, als fast durchweg kräftiges Weideland, von tausend buntscheckigen Rindern belebt wird. Hier und dort inmitten der weiten grünen Flächen ein paar Kornfelder; alle halbe Stunde ein buschreiches Dorf, meistens in der Nähe des Deiches, und endlich die großen Bauernhöfe, nicht wie in anderen Marschen einzeln umhergestreut, sondern fast alle im Weichbilde der Dörfer selbst liegend, die dadurch ein stattliches Ansehen erhalten. — Außer den Bäumen, welche die Häuser beschatten, und außer einer langen Reihe hoher Weiden der äußeren Deichbärme trifft das Auge selten auf Baumwuchs, da die Wege hier nicht, wie in anderen Marschen mit solchen bepflanzt sind.“ So beschreibt Hermann Allmers seine engere Heimat! Bei Alisni, dem jetzigen Dorfe Alse im oldenburgischen Kirchspiele Rodenkirchen, überschritt Karl der Große 797 die Weser und betrat Osterstade beim Dorfe Rechtenfleth, das, nebenbei bemerkt, Hermann Allmers’ Wohnsitz ist. Von hier aus zog er über Stotel nach Bederkesa und von dort ins Hadelner Land, dessen sächsische Bewohner er nach hartnäckigem Widerstand bezwang. Nahe bei Bederkesa wurde im Jahre 1855 eine lange Holzbrücke im Moor entdeckt, wie man meint, ein Denkmal dieses Heereszuges. Von den männlichen Bewohnern wird hier, wie übrigens auch noch in anderen Marschgebieten, der Springstock, in Osterstade „Klubenstock“ benannt, benützt, den wir schon bei den Bauern Eiderstedts kennen gelernt haben. Im Süden Osterstades herrscht das rein niedersächsische[S. 156] Element vor, im Norden das gemischt friesische, in Wührden dagegen tritt das Friesische im Gesichtstypus, im Charakter und in dem Namen der Bewohner schon ungleich merklicher hervor und läßt den Wührdener schon bedeutend derber, selbständiger und entschlossener auftreten, als seinen südlichen Nachbar, den Allmers, dem wir hier weiter folgen, als den in politischer Hinsicht allerzahmsten, gleichgültigsten und allerloyalsten sämtlicher Marschbewohner schildert. In Wührden und in den Marschen der nördlich davon in die Weser mündenden Lune ist reger Ziegeleibetrieb, da der schwarze Marschthon sich sehr gut dazu eignet und sehr harte und dauerhafte Mauersteine liefert, die fast durchweg von Arbeitern aus dem Lippeschen hergestellt werden.
Das Vieland — vom altfriesischen, mit „Sumpf“ gleichbedeutendem Worte „Vie“ — ist die Übergangsregion von der Fluß- zur Meeresstrandflora. Das Rohr nimmt ab, und dafür zeigen sich das Löffelkraut und andere Pflanzen des Meeresstrandes. In landwirtschaftlicher Beziehung steht dieser kleine Marschdistrikt oben an. Die Nähe von Bremerhaven, Geestemünde und Lehe, der vortrefflichen Absatzgebiete für die Produkte des Vielandes, trägt ungemein viel zu dessen stetig wachsendem Wohlstande bei.
Das Land Wursten ist fast gänzlich von Seemarsch gebildet, doch tritt in seinem nördlichen Teil, der vom Hamburger Amte Ritzebüttel eingenommen wird, die Geest bis an den Elbstrom heran. Die Marsch Wurstens grenzt unmittelbar an das Geestland, deutliche Randmoore fehlen hier. Dem südlichen Teil des Landes liegt auf dem linken Weserufer der Langlütjensand gegenüber, vor dem mittleren und nördlichen Teile desselben breiten sich weitausgedehnte Watten aus. Besonders fest ist der Seedeich gebaut; in seiner jetzigen Stärke wurde derselbe erst in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts errichtet und durch einen großen Umzug sämtlicher Bauern Wurstens zu Pferd und zu Wagen, durch einen feierlichen Gottesdienst in der Hauptkirche des Landes zu Dorum und durch ein Festessen eingeweiht. „In seiner Grundfläche 160 Fuß breit und nahe an 30 Fuß in seiner Höhe haltend, steht der Wurster Deich wohl als der stärkste Seewall der Provinz Hannover da. An schönen Sommertagen auf ihm zu lustwandeln ist einer der interessantesten Genüsse, gehoben durch die überraschenden Kontraste des segeltragenden Flusses, des mövenumschwärmten Watts und des fruchtbaren Landes mit seinen auffallend zahlreichen Kirchtürmen, Höfen und Dörfern im wogenden Saatenmeere“ (Allmers). Wursten ist 3,97 Quadratmeilen groß (= 21797 Hektaren) und hat eine Bevölkerung von 9000 Seelen, so daß auf die Quadratmeile 2264 Menschen kommen. Dorum mit etwa 1850 Bewohnern ist sein Hauptort und liegt etwa in der Mitte zwischen den vier südlichen Kirchspielen (Imsum, Wremen, Mulxum, Misselwarden) und den vier nördlichen (Paddingbüttel, Midlum, Cappel und Spieka). Die Kirchen sind klein und niedrig, an der Westseite mit einem dicken stumpfen Turm versehen und aus einem cyklopischen Mauerwerk von unbehauenen Findlingen aufgeführt. Der Boden Wurstens ist heller und sandiger als in den oberen Weser- und Elbmarschen, daher geeigneter zum Ackerbau, der die Haupterwerbsquelle der Bewohner bildet;[S. 157] nur im Süden des Landes wird auch Viehzucht getrieben. Der Name bedeutet so viel als das Land der auf den Wurten (Werften) sitzenden Bauern, der „Wurtsassen“, „worsati“ der lateinischen Schriftsteller, und des Plinius bekannte Beschreibung von unserer Nordseeküste paßt ganz für die ersten Ansiedelungen der Wurster, die sich schon in frühen Zeiten zu einem kühnen Seeräubervolk ausgebildet hatten. Die Bevölkerung ist rein friesischer Abkunft, und noch bis in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hinein hatte sich in Wursten die friesische Sprache erhalten, die jetzt nur noch in den Namen der Einwohner und der Ortschaften klingt. Von den alten Rechten der Wurster ist noch vielerlei erhalten geblieben, so die Landesversammlung zu Dorum, welche die Verwaltung der inneren Angelegenheiten des Landes, wie das Deich- und Sielwesen zu regeln hat.
Zwei große Übelstände im Lande Wursten, die sich übrigens auch in den übrigen Marschlanden mehr oder weniger fühlbar machen, sind das Marschfieber und der Mangel an gutem Wasser, so daß besonders in letzterer Hinsicht Winterkälte und dürre Sommer große Not hervorrufen.
Ihre besondere Freiheitsliebe und ihren großen Unabhängigkeitssinn haben die Wurster von alters her in vielen Kriegen bewährt, die meist von seiten der Bremer Erzbischöfe zu ihrer Unterwerfung gegen sie geführt worden sind, und selbst schreckliche Niederlagen, die sie erleiden mußten, und die argen Verwüstungen ihres Landes durch den Feind (1516 und 1526) hielten sie nicht ab, den Kampf für ihre Selbständigkeit immer wieder von neuem zu beginnen. In der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts trat in der Geschichte des Landes Wursten ein Wendepunkt ein. Des langen Haders und Kämpfens müde, entschlossen sie sich, dem Bremer Erzbischof billige Steuern zu zahlen, der dafür ihre Rechte anerkannte und gewährleistete. Später kam Wursten dann unter das schwedische, hierauf unter das dänische Scepter, im Jahre 1715 aber unter den Schutz des Kurhuts von Hannover. Seither hat es die Geschicke dieses letzteren Landes geteilt.
Eine 44 Kilometer lange Eisenbahnlinie verbindet nunmehr, das Land Wursten durchziehend, Geestemünde über Lehe, Imsum, Dorum u. s. f. mit Cuxhaven. Letzteres ist ein emporstrebender Flecken im hamburgischen Amte Ritzebüttel und seit 1872 mit dem gleichnamigen letzteren Orte[S. 158] vereinigt. Gegenwärtig zählt es 6200 Einwohner, verfügt über große im letzten Jahrzehnt erbaute Hafenanlagen (Anlegestelle für die Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie), eine Lotsenstation und hat zugleich auch ein früher vielbesuchtes, später durch die Konkurrenz der Seebäder auf den ostfriesischen Inseln etwas herabgekommenes, neuerdings aber wieder im Aufschwung begriffenes Seebad (Abb. 88 u. 89). Am Ende der Alten Liebe, der Strandpromenade Cuxhavens, steht ein 25 Meter hoher Leuchtturm; draußen an den äußersten Mündungen der Elbe erheben sich zwei weitere Leuchtfeuer auf der kleinen Marschinsel Neuwerk, nordwestlich von dieser bezeichnet die „Rote Tonne“ die Einfahrt in den Strom. Starke Küstenbefestigungen etwas nördlich von Cuxhaven verteidigen diese letztere. Ganz an der Nordspitze des Landes liegen endlich noch die kleinen unbedeutenden Orte Döse auf Marschland und Duhnen auf Geest, in welchen in neuerer Zeit Kinderhospize entstanden sind.
XVI.
Das Küstengebiet Oldenburgs und Ostfrieslands. Die ostfriesischen Inseln.
Ein schmales Band Landes trennt die Weser vom Jadebusen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der die Weser in mehrere Arme geteilt sich in die Nordsee ergoß und im Westen des gegenwärtigen Stromes die Entwickelung einer großen Deltabildung verursacht hatte. Das war in den Tagen, da der Jadebusen noch festes Land war, und bevor noch die Meeresfluten das Land Rustringen durchbrochen und diese 190 Quadratkilometer große Meereseinbuchtung geschaffen hatten, deren heutige Gestaltung erst in historischer Zeit vollendet worden ist. Soll doch die sogenannte Eisflut vom 17. Januar 1511 noch fünf Kirchspiele mit Mann und Maus alldort verschlungen haben.
Durch spätere Anschlickung, Verschlemmung und wohl auch durch die Arbeit fleißiger Menschenhände ist dieses Weserdelta in der Gegenwart verschwunden, wenn auch die einzelnen Arme desselben in der orographischen Beschaffenheit des Landes sich noch nachweisen lassen. Die Weser fließt heutzutage als ein breiter Strom nach der Nordsee, dessen Fahrwasser sich dicht an der Küste Oldenburgs hinzieht, hier und dort mit Sanden und Platen in ihrem Bette, wie beispielsweise die Strohauser Plate, die Luneplate u. s. f. Bei Geestemünde hat der Strom bereits eine Breite von 1325 Meter. Nordwestlich von Bremen legen sich die Marschen des Stedinger Landes an das linke Weserufer, denen weiter nördlich diejenigen des Stadlandes, und nach diesen das Butjadingerland folgen. Dem Nordosten und dem Norden der Halbinsel zwischen Weser und Jade lagern sich Watt- und Sandbildungen vor, der uns schon bekannte Langlütjensand im Osten, das Solthörner Watt, der Hohe Weg und die Alte Mellum im Norden. Westlich wird dieses Areal vom Jadebusen selbst und dann weiter nach Süden von großen Mooren umrandet. Derjenige Teil des Großherzogtums Oldenburg, der in das Bereich unserer Betrachtungen fällt und südlich etwa von der Bahnlinie begrenzt wird, welche von der Landeshauptstadt nach Leer führt, besteht aus Geestland (Ammerland) mit der Wasserfläche des Zwischenahner Meeres und daran liegenden großen Moorgebieten (Jührdener Feld), während die östliche Grenze des Oldenburger Küstenlandes in seinem südlichen Teil vom Lengener Moor bezeichnet wird, das mit dem großen Hochmoor Ostfrieslands im Zusammenhang ist. Der an der Jade belegene nördliche Teil besteht wiederum aus Alluvionen. Es ist das Jeverland.
Moore in überwiegendem Maße und dann Geest setzen Ostfrieslands Boden zusammen, der im Norden und Westen, an der See, am Dollart und am äußeren Mündungstrichter der Ems von Marschen und diesen vorgelagerten Watten umsäumt wird, über welchen hinaus die Wellen der Nordsee das Band der ostfriesischen Inseln bespülen.
Bäche und Flüsse in großer Zahl entwässern das ganze Areal zwischen Weser und Ems, von denen die an der Stadt Oldenburg vorbeiziehende und bei Elsfleth in die Weser fallende Hunte und die unweit von Leer in die Ems sich ergießende Leda die beiden bedeutendsten sind. Auch der 22 Kilometer lange Küstenfluß der Jade, welcher aus dem Vareler Hochmoor kommt und sich in den gleichnamigen Meerbusen wirft, mag hier noch erwähnt werden.
Das Stedinger Land besteht aus sehr tiefliegenden und vielfach den Überschwemmungen ausgesetzten Marschen, in denen viel Hafer, Hanf und Weiden gebaut und kultiviert werden, letztere um als Korbweiden, Faßbänder, zu Schlengen u. s. f. Verwendung zu finden. Die Entwässerung des Landes wird von großen, aus Steinen gebauten und einer Anzahl kleinerer wasserhebender Windmühlen besorgt. Großer Reichtum herrscht im Stedinger Lande nicht, dagegen ist aber auch kaum wirkliche Armut unter der dortigen, äußerst intelligenten, soliden und wohlgesitteten Bevölkerung zu finden, die ein beträchtliches Kontingent der Seeleute für die Weserhäfen abgibt. Wer nicht Landmann oder Handwerker ist, fährt zur See. Am Einfluß der Hunte in die Weser liegt an der Eisenbahn von Hude, einem Knotenpunkt an der Linie Bremen-Oldenburg-Leer, nach Nordenham, die kleine Stadt Elsfleth, wo früher ein wichtiger Weserzoll erhoben wurde, ein Schiffbau, Schiffahrt und Handel treibender Ort mit Navigationsschule. Hier schiffte sich am 7. August 1809 der Held von Olfers und von Quatrebras, Herzog Wilhelm von Braunschweig, mit dem Häuflein seiner Getreuen am Schlusse seines Zuges durch das vom Feinde besetzte deutsche Land ein. Eine gotische Steinpyramide erinnert an diese Begebenheit.
Zwischen der Hunte und dem Südrande des Stadlandes heißt das Land Moorriem, zu dem Elsfleth eigentlich schon gehört. Etwa elf Kilometer nördlich von dieser Stadt erscheint Brake (mit über 4000 Einwohnern), Station der Bahn nach Nordenham und durch eine Zweigbahn mit Oldenburg verbunden, eine gewerbreiche und viel Schiffahrt treibende Hafenstadt, in den Jahren 1848 und 1849 die Hauptstation der deutschen Kriegsflotte, in früherer Zeit ein wichtiger Ausfuhrort für das nach England verschiffte Butjadinger Vieh, worin ihm nun Nordenham den Rang abgelaufen hat.
Stadland trägt den Charakter der Flußmarsch, während Klima und Strandflora die Marschen Budjadingens als völlige Seemarsch kennzeichnen, die rings vom Salzwasser bespült werden. Auch hier steckt im Untergrunde des Bodens jener kalkreiche Schlick, wie in der Hadelner Marsch, den man ebenfalls zur Aufbesserung der Bodenoberfläche benützt, indem man denselben heraufbringt, eine Arbeit, die hier „wühlen“ genannt und etwas anders ausgeführt wird, als in den Elbmarschen. Stadland treibt mehr Viehzucht als Ackerbau, in Butjadingen herrscht letzterer vor. Die Marschhöfe sind gut gepflegt, und die Wohnstätten sind nicht nur zu zahlreichen kleinen Dörfern vereinigt, sondern auch als Einzelhöfe, dann aber fast immer an den Hauptstraßen des Landes reihenweise angeordnet, vorhanden. Die Bauart der Häuser ist meist die uns schon als Hauberg, hier „Berg“ genannt bekannt gewordene. Butjadingen und Stadland gehörten zu dem durch die Meeresfluten teilweise verschlungenen Land Rustringen, einem der sieben zu einem Bunde vereinigten friesischen Seelande, die ihre Versammlungen bei Aurich unter dem Upstallsboom abhielten.
Golzwarden, in der Geschichte des Landes viel genannt, Rodenkirchen mit seiner alten Kreuzkirche und Atens, wo die erste der von den Bremern erbauten Zwingburgen sich erhob, sind wichtige Orte unseres Gebietes. Bei Atens liegt das durch eine[S. 160] Dampffähre mit Geestemünde in Verbindung stehende Nordenham, ein Hochseefischereihafen. Die dortige Dampffischereigesellschaft „Nordsee“ hat in den drei ersten Monaten des Jahres 1900 2100500 Kilogramm Seefische auf den Markt gebracht (im gleichen Zeitraume 1899 1648000 Kilogramm), was etwa dem Schlachtgewicht von 21000 fetten Schweinen entsprechen würde. Blexen, Burhave, an dessen Kirchenmauer das alte Rustringer Landesmaß, eine Rute von 22 Fuß Länge, eingehauen ist, und Langwarden befinden sich noch weiter nördlich. Beim letztgenannten Orte wendet das Land um, und über die Kirchdörfer Tossens, Eckwarden, Stollhamm und Seefeld kommen wir längs der durch starkes Mauerwerk von hartgebrannten Ziegeln und sonstige Befestigungsmittel geschützten mächtigen Deiche am Ufer der Jade nach dem freundlichen, 5000 Seelen zählenden Städtlein Varel, das bedeutende Fabriken, so Spinnereien, Webereien, Färbereien, auch Eisengießereien und Maschinenfabriken, außerdem Viehhandel hat und ebenso regen Schiffsverkehr in seinen vom Vareler Siel gebildeten Hafen betreibt.
Die direkte Bahnverbindung von Bremen nach Varel führt über Delmenhorst nach Oldenburg. Hier zweigt der Schienenstrang nach Wilhelmshaven ab, welcher Varel berührt.
Das industriereiche Delmenhorst mit über 12500 Einwohnern, an der Delme, liegt zwölf Kilometer westlich von Bremen und hat große Cigarren- und Korkfabriken. Im Amte Delmenhorst selbst gibt es viele Korkschneidereien. Auch die Linoleum-Industrie Delmenhorsts ist von großer Wichtigkeit. Bei Grüppenbühren befindet sich der berühmte Eichenwald Hasbruch, der zusammen mit dem Urwald von Neuenburg im Jadegebiete im nördlichen Deutschland seinesgleichen sucht. „Echt urwaldschauerlich weht es uns an,“ wenn wir diesen prächtigen Wald mit seinen urgewaltigen Stämmen betreten, deren es so gewaltige gibt, daß sechs Männer sie kaum umklaftern können. Nach den Jahresringen zu urteilen, waren mehrere dieser Eichenbäume, welche gefällt werden mußten, 1000–1100 Jahre alt, reichten also auf die Zeit Karls des Großen heran. Und diese gefällten Eichen waren nicht einmal die größten. Das in der Nähe liegende Hude ist seiner großartigen Ruine[S. 161] der ehemaligen, im Jahre 1538 durch den bischöflich münsterischen Drosten Wilke Steding zerstörten Cisterzienserabtei wegen berühmt, ein frühgotischer Ziegelbau aus dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts.
Oldenburg, die Haupt- und Residenzstadt des Landes, an der hier schiffbaren Hunte und am Hunte-Ems-Kanal, sowie an einer Anzahl nach den verschiedensten Richtungen hinführender Bahnlinien belegen, zugleich bedeutender Garnisonsort, zählt gegenwärtig 26000 Einwohner. Im Südosten der Stadt erhebt sich das Schloß des Großherzogs, das schöne Gemälde und Fresken und mancherlei sehenswerte Kunstschätze enthält, auch eine reichhaltige Bibliothek sowie verschiedene Sammlungen. Besonders gerühmt werden die schönen Anlagen des Schloßgartens. Im Augusteum ist eine treffliche Gemäldesammlung älterer, besonders zahlreicher niederländischer Meister aufgehängt, die Sammlungen des Museums gewähren einen vortrefflichen Einblick in die Natur- und die älteste Kulturgeschichte Oldenburgs. Die ehrwürdige, aus dem dreizehnten Jahrhundert stammende, nunmehr renovierte fünftürmige Lambertikirche steht am Markt und ist das älteste Gotteshaus der Stadt, deren neuere Viertel von schönen Villen bebaut sind. Das 1891 abgebrannte und im verflossenen Jahrzehnt neu aufgeführte stilvolle Theatergebäude mag hier ebenfalls Erwähnung finden. Oldenburg betreibt lebhaften Handel und Schiffahrt, seine Pferdemärkte sind von großer Bedeutung und werden von weither besucht (Abb. 119–122).
Auf der Bahnfahrt zwischen Oldenburg und Varel kommen wir an der kleinen Ortschaft Rastede mit einem reizend gelegenen großherzoglichen Schlosse aus dem achtzehnten Jahrhundert in schattigen Parkanlagen vorbei. Hier stand früher ein Benediktinerkloster. In Rastede pflegt der Landesfürst einen Teil des Sommers zuzubringen.
Nördlich von dem uns schon bekannten Varel finden wir am Jadebusen auf einem Dünenvorsprung das Seebad Dangast, eine der wenigen Stellen an der ganzen Nordseeküste, an denen die künstliche Eindeichung unterbrochen ist. Draußen im Jadebusen liegt die Insel Arngast, die viel und stark von den Fluten heimgesucht worden ist und früher ein ansehnliches Dorf und grüne Weiden getragen hat. Nördlich davon, nahe dem Westrande des Busens, sind kleine uneingedeichte[S. 162] Schollen alten Marschlandes, echte Halligen, im Winter unbewohnt und nur im Sommer von Hirten mit ihren Schafherden aufgesucht, die Oberahnschen Felder.
Westlich von Varel, bei dem durch eine 19 Kilometer lange Zweigbahn mit diesem verbundenen Neuenburg, steht ein ähnlicher Urwald, wie derjenige von Hasbruch, der wundervolle Baumgruppen enthält und einen Flächenraum von etwa 30 Hektaren bedeckt, eine der ältesten Waldungen Deutschlands.
Die von Varel nach Wilhelmshaven ziehende Bahnlinie berührt Sande, den Knotenpunkt für die nach Wittmund oder nach Karolinensiel in Ostfriesland führenden Strecken, die sich wiederum in Jever verzweigen.
Wilhelmshaven, gegenwärtig 28000 Einwohner zählend, ist eine neue Stadt und die deutsche Marinestation der Nordsee, am in seinen inneren Teilen flachen, hier aber unseren größten Kriegsschiffen Einfahrt gestattenden Jadebusen. Als Preußen 1853 das Gebiet zur Anlage von Wilhelmshaven von Oldenburg erwarb, zählte dasselbe 109 Einwohner auf 340 Hektaren. Mit der zunehmenden Bedeutung, die unsere Marine durch die Gründung des Reiches erlangt hat, hat sich auch Wilhelmshavens Weichbild mehr und mehr gehoben. Die großartigen Hafenanlagen zerfallen in den im Südwesten der Stadt belegenen Neuen Hafen, der eine Fläche von 70000 Quadratmeter umfaßt und 8 Meter Tiefe hat. Derselbe dient für die in Dienst gestellten Kriegsschiffe und hat eine besondere für die Torpedoboote bestimmte Abteilung. Eine 174 Meter lange Schleuse verbindet den Neuen Hafen mit der 1886 eröffneten Neuen Einfahrt. Im Westen mündet der Ems-Jade-Kanal, von dem noch später die Rede sein wird, vermittelst einer 50 Meter langen und 7,5 Meter breiten Schleuse in diesen Hafen.
Nördlich vom Neuen Hafen treffen wir auf den Ausrüstungshafen, der sich in einer Länge von 1168 Meter bei 136 Meter Breite ausdehnt und mit dem vorgenannten in Verbindung steht. Eine 48 Meter lange Schleuse führt von hier in den Vorhafen und dann durch die Alte Einfahrt in die Jade hinaus. Der Bauhafen (377 Meter lang, 206 Meter breit) mit Trockendocks, je zwei zu 138 Meter und eines zu 120 Meter Länge, schließt sich im Westen an den Ausrüstungshafen an. Die Hafenanlagen sind von den zahlreichen Gebäuden der kaiserlichen Werft umgeben, auf welcher eine Anzahl unserer achtungsgebietenden Kriegsschiffe vom Stapel gelaufen sind, und die in Zukunft wohl noch weitere solcher Art erbauen wird (Abb. 123–125). Der deutsche Michel ist ja in diesen Tagen erwacht und hat begriffen, was der Große Kurfürst einmal in den Worten: „Schiffahrt und Handelung sind die fürnehmsten Säulen des Estats“ ausgedrückt hat.
Zweier Denkmäler, die in Wilhelmshaven errichtet worden sind, sei hier noch kurz gedacht, desjenigen des Prinzen-Admiral Adalbert von Preußen, von Schuler entworfen und 1882 enthüllt, vor der Elisabethkirche, und des vom gleichen Künstler modellierten Monuments Kaiser Wilhelms I., im Jahre 1896 eingeweiht. Heppens im Norden und Bant im Westen der Stadt Wilhelmshaven befinden sich bereits auf oldenburgischem Grund und Boden. Wilhelmshaven wird nach der Land- und der Seeseite zu von starken Befestigungen verteidigt.
Das Jeverland (Wangerland), das bis 1575 eine selbständige Herrschaft bildete und seit 1818 unter der Oberhoheit Oldenburgs steht, breitet sich nördlich von Wilhelmshaven bis an das Gestade der Nordsee aus. Jever, an einem nach Hooksiel führenden schiffbaren Kanale, mit 5300 Einwohnern, ist die Hauptstadt dieses Gebietes. Das Schloß ist der herrlichen im Renaissancestil gehaltenen Decke seines Audienzsaales wegen berühmt. Die Heimat der „Getreuen“[S. 163] ist zugleich auch der Geburtsort des großen Historikers Schlosser (1776 bis 1861) und des bekannten Chemikers Mitscherlich (1791 bis 1863). Beiden hat ihre Vaterstadt Denkmäler gesetzt. Hooksiel am Jadebusen besitzt Schiffswerften und betreibt Schiffahrt.
Über die reichbewaldete Geest, nur hier und da die vom Süden herantretenden Moorflächen berührend, zieht die Bahnlinie von Oldenburg nach Leer am schönen Zwischenahner Meer vorbei, das von einem Dampfer befahren wird und ein beliebtes Ausflugsziel der Bewohner der Landeshauptstadt bildet. Dann folgt Ocholt mit einer nach dem Geestorte Westerstede führenden Zweigbahn. Noch bevor wir die Landesgrenze überschreiten, erscheint Augustfehn im Lengener Moor mit seinem 4 Kilometer langen, etwa 6 Meter Sohlbreite und 1,5 Meter Tiefe besitzenden Kanal. Diese Fehnkolonie gedeiht besonders durch die dort im Jahre 1856 gegründete und mit Torf heizende Eisenhüttengesellschaft. Südlich dehnt sich das Saterland aus. Während Moor und Geestland die Bahnlinie im Norden begrenzen, zeigen sich allmählich im Süden die Alluvionen der Jümme, durch welche dieser Fluß sich hindurchwindet, der sich eine Meile oberhalb Leer mit der Leda vereinigt.

(Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
Ostfriesland bildet in politischer Beziehung den Regierungsbezirk Aurich. Die einzelnen Teile Ostfrieslands tragen jedoch im Volksmunde besondere Bezeichnungen. Im Norden und Osten von der[S. 164] Ems, im Westen vom Dollart und der holländischen Grenze, südlich von dem Bourtanger Moor umzogen breitet sich das Reiderland aus. Weener mit etwas über 3800 Einwohnern ist sein Hauptort, der Sammelplatz seiner Produkte, mit Handel und Industrie, großen Baumschulen und weithin bekanntem Pferdemarkt.
Auf dem rechten Emsufer bis Oldersum und landeinwärts bis gegen Oldendorf an der Westseite des Hochmoors heißt das Gebiet Moormer Land. Zwischen Ems und der 2 Kilometer unterhalb in diese mündenden Leda treffen wir als beträchtlichste Niederlassung dieses Gebiets die 11500 Einwohner zählende Handels- und auch Industriestadt Leer an. Erst spät hat sich der so günstig belegene Ort zum Handelsplatz entwickelt und bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wird er als solcher kaum genannt. Schiffe bis zu 5 Meter Tiefgang können auf der Ems und Leda bis zur Stadt gelangen und hier löschen (Abb. 126). Im Osten reicht das kleine nur das eine Kirchspiel Remels (in alten Zeiten Uplengen genannt) umfassende Lengener Land an das Moormer Gebiet. Besondere, hier übliche Rechtsgebräuche lassen darauf schließen, daß es eine sächsische Kolonie innerhalb des alten Friesenlandes ist. Nördlich von Oldersum, zwischen Ems, Dollart und dem Emsbusen der Ley, folgt das fast nur aus reinem Marschboden bestehende Emsiger Land. Seine Marschen sind reich an Werften, auf denen sich die Bevölkerung angesammelt hat. Einige derselben sind so klein, daß nur die dichtgedrängten Häuser des Dorfes darauf Platz haben und die Gärten auf dem tiefer liegenden Boden angelegt werden mußten. Den Marschgürtel Ostfrieslands begleitet ein Streifen anmoorigen Bodens, das sogenannte Dargland, auf seiner Innenseite, der wesentlich tiefer liegt als Marsch und Hochmoor, aus welchem Grunde er auch mit zahlreichen Seenflächen besetzt ist, beispielsweise das große Meer bei Wiegoldsbur nordöstlich von Emden. Es sind im Darglande dieselben Verhältnisse, die wir im Sietlande Hadelns bereits kennen gelernt haben. Im Winter ist das Ganze meist überschwemmt.
Noch bis in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts hinein war das heute vom Dollart eingenommene Areal ein etwa 400 Quadratkilometer großes Land, darauf eine Stadt, drei Flecken und fünfzig Ortschaften und Dörfer standen. Die Mehrzahl dieser Orte lag im nordöstlichen Teil des Gebietes. Am 12. Januar 1277 fingen die[S. 165] Zerstörungen durch die Meereswellen an, und die Flut von 1287 vollendete, was die ersteren begonnen hatten. Von 1539 ab datieren die Versuche, dem Ocean das entrissene Land wieder abzugewinnen, zunächst auf der Seite Hollands, seit dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts auch auf der rechten Seite des Busens. 1682 wurde der Charlottenpolder, 1752 der Landschaftspolder, gesegnete Marschländer, eingedeicht. Die Ems floß vor dem Einbruch des Dollart mit einem Bogen von kurzem Radius unmittelbar an der Stadt Emden vorüber, und die Seeschiffe konnten vor ihren Thoren ankern. Als aber 1277 der hoch aufgestaute Fluß die Halbinsel Nesserland zerriß und zur Insel machte, bevorzugten die Gezeitenströme das nunmehr gerade gelegte Flußbett und spülten die seitwärts gelegene Stromschlinge, das Emdener Fahrwasser nur mangelhaft, so daß dort ein fataler Schlickfall die Wassertiefen rasch und stetig verminderte. „Emden,“ sagt Krümmel, dessen Abhandlung über die Haupttypen der natürlichen Seehäfen wir diese Mitteilungen entlehnt haben, „stand damals, im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, unter den berühmten und blühenden Hansastädten vorn in erster Reihe, was es dem Vorzug verdankte, daß die Schiffahrt auf der unteren Ems niemals durch Eis behindert wird; der Tuchhandel nach England und die nordische Fischerei auf Wale und Heringe beschäftigten über 600 große Seeschiffe, und an Unternehmungsgeist und Reichtum übertraf es unzweifelhaft das damalige Hamburg und Bremen. Der noch heute viel bewunderte Rathausbau entstammt dieser goldenen Zeit.“

(Nach einer Photographie von Wolffram & Co. in Bremen.)
Bei zunehmender Versandung des Flußarmes am Ende des sechzehnten Jahrhunderts stellten die Emdener unter großen Kosten und mit vieler Mühe den Zustand von 1277 vermittelst des langen Dammes „Neßmer Höft“ wieder her. Die Ems wurde in ihr altes Bett zurückgeleitet, und Nesserland wurde wieder zur Halbinsel. Im Verlaufe der Zeit waren aber Emdens Bewohner durch verschiedene Umstände verhindert, das Neßmer Höft zu erhalten. Dasselbe verfiel und wurde im Jahre 1632 aufgegeben. Infolgedessen suchte der Fluß abermals sein geradeaus führendes Bett auf, das alte, an Emden vorbeiziehende verschlickte, und so liegt die Stadt denn heutzutage etwa 4 Kilometer von der Ems[S. 166] entfernt. Der kurze Aufschwung von Handel und Schiffahrt, den Emden nach dem Frieden zu Basel 1795 erleben durfte, nahm durch die Kriege mit Napoleon, die Kontinentalsperre, die holländische und die französische Fremdherrschaft ein rasches Ende. Während dieser Zeiten wurden 278 Emdener Schiffe mit wertvoller Ladung in fremden Häfen fortgenommen. Emden wurde zum Rang einer kleinen Landstadt herabgedrückt. Auch das im Jahre 1846 mit großen Opfern von der Stadt geschaffene neue Fahrwasser nach der Ems konnte ihr nicht aufhelfen. In der Gegenwart ändert sich aber die Sachlage. Dadurch, daß die preußische Regierung die Unterhaltung des Hafens in Verbindung mit der Anlage des Ems-Jade-Kanals übernahm und eine neue Seeschleuse (120 Meter lang, 6,5 Meter tief und von 15 Meter nutzbarer Breite) schuf, die den Wasserspiegel beständig auf Hochwasser erhält, ferner umfangreiche Binnenhafenanlagen erstehen ließ, hat der Schiffsverkehr zugenommen und wird durch den weiteren Umstand, daß der Dortmund-Emshäfen-Kanal Emdens Handel ein großes Hinterland durch eine schiffbare, ihresgleichen suchende Wasserstraße erschlossen hat, noch weiter und glänzend gehoben werden (Abb. 127–129).
Nach einer Zusammenstellung des königl. Hafenamtes zu Emden aus dem laufenden Jahre über die Entwickelung des dortigen Schiffsverkehrs seit der Verstaatlichung des Hafens im Jahre 1888 betrug die Zahl der ein- und der ausgegangenen Schiffe:
| 1888: | 806 | Seeschiffe | ( 33818 Registert.), |
| 1209 | Flußschiffe | ( 18599 Registert.), | |
| 1893: | 1022 | Seeschiffe | ( 51774 Registert.), |
| 2938 | Flußschiffe | ( 42811 Registert.), | |
| 1899: | 1319 | Seeschiffe | (141844 Registert.), |
| 4290 | Flußschiffe | ( 70553 Registert.). |
In der Berichtszeit hat sich also der Verkehr, was die Schiffszahl anlangt, beinahe, was den Raumgehalt der Fahrzeuge angeht, mehr als verdreifacht.
Der Dortmund-Emshäfen-Kanal liegt außerhalb des Bereiches unserer Betrachtungen, der Ems-Jade-Kanal jedoch, der Ostfriesland durchquert, gehört in unser Gebiet. Derselbe war ursprünglich geplant und angelegt, um die großen Moorflächen dieses Landes aufzuschließen und um[S. 167] in Kriegszeiten Wilhelmshaven von Ostfriesland her verproviantieren zu können, ferner um die Entwässerung eines großen Teiles dieser Provinz zu verbessern und um seine Spülkraft für den Kriegshafen an der Nordsee zu verwerten. In Emden beginnt diese Wasserstraße und endet im Neuen Hafen zu Wilhelmshaven. Dieselbe ist 73 Kilometer lang. Mit Benutzung der älteren Treckfahrt zwischen Emden und Aurich wurde der Kanal von der preußischen im Verein mit der Reichsregierung in den Jahren 1880–1887 mit einem Kostenaufwand von 13967500 Mark gebaut. Er ist im Wasserspiegel 18 Meter breit, 8,5 Meter auf seiner Sohle und in der Mitte 2,1 Meter tief. Vor der Mündung bei Wilhelmshaven ist diese Tiefe auf einen Kilometer Strecke auf 3 Meter erhöht worden. Fünf Schleusen, mit je 33 Meter Kammerlänge, 6,5 Meter lichter Weite und 2,1 Meter Tiefe befinden sich auf seiner Gesamtlänge. Der Schleuse in Wilhelmshaven ist schon früher gedacht worden; ihre größeren Dimensionen wurden im Hinblick auf eine spätere Erweiterung der Wasserstraße, die wohl einmal in denjenigen des Dortmund-Emshäfen-Kanals ausgebaut werden dürfte, gewählt. Mit dem letzteren steht der Ems-Jade-Kanal durch den Seitenkanal Oldersum-Emden in Verbindung. Kleine Schraubendampfer vermitteln den Güterverkehr und die Passagierfahrten zwischen Emden-Aurich und Aurich-Wilhelmshaven. Auf die Melioration des von ihm durchzogenen Landes wirkt der Kanal ungemein fördernd ein (Marccardsmoor bei Wiesede). Die Baggerarbeiten in der Jade fördern jährlich etwa 200000 Kubikmeter Schlick, wovon große Mengen auf dem Kanal für die daran belegenen Moorkolonien verschifft werden.
Das älteste Emden wurde auf einer großen Werft, vielleicht der größten an der ganzen Nordseeküste, 400 Morgen Fläche umfassend und 10–12 Fuß über die umliegende Marsch erhaben, erbaut. Daraus entstand die später so bedeutende Handelsstadt. Gegenwärtig zählt Emden 14800 Einwohner. Es bietet mancherlei Interessantes. Das im edelsten Renaissancestil errichtete Rathaus aus den Jahren 1574 bis 1576 enthält wertvolle alte Waffen, das Museum der Gesellschaft für Kunst und vaterländische Altertümer, schöne Gemälde niederländischer Künstler, Münzen- und Altertumssammlungen. Auch die Große Kirche mit dem Denkmal des Grafen Enno II. von Ostfriesland ist sehenswert. Eine Kleinbahn führt von Emden in die Halbinsel Krumme Hörn. Die Leybucht, welche dieselbe nördlich umgrenzt, ist wohl erst durch die Flut im Jahre 1373 entstanden.
Die Marschen des Norderlandes im Norden, der Rücken des Hochmoores im Osten begrenzen das sich östlich an das Emsiger Land anschließende Broekmer Land, dessen Name von den vielen Wiesenmooren oder Brüchen, die seinen Boden bedecken, kommt. Es war in den Zeiten des Mittelalters seiner vier ansehnlichen Kirchspiele Marienhave, Utengerhave, Victorhave und Lambertushave wegen berühmt. Marienhave stand, bevor die Eindeichungen an der Ostseite der Ley zustande gekommen waren, durch ein vertieftes Fahrwasser, das[S. 168] Störtebeckers Tief, in Verbindung mit der See und bot den Vitalienbrüdern einen Zufluchtsort. Auf dem quer durch das sonst unwegsame Hochmoor verlaufenden, sich bis Esens und Wittmund hinziehenden und zuweilen sogar von Dünen besetzten Geestrücken, über welchen der Verbindungsweg von der Ems zur Nordküste Frieslands dahingeht, lag die von zehn Dörfern umgebene Kirche von Lambertushave. Eines dieser letzteren, Aurichhave oder Aurike, überflügelte die übrigen und wurde von den Cirksena, den Fürsten des Landes, zu ihrer Residenz erhoben. Die heutzutage 5900 Einwohner zählende Stadt Aurich, Hauptort des Regierungsbezirks, Gewerbe und Handel betreibend, bekannt durch ihren starken Gartenbau und ihren bedeutenden Pferdemarkt, ist daraus entstanden. Südlich von Aurich, bei Rahe, erhebt sich ein kleiner, rasenbewachsener Hügel, der von niedrigem Gestrüpp umgeben ist. Vor Zeiten trug sein Scheitel drei hohe Eichen, und hier, am Upstallsboom (Obergerichtsbaum) kamen die Abgeordneten von ganz Friesland zusammen, um über Landfriedensbündnisse oder kriegerische Dinge zu beraten. Im Osten von Aurich dehnt sich das Hochmoor und weites Heidegebiet aus bis an die Marschen Wangerlandes. Dieser Teil, die ödeste Strecke Ostfrieslands, bildete ehemals zusammen mit dem früheren Amte Friedburg und dem schon im Marschlande liegenden Gebiete von Neustadt-Gödens das Land Ostringen. Die Marschen an der Nordsee zerfallen in das Nordernerland im Westen, etwa mit Dornum als Ostgrenze; die nachher zu besprechenden Eilande Norderney und Baltrum gehören dazu. Von der Gegend von Dornum bis an die oldenburgischen Marken, Langeoog und Spiekeroog in sich einbegreifend, reicht das etwa 400 Quadratkilometer umfassende Harlinger Land. Ein tiefer Busen, die Harlbucht, die trichterförmig in das Land eingriff und südlich bis Wittmund vordrang, trennte dasselbe noch bis in das sechzehnte Jahrhundert hinein vom Wangerlande. 1547 wurde mit den Eindeichungen der Anfang gemacht. Wittmund, Esens und Stedesdorf waren die drei Häuptlingschaften vom Harlinger Land, dessen Herrscher zwar die Cirksena als Nachfolger der alten Häuptlingsfamilie des Sibo waren, das aber nur durch Personalunion mit Ostfriesland verbunden gewesen ist. Erst durch Preußen wurde es 1745 mit letzterem vereinigt. Norden mit 7000 Einwohnern, an einem zum Leybusen führenden Kanal, mit viel Gewerbsamkeit (Geneverbrennereien, Zuckerwarenfabrikation, Tabakindustrie) und Handel, hat einen architektonisch schönen Marktplatz (s. Abb. 130 u. 131). Vier Kilometer davon liegt Norddeich, die Dampferstation für Norderney.[S. 169] Eine Eisenbahnlinie verbindet Norden über Georgsheil, von wo sich ein Schienenstrang nach Aurich abzweigt, mit Emden, und längs der Marsch über Esens, einer Stadt mit etwa 2100 Seelen, die durch das Benser Siel mit dem Meere verbunden ist, sowie Wittmund und Jever. Das erstere ist durch das Harletief für kleinere Fahrzeuge vom Meere her erreichbar. Es hat nicht unbedeutenden Viehhandel. Nördlich davon, an der See, liegt Karolinensiel mit gutem Hafen und aufblühendem Handel.
Eine Gesamtlänge von 90 Kilometer hat die Kette der ostfriesischen Inseln, die sich von der Jade im Osten bis zur Westerems hinzieht und erst eine ost-westliche Richtung bis einschließlich Norderney einnimmt, um dann mit den beiden westlichsten dieser Eilande, mit Juist und Borkum, nach Süden abzuweichen. Im Osten beginnt die Kette mit dem unter Oldenburgs Oberhoheit stehenden Wangeroog, nach Westen zu folgen Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Juist und Borkum, zum Regierungsbezirk Aurich gehörig. Schmale Seegate trennen die einzelnen Eilande voneinander, bis auf das mitten im äußersten Mündungstrichter der Ems belegene Borkum, und mit Ausnahme dieses letzteren sind die Inseln auch alle wattfest. Ihre Größe ist verschieden angegeben worden, je nachdem man nur die Dünen und das bewachsene Grasland, oder auch den oft weit ausgedehnten Strand mit einbezieht. Wenn man als diesen letzteren das bei gewöhnlichem Hochwasser noch unbenetzte Areal begreift, so würde der Flächenraum der Inseln etwa 80 Quadratkilometer ausmachen. Der Körper der Eilande besteht aus einem sehr gleichmäßigen und feinen gelblich weißen Sande mit Beimengung von zahlreichen Titaneisenkörnern und von Kalk, dem Überreste der zerriebenen Muschelschalen, und diese gesamten Sandmassen ruhen wiederum entweder auf alten Sandbänken oder auf dem Schlick der Wattwiesen. Auch auf den ostfriesischen Inseln tritt uns die Dünenbildung in großartiger Weise entgegen. Buchenau, dem wir eine interessante und sehr wertvolle Darstellung dieser Eilande und ihrer Flora verdanken, schildert dieselbe wie folgt:
„Dem mannigfachen Aufbau der Dünen entsprechend ist denn auch der Anblick unserer Inseln ein überraschender. Er bietet sich am besten auf dem Watt von einem Fährschiff aus dar. Die Insel mit ihren mannigfach eingeschnittenen Erhebungen gleicht dann einem fernen Hochgebirge, und die Schwierigkeit der Schätzung von Entfernungen und Höhen auf der Wasserfläche verstärkt diesen Eindruck für den Landbewohner noch sehr. Das Gewirre der Sandhügel ahmt steile Gipfel und ausgedehnte Schneefelder, schroffe Einstürze und plötzliche Gletscherabstürze nach, und vor ihnen dehnen sich scheinbar bewaldete Berge und die flache Kulturebene aus.“
Bäume gedeihen nur im unmittelbaren Schutze der Dünen und Häuser. Auf den Dünen wachsen der Dünenweizen, die Dünengerste[S. 170] und besonders der Dünenhafer oder Helm, der bekanntlich durch seine Stöcke dazu beiträgt, die Düne zu erhöhen, und durch seine zähen, bis 5 Meter Länge erreichenden Wurzelausläufer mit ihren zahlreichen, nicht minder langen, geschlängelten Wurzeln die Düne durchzieht und sie auf solche Weise festigen hilft. Auf den Wattweiden grünen die Meerstrandbinse und der Krückfuß, in den Dünenthälern die Zwergweide, der stachelige Sanddorn u. s. f. Die Gesamtzahl der auf den ostfriesischen Inseln einheimischen höheren Gewächse beträgt etwa 400 Arten.
Unter der Tierwelt zeichnet sich der hier ungewöhnlich häufige Kuckuck aus, Strand- und Wasservögel beleben die Inselwelt, Fledermäuse, die Wühlmäuse und am Strande die Seehunde vertreten die Säuger, die früher hier zahlreichen Kaninchen sind ausgerottet worden. In neuerer Zeit wurden Hasen eingeführt, die sich auf einigen Inseln, so auf Langeoog, sehr vermehrt haben.
Die Bevölkerung ist echt friesisch; sie treibt Schiffahrt, Fischfang und da, wo es geht, etwas Ackerbau, so die Kartoffelkultur, immerhin aber nur in sehr beschränktem Maße. Die meisten ostfriesischen Inseln besitzen Rettungsstationen, und auf allen sind Nordseebäder, die, wie Borkum und Norderney, Weltberühmtheit erlangt haben. Das letztgenannte Eiland hat das besuchteste deutsche Nordseebad überhaupt und zählt jährlich etwa 24000 Badegäste. Starke Uferschutzwälle halten an den dem Andrang der Fluten ausgesetzten Stellen die brandenden Wogen der Nordsee ab und tragen zur Sicherung der auf den Inseln befindlichen Dörfer und Wohnstätten bei.
Wangeroog (Abb. 132–134) steht über Karolinensiel-Harle mit dem Festlande in Verbindung. Als Seebad ist die Insel schon seit dem Jahre 1819 bekannt. Kirche und Dorf befinden sich auf dem Eiland. Spiekeroog (Abb. 135–137) ist auf demselben Wege oder über Esens und Neu-Harlingersiel zu erreichen, und vom Dorfe bis zum Strand führt eine Pferdebahn. Auf Langeoog, das 1717 durch die Wogen mitten durchgerissen worden ist, so daß Kirche und Dorf zerstört wurden, ist ein vom Kloster Loccum verwaltetes Hospiz; das dortige aufblühende Seebad ist, wie dasjenige von Spiekeroog einfacheren Verhältnissen angepaßt (Abb. 138–142). Über Esens und Bensersiel gelangt man dorthin, und über Dornum und Neßmersiel nach Baltrum, der kleinsten der sieben ostfriesischen Inseln, die ein Ost- und ein Westdorf besitzt (Abb. 143–148). Nach der Flut vom Jahre 1825 mußten Dorf und Kirche, die an der Westseite der Insel gelegen hatten, nach deren Mitte übertragen werden.
Norderney ist 13 Kilometer lang und 4 Kilometer breit; an der Südwestecke der Insel erhebt sich das gegenwärtig 3000 Seelen zählende gleichnamige Dorf. In der schönen Sommerszeit ist das unter staatlicher Verwaltung stehende Seebad Norderney ein Modebad im vollen Sinne des Wortes, mit allen Annehmlichkeiten und jedem nur denkbaren Komfort, das Ostende und Blankenberghe in den Schatten stellt. Ein schön und zweckmäßig eingerichtetes Konversationshaus, großartige Gasthöfe, praktische Badehäuser, auch für warme Seebäder, wie sich solche übrigens auch auf der Mehrzahl der anderen ostfriesischen Inseln finden, gut ausgerüstete Verkaufsläden und dergleichen Dinge mehr befinden sich hier. Am nördlichen Strande steht der bekannte Restaurationspavillon, die Giftbude. In Norderney hat der Verein für Kinderheilstätten an den Seeküsten ein zur Aufnahme von 240 Kindern eingerichtetes Seehospiz erbaut, das unter dem Protektorate der Kaiserin Friedrich steht, ebenso ist auf der Insel eine evangelische Diakonissenanstalt zur Heilung skrophulöser Kinder, zwei Unternehmungen, die seit der Zeit ihres Bestehens schon vielen Segen gestiftet und manchem kranken Kinde wieder zur Gesundheit verholfen haben (Abb. 149–155).
Im Osten ist Norderney von 11–15 Meter hohen Dünen bedeckt, im Süden steigt der 54 Meter hohe, einen prächtigen Rundblick gewährende Leuchtturm auf, nördlich davon erhebt sich der höchste Punkt der Insel, die nunmehr mit Helm bepflanzte, früher aber kahle Weiße Düne.
Während der tiefen Ebbe ist Norderney vom Festlande aus durch das seichte Watt trockenen Fußes zu erreichen. Auch der Postwagen fährt dann über die Watten.
Das langgestreckte Juist hing in alten Zeiten mit Borkum zusammen. Im dreizehnten Jahrhundert soll eine grausige Wasserflut beide Eilande voneinander getrennt[S. 171] haben. Der Pastor Janus zu Juist war zu Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts der erste, der, wenn auch damals ohne Erfolg, auf die heilsamen Wirkungen der Seebäder hingewiesen hat. Juists Bedeutung als Seebad nimmt jährlich zu. Gegenwärtig ist der Landungsplatz mit dem Dorfe bereits durch eine Eisenbahn verbunden (Abb. 156 u. 157).
Man fährt nach Norderney und Juist über Norden und Norddeich, Norderney ist außerdem noch in direktem Seeverkehr mit Bremen und Hamburg durch Schiffe der Hamburger Nordseelinie, die auch nach Borkum fahren. Letzteres erreicht man auch mittels Dampfboot von Emden oder von Leer aus.
Das 8 Kilometer lange und 4 Kilometer breite Borkum, das Burchana oder Fabaria der Römer, hat durch die Sturmfluten in früheren Jahrhunderten viel zu leiden gehabt. Nunmehr ist die in West- und Ostland zerfallende Insel ein sehr emporstrebender und vielbesuchter Badeort, der Norderney nicht allzusehr nachstehen dürfte (jährlich 14000 Badegäste) und einen vorzüglichen Badestrand besitzt. Der Hauptort liegt auf dem Westlande; in demselben ragen die beiden Leuchttürme empor, der alte, 47 Meter hohe, und der neue, 60 Meter Höhe aufweisende und ein Blinkfeuer erster Ordnung besitzende (Abb. 158–165). Der Ort selbst steht mit der Landungsbrücke durch eine Eisenbahn in Verbindung. Borkums Weiden ernähren einen ansehnlichen Viehstand. Eine Eigentümlichkeit der Insel bilden die aus Walfischknochen hergestellten Straßenzäune. Ansehnliche Brutstätten von vielerlei Seevögeln liegen auf Borkums Ostlande, in noch größerem Maße ist dies auf Rottum der Fall, einem westwärts von Borkum belegenen und schon Holland zugehörigen Eiland.
Hier sind wir am Ziele unserer Reise angelangt. Hoch oben, im Norden Schleswigs, bei Endrup haben wir den Wanderstab in die Hand genommen, an der Nordwestgrenze des Reiches, angesichts der holländischen Küste, stellen wir denselben wieder beiseite. Unseren Lesern aber, die uns auf dieser langen Fahrt begleitet haben, die mit durch die großen Hansestädte, durch die alten Flecken und die reichen Dörfer gezogen sind, über die schwermütig stimmende Heide, das düstere und öde Moorland oder in die fetten Marschen, und dann hinaus an den vom frischen und lebendigen Hauch der brandenden Nordsee durchwehten Inselstrand mit seinem weißblinkenden Dünensaum, sagen wir ein herzliches Lebewohl!
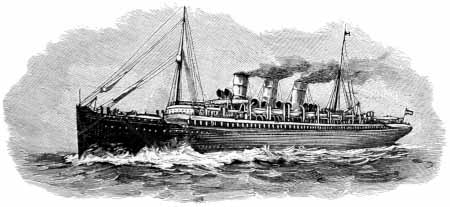
Einige der wichtigsten Quellenwerke und Abhandlungen zu dem vorliegenden Buche.
Allmers, Hermann. Marschenbuch. Land- und Volksbilder aus den Marschen der Weser und Elbe. Dritte Auflage. Oldenburg und Leipzig. Ohne Jahreszahl.
Boysen, L. Dr. Statistische Übersichten über die Provinz Schleswig-Holstein. Kiel und Leipzig, 1892.
Buchenau, Dr. F. Über die ostfriesischen Inseln und ihre Flora. (Verhandlungen des elften deutschen Geographentages zu Bremen, 1895.) Berlin, 1896.
Bücking, H., Baurat in Bremen. Die Unterweser und ihre Korrektion. (Verhandlungen des elften deutschen Geographentages zu Bremen, 1895.) Berlin, 1896.
Eckermann, Baurat in Kiel. Verschiedene Abhandlungen über die Geschichte der Eindeichungen an der Westküste Schleswig-Holsteins. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte.) Kiel.
Eilker, Georg. Die Sturmfluten der Nordsee. Emden, 1877.
Festschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Provinzial-Vereins zu Bremervörde (Regierungsbezirk Stade). Stade, 1885.
Guthe, H. Die Lande Braunschweig und Hannover, mit Rücksicht auf ihre Nachbargebiete geographisch dargestellt. Hannover, 1867.
Haage, Reinhold. Die deutsche Nordseeküste in physikalischer und morphologischer Hinsicht. (Inauguraldissertation) Leipzig, 1899.
Haas, H., Krumm, H. und Stoltenberg, Fritz. Schleswig-Holstein meerumschlungen in Wort und Bild. Kiel, 1897.
Hahn, F. G. Die Städte der norddeutschen Tiefebene in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung. Stuttgart, 1885.
Hansen, C. P. Chronik der friesischen Uthlande. Altona, 1856.
Hansen, Reimer. Beiträge zur Geschichte und Geographie Nordfrieslands im Mittelalter. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, Bd. 24.) Kiel, 1894.
Jensen, Chr. Die nordfriesischen Inseln Sylt, Föhr, Amrum und die Halligen vormals und jetzt. Hamburg, 1891.
Krümmel, Otto. Die geographische Entwickelung der Nordsee. Ausland.
Lepsius, R. Geologische Karte des Deutschen Reiches. Gotha, 1894–1897.
Meiborg, R. Das Bauernhaus im Herzogtum Schleswig und das Leben des schleswigschen Bauernstandes im 16., 17. und 18. Jahrhundert. Deutsche Ausgabe besorgt von R. Haupt. Schleswig, 1896.
Meyn, Ludwig. Geographische Beschreibung der Insel Sylt und ihrer Umgebung. Berlin.
Meyn, L. Geologische Übersichtskarte der Provinz Schleswig-Holstein 1 : 300000. Berlin, 1881.
Nauticus. Jahrbuch für Deutschlands Seeinteressen. Berlin, 1899.
Reventlow, Graf Arthur von. Über Marschbildung an der Küste des Herzogtums Schleswig und die Mittel zur Beförderung derselben. Kiel, 1863.
Salfeld, Dr. Die Hochmoore auf dem früheren Weser-Delta. (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 16. Bd.) Berlin, 1881.
Schröder, J. von und Herm. Biernatzki. Topographie der Herzogtümer Holstein und Lauenburg, des Fürstentums Lübeck und des Gebiets der Freien und Hanse-Städte Hamburg und Lübeck. Oldenburg i. Holstein, 1855 bis 1856.
Schröder, J. von. Topographie des Herzogtums Schleswig. Schleswig, 1837.
Seelhorst, C. von. Acker- und Wiesenbau auf Moorboden. Berlin, 1892.
Segel-Handbuch für die Nordsee, herausgegeben von dem hydrographischen Amte der Admiralität. Erstes Heft. Berlin, 1884.
Tacke, Dr. Br. Die nordwestdeutschen Moore, ihre Nutzbarmachung und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung. (Verhandlungen des elften deutschen Geographentages zu Bremen, 1896.) Berlin, 1896.
Tittel, Ernst. Die natürlichen Verhältnisse Helgolands und die Quellen über dieselben. (Inauguraldissertation.) Leipzig, 1894.
Traeger, Eugen. Die Halligen der Nordsee. Stuttgart, 1892.
Traeger, Eugen. Die Rettung der Halligen und die Zukunft der schleswig-holsteinischen Nordseewatten. Stuttgart, 1900.
Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs, herausgegeben vom kaiserlichen statistischen Amt. Siebenter Jahrgang, 1898. Berlin, 1898.
Wichmann, E. H. Die Elbmarschen. (Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 20. Bd.) Berlin, 1885.
Register.
- Alkersum 92.
- Alse 155.
- Alster 114.
- Alte Land, das 128. 137. 138.
- Alte Mellum 158.
- Altenbruch 140. 142.
- Altendorf 140.
- Altengamme 126.
- Altenländer Moor 143.
- Altenwalde 143.
- Altländer Moor 145.
- Altmannshöhe 152.
- Altona 126. 127. 128; Palmaille mit Blücherdenkmal 82 (Abb. 83); Rathaus 82 (Abb. 82).
- Ammerland 158.
- Amönenhöhe 111.
- Amrum 36. 87–90; Leuchtturm 25 (Abb. 24).
- Amrumer-Tief 87.
- Appelland 90.
- Archsum 75. 84.
- Archsumburg 84.
- Arngast 161.
- Assel 139.
- Atens 159.
- Aue 140. 145.
- Augustfehn 163.
- Aumühle 126.
- Aurich 163. 168.
- Außenalster 114. 53 (Abb. 49).
- Austernbänke 82.
- Baljen 39.
- Balksee 146.
- Ballum 72. 74.
- Baltrum 170. 145 (Abb. 144); alter Friedhof 149 (Abb. 148); Haus in den Dünen 147 (Abb. 146); Landungsbuhne 148 (Abb. 147); Ostdorf 145 (Abb. 143); Pfahlwerk in Sturmflut 146 (Abb. 145).
- Bant 162.
- Bargum 66.
- Bauernhäuser in Kurslak 77 (Abb. 75). 79 (Abb. 77); in Neuengamme 76 (Abb. 73); 78 (Abb. 76).
- Bederkesa 146. 155.
- Bederkesaer See 140. 146.
- Benser Siel 169.
- Bergedorf 126.
- Bernstein 24. 25.
- Bevölkerung 51. 52. 56.
- Billberg 131.
- Bille 114. 126.
- Billwerder 126.
- Binnenalster 114. 53 (Abb. 49).
- Binnenmoore 144.
- Blankenese 128. 85 (Abb. 86), (Abb. 87).
- Blexen 160.
- Blockhäuser des Seebades Lakolk auf Röm 14 (Abb. 14).
- Blockland 147.
- Blumenthal 152. 155.
- Boldixum 92. 30 (Abb. 28).
- Bolilmark 74.
- Boot zu Wasser 6 (Abb. 5).
- Bordelum 66.
- Borkum 170. 171. 6 (Abb. 4). 163 (Abb. 158). 164 (Abb. 159). 165 (Abb. 160). 166 (Abb. 161); (Abb. 162). 167 (Abb. 163). 168 (Abb. 164). 169 (Abb. 165).
- Bösch 110.
- Bracke 140.
- Braderup 83. 84.
- Brake 147. 159.
- Bredau 39.
- Bredberg 131.
- Brede-Au 72.
- Bredebro 72. 73.
- Bredstedt 66.
- Breitenburg, Schloß 111.
- Breklum 66.
- Bremen 147–152. 101 (Abb. 104); Börse 108 (Abb. 111); Dom 108 (Abb. 112); Essighaus 109 (Abb. 113); Freihafen 103 (Abb. 105); Markt 110 (Abb. 114); Museum 111 (Abb. 116); Rathaus 105 (Abb. 107); 106 (Abb. 108). 107 (Abb. 109); (Abb. 110); Weserbrücke 104 (Abb. 106).
- Bremer Typen 111 (Abb. 115).
- Bremerhaven 147. 153. 154. 115 (Abb. 118).
- Bremervörde 142. 146.
- Broekmer Land 167.
- Bröns 72.
- Brönsau 39.
- Brundorfer Heide 143.
- Brunsbüttel 109. 44 (Abb. 41). 46 (Abb. 43).
- Brunsbüttelkoog, Binnenhafen 47 (Abb. 44).
- Brunshausen 140.
- Buchholz 146.
- Burg 110.
- Burglesum 152.
- Burhave 160.
- Büsum 106.
- Butjadingen 159.
- Butjadingerland 158.
- Büttel 110.
- Buxtehude 138.
- Campe 140.
- Camper Höhe 143.
- Cappel 156.
- Charlottenpolder 165.
- Christian-Albrechts-Koog bei Tondern 66.
- Cuxhaven 128. 157. 158. 86 (Abb. 88). (Abb. 89).
- Dagebüll 70.
- Dahlemer See 146.
- Dammhausen 145.
- Dangast 161.
- Dargland 164.
- Deetzbüll 68.
- Deichen 48. 49.
- Delme 160.
- Delmenhorst 160.
- Denghoog 78.
- Dieksand 104.
- Doggerbank 20.
- Dollart 28. 158. 164.
- Dornum 168.
- Dorum 156. 157.
- Döse 158.
- Döstrup 72.
- Drepte 145.
- Duhnen 158.
- Düne (Helgoland) 130. 2 (Abb. 1).
- Dwarsgatt 154.
- Eckwarden 160.
- Eddelak 110.
- Eider 105.
- Eiderstedt 98. 99. 100. 102.
- Eindeichungen 48.
- Elbe 114. 126.[S. 174]
- Elbschleuse 45 (Abb. 42).
- Ellenbogen, Halbinsel 79.
- Elmer Schiffgraben 145.
- Elmshorn 112. 51 (Abb. 47).
- Elsfleth 147. 158. 159.
- Emden 165. 166. 167. 127 (Abb. 127); am Delft in 128 (Abb. 128); Rathaus 129 (Abb. 129).
- Emmelcke 140.
- Emmelsbüll 66.
- Emmerlef 72.
- Ems 158. 165.
- Ems-Jade-Kanal 166. 167.
- Emsiger Land 164. 167.
- Endrup 39.
- Eppendorf 126.
- Esens 169.
- Este 138. 145.
- Fahretoft 97.
- Fahrstedt 109.
- Fartrapp-Tief 87.
- Fehnkolonien 144.
- Fischerwohnung, Helgoländer 93 (Abb. 97).
- Flaggenberg 131.
- Flögelner See 146.
- Föhr 36. 90. 92; Strand von Wyk auf Föhr 3 (Abb. 2).
- Frauentracht auf Föhr 28 (Abb. 26).
- Freiburg 139.
- Freiburger Tief 139.
- Friedburg 168.
- Friedhof für Heimatlose (Sylt) 19 (Abb. 19).
- Friedrichskoog 104. 108.
- Friedrichsruh 126. 80 (Abb. 78). 81 (Abb. 80); Mausoleum 81 (Abb. 81); Schlaf- und Sterbezimmer des Fürsten Bismarck 80 (Abb. 79).
- Friedrichsstadt 104. 105.
- Garding 102.
- Garlstedter Heide 143.
- Geest 41.
- Geeste 142. 145.
- Geestemünde 153. 158. 113 (Abb. 117).
- Geesthacht 126.
- Geestland zwischen Unterelbe und Unterweser 142.
- Geestufer von Schobüll 65.
- Geologisches 17.
- Georgsheil 169.
- Gerichtshügel 78.
- Geschichtliches 58.
- Gezeiten 7.
- Glückstadt 112.
- Golzwarden 159.
- Gösche 140. 145.
- Goting 92.
- Gotteskoogsee 66.
- Gramm 73.
- Gröde 36. 90. 97; 37 (Abb. 33). 38 (Abb. 34). 39 (Abb. 35).
- Grünenthal 109; Hochbrücke 49 (Abb. 45).
- Grünlandmoor 144.
- Grüppenbühren 160.
- Habel 90.
- Hadeln 128. 137. 140. 141.
- Hadeler Kanal 140.
- Hadeler Marsch 140.
- Hadeler Moore 144.
- Halemmer See 146.
- Halligen 36. 94. 95. 96. 97. 10 (Abb. 9).
- Halligwerft nahe vor dem Einsturz (Langeneß) 11 (Abb. 10).
- Hamburg 114–126. 61 (Abb. 57). 62 (Abb. 58). 64 (Abb. 60); Fleet zwischen Deichstraße und Cremon 58 (Abb. 54); Fleet bei der Reimersbrücke 59 (Abb. 55); Freihafenlagerhäuser 57 (Abb. 53); Großer Burstah 66 (Abb. 62); Hafen 54 (Abb. 50). 56 (Abb. 52); Hopfenmarkt 67 (Abb. 63); Jungfernstieg 73 (Abb. 69); Katharinenkirche 59 (Abb. 55); Kriegerdenkmal 72 (Abb. 68); Lombardsbrücke 68 (Abb. 64); Michaeliskirche 65 (Abb. 61); Nikolaikirche 67 (Abb. 63); Rathaus 69 (Abb. 65); Rathausbrunnen 71 (Abb. 67); Ratskeller 70 (Abb. 66); Sandthorkai 57 (Abb. 53); Seewarte 64 (Abb. 60); Segelschiffhafen 55 (Abb. 51); Steckelhörn 61 (Abb. 57); Winserbaum 60 (Abb. 56); neue Brücke nach Harburg 96 (Abb. 100).
- Hamburger Hallig 90.
- Hamburger Volkstrachten 74 (Abb. 70).
- Hamme 42. 144. 145.
- Hammelwörden 139.
- Harburg 137. 146; neue Brücke nach Hamburg 96 (Abb. 100).
- Harlbucht 168.
- Harletief 169.
- Harlinger Land 168.
- Harsefeld 142.
- Harsfelder Rücken 143.
- Hasbruch 160.
- Haseldorfer Marschen 104. 112.
- Haseldorfer Schloß 114.
- Hattstedt 64.
- Heide 43. 105.
- Helgoland 129–137. 89 (Abb. 92), (Abb. 93); Hengst und Nordspitze 94 (Abb. 98); Oberland und Unterland 95 (Abb. 99); Oberland und Nordspitze 91 (Abb. 95); Unterland und die Düne 2 (Abb. 1).
- Helgoländer Fischerwohnung 93 (Abb. 97).
- Helgoländerinnen 92 (Abb. 96).
- Helmsand 94.
- Hemmingstedt 106.
- Hemmoor 146.
- Heppens 162.
- Hever 64. 90.
- Himmelpforten 142. 143.
- Hitzbank 102.
- Hochland 140. 141.
- Hochmoore 41. 42. 144.
- Hochseefischerei, deutsche 13–15.
- Hohe Lieth 143.
- Hoher-Lieth 140.
- Hoher Weg 158.
- Hohewegsleuchtturm 154.
- Hollerland 147.
- Hooge 36. 90. 95. 96. 97.
- Hooksiel 162. 163.
- Horneburg 138. 145.
- Hörnum 86.
- Horsbüll 66.
- Horsbüllharde 67. 68.
- Horst 106.
- Hoyer 50. 70. 71. 72.
- Hoyerschleuse 70. 72.
- Hude 159. 160.
- Hüll 140.
- Humptrup 71.
- Hunte 158. 159. 161.
- Hunte-Ems-Kanal 161.
- Husum 62. 63. 64; Storms Grab in 12 (Abb. 11).
- Husumer Au 39.
- Hvidding 72.
- Hymensee 146.
- Imsum 156.
- Isensee 140.
- Itzehoe 110. 111. 50 (Abb. 46).
- Jade 158.
- Jadebusen 158. 161.
- Jerpstedt 72.
- Jever 162. 169.
- Jeverland 158. 162.
- Jordsand 94.
- Jork 138. 143.
- Jührdener Feld 158.
- Juist 170. 171. 160 (Abb. 156). 161 (Abb. 157).
- Jümmer 163.
- Juvre 74.
- Juvrer Tief 40.
- Kaiser Wilhelm-Kanal 109. 45 (Abb. 42). 46 (Abb. 43). 47 (Abb. 44). 49 (Abb. 45).
- Kaiser Wilhelm-Koog 104.
- Kaltehofe 126.
- Kampen 78. 84; Kurhaus 77; Leuchtturm 20 (Abb. 20).
- Karolinensiel 162. 169.
- Kehdingen 128. 137. 138. 139.
- Kehdinger Moor 139. 144.
- Keitum 75. 83. 23 (Abb. 22).
- Kellinghusen 112.[S. 175]
- Kirchwerder 126.
- Kirkeby 74. 14 (Abb. 13).
- Klauxbüll 67.
- Klopstocks Grab 83 (Abb. 84).
- Kniepsand 88.
- Kongsmark 74.
- Königshafen 79.
- Königspesel 95.
- Kornkoog 68.
- Kranenburg 140.
- Krempe 112.
- Krempermarsch 104.
- Kronprinzenkoog 104.
- Krückau 112.
- Krumme Hörn 167.
- Kudensee 110.
- Kurslack 126; Bauernhaus 77 (Abb. 75). 79 (Abb. 77).
- Lägerdorf 112.
- Lakolk 74; Blockhäuser 14 (Abb. 14).
- Land und Leute 39.
- Landschaftspolder 165.
- Langeneß 25. 36. 97; Halligwerft 11 (Abb. 10); Peterswerft 34 (Abb. 31).
- Langeneß-Nordmarsch 90. 96.
- Langeoog 170; 141 (Abb. 138). 141 (Abb. 139); 143 (Abb. 141); Neutraler Strand 143 (Abb. 142).
- Langeoog-Dünen 142 (Abb. 140).
- Langlütjensand 156. 158.
- Langwarden 160.
- Leck 66.
- Leda 158. 163. 164.
- Leer 158. 164; Rathaus 125 (Abb. 126).
- Lehe 154.
- Lengener Land 164.
- Lengener Moor 158. 163.
- Lesum 42. 143. 145. 154.
- Ley 164.
- Lieth 112.
- Lilienthal 143.
- Lindholm 66. 68.
- Lintrup 73.
- List 79.
- Lister Tief 74. 79.
- Litberg 143.
- Lockstedt 112.
- Lockstedter Lager 112.
- Lohberg 143.
- Lombardsbrücke in Hamburg 68 (Abb. 64).
- Lornsenhain 86.
- Lüdingworth 142.
- Lügumkloster 73.
- Lühe 138. 145.
- Lunden 105.
- Lune 145. 156.
- Manö 39.
- Marccardsmoor 167.
- Marne 109.
- Marschen 22. 41. 44. 46.
- Marschlande am linken Elbufer 137.
- Marschlande am rechten Weserufer 147.
- Medem 140. 145.
- Meldorf 107. 108. 43 (Abb. 40).
- Meldorfer Bucht 94.
- Midlum 156.
- Miele 39.
- Misselwarden 156.
- Moderberg 131.
- Mögeltondern 72.
- Mönch 90 (Abb. 94).
- Mönchshügel 75.
- Moorburg 137.
- Moore 43.
- Moorbildungen 42.
- Moorkolonien 144.
- Moorkultur 144.
- Moormer Land 164.
- Moornutzung 144.
- Moorriem 159.
- Morsum 75. 84.
- Morsumkliff 75.
- Mövennest 42 (Abb. 39).
- Mulxum 156.
- Munkehoi 75.
- Munkmarsch 70. 83. 84.
- Näs Odde 84.
- Nebel, Kirchdorf 88.
- Nesserland 165.
- Neßmer Höft 165.
- Neudorfer Hafen 109.
- Neuenburg 162; Urwald von 160.
- Neuengamme 126; Bauernhäuser in 76 (Abb. 73). 78 (Abb. 76).
- Neuenkehn 154.
- Neuhaus 140.
- Neuland 139.
- Neumühlen 128. 84 (Abb. 85).
- Neustadt-Gödens 168.
- Neuwerk 128. 158. 87 (Abb. 90).
- Nieblum 92. 29 (Abb. 27).
- Niebüll-Deezbüll 66.
- Niedervieland 147.
- Nienstedten 128.
- Norddeich 168.
- Norddeutscher Lloyd 148.
- Norddorf 88.
- Norden 168. 130 (Abb. 130); Liudgerikirche 131 (Abb. 131).
- Nordenham 159. 160.
- Nordernerland 168.
- Norderney, Ausblick von den Dünen 155 (Abb. 152); Dünen 157 (Abb. 154); Leuchtturm 159 (Abb. 155); Seesteg 154 (Abb. 151); Strand 151 (Abb. 149).
- Norderoog 36. 90. 96.
- Norderpiep 40.
- Nordmarsch 25. 36.
- Nordsee, Grenzen 5; Salzgehalt 9.
- Nordseeschiffahrt, deutsche 10.
- Nordstrand 35. 64. 90. 93. 42 (Abb. 38).
- Nordstrandisch-Moor 34. 90. 93. 97.
- Nösse 84.
- Oberahnsche Felder 162.
- Obervieland 147.
- Ocholt 163.
- Odenbüll 93.
- Ohlsdorf 126.
- Oland 90. 96. 97. 35 (Abb. 32).
- Oldenburg 158. 161; Lambertikirche 119 (Abb. 122); Rathaus 117 (Abb. 120); Schloß 116 (Abb. 119); der Stau in 118 (Abb. 121).
- Oldenbüttel 153.
- Oldendorf 164.
- Oldersum 164.
- Oslebshausen 152.
- Oste 137. 140. 142. 145.
- Ostemarsch 137. 140.
- Oste-Moore 144.
- Osterholz-Scharmbeck 152.
- Oster-Ihlienworth 140.
- Osterstade 154. 155.
- Osterstader Moore 144.
- Ostfriesische Inseln 158. 169.
- Ostfriesland 163. 164. 165.
- Ostringen 168.
- Ottensen 128.
- Otterndorf 141. 142.
- Övenum 92.
- Paddingbüttel 156.
- Panderkliff 83.
- Papenburg 144.
- Pellworm 35. 36. 90. 93. 96.
- Pinnau 112.
- Pinneberg 112.
- Pohnshallig 90.
- Poppenbüttel 114.
- Postfahrt durch das Wattenmeer 8 (Abb. 7). 9 (Abb. 8).
- Predigtstuhl 90 (Abb. 94).
- Rade 155.
- Rahe 168.
- Rantum 85. 21 (Abb. 21).
- Rastede 161.
- Rechtenfleth 155.
- Reiderland 164.
- Reinbeck 126.
- Reisby 72.
- Remperbach 146.
- Rettungsstationen 6 (Abb. 4). 16 (Abb. 16).
- Riesum 66.
- Risummoor 68.
- Ritzebüttel 156.
- Rödding 73.
- Rodenäs 67.
- Rodenkirchen 155. 159.
- Röm 72. 74. 14 (Abb. 13).
- Römer Tief 40. 74.
- Römer Tracht, Mädchen in 15 (Abb. 15).[S. 176]
- Rönnebeck 152.
- Rotenburg 146.
- Rotesand 154.
- Rotes Kliff 75. 77. 78. 5 (Abb. 3).
- Rottum 171.
- Rungholter Sand 29.
- Rustringen 158.
- Sande 162.
- Sandspierenfang 40 (Abb. 36).
- Sankt Jürgens-Land 145.
- Sankt Margareten 110.
- Sankt Michaelisdonn 108.
- Sankt Peter 102.
- Saterland 163.
- Satteldüne 89.
- Sauensiek 143.
- Schackenburg, Schloß 72.
- Scharhörn 128.
- Scharhörnwatt 88 (Abb. 91).
- Scherrebek 72. 74.
- Schiffsunfälle 12.
- Schleswig-Holsteinische Westküste 102.
- Schnelldampfer „Auguste Victoria“ 63 (Abb. 59); „Kaiser Wilhelm der Große“ 97 (Abb. 101). 98 (Abb. 102). 99 (Abb. 103).
- Schobüll, Geestufer 65.
- Schobüller Berg 64.
- Schwinge 137. 139. 145.
- Seefeld 160.
- Seehundsjäger 41 (Abb. 37).
- Seestermühe 112.
- Seestermüher Marsch 112.
- Seewarte in Hamburg 64 (Abb. 60).
- Sietland 140. 141.
- Skalnasthal 88.
- Solthörner Watt 158.
- Sophienkoog 104.
- Spieka 156.
- Spiekeroog 170. 137 (Abb. 135). 138 (Abb. 136). 139 (Abb. 137).
- Stade 139.
- Stadland 158. 159.
- Stedesand 66.
- Stedinger Land 158. 159.
- Steinhorst 114.
- Stollhamm 160.
- Störfluß 111.
- Störtebecker Tief 168.
- Stotel 155.
- Strömungen 7.
- Stubben 153.
- Sturmfluten 7. 8. 26. 28. 29. 30. 32. 33.
- Süddorf 88.
- Süderhever 40.
- Süderoog 90. 96.
- Südfall 90.
- Süllberg, vom Bismarckstein gesehen 85 (Abb. 86).
- Sülwert 92.
- Sylt 36. 74–87. 16 (Abb. 16). 17 (Abb. 17).
- Sylter Heide 77.
- Tating 102.
- Temperatur 8.
- Teufelsbrücke 128.
- Teufelsmoor 142. 144.
- Tinnum 84.
- Toftum 74.
- Tondern 50. 70. 71.
- Tönning 102; Hafen 13 (Abb. 12).
- Tornesch 112.
- Tossens 160.
- Trachten: Hamburger Volkstrachten 74 (Abb. 70); Römer Tracht 15 (Abb. 15); Vierländer 75 (Abb. 72). 77 (Abb. 74).
- Uhlenhorst 52 (Abb. 48).
- Unterland (Helgoland) 129. 2 (Abb. 1).
- Ütersen 112.
- Ütersum 92.
- Uwenberg 77.
- Varel 160.
- Vareler Hochmoor 158.
- Vegesack 147. 152.
- Versandetes Wrack 7 (Abb. 6).
- Vieland 143. 155. 156.
- Vierlande 126.
- Vierländer 75 (Abb. 72). 77 (Abb. 74).
- Viktoriahain 86.
- Vogelkoje 80.
- Volksdichte 80.
- Waakhausen 144. 145.
- Wandsbek 126; Denkmal für Matthias Claudius 75 (Abb. 71).
- Wangerland 162. 168.
- Wangeroog 170. 133 (Abb. 132). 134 (Abb. 133). 135 (Abb. 134).
- Wanna 140.
- Wannaer Moor 140.
- Wanse 126.
- Watten 22. 24. 25. 39. 44. 33 (Abb. 30).
- Wattenmeer 64.
- Weddingstedt 105.
- Wedel 114.
- Wedelau 114.
- Weener 164.
- Wendingstadt 29.
- Wenningstedt 75. 77. 84; Rotes Kliff 5 (Abb. 3).
- Werderland 147.
- Werften 49.
- Weser 143. 147. 158.
- Weserbrücke in Bremen 104 (Abb. 106).
- Wesselburen 105. 106.
- Westerberg 142. 146.
- Westerhever 102.
- Westerland auf Sylt 75. 17 (Abb. 17). 18 (Abb. 18).
- Westerstede 163.
- Widau 70.
- Wiedau 39.
- Wiedingharde 67.
- Wiegoldsbur 164.
- Wiesede 167.
- Wilhelmshaven 162; Kaiser Wilhelmsdenkmal 123 (Abb. 125); Kriegshafen und Hauptschleuse 121 (Abb. 123); Rathaus 122 (Abb. 124).
- Wilster 110.
- Wilstermarsch 104. 110.
- Wingst 140. 142. 143. 146.
- Wite Klif 136.
- Witsum 92.
- Wittdün 88. 24 (Abb. 23).
- Wittmund 162. 168. 169.
- Worpswede 145. 152.
- Wremen 156.
- Wührden 155. 156.
- Wümme 42. 145.
- Wursten 137. 155. 156. 157.
- Wyk 70. 90. 92. 3 (Abb. 2). 27 (Abb. 25). 31 (Abb. 29).
- Zeven 142. 146.
- Zwischenahner Meer 163.
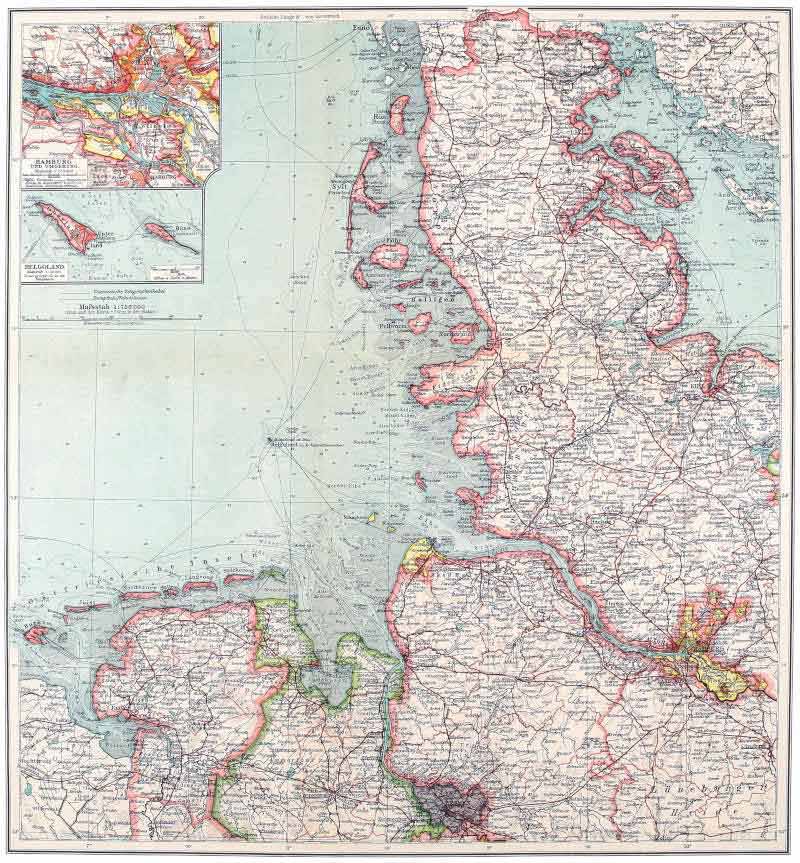
| Geographische Anstalt von Velhagen & Klasing in Leipzig. | Ausschnitt aus Andree, Handatlas IV. Auflage. | Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld u. Leipzig. |
Hellenica World Literatur, Deutsch