.

Anmerkungen zur Transkription:
Die Rechtschreibung und Zeichensetzung des Originals wurde weitgehend übernommen, lediglich offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Die Originalvorlage ist in Fraktur gedruckt. Davon abweichende, in Antiqua gedruckte Textstellen sind (bis auf römische Ziffern) kursiv dargestellt. Am Ende des Textes befindet sich eine Liste korrigierter Druckfehler.

Charles Perrault
Gänsemütterchens Märchen
Illustriert von
Gustave Doré

Übersetzt und herausgegeben von
Hans Krause
O. C. Recht Verlag / München
Dieses Buch wurde im Auftrage des O. C. Recht Verlages in der Offizin der Mandruck A.-G., München in der Altschwabacher gedruckt. Es wurde eine Vorzugsausgabe von 100 Exemplaren auf Bütten hergestellt. Nr. 1–25 wurden in Ganzleder, Nr. 26–100 in Halbleder gebunden. Drucküberwachung und Ausstattung von
Ferdinand Kramer.
Copyright 1921 by O. C. Recht Verlag / München
Gänsemütterchens
Märchen
Rotkäppchen
Blaubart
Die Fee
Der gestiefelte Kater
Der kleine Däumling
Aschenbrödel
Riquet mit der Locke
Jungfer Eselshaut
Dornröschen
Übersetzung nach der ersten Buchausgabe von 1697.
Rotkäppchen
Es war einmal eine kleine Bauerndirne, die war hübscher, als man jemals eine sah. Ihre Mutter war ganz verliebt in sie und ihre Großmutter noch viel mehr. Diese brave Frau ließ ihr ein rotes Käppchen machen, welches ihr so gut stand, daß man sie überall das »Rotkäppchen« nannte.
Eines Tages, als ihre Mutter Kuchen gebacken hatte, sagte sie zu ihr:
»Geh zu deiner Großmutter und sieh zu, was sie macht, denn man hat mir erzählt, sie sei krank. Nimm ihr einen Kuchen mit und dieses Töpfchen mit Butter!«
Rotkäppchen machte sich gleich auf, um zu ihrer Großmutter zu gehen, die in einem anderen Dorfe wohnte. Als sie durch einen Wald kam, begegnete ihr der Gevatter Wolf, der große Lust hatte, sie zu fressen; aber er wagte es nicht wegen der Holzhauer, die in dem Walde waren. Er fragte sie, wohin sie gehe. Das arme Kind, das nicht wußte, wie gefährlich es ist, einen Wolf anzuhören, sagte:
»Ich gehe meine Großmutter besuchen und bringe ihr Kuchen und einen Topf Butter, den ihr meine Mutter schickt.«
»Wohnt sie weit von hier?« fragte der Wolf.
»Oh ja,« antwortete das Rotkäppchen, »noch hinter der Mühle, die Ihr dort in der Ferne seht, in dem ersten Hause des Dorfes.«
»Wohlan,« sagte der Wolf, »ich will sie auch besuchen; ich gehe auf diesem Wege hin und du dort auf jenem, wir wollen sehen, wer zuerst da ist.«
Der Wolf lief so schnell er konnte und schlug den kürzeren Weg ein, und das kleine Mädchen ging den weiteren Weg; fröhlich pflückte sie Haselnüsse, lief den Schmetterlingen nach und machte Sträuße aus den Blümlein, die sie fand. Es dauerte nicht lange, da war der Wolf an Großmutter Haus angelangt, und er pochte an die Tür: Bum! Bum!
»Wer ist da?«
»Euer Enkelchen ist es, das Rotkäppchen,« sagte der Wolf, indem er seine Stimme verstellte, »ich bringe Euch einen Kuchen und ein Töpfchen mit Butter, das Euch meine Mutter schickt.«
Die gute Großmutter, die krank in ihrem Bette lag, rief ihm zu:
»Zieh den Riegel zurück, dann springt das Schloß auf!«
Der Wolf zog den Riegel zurück, und die Tür öffnete sich. Er stürzte sich auf die gute Frau und verschlang sie im Handumdrehen, denn er hatte länger als drei Tage nichts mehr gefressen.

Dann schloß er die Tür, legte sich in das Bett der Großmutter und wartete auf Rotkäppchen, das bald darauf kam und an die Tür pochte: Bum! Bum!
»Wer ist da?«
Als Rotkäppchen die laute Stimme des Wolfes hörte, bekam es zuerst Angst; aber sie glaubte, die Großmutter sei erkältet, und antwortete:
»Euer Enkelchen ist es, das Rotkäppchen; ich bringe Euch einen Kuchen und ein Töpfchen Butter, das Euch meine Mutter schickt.«
Der Wolf rief ihr zu, indem er seine Stimme etwas dämpfte:
»Zieh den Riegel zurück, dann springt das Schloß auf!«
Rotkäppchen zog den Riegel zurück, und die Tür öffnete sich. Als der Wolf sie eintreten sah, versteckte er sich im Bett unter der Decke und sagte zu ihr:
»Stelle den Kuchen und das Töpfchen mit Butter auf den Backtrog und komme zu mir ins Bett!«

Rotkäppchen zog sich aus und legte sich mit ins Bett. Sie war erstaunt, wie verändert die Großmutter in ihrem Nachtgewand aussah, und fragte sie:
»Großmutter, was hast du für große Arme?«
»Damit ich dich besser umarmen kann, mein Kind.«
»Großmutter, was hast du für große Beine?«
»Damit ich besser laufen kann, mein Kind.«
»Großmutter, was hast du für große Ohren?«
»Damit ich besser hören kann, mein Kind.«
»Großmutter, was hast du für große Augen?«
»Damit ich dich besser sehen kann, mein Kind.«
»Großmutter, was hast du für große Zähne?«
»Damit ich dich besser fressen kann.«
Und nachdem er dies gesagt hatte, stürzte der böse Wolf sich auf das Rotkäppchen und fraß es.
Man kann an diesem Beispiel sehn,
Wie’s allen Mädchen wird ergehn,
Die stets auf fremde Leute hören,
Die sie beschwätzen und betören:
So ist nun mal der Dinge Lauf,
Es kommt der Wolf und frißt sie auf.
Ich meine andere Wölfe als den bösen,
Die Wölfe haben ein ganz anderes Wesen,
Es sind die höflichen, die zahmen,
Sie folgen oft den jungen Damen.
Paß auf, mein Kind, nimm dich in acht!
Das sind die Wölfe schlimmster Art.
Blaubart
Es war einmal ein Mann, der hatte schöne Häuser in der Stadt und auf dem Lande, goldenes und silbernes Tafelgeschirr, Möbel mit kostbaren Stickereien und Karossen, die von oben bis unten vergoldet waren. Aber er hatte einen blauen Bart, und das war sein Unglück. Denn der machte ihn so häßlich und abstoßend, daß alle Frauen und Mädchen vor ihm davonliefen.
Seine Nachbarin, eine vornehme Dame, hatte zwei Töchter, die beide sehr schön waren. Eine von diesen erbat er sich zur Frau und überließ es der Mutter, die Braut zu bestimmen. Aber keine wollte etwas von ihm wissen, jede wollte ihn der anderen überlassen; denn sie konnten sich nicht entschließen, einen Mann mit einem blauen Barte zu heiraten. Sie fürchteten sich auch vor ihm, weil er schon mehrere Frauen gehabt hatte, und weil man nicht wußte, was aus diesen geworden war.
Um sie näher kennen zu lernen, führte Blaubart sie mit ihrer Mutter und drei oder vier ihrer besten Freundinnen sowie mehreren jungen Männern aus der Nachbarschaft auf eines seiner Landhäuser, wo man volle acht Tage blieb. Da machte man Landpartien, ging auf Jagd und Fischerei und vergnügte sich bei Tanzereien, Festlichkeiten und Gelagen; ja man schlief nicht einmal, sondern verbrachte die ganze Nacht mit Späßen und Spielen. Zu guter Letzt kam es so weit, daß die jüngere der Schwestern fand, der Hausherr habe doch keinen allzu blauen Bart und er sei ein sehr netter Mann; und als man in die Stadt zurückgekehrt war, wurde die Hochzeit gefeiert.
Einen Monat später sagte Blaubart zu seiner Frau, er müsse in einer wichtigen Angelegenheit mindestens sechs Wochen lang in die Provinz verreisen, und er bat sie, sich während seiner Abwesenheit gut zu unterhalten: sie solle ihre Freundinnen einladen, sie mit aufs Land nehmen, wenn sie wolle, und vor allem sich nichts abgehen lassen an Speis und Trank.

»Hier,« sagte er dann, »sind die Schlüssel zu den beiden Vorratskammern, hier der vom goldenen und silbernen Tafelgeschirr, das nicht täglich benutzt wird, hier der meiner eisernen Truhe, in der mein Gold und Silber liegt, der meiner Kassetten, in denen meine Papiere sind, und hier der Hauptschlüssel zu allen Zimmern. Aber dieser kleine Schlüssel hier, der führt in das Gemach am Ende der großen Galerie des unteren Stockwerks. Du darfst alle Türen öffnen, überall hingehen, aber dieses kleine Gemach darfst du nicht betreten; ich verbiete es dir aufs strengste. Sollte es dir doch einfallen, diese Tür zu öffnen, so hast du das Schlimmste von meinem Zorne zu erwarten.«
Sie versprach, alles genau zu befolgen, was er ihr befohlen. Hierauf küßte er sie, stieg in seine Karosse und fuhr davon.
Die Nachbarinnen und die guten Freundinnen warteten nicht erst, bis man sie zu der Jungvermählten einlud, denn sie brannten vor Neugierde, alle Reichtümer des Hauses zu sehen. Aber sie hatten nicht gewagt, zu ihr zu kommen, solange der Gatte da war, weil sie sich vor seinem blauen Barte fürchteten. Gleich liefen sie nun durch die Zimmer, die Gemächer und die Kammern, von denen eine schöner war als die andere. Dann stiegen sie hinauf in die Vorratsräume, wo sie nicht genug die vielen schönen Stickereien bewundern konnten, und die Betten, Sofas, Sessel, Tischlein und Tische und die Spiegel, in denen man sich von Kopf bis zu Fuß sehen konnte, und deren Rahmen, teils von Glas, teils von vergoldetem Silber, schöner waren und prächtiger, als man jemals welche sah. Alle waren begeistert und hörten nicht auf, die Freundin in ihrem Glücke zu beneiden. Aber diese wurde nicht froh beim Anblick all der Reichtümer, denn sie konnte es nicht erwarten, das Gemach im unteren Stockwerk zu sehen.

Die Neugierde plagte sie so, daß sie ihre Gäste verließ, ohne sich ihrer Unhöflichkeit bewußt zu werden. Sie lief eine Hintertreppe in solcher Hast hinab, daß sie drei- oder viermal glaubte, den Hals zu brechen. An der Tür des Gemaches hielt sie eine Zeitlang inne und dachte an das Verbot ihres Gemahls; sie überlegte, ob ihr nicht doch aus ihrem Ungehorsam ein Unglück erwachsen könne. Aber die Versuchung war zu stark: sie nahm den kleinen Schlüssel und öffnete zitternd die Tür.
Zuerst sah sie nichts, weil die Fenster geschlossen waren; aber bald bemerkte sie, daß der Fußboden über und über von geronnenem Blute bedeckt war. Darin spiegelten sich die Leichen von mehreren Frauen, die aufgereiht an der Wand hingen. Es waren alle die Frauen, die Blaubart geheiratet und eine nach der anderen abgeschlachtet hatte.
Sie glaubte sterben zu müssen vor Angst, und der Schlüssel, den sie eben aus dem Schlosse gezogen, fiel ihr aus der Hand.
Nachdem sie sich etwas gefaßt hatte, hob sie den Schlüssel auf, schloß die Tür wieder und stieg hinauf in ihr Zimmer, um sich ein wenig zu erholen; aber es gelang ihr nicht, so sehr hatte sie sich erschrocken.
Als sie bemerkte, daß der Schlüssel des Gemaches mit Blut befleckt war, wusch sie ihn zwei- oder dreimal. Aber das Blut ging nicht ab, sie wischte umsonst; selbst mit Sand und Bimsstein rieb sie vergebens: der Schlüssel blieb immer blutig. Denn er war verzaubert und es gab kein Mittel, ihn wieder ganz sauber zu machen. Wenn man das Blut auch auf einer Seite weggebracht hatte, so kehrte es auf der anderen wieder zurück.
Noch an demselben Abend kam Blaubart nach Hause und erzählte, er habe unterwegs durch Briefe die Nachricht erhalten, daß die Angelegenheit, wegen der er die Reise unternommen, schon zu seinen Gunsten erledigt sei. Seine Frau tat alles, was sie konnte, um ihm zu zeigen, wie entzückt sie über seine schnelle Rückkehr sei. — Am folgenden Tage verlangte er die Schlüssel, und sie gab sie ihm. Aber ihre Hand zitterte so sehr, daß er ohne Mühe erriet, was vorgefallen war.
»Wie kommt es,« fragte er, »daß der Schlüssel zu dem Gemache nicht mehr bei den anderen ist?«
»Ich muß ihn wohl,« antwortete sie, »oben auf meinem Tische liegen gelassen haben.«
»Vergiß nicht,« sagte Blaubart, »ihn mir alsbald zu geben!«
Mehrere Male schob sie es auf, aber schließlich mußte sie ihm den Schlüssel bringen. Blaubart betrachtete ihn und sagte zu seiner Frau:
»Warum ist Blut an diesem Schlüssel?«
»Ich weiß es nicht«, sagte das arme Weib, blasser als der Tod.
»Du weißt es nicht?« schrie Blaubart, »aber ich, ich weiß es. Du wolltest in das Gemach gehen! Wohlan, du sollst hinein! Du sollst deinen Platz bekommen neben den andern Frauen, die du dort sahst!«
Sie warf sich weinend ihrem Gatten zu Füßen und bat um Verzeihung mit allen Zeichen tiefer Reue ob ihres Ungehorsams. In ihrer Schönheit und ihrer Verzweiflung hätte sie einen Felsen rühren können, aber Blaubart hatte ein Herz härter als Stein.
»Du mußt sterben, Weib,« sagte er, »auf der Stelle!«
»Wenn ich sterben muß,« so flehte sie, indem sie ihn mit tränenvollen Augen ansah, »so gebt mir noch ein wenig Zeit, um zu beten!«
»Ich gebe dir eine halbe Viertelstunde,« erwiderte Blaubart, »aber nicht einen Augenblick mehr.«
Als sie allein war, rief sie ihre Schwester und sagte zu ihr: »Schwester Anne (so hieß diese), ich bitte dich, steige hinauf auf die Spitze des Turmes und halte Ausschau, ob meine Brüder noch nicht kommen. Sie haben mir versprochen, mich heute zu besuchen; wenn du sie siehst, gib ihnen ein Zeichen, damit sie eilen.«
Die Schwester Anne stieg auf die Spitze des Turmes, und die Arme rief in ihrer Angst von Zeit zu Zeit hinauf:
»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«
Und die Schwester Anne antwortete:
»Ich sehe nichts als Sonnenstaub und Gräsergrün.«
Währenddessen hielt Blaubart ein großes Messer in seiner Hand und schrie aus Leibeskräften:
»Steige sofort herab, oder ich komme dich holen!«
»Noch einen Augenblick«, bat seine Frau und rief leise:
»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«
Und die Schwester Anne antwortete:
»Ich sehe nichts als Sonnenstaub und Gräsergrün!«
»Steige sofort herab,« schrie Blaubart, »oder ich komme dich holen!«
»Ich komme«, antwortete seine Frau.
Und dann rief sie:
»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«
»Ich sehe,« erwiderte die Schwester Anne, »eine große Staubwolke, die von dieser Seite kommt.«
»Sind es meine Brüder?«
»Ach nein, meine Schwester, es ist nur eine Schafherde.«
»Willst du nicht herunterkommen?« schrie Blaubart.
»Noch einen kleinen Augenblick«, bat seine Frau.
Und dann rief sie:
»Anne, Schwester Anne, siehst du nichts kommen?«
»Ich sehe,« erwiderte diese, »zwei Reiter, die von dort herkommen, aber sie sind noch weit entfernt.« Gleich darauf rief sie: »Gott sei gelobt, es sind die Brüder. Ich gebe ihnen Zeichen, so gut ich kann, damit sie eilen.«

Blaubart fing an, so laut zu schreien, daß das ganze Haus zitterte, und die arme Frau stieg hinab und warf sich ihm tränenüberströmt mit aufgelösten Haaren zu Füßen.
»Das nützt nichts,« sagte Blaubart, »du mußt sterben.«
Dann packte er sie mit der einen Hand bei den Haaren und erhob mit der anderen das große Messer, um ihr den Hals abzuschneiden.
Das arme Weib wandte sich ihm zu, sah ihn mit todesängstlichen Augen an und bat um einen Augenblick, damit sie sich sammele.
»Nein, nein!« schrie er, »empfiehl dich deinem Gott!« dann hob er den Arm und ... ...
In demselben Augenblick pochte jemand so heftig an das Tor, daß Blaubart innehielt. Man öffnete, und sogleich sah man zwei Ritter, die mit Degen in den Händen eintraten und sich geradewegs auf Blaubart stürzten.

Er erkannte, daß es die Brüder seiner Frau waren — der eine war Dragoner, der andere Musketier — und ergriff die Flucht, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber die Brüder verfolgten ihn so schnell, daß sie ihn einholten, bevor er noch die Freitreppe erreicht hatte. Sie stießen ihm ihren Degen mitten durch den Leib und ließen ihn tot liegen. Die arme Frau war fast ebenso tot wie ihr Gatte; sie hatte nicht mehr die Kraft sich aufzurichten, um ihre Brüder zu umarmen. —
Es stellte sich heraus, daß Blaubart keine Erben hatte, und so blieb seine Frau Herrin aller seiner Güter. Einen Teil verwendete sie dazu, ihre Schwester Anne mit einem jungen Edelmanne zu verheiraten, den diese schon seit langem liebte; mit einem anderen Teile kaufte sie ihren beiden Brüdern Hauptmannsstellen; das übrige brachte sie selbst einem rechtschaffenen Manne mit in die Ehe, der sie bald die schlechte Zeit vergessen ließ, die sie mit Blaubart verbracht hatte.
Moral:
Die Neugier ist die allerschlimmste Plage;
Sie reizt den Wunsch und bringt dann böse Pein.
Man sieht das tausendmal an einem Tage. —
Der Drang zum Neuen ist zwar stark, allein
Das Wissen selbst enttäuscht, und jedes Mal
Ist die gerechte Strafe: bittre Qual.
Die Fee
Es war einmal eine Witwe, die hatte zwei Töchter. Die älteste glich ihr von Ansehn und Wesen so sehr, daß ein jeder, der sie sah, die Mutter zu sehen glaubte: sie waren alle beide so unausstehlich und so hochmütig, daß man nicht mit ihnen zusammen leben konnte. Die jüngere, in ihrer Sanftmut und Rechtschaffenheit das wahre Ebenbild ihres verstorbenen Vaters, war eines der schönsten Mädchen, das man je zu Gesicht bekam. Wie man natürlich immer seinesgleichen liebt, so war die Mutter wie vernarrt in ihre älteste Tochter; aber gegen die jüngere hegte sie eine schreckliche Abneigung. Sie ließ sie in der Küche essen und ohne Unterbrechung arbeiten.
Unter anderem mußte das arme Kind zweimal am Tage eine gute halbe Meile weit Wasser holen, jedes Mal einen großen Krug voll. Eines Tages, als sie wieder bei dem Brunnen war, kam eine arme Frau zu ihr, die bat um einen Schluck Wasser.
»Gern, mein Mütterchen«, sagte das gute Kind, spülte sogleich den Krug aus, schöpfte an der schönsten Stelle des Brunnens und reichte ihr den Trunk, wobei sie immer den Krug unterstützte, um ihr das Trinken zu erleichtern. Als die gute Frau getrunken hatte, sagte sie:
»Du bist so schön, so gut und so brav, daß ich dir etwas schenken muß.« Es war nämlich eine Fee, die hatte die Gestalt einer armen Bäuerin angenommen, um zu sehen, wie weit die Rechtschaffenheit des jungen Mädchens gehe.
»Ich schenke dir,« so fuhr die Fee fort, »die Gabe, daß mit jedem Worte, das du sprichst, eine Blume oder ein Edelstein aus deinem Munde kommt.«

Als das Mädchen nach Hause kam, zankte die Mutter, weil sie so lange beim Brunnen geblieben war. »Ich bitte um Verzeihung, Mutter,« sagte das arme Kind, »daß ich mich so verspätet habe.« Und während sie sprach, kamen aus ihrem Munde zwei Rosen, zwei Perlen und zwei große Diamanten. »Was sehe ich,« rief die Mutter ganz erstaunt, »mir scheint, Perlen und Diamanten kommen aus deinem Munde! Woher hast du das, mein Kind?« Es war das erstemal, daß sie zu ihr »mein Kind« sagte.
Das arme Mädchen erzählte in ihrer Einfalt alles, was sich zugetragen hatte, wobei wieder eine Menge Diamanten zum Vorschein kamen.
»Wundervoll,« rief da die Mutter, »ich muß auch meine andere Tochter schicken. Sieh nur, Fanchon, was aus dem Munde deiner Schwester kommt, wenn sie spricht; wärst du nicht glücklich, dieselbe Gabe zu besitzen? Du brauchst nur zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu schöpfen, und wenn eine arme Frau dich um einen Trunk bittet, ihn ihr recht höflich zu reichen.«
»Zum Brunnen zu gehen,« antwortete jene grob, »das stände mir gut an!«
»Aber ich will, daß du gehst,« entgegnete die Mutter, »und zwar auf der Stelle!«
Darauf ging sie, aber brummend und widerwillig. Sie nahm die schönste Flasche mit, die im ganzen Hause war. Kaum war sie am Brunnen angelangt, da sah sie eine prächtig gekleidete Dame, die aus dem Walde kam und sie um einen Trunk Wasser bat. Es war dieselbe Fee, die ihrer Schwester erschienen war, aber sie hatte jetzt Wesen und Kleidung einer Prinzessin angenommen, um zu sehen, wie weit die Unhöflichkeit dieses Mädchens gehe.
»Bin ich hierher gekommen,« sagte barsch zu ihr die Hochmütige, »um Euch einen Trunk zu reichen? Sollte ich eigens ein silbernes Fläschchen mitgebracht haben, nur damit ich einer Dame daraus zu trinken geben kann? Meinetwegen trinkt allein, wenn Ihr wollt!«
»Du bist gar nicht höflich,« antwortete die Fee, ohne in Zorn zu geraten, »und weil du so wenig gefällig bist, verleihe ich dir die Gabe, daß mit jedem Wort, das du sprichst, eine Schlange oder eine Kröte aus deinem Munde kommt.«
Als ihre Mutter sie kommen sah, rief sie ihr entgegen: »Wie ist es, mein Kind?«
»So ist es, Mutter,« antwortete die Grobe und spie zwei Vipern und zwei Kröten.
»Himmel, was muß ich sehen,« jammerte die Mutter, »deine Schwester ist daran schuld, sie soll es mir büßen.«
Und sogleich lief sie hin, um diese zu schlagen. Das arme Kind floh und brachte sich in dem nahen Walde in Sicherheit. Der Königssohn, der von der Jagd zurückkehrte, begegnete ihr, und als er sie so schön sah, fragte er sie, was sie allein im Walde mache und warum sie weinen müsse.
»Ach, Herr, meine Mutter hat mich aus dem Hause gejagt!«
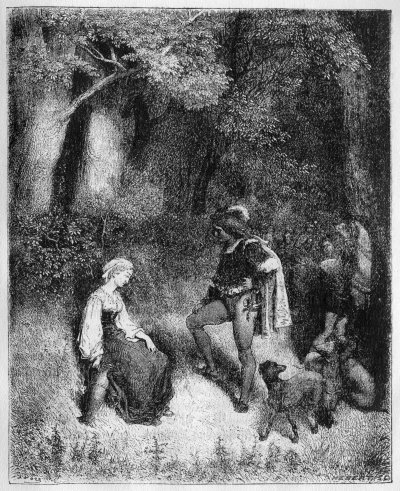
Der Königssohn, der aus ihrem Munde fünf oder sechs Perlen und ebensoviel Diamanten kommen sah, bat sie, ihm doch zu sagen, woher sie das habe. Und sie erzählte ihm ihr Abenteuer. Da verliebte sich der Königssohn in sie; und indem er überlegte, daß eine solche Gabe mehr wert sei als alles, was man einer anderen als Mitgift geben könne, nahm er sie mit sich in den Palast des Königs, seines Vaters, und heiratete sie dort.
Ihre Schwester aber hatte sich so hassenswert gemacht, daß ihre eigene Mutter sie aus dem Hause jagte. Die Unglückliche lief lange Zeit herum, ohne jemanden zu finden, der sich ihrer annahm und starb elendiglich in einem Winkel des Waldes.
Moral:
Edelsteine und Dukaten
Sind gar sehr begehrt;
Milde Worte, edle Taten
Haben höheren Wert.
Der gestiefelte Kater
Es war einmal ein Müller, der hinterließ bei seinem Tode seinen drei Kindern nur eine Mühle, einen Esel und einen Kater. Das Erbe war schnell geteilt. Kein Notar und kein Rechtsanwalt wurde gerufen. Die Kosten hätten auch die ganze Erbschaft aufgezehrt.
Der Älteste bekam die Mühle und der Zweite den Esel. Der Jüngste bekam den Kater, und er war untröstlich über das armselige Los, das er gezogen hatte.
»Meine Brüder,« sagte er, »können sich jetzt anständig ernähren, wenn sie sich zusammen tun. Aber ich kann des Hungers sterben, wenn ich meinen Kater aufgegessen und aus seinem Fell mir eine Weste gemacht habe.«
Der Kater hatte diese Worte gehört, aber er ließ sich nichts merken und sagte mit wichtiger und ernster Miene zu seinem Herrn:
»Seid nicht traurig, lieber Herr, gebt mir einen Sack und laßt mir ein Paar Stiefeln machen, damit ich in den Wald gehen kann, und dann sollt Ihr sehen, daß Euer Erbteil doch nicht so schlecht ist, wie Ihr glaubt.«
Sein Herr gab nicht viel auf diese Rede, aber er hatte oft den Kater bei seiner Jagd auf Ratten und Mäuse beobachtet und er hatte gesehen, wie er sich an den Beinen aufhing, oder wie er sich im Mehl versteckte und sich tot stellte. So hatte er Zutrauen und glaubte in ihm eine Hilfe in seinem Unglück zu haben.
Als der Kater das bekommen, worum er gebeten hatte, zog er sich sofort die Stiefeln an, hing sich den Sack um den Hals, nahm den Riemen in die Pfote und ging in ein Dickicht, wo es viele Hasen gab. In den Sack steckte er Klee und Disteln, stellte sich tot und wartete, ob nicht irgendein junger, mit den Ränken dieser Welt noch wenig vertrauter Hase sich in den Sack schliche, um an dem Leckerbissen zu naschen. Kaum hatte er sich hingelegt, kam ein junges und unerfahrenes Häschen und kroch in den Sack. Da zog Meister Kater die Schnüre zu, packte das Häschen und machte ihm ohne Erbarmen den Garaus. Stolz ging er mit seiner Beute zum König und verlangte ihn zu sprechen.
Man führte ihn in das Gemach Seiner Majestät, wo er mit einer tiefen Verbeugung eintrat und so zum Könige sprach:
»Hier bringe ich Euch einen Hasen, Herr König, den Euch der Marquis von Carabas (so war der Name, den er für seinen Herrn ausgesucht hatte) als Geschenk übersendet.«
»Sage deinem Herrn,« antwortete der König, »daß ich ihm danke, und sage ihm, er habe mir eine große Freude bereitet.«
Ein zweites Mal verbarg er sich in einem Kornfeld und legte den offenen Sack wieder hin. Und als zwei Rebhühner hineingeschlüpft waren, zog er ihn zu und fing alle beide.
Dann ging er zum König und brachte ihm, wie früher den Hasen, die beiden Rebhühner zum Geschenk. Der König nahm auch dieses Wildbret mit Freude entgegen und ließ dem Kater einen Trunk reichen.
So brachte er zwei bis drei Monate lang dem König von Zeit zu Zeit irgendein Stück aus der angeblichen Jagdbeute seines Herrn. Als er aber eines Tages erfuhr, daß der König mit seiner Tochter, der schönsten Prinzessin der Welt, am Ufer des Flusses spazieren fahren wollte, da sagte er zu seinem Herrn:
»Jetzt folgt meinem Rat, und Euer Glück ist gemacht. Ich zeige Euch eine Stelle am Fluß, da könnt Ihr baden. Das übrige laßt mich machen!«
Herr von Carabas tat, wie ihm der Kater riet, ohne zu wissen, wozu es gut sein sollte. Wie er nun badete, kam der König vorüber, und der Kater fing an, aus Leibeskräften zu schreien:
»Zu Hilfe. Zu Hilfe! Der Marquis von Carabas ertrinkt!«

Als der König diese Hilfeschreie hörte, steckte er den Kopf zum Wagenfenster heraus. Sofort erkannte er den Kater, der ihm des öfteren Wildbret gebracht hatte, und befahl seiner Leibwache, dem Marquis von Carabas schleunigst zu Hilfe zu eilen.
Während man den armen Marquis aus dem Fluß zog, trat der Kater an den Wagen heran und berichtete dem König, daß Diebe gekommen seien und die Kleider seines badenden Herrn gestohlen hätten, trotzdem er ihnen, so laut er konnte, zugerufen hätte. In Wahrheit hatte der Schlauberger die Kleider unter einem großen Steine versteckt.
Sogleich gab der König seinem Kammerdiener den Auftrag, einen seiner schönsten Röcke für den Marquis von Carabas zu holen.
Tausend Aufmerksamkeiten erwies der König dem Marquis, und da das schöne Gewand, das er ihm schenkte, seine Gestalt gut zur Geltung brachte, gefiel er der Tochter des Königs sehr, und kaum hatte der Marquis von Carabas zwei bis drei bei aller Ehrfurcht doch ein wenig zärtliche Blicke mit ihr getauscht, da war sie bis über die Ohren in ihn verliebt.
Der König lud ihn ein, in den Wagen zu steigen und die Spazierfahrt mitzumachen.

Froh über das gute Gelingen seines Planes, ist der Kater vor dem Wagen her. Als er zu Bauern kam, die eine Wiese mähten, rief er ihnen zu:
»Ihr guten Leute, wenn Ihr nicht sagt, daß diese Wiese, die Ihr mäht, dem Herrn Marquis von Carabas gehört, so werdet Ihr alle miteinander zu Pastetenfleisch zerhackt!«
Richtig fragte sie der König, wem diese Wiese gehöre, die sie mähten.
»Dem Herrn Marquis von Carabas«, riefen sie wie mit einer Stimme, denn die Drohung des Katers hatte ihnen angst gemacht.
»Da habt Ihr ein schönes Erbe«, wandte sich der König an den Marquis von Carabas.
»Ja, Sire,« antwortete der, »die Wiese hier bringt alle Jahre schöne Erträge.«
Meister Kater, der immer vorneweg lief, kam zu Schnittern und rief ihnen zu:
»Ihr guten Leute, die Ihr da mäht, wenn Ihr nicht sagt, daß diese Kornfelder dem Herrn Marquis von Carabas gehören, so werdet Ihr alle klein gehackt wie Pastetenfleisch!«
Als der König einen Augenblick später vorüberfuhr, wollte er wissen, wem die Felder gehörten, die er da sah.
»Dem Herrn Marquis von Carabas«, antworteten die Schnitter, und der König und der Marquis hatten ihre Freude an der Antwort.
Allen Leuten, die er traf, schärfte der Kater, der immer vor dem Wagen her lief, denselben Spruch ein, und der König wunderte sich sehr über den großen Reichtum des Herrn Marquis von Carabas. Am Ende kam Meister Kater an ein prächtiges Schloß. Das gehörte einem Riesen, dem Reichsten, der weit und breit zu finden war, und alle Felder, bei denen der König vorübergekommen war, gehörten zu dieser Schloßherrschaft.
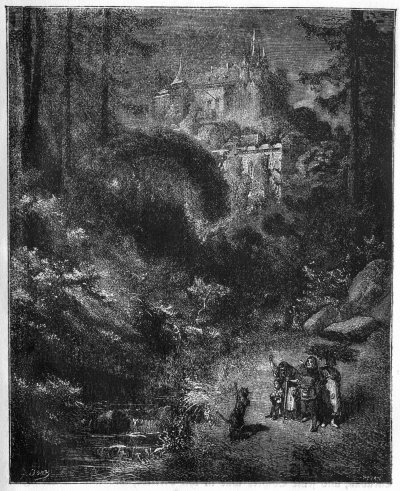
Vorsichtig erkundigte sich der Kater, wer der Riese sei und was er treibe. Dann bat er um eine Audienz mit der Begründung, daß er bei seinem Schlosse nicht vorübergehen wolle, ohne sich die Ehre zu geben, seine Aufwartung zu machen.
Der Riese empfing ihn so höflich, wie es bei einem Riesen möglich ist, und bat ihn, Platz zu nehmen.

»Man hat mir versichert,« sagte der Kater, »daß es in Eurer Macht stände, die Gestalt eines jeden Tieres anzunehmen, daß Ihr beispielsweise ein Löwe sein könnt oder ein Elefant.«
»Ganz recht,« brummte der Riese, »damit Ihr’s glaubt, will ich jetzt ein Löwe werden.«
Der Kater erschrak, als er wirklich einen Löwen vor sich sah, und kletterte schleunigst auf die Dachrinne, nicht ohne Mühe und Gefahr, denn die Stiefel hinderten ihn beim Laufen. Als der Kater sah, daß der Riese wieder seine alte Gestalt angenommen hatte, kletterte er herab und gestand, daß er große Angst gehabt habe.
Dann sagte er: »Man hat mir außerdem versichert, was ich aber kaum glauben kann, Ihr könntet Euch auch in die kleinsten Geschöpfe verwandeln, beispielsweise in eine Ratte oder in eine Maus. Ich muß gestehen, ich halte das für ganz ausgeschlossen.«
»Ausgeschlossen,« höhnte der Riese, »sieh einmal an«, und in demselben Augenblick verwandelte er sich in eine Maus, die auf dem Fußboden hin und her huschte. Kaum hatte der Kater das bemerkt, da packte er die Maus und fraß sie auf.
Inzwischen war der König beim Schlosse des Riesen angekommen und zeigte Lust, hineinzugehen. Als der Kater den Wagen über die Schloßbrücke holpern hörte, lief er hin und sagte zum König:
»Eure Majestät heiße ich herzlich willkommen im Schlosse des Herrn Marquis von Carabas!«
»Wie, Herr Marquis,« rief der König aus, »dieses Schloß gehört Ihnen? Es gibt nicht leicht etwas Schöneres mit all diesen Gebäuden ringsum. Wenn Sie erlauben, gehen wir hinein.«
Der Marquis reichte der Prinzessin die Hand, und sie gingen hinter dem König her, der voranschritt. Sie kamen in einen großen Saal, wo ein herrliches Mahl bereitet war, welches der Riese für seine Freunde bestimmt hatte, die ihn am selben Tage besuchen wollten, die aber nicht gewagt hatten, zu kommen, als sie erfuhren, daß der König da sei.
Der König war entzückt von dem vortrefflichen Herrn Marquis von Carabas, und seine Tochter war in ihn verliebt, und wie der König die vielen Reichtümer sah, die dem Herrn Marquis gehörten, da sagte er zwischen dem sechsten und siebten Glase zu ihm:
»Herr Marquis, es liegt nur an Ihnen, wenn Sie mein Schwiegersohn werden wollen.«
Der Marquis von Carabas verbeugte sich und nahm das ehrenvolle Angebot des Königs an und heiratete die Prinzessin noch an demselben Tage. Der Kater aber wurde ein großer Herr und ging nur noch auf die Mäusejagd, wenn er sich die Zeit vertreiben wollte.
Moral:
Es ist fürwahr sehr angenehm,
Vom Vater Geld und Gut zu erben.
Der Arme hat’s nicht so bequem;
Er braucht jedoch nicht arm zu sterben:
Mit Fleiß und mit Geschicklichkeit
Kommt er bisweilen auch so weit.
Der kleine Däumling
Es war einmal ein Holzhacker und seine Frau. Die hatten sieben Kinder, lauter Knaben. Der älteste war erst zehn Jahre alt und der jüngste sieben. Man braucht sich aber nicht zu wundern, daß der Holzhacker in der kurzen Zeit so viel Kinder bekam, denn seine Frau war sehr fleißig und schenkte ihm jedesmal mindestens zwei.
Es waren arme Leute, und die sieben Kinder machten ihnen viel Sorge, weil noch keines von ihnen sich sein Brot selber verdiente. Aber die größte Sorge machte ihnen ihr Jüngster; er war ein Schwächling und konnte noch kein einziges Wort sprechen. Das war in Wirklichkeit ein Zeichen seiner Schlauheit; aber die Eltern hielten ihn für dumm.
Er war ein winziger Kerl und, als er zur Welt kam, nicht länger ein Daumen. Man nannte ihn deshalb den kleinen Däumling.
Das arme Kind war immer der Sündenbock zu Hause, stets gab man ihm unrecht. Und doch war er der Schlaueste und Geriebenste von allen seinen Brüdern und wenn er auch wenig sprach, so hörte er um so mehr.
Eines Tages, als die Kinder schon zu Bett gebracht waren, saß der Holzhacker mit seiner Frau auf der Ofenbank und sagte kummervollen Herzens zu ihr:
»Du mußt einsehen, daß wir unsere Kinder nicht länger ernähren können. Ich kann es nicht mit ansehen, wie sie vor meinen Augen verhungern. Wir müssen sie im Walde aussetzen. Das ist nicht schwer; wenn sie Reisig suchen, dann lassen wir sie allein und gehen davon.«
»Was!«, rief da seine Frau, »du brächtest es über das Herz, deine eigenen Kinder zu töten?«

Vergebens sprach der Mann von ihrer großen Armut, aber sie konnte ihm nicht recht geben, denn wenn sie auch arm war, so war sie doch die Mutter der Kinder. Doch als er ihr vorhielt, welcher Schmerz es für sie sei, zuzusehen, wie die Kinder verhungerten, da war sie schließlich einverstanden und ging weinend zu Bett.
Der kleine Däumling aber hatte alles gehört. Denn als er in seinem Bette lag und die Eltern von ihren Sorgen sprechen hörte, da war er leise aufgestanden und unter den Schemel seines Vaters gekrochen, wo er unbemerkt lauschen konnte.
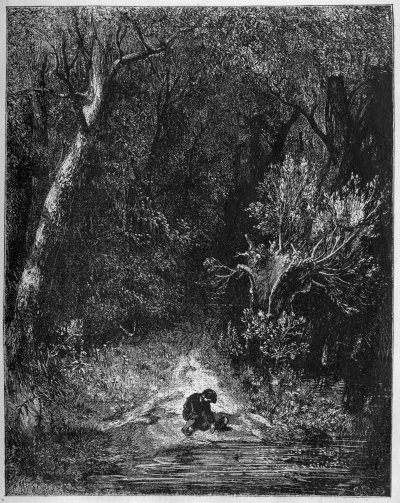
Er legte sich dann wieder hin. Aber er konnte nicht einschlafen und dachte nur darüber nach, was jetzt zu tun sei. Früh am Morgen stand er auf, ging an den Bach, füllte sich die Taschen mit kleinen, weißen Kieselsteinen und kehrte ins Haus zurück. Bald brachen sie auf. Der kleine Däumling verriet seinen Brüdern kein Sterbenswörtchen von dem, was er wußte. Sie kamen in einen großen, dichten Wald, in dem man sich schon auf zehn Schritte nicht mehr sehen konnte. Der Holzhacker fällte Bäume, und seine Kinder sammelten Reisig, das sie zu Bündeln banden. Als der Vater und die Mutter sie so beschäftigt sahen, da machten sie sich heimlich auf einem kleinen Seitenpfade davon.

Auf einmal sahen sich die Kinder verlassen und fingen an zu weinen und aus Leibeskräften zu schreien. Der kleine Däumling ließ sie schreien, weil er wußte, wie sie nach Hause zurückfinden könnten. Denn unterwegs hatte er die kleinen, weißen Kieselsteine fallen lassen, die er in seiner Tasche trug. Er sagte deshalb zu seinen Brüdern:
»Fürchtet euch nicht! Vater und Mutter haben uns verlassen, aber ich werde euch heimführen. Folgt mir nur!«
Und sie folgten ihm. Er führte sie auf demselben Wege, auf dem sie in den Wald gekommen, zu ihrem Hause zurück. Zuerst wagten sie nicht, hineinzugehen. Sie lehnten sich alle an die Tür, um zu hören, was Vater und Mutter sprachen.
Kaum waren der Holzhacker und seine Frau nach Hause gekommen, da schickte ihnen der Herr des Dorfes die zehn Taler zurück, die er ihnen schon lange schuldig war, und mit denen sie nicht mehr gerechnet hatten. Das rettete den armen Leuten das Leben, denn sie waren am Verhungern. Sogleich schickte der Holzhacker seine Frau zum Fleischer, und weil sie schon lange kein Fleisch gegessen hatten, kaufte sie dreimal soviel, wie sie für sich zu einem Abendessen brauchten. Als sie nun satt waren, sagte die Frau:
»Wo mögen jetzt unsere armen Kinder sein? Wie würde ihnen das schmecken, was wir hier übrig haben, aber du, Wilhelm, hast sie ja durchaus umbringen wollen. Immer habe ich gesagt, wir würden es noch bereuen. Wie mag es ihnen jetzt in dem finsteren Walde gehen? Ach, mein Gott, die Wölfe haben sie vielleicht schon gefressen! Du bist wahrhaftig ein Unmensch, daß du deine eigenen Kinder so umgebracht hast.«
Der Mann verlor schließlich die Geduld, denn mehr als zwanzigmal wiederholte sie, daß sie recht gehabt habe und daß er es noch bereuen würde. Am Ende drohte er ihr, sie zu schlagen, wenn sie nicht den Mund halte.
Und doch war der Holzhacker nicht weniger betrübt als seine Frau. Aber sie machte ihm den Kopf heiß, und er gehörte zu jenen Männern, die Frauen gerne haben, wenn sie sanfte Reden führen, die aber empört sind, wenn sie immer recht haben wollen.
Bittere Tränen vergoß seine Frau:
»Ach, wo sind jetzt meine Kinder, meine armen Kinder?«
Einmal rief sie das so laut, daß die Knaben, die an der Tür horchten, alle miteinander zu schreien anfingen:
»Wir sind wieder da! Wir sind wieder da!«
So schnell sie konnte, lief die Frau und machte ihnen die Tür auf. Unter tausend Küssen rief sie:
»Wie bin ich froh, daß ich euch wiederhabe, liebe Kinder! Ihr seid gewiß müde und habt großen Hunger; und du, Peterle, wie schmutzig bist du denn! Komm, ich will dich waschen!«
Peterle war ihr ältester Sohn, und sie liebte ihn mehr als alle anderen, weil er von ihr die roten Haare geerbt hatte. Dann setzten sie sich zu Tisch, und sie aßen mit einem Appetit, der Vater und Mutter helle Freude machte, und sie erzählten, welche Angst sie im Walde gehabt hatten, und einer schrie lauter als der andere.
Die guten Leute freuten sich, ihre Kinder wieder bei sich zu haben, und diese Freude dauerte geradeso lange, wie die zehn Taler reichten. Aber als das Geld ausgegeben war, kam wieder die alte Verzweiflung und mit ihr von neuem der Entschluß, die Kinder auszusetzen. Damit es nicht gehe wie beim ersten Mal, wollten sie die Kinder noch tiefer in den Wald hineinführen. Aber sie konnten darüber nicht so heimlich sprechen, daß der kleine Däumling es nicht gehört hätte, und er wollte es jetzt wieder so machen wie damals. Aber als er früh aufstand, um kleine Kieselsteine zu sammeln, da fand er die Haustür doppelt verriegelt.
Nun wußte er nicht, was er tun sollte. Doch als die Mutter jedem von ihnen ein Stück Brot zum Frühstück gab, da fiel ihm ein, daß er anstatt der Steinchen das Brot nehmen könne, wenn er es in Krümeln auf dem Wege ausstreute, den sie gehen würden, und er steckte das Brot in seine Tasche.
Vater und Mutter führten die Kinder in den dichtesten und finstersten Teil des Waldes, und als sie dort angekommen waren, machten sie sich auf einem Umweg davon und ließen sie zurück. Der kleine Däumling war nicht ängstlich, denn er glaubte, den Weg mit den Brotkrümeln, die er überall ausgestreut hatte, leicht zurückzufinden. Aber er war sehr betroffen, als er nicht ein einziges Krümelchen entdeckte. Die Vögel waren gekommen und hatten alle aufgepickt.
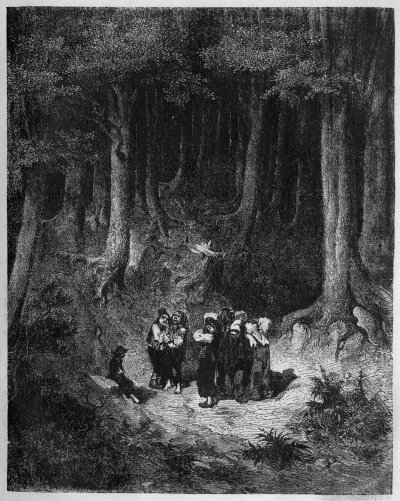
Da waren sie nun in großer Sorge, denn je weiter sie wanderten, um so mehr verirrten sie sich und gerieten immer tiefer in den Wald hinein. Die Nacht brach an, und es kam ein großer Sturm, der sie in Schrecken setzte. Von allen Seiten glaubten sie das Geheul der Wölfe zu hören, die sie fressen wollten. Sie wagten nicht mehr zu sprechen, noch sich zu rühren.
Zu alldem überraschte sie ein großer Regen, und sie wurden naß bis auf die Knochen. Bei jedem Schritt glitten sie aus und fielen zu Boden. Ganz beschmutzt standen sie da und wußten nicht mehr, was sie anfangen sollten.
Da kletterte der kleine Däumling auf einen großen Baum, um auszuschauen, ob er keine Hilfe sähe. Nach allen Seiten drehte er den Kopf und sah endlich ein kleines Licht, wie von einer Kerze, aber es war weit weg, jenseits des Waldes. Er kletterte vom Baum herab, und wie er wieder auf der Erde war, sah er das Licht nicht mehr. Das machte ihn trostlos. Aber als er eine Zeitlang mit seinen Brüdern in der Richtung gegangen war, in welcher er das Licht gesehen hatte, da sah er es beim Austritt aus dem Walde von neuem. Jedesmal, wenn der Weg sich senkte, verloren sie es wieder aus den Augen, und das machte ihnen große Angst. Aber schließlich kamen sie an das Haus, wo die Kerze brannte.
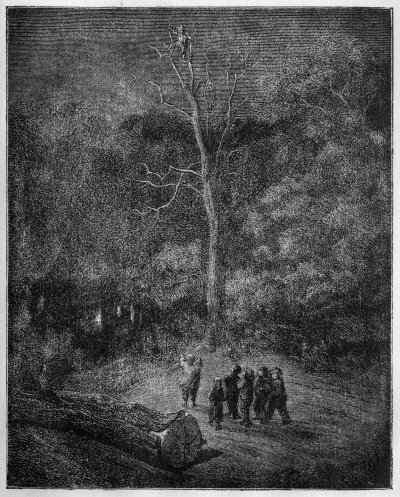
Sie pochten an die Tür, und eine gute Frau machte ihnen auf und fragte nach ihrem Begehr.
Der kleine Däumling sagte, sie seien arme Kinder, die sich im Walde verirrt hätten, und sie bäten um Gottes willen um ein Nachtlager.
Wie die Frau die netten Kinder sah, fing sie an zu weinen und sagte zu ihnen:
»Ach, meine armen Kinder, wohin seid ihr geraten! Wißt ihr nicht, daß hier ein Riese wohnt, der kleine Kinder frißt?«
»Gute Frau,« antwortete ihr der kleine Däumling, der ebenso wie seine Brüder am ganzen Leibe zitterte, »was sollen wir jetzt anfangen? Gewiß werden uns die Wölfe heute im Walde auffressen, wenn Ihr uns nicht aufnehmen wollt. Da ist es schon besser, daß uns der Herr frißt; vielleicht hat er aber Mitleid, wenn wir ihn darum bitten.«

Da ließ die Frau die Kinder hinein, denn sie hoffte, sie bis zum nächsten Morgen vor ihrem Manne verstecken zu können. Sie führte sie an ein helles Feuer, damit sie sich wärmen konnten. Es wurde nämlich gerade ein Hammel am Spieße gebraten als Abendessen für den Riesen. Kaum fingen die Kinder an, warm zu werden, da hörten sie es drei- bis viermal an die Haustür donnern. Das war der Riese, der zurückkam. Schleunigst versteckte die Frau die Kinder unter dem Bett und öffnete.
Zuerst fragte der Riese, ob sein Abendbrot fertig und ob der Wein abgefüllt sei, und setzte sich zu Tisch. Der Hammel war noch ganz blutig, aber das schien ihm gerade recht. Dann schnüffelte er rechts und links und sagte, es röche ihm nach frischem Fleisch.

»Das wird wohl der Hammel sein, den ich soeben gebraten habe«, meinte seine Frau.
»Ich rieche frisches Fleisch, sage ich dir nochmals«, versetzte der Riese und sah seine Frau von der Seite an:
»Hier muß etwas sein, von dem ich nichts weiß!«
Mit diesen Worten stand er auf und ging geradenwegs auf das Bett zu.
»Aha, du schlechtes Weib! Du hast mich also wirklich betrügen wollen! Ich weiß wahrhaftig nicht, warum ich dich nicht schon längst gefressen habe. Es ist dein Glück, daß du so ein altes Tier bist. Der Leckerbissen hier kommt mir gerade recht. Damit kann ich drei befreundete Riesen, die mich in diesen Tagen besuchen, schön bewirten.«
Dann zerrte er die Kinder eines nach dem anderen unter dem Bette hervor. Die Ärmsten warfen sich ihm zu Füßen und baten um Gnade. Aber es war der Grausamste aller Riesen; er hatte kein Mitleid mit ihnen, und mit seinen Augen verschlang er sie schon. Dann sagte er zu seiner Frau, das würden Leckerbissen werden, wenn sie nur eine gute Brühe dazu mache.

Er langte nach seinem Messer und fing vor den armen Kindern an, es auf seinem Schleifstein, den er in der Linken hielt, zu schärfen. Schon hatte er eines gepackt, da sagte seine Frau zu ihm:
»Was willst du denn jetzt damit? Hast du nicht Zeit bis morgen?«
»Halt den Mund,« schrie sie der Riese an, »sie sind dann mürber!«
»Aber du hast ja noch so viel Fleisch,« meinte seine Frau, »ein Kalb, zwei Hammel und ein halbes Schwein.«
»Du magst recht haben,« brummte der Riese, »gib ihnen aber gut zu essen, damit sie mir nicht abmagern, und bring sie dann zu Bett!«
Die gute Frau war außer sich vor Freude und brachte den Kindern ein schönes Abendessen. Doch sie konnten keinen Bissen anrühren, so sehr zitterten sie vor Angst. In bester Laune setzte sich der Riese hin und freute sich, für seine Kumpane einen so schönen Leckerbissen erwischt zu haben. Er trank und trank zwölf Glas mehr als sonst. Das stieg ihm in den Kopf, und er legte sich zu Bett.
Der Riese besaß sieben junge Töchter. Diese Riesinnen hatten alle eine wunderschöne Haut, da sie sich ebenso wie ihr Vater von frischem Fleische nährten; aber sie hatten kleine, graue, ganz runde Augen, eine große Nase und einen großen Mund mit langen, spitzen und weit auseinanderstehenden Zähnen. Sie waren noch nicht sehr bösartig, aber doch vielversprechend, denn sie fingen schon an, die kleinen Kinder zu beißen und ihnen das Blut auszusaugen.
Sie waren schon früh zu Bette gebracht worden und schliefen alle in einem einzigen großen Bett. Jede von ihnen trug eine goldene Krone auf dem Kopfe. In demselben Zimmer stand ein zweites Bett von derselben Größe. In dieses Bett legte die Frau des Riesen die sieben kleinen Jungen. Dann ging sie selbst zur Ruhe.
Der kleine Däumling hatte gesehen, daß die Töchter des Riesen goldene Kronen auf dem Kopfe trugen, und da er fürchtete, es möchte den Riesen reuen, daß er sie nicht schon am selben Abend abgeschlachtet hatte, stand er gegen Mitternacht auf, nahm sich und seinen Brüdern die Mütze vom Kopf und setzte sie, mit aller Vorsicht, den sieben Riesentöchterchen auf. Seinen Brüdern und sich selbst setzte er die goldenen Kronen auf, die er jenen genommen hatte. So mußte der Riese die Knaben für seine Töchter und seine Töchter für die Knaben halten, die er schlachten wollte.
Es kam genau so, wie es sich der kleine Däumling gedacht. Der Riese wachte um Mitternacht auf, und es tat ihm leid, daß er bis zum anderen Tage verschoben hatte, was er sofort erledigen wollte. Mit einem mächtigen Satz sprang er aus seinem Bett und griff zu seinem Messer:
»Nun wollen wir mal sehen, was unsere kleinen Schelme machen! So etwas gibt es nicht zum zweiten Male.«
So sprechend, tappte er im Dunkeln hinauf ins Zimmer seiner Töchter und trat an das Bett heran, in dem die kleinen Knaben lagen. Sie schliefen alle fest, nur der kleine Däumling wachte. Ein Gruseln überlief ihn, als er die tastende Hand des Riesen fühlte, der vorher schon alle seine Brüder abgetastet hatte. Wie der Riese die goldenen Kronen berührte, sagte er:
»Donnerwetter, da hätte ich beinahe etwas Schönes angerichtet! Ich habe wahrhaftig am Abend zuviel getrunken.«
Dann ging er an das Bett seiner Töchter, und als er hier die Mützen der Knaben fand, sagte er:
»Da hätten wir ja unsere Bürschchen! Nun rasch an die Arbeit!«
Mit diesen Worten schnitt er, ohne zu zögern, allen seinen Töchtern die Köpfe ab.

Zufrieden mit seiner Tat legte er sich wieder ins Bett. Kaum hörte der kleine Däumling den Riesen schnarchen, da weckte er seine Brüder und hieß sie, sich schnell anzuziehen und ihm zu folgen. Vorsichtig stiegen sie hinab in den Garten und sprangen über die Mauer. Am ganzen Leibe zitternd, liefen sie bis zum Morgen, ohne Weg und Steg zu kennen.
Als der Riese erwachte, sagte er zu seinem Weib:
»Gehe hinauf und mache die kleinen Schelme von gestern abend zurecht!«
Die Frau des Riesen war erstaunt über die gute Laune ihres Mannes und glaubte, er schicke sie, die Knaben anzuziehen. Sie ging hinauf und war zu Tode erschrocken, als sie ihre sieben Töchter mit abgeschnittenen Hälsen in ihrem Blute sah. Sie fiel in Ohnmacht, denn das ist das einzige, was Frauen in dieser Lage tun können. Der Riese glaubte, seiner Frau würde die Arbeit zu schwer, die er ihr aufgetragen hatte, und ging hinauf, um ihr zu helfen. Aber er war nicht weniger erschrocken als seine Frau bei diesem gräßlichen Anblick.
»Was habe ich da angerichtet,« schrie er, »aber sie sollen es mir auf der Stelle büßen, die Unglücklichen!«
Er goß seiner Frau einen Topf Wasser über die Nase, und als sie wieder zu sich kam, sagte er zu ihr:
»Gib mir schnell meine Siebenmeilenstiefel, daß ich die Bande einhole!«
Er machte sich auf den Weg, und als er kreuz und quer gelaufen war, kam er endlich auf die Straße, wo die Knaben gingen. Nur noch hundert Schritte waren sie vom Hause ihres Vaters entfernt. Da sahen sie den Riesen, wie er von Berg zu Berg schritt und die größten Ströme überquerte wie den kleinsten Bach. Der kleine Däumling fand in nächster Nähe ein Loch in einem Felsen und versteckte darin seine Brüder; auch er selbst kroch hinein und gab acht, was der Riese tat. Der war von dem großen Umweg, den er vergebens gemacht hatte, sehr erschöpft und wollte sich ausruhen. Zufällig setzte er sich gerade auf denselben Felsen, unter dem sich die Knaben versteckt hatten. Er konnte vor Müdigkeit nicht mehr weiter und schlief bald ein. Dabei fing er so schrecklich an zu schnarchen, daß die Kinder nicht weniger Angst bekamen wie damals, als er zu seinem großen Messer griff, um ihnen den Hals abzuschneiden.
Der kleine Däumling war mutiger. Während der Riese in festem Schlafe lag, sagte er zu seinen Brüdern, sie sollten rasch nach Hause laufen und sich um ihn keine Sorge machen. Sie folgten seinem Rat und erreichten glücklich das Haus. Der kleine Däumling machte sich an den Riesen heran, zog ihm vorsichtig seine Stiefel aus und schlüpfte selbst hinein. Die Stiefel waren zwar groß und weit, aber es waren Zauberstiefel: sie hatten die Eigenschaft, größer oder kleiner zu werden, je nach ihrem Träger, und sie paßten ihm so gut, als seien sie für ihn gemacht.

Schnurstracks lief er zum Hause des Riesen zurück und fand dort sein Weib in Tränen bei ihren toten Töchtern.
»Euer Gatte ist in großer Gefahr,« sagte Däumling zu ihr, »er ist von Räubern gefangen, und diese haben geschworen, ihn zu töten, wenn er ihnen nicht all sein Gold und Silber gäbe. Gerade als sie ihm den Dolch an die Kehle setzten, kam ich zufällig vorbei, und er bat mich, zu Euch zu gehen, um Euch zu benachrichtigen und Euch zu sagen, Ihr solltet mir alles aushändigen, was er an Vermögen besitzt, und sollt nichts zurückbehalten, weil sie ihn sonst ohne Mitleid töten. Da größte Eile nötig ist, gab er mir seine Siebenmeilenstiefel. Es soll zugleich ein Beweis sein, damit Ihr nicht glaubt, ich sei ein Schwindler.«
In ihrem großen Schrecken gab die Frau ihm alles, was sie hatte, denn wenn der Riese auch kleine Kinder fraß, so war er doch immer ein guter Vater und Gatte.
Schwer beladen mit den Schätzen des Riesen kehrte der kleine Däumling in das Haus seines Vaters zurück, wo er mit großer Freude empfangen wurde.
Es gibt viele Leute, die nicht glauben wollen, daß der kleine Däumling den Riesen bestohlen habe. Er habe in Wirklichkeit sich nur deshalb keine Gedanken darüber gemacht, dem Riesen die Siebenmeilenstiefel fortzunehmen, weil dieser sie doch nur dazu benutzte, um die kleinen Kinder zu fangen. Diese Leute behaupten, sie wüßten es aus bester Quelle, denn sie wären selbst im Hause des Holzhackers zu Gast gewesen, und sie erzählen, der kleine Däumling habe sich die Stiefel des Riesen angezogen und sei damit an den Hof des Königs gegangen, wo man in großer Sorge um das Schicksal des Heeres war, das 200 Meilen entfernt in heißem Kampfe lag. Man hatte keine Nachricht über den Ausgang der Schlacht.
Däumling ging nun zum König und erbot sich, ihm noch vor Tagesende Nachricht von der Armee zu bringen. Der König versprach ihm eine große Belohnung, wenn er dies fertig bringe. Noch am selben Abend überbrachte der kleine Däumling die ersehnte Botschaft, und dieser erste Lauf machte ihn so berühmt, daß er alles erreichte, was er wollte. Der König belohnte ihn fürstlich. Däumling brachte seine Befehle zur Armee, und viele Damen gaben ihm alles, was er verlangte, um nur Nachricht von ihren Liebhabern zu erhalten. Das war seine beste Einnahme. Es fanden sich zwar auch einige Ehefrauen, die ihm Briefe für ihre Gatten mitgaben, aber diese zahlten schlecht, und er hielt es für unter seiner Würde, mit dem ihm von dieser Seite zufließenden Verdienste überhaupt zu rechnen.
Auf diese Weise verschaffte er seiner ganzen Familie ein gutes Auskommen. Seinem Vater und seinen Brüdern kaufte er neugeschaffene Amtsstellen, und sich selbst schuf er einen trefflichen Hausstand.
Moral:
Wenn einer nette Kinder hat,
Die schön und wohl geraten sind,
Dann zeigt er sie der ganzen Stadt. —
Jedoch verliert er nicht ein Wort,
Wird ihm geschenkt ein schwächlich Kind,
Er quält’s und tut ihm jedem Tort. —
Doch oft ist so ein kleiner Mann
Ein Kerl, der vieles weiß und kann:
Der kleine Däumling, wie gesagt,
Hat der Familie Glück gebracht.
Aschenbrödel
oder
die Geschichte vom gläsernen Pantöffelchen
Es war einmal ein Edelmann, der hatte in seiner zweiten Ehe ein so hochmütiges und stolzes Weib geheiratet, wie man noch niemals eines sah. Diese Frau hatte zwei Töchter, welche ganz nach ihrer Art waren und ihr in jeder Hinsicht glichen. Auch der Mann hatte eine Tochter mit in die Ehe gebracht, ein Mädchen von holder Anmut und unvergleichlicher Güte, das wahre Ebenbild ihrer verstorbenen Mutter, der besten Frau der Welt.
Kaum war die Hochzeit vorbei, da zeigte sich die Stiefmutter auch schon von ihrer schlimmsten Seite. Sie konnte das junge Mädchen nicht leiden, denn neben ihm erschienen ihre eigenen Töchter noch häßlicher.
Deshalb trug sie ihm die schmutzigsten Arbeiten im Hause auf: es mußte das Geschirr reinigen, die Treppen fegen, es mußte das Zimmer der gnädigen Frau scheuern und das der gnädigen Fräuleins, ihrer Töchter. Es mußte auf dem Speicher unter dem Dache auf einem elenden Strohsacke schlafen, während seine Schwestern die herrlichsten Zimmer hatten, mit den allermodernsten Betten und mit Spiegeln, in denen sie sich vom Kopf bis zum Fuß betrachten konnten.
Doch alles ertrug das arme Mädchen mit Geduld, es wagte nicht, sich bei ihrem Vater zu beschweren, denn der hätte ihm doch nicht recht gegeben, weil er ganz unter dem Einflusse seiner Frau stand. Wenn es seine Arbeit gemacht hatte, dann setzte es sich neben dem Küchenherd in die Asche, und deshalb nannte man es im Hause nur noch die Küchenschabe; aber die zweite Tochter, die nicht ganz so böse war wie ihre ältere Schwester, gab ihm den Namen Aschenbrödel. Trotz allem war Aschenbrödel in ihren schlechten Kleidern noch hundertmal schöner als ihre Schwestern, wie sehr sich diese auch putzten.
Eines Tages gab der Sohn des Königs einen Ball und lud dazu alle Personen von Rang ein. Auch die beiden Fräuleins wurden eingeladen, denn sie spielten im Lande eine große Rolle. Darüber freuten sie sich sehr, und sie überlegten den ganzen Tag, wie sie sich am schönsten kleiden und schmücken könnten und was ihnen am besten stände. Da gab es neue Arbeit für Aschenbrödel. Sie mußte die Wäsche ihrer Schwestern waschen und bügeln und die Manschetten ihrer Kleider kräuseln. Man sprach von nichts anderem, als was man anziehen wolle.
»Ich,« sagte die Ältere, »ziehe das rote Velourkleid mit dem englischen Besatze an.«
Und die Zweite meinte: »Ich werde meinen gewöhnlichen roten Rock tragen, aber dazu nehme ich den Umhang mit den Goldblumen und meinen Diamantschmuck, was mir auch nicht schlecht stehen wird.«
Die berühmteste Haarkräuslerin mußte kommen, um die Spitzenhauben zu ordnen und die niedlichen Schönheitspflästerchen zu kleben. Dann riefen sie Aschenbrödel herbei, um ihr Urteil zu hören; denn sie hatte einen guten Geschmack. Aschenbrödel gab ihnen die besten Ratschläge und erbot sich sogar, ihnen das Haar zu machen. Das ließen sie sich gerne gefallen.
Während sie die Schwestern kämmte, sagten diese zu ihr:
»Aschenbrödel, hättest du wohl auch Lust, mit auf den Ball zu gehen?«
»Ach, edle Damen, warum treibt ihr euren Spott mit mir? Die Ehre wäre zu hoch für mich.«
»Da hast du recht, man würde nur lachen, sähe man eine Küchenschabe, wie du, zum Balle gehen.«
Eine andere als Aschenbrödel hätte nun sicher die Frisuren verdorben; aber Aschenbrödel war zu gutmütig dazu und kämmte ihnen die Haare wunderbar schön.
Fast zwei Tage lang aßen die beiden keinen Bissen, so zitterten sie vor freudiger Erwartung. Mehr als ein Dutzend Bänder gingen beim Schnüren entzwei, da sie so schlank als möglich sein wollten. In einem fort standen sie vor dem Spiegel.
Endlich war der ersehnte Tag gekommen, und sie fuhren ab.
Aschenbrödel folgte ihren Schwestern mit den Augen, solange sie konnte. Aber als sie den Wagen nicht mehr sah, da setzte sie sich hin und weinte. Ihre Patin sah ihre Tränen und fragte, was ihr fehle.
»Ich möchte so gern, .... ich möchte so gern ....«
Vor lauter Schluchzen konnte sie nicht zu Ende sprechen.
»Du möchtest wohl gern auf den Ball gehen?« sagte die Patin, die eine Fee war.
»Ach ja«, antwortete Aschenbrödel und tat einen tiefen Seufzer.
»Wenn du brav bist, dann will ich dich hingehen lassen.«
Mit diesen Worten führte sie Aschenbrödel in ihre Kammer und sagte zu ihr:
»Gehe in den Garten und bringe mir einen Kürbis!«
Aschenbrödel ging sofort hinunter, pflückte den schönsten Kürbis, den sie fand, und brachte ihn der Patin, ohne zu ahnen, wie er ihr zum Ballbesuch verhelfen könnte. Die Patin fing an, den Kürbis auszuhöhlen, und als nur noch die Schale übrig war, klopfte sie mit ihrem Zauberstab daran, und auf der Stelle verwandelte sich der Kürbis in einen schönen, goldenen Wagen.

Dann sah sie in der Mäusefalle nach und fand sechs lebendige Mäuse darin. Sie befahl Aschenbrödel, die Klappe ein wenig anzuheben, und gab jeder Maus, die herausschlüpfte, einen leichten Schlag mit ihrem Zauberstab. Darauf verwandelte sich die Maus sofort in ein schönes Roß. Das gab ein prächtiges Sechsgespann, sechs Pferde von herrlichem Apfelgrau, geradeso wie die Mäuse gewesen waren.
Nun fehlte nur noch ein Kutscher, und Aschenbrödel meinte: »Ich werde einmal sehen, ob nicht eine Ratte in der Falle ist! Daraus könnten wir wohl einen Kutscher machen.«
»Du hast recht,« sagte die Patin, »sieh einmal nach!«
Aschenbrödel holte die Rattenfalle; da waren drei fette Ratten darin. Eine von ihnen, die einen stattlichen Bart hatte, packte die Fee, und kaum hatte sie die Ratte mit dem Stabe berührt, da stand auch schon ein dicker Kutscher da, mit einem so mächtigen Schnauzbart, wie man noch keinen gesehen hatte.
Hierauf sagte die Fee zu Aschenbrödel:
»Gehe in den Garten, dort wirst du hinter der Gießkanne sechs Eidechsen finden, die bringe mir her!«
Kaum hatte sie die Eidechsen gebracht, da verwandelte sie die Patin in sechs Lakaien in prächtig verbrämten Röcken. Sofort stiegen die Lakaien auf ihre Sitze und benahmen sich dabei so geschickt, als hätten sie in ihrem ganzen Leben nichts anderes getan. Dann sagte die Fee zu Aschenbrödel:
»Siehst du, jetzt kannst du auf den Ball fahren; freust du dich nun?«
»O ja; aber soll ich denn so, wie ich bin, hingehen, in diesen schlechten Kleidern?«
Da berührte sie die Patin leise mit ihrem Zauberstabe, und sofort hatte sich ihr armseliges Kleid in ein gold- und silberglänzendes, mit Edelsteinen besetztes Gewand verwandelt. Zum Schluß gab sie ihr noch ein Paar niedliche gläserne Pantöffelchen.
So geschmückt stieg Aschenbrödel in den Wagen; aber vorher trug ihr die Patin auf, ja nicht die Mitternacht vorbeizulassen, und drohte ihr, wenn sie auch nur einen Augenblick länger auf dem Ball bliebe, so würde ihr Wagen wieder zum Kürbis werden, ihre Pferde zu Mäusen, ihr Kutscher zur Ratte, und ihre stattlichen Lakaien würden wieder ihre frühere Gestalt annehmen.
Aschenbrödel versprach ihrer Patin, den Ball ganz gewiß vor Mitternacht zu verlassen, und fuhr ab, außer sich vor Freude. Als sie so prächtig dahergefahren kam, benachrichtigte man den Sohn des Königs, eine vornehme Prinzessin, die niemand kenne, sein angekommen, und der Königssohn lief herbei, sie zu empfangen. Wie sie aus dem Wagen stieg, reichte er ihr die Hand und führte sie in den Festsaal. Da war mit einem Male großes Schweigen: alles hörte auf zu tanzen, und die Geigen verstummten. Jeder sah nur noch die wunderschöne Unbekannte. Überall hörte man raunen und wispern:
»Ach, wie schön ist sie!«

Sogar der König, so alt er war, konnte sich nicht von ihrem Anblick losreißen und flüsterte der Königin zu, er hätte lange keine so hübsche und so liebenswerte Person gesehen.
Die Damen musterten Kopfputz und Kleiderschnitt der Fremden mit großer Aufmerksamkeit, um es ihr schon am anderen Tage nachzutun, vorausgesetzt, daß sich so schöne Stoffe finden ließen und so geschickte Schneider.
Der Königssohn führte die Fremde auf den Ehrenplatz und bat sie sofort um einen Tanz, und sie tanzte mit so viel Anmut, daß man nicht aus dem Staunen kam.
Nun wurde ein köstliches Mahl bereitet, aber der junge Prinz konnte keinen Bissen essen: er sah nichts anderes mehr als seine Dame.
Nach dem Mahl stand Aschenbrödel auf und setzte sich zu ihren Schwestern, um ihnen tausenderlei Artigkeiten zu erweisen. Sie teilte Orangen und Zitronen mit ihnen, die ihr der Prinz geschenkt hatte, und setzte sie mit alldem in das größte Erstaunen. Denn sie erkannten Aschenbrödel nicht.
Als sie noch plauderten, hörte Aschenbrödel drei Viertel auf zwölf schlagen. Schleunigst erhob sie sich, machte vor der ganzen Festgesellschaft eine tiefe Verbeugung und verließ den Saal so rasch, wie sie konnte.
Zu Hause angelangt, suchte sie die Patin auf, dankte ihr herzlich und sagte ihr, sie wünsche sich sehnlichst, am nächsten Tage nochmals auf den Ball zu gehen, weil der Königssohn sie darum gebeten habe. Als sie gerade dabei war, ihre Erlebnisse zu erzählen, da klopften die Schwestern an die Türe, und Aschenbrödel machte ihnen auf.
»Ihr kommt aber spät!« sagte sie, rieb sich gähnend die Augen und reckte sich, als sei sie eben aufgestanden.
Die eine der Schwestern sagte: »Wärest du mit auf dem Ball gewesen, du hättest dich sicher nicht gelangweilt. Es war eine so schöne Prinzessin da, wie es auf der ganzen Welt keine zweite gibt. Tausend Artigkeiten hat sie uns erwiesen und hat uns Orangen und Zitronen geschenkt.«
Aschenbrödel war außer sich vor Freude; sie fragte, wie die Prinzessin hieße. Aber ihre Schwestern antworteten, daß kein Mensch sie kenne, und daß der Königssohn sich den Kopf darüber zerbräche und alles in der Welt darum gäbe, wenn er erfahren könne, wer sie sei.
Aschenbrödel lachte: »War sie wirklich so schön? Mein Gott, wie ich euch beneide! Könnte ich sie doch nur einmal sehen! Ach, Fräulein Javotte, leiht mir doch euer gelbes Kleid, welches ihr alltags tragt!«
»Das könnte mir passen,« meinte Fräulein Javotte, »einer alten Küchenschabe wie dir das Kleid leihen! Da müßte ich ja närrisch sein!«
Aschenbrödel hatte diese Antwort erwartet und war froh darüber, denn sie wäre in die größte Verlegenheit geraten, hätte ihr die Schwester wirklich das Kleid geliehen.
Als die beiden Schwestern am nächsten Tage wieder zum Balle fuhren, erschien auch Aschenbrödel dort, aber diesmal noch herrlicher geschmückt wie am ersten Tag.
Der Königssohn ging nicht von ihrer Seite und sagte ihr die schönsten Dinge.
Darüber vergaß das junge Mädchen ganz, was ihr die Patin gesagt. Die Uhr holte schon zum Schlag der zwölften Stunde aus, da glaubte sie noch, es sei erst elf. Schnell sprang sie nun auf und flüchtete so leicht wie eine Hindin.
Der Prinz stürzte ihr nach, aber er konnte sie nicht mehr erreichen. In der Eile verlor Aschenbrödel einen ihrer gläsernen Pantoffel, den der Prinz behutsam aufhob.
Ganz außer Atem kam sie nach Hause, ohne Wagen, ohne Lakai, in ihren schlechten Kleidern. Nichts war ihr von all der Herrlichkeit geblieben als das zweite Pantöffelchen, das genau so war wie das verlorene.
Die Torwächter des Schlosses wurden gefragt, ob sie keine Prinzessin gesehen hätten. Doch diese sagten, sie hätten nur ein junges Ding in Lumpen gesehen, mehr von dem Aussehen einer Bauernmagd als einer Edeldame.
Als nun die beiden Schwestern vom Ball heimkehrten, fragte sie Aschenbrödel, ob sie sich wieder gut unterhalten hätten, und ob auch die schöne Dame wieder da gewesen wäre.
Ja, sagten diese, aber die schöne Dame sei davongelaufen, als die Uhr Mitternacht geschlagen habe. Sie sei so rasch gelaufen, daß sie dabei eines ihrer wunderschönen gläsernen Pantöffelchen verloren habe. Das habe der Königssohn aufgehoben und bis zum Ende des Balles kein Auge davon gelassen. Sicher sei er ganz verliebt in das schöne Mädchen, dem das Pantöffelchen gehöre.
Sie hatten recht, denn wenige Tage darauf ließ der Königssohn mit Trompetenschall bekanntgeben, er würde das junge Mädchen zu seiner Frau machen, an dessen Fuß das Pantöffelchen passe.
Zuerst probierte man bei den Prinzessinnen, dann bei den Herzoginnen und bei der ganzen Hofgesellschaft, aber umsonst. Man brachte das Pantöffelchen zu den beiden Schwestern, die sich anstrengten, den Fuß hineinzuzwängen, aber sie brachten es nicht zuwege. Als Aschenbrödel ihnen dabei zusah und ihren Pantoffel wieder erkannte, sagte sie lachend:
»Laßt mich doch einmal sehen, ob er mir nicht paßt!«
Da fingen die Schwestern an zu lachen und ihre Witze über sie zu machen. Aber der Edelmann, der die Pantoffelprobe veranstaltete, hatte Aschenbrödel aufmerksam betrachtet und fand sie sehr schön. Deshalb sagte er zu ihr, ihr Wunsch sei berechtigt, denn er habe den Auftrag, die Probe bei allen jungen Mädchen zu machen.
Er ließ Aschenbrödel Platz nehmen, und als er den Pantoffel an ihren kleinen Fuß hielt, da schlüpfte sie mühelos hinein, und das Pantöffelchen paßte ihr wie angegossen.

Das Erstaunen der beiden Schwestern war groß, aber es wurde noch größer, als Aschenbrödel aus ihrer Tasche das andere Pantöffelchen hervorzog und hineinschlüpfte.
Darüber kam die Patin hinzu und mit ihrem Zauberstabe berührte sie Aschenbrödels Kleid und verwandelte es in ein Gewand, das noch viel, viel schöner war als alle früheren.
Da erkannten die beiden Schwestern in Aschenbrödel die schöne Fremde, die sie auf dem Ball gesehen hatten. Sie warfen sich ihr zu Füßen und baten sie um Verzeihung für alles Böse, was sie ihr zugefügt hatten.
Aschenbrödel hob sie auf, umarmte sie und beteuerte, daß sie ihnen von ganzem Herzen verzeihe und sie bäte, immer lieb zu ihr zu sein.
Dann geleitete man Aschenbrödel, herrlich geschmückt, wie sie war, zu dem jungen Prinzen, und dieser fand sie noch tausendmal schöner als zuvor. Wenige Tage darauf wurde die Hochzeit gefeiert. Aschenbrödel war ebenso gut wie schön, ließ die beiden Schwestern im Schlosse wohnen und verheiratete sie noch an demselben Tage mit zwei vornehmen Herren vom Hofe.
Moral:
Ganz ohne Zweifel es von großem Vorteil ist,
Wenn du nicht mutig nur, wenn du auch witzig bist,
Vornehmen Standes und auch klug dabei,
Und was an Gaben dir noch mehr beschieden sei.
Jedoch vergebens sie zu eigen dir gehören,
Dein Glück und Streben sie um keinen Deut vermehren,
Wenn du nicht eine Patin hast und gute Paten,
Die dich bei deinem Werk betreuen und beraten.
Riquet mit der Locke
Es war einmal eine Königin, die bekam einen Sohn, der war so häßlich und mißgestaltet, daß man lange im Zweifel war, ob er überhaupt ein Mensch sei. Eine Fee, die bei der Geburt des Kindes erschien, versicherte, es würde sehr klug werden. Sie fügte noch hinzu, er könne dank einer besonderen Gabe, die sie ihm verliehen habe, ebensoviel Verstand, wie er selbst besitze, auf den Menschen übertragen, den er am meisten liebe.
Das tröstete ein wenig die arme Königin, die sehr betrübt war, einem so häßlichen kleinen Kerl das Leben geschenkt zu haben.
Aber kaum fing das Kind an zu sprechen, da konnte es auch schon tausend Dinge bei ihrem Namen nennen, und bei all seinem Tun zeigte es einen so großen Verstand, daß jedermann von ihm entzückt war.
Ich vergaß zu erzählen, daß es mit einer kleinen Haarlocke auf dem Kopfe geboren wurde und man es deshalb Riquet mit der Locke nannte, denn Riquet war sein Familienname.
Sieben oder acht Jahre darauf gebar die Königin eines Nachbarlandes zwei Töchter. Die erste, die zur Welt kam, war schöner als der Tag, und die Königin freute sich dermaßen darüber, daß man schon fürchtete, die allzu große Freude könne ihr schaden.
Dieselbe Fee, die bei der Geburt des kleinen Riquet mit der Locke zugegen war, erschien auch hier und erklärte der Königin, um ihre Freude zu mäßigen, die kleine Prinzessin würde keinen großen Verstand haben, ihre Dummheit würde ebenso groß sein wie ihre Schönheit.
Das schmerzte die Königin sehr, und doch hatte sie bald darauf einen noch viel größeren Kummer; denn die zweite Tochter, deren sie genas, war über die Maßen häßlich.
»Seid darüber nicht weiter traurig!« sagte die Fee, »Eure Tochter wird entschädigt werden. Sie wird so klug sein, daß man es fast vergißt, was ihr an Schönheit fehlt.«
»Gott gebe es!« antwortete die Königin, »aber gibt es denn kein Mittel, der älteren zu ihrer Schönheit auch ein wenig Verstand zu verschaffen?«
»Leider kann ich hierin für Eure Tochter nichts tun, Frau Königin,« sagte die Fee. »Aber was die Schönheit angeht, das vermag ich alles; und da ich Euch herzlich gern einen Gefallen tue, so will ich Eurer Tochter die Gabe verleihen, dem Menschen, der ihr gefällt, Schönheit zu verleihen!«
Je älter die beiden Prinzessinnen wurden, um so deutlicher wurden ihre Vorzüge: überall sprach man von der Schönheit der älteren und von der Klugheit der zweiten.
Aber auch ihre Fehler wuchsen mit den Jahren: die jüngere wurde immer häßlicher und die ältere von Tag zu Tag dümmer. Sie gab nicht einmal mehr eine Antwort, wenn man sie fragte, oder sie sagte eine Dummheit. Dabei war sie noch so ungeschickt, daß sie nicht vier Teller auf den Ofensims stellen konnte, ohne einen zu zerbrechen, und kein Glas Wasser konnte sie trinken, ohne die Hälfte auf ihr Kleid zu schütten.
Wenn auch Schönheit ein großer Vorteil für ein junges Mädchen ist, so war doch die jüngere fast in jeder Gesellschaft beliebter als ihre ältere Schwester.
Zuerst kam man immer zur Schönen, um sie anzustaunen und zu bewundern; aber es dauerte nicht lange, da ging man zur Klügeren, um tausend anmutige Dinge von ihr zu hören, und es war erstaunlich, daß in weniger als einer Viertelstunde die ältere keinen Menschen mehr auf ihrer Seite hatte, und sich alle um die zweite scharten.
Trotz ihrer großen Dummheit entging ihr dies nicht, und sie hätte ohne Besinnen alle ihre Schönheit eingetauscht gegen die halbe Klugheit ihrer Schwester.
Wie verständig die Königin auch war, so konnte sie sich doch nicht enthalten, ihrer Tochter hie und da ihre Dummheit vorzuwerfen, so daß die arme Prinzessin vor Kummer fast gestorben wäre.
Eines Tages, als sie in einen Wald gegangen war, um ihr Unglück zu beklagen, sah sie einen sehr häßlichen und unausstehlichen jungen Mann auf sich zu kommen, der aber sehr vornehm gekleidet war.
Es war der junge Prinz Riquet mit der Locke. Als er die Bilder gesehen hatte, die von der Prinzessin in aller Welt verbreitet waren, da hatte er, in Liebe zu ihr entbrannt, das Reich seines Vaters verlassen, um sie zu sehen und zu sprechen.
Erfreut über diese einsame Begegnung, redete er sie mit aller Ehrfurcht und aller nur denkbaren Höflichkeit an. Nachdem er die üblichen Komplimente gemacht hatte, sah er, daß sie sehr traurig war, und er sagte deshalb zu ihr:
»Ich verstehe nicht, mein Fräulein, daß eine Dame, die so schön ist wie Sie, so trübsinnig sein kann, wie Sie zu sein scheinen; denn wenn ich mich auch rühmen darf, eine Unzahl hübscher Mädchen gesehen zu haben, so habe ich doch noch niemals eine Schönheit gefunden, die der Ihrigen gleichkäme!«
»Das sagen Sie so, mein Herr!« antwortete die Prinzessin und blieb traurig wie zuvor.
»Die Schönheit,« fuhr Prinz Riquet mit der Locke fort, »ist ein großer Vorzug, der wichtiger ist als alles andere, und ich weiß nicht, warum jemand der so schön ist wie Sie, noch traurig sein kann.«
»Lieber möchte ich so häßlich sein wie Sie,« entgegnete die Prinzessin, »und Ihren Verstand haben, als meine Schönheit behalten und so dumm sein, wie ich es bin!«
»Nichts beweist mehr, daß jemand Verstand hat, als sein Glaube, er habe keinen; es ist eine Eigentümlichkeit dieser Gabe, daß man, je mehr man davon besitzt, desto mehr glaubt, sie fehle einem.«
»Das verstehe ich nicht,« sagte die Prinzessin, »ich weiß nur, daß ich sehr dumm bin, und das ist der Grund meines Leides, das mich noch töten wird!«
»Wenn Sie weiter nichts bekümmert, mein Fräulein, so kann ich Ihrem Schmerze leicht ein Ende machen!«
»Und wie wollen Sie das tun?« forschte die Prinzessin.
»Ich habe die Macht, mein Fräulein,« sagte Riquet mit der Locke, »auf den Menschen, den ich am meisten lieben muß, so viel Verstand zu übertragen, wie man eben braucht. Sie sind dieser Mensch, mein Fräulein!
Es liegt also nur an Ihnen, und Sie verfügen über so viel Verstand, wie man nur haben kann, vorausgesetzt, daß Sie mich gerne heiraten wollen!«
Die Prinzessin war über diese Worte ganz bestürzt und gab keine Antwort darauf.
»Wie ich sehe,« fuhr Prinz Riquet mit der Locke fort, »ist Ihnen mein Vorschlag peinlich, und das wundert mich nicht; ich gebe Ihnen aber ein ganzes Jahr Zeit, um sich zu entscheiden!«
Die Prinzessin hatte so wenig Verstand und gleichzeitig so große Sehnsucht, Verstand zu besitzen, daß sie sich einbildete, das Jahr würde niemals zu Ende gehen: deshalb nahm sie den ihr gemachten Vorschlag an. Kaum hatte sie Riquet mit der Locke versprochen, ihn am gleichen Tage des nächsten Jahres zu heiraten, als sie sich anders fühlte, wie sie vorher war: sie bemerkte in sich eine unbekannte Fähigkeit, alles, was sie sagen wollte, auf eine feine, heitere und natürliche Art zum Ausdruck zu bringen; und sie begann mit Riquet eine artige und wohlgesetzte Unterhaltung, die so geistreich war, daß der Prinz glaubte, ihr mehr Verstand gegeben zu haben, als er sich selbst behalten habe.
Als die Prinzessin ins Schloß zurückkehrte, wußte der ganze Hof nicht, was er zu einer so plötzlichen und außerordentlichen Wandlung sagen sollte.
Noch kurz vorher hatte sie lauter albernes Zeug geredet, und jetzt hörte man von ihr tiefempfundene, unendlich geistvolle Dinge.
Der ganze Hof hatte eine so große Freude, wie man es sich nicht vorstellen kann. Aber die jüngere Schwester der Prinzessin freute sich weniger: Jetzt, wo sie vor der älteren nicht mehr den Vorzug der Klugheit voraushatte, erschien sie neben ihr wie ein recht unangenehmes Affengesicht.
Der König gab viel auf ihre Meinung und hielt sogar öfters den Staatsrat in ihrem Zimmer ab.
Als sich nun die Kunde von dieser Wandlung verbreitete, gaben sich alle jungen Prinzen der benachbarten Reiche Mühe, sich bei der Prinzessin beliebt zu machen, und fast alle begehrten sie zur Frau. Sie fand aber keinen, der ihr klug genug war, hörte sie alle an und entschied sich für keinen von ihnen.
Eines Tages aber kam ein so mächtiger, reicher, kluger und schöner Prinz, daß sie sich einer Neigung für ihn nicht enthalten konnte.
Als das ihr Vater merkte, sagte er zu ihr, er stelle ihr die Wahl eines Gatten frei, sie brauche sich nur zu erklären.
Da nun, je klüger man ist, es einen desto mehr Mühe kostet, in solcher Angelegenheit zu festem Entschluß zu gelangen, dankte sie ihrem Vater und bat ihn um Bedenkzeit.
Zufällig ging sie eines Tages in demselben Wald, in dem ihr Riquet mit der Locke begegnet war, spazieren, um ungestört darüber nachzudenken, was sie tun solle. Wie sie so in ihre Gedanken versunken dahinschritt, hörte sie unter ihren Füßen ein dumpfes Geräusch, als ob viele Leute geschäftig hin und her gingen.
Als sie aufmerksam lauschte, hörte sie, wie einer sagte: »Bring mir den Kessel!« und ein andrer: »Leg’ Holz aufs Feuer!«
In demselben Augenblick tat sich die Erde auf, und sie sah zu ihren Füßen eine Art große Küche, voll von Köchen, Küchenjungen und allen möglichen Küchenmeistern, wie man sie braucht, um ein prächtiges Festmahl herzurichten. Etwa zwanzig bis dreißig Köche kamen hervor und scharten sich in einer Allee des Waldes um einen langen Tisch, wo sie sich, die Spicknadel in der Hand und den Löffel hinter dem Ohr, nach dem Takte eines Liedes an die Arbeit machten.
Verwundert über diesen Anblick fragte die Prinzessin, für wen sie da tätig wären.
Der Oberste der Schar gab zur Antwort: »Für den Prinzen Riquet mit der Locke, der morgen Hochzeit macht!«

Die Prinzessin fiel aus allen Wolken, so überrascht war sie. Nun erinnerte sie sich plötzlich, daß es ja ein Jahr her war, da sie am gleichen Tage dem Prinzen Riquet mit der Locke die Hochzeit versprochen hatte. Sie hatte deshalb nicht mehr daran gedacht, weil sie noch ein dummer Mensch gewesen war, als sie das Versprechen gab. Im Besitze der von dem Prinzen auf sie übertragenen Vernunft hatte sie dann später alle ihre Torheiten vergessen.
Sie war noch keine dreißig Schritt weitergegangen, als Riquet mit der Locke vor ihr erschien, stolz, prächtig, kurz: wie ein Prinz, der Hochzeit machen will.
»Wie Sie sehen, mein Fräulein, habe ich pünktlich mein Wort gehalten, und zweifelsohne kamen auch Sie hierher, um dasselbe zu tun und mich durch Ihre Hand zum Glücklichsten aller Sterblichen zu machen!«
»Ich will Ihnen offen gestehen,« antwortete die Prinzessin, »daß ich noch keinen Entschluß gefaßt habe, und daß ich kaum glaube, Ihren Wünschen entsprechen zu können!«
»Sie setzen mich in Erstaunen, mein Fräulein!« sagte Riquet mit der Locke zu ihr.
»Ich glaube es,« sagte die Prinzessin, »und sicherlich wäre ich jetzt in der größten Verlegenheit, wenn ich es mit einem rohen, unvernünftigen Menschen zu tun hätte. Dieser würde sagen, daß auch eine Prinzessin nur ein Wort zu vergeben habe und da sie einmal ihr Versprechen gegeben, so müsse sie es auch halten. Aber da der Mann, mit dem ich spreche, der klügste Mensch in der ganzen Welt ist, so bin ich sicher, daß er Vernunft annehmen wird. Als ich nichts weiter war wie ein Dummkopf, hatte ich mich trotzdem, wie Sie wissen, nicht entschließen können, Sie zu heiraten. Wie können Sie von mir erwarten, daß ich heute, wo ich infolge des von Ihnen erhaltenen Verstandes so viel anspruchsvoller bin, einen Entschluß fassen soll, zu dem ich mich damals nicht aufraffen konnte? Wenn Sie also darauf ausgingen, mich zu heiraten, dann war es eine große Ungeschicklichkeit von Ihnen, mir meine Dummheit zu nehmen und mich klarer sehen zu lassen als früher!«
Riquet mit der Locke gab zur Antwort: »Wenn Sie es einem geistlosen Menschen, wie Sie eben sagten, nicht verübeln würden, Ihnen die Nichterfüllung Ihres Wortes vorzuwerfen, warum wollen Sie denn, mein Fräulein, daß ich nicht ebenso verfahre, wo es sich doch um mein ganzes Lebensglück handelt? Ist es vernünftig, daß Menschen mit Verstand schlechter daran sind als Menschen ohne Verstand? Wollen Sie das wirklich behaupten, Sie, die Sie jetzt so viel Verstand besitzen und sich so sehr danach gesehnt haben? Aber kommen wir zur Sache, wenn es Ihnen beliebt! Abgesehen von meiner Häßlichkeit — gibt es da noch irgend etwas an mir, was Ihnen mißfällt? Nehmen Sie vielleicht Anstoß an meiner Abstammung, an meinem Verstande, an meiner Gemütsart, an meinen Manieren?«
»Ganz und gar nicht!« antwortete die Prinzessin, »alles, was Sie eben anführten, schätze ich an Ihnen.«
»Wenn dem so ist,« fuhr Riquet mit der Locke fort, »so werde ich doch noch glücklich werden, denn Sie haben die Macht, mich zum liebenswertesten aller Menschen zu machen!«
»Auf welche Weise?« fragte die Prinzessin.
»Es ist einfach! Wenn Sie mich nur genug lieben, um zu wünschen, daß es so sein möchte! Kurz, mein Fräulein, damit Sie nicht länger im Zweifel sind, so hören Sie: Dieselbe Fee, die mir am Tage meiner Geburt die Gabe verlieh, den Menschen, der mir gefällt, klug zu machen, gab Ihnen die Gabe, den Mann schön zu machen, den Sie lieben, und an dem Sie diese Gunst betätigen wollen!«
»Wenn es sich so verhält,« sagte die Prinzessin, »so wünsche ich von ganzem Herzen, daß Sie der schönste und liebenswürdigste Prinz der Welt werden sollen, und ich verleihe Ihnen von diesen Eigenschaften ebenso viel, wie ich selbst besitze!«
Kaum hatte die Prinzessin diese Worte gesprochen, als Riquet mit der Locke sich in ihren Augen in den schönsten Mann der Welt verwandelte, den bestgestalteten und liebenswürdigsten, den sie je gesehen hatte.
Einige Leute behaupten, es wären nicht die Zauberkünste der Fee gewesen, die da am Werke waren: die Liebe allein habe diese Wandlung vollbracht. Sie sagen, als sich die Prinzessin der Beharrlichkeit ihres Bewerbers, seiner Verschwiegenheit und aller seiner guten Herzens- und Verstandesgaben bewußt geworden wäre, habe sie keinen Blick mehr für seinen mißgestalteten Körper und sein häßliches Gesicht gehabt. Sein Buckel wäre ihr nur wie krumme Haltung vorgekommen, und in dem schrecklichen Hinken, das sie früher an ihm wahrgenommen hatte, habe sie jetzt nur eine gewisse reizvolle Nachlässigkeit erblickt. Es heißt weiter, daß ihr sogar seine schielenden Augen als außerordentlich strahlend vorgekommen wären, und ihre Unregelmäßigkeit nahm in ihrer Vorstellung den Charakter gewaltiger Liebesleidenschaft an; endlich hatte auch seine dicke, rote Nase für sie etwas Kriegerisches und Heldenhaftes.
Wie dem auch sei, die Prinzessin versprach ihm, auf der Stelle ihn zu heiraten, vorausgesetzt, daß er dazu die Einwilligung ihres königlichen Vaters erhalte.
Als der König erfuhr, wie sehr seine Tochter den Prinzen Riquet mit der Locke schätzte, den er übrigens als einen sehr vernünftigen und weisen Menschen kannte, nahm er ihn mit Vergnügen als seinen Eidam an.
Schon am nächsten Tag wurde die Hochzeit gefeiert, wie Riquet mit der Locke es vorausgesehen hatte, und zwar nach den Anordnungen, die er schon lange vorher dafür getroffen hatte.
Moral:
Nicht Dichtung ist’s, was Ihr gehört:
Das Leben selbst Euch hier belehrt,
Daß schön und klug ist jedermann,
Den eins von Herzen lieben kann.
Jungfer Eselshaut
Es war einmal ein König, der war so mächtig, von seinem Volke so geliebt, von allen seinen Nachbarn und Freunden so geehrt, daß man ihn den glücklichsten aller Herrscher nennen konnte. Noch größer wurde sein Glück, als er sich eine Prinzessin zur Braut erwählte, die ebenso schön wie tugendhaft war. In ihrer treuen Ehe wurde ihnen ein Töchterchen geschenkt, welches so schön und so anmutig war, daß sie niemals bedauerten, nur dieses eine Kind zu haben.
Pracht, Reichtum und Geschmack herrschten in ihrem Palaste. Die Minister waren weise und geschickt, die Höflinge tugendhaft und anhänglich, die Diener treu und fleißig. Die schönsten Pferde standen reich gezäumt in den geräumigen Ställen. Aber was die Fremden, die die schönen Ställe besuchten, am meisten in Erstaunen setzte, das war ein alter Esel, der an einem besonderen Ehrenplatze im Stalle seine langen, großen Ohren ausstreckte. Der König hatte ihm diesen bevorzugten Platz nicht etwa aus irgendeiner Laune angewiesen, — er hatte vielmehr einen guten Grund dazu. Denn dieses seltene Tier verdiente eine solche Bevorzugung; es hatte nämlich die sonderbare Eigenschaft, daß seine Streu jeden Morgen nicht etwa beschmutzt, sondern in verschwenderischer Fülle mit schönen Goldtalern und Dukaten aller Art bedeckt war, die man nur aufzusammeln brauchte.
Da die Sonne des Lebens ihre Schatten nicht nur auf die Untertanen, sondern auch auf die Könige wirft, und da Gutes und Schlechtes stets beieinander wohnen, so wollte es der Himmel, daß die Königin plötzlich von einer schweren Krankheit befallen wurde, gegen die man trotz aller ärztlichen Wissenschaft und Geschicklichkeit kein Heilmittel fand. Alle waren untröstlich.
Der König, der trotz jenes berühmten Sprichwortes, welches die Ehe das Grab der Liebe nennt, immer noch seine Gattin in Zärtlichkeit verehrte, wußte nicht, was er in seinem Kummer tun sollte. Allen Kirchen seines Reiches machte er heilige Gelübde; er wollte dem Himmel sein eigenes Leben opfern, um das seiner geliebten Gemahlin zu retten. Aber er rief vergeblich Gott und die Feen an.
Als die Königin ihr letztes Stündchen nahen fühlte, sagte sie zu ihrem weinenden Gemahl:
»Verzeiht, wenn ich vor meinem Tode eines von Euch fordere: Solltet ihr jemals das Verlangen haben, Euch wieder zu verheiraten ...« Bei diesen Worten schluchzte der König gar jammervoll, faßte die Hand seiner Frau, versicherte mit Tränen in den Augen, daß es überflüssig sei, ihm von einer zweiten Ehe zu sprechen.
»Nein, nein, teuerste Königin, sagte er endlich, sprecht lieber davon, wie ich Euch folgen soll!«
Darauf entgegnete die Königin mit einer Entschlossenheit, die den Schmerz ihres Mannes nur noch vermehrte:
»Der Staat, der auf eine richtige Thronfolge bedacht sein muß, hat ein Recht, von Euch Söhne zu verlangen, die Euch gleichen. Trotzdem ich Euch nur eine Tochter geschenkt habe, bitte ich Euch inständig bei aller Liebe, die Ihr für mich hegt: gebt dem Verlangen Eures Volkes erst dann nach, wenn Ihr eine Prinzessin gefunden habt, die schöner ist, als ich gewesen bin. Schwört mir dies, dann will ich ruhig sterben.«
Man könnte meinen, die Königin, die nicht ganz ohne Eifersucht war, habe diesen Schwur gefordert, um sicher zu sein, daß der König keine zweite Ehe schließen würde. Glaubte sie doch bestimmt, daß es auf der ganzen Welt keine Frau gäbe, die ihr gleich käme.
So starb sie denn. Niemals hatte ein Gatte größere Trauer gezeigt: Weinen und Schluchzen bei Tag und bei Nacht, diese armseligen Rechte der Verlassenheit waren seine einzige Beschäftigung. Aber auch der größte Schmerz dauert nicht ewig.
Es versammelten sich die Großen des Staates und kamen mit der gemeinsamen Bitte zum König, er solle sich wieder verheiraten. Ihr Vorschlag schien ihm grausam und ließ ihn neue Tränen vergießen. Er berief sich auf den Eid, den er der Königin geschworen und gab allen seinen Räten den Auftrag, erst einmal eine Prinzessin zu suchen, die schöner sei, als seine Frau es gewesen. Er war aber überzeugt, daß sie diese niemals finden würden.

Dem hohen Rate kam das Gelübde des Königs lächerlich vor, und er erklärte, Schönheit sei eine Nebensache; das Staatsinteresse verlange eine tugendhafte Königin, die Mutter werde; der Staat brauche für seine Ruhe und seinen Frieden Prinzen. Die Prinzessin habe zwar alle Eigenschaften, die eine große Königin zieren, aber man müsse ihr einen Fremden zum Gemahl erwählen. Dieser Fremde würde sie entweder in seine Heimat führen, oder wenn er neben ihr im Lande herrsche, so würden seine Kinder immer fremdblütig bleiben. Das wäre eine Gefahr, da die Nachbarvölker eines Königreiches, das keinen Thronfolger habe, Krieg beginnen und den Untergang des Landes herbeiführen könnten.
Betroffen von solchen Erwägungen versprach der König, ihrem Rate zu folgen und begann, unter den heiratsfähigen Prinzessinnen Umschau zu halten, ob eine unter ihnen wäre, die ihm gefallen könnte. Jeden Tag brachte man ihm die reizendsten Bilder. Aber keines zeigte die Anmut der verstorbenen Königin, und so konnte er sich für keine entscheiden.
Obwohl er sonst von gutem Verstande war, kam er unglücklicher Weise auf den tollen Einfall, seine Tochter, die Prinzessin, zur Frau zu nehmen. Da sie ihre königliche Mutter, an Geist und Anmut bei weitem übertraf, so glaubte er, sie allein könne ihn von seinem Eide erlösen.
In ihrer Tugendhaftigkeit und Scham wäre die Prinzessin bei diesem entsetzlichen Vorschlag fast in Ohnmacht gefallen. Sie warf sich ihrem königlichen Vater zu Füßen und beschwor ihn mit der ganzen Leidenschaft ihrer Seele, sie nicht zu einem solchen Verbrechen zu zwingen.
Der König aber hatte sich nun einmal diesen Wahnsinn in den Kopf gesetzt und fragte, um das Gewissen der Prinzessin zu beruhigen, eine alte Zauberin um ihren Rat. Dieses alte Weib, das ebenso gottlos wie ehrgeizig war, opferte das Glück der unschuldigen und tugendhaften Prinzessin der Ehre, die Vertraute eines mächtigen Herrschers zu sein. Sie schmeichelte sich so sehr in das Herz des Königs ein, schilderte ihm das Verbrechen, das er begehen wollte, in so schönen Farben, daß er der festen Überzeugung war, es sei ein Gott wohlgefälliges Werk, die Tochter zu heiraten.

Ganz im Banne dieser Worte umarmte der König die Zauberin und bestand nach seiner Rückkehr mehr als zuvor auf seinem Plan; er gab daher der Prinzessin den Befehl, sie solle sich bereit halten, ihm zu gehorchen.
In ihrem schmerzlichen Unglück dachte die Prinzessin nach, wie sie die Lila-Fee, ihre Patin, finden könne. In einem kleinen Wagen, der mit einem Hammel bespannt war, welcher Weg und Steg kannte, fuhr sie noch in derselben Nacht davon. So kam sie glücklich an ihr Ziel.
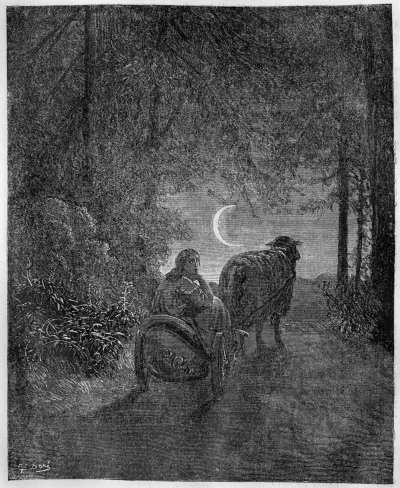
Die Fee, welche die Prinzessin liebte, sagte, sie wisse schon alles, was sie bekümmere, doch brauche sie sich keine Sorge zu machen. Nichts würde ihr schaden, wenn sie sich nur treu an die Vorschriften halte, die sie ihr geben würde.
»Es wäre freilich ein großes Vergehen, wenn Du Deinen Vater heiraten wolltest, mein liebes Kind!« sagte die Fee, »aber ohne ihm zu widersprechen, kannst Du seinen Absichten doch aus dem Wege gehen. Sage ihm, er solle Dir einen Wunsch erfüllen: er solle Dir ein Kleid schenken von der Farbe des Wetters. Wie groß auch seine Macht ist, das wird er nicht können.«
Die Prinzessin dankte ihrer Patin von Herzen und schon am anderen Morgen sagte sie zum Könige, ihrem Vater, das, was ihr die Fee geraten hatte, und erklärte feierlich, sie würde ihre Einwilligung erst dann geben, wenn sie das Kleid von der Farbe des Wetters bekäme.
Erfreut über die Hoffnung, die sie in ihm erweckte, berief der König die berühmtesten Schneider und befahl ihnen, das gewünschte Kleid zu machen, und drohte ihnen, daß er sie alle hängen lassen würde, wenn sie es nicht fertig bekämen. Doch dieses Äußerste blieb ihm erspart: schon am zweiten Tage brachten sie das so heiß begehrte Gewand herbei. Der Himmel selbst hatte kein schöneres Blau, wenn er umkränzt ist mit goldenen Wölklein, als dieses wunderschöne Gewand, wie es da ausgebreitet lag.
Die Prinzessin war ganz untröstlich und wußte sich keinen Rat. Der König drängte zur Heirat. So blieb ihr nichts übrig, als ein zweites Mal die Patin aufzusuchen. Erstaunt, daß ihre List nicht geglückt war, riet ihr die Fee, sie solle es noch einmal versuchen, aber dieses Mal ein Kleid von der Farbe des Mondes verlangen. Da der König ihr nichts abschlagen konnte, rief er wieder die besten Schneider herbei und gab ihnen ein Kleid von der Farbe des Mondes in Auftrag. So rasch sollten sie es machen, daß zwischen Auftrag und Lieferung nur vierundzwanzig Stunden lagen. In großer Angst saß die Prinzessin bei ihren Frauen und bei ihrer Amme und war mehr entzückt über das neue herrliche Gewand, als über die Absicht ihres königlichen Vaters.
Die Lila-Fee, die das alles wußte, kam der bedrängten Prinzessin zu Hilfe und sprach zu ihr:
»Ich müßte mich sehr täuschen, wenn wir es nicht doch noch fertig brächten, Deinem königlichen Vater die Lust zur Heirat zu nehmen. Verlange jetzt ein Kleid von der Farbe der Sonne! Ein solches zu beschaffen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auf jeden Fall gewinnen wir aber Zeit.«
Die Prinzessin war damit einverstanden und verlangte das Kleid von der Farbe der Sonne. Da gab der verliebte König ohne Bedenken alle Diamanten und Rubinen seiner Krone her, um ihr zu diesem herrlichen Gewande zu verhelfen und er befahl, mit nichts zu sparen, um das Kleid der Sonne gleich zu machen.
Als es dann geliefert wurde, mußten alle, die es sahen, die Augen schließen, so wurde man geblendet. Aus jener Zeit stammen die grünen Brillen und die schwarzen Augengläser.
Aber wie erschrak die Prinzessin bei diesem Anblick! Noch nie hatte man ein so schönes und so herrlich gearbeitetes Kleid gesehen. Sie war ganz verwirrt und zog sich unter dem Vorwand, Augenschmerzen zu haben, auf ihr Zimmer zurück, wo sie die Fee erwartete. Das war eine schlimme Sache. Wie diese das sonnenfarbene Kleid sah, war sie so beschämt, wie man es nicht sagen kann; sie wurde rot vor Zorn und sagte zur Prinzessin:
»Nunmehr müssen wir die schmachvolle Liebe Deines Vaters auf eine schwere Probe stellen. Wenn er auch noch so sehr nach dieser Heirat strebt, so glaube ich doch, daß er einen kleinen Schrecken über die Bitte bekommen wird, zu der ich Dir jetzt rate. Ich meine die Haut des Esels, den er so sehr liebt und der ihm die Mittel zu seinen verschwenderischen Ausgaben verschafft. Gehe hin und bitte ihn um die Haut des Esels.«
Froh über dieses Mittel der verabscheuten Heirat zu entgehen und überzeugt, daß ihr Vater sich niemals dazu entschließen würde, des Esels Haut zu opfern, ging die Prinzessin zum Könige und verlangte von ihm die Haut des schönen Tieres. Der König war bestürzt über diesen Einfall seiner Tochter, aber er zögerte nicht, ihm zu genügen. Der arme Esel wurde geschlachtet und die Haut feierlich der Prinzessin überbracht. Nun sah sie kein Mittel mehr, ihrem Unglück zu entgehen und war in Verzweiflung.
Ihre Patin eilte herbei und als sie sah, wie sich die Prinzessin ihr Haar raufte und ihre zarten Wangen zerfleischte, sprach sie:
»Was tust Du da, mein Kind! Es ist doch der glücklichste Augenblick Deines Lebens! Hülle Dich in diese Haut, verlasse den Palast und gehe so weit, wie Dich die Erde trägt, denn wer alles seiner Tugend opfert, den werden die Götter belohnen. Mache Dich auf, ich werde Sorge tragen, daß Dir Deine Kleider überall folgen, wohin Du auch gehst. Der Kasten mit Deinem Schmuck und Deinen Gewändern wird auf unterirdischem Wege Dich begleiten. Hier gebe ich Dir meinen Zauberstab, klopfe damit auf die Erde, wenn Du Deinen Kasten brauchst, und er wird Dir sofort erscheinen. Doch Du mußt eilen und darfst jetzt nicht mehr zögern!«
Die Prinzessin bat ihre Patin unter tausend Küssen, sie niemals zu verlassen; dann befleckte sie die Eselshaut mit Straßenschmutz, hüllte sich hinein und verließ unerkannt den Palast.

Das Verschwinden der Prinzessin brachte alle in die größte Aufregung. Der König, der gerade ein prächtiges Fest vorbereitete, war untröstlich in seiner Verzweiflung. Er schickte mehr als hundert Gendarmen und ganze Regimenter Soldaten aus, um seine Tochter zu suchen. Aber die Fee nahm sie in ihren Schutz, machte sie unsichtbar und entzog sie den geschicktesten Verfolgern. So mußte der König sich mit ihrem Verluste abfinden.
Die Prinzessin aber wanderte ihres Weges. Sie ging weit, weit und immer weiter und suchte überall nach einer Stellung. Aus Mitleid gab man ihr zu essen; aber jedermann fand sie zu häßlich, um sie in seinen Dienst zu nehmen.
Endlich kam sie an eine schöne Stadt, vor deren Toren eine Meierei lag. Die Pächterin dieser Meierei brauchte eine Magd, um die Wäsche zu waschen und um den Hühnerhof und den Schweinestall zu fegen. Wie nun die Frau die schmutzige Wanderin sah, schlug sie ihr vor, in ihren Dienst zu treten. Mit großer Freude war die Prinzessin damit einverstanden, denn sie war müde von dem langen Wege.
Als Wohnung wies man ihr einen Verschlag an, der weit von der Küche entfernt lag. Die andern Bedienten trieben in den ersten Tagen grobe Späße mit ihr, weil sie in ihrer Eselshaut so schmutzig und abstoßend war. Aber bald gewöhnte man sich an sie; und da sie ihre Pflichten sehr gewissenhaft erfüllte, nahm sich die Pächterin ihrer an.
Die Prinzessin ließ die Schafe aus dem Stall und führte sie auf die Weide. Auch die Truthühner hütete sie mit so viel Verständnis, daß es schien, als habe sie niemals etwas anderes getan. Alles gedieh unter ihren zarten Händen.
Eines Tages saß sie wieder an der klaren Quelle, wo sie oft über ihr trauriges Los weinte. Da kam sie auf den Gedanken, sich im Spiegel des Wassers zu betrachten, und sie erschrak über die gräßliche Eselshaut, die ihren Kopf und Körper umhüllte. Beschämt über ihr Aussehen, wusch sie sich Gesicht und Hände, bis sie weiß waren wie Elfenbein und bis ihre zarte Haut wieder so frisch war wie früher. Erfreut über ihre Schönheit bekam sie Lust zu einem Bade. Aber dann mußte sie wieder in ihre unwürdige Haut schlüpfen, um nach der Meierei zurückzukehren.

Glücklicherweise war der nächste Tag ein Sonntag, und für sie ein Tag der Muße. Sie ließ ihren Kasten erscheinen, brachte ihre Kleider in Ordnung, puderte ihr schönes Haar und zog das wunderbare wetterfarbene Kleid an. Aber ihre Kammer war so klein, daß die Schleppe des herrlichen Gewandes keinen Platz darin hatte. Die schöne Prinzessin betrachtete sich im Spiegel und war über ihre Schönheit so erfreut, daß sie sich vornahm, an Sonn- und Festtagen der Reihe nach alle ihre schönen Gewänder anzuziehen.
Diesen Plan führte sie auch aus. Mit seltenem Geschmack steckte sie sich Blumen und Diamanten in ihr schönes Haar, und oft seufzte sie, daß niemand sie in solcher Schönheit sah außer ihren Schafen und Truthühnern, die sie aber nicht weniger liebten in ihrer häßlichen Eselshaut, wonach sie die Leute auf der Meierei »Jungfer Eselshaut« getauft hatten.
An einem Sonntage hatte die Prinzessin das sonnenfarbene Gewand angezogen, als gerade der Sohn des Königs, dem die Meierei gehörte, dort abgestiegen war, um sich auf der Heimkehr von der Jagd ein wenig auszuruhen.
Es war ein junger und schöner Prinz, geliebt von seinem Vater und seiner königlichen Mutter und verehrt von seinem ganzen Volke. Es wurde ihm ein ländliches Mahl bereitet, welches er mit Dank annahm. Danach bekam er Lust, sich die Geflügelhöfe anzusehen, und er durchstreifte sie bis in die äußersten Winkel.
Wie er sich so überall umsah, kam er in eine schattige Allee, an deren Ende er eine verschlossene Tür fand. Neugierig sah er durchs Schlüsselloch. Aber wie erschrak er, als er hier die wunderschön und reich gekleidete Prinzessin sah. In seiner edlen und bescheidenen Art hielt er sie für eine göttliche Erscheinung. Ohne die Ehrfurcht, die ihm das bezaubernde Bild einflößte, hätte der Sturm der Gefühle, der ihn da durchtobte, ihn sicherlich verführt, die Tür zu öffnen.
Es wurde ihm schwer, die dunkle, schattige Allee zu verlassen. Er tat es nur, um sich zu erkundigen, wer in der kleinen Kammer dort hause. Man gab ihm zur Antwort, es sei eine Magd, man nenne sie nur »Jungfer Eselshaut«, nach dem Kleide, das sie trage. Sie sei so schmutzig, daß niemand sie ansähe und niemand mit ihr sprechen wolle. Aus Mitleid habe man sie aufgenommen, damit sie die Schafe und die Truthühner hüte.
Diese Antwort sagte dem Prinzen so gut wie gar nichts. Er sah ein, daß die guten Leute von dem Geheimnis nichts wußten und er hielt es für zwecklos, sie weiter auszufragen.
So kehrte er über alle Maßen verliebt, in den Palast seines Vaters zurück und behielt immer das herrliche Bild der göttlichen Erscheinung vor Augen, das er durch das Schlüsselloch gesehen hatte. Nun reute es ihn doch, daß er nicht angeklopft hatte, und er nahm sich vor, es beim nächsten Male nicht zu versäumen.
Aber der Sturm in seinem Blute, den die Liebe heraufbeschworen hatte, warf ihn noch in derselben Nacht in ein so heftiges Fieber, daß er fast gestorben wäre. Seine Mutter, die Königin, deren einziges Kind er war, geriet in Verzweiflung darüber, daß alle Heilmittel versagten. Umsonst versprach sie den Ärzten fürstlichen Lohn. Sie wandten alle Mittel an, aber keines half dem Prinzen.
Schließlich ahnten sie, daß ein schwerer Kummer die Ursache dieser Krankheit war. Sie sagten es der Königin, und diese beschwor ihren Sohn in ihrer zärtlichen Liebe, ihr doch die Ursache seines Leides zu nennen. Wenn es sich etwa darum handle, ihm jetzt schon die Krone zu geben, so würde sein Vater, der König, ohne Schwanken des Thrones entsagen und ihn zum Könige machen. Sollte er aber irgendeine Prinzessin zur Frau begehren, so würde man, um seinen Wunsch zu erfüllen, alle Rücksichten opfern, selbst wenn man mit ihrem Vater im Kriege lebte oder auch andere Gründe hätte, eine solche Verbindung zu bedauern. Nur beschwöre sie ihn, am Leben zu bleiben, denn an seinem Leben hänge auch ihr Leben.
Als die Königin diese zu Herzen gehenden Worte gesprochen hatte, wobei sie das Antlitz des Prinzen mit Strömen von Tränen benetzte, sagte er zu ihr mit erschöpfter Stimme:
»Liebe Mutter, ich bin nicht der Unmensch, daß ich vom Vater die Krone fordere; gäbe Gott, daß er noch viele Jahre lebe, und daß ich immer sein treuester und ehrfurchtsvollster Untertan bliebe. Auch an eine Prinzessin denke ich nicht und auch nicht an eine Heirat. Ihr dürft überzeugt sein, daß ich hierin wie bisher mich immer Eurem Wunsche füge, was es mich auch kosten mag.«
»Ach liebster Sohn,« erwiderte die Königin, »um Dein Leben zu retten, gäben wir gern alles hin, nur rette Du jetzt mein Leben und das Deines königlichen Vaters und offenbare mir, was Du begehrst. Du darfst versichert sein: es wird Dir gewährt.«
»Nun liebe Mutter,« sagte der Prinz, »da ich Euch meine geheimsten Wünsche offenbaren soll, so will ich Euch gehorchen, um nicht zwei mir so teure Menschen in Gefahr zu bringen: Ich wünsche mir, daß Jungfer Eselshaut mir einen Kuchen backen soll, und daß man ihn so schnell wie möglich herbringt.«
Höchst erstaunt über diesen seltsamen Namen, forschte die Königin, wer Jungfer Eselshaut sei. Einer ihrer Offiziere, der sie zufällig gesehen hatte, antwortete: »Es ist das häßlichste Geschöpf nach dem Wolf, ein schmutziges Mädchen in einem schwarzen Stalle. Es haust in Eurer Meierei und hütet dort die Truthühner.«
»Und wenn es auch so ist,« sagte die Königin, »mein Sohn hat vielleicht einmal auf der Heimkehr von der Jagd von ihrem Kuchen gegessen. Es ist der Wunsch eines Fiebernden, kurz, ich will, daß Jungfer Eselshaut ihm schnell einen Kuchen backe.«
Man lief zur Meierei, holte Jungfer Eselshaut und trug ihr auf, für den Prinzen den allerschönsten Kuchen zu backen.
Einige Erzähler behaupten, Jungfer Eselshaut habe in dem Augenblick, als der Prinz durch das Schlüsselloch sah, diesen bemerkt, und als sie dann durch das Fensterlein ihrer Kammer den jungen, schönen Prinzen gesehen habe, sei sein Bild in ihrem Herzen geblieben, und die Erinnerung an ihn habe ihr manchen Seufzer gekostet.
Wie dem auch sei, ob Jungfer Eselshaut ihn wirklich gesehen, oder ob sie viel Rühmliches von ihm gehört, jedenfalls war sie hocherfreut, der Verborgenheit ihres Daseins zu entfliehen, schloß sich in ihr Kämmerlein ein, warf die Eselshaut ab, wusch sich Gesicht und Hände, kämmte ihr blondes Haar, legte ein hübsches, silbernglänzendes Leibchen an, dazu einen passenden Rock und machte sich daran, den Kuchen zu bereiten. Sie nahm das feinste Mehl, viel Eier und frische Butter. Hierbei ließ sie einen Ring, den sie am Finger trug, sei es Absicht, sei es Zufall, in den Teig fallen und mischte ihn darunter. Als der Kuchen gebacken war, hüllte sie sich wieder in ihre häßliche Haut und brachte das Gebäck dem Offizier, bei dem sie sich nach des Prinzen Befinden erkundigte. Doch dieser hielt es unter seiner Würde, ihr eine Antwort zu geben, und lief davon, um dem Prinzen den Kuchen zu bringen.
Hocherfreut griff der Prinz mit beiden Händen nach dem Kuchen und verzehrte ihn mit solcher Hast, daß die anwesenden Ärzte nicht verfehlten, diese Leidenschaft für ein bedenkliches Zeichen zu erklären. In der Tat wäre der Prinz beinahe an dem Ring erstickt, aber er hielt ihn noch rechtzeitig im Munde zurück. Sein Appetit verging ihm, als er das kostbare Kleinod betrachtete. So zierlich war dieser Ring, daß alle überzeugt waren, er könne nur dem schönsten Finger der Welt passen.
Wohl tausendmal küßte der Prinz den Ring und verbarg ihn unter seinem Hemd, um ihn jedesmal hervorzuziehen, wenn er sich unbeobachtet glaubte. Er quälte sich in dem Gedanken, wie er zu der gelangen könne, die diesen Ring getragen. Doch er wagte nicht zu hoffen, daß man ihm gestatten würde, Jungfer Eselshaut kommen zu lassen, die ihm den Kuchen gebacken hatte. Er wagte auch nicht davon zu sprechen, was er durch das Schlüsselloch gesehen hatte, aus Furcht, man würde ihn auslachen und ihn für einen Gespensterseher halten. Da alle diese Sorgen gleichzeitig auf ihn einstürmten, nahm sein Fieber stark zu, und in ihrer Ratlosigkeit erklärten die Ärzte der Königin, der Prinz sei krank aus Liebe.
In Begleitung des Königs, der schier verzweifelte, stürzte die Königin zu ihrem Sohn.
»Mein Sohn, mein lieber Sohn,« rief der bekümmerte Herrscher aus, »nenne uns das Mädchen, das Du begehrst und wäre es die niedrigste Magd, wir schwören Dir, sie soll Deine Frau werden.«
Unter vielen Küssen bekräftigte die Königin den Schwur ihres Gatten.
»Lieber Vater und liebe Mutter,« sagte da der Prinz, »ich denke gar nicht daran, eine Ehe zu schließen, die Euch mißfallen könnte. Um Euch das zu beweisen, werde ich das Mädchen heiraten, dem dieser Ring gehört, wer sie auch sein mag. Aber wer einen so schönen Finger hat, daß ihm dieser Ring paßt, der dürfte allem Anschein nach kaum von geringer oder bäuerischer Herkunft sein.«
Bei diesen Worten zog er das Kleinod unter seinem Hemd hervor. Der König und die Königin nahmen den Ring, prüften ihn neugierig und stimmten dem Urteil ihres Sohnes zu, daß er nur einem jungen Mädchen von edler Herkunft gehören könne. Der König umarmte seinen Sohn und beschwor ihn, gesund zu werden und dann ging er hinaus, um die Trommler, Pfeifer und Trompeter durch die ganze Stadt zu schicken und durch seine Herolde bekanntzumachen, daß alle Mädchen in den Palast kommen sollten, um einen Ring zu probieren, und das Mädchen, dem er zu eigen gehöre, die Frau des Prinzen werde.
Zuerst kamen die Prinzessinnen, dann die Herzoginnen, die Marquisen und Baroninnen. Aber sie zeigten umsonst ihre Finger vor: keiner von ihnen paßte der Ring. Schließlich ließ man die Bürgermädchen kommen, aber auch diese hatten alle, so hübsch sie auch waren, viel zu dicke Finger. Da es dem Prinzen besser ging, stellte er die Versuche selbst an. Endlich kamen auch die Kammermädchen an die Reihe, aber auch sie schnitten nicht besser ab. Nun gab es kein Mädchen mehr, an dem der Ring nicht probiert worden wäre. Dann ließ der Prinz die Köchinnen und Hirtinnen kommen: all das Pack führte man herbei, aber ihre dicken, roten und kurzen Finger gingen erst recht nicht durch den Ring.
»Hat man schon Jungfer Eselshaut kommen lassen, die mir neulich den Kuchen backte?« fragte der Prinz.
Da fingen sie alle an zu lachen, und man erklärte ihm: »Die ist doch viel zu häßlich und zu schmutzig.«
»Man hole sie sofort,« sagte der König, »es soll nicht heißen, ich hätte irgend jemanden ausgeschlossen.«
Mit Spott und Hohn liefen sie fort, die Magd zu holen.
Als Jungfer Eselshaut die Trommler gehört hatte und den Ruf der Herolde, war sie sehr im Zweifel, ob ihr Ring wirklich all den Lärm verursache. Sie liebte den Prinzen, und da die wahre Liebe immer furchtsam ist und nicht stolz, so fürchtete sie, daß es doch eine Dame geben könne, die denselben kleinen Finger habe, wie sie. Jetzt aber hatte sie große Freude, als man an ihre Tür klopfte und sie rief.
Seitdem sie wußte, daß man nach dem kleinen Finger suche, zu dem der Ring passe, hatte sie eine unbestimmte Hoffnung auf den Gedanken gebracht, ihre Haare noch schöner zu kämmen als sonst, ihr schönes, silbernes Leibchen anzulegen und dazu den Rock, der mit vielen Falten, silbernen Spitzen und Edelsteinen besetzt war.
Wie sie nun an ihre Tür klopfen und nach ihr rufen hörte, sie solle zum Prinzen kommen, da warf sie rasch ihre Eselshaut über und öffnete.
Spöttisch erklärten ihr die Leute, der König schicke nach ihr, damit sie seinen Sohn heirate. Dann führten sie Jungfer Eselshaut unter Hohngelächter zum Prinzen.
Als dieser das Mädchen in ihrem sonderbaren Aufputz sah, war er nicht wenig betroffen und hielt es für unmöglich, daß es dieselbe sei, die er so stolz und schön gesehen hatte. Traurig und verwirrt, daß er sich so schwer getäuscht, fragte er sie:
»Wohnst Du dort unten in der dunklen Allee, im dritten Geflügelhof der Meierei?«
»Ja, Herr«, antwortete sie.
Zitternd und mit einem tiefen Seufzer sagte er. »Zeige mir Deine Hand!«
Wer war da am meisten überrascht? Das waren der König und die Königin, ebenso der Kammerherr und die anderen Höflinge. Aus der schwarzen, beschmutzten Haut hervor kam eine feine, weiße, rosenfarbene Hand, und mühelos ließ sich der Ring an den kleinsten und schönsten Finger der Welt streifen. Dann schüttelte sich die Prinzessin und die Eselshaut fiel von ihr ab. Nun stand sie da, so bezaubernd in ihrer Schönheit, daß der Prinz, schwach wie er war, vor ihr niederfiel und sie mit einer Leidenschaft in seine Arme schloß, die sie erröten machte. Aber man achtete kaum darauf, denn auch der König und die Königin umarmten sie in einem fort und fragten sie, ob sie ihren Sohn zum Gemahl nehmen wolle. Die Prinzessin war ganz verwirrt von so viel Zärtlichkeit und Liebe, die ihr der schöne, junge Prinz bezeigte und wollte sich eben dafür bedanken, als sich die Decke des Saales auftat und die Lila-Fee in einem Wagen aus Zweigen und Blumen ihres Namens herabschwebte, und mit unendlicher Anmut das Schicksal der Prinzessin erzählte. In ihrer Freude darüber, daß Jungfer Eselshaut eine so vornehme Prinzessin war, verdoppelten der König und die Königin ihre Zärtlichkeit. Aber noch größer war die Freude des Prinzen über die Tugendhaftigkeit der Prinzessin und seine Liebe zu ihr wuchs noch mehr durch die Erzählung der Fee.
Die Ungeduld des Prinzen, seine Braut heimzuführen, war so groß, daß er sich kaum Zeit ließ, um die Feier würdig vorzubereiten. Ganz verliebt in ihre schöne Schwiegertochter, erwiesen ihr der König und die Königin Zärtlichkeiten über Zärtlichkeiten und ließen sie nicht aus ihrem Arm. Da die Prinzessin erklärt hatte, sie könne des Prinzen Frau nicht werden, ohne das Einverständnis des königlichen Vaters, wurde zunächst an diesen eine Einladung geschickt, ohne ihm dabei zu verraten, wer die Braut sei. Dies geschah auf Wunsch der Lila-Fee, die alles zum Guten lenkte.

Aus allen Ländern kamen die Könige herbei, die einen in Sänften, die anderen in Wagen, die weiter wohnenden kamen auf Elefanten daher geritten, auf Tigern und Adlern, aber der allerprächtigste und allermächtigste war der Vater der Prinzessin, der gottlob seine frevelhafte Liebe zu seiner Tochter überwunden und die sehr schöne Witwe eines kinderlosen Königs geheiratet hatte. Die Prinzessin eilte auf ihn zu. Da erkannte er sie und schloß sie mit großer Zärtlichkeit in die Arme, noch ehe sie Zeit hatte, sich ihm zu Füßen zu werfen. Der König und die Königin stellten ihm ihren Sohn vor, den er mit Beweisen seiner Freundschaft überhäufte. Nun wurde die Hochzeit mit aller nur denkbaren Pracht gefeiert. Die jungen Gatten aber hatten kein Auge für diese Herrlichkeiten, der eine sah nichts als nur den anderen.
Noch an demselben Tage ließ der Vater seinen Sohn zum König krönen und setzte ihn mit feierlichem Handkuß auf den Thron; wie sehr er sich auch dagegen wehrte, er mußte dem Willen des Vaters gehorchen. Fast drei Monate dauerten die Festlichkeiten, aber die Liebe der beiden Gatten würde noch heute dauern, wenn sie nicht hundert Jahre später gestorben wären.
Moral:
Dies Märchen klingt so wunderbar,
Daß viele glauben, es wär’ nicht wahr.
Doch bleibt Jungfer Eselshaut immer beliebt,
So lang es Großmütter und kleine Kinder gibt.
Dornröschen
Es war einmal ein König und eine Königin, die waren traurig, daß sie keine Kinder hatten, so traurig, wie man es nicht sagen kann. Sie reisten in alle Bäder der Welt, legten Gelübde ab, machten Wallfahrten. Nichts wollte helfen. Aber schließlich wurde die Königin dennoch schwanger und gebar ein Mädchen.
Man feierte eine schöne Taufe und lud zu Patinnen für die kleine Prinzessin alle Feen, die man im Lande finden konnte; es waren deren sieben. Jede sollte ihr ein Geschenk machen, wie es damals Brauch bei den Feen war, damit so die Prinzessin alle nur denkbaren Vorzüge erhielte.
Nach der Tauffeierlichkeit kehrte die ganze Gesellschaft in den Palast des Königs zurück, wo ein großes Fest für die Feen gegeben wurde. Man legte vor jede ein herrliches Gedeck mit einem goldenen Besteck: Löffel, Gabel und Messer von feinstem Gold, verziert mit Diamanten und Rubinen. Aber als man sich zu Tisch setzen wollte, trat plötzlich eine alte Fee ein, die man nicht eingeladen hatte, da sie seit mehr als fünfzig Jahren nicht aus ihrem Turm herausgekommen war; man hatte sie für tot oder für verzaubert gehalten.
Der König befahl, auch ihr ein Gedeck zu reichen; aber es war kein echt goldenes mehr da. Man hatte für die sieben Feen nur sieben machen lassen. Die Alte fühlt sich beleidigt und murmelte leise drohende Worte.
Eine der jungen Feen, welche in ihrer Nähe saß, hörte es, und ahnte, daß sie der kleinen Prinzessin ein unheilvolles Geschenk machen würde. Als man nun von der Tafel aufstand, verbarg sie sich hinter einem Vorhang, damit sie als letzte sprechen könne, um so das Unheil, das jene anrichten würde, nach Kräften wieder gut zu machen.
Indessen begannen die Feen, der Prinzessin ihre Gaben darzubringen. Die jüngste wünschte ihr die größte Schönheit von der Welt, die zweite die Klugheit eines Engels, die dritte eine wundervolle Anmut, die vierte Zierlichkeit im Tanz, die fünfte den Gesang der Nachtigall und die sechste Kunstfertigkeit in der Musik.
Als die Reihe an die alte Fee kam, sagte sie, wobei sie mehr aus Wut als wegen ihrer Altersschwäche mit dem Kopfe wackelte, die Prinzessin werde sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben. Dieser schreckliche Spruch ließ alle erschaudern, und es gab in der ganzen Gesellschaft niemanden, der nicht hätte weinen müssen.
In diesem Augenblick trat die junge Fee hinter dem Vorhange hervor und sprach mit lauter Stimme:
»Beruhigt Euch, König und Königin, Eure Tochter soll nicht sterben; ich habe zwar nicht genug Macht, um alles wieder gut zu machen, was die Alte angerichtet hat: die Prinzessin wird sich mit einer Spindel in die Hand stechen, aber anstatt des Todes wird sie in einen tiefen Schlaf fallen, der hundert Jahre dauert. Dann wird der Königssohn kommen und sie erwecken.«
Um das durch die Alte angekündigte Unheil abzuwenden, erließ der König alsbald ein Gesetz, das bei Todesstrafe verbot, mit Spindeln zu spinnen, ja überhaupt sie zu besitzen. —
Fünfzehn oder sechzehn Jahre später waren der König und die Königin einmal auf eines ihrer Lustschlösser hinaus gefahren. Da geschah es, daß die junge Prinzessin, als sie durch den Palast lief und von Zimmer zu Zimmer sprang, hinauf in ein kleines Turmstübchen kam, in dem eine alte Frau ganz allein saß und ihren Rocken spann. Diese gute Frau hatte von dem Verbote des Königs, mit Spindeln zu spinnen, noch nie etwas gehört.

»Was macht Ihr da, liebe Frau?« sagte die Prinzessin.
»Ich spinne, mein gutes Kind«, antwortete die Alte, die aber die Prinzessin nicht kannte.
»Wie hübsch das ist,« sprach die Prinzessin, »wie macht Ihr das? Gebt es mir, ich möchte sehen, ob ich es auch so gut kann.«
Kaum hatte sie die Spindel ergriffen, da stach sie sich in ihrer lebhaften Unbesonnenheit gerade so, wie es nach dem Spruch der Fee geschehen mußte, in die Hand und fiel ohnmächtig zu Boden.
Die gute Alte hielt sie in ihren Armen und rief um Hilfe: von allen Seiten kam man herbei, man spritzte der Prinzessin Wasser ins Gesicht, schnürte ihr Mieder auf, schlug ihr die Hände, rieb ihr die Schläfen mit ungarischem Königin-Wasser: aber nichts rief sie zum Leben zurück. Der König, der auf den Lärm hin herbeigeeilt war, erinnerte sich alsbald an die Weissagungen der Feen und in dem Gedanken, daß es so kommen mußte, wie die Feen es einmal gesagt hatten, ließ er die Prinzessin in das schönste Gemach des Palastes bringen, in ein Bett, das mit Gold und Silber bestickt war.
Man hätte sie für ein Englein halten können, so schön war sie; die Ohnmacht hatte ihr die Farben des Lebens nicht genommen, ihre Wangen waren wie Rosen so rot und ihre Lippen wie Korallen; nur ihre Augen waren geschlossen, aber man hörte sie leise atmen und daran sah man, daß sie nicht gestorben war. Der König befahl, man solle sie in Ruhe schlafen lassen, bis die Stunde ihrer Erweckung gekommen sei.
Als der Prinzessin dieses Unglück zustieß, war die gute Fee, die ihr das Leben gerettet und sie nur zu einem hundert Jahre langen Schlaf verurteilt hatte, gerade in dem Reiche des Königs Mataquin, zwölftausend Meilen weit weg; aber in einem Augenblicke wurde sie durch einen kleinen Zwerg benachrichtigt, der Siebenmeilenstiefel hatte. Das waren Stiefel, in denen man mit einem einzigen Schritt sieben Meilen zurücklegte. Sofort reiste die Fee ab; und kaum war eine Stunde vergangen, da sah man sie in einem von Drachen gezogenen feurigen Wagen daherkommen.
Der König ging ihr entgegen, um ihr beim Aussteigen die Hand zu reichen. Sie billigte alles, was er angeordnet hatte. Doch in ihrer weisen Voraussicht dachte sie daran, wie sehr sich die Prinzessin ängstigen müsse, wenn sie ganz allein in dem alten Schlosse aufwache, und sie tat dieses:
Mit ihrem Stabe berührte sie außer dem König und der Königin alles, was in dem Schlosse war, die Haushälterinnen, die Ehrendamen, die Kammerfrauen, die Edelleute, die Offiziere, die Haushofmeister, die Köche und Küchenjungen, die Laufburschen, die Wächter und Türsteher, die Pagen und Diener; sie berührte auch alle Pferde, die in den Ställen standen und die Stallknechte, die großen Hofhunde und den kleinen Puff, das Schoßhündchen der Prinzessin, das neben ihr auf dem Bette lag. Und wie sie alle berührte, so schliefen alle ein, um nicht eher aufzuwachen als ihre Herrin, und um jederzeit bereit zu sein, ihr zu dienen, wenn sie ihrer bedürfe. Auch die Bratspieße, die voll Rebhühner und Fasanen am Feuer steckten, schliefen ein, und sogar das Feuer selbst. Alles das geschah in einem Augenblick, denn die Feen brauchen nicht lange zu ihrer Arbeit.
Der König und die Königin küßten noch einmal ihr geliebtes Kind, ohne es dadurch aufzuwecken, verließen dann das Schloß und machten bekannt, daß es verboten sei, sich dem Schlosse zu nähern. Doch dies Verbot war nicht notwendig; denn es wuchsen in einer Viertelstunde um den ganzen Park herum eine solche Menge von großen und kleinen Bäumen, von Brombeerhecken und innig verschlungenem Dornengestrüpp, daß weder Tier noch Mensch hindurch gekonnt hätte; nicht einmal mehr sehen konnte man das Schloß außer den Spitzen der Türme, selbst nicht aus weiter Ferne. Es bestand kein Zweifel, daß auch dies eine Tat der Fee war, damit die Prinzessin während ihres Schlafes nichts von Neugierigen zu befürchten habe. —

Als die hundert Jahre um waren, kam der Sohn des Königs, der damals regierte, und der einer andern Familie als die schlafende Prinzessin entstammte, auf der Jagd in diese Gegend und fragte, was für Türme es seien, die er über dem dichten Walde erblicke. Jeder antwortete ihm so, wie er gehört hatte: die einen sagten, es sei ein altes Schloß, in dem die Geister spukten, die andern, daß alle Zauberer der Gegend dorthin zum Sabbath kämen. Die Meinung der meisten aber war, es wohne dort ein Menschenfresser und alle Kinder brächte er dorthin, die er erwischen könne, um sie in Ruhe und sicher vor Verfolgern zu verzehren, da nur er allein die Macht habe, sich einen Durchgang durch den Wald zu bahnen.
Der Prinz wußte nicht, wem er Glauben schenken sollte, als ein alter Bauer das Wort ergriff und sprach:
»Mein Prinz, es ist mehr als fünfzig Jahre her, daß ich meinen Vater erzählen hörte, es gäbe in dem Schlosse eine Prinzessin, schöner, als man jemals eine sah. Hundert Jahre müsse sie schlafen, dann würde sie erweckt von einem Prinzen, für den sie bestimmt sei.«

Feuer und Flamme war der junge Prinz bei diesen Worten. Ohne zu schwanken glaubte er, diesem schönen Abenteuer ein Ende bereiten zu müssen, und von Liebe und Ehrgeiz getrieben, beschloß er, auf der Stelle zu sehen, was daran Wahres sei. Kaum näherte er sich dem Walde, da gingen alle die großen Bäume, die Brombeersträucher und Dornenhecken von selbst auseinander und ließen ihn hindurch. Er näherte sich dem Schloß, das er am Ende einer großen Allee erblickte, und ging hinein. Er war ein wenig erstaunt, als er sah, daß niemand von seinen Leuten ihm hatte folgen können, da der Wald sich wieder geschlossen hatte, nachdem er hindurchgegangen. Aber er ließ sich nicht abhalten weiterzugehen, denn ein junger Prinz, der liebt, ist immer tapfer. Er trat in einen großen Vorhof, wo alles, was er zunächst erblickte, dazu angetan war, ihn zu erschrecken. Es war eine furchterregende Stille; ein Bild des Todes bot sich ihm. Ausgestreckt lagen die Leiber von Menschen und Tieren, die gestorben schienen. Doch erkannte er sehr bald an der sinnigen Nase und dem roten Gesicht der Türsteher, daß sie nur schliefen, und ihre Becher, in denen sie noch ein paar Tropfen Wein hatten, zeigten ihm deutlich genug, daß sie beim Trinken eingeschlafen waren. Er ging weiter durch einen großen, marmorgepflasterten Hof, stieg eine Treppe hinauf und trat in eine Wachtstube, wo die Soldaten mit Karabiner auf Schulter in Reih und Glied standen und um die Wette schnarchten. Er durcheilte mehrere Zimmer voller Edelleute und Damen, die alle schliefen, teils stehend, teils sitzend. Dann trat er in ein goldenes Gemach und sah auf einem Bette, dessen Vorhänge nach allen Seiten geöffnet waren, das schönste Bild, das er jemals gesehen: eine Prinzessin von etwa fünfzehn oder sechzehn Jahren, deren herrliche Schönheit in göttlichem Glanze strahlte.
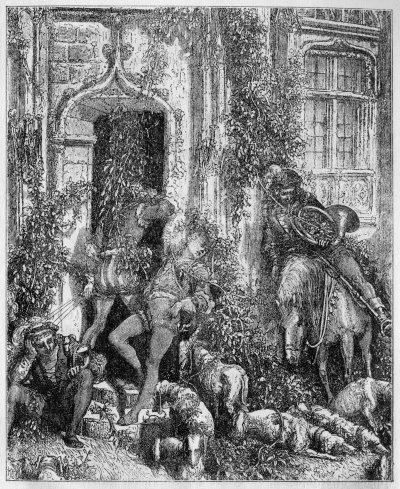
Zitternd und voller Bewunderung näherte er sich ihr und fiel vor ihr aufs Knie. In diesem Augenblick erwachte die Prinzessin: das Ende des Zauberschlafes war gekommen. Sie sah ihn mit zärtlicheren Augen an, als ein erster Blick es zu erlauben schien, und sprach:
»Seid Ihr es, mein Prinz? Ihr ließet lange auf Euch warten.«

Der Prinz war entzückt von diesen Worten und mehr noch von der Art, wie sie gesprochen wurden. Er wußte nicht, wie er ihr seine Freude und Dankbarkeit beweisen könne und versicherte, daß er sie mehr liebe als sich selber. Seine Rede war schlecht gesetzt und gefiel deshalb um so mehr; denn je geringer die Beredsamkeit, um so größer die Liebe. Er war verlegener als sie, denn sie hatte ja lange Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was sie ihm sagen würde. Man braucht sich darüber nicht zu wundern, denn obwohl die Geschichte davon nichts erzählt, scheint es so, als ob die gute Fee dafür gesorgt habe, daß sie sich während des langen Schlafes an schönen Gedanken erfreuen könne. Vier Stunden lang unterhielten sich die beiden miteinander und sie hatten sich noch nicht die Hälfte von dem gesagt, was sie auf dem Herzen hatten.
Indessen war mit der Prinzessin der ganze Palast aufgewacht. Ein jeder versah wieder seinen Dienst; aber da nicht alle so verliebt waren, hatten sie schrecklichen Hunger. Eine der Ehrendamen, die wie die andern hungerte, wurde schließlich ungeduldig und rief laut der Prinzessin zu, das Essen sei angerichtet. Der Prinz half der Prinzessin, als sie sich erhob. Sie war mit einem herrlichen Gewande angetan; aber er hütete sich wohl, ihr zu sagen, daß sie gekleidet sei wie eine Großmutter und einen altmodischen Kragen umhabe: aber trotzdem war sie nicht weniger schön.
Sie gingen in einen Spiegelsaal und speisten dort, von den Offizieren der Prinzessin bedient. Die Geigen und Hoboen spielten alte Melodien, die wunderschön klangen, obwohl man sie seit hundert Jahren nicht mehr gespielt hatte. Nach der Tafel traute sie, ohne Zeit zu verlieren, der Hofkaplan in der Schloßkapelle, und die Ehrendame zog ihnen den Vorhang zu.
Sie schliefen nicht lange, denn die Prinzessin war nicht sehr müde, und der Prinz verließ sie gegen Morgen, um in die Stadt zurückzukehren, wo sein Vater in Sorge um ihn sein mußte. Der Prinz erzählte ihm, er habe sich auf der Jagd im Walde verirrt, in der Hütte eines Köhlers übernachtet und von ihm Schwarzbrot und Käse zum Essen bekommen. Der König, sein Vater, war ein guter Mann und glaubte es. Aber seine Mutter ließ sich nicht so leicht überzeugen. Als sie sah, daß er fast täglich auf die Jagd ging und daß er nie um eine Entschuldigung verlegen war, wenn er zwei oder drei Nächte draußen geschlafen hatte, zweifelte sie nicht mehr, daß er irgendeine Liebschaft habe. Mehr als zwei Jahre lebte der Prinz so mit der Prinzessin; und sie bekamen zwei Kinder. Das älteste, ein Mädchen, nannten sie Morgenrot und das zweite, einen Knaben, Tageshell, weil er fast noch schöner war als seine Schwester.
Um hinter sein Geheimnis zu kommen, sagte die Königin öfters zu ihrem Sohne, er solle doch mit seinem Leben zufrieden sein.
Doch er wagte nicht, sich ihr anzuvertrauen, denn er fürchtete sich vor ihr, obgleich er sie liebte. Sie entstammte nämlich dem Geschlechte der Menschenfresser, und der König hatte sie nur geheiratet, weil sie so reich war.
Man sprach sogar am Hofe ganz leise davon, daß sie immer noch eine Neigung zum Menschenfressen habe, und daß sie sich mit aller Gewalt zurückhalten müsse, wenn sie kleine Kinder sähe, damit sie sich nicht auf sie stürze. Deshalb wollte der Prinz ihr nichts sagen.
Nach zwei Jahren starb der König, und der Prinz folgte ihm nach. Jetzt machte er seine Heirat bekannt und ließ unter großen Festlichkeiten seine Frau als Königin auf sein Schloß holen. Ein herrlicher Empfang wurde ihr in der Hauptstadt bereitet, als sie mit den beiden Kindern einzog.
Es trug sich zu, daß der König gegen den Kaiser Cantalabutte, seinen Nachbarn, in den Krieg ziehen mußte. Er übergab die Regierung der Königin Mutter, und ließ Frau und Kinder in ihrer Obhut zurück.
Den ganzen Sommer mußte er im Felde bleiben. Als er aber abgereist war, schickte die Königin ihre Schwiegertochter und die Kinder in ein Landhaus im Walde, um ungestörter ihrer fürchterlichen Lust zu fröhnen. Einige Tage darauf begab sie sich selbst dorthin und sagte eines Abends zu ihrem Haushofmeister:
»Morgen will ich zum Mittagessen die kleine Morgenrot verspeisen!«
»Um Gottes Willen, Königliche Hoheit«, rief der Haushofmeister.
»Ich will es«, sagte die Königin; und sie sagte es, wie ein Menschenfresser, der Lust hat, frisches Fleisch zu essen. »Ich will sie sogar mit Roberttunke essen!«
Als der arme Mann sah, daß man mit einer Menschenfresserin nicht gut spaßen könne, nahm er sein großes Messer in die Hand und ging hinauf in das Zimmer der kleinen Morgenrot. Diese war gerade vier Jahre alt, und sie warf sich tanzend und lachend ihm an den Hals und bat ihn um Süßigkeiten. Da fing er an zu weinen, und das Messer fiel ihm aus der Hand. Er ging hinunter in den Stall, schlachtete ein Lämmchen und bereitete es mit einer so guten Tunke zu, daß seine Herrin ihm versicherte, sie habe noch nie etwas so Gutes gegessen.
Gleichzeitig hatte er die kleine Morgenrot fortgetragen und seiner Frau übergeben, damit sie dieselbe in seinem Hause verberge, das hinter dem Stalle lag.
Acht Tage später sagte die Königin zu ihrem Haushofmeister:
»Ich will den kleinen Tageshell zum Abendbrot essen!«
Er erwiderte nichts und war fest entschlossen, sie ebenso wie das erstemal zu täuschen.
Er suchte den kleinen Tageshell und fand ihn mit einem Florett in der Hand, womit er gegen einen dicken Affen Krieg führte; dabei war er erst drei Jahre alt.
Auch ihn brachte er zu seiner Frau, damit sie ihn mit der kleinen Morgenrot verberge, und an seiner Stelle bereitete er ein zartes Zicklein, welches die Menschenfresserin äußerst wohlschmeckend fand.
Bis dahin war alles gut gegangen. Aber eines Abends sagte die böse Königin zum Haushofmeister:
»Ich will die Königin in derselben Tunke wie ihre Kinder essen!«
Da verzweifelte der arme Haushofmeister, weil er nicht glaubte, sie noch einmal täuschen zu können. Denn die junge Königin war über zwanzig Jahre alt, ganz abgesehen von den hundert Jahren, die sie geschlafen hatte. Ihre Haut war ein wenig spröde, obwohl sie schön und weiß war. Aber wie sollte man unter den Tieren eines finden, das eine ebenso spröde Haut hatte?
Deshalb faßte er, um sein eigenes Leben zu retten, den Entschluß, der Königin den Hals abzuschneiden. Er stieg hinauf in ihr Zimmer, und war fest entschlossen, es diesmal anders zu machen. Er brachte sich in Wut und trat mit dem Dolch in der Hand in das Zimmer der jungen Königin. Trotzdem wollte er sie nicht überfallen und er erzählte ihr mit allem Respekt von dem Auftrag, den er von der Königin Mutter erhalten hatte.
»Tut, was Euch befohlen!« sagte die Königin zu ihm und hielt ihren Kopf hin. »Ich werde meine Kinder wiedersehen, meine armen Kinder, die ich so geliebt habe!«
Sie hielt ihre Kinder nämlich für tot, seitdem man sie entführt hatte, ohne ihr etwas zu sagen.
»Nein, gnädige Frau,« antwortete der Haushofmeister ganz gerührt. »Ihr sollt nicht sterben. Ihr werdet dennoch Eure Kinder wiedersehen! In meinem Hause werdet Ihr sie sehen, wo ich sie verborgen habe. Ich will nochmals die Königin täuschen und ihr an Eurer Stelle einen jungen Hirsch zu essen geben.«
Dann führte er sie in seine Wohnung und ließ sie küssend und weinend bei ihren Kindern. Er selbst bereitete eine Hindin zu, und die Königin verzehrte sie mit demselben Appetit zum Abendessen, als wenn es die junge Königin gewesen wäre.
Sie war sehr befriedigt von ihren Grausamkeiten und nahm sich vor, dem König bei seiner Rückkehr zu sagen, daß wütende Wölfe seine Frau, die Königin, und seine beiden Kinder gefressen hätten. —
Eines Abends, als sie wie gewöhnlich in den Höfen des Schlosses herumstreifte, um dort nach frischem Fleisch auszuschauen, hörte sie in einem Kellerzimmer den kleinen Tageshell, der weinte, weil ihn seine Mutter wegen einer Ungehorsamkeit schlagen wollte; und sie hörte auch die kleine Morgenrot, wie sie für ihren Bruder um Verzeihung bat.
Die Menschenfresserin erkannte die Stimme der Königin und ihrer Kinder und geriet in Zorn, weil man sie getäuscht hatte.
Am nächsten Tage in der Frühe befahl sie mit schrecklicher Stimme, die alle erzittern machte, man solle in die Mitte des Hofes einen großen Bottich bringen. Diesen Bottich ließ sie mit Vipern, Kröten, Nattern und Schlangen füllen, um die Königin und ihre Kinder, den Haushofmeister, seine Frau und seine Dienerin hineinzuwerfen. Sie gab den Befehl, sie herbeizuführen, die Hände auf den Rücken gebunden.
So standen sie da, und der Henker machte sich daran, sie in den Bottich zu werfen. In diesem Augenblick kam der König, den man nicht so schnell erwartet hatte, in den Hof geritten; denn er war auf schnellstem Wege zurückgekehrt. Ganz erstaunt fragte er, was denn das schreckliche Schauspiel zu bedeuten habe.
Niemand wagte, es ihm zu sagen. Die Menschenfresserin aber stürzte sich in ihrer Wut über das, was sie sah, kopfüber in den Bottich und war in einem Augenblick von den schrecklichen Tieren, die sie selbst hineingesetzt hatte, verschlungen. Der König war traurig darüber, denn es war seine Mutter. Aber er tröstete sich bald mit seiner schönen Frau und seinen Kindern.
Moral:
Manch Mädchen wartet lange auf den Mann,
Bis sich der findet, den sie lieben kann;
Denn der muß reich sein, schön und sehr galant,
Dem sie zum Ehebunde reicht die Hand.
Doch zeige mir das Weib, das hundert Jahr
In Ruhe wartet auf den Traualtar,
Das auch noch sorglos schläft die ganze Zeit:
Du suchst nach ihr vergeblich weit und breit.
Es wird aus diesem Märchen klar,
Daß, wer da wartet viele Jahr,
Und wer trotz Wartens schlummern kann,
Am Ende kriegt den besten Mann.
Gern gäb ich Euch den guten Rat:
Wartet so lang, wie es Dornröschen tat!
Doch wage ich nicht, diesen Rat zu geben,
Ihr lieben Fräuleins: ich kenne Euch eben.
Charles Perrault
1628 geboren, wird er zuerst Advokat; später kommt er an den Hof und wird der treueste Gehilfe Colberts. 1683 zieht er sich in das Privatleben zurück und widmet sich ganz seinen literarischen Werken. Den Zeitgenossen gilt Perrault in erster Linie als der Verfasser der »Parallèles des Anciens et Modernes«, die Nachwelt kennt ihn nur als den Dichter des ersten abendländischen Märchenbuches. Seine Sammlung »Les Contes de ma Mère l’Oie« kam 1697 in Buchform heraus; sie war der Auftakt zu einer unübersehbaren Märchenliteratur.
Gustave Doré
Er wurde 1832 zu Straßburg geboren. Sein Vater bestimmte ihn zum Ingenieur-Beruf, aber seine reiche Phantasie, seine erstaunliche Begabung drängte ihn zur Malerei. Mit zehn Jahren begann er Dante zu illustrieren. Mit elf Jahren schloß er seinen ersten Vertrag ab, der ihn verpflichtete, wöchentlich eine Lithographie für das »Journal pour rire« zu liefern. Bald gab er die Vorbereitung zum Ingenieur-Beruf auf und widmete sich ganz der Kunst. 1854 erschienen seine ersten großen Werke, »Rabelais« und die »Contes drôlatiques« von Balzac, die seinen Ruhm weit über Frankreich hinaus verbreiteten. 1862 illustrierte er die »Contes de Perrault«. Er findet in den phantastischen Kostümen und ritterlichen Lebensformen der Zeit Franz I. und Ludwig XIII. den geeigneten Ausdruck für die übersprudelnde Fülle seiner köstlichen Einfälle. Doré starb im Jahre 1883; er wurde nur 51 Jahre alt.


